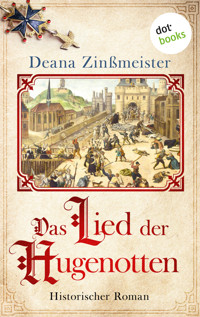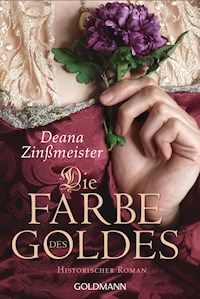6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Reise könnte sie ihr Leben kosten: Der packende historische Roman »Der Hexenschwur« von Deana Zinßmeister jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Sturm bricht los: Im Jahre 1635 erfasst der Dreißigjährige Krieg das Land an der Saar. Hier leben der Thüringer Johann und seine Familie, seit seine Frau Franziska in der Heimat einst der Hexerei bezichtigt wurde und fliehen musste. In dieser Zeit der Not wünscht sich Johann nichts sehnlicher als aufs Eichsfeld zurückzukehren und wieder mit Mutter und Schwester vereint zu sein. Er schlägt alle Warnungen seiner Freunde in den Wind und tritt mit Frau und Kindern die gefährliche Reise quer durchs Reich an. Als sie von einem deutschen Söldnertrupp überfallen werden, passiert das Undenkbare: Arne und Erik, zwei Schweden, retten sie vor dem sicheren Tod und gewähren ihnen Schutz in ihrem Tross. Aber die Erleichterung ist von kurzer Dauer, denn schon bald beobachtet Johann, wie zwischen seiner Tochter Magdalena und dem jungen Arzt Arne eine Liebe erwächst, die nicht sein darf ... »Deana Zinßmeister schreibt historische Romane, wie man sie sich wünscht!« Iny Lorentz Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der opulente historische Roman »Der Hexenschwur« von Bestsellerautorin Deana Zinßmeister ist der dritte Band ihrer Hexentrilogie, die Fans von Doris Röckle und Astrid Fritzsch begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Sturm bricht los: Im Jahre 1635 erfasst der Dreißigjährige Krieg das Land an der Saar. Hier leben der Thüringer Johann und seine Familie, seit seine Frau Franziska in der Heimat einst der Hexerei bezichtigt wurde und fliehen musste. In dieser Zeit der Not wünscht sich Johann nichts sehnlicher als aufs Eichsfeld zurückzukehren und wieder mit Mutter und Schwester vereint zu sein. Er schlägt alle Warnungen seiner Freunde in den Wind und tritt mit Frau und Kindern die gefährliche Reise quer durchs Reich an. Als sie von einem deutschen Söldnertrupp überfallen werden, passiert das Undenkbare: Arne und Erik, zwei Schweden, retten sie vor dem sicheren Tod und gewähren ihnen Schutz in ihrem Tross. Aber die Erleichterung ist von kurzer Dauer, denn schon bald beobachtet Johann, wie zwischen seiner Tochter Magdalena und dem jungen Arzt Arne eine Liebe erwächst, die nicht sein darf ...
»Deana Zinßmeister schreibt historische Romane, wie man sie sich wünscht!« Iny Lorentz
Über die Autorin:
Deana Zinßmeister widmet sich seit einigen Jahren ganz dem Schreiben historischer Romane. Bei ihren Recherchen wird sie von führenden Fachleuten unterstützt, und für ihren Bestseller »Das Hexenmal« ist sie sogar den Fluchtweg ihrer Protagonisten selbst abgewandert. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im Saarland.
Die Website der Autorin: www.deana-zinssmeister.de
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin »Der Duft der Erinnerung«, »Fliegen wie ein Vogel«, die Pesttrilogie mit den Romanen »Das Pestzeichen«, »Der Pestreiter« und »Das Pestdorf« sowie die Hexentrilogie mit den Romanen »Das Hexenmal«, »Der Hexenturm« und »Der Hexenschwur«.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2024
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Deana Zinßmeister und Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung einer Abbildung der Burg Hanstein, Deutschland, Photochrom LC-DIG-ppmsca-00440 aus der photochrom print collection der Library of Congress sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98952-323-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Hexenschwur« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Deana Zinßmeister
Der Hexenschwur
Historischer Roman
dotbooks.
Für meine Verwandten auf dem Eichsfeld
Nachtschatten pfleget sanft den schlaf zu flößen ein,
Und Zeiget träume drauf, daher ich mir erwehlet
Den Nahmen mit dem Kraut: Jeh wil befließen sein
Als ich vorhin auch war, als ich die träum’ erzehlet
Zu träumen mehr und mehr, bey nacht und tagesschein
Und Zwar mit ofnem äug’: Es soi sein unverhehlet
Was vor geschickligkeit wird träumen meinem fleiß’
Auf das der Träumend’ ich viel Hohe Sachen heiß.
Johann Michael Moscherosch, 1601-1669
Personenregister
Die mit einem * versehenen haben tatsächlich gelebt.
Wellingen
Eheleute Johann und Franziska Bonner
Magdalena, ihre Tochter
Benjamin, ihr Sohn
Clemens, Johanns Freund
Christel, Ehefrau von Clemens
Georg, Sohn von Clemens und Christel
Sebastian, Sohn von Clemens und Christel
Regina Rehmringer, Besitzerin des Gestüts in Wellingen
Johann Michael Moscherosch* (1601-1669), Amtmann von Wellingen
Hundeshagen
Karoline Schildknecht, Johann Bonners Schwester
Jodokus Schildknecht, Karolines Ehemann
Josefine, Grete, Helene, Tine, Bauersfrauen
Unterwegs
Joost van den Vondel* (1587-1679), niederländischer Dichter und Dramatiker
Schweden-Heer
Arne, Soldat und Arzt
Erik Gustavsson, Soldat
Brigitta, Marketenderin
Ingeborg, Marketenderin
Jan Banér* (1596-1641), schwedischer Feldmarschall im Dreißigjährigen Krieg
Allendorf
Christoph Kirchmeier*, Bürgermeister von Allendorf sowie der Saline in Sooden
Augustin Jehner*, Pfannenbesitzer in Sooden
Josephi*, Superintendent und Magister
Hans und Gabriel Kell*, Pfannenbesitzer in Sooden
Prolog
1628, während des Dreißigjährigen Kriegs im Reich
Die Gestalt lief zu dem Baum, der am Ortsrand stand, und presste sich dicht gegen den Stamm. Sie trug einen schwarzen Umhang, der ihre Konturen vor der dunklen Farbe der Baumrinde verwischte, sodass sie unsichtbar wurden. Mit wachem Blick schaute die Frau zum Dorf hinüber und zählte die Katen, deren Umrisse sich schwach im Licht des Mondes zeigten. »Rechts, links, rechts, rechts, links ...«, flüsterte sie mehrmals, da die Hütten nicht in einer Reihe standen. Sie schloss die Augen, um die Worte in Gedanken zu wiederholen. Als ihr die Aufzählung fehlerfrei gelang, blickte sie zum Himmel empor. Sie sah, dass eine Wolke den Halbmond bald ganz verdecken und dass dann vollkommene Dunkelheit herrschen würde. Zufrieden stülpte die Frau sich die Kapuze ihres Umhangs über den Kopf und holte tief Luft. Mit jedem Atemzug schien ihr Herz heftiger zu schlagen. Soll ich es wirklich wagen?, befragte sie sich leise, während sie sich den Schweiß von der Stirn wischte. Was ist, wenn auch sie versagt?
»Unfug«, schimpfte die Frau leise mit sich selbst und rief sich in Erinnerung, dass die Alte dafür bekannt war, Unmögliches möglich zu machen. Sofort regten sich weitere Zweifel: Nicht jeder wusste Gutes über sie zu berichten. Aber es gab kein Zurück, entschied die Frau und straffte die Schultern. Als sich die Finsternis vollends ausgebreitet hatte, stieß sie sich entschlossen von der Baumrinde ab und schlich in gebückter Haltung über den Weg zur ersten Kate, die rechts des Weges stand. Danach zur linken, rechten, rechten, linken. Sie war in Gedanken bemüht, sich an die Richtung zu erinnern, sodass sie den Hofhund erst bemerkte, als er sie anknurrte. Erschrocken sprang sie zur Seite, wobei ihre Hand zum Messer griff, das in ihrem Gürtel steckte. Als sie erkannte, dass der Hund an einer Kette lag, atmete sie erleichtert aus. Vorsichtig blickte sie sich um, um festzustellen, ob das Knurren des Hundes jemanden geweckt hatte. Alles blieb ruhig, und so rannte die Frau beherzt zur nächsten Hauswand. Nun trennten sie nur noch wenige Schritte von ihrem Ziel. Ein letztes Mal beugte sie sich nach vorn, um klein und unscheinbar zu wirken und nicht erkannt zu werden. Dann lief sie los.
Vor Angst und Anstrengung keuchend blieb sie vor der Bretterwand der Hütte stehen. Als die Wolke weiterwanderte und das Mondlicht das Dorf wieder beschien, lehnte sie sich gegen die Kate, sodass ihre Gestalt vom Schatten verschluckt wurde. Bebend drehte sie sich zur Tür und klopfte dagegen. Gleichzeitig presste sie ihr Ohr an das Holz. In der Hütte blieb alles ruhig, ebenso im Dorf, das in tiefer Stille lag. Wieder schlug die Frau gegen die Brettertür. Nichts! Sie wollte bereits aufgeben, als der Riegel von innen zur Seite geschoben und die Tür geöffnet wurde. Ein grauer Schopf erschien im Rahmen, und aus einem von Falten zerfurchten Gesicht blinzelten verschlafene Augen.
»Was willst du mitten in der Nacht?«, krächzte die Alte und stützte sich am Holz ab.
»Deine Hilfe!«, flüsterte die Frau und zog die Kapuze vom Kopf, sodass ihr langes Haar ihr über die Schultern fiel.
»Ich kenne dich«, sagte die Alte und kniff leicht die Augen zusammen. »Du bist von dem Hof in ...«
»Schweig!«, raunte die Frau und blickte sich beunruhigt nach allen Seiten um. »Lass mich herein, bevor mich jemand sieht.«
Der Blick der Alten wanderte über den Umhang der Frau. »Ich ahne, warum du hierherkommst. Das hat Zeit bis morgen.
Ich brauche meinen Schlaf. Komm wieder, wenn es hell wird«, forderte sie ungehalten und wollte die Tür schließen.
Die Frau schob rasch den Fuß in den Türrahmen. »Verschwinde, oder ich schreie«, fauchte die Alte.
»Wenn ich wollte, dass man mich bei dir sieht, dann wäre ich nicht zu dieser Unzeit erschienen«, schimpfte die unwillkommene Besucherin leise und griff in ihre Rockschürze. Langsam zog sie ein kleines Säckchen hervor, in dem Münzen klimperten. »Das ist für dein Schweigen, für deine Hilfe und für die entgangene Nachtruhe«, sagte sie und ließ das Beutelchen in die ausgestreckte Hand der Alten fallen.
Die wog den Geldbeutel in der Hand und nickte. Daraufhin drängte die Frau die Grauhaarige mit einem leisen Lachen zur Seite und betrat die Hütte.
Zwei Jahre später
Ein Raunen ging durch die Menge, als die Glocke ertönte. Geschwind bildeten die Menschen eine Gasse, durch die der Henker schritt. An einem Strick, der der Verurteilten um Hals und Hände gebunden war, zog der Henkersknecht eine Frau durch den Gang aus Gaffern. Einige der Schaulustigen spien ihr vor die Füße, während andere sie beschimpften oder den Blick angewidert von ihr abwendeten. Das faulige Gemüse, das nach der Verurteilten geworfen wurde, traf sie an Kopf und Rücken. Wehrlos blieb sie stehen und fixierte mit ihren kleinen Augen den Werfer, der das nächste Wurfgeschoss bereits in die Höhe hielt.
»Ich habe dir auf diese Welt geholfen, dich als Erste in den Armen gehalten und umsorgt, und jetzt willst du mir Schmerz zufügen?«, zischte die Frau ihn an. »Haben deine Eltern dir keinen Anstand beigebracht, Michel Betzler?«
Das Gesicht des Jungen rötete sich, und er ließ die Hand mit dem Kohlkopf sinken.
Die Frau strauchelte, als der Henker mit heftigem Ruck am Strick zog. Als sie nach vorn stolperte, hob der Bursche seinen Arm und warf ihr das Gemüse mit voller Wucht an den Hinterkopf, sodass sie aufjaulte. Die Meute lachte, und der Henkersgehilfe stieß die Verurteilte ungerührt in Richtung Richtplatz.
»Wie ein Stück Vieh, das zur Schlachtbank gebracht wird«, flüsterte ein Weib, das am Straßenrand das Schauspiel mit entsetztem Blick verfolgte.
»Sie ist eine Hexe, und Hexen müssen verbrannt werden, damit sie kein weiteres Unheil heraufbeschwören können«, belehrte ihr Mann sie mit verständnislosem Gesichtsausdruck.
»Ohne sie wäre ich bei der Geburt der Zwillinge gestorben«, flüsterte sein Eheweib mit tränenerstickter Stimme. »Sie kann nicht böse sein.«
»Was weißt du schon? Behalt dein unkundiges Geplapper für dich, Frau«, zischte der Mann. »Schon seit Langem munkelt man, dass sie in Buhlschaft mit dem Teufel stehe. Jetzt wurde sie überführt! Während der peinlichen Befragung hat sie gestanden.«
Die Blicke der Verurteilten und der Ehefrau trafen sich.
»Habt Erbarmen mit mir«, jammerte die Hebamme und hielt ihre von der Folter angeschwollenen Hände in die Höhe.
Als die Angesprochene sich wegdrehte, schloss die Verurteilte kurz die Augen, um dann anderen Schaulustigen zuzurufen: »Ihr kennt mich seit vielen Jahren! Nie habe ich einem von euch geschadet. Ich habe euren Kindern in die Welt geholfen. Warum wollt ihr mich bestrafen?« Tränen traten ihr in die Augen, als sie eine Frau erblickte, die sich in der Menschenmenge zu verbergen versuchte. Alle Farbe wich aus dem Gesicht der Greisin, und Wut verzerrte ihre Gesichtszüge. »Warum willst du mich brennen sehen?«, schrie sie und trat auf die Frau zu, soweit der Strick um ihren Hals es zuließ. Doch bevor sie eine Antwort bekommen konnte, zog der Henker sie weiter zum Scheiterhaufen, wo sie unter dem Beifall der Zuschauer an den Pfahl gebunden wurde. Als der Henker Reisig um die Füße der Verurteilten häufte, trampelte sie es keuchend fort. »Ich bin unschuldig!«, schrie sie. Ihr Blick fiel suchend auf die Menschenmenge, bis er bei der Frau hängen blieb, die mitleidlos die Verurteilte anstarrte.
»Warum?«, rief die Hebamme ihr zu, sodass die Meute sich neugierig umdrehte.
Ohne den Blick von der Verdammten zu lösen, zog die Frau zwischen ihren Brüsten einen Schlüssel an einem blauen Band hervor. Sie hielt ihn wie eine Trophäe in die Höhe, damit ihn die Alte sehen konnte. Mit verzerrter Stimme beantwortete sie die Frage der Hebamme: »Deshalb!« Dann steckte sie den Schlüssel zurück in ihr Gewand und drehte sich auf dem Absatz um.
In diesem Augenblick traf sie der gellende Schwur der verdammten Frau: »Dein Leben soll fortan von Angst, Krankheit und Seuchen gezeichnet sein. Ungeziefer soll über dich und die Deinen kommen. Du wirst Hunger und Not leiden. Das schwöre ich im Angesicht meines Todes!«
Ein Raunen ging durch die Menge, das stetig lauter wurde. Die Frau spürte finstere Blicke in ihrem Rücken, und sie vernahm, wie sich die Menschen um sie herum zuriefen: »Die alte Hebamme hat den Hexenschwur über sie gebracht. Haltet euch von ihr fern!«
Erschrocken blickte die Frau in die vertrauten Gesichter ihrer Freunde und ihrer Nachbarn. Das Mitgefühl, das ihr zuvor entgegengebracht worden war, hatte sich in pure Angst verwandelt. Sie sah Unverständnis und sogar Hass in den Blicken der anderen.
»Du wirst doch wohl nicht an einen Hexenschwur glauben?«, fragte eine Nachbarin.
»Gott wird mich schützen«, erwiderte die Frau. Mit diesen Worten straffte sie die Schultern und verließ den Richtplatz.
Kapitel 1
Oktober 1634, Wellingen im Land an der Saar
Johann trat aus der Hintertür des Wohngebäudes und schnaufte heftig ein und aus, um die Lunge mit frischer Luft zu füllen. Mit sorgenvoller Miene kratzte er sich über sein kantiges Gesicht und ging auf das Fuhrwerk zu, das inmitten des Hofs abgestellt war, um sich anzulehnen. Plötzlich spürte er einen stechenden Schmerz hinter der Stirn. Er rieb sich mit der linken Hand mehrmals die Schläfen. Johann versuchte sich zu entspannen, doch er konnte das totenbleiche Gesicht der sterbenden Frau, die nur noch ein Schatten ihrer selbst war, nicht aus seinem Kopf vertreiben. Auch an diesem Morgen hatte er bestürzt zusehen müssen, wie sich Regina Rehmringers Zustand weiter verschlechterte. Johann ahnte, dass das Leben der Frau zu Ende ging, die vor vielen Jahren ihn, sein Weib Franziska und seine damaligen Weggefährten selbstlos bei sich aufgenommen hatte. Dank ihrer Hilfe hatten sie in der Fremde ein neues Zuhause gefunden.
Der Kopfschmerz ließ nach, und Johann verschränkte mit einem tiefen Seufzer die Arme vor der Brust. Gedankenverloren starrte er auf die Hühner, die im Misthaufen scharrten.
»Unglaublich«, flüsterte er. »Siebzehn Jahre ist es her, seit wir unsere Heimat, das Eichsfeld, verlassen und hier ein neues Leben begonnen haben.«
***
Es war im Jahr des Herrn 1617 gewesen, als das Schicksal einige Menschen zusammenbrachte, die alle auf der Flucht waren. Einer von ihnen war Johann, der mit seiner geliebten Franziska dem tyrannischen Vater entfliehen musste, weil der ihre Heirat verhindern wollte. Der Großbauer verfolgte die beiden quer durchs Reich und fand sie im Land an der Saar. Getrieben von Hass versuchte er Franziska und ihre kleine Tochter zu töten. Beide wurden gerettet, den Großbauern traf der Schlag.
Auch Clemens war zu dieser Zeit auf der Flucht gewesen. Er wurde vom Ehemann seiner Schwester verfolgt, der vor einem Mordanschlag nicht zurückschreckte. Als man in der abgebrannten Scheune eine verkohlte Leiche fand, glaubte man, dass Clemens der Tote war; doch ihn hatte ein Mönch gerettet und versteckt. Um seine Schwester zu schützen, ließ Clemens sie in dem Glauben, er sei tot. Auf seiner Flucht begegnete Clemens Johann und Franziska und schloss sich ihnen an. Er war ein mürrischer Wegbegleiter, denn das Feuer hatte sein Gesicht mit hässlichen Brandnarben entstellt, sodass er glaubte, auf andere abschreckend zu wirken. Doch dann begegnete er in Wellingen Christel, der Tochter des damaligen Amtmanns ...
***
»Nun sind sie scheinbar schon eine Ewigkeit verheiratet«, murmelte Johann, als er vor dem Haus Stimmen hörte. Eine Frau, die in eine schwarze Nonnentracht gekleidet war, kam um die Häuserecke. »Hier steckst du«, sagte sie und umarmte ihn.
»Sei gegrüßt, Maria«, flüsterte Johann und drückte sein Gesicht an ihre Haube. »Schön, dass du sofort gekommen bist.«
»Das bin ich ihr schuldig«, erwiderte die Frau und blickte Johann aus schwarzen Augen traurig an.
Johann zog leise die Tür des Schlafzimmers zu. Während Maria seine Tochter Magdalena umarmte, die stumm am Bett der Sterbenden saß, blieb er abseits stehen. Müde fuhr er sich über die buschigen Augenbrauen. Er wollte sich den Anblick der kranken Frau ersparen, von dem er wusste, dass er ihn nicht ändern konnte.
Maria trat näher an das Bett heran. Bestürzt blickte sie in das bleiche Gesicht von Regina Rehmringer, die abgemagert daniederlag und ihre Umgebung kaum noch wahrnahm. Maria kämpfte mit den Tränen. Zwar ahnte sie seit ihrem letzten Besuch zwei Wochen zuvor, dass die Frau schon bald vor ihren Schöpfer treten würde, doch sie so daniederliegen zu sehen versetzte ihrem Herzen einen Stich.
Maria atmete tief ein und rümpfte dabei leicht die Nase. Sie glaubte bereits den Geruch des Todes wahrzunehmen. Allein der Gedanke daran erschwerte ihr das Durchatmen. Maria schaute Magdalena bewundernd an, die seit Tagen bei der alten Frau wachte und sie kaum allein ließ. Die Sechzehnjährige schien gegen den Geruch, die Düsternis und das Elend unempfindlich zu sein. Sie saß da und beobachtete mit einem zärtlichen Lächeln den Schlaf der Frau.
Frische Luft, dachte die Nonne und blickte zu dem Fenster, das mit dicht gewobenem Stoff zugehängt war und das Tageslicht wegsperrte. War der Vorhang schon immer so verschlissen?, überlegte Maria kurz. Der schwache Schein der Talglampen spendete kaum Helligkeit, sodass die Misslichkeit, in der sich das Haus befand, im Schatten blieb. Die Auswirkungen dieses unsäglichen Kriegs sind auch hier zu erkennen, dachte Maria betrübt. Obwohl die Gefechte das Land an der Saar noch nicht erreicht hatten, mussten die Menschen tagtäglich ums Überleben kämpfen. Zu Beginn waren es politische und konfessionelle Gründe gewesen, diesen Krieg zu entfachen. Doch mittlerweile hatte man den Eindruck, dass jeder gegen jeden kämpfte und die Gefechte deshalb nicht enden wollten.
Maria seufzte kaum hörbar und blickte zu der Todgeweihten. Emeut wurde ihr die Vergänglichkeit des Lebens bewusst, denn erst vor Kurzem hatte sie einen geliebten Menschen beerdigen müssen. Die Äbtissin des Augustinerklosters zu Fraulautern war nach kurzer, heftiger Krankheit gestorben. Es war ein schwerer Verlust für Maria gewesen, denn seit ihrem zwölften Lebensjahr lebte sie unter der Obhut der Äbtissin im Kloster. Auf Wunsch der Verstorbenen war Maria zur neuen Leiterin des Nonnenstifts ernannt worden. Ich hätte gern auf dieses Amt verzichtet, wenn Sophia weiterleben würde, dachte Maria und wischte sich über die Augen. Nun müsste sie sich schon bald auch von Regina Rehmringer verabschieden, der sie so viel zu verdanken hatte. Gerne hätte sie ihr noch einmal gedankt, doch sie wusste, dass die Frau sie nicht mehr hören konnte.
Maria hatte plötzlich das Gefühl, als ob jemand ihr Herz zusammenpresste. Ihre Augen brannten von aufsteigenden Tränen. Doch sie konnte nicht weinen. Regina Rehmringer hatte ein hohes Alter erreicht, und dafür war die Nonne ihrem Herrgott dankbar.
Sie ging neben Magdalena, die vor dem Bett auf einem Schemel saß, in die Hocke. Die Äbtissin flüsterte: »Geh an die frische Luft, mein Kind, und lass dir etwas zu essen zubereiten. Ich werde dich ablösen.«
Magdalena ergriff Marias Hand und drückte sie sanft. Mit müdem Blick stand sie auf und ging zur Tür, wo ihr Vater sie umarmte. »Kommst du mit hinaus?«, fragte sie ihn leise.
Er schüttelte den Kopf. »Ich bleibe noch eine Weile. Vielleicht wacht Regina ein letztes Mal auf.«
Magdalena nickte, doch ihr Blick verriet Zweifel. »Ruf mich, falls das geschehen sollte«, flüsterte sie und verließ mit hängenden Schultern den Raum.
Johann zog den Stuhl, der neben der Wäschetruhe im Zimmer stand, zu sich und setzte sich. Als Maria aufblickte, nickte er ihr kurz zu. Lächelnd wandte sich die Nonne der alten Rehmringer zu und nahm deren schlaffe Hand in ihre. Maria erinnerte sich an die Zeit, als sie nach Wellingen gekommen war.
***
Sie war ein kleines Kind gewesen, als ihr Vater der Hexerei beschuldigt und verbrannt wurde. Von da an quälten Maria schlimme Alpträume, in denen sie Menschen sah, die mit dem Teufel tanzten. In einem dieser Träume glaubte sie ihre Stiefmutter zu erkennen. Als ein Nachbar die Stiefmutter des Schadenszaubers anklagte und ihr unterstellte, dass wegen ihres bösen Blicks die Kuh weniger Milch gebe, erzählte Maria dem Richter von ihrem Traum. Fortan galt das Kind als Hexenerkennerin.
So kamen sie ins Land an der Saar in den Ort Wellingen, wo sie Regina Rehmringer kennenlernten, die das Kind ins Herz schloss und von seinen bösen Träumen befreien wollte. Sie stellte das Mädchen unter die Obhut der Äbtissin von Fraulautern. Tatsächlich verschwanden in der Abgeschiedenheit hinter den Klostermauern und durch zahlreiche Gebete sowie Gespräche die bösen Träume, und Maria wurde geheilt.
***
»Kannst du dich an den Tag erinnern, als ich zu euch gekommen bin?«, fragte Maria mit leiser Stimme.
»Wie könnte ich ihn je vergessen?«
Ohne aufzuschauen, flüsterte sie heiser: »Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn Frau Rehmringer und ihr euch nicht um mich gekümmert hättet.«
»Vielleicht hättest du einen netten Mann geheiratet, wärst Mutter geworden und nicht ins Kloster gegangen«, sagte Johann mit einem Schmunzeln in der Stimme.
»Oder ich wäre auf dem Scheiterhaufen gelandet«, erwiderte Maria ernst.
»Sag so etwas nicht«, bat Johann verhalten.
Mit starrem Blick schaute Maria ihn an. »Die meisten Menschen hatten Angst vor mir, schließlich zog ich mit einem Magier übers Land, um bei der Hexenfindung zu helfen.«
»Das war nichts Schlechtes«, erklärte Johann. »So konnte man gewiss sein, dass keine unschuldige Frau verurteilt wurde.«
Maria zog zweifelnd eine Augenbraue hoch. »Ich bin nicht sicher. Je älter ich werde, umso mehr denke ich darüber nach, ob unser Handeln damals rechtens war. Manchmal sehe ich im Traum die Frauen, denen ich als Mädchen begegnet bin, nachts vor meinem Bett stehen.«
»Sind die Träume zurückgekehrt?«, fragte Johann. Maria schüttelte den Kopf. »Nein, nicht diese Art von Träumen, die ich als Kind fürchtete und die mich Jede Nacht wachhielten. Ich sehe Frauen vor meinem Bett stehen, die mir keine Angst machen. Sie stehen nur da und blicken mich an.«
»Du weißt nicht, was sie wollen?«
Maria schüttelte den Kopf.
»Und du bist sicher, dass du ihnen früher schon einmal begegnet bist?«
Maria zuckte mit den Schultern und vermied es, ihn anzusehen. »Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ihre Gesichter erscheinen mir vertraut.«
»Wie furchtbar«, murmelte Johann.
Maria wandte sich ihm zu, legte den Kopf leicht schief und lächelte.
»Was ist?«, fragte Johann verunsichert.
»Weißt du, dass ich in dir immer einen Ersatzvater gesehen habe?«
Johann riss seine Augen weit auf. »Ich dachte immer, ich bin wie ein Bruder für dich. Schließlich trennen uns nur knapp acht Jahre.«
»Einem Bruder hätte ich widersprochen, einem Vater nicht.«
»Ich wollte nicht, dass du Nonne wirst...«
»Du hast es nie laut ausgesprochen.«
»Jetzt bin ich schuld«, lachte er verhalten.
»Ich bin glücklich mit meinem Leben und bereue nichts«, erklärte Maria mit fester Stimme.
»Dann ist es gut. Es ist ein schlimmes Gefühl, falsche Entscheidungen getroffen zu haben.«
Der Tonfall seiner Stimme ließ Maria aufblicken. Nachdenklich legte sie die Stirn in Falten. »Was ist?«, fragte sie.
Johann sah sie an und schien zu zögern, doch dann sagte er leise: »Ich überlege, zurück aufs Eichsfeld zu gehen.«
»Was?«, rief Maria aus und schlug sich sofort die Hand auf den Mund. Erschrocken blickte sie zu der Kranken, die jedoch regungslos dalag. »Wie kannst du so etwas sagen? Geschweige denn es ernsthaft erwägen«, wisperte sie.
Johann beugte sich auf seinem Stuhl nach vorn und stützte die Unterarme auf den Oberschenkeln ab. Nachdem er die Hände gefaltet hatte, rieb er die Handflächen aneinander. »Der Krieg kommt näher, Maria«, erklärte er mit gedämpfter Stimme.
»Ich weiß! Letzte Woche brachte ein fahrender Händler Flugschriften aus Saarbrücken mit, sodass ich die Neuigkeiten lesen konnte«, stimmte sie ihm ebenso leise zu. »Aber wenn du in Richtung Eichsfeld marschierst, läufst du dem Krieg entgegen und begegnest ihm eher als wir.«
»Ich weiß das und plane deshalb, durch die Gebiete zu ziehen, wo keine Gefechte mehr stattfinden. Falls wir doch durch ein Kriegsgebiet gehen müssen, werde ich meine Familie hinter die Kampflinien bringen.«
»Du bist kein Soldat und weißt nichts von Kampf- oder Verteidigungslinien. Du verfügst nicht über das Wissen, das man benötigt, um solch ein Wagnis einzugehen. Du bringst euch alle in Gefahr«, erregte sich Maria. Ihre Augen blitzten ihn an. »Sieh dich um, Johann, und sei vernünftig! Auf dem Gestüt seid ihr in Sicherheit. Zwar hat auch dieser Hof hier schon bessere Jahre erlebt. Aber ihr habt ein Dach über dem Kopf und genug zu essen. Unser kleines Land Westrich ist bis jetzt vom Krieg verschont geblieben. Selbst wenn die Flugschriften die Wahrheit sagen und die Truppen bis ins Land an der Saar vordringen, wird es die letzte Etappe des Krieges sein. Was willst du auf dem Eichsfeld, wo dich womöglich Hunger, Leid und Zerstörung erwarten?«
Johann holte tief Luft und blickte auf die Sterbende. »Seit der Geburt meiner Kinder hat Regina bei ihnen die Stelle der Großmutter ersetzt. Ihre wahre Großmutter haben sie nie kennengelernt. Auch wenn wir hier in Wellingen ein Zuhause gefunden haben, es ist nicht unsere Heimat. Ich habe Sehnsucht nach meiner Mutter, nach Hundeshagen und nach den Orten meiner Kindheit.«
»Ausgerechnet jetzt, wo das Reich in Schutt und Asche liegt, willst du deine Kinder in Gefahr bringen? Warum willst du nicht warten?«, fragte Maria und blickte ihn zweifelnd an.
»Deine Bedenken sind berechtigt. Aber niemand weiß, wie lange dieser verdammte Krieg andauern wird. Er hält das Land bereits seit sechzehn Jahren umklammert, und es können noch mal so viele Jahre werden.«
»Jetzt übertreibst du«, rügte ihn Maria.
Johann zuckte mit den Schultern. »Wer weiß?« Er setzte sich auf und blickte erneut zu der alten Rehmringer. »Ich denke nicht erst seit gestern darüber nach, sondern schon seit geraumer Zeit. Versteh bitte, dass ich meine Mutter nicht erst auf dem Krankenbett wiedersehen möchte. Ich würde mir nie verzeihen, wenn ich an ihrem Grab stehen müsste, nur weil ich mit der Rückkehr gezögert habe.« Er fuhr sich mit beiden Händen durch das dunkelblonde Haar, das an den Schläfen bereits grau wurde. »Ich war neunzehn, als ich sie verlassen habe. Nun bin ich fast doppelt so alt. Wie lang soll ich noch warten?«
Maria konnte seine Gründe nachvollziehen. Unglücklich schloss sie die Augen und presste die zitternden Lippen aufeinander. Dieses Mal hielt sie die Tränen nicht zurück. Als sie über ihre Wangen liefen, legte sie Regina Rehmringers Hand auf das Betttuch und zog ein Taschentuch aus dem Ärmel ihrer schwarzen Nonnentracht. Nachdem sie sich die Tränen weggewischt hatte, fragte sie: »Weiß Franziska von deinen Plänen?«
Johann schüttelte den Kopf, und sein Blick verriet seine Ängste.
Erstaunt weiteten sich Marias Augen. »Deine Frau wird nicht mit dir gehen wollen.«
»Ich weiß«, sagte Johann leise und räusperte sich. »Aber sie hat keine andere Wahl.«
»Bist du sicher?«
»Nein«, sagte er mit schwacher Stimme.
Kapitel 2
Die Kellerassel kam langsam aus dem Mauerloch hervorgekrochen und krabbelte geschwind mit ihren spinnendünnen Beinen über den Lehmboden. Plötzlich sauste eine Hand auf sie hernieder und zerquetschte sie.
Das Kind hob vorsichtig die Hand und spähte auf den Boden darunter. Als es die tote Kellerassel sah, quiekte es vor Freude. Mit den Fingerspitzen nahm das Kind das plattgedrückte Tier und hielt es sich dicht vor die trüben Augen. Brabbelnd betrachtete es die kleine Beute. Dann steckte es das Ungeziefer in den Mund und schluckte es.
Das Kind schaute sich sofort nach dem nächsten Opfer um, das nicht lange auf sich warten ließ. Immer wieder schlug das Händchen auf den Boden. Doch die kleinen Tiere stillten den Hunger des Kindes nicht. Als keine Kellerassel mehr aus dem Loch zwischen Mauersteinen gekrochen kam, fing das Kind an zu schreien. Es riss sich zornig an den Haaren und brüllte aus Leibeskräften. Erst als es hörte, wie sich ein Schlüssel knarrend im Schloss der Tür oberhalb der Treppe umdrehte, verstummte es und blickte mit tränennassem Blick die Stufen hinauf.
Kaum hörte es die Schritte, kroch es auf allen vieren in eine Ecke des Raums und presste sein Gesichtchen gegen die kalte Mauer.
Kapitel 3
Auf dem Eichsfeld
»Schon in den frühen Stunden des Tages habe ich neun Ratten in meinem Keller totgeschlagen«, erzählte die Bäuerin Josefine den Frauen, die mit ihr am Bach Wäsche wuschen. Obwohl sie am seichten Ufer standen, waren ihre Röcke bis zu den Knien mit Wasser vollgesogen und klebten ihnen an den Waden. Die klirrende Kälte des Morgens hatte ihre nackten Füße und Hände gefühllos gemacht und gerötet. Das eisige Wasser brannte in den feinen Wunden ihrer Haut, die an den Fingerkuppen vom Scheuern der Wäsche aufgeplatzt war.
»Es ist in dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches, Ratten im Keller zu haben. Besonders im Winter zieht sich das Ungeziefer in die Häuser zurück«, mischte sich Grete, eine grauhaarige Frau, in das Gespräch ein und presste ihre Hände zwischen die Oberschenkel, damit sie warm wurden.
»Der aufkommende Winter allein ist nicht schuld daran«, widersprach Josefine und dämpfte ihre Stimme. »Sie hat uns das eingebrockt«, erklärte die Bäuerin und schaute vorsichtig zu dem Hof hinüber, der am Ortsrand stand. Die Blicke der drei anderen Frauen folgten dem ihren.
»Meinst du wirklich, dass es damit zusammenhängt?«, wisperte Helene, eine junge Frau, die sich wegen ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft kaum bücken konnte.
»Erinnert ihr euch nicht mehr, wie die alte Hebamme den Hexenschwur hinausgeschrien hat, bevor die Flammen über ihr zusammenschlugen?«, fragte Josefine gereizt und schleuderte das Leinen gegen die flache Seite eines großen Steins.
Tine, eine kräftige Frau, die erst vor Kurzem zugezogen war, nachdem sie einen Witwer des Dorfes geheiratet hatte, hielt im Waschen inne und steckte ihre feuerroten Hände unter die Achseln. Bibbernd stand sie da und schaute auf den Berg Wäsche, den sie noch waschen musste. »Wie konnte ich einen Mann mit sechs Kindern heiraten?«, murmelte sie und hob einen der zahlreichen Kittel auf. »Welcher Hexenschwur?«, fragte sie dann, während sie die Kleidung einseifte.
Die Bauersfrau hielt in der Arbeit inne und antwortete: »Es ist vier oder fünf Jahre her, da wurde eine Hebamme aus dem Nachbarort zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt.«
»Jesus und Maria«, flüsterte Tine und bekreuzigte sich dreimal. »Nur Hexen werden zum Tod durch die Flammen gerichtet«, sagte sie und blickte die Frauen angsterfüllt an.
»Ich kann mich sehr gut an die Hinrichtung der alten Berta erinnern. Wie Schlachtvieh wurde sie an einem Strick zum Scheiterhaufen geschleift«, sagte die schwangere Helene und stützte ihren Rücken mit beiden Händen ab.
»Hexen müssen brennen!«, brummte die Bäuerin und schlug nun mit einem breiten Stock auf die Bettwäsche.
»Ohne Bertas Hilfe wäre ich bei der Geburt der Zwillinge gestorben. Deshalb kann ich dem Weib nichts Schlechtes nachsagen. Ich wäre froh, würde sie mir bei dieser Geburt ebenfalls beistehen«, verteidigte die werdende Mutter die Hebamme zaghaft und bückte sich umständlich, um das Betttuch aufzunehmen.
»Wenn du von ihrer Unschuld überzeugt warst, warum hast du damals geschwiegen und sie nicht verteidigt?«, fragte Josefine bissig.
Helene schluckte und antwortete leise: »Du weißt, wie schnell man bezichtigt wird, mit der Hexe gemeinsame Sache zu machen. Außerdem hatte mein Mann mir verboten, mich zu äußern.«
»Warum hat man die Hebamme der Hexerei für schuldig befunden?«, fragte Tine, während sie den Stoff mit der Bürste bearbeitete.
Josefine schnaufte laut und legte die gewaschenen Teile in den Korb. Dann blickte sie zu dem Gehöft hinüber, das das größte in der Umgebung war, und erzählte die Geschichte, die sich damals zugetragen hatte: »Es war schon lange das Gerücht im Umlauf, dass die alte Berta mit dem Teufel im Bunde stehe. Die Leute schwiegen dazu, denn die Hebamme hatte vielen geholfen, ihre Kinder auf die Welt zu bringen.« Sie schielte zu der Schwangeren hinüber. »Zu Berta kamen aber auch Frauen, die nicht empfangen konnten. So war die Ehe einer Frau aus unserem Dorf lange kinderlos geblieben. Ihr Mann wünschte sich sehnsüchtig einen Sohn, doch die Frau wurde nicht schwanger. Die Arme war so verzweifelt, dass sie mitten in der Nacht Berta aufsuchte und der Alten ihr Leid klagte. Ich weiß nicht, was ihr die Hebamme gab. Aber wenig später wurde die Frau schwanger und schenkte einem Knaben das Leben. Ich habe das Kind nie gesehen, aber es soll rosige Wangen, sonnenhelle Locken und große blaue Äuglein gehabt haben. Auch soll er selten geweint und die meiste Zeit geschlafen haben.«
»Die Eltern konnten sich glücklich schätzen«, meinte die Frau des Witwers. »Die Kinder meines Mannes haben dünne dunkle Haare, Rotznasen, und ihre Haut ist von Flohbissen übersät«, erklärte sie verächtlich und knetete die Wäsche im klaren Wasser, bis keine Seife mehr im Stoff war. Dann schaute sie auf und fragte: »Warum aber war die Frau mitten in der Nacht zu der Hebamme gegangen?«
Die Bäuerin zuckte mit den Schultern. »Ich sagte bereits, dass die Berta mit dem Teufel im Bunde stand. Vielleicht hat er bei der Schwangerschaft mitgeholfen«, lachte sie gehässig, und auch Grete grinste hämisch.
»Ihr redet Unfug!«, schimpfte Helene und widersprach: »Die Frau wollte sicher nicht, dass das Dorf sich über ihr Unglück lustig machte – so wie ihr jetzt.«
»Ich sage dir eins: Mir ist es einerlei, ob jemand Kinder hat oder nicht oder wie viele. Aber mir ist es nicht einerlei, wenn jemand mit dem Teufel tanzt«, sagte Josefine aufbrausend.
»Was haben die Frau und ihr prächtiges Kind mit deinem Ungeziefer im Keller zu tun?«, versuchte Tine die Streitenden abzulenken.
Die Bäuerin schüttelte den Kopf. Bevor sie weitererzählte, wanderte ihr Blick erneut hinüber zu dem Gehöft. »Ja, alles schien gut zu sein bis zu dem Tag, als das Unglück über die Arme hereinbrach«, sagte sie kaum hörbar.
Grete und Helene zuckten zusammen. Rasch sammelten sie ihre Wäsche ein, während die Frau des Witwers in ihrer Arbeit innehielt und die anderen fragend anschaute.
»Was ist geschehen?«, fragte sie mit angespannten Gesichtszügen und stellte sich neben Grete und Helene.
Josefine zögerte mit der Antwort: »Es war ein heißer Sommertag, und die Frau verrichtete ihre Arbeit im Hof. Plötzlich hörte sie im Schlafzimmer ihr Kind jämmerlich wimmern. Zwei Stufen auf einmal nehmend, rannte sie die Treppen hoch zur Wiege, und da erwartete sie das Schreckliche.« Die Bäuerin legte eine Atempause ein. Als sie weitersprach, zitterte ihre Stimme. »Wie die arme Mutter uns erzählte, lag nicht mehr ihr schönes Kindchen in dem Bett, sondern ein heulender Wechselbalg. Hässlich anzusehen mit vom Weinen feuerrotem Gesicht und Ärmchen und Beinchen, die krumm, verzerrt und verdreht schienen.«
»Jesus und Maria«, flüsterte die Kräftige und schlug ihre rissige Hand gegen den Mund.
»Ein Wechselbalg«, nickte die Grauhaarige, und ihre hellblauen Augen wurden feucht.
»Ein Alptraum!«, flüsterte die Schwangere und legte ihre Hände schützend um den gewölbten Leib.
»Ein Wechselbalg?«, fragte das Weib des Witwers. »Ich habe noch nie ein solches Kind gesehen. Woher kam es?«
»Dämonen haben ihr eigenes hässliches Kind gegen das zarte und schöne Menschenkind ausgetauscht und es mitgenommen«, antwortete mit zitternder Stimme die Bauersfrau.
»Aber warum?«, fragte die andere, und auch ihre Stimme bebte.
»Der Wechselbalg ist ein unschönes Kind. Es ist ein Nimmersatt, der ständig Hunger hat. Er schreit und brüllt den lieben langen Tag, dass man ihn erwürgen möchte. Trotz des vielen Essens wächst er kaum und bleibt kleinwüchsig. Seine Gliedmaßen sind verkrüppelt, sodass er weder aufrecht stehen noch gehen kann. Auch lernt er nicht fehlerlos sprechen, sondern grunzt wie ein Tier.« Düster senkte Josefine ihre Stimme. »Warum, frage ich dich, sollen die Dämonen ein solches Kind aufziehen, wenn sie es gegen ein schönes und gesundes Menschenkind austauschen können?«
»Jesus und Maria«, stöhnte das Weib des Witwers. »Wie furchtbar! Aber was hatte die Hebamme damit zu tun?«
Die drei Frauen blickten sich verschwörerisch an und schwiegen. Erst als Tine bettelte: »Nun sagt schon!«, trat die Bäuerin einen Schritt auf sie zu und flüsterte:
»Die Hebamme hat den Dämonen verraten, welches Kind das schönste ist im Dorf. Und sie hat ihnen geholfen, es auszutauschen.«
»Woher wollt ihr das wissen?«, fragte die Frau ungläubig.
»Die Kammer des Kindes war mit dem Geruch der Hebamme gefüllt.«
Die kräftige Frau runzelte die Stirn. »Wie riecht eine Hebamme? Riecht sie wie die Kräuter, die sie sammelt?«
Die Bäuerin blickte die Frau düster an und zischte: »Sie riecht wie der Schwefel des Teufels!«
Nun wurde das Weib des Witwers kreidebleich. »Nur gut, dass man sie verbrannt hat. So kann sie nicht als Untote zurückkehren und ihr Unwesen treiben«, stammelte sie und konnte doch Zweifel nicht unterdrücken. »Ich verstehe immer noch nicht, was es mit dem Ungeziefer auf sich hat.« Sie rieb sich fröstelnd über die Oberarme.
Die Bäuerin sog die Luft zwischen ihren schwarzen Zähnen ein und schüttelte sich. Mit scharfem Blick erklärte sie: »Es war die Mutter des gestohlenen Kindes, die die Hebamme der Hexerei bezichtigt hatte. Als man Berta verbrannte, verhängte sie gegen die Frau den Hexenschwur. Sie verfluchte und verdammte sie und schrie, dass sie fortan von Angst, Krankheit und Seuchen gezeichnet sein werde, dass Ungeziefer über sie und ihresgleichen kommen werde. Auch solle sie Hunger und Not leiden.«
»Jesus und Maria«, sagte das Weib erneut und bekreuzigte sich dreimal. »Ist alles eingetreten?«
Die übrigen Frauen blickten sich an und zuckten gleichzeitig mit den Schultern. »Seit jenem Tag wird die Frau im Dorf gemieden. Wir sprechen nur selten mit ihr, um nicht Unglück über uns selbst zu bringen. Die vom Schicksal hart getroffene Frau ist oft geistesabwesend. Der Hexenschwur hat sie verdammt, und es gibt keine Rettung für sie.«
»Die arme Frau! Und ihr Mann?«
»Er bewirtschaftet mit ihr den Hof. Manchmal sehe ich ihn beim Gottesdienst, dann steht er da und betet stumm zu unserem Heiland.«
Josefine nahm ihren Korb mit der nassen Wäsche auf und trat den Heimweg an. Auch die anderen Waschfrauen folgten ihr. Dabei lief das Wasser in feinen Rinnsalen am Geflecht der Weidenruten ihrer Körbe entlang und versickerte in der Kleidung der Frauen.
»Ich wasche erst wieder, wenn es wärmer ist. Von mir aus kann mein Alter in seiner schmutzigen Wäsche laufen, bis der Frühling kommt«, schimpfte Grete und wischte sich die kalten Wassertropfen von der Brust. Gemeinsam beschritten die vier Frauen den schmalen, glitschigen Weg, der nach oben zur Straße führte.
»Weiß sie, was aus ihrem prächtigen Kind geworden ist?«, fragte Tine und setzte achtsam einen Fuß vor den anderen, damit sie auf dem aufgeweichten Boden nicht ausrutschte.
Die Bäuerin schüttelte den Kopf. »Seit diesem Unglückstag ist ihr Sohn verschwunden. Das ganze Dorf hat damals nach ihm gesucht, aber nirgends eine Spur gefunden. Die Frau klammert sich an die Hoffnung, dass die Dämonen eines Tages im Austausch gegen ihr eigenes Kind den Wechselbalg zurückfordern, wenn der Krüppel nur schlecht genug behandelt wird. Aber einerlei, was sie mit ihm anstellt, die Dämonen sind bislang nicht gekommen, ihn zu holen.«
Das Weib wurde hellhörig. »Was macht sie mit dem Dämonenkind?«
Mit einem Seitenblick streifte die Bäuerin die Grauhaarige, und diese antwortete: »Sie hat es in den Keller gesperrt, und nur sie hat den Schlüssel zu der Tür. Da meine Hütte ihrem Hof am nächsten steht, höre ich das Dämonenkind manchmal weinen. Keine Ahnung, was sie mit ihm macht, aber die Frau hat keine andere Wahl. Nur wenn sie den Krüppel schlecht behandelt und die Dämoneneltern seine Schreie hören, werden sie ihr eigenes Kind retten wollen und das Menschenkind zurückbringen.« Mit strengem Gesichtsausdruck erklärte sie: »So ein Wechselbalg muss leiden.«
»Ich glaube nicht, dass sie unmenschlich ist und den Balg quält. Dieser Tage habe ich gesehen, wie sie mit einem Korb voller Kräuter gegen Fieber und Erkältungen aus der Hütte der Kräuteranni kam«, schilderte Helene ihre Beobachtungen.
»Die können auch für sie selbst oder ihren Mann und nicht für das Kind gewesen sein«, warf die Bäuerin ein, doch die Schwangere schüttelte den Kopf.
»Sie sah gesund aus, und Männer kippen eher einen Selbstgebrannten, als dass sie einen Sud trinken«, lachte sie verhalten. »Nein, ich denke, dass der Wechselbalg kränkelt, denn es lagen Spitzwegerich und Baldrian im Korb. Das Kraut brühe auch ich meinen beiden Kindern auf, wenn sie Fieber und Halsschmerzen plagen. Welche Mutter wäre so herzlos und würde den Dämonenbalg sterben lassen, wenn sie nur durch Tausch ihr eigenes Kind zurückbekommen kann?«, flüsterte sie. Nachdenklich blieben die drei anderen Frauen stehen.
»Zum Glück musste ich mir nie solche Gedanken machen. Meine Kinder waren nicht so hübsch, dass Dämonen sie hätten entführen wollen«, lachte Grete und zeigte dabei ihren zahnlosen Mund.
Die drei anderen Frauen stimmten in das Gelächter ein. Dann ging jede ihres Weges.
Kapitel 4
Clemens stand am Rand der Weide und schärfte mit fließenden Bewegungen die Sense. Seine Frau hatte ihn beauftragt, Brennnesseln zu schneiden, weil sie sich seit Tagen erschöpft und müde fühlte. Da dem Kraut eine aufmunternde Wirkung nachgesagt wurde, wollte sie einen Sud aufbrühen. Clemens hielt kurz inne und lächelte. Die Schwangerschaft war nun nicht mehr zu übersehen. Überglücklich erwarteten Christel und er ihr zweites Kind, nachdem sie beide bereits die Hoffnung aufgegeben hatten, nochmals Eltern zu werden.
Er prüfte mit dem Daumen die Schärfe des Sensenblattes und steckte zufrieden den Wetzstein in das Futteral, das an seinem Gürtel hing. Gleichmäßig schnitt er die Stängel der Brennnesseln dicht über dem Boden ab, als sein zehnjähriger Sohn aufgeregt auf ihn zu rannte. Außer Atem blieb der Junge vor ihm stehen und stützte keuchend die Hände auf den Oberschenkeln ab.
»Ist etwas geschehen?«, fragte Clemens voller Sorge und wollte schon losstürmen, doch Georg schüttelte den Kopf.
»Nein«, japste er und versuchte zu lächeln. Der Knabe wies mit dem Zeigefinger hinüber zu dem Acker, auf dem sonst das Getreide wuchs. »Ich habe ein Rehkitz gefunden.«
»Ist es tot?«, fragte der Vater.
Georg verneinte.
»Ich hoffe, du hast es nicht angefasst.«
Georg schüttelte so heftig den Kopf, dass sein halblanges, dunkles Haar ihm ins Gesicht schlug. »Man darf Kitze nicht anfassen, weil die Mutter es sonst verstößt.«
Clemens streichelte dem Jungen über das Haupt. »Du bist ein schlauer Bursche und weißt, dass die Ricke Angst vor Menschengeruch hat«, lobte er ihn. »Jetzt nimm den Leinensack und sammle die Brennnesseln ein, damit es Mutter bald besser geht.«
»Die brennen!«, erklärte der Junge und hielt sich die Hände auf den Rücken.
»Mutter hat mir einen Handschuh mitgegeben. Damit spürst du das Brennen nicht.«
Georg nahm den Handschutz, der viel zu groß für seine kleine Hand war, und stülpte ihn über. Während er die Brennnesseln in den Sack stopfte, fragte er den Vater mit ernster Miene: »Wann wird das Kind auf die Welt kommen?«
»Wir schätzen, im Februar«, rechnete Clemens nach. »Freust du dich?«, wollte er wissen, während er weitermähte.
Der Junge zuckte mit den Schultern. »Der Schuster Peter hat jetzt die fünfte Schwester bekommen und ist deshalb ziemlich mürrisch. Er hatte unbedingt einen Bruder haben wollen, und außerdem schreit die Kleine den ganzen Tag, sodass die anderen Mädchen jedes Mal mitheulen.«
Clemens lachte laut. »Ja, der Peter hat ein schweres Schicksal. Fünf Jahre lang jedes Mal eine Schwester – das verträgt kein Mensch. Ich kann mir vorstellen, wie die Kleinen um die Wette schreien. Aber sorge dich nicht, dass uns das gleiche Schicksal blüht, mein Sohn. Deine Mutter und ich sind froh und dankbar, dass zehn Jahre nach deiner Geburt wieder ein Kind zu uns in die Familie kommt. Mehr werden es sicher nicht werden.«
Von den Worten des Vaters beruhigt, stopfte der Junge die Pflanzen in den Sack. Als genügend Brennnesseln geschnitten waren, schulterte Georg den Leinenbeutel und sein Vater die Sense. Auf dem Weg zurück ins Haus kam Johann ihnen über die Wiese entgegen und winkte ihnen von Weitem zu. Clemens sah sofort am Gesichtsausdruck seines Freundes, dass Johann mit ihm sprechen wollte. Darum sagte er zu seinem Sohn: »Geh schon vor und gib deiner Mutter das Kraut. Ich werde gleich nachkommen.«
»Gott zum Gruß!«, rief der Zehnjährige und lief an Johann vorbei.
Clemens ließ das Schneideblatt der Sense zu Boden gleiten und stützte sich auf dem Stielknauf auf. Abwartend blickte er seinem Freund entgegen. Als er vor ihm stand, fragte er leise: »Ist sie tot?«
Johann schüttelte den Kopf. »Aber es kann nicht mehr lange dauern. Maria und Magdalena sind bei ihr. Ich habe den Pastor gerufen, damit Regina die Letzte Ölung bekommt.«
»Dann ist es Zeit, dass wir uns von ihr verabschieden«, sagte Clemens, und Johann nickte.
Beide Männer schwiegen für einen Augenblick, als Johann in die Stille sagte: »Ich werde mit meiner Familie zurück aufs Eichsfeld gehen.«
»Das meinst du nicht ernst«, unterstellte Clemens dem Freund und blickte ihn ungläubig an.
Doch Johann nickte ein zweites Mal. »Ich spüre schon seit Langem diese Sehnsucht, die täglich größer zu werden scheint. Ich bin geblieben, weil ich mich für Regina Rehmringer verantwortlich fühle. Sie hatte nur uns, und wir waren ihre Ersatzfamilie. Doch wenn sie stirbt, hält mich hier niemand mehr. Ich fühle mich frei zu gehen.«
»Was ist mit mir?«, fragte Clemens leise. »Ist unsere Freundschaft es nicht wert, dass du in Westrich bleibst? Hier, wo die Heimat deiner Kinder ist?«
»Du warst mir immer ein treuer Gefährte und Freund«, antwortete Johann, atmete tief ein und erklärte: »Aber wenn ich eines Tages von dieser Welt Abschied nehmen muss, möchte ich nicht in fremder Erde beerdigt werden. Ich will heim nach Hundeshagen.« Johann flüsterte mehr, als dass er sprach, und Clemens musste sich leicht nach vorn beugen, um ihn verstehen zu können.
»Bist du krank?«, fragte er bestürzt.
»Nicht dass ich wüsste«, erklärte Johann und lächelte schief. »Ich hoffe, dass der Herrgott mir noch einige Jahre schenkt, bevor er mich zu sich ruft.«
Clemens klopfte ihm erleichtert auf den Rücken. »Ich bitte dich, deine Entscheidung zu überdenken«, bat er Johann.
Der schüttelte den Kopf. »Mein Entschluss steht fest, und deshalb wollte ich dich fragen, ob du mit deiner Familie mitkommen willst. Auch du bist auf dem Eichsfeld geboren. Hast du kein Verlangen danach zu wissen, ob deine Schwester und ihre Familie noch in Dingelstedt leben? Hast du nicht den Wunsch zu wissen, wie es ihnen geht?«
Clemens starrte in die Ferne. Ein Bussard schreckte in einer Baumkrone mehrere Krähen auf, die schimpfend davonflogen. Clemens sah ihnen nach, schluckte hart und blickte dann Johann an: »Ich kann deine Sehnsucht verstehen, denn auch ich spüre sie. Jeden Tag denke ich an meine Schwester Anna und frage mich, wie es ihr und ihrer Familie geht. Doch ich kann nicht mitkommen, Johann. Die Reise wäre für Christel zu anstrengend. Ihre Schwangerschaft wird täglich beschwerlicher, und ich möchte nichts riskieren.« Als er sah, wie bei der Erwähnung von Christels Schwangerschaft ein Schatten über Johanns Gesicht fiel, sprach er schnell weiter. »Außerdem herrscht Krieg. Weite Teile des Reichs sind verwüstet, die Menschen leiden Hunger. Überall gibt es Mord und Totschlag. Willst du deine Familie wirklich einer so gefährlichen Reise aussetzen? Wir können glücklich sein, dass das Land an der Saar vom Krieg verschont geblieben ist. Wir haben zu essen und ein Dach über dem Kopf. Hier in Wellingen sind unsere Familien in Sicherheit«, gab er zu bedenken.
»Der Krieg kommt näher! Selbst Maria hat es in den Flugschriften gelesen. Wir haben die Möglichkeit, ihm zu entgehen, wenn wir uns durch die Landstriche bewegen, durch die die Truppen bereits gezogen sind.«
»Das ist Irrsinn!«
»Irrsinn ist es zu bleiben«, widersprach Johann.
Doch Clemens schüttelte den Kopf. »Der Krieg wird bald vorbei sein. Seit über sechzehn Jahren wütet er im Reich. Wie lange soll er noch Angst und Schrecken verbreiten? Er hat bereits Zehntausende Opfer gefordert. Menschen verhungern, siechen an der Pest oder anderen Seuchen elendig dahin, und andere werden ...« Clemens stockte und schaute erschrocken seinen Freund an, der seinem Blick standhielt.
Johann ahnte, was Clemens hatte sagen wollen. »Du kannst es laut aussprechen«, forderte er ihn auf, und Clemens führte den Satz zu Ende:
»... und andere werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie für die Not der Menschen verantwortlich gemacht werden.«
Beide Männer hatten vor vielen Jahren beschlossen, das Wort »Hexenverfolgungen« nicht mehr auszusprechen, um hässliche Erinnerungen zu unterdrücken. Doch Nachrichten, dass Menschen auf Scheiterhaufen verbrannt wurden, kamen aus allen Reichsgebieten, und auch in Westrich schlugen die Flammen der Feuer empor. Der Geruch des verbrannten Fleisches der Opfer, den der Wind mit sich brachte, drang manchmal bis nach Wellingen vor.
»Niemand – auch keines der Kinder – weiß, dass Franziska damals der Hexerei bezichtigt wurde und wir deshalb aus dem Eichsfeld fliehen mussten. Es liegt so viele Jahre zurück, dass mich der Gedanke daran nicht mehr ängstigt.«
»Dann ist es gut«, murmelte Clemens und blickte Johann forschend an. Als sein Freund den Blick abwandte, sagte Clemens mit fester Stimme: »Du irrst, wenn du glaubst, dass du auf dem Eichsfeld glücklich werden könntest und alles wieder wie früher wird. Du nimmst deine Schwierigkeiten mit.«
Johanns Kopf ruckte herum. »Wie meinst du das? Ich habe dir erklärt, dass ich mich nicht vor neuer Verfolgung fürchte. Die haltlosen Vorwürfe gegen Franziska sind längst vergessen. Ich aber kann die Sehnsucht nicht länger unterdrücken, endlich meine Mutter wieder in die Arme zu schließen.«
Clemens hob beschwichtigend die Hände. Dann widersprach er: »Es ist nicht allein die Sehnsucht nach deiner Mutter und der Heimat, die dich forttreibt. Es ist die Vergangenheit, die dich nicht ruhen lässt. Glaube mir, mein Freund: Auch wenn du fortziehst, du wirst dein Schicksal überallhin mitnehmen.«
Johann schloss gequält die Augen. Seine Beine zitterten, und er musste sich ins Gras setzen. Clemens legte die Sichel auf den Boden und ging neben ihm in die Hocke. »Weiß deine Frau, was du planst?«
Johann schüttelte den Kopf.
»Sie wird nicht mitgehen wollen. Und wenn sie dir nicht folgt, werden auch die Kinder sich weigern mitzukommen«, prophezeite Clemens, während er Grashalme zupfte.
»Ich weiß«, flüsterte Johann und blickte seinen Freund bekümmert an. Dann sagte er mit nachdrücklicher Stimme: »Ich bin der Herr im Haus, und sie wird sich fügen müssen. Ebenso die Kinder. Es wird nicht leicht werden, doch es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir bleiben, bedeutet das schon bald das Ende meiner Ehe und das Ende unserer Familie. Ich habe kaum noch Kraft, das alles zu ertragen. Hier werde ich ständig daran erinnert.«
Clemens wusste, dass Johann nicht übertrieb. »Ich möchte nicht in deiner Haut stecken«, sagte er ehrlich und richtete sich auf. »Ich muss zurück. Kommst du mit?«
Johann verneinte und streckte sich im Gras aus.
Clemens wartete einen Augenblick. Doch als Johann die Arme hinter dem Kopf verschränkte und die Augen schloss, nahm er achselzuckend die Sichel auf und sagte: »Ich werde mit Christel und Georg zu Regina gehen, um Abschied zu nehmen.«
Als Johann sicher war, dass Clemens ihn nicht mehr sehen konnte, stand er auf. Der Boden zwischen den Grashalmen fühlte sich feucht und kühl an, und seine Hose war nass geworden. Plötzlich fröstelte es ihn so sehr, dass er Gänsehaut bekam. Es war Mitte Oktober, und die Tage wurden kürzer und kühler. Johann stützte sich an einem Zaunpfosten ab und streckte sein Hinterteil der Sonne zum Trocknen entgegen. Er ließ seinen Blick über den Hain schweifen. Das Laub zeigte sich um diese Jahreszeit in unterschiedlichen Farben, von Ackerbraun, Hell- und Dunkelrot bis hin zu abgestuften Rosttönen waren die warmen Herbstfarben vertreten. Die Bäume wirkten, als würden sie brennen, da das Laub im Licht golden leuchtete. Das Leben könnte so schön sein, dachte Johann und spürte, wie ihn Bitterkeit überkam.
Es war nicht Regina Rehmringers nahender Tod, der ihn niederdrückte. Alle Menschen mussten einmal sterben. Johann tröstete die Gewissheit, dass die Sterbende älter als viele andere im Dorf geworden war und zudem die meisten Jahre ein schöneres Leben als andere gehabt hatte. Nun würde sie bald nicht mehr sein, und alle würden trauern. Aber noch mehr belastete Johann sein eigenes Schicksal. Über fünf Jahre war es her, dass sich sein Leben und das seiner Familie jäh verändert hatten.
Bei dem Gedanken daran musste Johann die Zähne fest zusammenbeißen, um nicht laut aufzuschreien. Seit jenem Tag, der der schwärzeste in seinem bisherigen Leben war, haderte er mit Gott und seinem Glauben. Franziskas Liebe zu ihm und zu ihren Kindern hatte sich seitdem verändert, und dadurch ihrer aller Leben.
Jedes Mal, wenn Johann seine Frau ansah, fragte er sich, ob sie noch Gefühle für ihn, Magdalena oder Benjamin hegte. Die Liebe, die sie beide bei ihrer Flucht quer durchs Reich alle Anstrengungen und Entbehrungen hatte vergessen lassen, schien versiegt. Franziskas Verhalten gegenüber ihrem Ehemann war abweisend und befremdend geworden, und Johann konnte das kaum ertragen. Es zerriss ihm schier das Herz, wenn sie ihn von sich stieß, denn er liebte sie wie am ersten Tag.
Franziska sprach nur noch das Nötigste mit ihm, und er vermied es, sie anzusprechen. Doch wenn sie miteinander sprechen mussten, machte Franziska voller Hass ihren Mann und den Rest der Welt für ihr Schicksal verantwortlich. Sie tobte und klagte, bis sie zusammenbrach und weinend auf dem Boden kauerte. Anschließend verließ sie das Haus und kam erst Stunden später wieder – das Gesicht verquollen. Johann wagte nicht zu fragen, wohin sie gegangen war. Er litt schweigend und hegte doch die Hoffnung, dass es eines Tages wieder wie früher werden würde.
Johann holte tief Luft und strich sich über die Stirn. Wenn ich doch die Zeit zurückdrehen könnte, dachte er. Nur seine Kinder gaben ihm die Kraft, Franziskas Ablehnung zu ertragen. Bei dem Gedanken an die beiden zog ein Lächeln seine Mundwinkel nach oben. Magdalena war noch keine elf Jahre alt gewesen, als das Unglück geschehen war. Das Kind hatte versucht, seine Mutter zu trösten. Doch Franziska stieß auch ihre Tochter immer wieder barsch von sich. So übernahm Magdalena irgendwann die Pflichten der Mutter, die meist geistesabwesend in der Stube saß und Löcher in die Wand starrte. Der sechsjährige Benjamin hingegen kannte seine Mutter nicht anders. Er gab sich mit dem wenigen zufrieden, was Franziska ihm zu geben bereit war. Aber je älter er wurde, desto öfter beobachtete Johann, wie sein Sohn mit unglücklichem Blick seine Mutter betrachtete. Auch Magdalena bemerkte die Niedergeschlagenheit ihres Bruders. Nur Franziska erkannte die Sehnsucht ihres Sohnes nicht.
Johann blickte zum Himmel und murmelte: »Gott, was habe ich getan, dass du uns so strafst?« Wie immer bekam er keine Antwort. Niedergeschlagen wandte er sich um, als er seinen Sohn Benjamin rufen hörte, der auf ihn zulief.
»Magdalena sagt, du sollst kommen«, rief er und ließ sich in die ausgestreckten Arme seines Vaters fallen. Johann ahnte, warum seine Tochter ihren Bruder schickte. Er hob den Jungen auf seine Schultern und rannte, so schnell er konnte, zum Gestüt.
Im Hof ließ Johann den Jungen über seinen Rücken auf den Boden gleiten. Der Lauf mit Benjamin auf den Schultern hatte ihm den Schweiß aus den Poren getrieben. Er wischte sich mit dem Ärmel seines Hemds über die Stirn und schnaufte mehrere Male durch. Als er durch die Tür ins Haus gehen wollte, trat ihm der Pastor entgegen.
»Ist sie ...?«, fragte Johann hastig, doch der Mann schüttelte den Kopf.
»Sie scheint ein starkes Herz zu haben. Ich kann nicht länger warten, denn in Schwallbach benötigt ein anderer Sterbender die Letzte Ölung«, erklärte er. »Menschen sterben lieber im tristen Winter«, fügte er hinzu und blinzelte in die Sonne, dann ging er rasch davon.
»Menschen sterben zu keiner Jahreszeit gern«, wollte Johann ihm hinterherrufen, doch der Pastor war bereits außer Hörweite. Mit Benjamin an der Hand ging Johann die Treppenstufen hinauf in den ersten Stock. Als er die Tür von Regina Rehmringers Stube öffnete, schlug ihm schlechte Luft entgegen, sodass er versucht war, die Tür offen stehen zu lassen. Doch als das Licht der zahlreichen Kerzen, die den Raum nur schwach erhellten, wegen des Durchzugs flackerte, schloss er die Tür.
Clemens, seine Frau Christel und ihr Sohn Georg standen am Fußende, Magdalena und Maria saßen auf Schemeln neben dem Bett. Benjamin ging zu seiner Schwester und drückte sich gegen sie. Sie legte den Arm um ihn. Johann stellte fest, dass Franziska fehlte, und im selben Augenblick spürte er Zorn und Unverständnis in sich hochsteigen. Selbst jetzt, in der Stunde des Todes der teuren Freundin, schien sie gefühllos zu sein. Johann musste an sich halten, um nicht hinauszustürmen und seine Frau zu suchen.
Doch da flackerte das Licht der Kerzen erneut, und Johann schloss erleichtert die Augen.
Kapitel 5
Das Kind hielt sich die Hände vors Gesicht und schrie. Erst als es hörte, wie die Kellertür ins Schloss fiel, verstummte es. Schluchzend ließ es die Hände sinken und blickte die Stufen hinauf. Tränen und Rotz ließen sein blasses Gesichtchen glänzen. Mit seinen großen Augen starrte es in die Dunkelheit und lauschte. Als es das Weinen der Frau hinter der verschlossenen Tür hören konnte, war es erleichtert. Und als es hörte, wie Schritte sich entfernten, ahnte es, dass sie heute nicht mehr wiederkommen würde – sie, die sich Mutter nannte.
Das Kind wusste nicht, was das Wort bedeutete, aber die Frau hatte es mehrmals gesagt, wenn sie es beschimpfte und schlug.
»M-u-t-r«, murmelte das Kind und nahm seine schmutzigen Fingerchen zu Hilfe, um die Unterlippe zu bewegen. Nur es selbst konnte das Wort deutlich hören. Für die Frau hingegen kam seine Sprache einem Grunzen gleich. »Du quiekst wie ein Schwein«, hatte sie dem Kind gesagt, als es nach der Schüssel Essen griff und dabei »M-u-t-r« sagte. Dabei wollte das Kind freundlich sein und zeigen, dass es dankbar war.
Gierig hatte es den hellen Brei in seinen Mund gestopft und geschluckt. Doch das Essen reichte nicht. Das Kind war immer noch hungrig. Zornig hatte es die leere Schüssel der Frau vor die Füße geworfen, sodass sie zu Bruch ging.
»Du undankbarer Nichtsnutz«, hatte die Frau es angebrüllt und es an den Ohren gezogen, bis es aufheulte. »Warum kommen die Dämonen nicht, dich zurückzuholen? Was muss ich noch tun, damit ich dich endlich loswerde?«, hafte sie gefragt und den Kindeskopf von sich gestoßen, sodass er gegen die grobe Mauer stieß.
Brüllend hatte das Kind sich die Stelle gehalten, in der der Schmerz pochte.
»Mutr«, hatte es gegrunzt und die Händchen in die Höhe gehalten. Doch die Frau verstand nicht. Als sie einen Schritt rückwärts gegangen war, dachte das Kind, sie würde es allein lassen, und hatte zu schreien begonnen.
»Halt dein Maul«, hatte die Frau gebrüllt und sich die Ohren zugehalten. Dann war sie die Stufen hinaufgestürmt und hatte die Tür zugeknallt.
Das Kind gab auf. Hungrig lutschte es an seinem schmutzigen Daumen und blickte sich in dem düsteren Raum um. Es erhob sich mühsam und stakste auf seinen krummen Beinen hinüber zu der Wand, die weit oben eine Öffnung hatte. Diese Öffnung war nicht größer als die beiden Händchen des Kindes, doch von dort fiel etwas Licht auf den Boden vor seine missgeformten Füße. Das Kind setzte sich langsam hin und starrte das kleine Loch in der Wand dicht über dem Boden an. Bewegungslos saß es da und wartete. Es wusste, dass es nur geduldig sein musste. Irgendwann würde eine Kellerassel es wagen herauszukommen.
Karoline lehnte sich mit heftig pochendem Herzen gegen die Kellertür. Als sie spürte, wie Tränen hochstiegen, zwinkerte sie mehrmals mit den Lidern, bis das Brennen nachließ. Mit einem Ruck stieß sie sich vom Türblatt ab und ging in die Küche. Dort stützte sie die Hände auf den blank gescheuerten Küchentisch und schnaufte tief durch. Obwohl ihr Herzschlag ruhiger wurde, zitterte sie. Ihr Blick erfasste den Krug mit dem Sud auf der Fensterbank. Mit steifen Beinen lief sie durch den Raum zum Fenster. Dort fischte sie die zerstoßene Baldrianwurzel aus dem Gefäß und goss die Brühe zusätzlich durch ein Tuch in einen Topf, damit von der bitteren Knolle nichts zurückblieb. Nachdem sie den Sud über den glühenden Kohlen des Herdes erwärmt hatte, schenkte sie sich einen Becher ein. Karoline setzte sich mit einem tiefen Seufzer an den Tisch und nahm einige Schlucke. Ihre Gedanken schweiften zu dem verkrüppelten Wesen, das im Keller ihres Hauses lebte, und sogleich legte sich eine Zornesfalte zwischen ihre Augenbrauen. »Der Wechselbalg bringt mich um den Verstand«, zischte sie leise. Mit beiden Händen umfasste sie den Becher und starrte in das dunkle Gebräu.