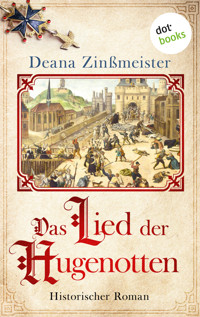9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte von der Flucht ihrer Eltern aus der DDR kennt Britta Hofmeister seit Kindesbeinen. Sie selbst kam in der Bundesrepublik zur Welt, wuchs mit ihren Geschwistern behütet auf und hatte nie Grund, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Bis ihr Vater an Demenz erkrankt. Zunehmend verwirrt, beginnt er, von früher zu erzählen. Und bald wird klar: Was bei der Flucht 1961 wirklich geschah, hat er jahrzehntelang verschwiegen. Nun kommt die dramatische Wahrheit ans Licht und stellt die Familie vor eine Zerreißprobe …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Die Geschichte von der Flucht ihrer Eltern aus der DDR kennt Britta Hofmeister seit Kindesbeinen. Sie selbst kam in der Bundesrepublik zur Welt, wuchs mit ihren Geschwistern behütet auf und hatte nie Grund, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Bis ihr Vater an Demenz erkrankt. Zunehmend verwirrt, beginnt er, von früher zu erzählen. Und bald wird klar: Was bei der Flucht 1961 wirklich geschah, hat er jahrzehntelang verschwiegen. Nun kommt die dramatische Wahrheit ans Licht und stellt die Familie vor eine Zerreißprobe …
Autorin
Deana Zinßmeister widmet sich seit einigen Jahren dem Schreiben historischer Romane. Mit Die vergessene Heimat betritt die Autorin Neuland: In ihrem halb autobiographischen Roman schildert sie die Flucht ihrer Eltern aus der DDR kurz nach dem Mauerbau, deren Details erst ans Licht kommen, als ihr Vater an Demenz erkrankt und im verwirrten Zustand das ausplaudert, über das bisher nicht gesprochen wurde. Deana Zinßmeister lebt mit ihrer Familie im Saarland.
Deana Zinßmeister
Die vergessene Heimat
Roman nach einer wahren Geschichte
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2020 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München Umschlagmotiv: © 1/4 U1 (Paar): Ildiko Neer / arcangel images; Composing-Elemente (Haare Mann, Wachturm, Zaun): FinePic, München; Composing (Vögel): Westend61 / getty images Redaktion: Eva Wagner BH · Herstellung: kw Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-26090-3V005www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Gewidmet neun mutigen Menschen in meiner Familie und in Erinnerung an die Kinder, Frauen und Männer, die an der DDR-Grenze zu Tode kamen
Aus Respekt vor den bereits verstorbenen Familienmitgliedern und aus Rücksicht gegenüber meiner Familie bleiben diese Personen im Roman namenlos. Die meisten anderen Namen sind fiktiv, auch wenn es diese Personen tatsächlich gab bzw. gibt.
Jahre später erkannte ich die Situationen.Jahre später konnte ich das Gehörte verstehen.Jahre später wusste ich das Gesagte zu deuten.Jahre später schoben sich die Puzzleteile zusammen.Jahre später ergab alles einen Sinn!
Prolog
Samstag, 12. August 1961
Leni und Ernst mussten sich sputen, um die letzte S-Bahn nach Falkensee nicht zu verpassen. Kurz vor Mitternacht waren sie zuhause, wo sie müde in ihr Bett fielen. Die gestrige Rückreise von Thüringen nach Berlin und der aufregende Abend bei den Schmitts hatten sie erschöpft.
»Udo quasselt ohne Punkt und Komma. Das hat mich zusätzlich fertiggemacht«, gähnte Ernst und drehte sich auf die Seite. Bald verriet sein leises Schnarchen, dass er eingeschlafen war.
Leni hingegen war hellwach. Sie lehnte sich gegen das Rückenteil ihres Betts und betrachtete Ernst. Im Schein des Mondlichts, das schwach durch den Stoff der dünnen Vorhänge fiel, konnte sie die Konturen seines Gesichts erkennen. Es wirkte entspannt. Nichts ließ auf das schließen, was er hinter seiner Stirn plante. Mit seinen siebenundzwanzig Jahren war er nur drei Jahre älter als sie, und doch bestimmte er ihr Leben mit. Dabei waren sie nicht einmal verheiratet. Dass er sie als meine Frau und sie ihn als meinen Mann vorstellte, war der Situation geschuldet, weil dadurch ihr Zusammenleben leichter wurde. In der prüden Gesellschaft der DDR bekamen Pärchen selten eine Wohnung vermietet, wenn sie nicht verheiratet waren.
Leni schmunzelte, als sie an ihre erste Vermieterin dachte, bei der sie ein möbliertes Zimmer bewohnt hatte. Es war ungemütlich eingerichtet gewesen, mit dunklen, schweren Möbeln. Das Bett hatte Rollen, so dass man es hin und her schieben konnte. Manchmal rollte es von selbst, weil der Boden nicht eben war. Bei Lenis Einzug damals hatte die Frau mit den kleinen Augen sie mit stechendem Blick regelrecht durchbohrt und sie ermahnt, dass sie keinen Herrenbesuch dulden würde. Zum Glück lag das Zimmer im Erdgeschoss. Nach einem halben Jahr fand Ernst jemanden, der ihnen ohne Trauschein ein ehemaliges Wochenendhäuschen mit zwei kleinen Zimmern, einer Kochküche und einem Plumpsklo im Garten vermietete. Seitdem wohnten sie zusammen in der Calvinstraße im Ortsteil Falkensee, im Sperrgebiet gegenüber von Spandau.
Als das Schnarchen von Ernst lauter wurde, strich sie ihm sanft über den Oberarm. Sogleich ließ die Lautstärke nach. Vom ersten Augenblick ihres Kennenlernens an hatte sie instinktiv gewusst, dass sie sich auf ihn verlassen konnte. Auch wenn die Flucht ein Risiko barg und sie nicht wussten, wie es im Westen weitergehen würde, so vertraute sie trotzdem darauf, dass er immer das Beste für sie und ihre zukünftigen Kinder erreichen wollte. Sie war sich sicher, dass er sie beschützen und umsorgen würde.
Leni ließ den Blick durch das Schlafzimmer schweifen. Auch hier waren die Möbel dunkel, schwer und klobig. So wie der Rest der DDR, dachte sie. Trotz ihrer Zweifel, trotz ihrer Ängste spürte sie eine zaghafte Freude in sich auf das, was sie erwartete.
»Im Westen wird alles besser«, murmelte sie, streckte sich aus und wartete, bis der Schlaf sie holte.
Ernst hatte keine Ahnung, wie lang er geschlafen hatte, als ein fürchterlicher Krach ihn aus dem Schlummer riss. Schlaftrunken fuhr er hoch und riss die Augen auf. Gleißendes Licht erhellte das Zimmer. Nur kurz, dann erlosch es, um gleich wieder zu erstrahlen. Das Scheppern von Metall, aufheulende Motorengeräusche, Kettenrasseln und laute Stimmen, deren Worte man nicht verstehen konnte, dröhnten in seinen Ohren. Leni drückte sich an ihn und starrte wie er zum Fenster hinüber.
»Was ist da draußen los?«, wisperte sie.
»Ich habe keine Ahnung. Bleib liegen, ich sehe nach.«
Ernst spürte, wie sein Herz raste. Er schlug die Decke zur Seite, krabbelte aus dem Bett und schlich in gebeugter Haltung zum Fenster hinüber. Mit zittrigen Fingern zog er die beiden Vorhänge einen Spalt auseinander und linste hinaus.
Was er sah, verschlug ihm die Sprache. Er zählte stumm acht Planwagen und zwei Panzerfahrzeuge. Etliche Soldaten, die hin und her rannten, entluden die Fahrzeuge. Leider konnte er nicht erkennen, was sie forttrugen. Doch dann erleuchtete ein Autostrahler die Straße.
»Was siehst du?«, flüsterte Leni.
Ernst brachte kein Wort heraus. In seinem Kopf dröhnte es. Er hätte schreien mögen in diesem Augenblick und wäre am liebsten hinausgelaufen, um die Soldaten aufzuhalten und die Lkw fortzuschicken. Doch stattdessen hockte er da und kämpfte mit den Tränen.
»ERNST! WASISTLOS?«, fragte Leni hysterisch.
Er schluckte mehrmals. »Hätten wir doch nur die letzte S-Bahn verpasst, dann wäre es anders gekommen. Wir hätten bei den Schmitts bleiben sollen. Einfach drüben bleiben und nicht mehr hierher zurückkehren.« Seine Stimme glich einem Hauchen. Sie war kraftlos, fast unhörbar.
»Wie meinst du das?« Leni kam aus dem Bett, kniete sich neben ihn und öffnete den Vorhang etwas weiter. Als sie erkannte, was sich in ihrer Straße abspielte, schlug sie sich die Hand vor den Mund. »Um Himmels willen, das kann nicht wahr sein. Das können sie nicht machen!« Voller Entsetzen und zugleich ungläubig sah sie Ernst an.
»Es ist zu spät, Leni. Sie ziehen Stacheldraht um unser Leben.«
Kapitel 1
Dezember 2013
Ich knabbere am letzten Weihnachtskeks, den ich in der Plätzchendose gefunden habe. Obwohl er einen feinen Zimtduft verströmt, schmeckt er mir nicht. Ich seufze und lege den Rest zurück. Jedes Jahr dasselbe. Kaum sind die Feiertage vorbei, ist der Weihnachtszauber verflogen und mit ihm der Appetit auf die Köstlichkeiten, die es ab der Adventszeit zu naschen gibt. Während ich mir an der Jeans die Krümel von den Fingern wische, schaue ich mich in meinem Esszimmer um. Die zwei Tische stehen noch immer zu einer langen Tafel zusammengeschoben. Nicht zu glauben, dass das große Weihnachtsessen drei Tage her ist, denke ich und grinse bei der Erinnerung an den Heiligen Abend. Auch dieses Mal war das Treffen mit meinen Geschwistern und ihren Familien laut und fröhlich gewesen. Ich entdecke Fichtennadeln auf den Fliesen.
»Bis zum 3. Januar darfst du stehen bleiben, dann fliegst du«, murmele ich dem Weihnachtsbaum zu.
Dabei kann er nichts dafür, dass er nadelt. Wegen seiner Größe muss er in der Nähe des warmen Kachelofens stehen, da dort die Decke höher ist als in den anderen Räumen. Doch selbst wenn der Baum seine Nadeln nicht verlieren würde, würde ich ihn Anfang Januar draußen auf die Terrasse stellen. Dann wird auch die Weihnachtsdekoration in ihre Kisten gepackt, denn für mich beginnt gleich nach Silvester der Frühling. Bunte Primeln und Tulpen sollen dann mein Haus schmücken und das Grau des Winters vertreiben.
Mein Blick streift die Engelsfigur auf dem Kamin, als das Telefon klingelt. Ich suche den Hörer, der wie immer nicht auf seiner Ladestation liegt. Gerade noch rechtzeitig, bevor sich der Anrufbeantworter einschaltet, finde ich das Telefon unter der Fernsehzeitschrift. Hastig drücke ich auf den kleinen grünen Knopf und melde mich.
»Hat Mutti dich erreicht?«, höre ich die ernste Stimme meiner Schwester am anderen Ende der Leitung.
Manuela hat mich nicht begrüßt, bemerke ich sofort.
»Nein, warum?«, frage ich stirnrunzelnd.
»Vati geht es nicht gut. Sie werden morgen nach Hause fliegen.«
Meine Hand umschließt den Hörer fester. »Was heißt das?«
»Soviel ich verstanden habe, hat Vati blaue Lippen und scheint verwirrt zu sein. Mutti schiebt Panik, dass sie ihn nicht mehr nach Deutschland bekommt, wenn es ihm schlechter gehen sollte. Ich habe ihnen gerade zwei Flüge gebucht und veranlasst, dass Rocky in seiner Hundetasche zwischen ihren Beinen stehen kann. Zum Glück hat Mutti noch eine Tablette, um ihn ruhigzustellen. Kannst du sie vom Flughafen abholen? Ich muss morgen arbeiten.«
»Ja, klar. Schick mir ihre Ankunftszeit. Hat Mutti eine Vermutung, was mit Vati sein könnte?«
»Sie hat nichts angedeutet.«
»Ich rufe bei ihrem Hausarzt an und lasse mir morgen für Vati einen Termin geben.«
»Gute Idee. Nicht, dass wir an Silvester einen Notfall haben. Schließlich wird er nächstes Jahr achtzig.«
»Hoffentlich geht es jetzt nicht los«, flüstere ich.
»Dasselbe habe ich auch gedacht, als der Anruf kam. Ich gebe Marko Bescheid, damit er ihre Wohnung einheizt.«
Wieder einmal zeigt sich, dass es ein weiser Entschluss war, dass unser Bruder unseren Eltern ihr Wohnhaus abgekauft hat. Ihnen reicht die kleine Einliegerwohnung in dem Haus, weil sie seit ihrem Rentendasein die Wintermonate auf Mallorca verbringen. Da Markos Wohnung über der ihren liegt, kann er unkompliziert nach dem Rechten sehen, wenn sie nicht da sind.
»Was machen wir …«, beginnt Manuela, doch ich unterbreche sie:
»Weißt du, was die Menschen im Mittelalter glaubten?«
»Woher soll ich das wissen? Du bist die mit den Weisheiten.«
»Ich kann nichts dafür. Manchmal lese ich so was bei meinen Recherchen und merke es mir. So was kann nicht schaden«, erkläre ich. »Und roll nicht mit den Augen!«
»Woher willst du wissen, dass ich das tue?«
»Ich kenne dich, Schwesterherz. Dich interessieren meine schlauen Sprüche nicht die Bohne«, erwidere ich schmunzelnd.
»Blödsinn. Das bildest du dir ein.« Ich kann ihr unterdrücktes Glucksen hören.
»Du rollst immer mit den Augen, wenn ich was Kluges von mir gebe.«
»Ertappt … aber nur ein kleines bisschen.«
»Alles okay, ich habe mich daran gewöhnt. Als ältere Schwester hat man es nicht leicht mit zwei jüngeren Ungeheuern«, lache ich.
»Wir mit dir auch nicht«, erwidert Manuela ebenfalls lachend. »Was macht dein neues Kochbuch? Hat es schon einen Titel?«
»Nein, noch nicht. Mein Arbeitstitel Blick in den Sterne-Kochtopf gefällt dem Verlag nicht so richtig. Gleich im neuen Jahr werden wir darüber diskutieren.«
»Hast du schon beim großen Meister vorgesprochen?«
»Stell dir vor, Ende Januar will er mich kontaktieren, um einen Termin mit mir abzusprechen.«
»Großartig! Bitte, bitte entlock ihm das Rezept von seiner einzigartigen Mousse au Chocolat und nimm es in dein Buch mit auf, und das von der Soup …?«
»Komm auf den Punkt, Schwesterchen! Ich weiß, was du eigentlich willst«, unterbreche ich lachend ihren Redefluss.
»Ach ja?«, frotzelt sie.
»Du willst nur, dass ich euch zum Probeessen einlade, wenn ich seine Rezepte für die Fotos nachkoche«, unterstelle ich ihr amüsiert.
»Wir sind ja wohl die dankbarsten Probeesser, die du finden kannst.«
»Okay, du hast gewonnen. Wenn es so weit ist, gebe ich euch Bescheid.«
»Dann darfst du mir jetzt auch die Weisheiten von früher mitteilen.«
»Endlich«, stöhne ich theatralisch und gebe mein Wissen preis. »Angeblich erhält jeder Mensch bei seiner Geburt ein Säckchen mit Glück. Das eine ist mit mehr, das andere mit weniger Glück gefüllt. Wenn jemand stirbt, ist sein Glückssäckchen aufgebraucht.«
»Aha!«
»Manuela, jetzt tu nicht so. Wir müssen nur fest daran glauben, dass die Säckchen unserer Familie randvoll sind. Du sagst doch selbst immer, dass wir Glückskinder sind.«
»Ja, das sind wir auch. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl dieses Mal.«
»Wir müssen abwarten, was bei der Untersuchung herauskommt. Ich rufe seinen Arzt gleich an.«
»Ja, mach das. Wir sprechen uns, wenn Vati und Mutti zurück sind. Bis dann, Britta.«
»Okay, bis dann!«
Kaum habe ich aufgelegt, verkrampft sich etwas in mir. Eben war das Leben noch so leicht, so unkompliziert. Doch nach diesem Anruf scheint alles anders zu sein. Ich lasse mir vom Hausarzt meiner Eltern einen Termin für den morgigen Nachmittag geben, damit mein Vater gleich nach seiner Ankunft untersucht wird. Manuelas Skepsis färbt auf mich ab. Was, wenn es jetzt tatsächlich losgeht und uns das Glück verlässt? Was, wenn unser Vater schwerkrank ist und sich von jetzt auf gleich unser aller Leben ändert? Was ist, wenn unser Säckchen ein Loch bekommen hat und das Glück herausrieselt?
Ich kann mich auf nichts konzentrieren. Meine Gedanken kreisen nur noch um meine Eltern. Wie glücklich beide waren, als sie sich das Apartment auf Mallorca leisten konnten. Der Ruhesitz in der Sonne sollte die Belohnung für ein hartes und arbeitsreiches Leben mit vielen Entbehrungen sein. Seitdem genossen sie das halbe Jahr auf der Sonneninsel und die andere Hälfte in Deutschland. Sollte dieses Leben nun zu Ende gehen? Hoffentlich schaffen sie den Rückflug, denke ich und setze mich ins Esszimmer. Meine Finger trommeln auf der Tischdecke, die das Geräusch verschluckt.
Es wird schon alles gut gehen, denke ich. Sicher hat Vati nur einen Schwächeanfall. Wir sind doch alle Glückskinder! Unsere Säckchen sind randvoll. Sicherheitshalber klopfe ich dreimal auf das Holz der Tischplatte.
Kapitel 2
Januar 2014
Am liebsten schreibe ich mitten in der Nacht, wenn meine Familie schläft. Zwar habe ich die Fähigkeit, im wildesten Trubel an meinen Kochbüchern zu arbeiten, und Krach stört mich ebenfalls nicht, denn ich kann mich komplett aus dem Hier und Jetzt ausklinken. Ablenkung hingegen ist tödlich für meine Kreativität. Und diese lauert tagsüber überall. Entweder klingelt das Telefon, oder der Postbote oder der Staubsauger erinnert mich daran, dass ich putzen müsste, oder die Waschmaschine piepst, weil die Wäsche fertig ist. Nachts hingegen hält mich nichts und niemand auf. Dann sitze ich mehrere Stunden ohne Unterbrechung an meinem Schreibtisch und recherchiere Geschichten aus fremden Ländern, die zu den Rezepten in meinen Kochbüchern passen.
Das war auch gestern Abend mein Plan, als ich mir den Wecker stellte und er mich um halb drei aus dem Schlaf riss. Aber anstatt in Fachbüchern über die kulinarischen Geheimnisse der Côte d’Azur zu lesen, liege ich im Bett und denke an meinen Vater im Krankenhaus. Gestern Nachmittag hatte man ihm drei der fünf nötigen Stents gesetzt, da seine Halsschlagader verstopft war und sich gänzlich zu verschließen drohte. Nur weil sein Hausarzt ihn direkt in die Spezialklinik eingewiesen hatte, konnte die Gefahr eines Schlaganfalls gebannt werden.
Ich lächle, als ich daran denke, wie er bei unserem Besuch nach dem Eingriff putzmunter im Bett gesessen und seine Bettnachbarn unterhalten hat. Mein Bruder hatte uns grinsend angesehen und geflüstert: »Er hat neue Opfer gefunden, bei denen er seine Geschichten zum Besten geben kann.« Da unser Vater viele Jahre für eine weltweit agierende Firma im Ausland tätig war, weiß er interessante Geschichten zu erzählen; vor allem aus Russland, wo er bis zu seiner Rente arbeitete. Wir kennen seine Storys in- und auswendig und sind froh, wenn er neue Zuhörer findet. Oft sind Fremde fasziniert von seinen Erlebnissen an fernen Orten, zumal er das Talent hat, spannend und interessant zu berichten.
Ich glaube, in diesem Augenblick waren wir alle erleichtert, die alten Russlandgeschichten zu hören. Sind sie doch der Beweis dafür, dass es unserem Vater gut zu gehen scheint. »Ich gebe euch Brief und Siegel, Vati wird die ganze Station unterhalten, sobald er wieder aufstehen darf«, höre ich noch meine Schwester sagen.
»Wir sind eben Glückskinder«, murmle ich und schließe die Augen in der Hoffnung einzuschlafen.
Doch ich bin hellwach und starre nach einer Weile wieder in unser dunkles Schlafzimmer. Vielleicht hilft mir heiße Milch, überlege ich und schiebe mich vorsichtig über die Bettkante, damit mein Mann nicht wach wird. Er ist erst spät ins Bett gekommen, weil er noch am PC arbeiten musste. Manchmal wäre ich froh, er wäre im Angestelltenverhältnis und hätte nach acht Stunden Arbeit Feierabend. Doch sein Herz schlägt für die Selbstständigkeit, und das seit fünfzehn Jahren. Zum Glück sind unsere Kinder erwachsen, so dass sie den Vater nicht mehr so oft brauchen. Da beide in der Nähe studieren, wohnen sie noch bei uns, worüber ich sehr froh bin.
Auf Zehenspitzen schleiche ich an ihren Zimmern vorbei und die Treppe nach unten in die Küche. Während ich darauf warte, dass die Milch heiß wird, schaue ich zum Küchenfenster hinaus in den Garten. Im Schein der Straßenlaterne, deren Lichtkegel bis über unsere Hecke reicht, kann ich erkennen, wie der Wind weiße Flocken vor sich hertreibt. O nein, nicht noch mehr Schnee, schreit es in mir. Sofort beschließe ich, morgen auf dem Weg ins Krankenhaus am Blumenladen anzuhalten und bunte Primeln zu kaufen, damit wenigstens im Haus der Frühling einzieht. Als ich aus den Augenwinkeln sehe, wie die Milch hochkocht, ziehe ich den Topf von der Herdplatte. Süßes soll die Nerven beruhigen, denke ich und lasse einen Löffel Honig in die Tasse fließen. Und noch einen, das kann nicht schaden. Dann gieße ich die heiße Milch dazu und verrühre beides. Meine Hände umfassen das Porzellan. Die Wärme fließt durch meine Finger. Nachdem ich ein paar kleine Schlucke getrunken habe, bilde ich mir ein, mich zu entspannen.
Bis ich wieder müde werde, will ich nun doch noch arbeiten und mir ein paar Notizen machen. Zufrieden mit dem Entschluss gehe ich in mein Arbeitszimmer. Doch anstatt meinen Laptop aufzuklappen, blättere ich in einer Frauenzeitschrift und nippe dabei an der Milch. Als die Tasse leer ist, stelle ich sie auf die Glasplatte meines Schreibtisches und schiele schuldbewusst zu meinem Mac. Heute wird das nichts mehr mit uns beiden, denke ich und husche zurück ins Bett. Ich ziehe mir die Bettdecke bis zu den Ohren hoch. Schon fallen mir die Augen zu.
Im Schlaf spüre ich, wie mich jemand anstupst. Blinzelnd öffne ich erst das eine, dann das andere Auge. Tageslicht fällt durch die Jalousienritzen. Auf der Bettkante sitzt meine Tochter.
»Musst du nicht zur Uni?«, frage ich verschlafen und strecke mich.
»Doch, ich bin schon auf dem Weg. Du sollst Oma zurückrufen.«
Hastig setze ich mich auf. »Ist was mit Opa?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Hat sie nicht gesagt.«
»Ach, Kind, du hättest sie fragen sollen«, ermahne ich sie sanft, werfe die Zudecke zurück und stehe auf. »Ist Papa schon unterwegs?«, frage ich mit einem Blick auf die leere Bettseite.
Sie nickt. »Es ist nach neun!«
»Was? Ich habe total verschlafen. Um zehn will Oma hier sein, damit wir zusammen ins Krankenhaus fahren. Sicher hat sie deshalb angerufen.«
»Hast du wieder die Nacht durchgearbeitet?«
»Leider nein. Ich war zwar auf, aber geschrieben habe ich nicht einen Satz. Opa ging mir nicht aus dem Kopf«, gestehe ich zerknirscht.
»Mach dir nicht zu viele Gedanken, Mama. Du wirst sehen, wenn Opa die restlichen zwei Stents gesetzt bekommt, ist er wieder fit wie ein Turnschuh. Er überlebt uns alle«, lacht meine Tochter und küsst mich auf die Wange. »Bis heute Nachmittag«, verabschiedet sie sich und ist auch schon verschwunden.
Gähnend stöpsle ich mein Smartphone vom Ladegerät und wähle die Nummer meiner Mutter.
»Guten Morgen, Mutti, ich habe verschlafen …«, beginne ich, doch sie unterbricht mich:
»Wir müssen sofort ins Krankenhaus fahren. Die Nachtschwester hat mich schon in aller Herrgottsfrühe angerufen …« Ihre Stimme überschlägt sich fast.
»Mutti, du musst langsam sprechen. Ich verstehe kein Wort«, versuche ich, sie zu beruhigen.
Nun höre ich meine Mutter weinen. »Es ist schrecklich, Britta. In der Nacht hat euer Vater die Mitbewohner im Zimmer übelst beleidigt und sich nicht beruhigen lassen. Deshalb hat man ihn in ein anderes Krankenzimmer gebracht, wo er alleine liegt. Doch anstatt zu schlafen, hat er sich die Infusionsschläuche aus dem Arm gerissen und sich in eine dunkle Zimmerecke verkrochen. Als der Krankenpfleger ihn ins Bett zurückbringen wollte, wurde euer Vater panisch und schrie: ›Stasi! KGB!‹ Er ist sogar mit einem Stuhl auf den Pfleger losgegangen. Anscheinend hat er ihn für einen feindlichen Spion gehalten … Kind, was sollen wir nur tun?«, schluchzt sie.
Ich plumpse zurück auf meine Matratze. Meine Hände und Füße werden eiskalt. Was hat das zu bedeuten? Ich wische mir mit der Hand durchs Gesicht und versuche, einen klaren Gedanken zu fassen. »Ich sage Manuela und Marko Bescheid. Anschließend müssen wir sofort ins Krankenhaus fahren.«
»Du musst mich abholen. Ich kann unmöglich zu dir fahren. Mir ist hundeelend wegen der Sache«, erklärt sie.
Ich nicke, als mir bewusst wird, dass sie meine Zustimmung nicht sehen kann. »Kein Problem, Mutti. Ich mache mich fertig und komm dich holen.«
»Ja, mach das! Bis gleich.«
»Okay, ich beeile mich. Nimm ein paar von deinen Beruhigungstropfen«, schlage ich noch schnell vor und lege auf.
Bevor ich unter die Dusche springe, rufe ich meine Schwester an. Als ich sie nicht erreiche, wähle ich die Nummer meines Bruders. Zum Glück hebt er ab. Ich erzähle ihm, was passiert ist.
»Das ist typisch Mutti. Sie schiebt uns die Verantwortung zu, indem sie von unserem Vater und nicht von ihrem Mann redet«, schimpft er zwar, doch sein Ausbruch ist nur Zeichen seiner Hilflosigkeit, da er auf der Arbeit sitzt und sich um nichts kümmern kann.
»Mach dir keine Gedanken, Marko, ich werde Mutti ins Krankenhaus begleiten und mit dem Arzt sprechen«, nehme ich ihn aus der Verantwortung.
»Danke, Schwesterherz«, meint er hörbar erleichtert.
»Kannst du Manuela Bescheid geben, was los ist? Ich habe sie nicht erreichen können eben, kann aber auch nicht länger warten, denn ich muss Mutti abholen und vorher noch duschen.«
»Ja, kein Problem. Melde dich, wenn ihr zurück seid.«
»Mach ich«, verspreche ich, lege auf und eile ins Bad.
Kapitel 3
Mittwoch, 2. August 1961
Ernst klemmte sich die braune Lederaktentasche zwischen die Beine und zündete sich eine Zigarette an. Die erste Chesterfield nach der Arbeit schmeckt am besten, dachte er und blies den Rauch weit von sich. Er hatte keine Eile. Seine S-Bahn fuhr erst in dreißig Minuten ab. Entspannt schaute er an der Überdachung des Bahnsteigs vorbei zum Himmel hinauf. Den Sommertag trübte keine Wolke. Immer noch kein Regen in Sicht, dachte er, als er seinen Arbeitskollegen Willi auf sich zueilen sah. Irgendetwas an dessen Blick gefiel ihm nicht. Auch schien er unter der sonnengebräunten Gesichtshaut bleich zu sein.
Sein Kumpel blieb dicht vor ihm stehen und sah sich nach allen Seiten um. Ernsts Blick folgte seinem. Ein Hund pinkelte an eines der abgestellten Fahrräder, Menschen hetzten an ihnen vorbei, ein Pärchen konnte sich nicht voneinander lösen. Niemand schien von den beiden Männern Notiz zu nehmen.
»Hast du das von den Kellers gehört?«, raunte sein Kumpel ihm zu.
Ernst legte die Stirn in Falten und schüttelte den Kopf.
»Sie haben sie vor zwei Tagen mitten in der Nacht abgeholt.«
Ernsts Stirnfurchen vertieften sich. Albert Keller arbeitete im selben Metallverarbeitungsbetrieb wie er und Willi. Im Gegensatz zu Ernst, der erst knapp zwei Jahre dort tätig war, hatte Albert in dem Betrieb bereits gelernt. »Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst, Willi.«
Sein Kumpel nahm ihm die Zigarette aus der Hand und zog mehrmals daran, ohne den Rauch auszustoßen. Erst als er den Filter zu Boden fallen ließ und die Glut mit dem Absatz austrat, nebelte der Rauch seinen Kopf ein. »Sie haben die gesamte Familie abgeholt und weggeschafft«, verriet er leise.
Ernst war irritiert. Die Kellers wohnten nur einige Straßen von ihnen entfernt. Er hätte doch mitbekommen, wenn sie nicht mehr da wären. »Wie meinst du das? Wohin sind sie gebracht worden, und wer hat sie abgeholt?«
»Hast du nichts darüber gehört auf der Arbeit?«, fragte Willi erstaunt.
»Ich war allein in der Kontrolle heute.«
»Vorgestern Nacht sind zwei Planwagen vorgefahren. Kaum standen die Lkw, sprangen mehrere Soldaten von den Pritschen. Sie müssen die Wohnung der Kellers regelrecht gestürmt und das Ehepaar aus den Betten geholt haben. Ohne Erklärungen wurden sie aufgefordert, nur das Notwendigste einzupacken. Selbst Klagen, Betteln und Schimpfen hat den Kellers nicht geholfen. Noch in derselben Stunde mussten sie mit den fünf Kindern ihr Heim verlassen.« Willi fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar. »Wie Verbrecher hat man sie aus ihrem Haus geführt. Die Kinder sollen laut geweint haben.«
»Warum hat man sie fortgebracht?«, fragte Ernst geschockt.
»Angeblich steht ihr Haus zu dicht am Grenzverlauf.«
»Woher weißt du das alles so genau?«
»Es war Gespräch bei uns auf der Schicht, gestern und heute.«
Hinter Ernsts zerknitterter Stirn fing es an zu klopfen, als er sich bewusst wurde, was das bedeutete. »Sie werden uns Grenzgänger fortschaffen, weil wir das Leben im Westen kennen und weil sie Angst haben, dass wir einen Aufstand anzetteln könnten.«
»Du faselst dummes Zeugs. Warum sollten wir das tun?«
»Weil die Mauer kommt. Sie werden sie bauen und uns damit vom Westen abschneiden. Dann rauchst du keine Chesterfield mehr, sondern CASINO- oder CLUB-Zigaretten. Statt Bohnenkaffee werden wir dann Muckefuck trinken«, zischte Ernst.
»Quatsch doch nicht!«, unterbrach ihn sein Kumpel. »Unser Staatsratsvorsitzender, Genosse Ulbricht, hat doch neulich erst gesagt, dass niemand die Absicht hat, eine Mauer zu bauen. Und der muss es wissen, schließlich ist er der mächtigste Mann im Staat«, gab Willi zu bedenken und sah sich erneut um.
»Politikergeschwätz«, entgegnete Ernst, dessen Gedanken hin und her sprangen. »Weiß man, wohin die Kellers gebracht wurden?«
»Einige haben versucht, das herauszufinden, aber ohne Erfolg.«
»Wahrscheinlich hat man sie ins Tal der Ahnungslosen verbannt«, schlussfolgerte Ernst.
»Tal der Ahnungslosen? Wo soll das sein?«
Ernst sah ihn ungläubig an. »So wird das Hinterland genannt, wo man weder Westfernsehen noch Westradio empfangen kann. Dort, wo es keinen Fortschritt gibt und manche ohne fließend Wasser und Strom zurechtkommen müssen. Dort, wo man die Menschen mit zensierten Medien gefügig macht, so dass sie unser Regime nicht hinterfragen. Hast du wirklich noch nie davon gehört?«
Willi verneinte.
»Na ja, eigentlich kein Wunder, dass du das nicht kennst. Du bist in Berlin geboren und aufgewachsen und hast schon immer im Westen gearbeitet. Lass dir gesagt sein, Willi: Je weiter du in unserem Land nach Osten fährst, desto unwissender sind die Menschen. Vor einiger Zeit sagte einer von dort zu mir, dass die Bundesrepublik Deutschland keine zwei Jahre mehr überleben würde, dann hätte die DDR sie eingenommen.«
Willi schüttelte den Kopf. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen dort tatsächlich so denken. Jeder weiß doch, dass der Westen dem Osten weit voraus ist.«
Ernst zuckte mit den Schultern. »Wenn du stets nur Schlechtes über die BRD im Radio hörst und man dir außerdem Lügen auftischt, die du nicht überprüfen kannst, dann glaubst du jedem alles.«
Willi kratzte sich über die Kopfhaut. »Trotzdem glaube ich nicht, dass sie eine Mauer bauen werden. Wie soll das funktionieren? Sie müssten Berlin auch unterirdisch abriegeln und bis zur Kanalisation vordringen, außerdem die Häuser an der Grenze zumauern. Nee, Ernst, so was geht nicht.«
»Denk, was du willst. Ich weiß, dass es so kommen wird. Wenn es tatsächlich stimmt, dass die Kellers fortmussten, weil Albert im Westen gearbeitet hat und ihr Haus zu dicht an der Grenze stand – dann sind Leni und ich die Nächsten, die sie wegbringen werden. Unser Haus liegt ebenfalls im Sperrgebiet, keine hundert Meter von Spandau entfernt.«
»Dort, wo du wohnst, laufen mehr Soldaten rum als im Ostteil der Stadt. Ihr werdet gut überwacht. Da passiert nichts.«
Ernst hörte seinem Kumpel kaum zu. Er wusste, dass sie auf das Unmögliche gefasst sein mussten. Plötzlich zuckte ein Gedanke durch seinen Kopf, den er auf keinen Fall laut aussprechen durfte. Im Grunde durfte er ihn nicht einmal denken. Erschrocken über sich selbst drängte er ihn zurück und beugte sich hastig zur Aktentasche hinunter, die noch immer zwischen seinen Waden klemmte. Er kramte das Päckchen Zigaretten hervor und bot aus der Hocke Willi davon an. Bevor er wieder aufstand, atmete er tief durch. Im selben Augenblick fuhr ihre S-Bahn ein.
Ernst setzte sich mit einem mulmigen Gefühl in das Abteil. Um sich abzulenken, zählte er die Bäume, die auf der Wegstrecke standen. Am ersten Bahnhof im Osten mussten sie aussteigen. Als die Station Albrechtshof in Sicht kam, holte er erleichtert Luft.
Willi und er gingen zum Ausgang des Bahnhofs. Wie jeden Abend wurden die heimkehrenden Ostbürger von Grenzpolizisten erwartet, die ihre Ausweise kontrollierten. Über die Jahre kannte man die unterschiedlichen Gesichter, die sich jede Woche abwechselten. Kaum einer der Polizisten besah sich die Pässe der Männer und Frauen genauer. Sie kannten »ihre« Grenzgänger und winkten sie durch, noch bevor sie den Ausweis in die Höhe hielten. Heute jedoch standen fremde Polizisten am Ausgang. Sie prüften jeden Namen auf Listen und machten hinter manchen einen Haken.
Ernsts Hand mit dem Dokument wurde feucht, feine Schweißperlen bedeckten seine Oberlippe. Wie fast jeden Tag hatte er zwischen dem Hemdstoff und seiner nackten Haut die BILD-Zeitung versteckt. Weil es verboten war, das Tagesblatt in den Osten zu bringen, schmuggelte Ernst die Zeitung unter der Kleidung hinüber. Er wollte Leni damit eine Freude machen, denn sie interessierte sich für die Neuigkeiten, die in der DDR nicht erzählt wurden.
Schon winkte ihn der Grenzpolizist, der besonders grimmig umherschaute, zu sich und befahl: »Den Ausweis!«
Trotz des unfreundlichen Tons versuchte Ernst zu lächeln und hielt den Ausweis vor sich.
»Herr Schimpf und Frau Schande verdienen im Westen und kaufen im Osten. Doch damit ist bald Schluss«, spottete der Polizist und sah grinsend zu seinen Kollegen, die hämisch auflachten.
Ernst tat, als habe er nichts gehört. Schon zu oft hatte er sich ähnliche Beschimpfungen und Beleidigungen von fahnentreuen DDR-Bewohnern anhören müssen. Mancherorts waren an Geschäften sogar Propagandaplakate angebracht, auf denen zu lesen stand, dass Ostbürger, die im Westen arbeiteten, in diesem Laden »nicht zuvorkommend bedient werden«. Sogar in seinem Bekanntenkreis waren einige neidisch, weil er und Leni sich den guten Kaffee aus dem Westen leisten konnten und nicht den Kaffeeverschnitt aus dem Osten trinken mussten, der aus gerösteten Eicheln hergestellt wurde. Durch den günstigen Devisenumtausch bekamen sie fünf Mark Ost für eine Mark West. Dadurch konnten sie Dinge erwerben, die man sich mit einem Ostgehalt nicht kaufen konnte.
»Was ist in der Tasche?«, wollte der Volkspolizist wissen und zeigte auf die Aktentasche.
»Brotdose und Thermoskanne.«
»Herzeigen!«
Ernst holte die beiden Utensilien hervor. Der Polizist zog eine Augenbraue hoch, machte einen Haken auf die Liste, gab Ernst den Ausweis zurück und winkte ihn durch.
Als Ernst ihm den Rücken zudrehte und zum Ausgang ging, trat er fest auf.
Vor dem Bahnhof wartete Willi, der ihm nägelkauend entgegensah. »Warum haben die unsere Namen auf einer Liste stehen?«
»Vielleicht, weil der Staat wissen will, wer Grenzgänger ist in dem Bezirk.«
»Diese Polizisten habe ich noch nie hier gesehen.«
»Glaubst du jetzt endlich, dass die Mauer kommt? Sie sperren uns dahinter ein, Willi«, zischte Ernst.
»Nee, das glaube ich immer noch nicht. So etwas machen sie nicht mit uns«, erwiderte sein Kumpel entschlossen.
Ernst wusste, dass jedes weitere Wort darüber unnötig war. Willi war in seiner Meinung gefangen. Erneut schwirrte ihm der Gedanke durch den Kopf, den er vorhin zurückgedrängt hatte.
Dieses Mal ließ er ihn zu.
Kapitel 4
Januar 2014
Als meine Mutter und ich durch die Drehtür das Innere der Klinik betreten, schlägt uns ein Gemisch aus Desinfektionsmittel und Bratendunst, der aus der Kantine im Souterrain die Treppe hochschwappt, entgegen.
»Hier wird wohl schon das Mittagessen gekocht«, versuche ich zu spaßen.
»Da vergeht einem ja der Appetit«, sagt meine Mutter und verzieht das Gesicht. Wir folgen der orangefarbenen Linie zum Aufzug und fahren in den dritten Stock. Auf dem Gang der Kardiologie kommt uns ein Pfleger entgegen, den wir nach dem Zimmer meines Vaters fragen.
»Wir haben ihm ein leichtes Beruhigungsmittel verabreicht. Er schläft tief und fest. Deshalb wäre es besser, wenn Sie am Abend wiederkommen würden«, meint er freundlich.
»Wir haben gehört, was passiert ist letzte Nacht. Wäre es möglich, mit seinem behandelnden Arzt zu sprechen?«, bitte ich kleinlaut.
Der Mann lächelt. Er scheint meine Not zu erahnen. »So etwas geschieht öfter«, versucht er, uns zu trösten, und begleitet uns zum Arztzimmer.
Dort treffen wir auf einen sympathisch aussehenden Mediziner, dessen freundliche Art die Peinlichkeit aus unserem Treffen nimmt. Nachdem wir vor seinem Schreibtisch Platz genommen haben, erklärt er:
»Diese Wesensänderung ist nicht selten nach solch einem Eingriff. Wir nennen es ›Durchgangssyndrom‹. Deshalb müssen Sie sich nicht sorgen. Dieses Phänomen entsteht manchmal durch die Kombination der unterschiedlichen Medikamente, die wir verbreichen müssen – wie Schmerzmittel, Narkosemittel und andere. Dieser Medikamentencocktail kann Symptome wie Gedächtnis- und Denkstörungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und sogar völlige Verwirrung hervorrufen. Es kann innerhalb weniger Stunden nach dem Eingriff auftreten, manchmal aber auch erst nach einigen Tagen. Ihr Vater beziehungsweise Ihr Ehemann ist also kein Einzelfall. Damit seine Unruhe und die Wahnvorstellungen verschwinden, haben wir ihm Neuroleptika gespritzt. Wie Sie schon wissen, schläft er momentan.« Dann schlägt er uns vor: »Es wäre gut, wenn Sie später noch einmal vorbeikommen, damit er sieht, dass alles in Ordnung ist.«
»Jetzt geht es uns besser, nicht wahr, Mutti?«, frage ich sie. Als ich zu ihr blicke, nickt sie gequält.
»Morgen sieht die Welt schon besser aus«, versucht der Arzt, sie aufzumuntern. Dann verabschieden wir uns und verlassen das Zimmer.
Auf der Heimfahrt sehe ich ihre verkrampften Hände in ihrem Schoß. »Mach dir keine Sorgen, Mutti. Der Arzt hat Vatis Verhalten logisch erklärt.«
Statt zu antworten, starrt sie aus dem Autofenster.
Am Nachmittag rufe ich sie an, um zu fragen, wie es ihr geht und wann ich sie abholen soll.
»Kannst du allein zu Vati fahren? Ich habe rasende Kopfschmerzen und möchte früh zu Bett gehen.«
»Ja, das mache ich. Hast du schon mit Marko geredet?«
»Er kommt nachher zu mir. Dann werde ich ihm das sagen, was uns der Arzt erklärt hat. Marko kann anschließend Manuela informieren.«
»Gut. Dann fahre ich später zu Vati. Ich ruf dich morgen an, damit ich dich nachher nicht wecke, falls du schon schläfst.«
Als keine Antwort kommt, sage ich sanft: »Mutti, alles wird gut. Du wirst sehen, sobald Vati zuhause ist und die Medikamente wieder aus seinem Körper draußen sind, wird alles wie immer sein.«
»Dein Wort in Gottes Ohr«, höre ich ihre leise Stimme.
»Ich melde mich morgen!«, verspreche ich erneut und lege auf.
Gegen 19 Uhr fahre ich wieder in die Klink, um nach meinem Vater zu sehen.
»Wo ist deine Mutter?«, will er wissen, als ich ohne sie an sein Bett trete. Sein bleiches Gesicht, das von seinem weißen Haar eingerahmt ist, scheint in der faden Bettwäsche, in der er liegt, zu verschwinden. Nur seine Pupillen stechen wie schwarze Knöpfe aus dem Weiß hervor.
»Wir wollten dich heute Morgen besuchen, Vati. Da du tief geschlafen hast und wir dich nicht wecken wollten, sind wir wieder heimgefahren. Mutti geht es nicht gut, deshalb hat sie sich hingelegt«, erkläre ich ihm einfühlsam.
»Sie soll auf sich aufpassen«, flüstert er mir erregt zu.
»Du musst dich nicht sorgen, Vati. Manuela, Marko und ich geben auf Mutti acht.« Ich nehme seine Hand, deren Fingerknöchel sich weiß unter der wie durchsichtig wirkenden Haut abzeichnen, in die meine. »Geht es dir besser? Der Arzt hat erzählt, dass du verwirrt warst.«
Sein Blick verändert sich. Mit den Augen wandert er unruhig hin und her, als ob er den Raum abscannt. »Können sie uns hören?«, murmelt er und krallt sich an meinem Finger fest.
»Wen meinst du?«
»Frag nicht so dumm! Die Leute von der Staatssicherheit!«, schimpft er nun.
»Vati, hier sind keine Männer von der Stasi«, erwidere ich irritiert.
»Natürlich sind sie hier. Sie verstecken sich. Ich habe letzte Nacht deutlich ihre Schatten erkannt, als sie auf dem Dach des Gebäudes gegenüber gelegen und mich beobachtet haben«, wispert er und deutet zum Fenster hinüber.
»Das hast du dir eingebildet. Der Arzt hat erklärt …«, beginne ich und verstumme wieder, als ich bemerke, dass mir mein Vater nicht zuhört.
Stattdessen murmelt er Unverständliches, hebt den Kopf leicht an und späht über meine Schulter zur weit offen stehenden Zimmertür. »Glaub mir, diese Spitzel sind überall. Dabei haben wir niemandem erzählt, dass wir fliehen wollen. Nicht einer Menschenseele haben wir etwas verraten.«
Ich hätte beinahe laut aufgelacht, da die Situation dermaßen grotesk ist, dass ich schon glaube, mein Vater würde sich einen Spaß mit mir erlauben. Doch sein ängstlicher Blick verdeutlicht mir, dass er selbst glaubt, was er sagt. Um ihn nicht noch mehr zu verwirren, spiele ich mit, auch wenn es mich Kraft kostet, ruhig zu bleiben.
»Wohin wollt ihr fliehen?«, frage ich sanft. Zwar ahne ich, wovon er redet, doch um keine falschen Schlüsse zu ziehen, will ich es von ihm selbst hören.
»Das weißt du doch«, erregt er sich. Dann legt er sich zurück in sein Kissen und flüstert: »In den Westen.« Er sieht mich verschwörerisch an und scheint auf meine Reaktion zu warten.
»Es gibt keinen Grund zu fliehen«, versuche ich, ihn zu beruhigen.
»Was redest du? Sie wollen eine Mauer bauen! Bis dahin müssen wir drüben sein.«
Ich kann kaum mehr meinen Atem kontrollieren. Da mein Vater meine rechte Hand nicht loslassen will, ziehe ich mit der linken umständlich einen Stuhl zu mir ans Bett. Obwohl er schwach ist, quetscht sein Griff meine Hand zusammen. Ich versuche, seine Finger von meinen zu lösen, doch er lässt nicht locker und zieht mich dicht zu sich heran.
»Lenichen! Hör gut zu! Du musst keine Angst haben. Ich werde dich beschützen. Wir müssen uns nur eine Leiter besorgen, mit der wir aus dem Fenster steigen können. Dann können sie uns nichts mehr anhaben, und wir sind in Sicherheit«, flüstert er und blickt erneut zum Klinikfenster hinüber.
Meine Augen weiten sich ungläubig. Mein Vater hält mich für seine Frau – meine Mutter. Ich überlege kurz, wie ich reagieren soll. Da ich ihn nicht aufregen will, entscheide ich, mir nichts anmerken zu lassen, und spiele das Spiel mit.
»Ernst …«, sage ich mit zittriger Stimme, »… das ist ein guter Plan. Aber zuerst müssen wir uns ausruhen, sonst schaffen wir die Strecke nicht bis zur Grenze.«
Mein Vater kneift die Augen zusammen und überlegt. Schließlich stimmt er mit einem Nicken zu. »Du hast recht, Leni. Morgen werde ich eine Leiter stibitzen, und dann geht es los.«
Während ich meinem Vater über die Hand streiche, wie es sonst meine Mutter tut, klopft mir das Herz schmerzhaft unter den Rippen. Diese Situation ist so unwirklich.
Kurz darauf spüre ich, wie sich sein Griff lockert. Mein Vater ist eingeschlafen. Vorsichtig ziehe ich meine Hand aus seiner. Bebend streiche ich ihm das Haar zurück und hauche ihm einen Kuss auf die Stirn. Auf zittrigen Knien gehe ich zu meinem Auto und fahre nach Hause.
Kapitel 5
Freitag, 4. August 1961
Leni drückte sich das Geschirrhandtuch gegen die Brust, mit dem sie sich die Hände abtrocknen wollte. Sie musste sich gegen die Küchenanrichte lehnen, da sie glaubte zu schwanken.
»Du hast was?«, fragte sie, damit ihr Mann das Gesagte wiederholte.
»Ich habe mich krankschreiben lassen.«
»Du bist kerngesund.«
»Leni, sie werden uns Grenzgängern die Ausweise abnehmen …«
»Das weißt du nicht.«
»Doch, das weiß ich. Denk an die Kellers. Sie waren die Ersten, die sie ins Hinterland verfrachtet haben.«
Leni lief ein Schauer über den Rücken. Seit Ernst ihr vom Schicksal der Familie erzählt hatte, konnte sie kaum noch an etwas anderes denken. »Was ist, wenn jemand dich sieht und deinem Kolonnenführer meldet, dass dir nichts fehlt? Sie werden dich fristlos entlassen, dann bekommst du nicht einen Pfennig mehr.«
»Jetzt beruhig dich. Mich wird schon niemand anschwärzen. Außerdem weiß keiner hier, dass ich krankgeschrieben bin. Wichtig ist, dass sie mir den Ausweis nicht wegnehmen können.«
»Falls du recht haben solltest, werden sie ihn dir früher oder später sowieso abnehmen.«
»Dann besser später«, spaßte ihr Mann, doch Leni war nicht zum Lachen zumute.
»Glaubst du wirklich, dass sie die Grenze dichtmachen?«
»Für mich ist das so sicher wie das Amen in der Kirche.«
»Was sollen wir dann machen, Ernst? Wo willst du arbeiten? Hier im Osten wirst du sicherlich keine so gut bezahlte Stelle bekommen wie im Westen. Mein Gehalt in der PGH reicht für uns beide nicht aus.« Leni konnte nicht verhindern, dass ihre Stimme vorwurfsvoll klang. Sie war zwar die Leiterin eines der fünf Friseurgeschäfte der Produktionsgenossenschaft des Handwerks, die vor knapp drei Jahren unter dem Namen PGHFriseurCharmant gegründet worden waren, aber sie verdiente nicht annähernd so viel wie ihre Kolleginnen im Westen.
»Leni …«, hörte sie ihren Mann sagen. Sie schaute zu ihm. »Wir sollten nach Westberlin fliehen«, erklärte er schwach.
Sie glaubte sich verhört zu haben und schaute ihn ungläubig an. »Was sagst du?«
»Wir sollten in den Westen fliehen«, wiederholte er, doch dieses Mal mit fester Stimme und entschlossen.
Leni forschte in seinem Gesicht. Seine Miene bestätigte ihre Vermutung. »Du willst tatsächlich fliehen«, wisperte sie. »Wie stellst du dir das vor? Meine Schwester lebt mit ihrer Familie in Ostberlin, mein Bruder und meine Mutter in Thüringen. Soll ich sie zurücklassen, nur weil du das willst?«
»Vielleicht kommen sie ja mit.«
Leni lachte verzweifelt auf. »Meine Mutter wird bestimmt nicht mitkommen. Sie kennt doch nur ihr kleines Dorf. Die Großstadt wird sie ängstigen. Und mein Bruder kann seine Stelle bei der Bahn nicht so einfach aufgeben. Er hat eine Frau und zwei Kinder, für die er sorgen muss. Das geht nicht, Ernst. Wir können nicht fort von hier, denn dann dürfen wir nie wieder zurück.« Lenis Stimme überschlug sich. Sie presste sich das Geschirrtuch vor den Mund, um ihr Schluchzen zu unterdrücken.
Ihr Mann kam zu ihr und nahm sie in den Arm. »Weine nicht, Leni. Du weißt nicht, ob deine Familie nicht doch mit uns mitkommen will. Wir können hier nicht bleiben, denn sie werden uns wie die Kellers von hier fortschaffen. Weil ich Grenzgänger bin, werden sie mich bestrafen und mir irgendeine Stelle als Hilfsarbeiter in irgendeinem kleinen Betrieb geben. Wir werden uns nichts mehr leisten können und hinter einer Mauer leben, die uns vom Rest der Welt abtrennt. Unsere zukünftigen Kinder werden die Freiheit, das bunte Leben, den Fortschritt niemals kennenlernen. Das kannst du nicht wirklich wollen.«
»Natürlich will ich das nicht. Aber der Preis dafür ist zu hoch«, wisperte sie. Sie bekam kaum noch Luft, japste.
Ihr Mann ließ sie los und setzte sich an den Küchentisch mit den dünnen Metallbeinen. Nachdenklich sah er zu ihr. »Wir werden zu deiner Mutter und deinem Bruder reisen und sie fragen, ob sie mit uns kommen wollen. Ich werde gleich zu meinem Bruder gehen und ihm von unseren Plänen erzählen«, sagte er, griff nach seiner Jacke, die über der Stuhllehne lag, und drückte die Türklinke herunter.
»Es sind deine Pläne, Ernst, nicht meine«, rief Leni ihm hinterher, bevor sich die Tür hinter ihm schloss.
Wütend griff sie nach ihrer Handtasche, die an der Garderobe neben der Tür hing. Sie zog das Etui hervor, in dem sie die West-Zigaretten sammelte, die ihr eine Kundin anstelle von Trinkgeld spendierte. Mit zittriger Hand zündete sie sich eine Chesterfield an und inhalierte tief. Mit jedem Zug wurde sie ruhiger. Sie versuchte, sachlich über Ernsts Vorschlag nachzudenken, und setzte sich an den Tisch. Mit starrem Blick schaute sie vor sich und zog wieder an der Zigarette. Nachdem sich der Rest des Tabaks in Qualm aufgelöst hatte, drückte sie den Filter im Aschenbecher aus.
Vielleicht sollte ich wie früher bei wichtigen Entscheidungen eine Pro-und-contra-Tabelle erstellen, dachte sie und holte Stift und Papier hervor. Sie unterteilte das Blatt mit einer Linie in zwei Hälften. In eine schrieb sie OST, in die andere WEST.
Doch anstatt ihre Gedanken zu notieren, starrte sie nachdenklich auf das Wachstuch mit dem bunten Blumenmuster. Es ist genauso farbenfroh wie der Westteil von Berlin, stellte Leni fest. Dort wurde angepackt und aufgeräumt. Mehr und mehr pulsierte das Leben am Kurfürstendamm, in Schöneberg und in den anderen Westbezirken der Stadt. Es gab Kinos, Restaurants, Bars und Einkaufshäuser. Ernst und sie mochten es, durch die Straßen zu bummeln und die Schaufensterauslagen zu betrachten. Oder sich abends mit Freunden in einer Bar zu treffen. Vor Kurzem erst hatte Ernst von seinem Westgeld Leni im KaDeWe einen roten Teddymantel gekauft. Wenn sie ihn trug, kam sie sich vor wie eine Filmschauspielerin. Neidische Blicke waren ihr dann sicher. So etwas Schönes, Ausgefallenes und Farbenfrohes gab es im Osten nicht. Es gab auch keine bunten Neonreklamen an den Häuserfassaden oder chice Restaurants, in denen eine Vielfalt an Speisen und Getränken angeboten wurde. In Westberlin blieben keine Wünsche unerfüllt.
Anders im Osten. Immer wenn sie nach ihren Westberlin-Ausflügen mit der S-Bahn über die Grenze nach Hause fuhren, hatte sie das Gefühl, dass es mit einem Mal düster wurde. Plötzlich erstarben die Gespräche der Fahrgäste, ihr Lachen verstummte. Wenn sie in Albrechtshof ausstiegen, schien alles grau und eintönig zu sein. Noch immer lag ein Großteil von Ostberlin in Schutt und Asche. Der Potsdamer Platz war ein einziges Trümmerfeld. An manchen Stellen waren schmale Pfade durch das Geröll entstanden, so dass man leicht von einem Stadtteil in den anderen gelangen konnte. Doch meistens mussten sie über Steinberge hinwegsteigen, deren dumpfes Grau nur hier und da von grünem Wildwuchs durchbrochen wurde, der nicht ausreichte, um die Monotonie zu durchbrechen.
»Unsere zukünftigen Kinder werden die Freiheit, das bunte Leben, den Fortschritt niemals kennenlernen …«, hörte sie Ernsts Stimme wieder. Aber war es das wert, ihre Mutter, ihren Bruder und ihre Schwester zurückzulassen?
Woher willst du wissen, ob sie nicht mitwollen? Hast du sie gefragt?, meldete sich ihre innere Stimme zu Wort.
Leni streckte das Kreuz durch. Ihr Mann hatte recht! Sie würden es erst wissen, wenn sie mit ihrer Familie gesprochen hatte.
Kapitel 6
Januar 2014
Ich bin froh, dass mein Mann zuhause ist, als ich aus dem Krankenhaus komme. Er sitzt im Wohnzimmer und schaut die Nachrichten, als ich mich zu ihm setze. Kaum habe ich Platz genommen, kann ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich schlage mir die Hände vors Gesicht und schluchze wie ein Kind.
»Was ist passiert?«, fragt er entsetzt.
Schon sprudelt es aus mir heraus. Ich erzähle ihm von dem Realitätsverlust meines Vaters und dem Gespräch mit dem Arzt. Er hört aufmerksam zu.
»Das hört sich zwar besorgniserregend an. Aber ihr müsst dem Arzt vertrauen. Wie hat er es genannt? Durchgangssyndrom? Das Wort sagt doch schon aus, dass der verwirrte Zustand deines Vaters vorübergehend ist, denke ich. Du wirst sehen, morgen geht es ihm besser. Ihr müsst Geduld haben. In seinem Alter ist selbst dieser Routineeingriff eine schwerwiegende OP.«
»Wahrscheinlich hast du recht«, stimme ich zögerlich zu. Ich bin froh, dass er einen klaren Kopf behält und nicht wie ich panisch reagiere. Ich lehne meinen Kopf an seine Schulter.
»Hast du mit deinen Geschwistern und deiner Mutter gesprochen?«
»Ich will das nicht am Telefon machen, sondern mich mit Manuela und Marko treffen. Meine Mutter und ich fahren morgen früh zusammen in die Klinik. Unterwegs werde ich sie aufklären.«
Unsere Kinder kommen ins Wohnzimmer und setzen sich zu uns. »Wie geht es Opa?«, fragt mein Sohn.
Ich weihe beide in meine Sorgen ein, erwähne auch die Meinung ihres Vaters.
»Das scheinen ja die reinsten Horrormedikamente zu sein, wenn jemand solche Ängste davon bekommt«, findet mein Sohn kopfschüttelnd.
»Daraus könntest du einen Thriller stricken«, meint meine Tochter lachend und lockert dadurch die Situation auf.
Ich sehe meine Familie dankbar an. »Wenn ich euch nicht hätte, würde ich sicherlich verzweifeln.«
»Das würdest du nicht, Mama. Du bist ein positiv denkender Mensch«, sagt meine Tochter.
»Ich muss leider noch an den Schreibtisch«, gesteht mein Mann und sieht mich entschuldigend an.
»Kein Problem, mir geht es dank euch schon wieder besser. Du kannst ruhig abhauen«, sage ich lachend und scheuche ihn mit einer Handbewegung aus dem Zimmer.
Sein Büro befindet sich im Erdgeschoss unseres Hauses, meins im ersten Stock. Wir beide können zu jeder Tages- oder Nachtzeit arbeiten, ohne das Haus verlassen zu müssen. Das ist ein großer Vorteil unserer Berufe, die ansonsten keine Gemeinsamkeiten haben.
»Ich muss für meine Klausur nächste Woche lernen«, erklärt mein Sohn und verschwindet nach oben.
Ich sehe meine Tochter fragend an. »Welche Ausrede hast du, mich zu verlassen?«
»Johanna wartet auf mich«, sagt sie grinsend.
»Akzeptiert.«
Sie beugt sich zu mir und gibt mir einen Kuss auf die Wange. »Alles wird gut«, versichert sie mir augenzwinkernd und geht ebenfalls.
»Dann ist das wohl das Zeichen, mich auch an meinen Schreibtisch zu setzen«, seufze ich und gehe nach oben in mein Arbeitszimmer.
Dort klappe ich mein MacBook auf und öffne die Schreibdatei des Kochbuchs. Ich lese meinen kleinen Bericht über Tricastin durch, die Trüffelhochburg Frankreichs. Doch schon nach wenigen Sätzen kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Meine Gedanken schweifen ab zu meinem Vater.
Immer und immer wieder rasen seine Worte durch meinen Kopf. »KGB … Stasi«,