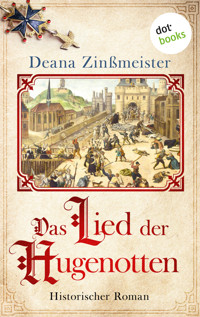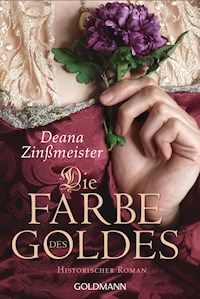0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Geschwisterpaar auf unterschiedlichen Wegen: Der historische Roman »Der Turm der Ketzerin« von Deana Zinßmeister jetzt als eBook bei dotbooks. Frankreich, 1588. Vor Jahren floh der Hugenotte Jacon mit seinen Kindern vor den Schrecken der Bartholomäusnacht aufs Land, wo sie ihren Glauben ablegen mussten. Die junge Magali, die alles gibt, um die Glasbläserwerkstatt ihres Vaters weiterführen zu können, fühlt sich inzwischen ganz als Katholikin – ihr Bruder Pierre hingegen hat sich in die Hugenottin Florence verliebt und will zu seinen ursprünglichen Wurzeln zurückkehren. Doch Florences Familie sperrt sich gegen die Verbindung, denn Pierre entspricht nicht ihren strengen Sitten- und Lebensvorstellungen. Gemeinsam kämpfen die beiden gegen alle Widerstände für ihre Liebe – doch gerade, als sie zu hoffen beginnen, droht eine neue Gefahr, ihnen alles zu nehmen … »Deana Zinßmeisters Geschichten haben Erfolgsgarantie.« Bild Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der perfekt recherchierte Roman »Der Turm der Ketzerin« von Deana Zinßmeister ist der zweite Band ihrer Hugenotten-Saga, die Fans von Kate Mosse und Sabine Ebert begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Frankreich, 1588. Vor Jahren floh der Hugenotte Jacon mit seinen Kindern vor den Schrecken der Bartholomäusnacht aufs Land, wo sie ihren Glauben ablegen mussten. Die junge Magali, die alles gibt, um die Glasbläserwerkstatt ihres Vaters weiterführen zu können, fühlt sich inzwischen ganz als Katholikin – ihr Bruder Pierre hingegen hat sich in die Hugenottin Florence verliebt und will zu seinen ursprünglichen Wurzeln zurückkehren. Doch Florences Familie sperrt sich gegen die Verbindung, denn Pierre entspricht nicht ihren strengen Sitten- und Lebensvorstellungen. Gemeinsam kämpfen die beiden gegen alle Widerstände für ihre Liebe – doch gerade, als sie zu hoffen beginnen, droht eine neue Gefahr, ihnen alles zu nehmen …
»Deana Zinßmeisters Geschichten haben Erfolgsgarantie.« Bild
Über die Autorin:
Deana Zinßmeister widmet sich seit einigen Jahren ganz dem Schreiben historischer Romane. Bei ihren Recherchen wird sie von führenden Fachleuten unterstützt, und für ihren Bestseller »Das Hexenmal« ist sie sogar den Fluchtweg ihrer Protagonisten selbst abgewandert. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im Saarland.
Deana Zinßmeister veröffentlichte bei dotbooks bereits die Australienromane »Fliegen wie ein Vogel« und »Der Duft der Erinnerung«, die Pesttrilogie mit den Romanen »Das Pestzeichen«, »Der Pestreiter« und »Das Pestdorf« sowie die Hexentrilogie mit den Romanen »Das Hexenmal«, »Der Hexenturm« und »Der Hexenschwur« und die Hugenotten-Saga mit den Bänden »Das Lied der Hugenotten« und »Der Turm der Ketzerin«.
Die Website der Autorin: www.deana-zinssmeister.de
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Copyright © der Originalausgabe 2017 by Deana Zinßmeister und 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung. Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von Francois Dubois
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98952-232-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Deana Zinßmeister
Der Turm der Ketzerin
Historischer Roman
dotbooks.
Für Monika und Helmut, die mit mir auf den Spuren der Hugenotten in Aigues-Mortes gewandert sind
Als wir den Kerkerturm von Aigues-Mortes besuchten,
sagten mir jene Damen mit mühsam verhaltenem
Schluchzen: »Dichter, wundern Sie sich nicht, uns so weinen
zu sehen: für uns Hugenotten sind diese armen Frauen
›Blutzeugen ihres Glaubens‹, unsere Heiligen Marien – es
nòsti sànti Mario.«
Frédéric Mistral, »Moun espelido, remòri e raconte«
(aus: Joseph Chambon, Der französische Protestantismus)
Personenregister
Die mit einem * versehenen Personen
sind tatsächliche historische Personen.
Vernou-sur-Brenne
Jacon Desgranges, Glashüttenbetreiber
Magali Bercy, seine Tochter
Olivier Bercy, Magalis Ehemann, Neffe von Claire (s. u.)
Claire Bercy, Ziehmutter von Olivier und Colette
Antoine Bercy, Claires Ehemann
Fleur, die gute Seele im Hause Desgranges
Monsieur Chaila, Alchimist im Nachbarort Amboise
Angélique, seine Tochter
La Rochelle
Pierre Desgranges, Jacon Desgranges’ Sohn
Florence Duchène, Pierres Bekanntschaft
Albert Duchène, Salzhändler, Florence’ Vater
Sandrine Duchène, Alberts Ehefrau, Florence’ Mutter
Francine und Marie, Florence’ jüngere Schwestern Maurice Gillon, Albert Duchènes Geschäftspartner, Freund der Familie Duchène
Monsieur Gillon, Maurice’ Vater, Mitglied des Presbyteriums von La Rochelle
Monsieur Dambonnett, Prediger und Pierres Mentor Monsieur Adomat, Mitglied des Presbyteriums von La Rochelle René Lamené, ein Schneider
Auf dem Schiff
Monsieur Rabané, Kapitän
Aigues-Mortes
Isabeau Beron, prominente Gefangene
Marianne Fabré, Mathieu Fabrés (s. u.) Ehefrau
Paul Carême, Hauptmann im Gefangenenturm
Louis Blache, Hauptmann im Gefangenenturm
Etienne, ein Wachsoldat
Suzanne, Marianne, Marguerite, Sophie, Anne, Cécile,
Valérie, Frédéric, Colette: weitere gefangene Frauen und
Kinder im Turm
Fabrice Argeau, Fuhrunternehmer
Gilbert Marchand, Salinenbesitzer
Philippe Beron, Isabeaus Bruder, Dorfschreiber, Gründer einer
Untergrundorganisation
Mathieu Fabré, Prediger, Mariannes Mann
Abraham Mazel*, Gefangener im Tour de Constance
Paris
Charles Marty, Jacons alter Freund, Küchenchef im Louvre
Richard, Sohn von Jacons ehemaligem Glasmacher Romain
Romain, Richards Sohn, Romains Enkel
Anne, Richards Frau
Katharina von Medici* (1519-1589):
Mutter von Karl IX. und Marguerite de Valois
Heinrich von Navarra* (1553-1610):
auch: Heinrich IV., Hugenottenkönig von Navarra (historischer Staat zwischen Frankreich und Spanien)
Marguerite de Valois* (1553-1615):
Ehefrau von Heinrich von Navarra, Kosename: Margot
Heinrich IIL* (1551-1589):
Herzog von Anjou, Sohn von Katharina von Medici; Bruder von Karl IX. und Marguerite de Valois
Prolog
Sie erwachte. Ihre Lider waren schwer und ließen sich nicht heben. Sie hielt sie bewusst geschlossen in der Hoffnung, gleich wieder in einem traumlosen Tiefschlaf zu versinken. Sie wollte den furchtbaren Traum vergessen, der sie in große Angst versetzte.
Im Traum hatten Männer sie entführt und an den Haaren in einen Turm geschleppt. Ihr wurde ein Seil um die Hüfte geschlungen, mit dem man sie in die Höhe zog. Vergeblich rief sie nach ihrem Mann. Er war nicht gekommen, um sie zu retten. Je höher sie gezogen wurde, desto größer wurde die Angst, das Seil könnte reißen und sie in die Tiefe fallen. Panisch blickte sie hoch und sah eine offene Klappe, durch die der Strick sie bis in die Kuppe des Turms zog.
Oben angekommen griffen zahlreiche Hände nach ihr. Dann spürte sie Boden unter den Füßen. Der Strick wurde ihr vom Leib gelöst, und eine Klappe im Boden wurde geschlossen. Sie stand in einem stockdunklen Turm.
Sie hörte Stimmengemurmel. Als sie vorsichtig die Augen öffnete, wurde eine Kerze entzündet. Sie blickte in ein fremdes Gesicht, das sie anlächelte. »Du musst dich nicht fürchten. Wir wollen dir nichts Böses. Wir sind wie du Gefangene im Turm«, sagte eine Stimme.
Es ist kein Traum, dachte sie. Sie schrie.
Kapitel 1
La Rochelle, Juli 1588
Pierre hatte schweißnasse Hände. Kaum hatte er sie über dem Stoff seiner knielangen Hose trockengerieben, brach der Schweiß erneut aus. Gleich würde die große Uhr im Stadttor die sechste Stunde schlagen. Pierres Herzschlag begann zu rasen. Um sich abzulenken, schaute er zum Tour Saint-Nicolas hinüber, dessen helles Gemäuer von der tiefstehenden Sonne angestrahlt wurde. Sein Blick erfasste zwei Soldaten auf dem oberen Rundgang des Wachturms. Sie beobachteten die Segelschiffe, die weit draußen vor der Stadt auf Reede lagen.
»Wartest du auf mich?«, fragte eine Stimme hinter ihm.
Pierre schluckte. »Du bist gekommen«, flüsterte er.
Das Sonnenlicht blendete sie. Blinzelnd sah sie ihn an. »Warum sollte ich nicht kommen?«, fragte sie sanft.
Schüchtern zuckte Pierre mit den Schultern.
Sie kicherte. »Ich hatte dir versprochen, dass ich jeden Tag zur sechsten Stunde hier auf dich warte.«
Er kam näher, bis er dicht vor ihr stand.
Sie reckte ihm ihr Gesicht entgegen. Aus ihren veilchenblauen Augen musterte sie ihn scheu. Pierre glaubte ein zaghaftes Lächeln zu erkennen.
Mutig näherte er sich ihren Lippen.
Als sie nicht zurückschreckte, drückte er sanft seinen Mund auf ihren.
»Schläfst du im Stehen?«
Pierre riss die Augen auf und sah in das wettergegerbte Gesicht eines Bauern, der ihn hämisch angrinste. »Du hattest wohl einen süßen Traum«, grölte der Fremde, und die Umstehenden stimmten in sein Lachen ein.
Pierre sah sich erschrocken um. Er brauchte einige Sekunden, um wahrzunehmen, wo er war. Eingereiht zwischen zahlreichen Menschen wartete er vor dem nördlichen Stadttor von La Rochelle darauf, eingelassen zu werden. Reisende, die der Handelsstraße gefolgt waren, standen dicht gedrängt neben Viehhändlern, Bauern, Kaufleuten und anderen. Manche saßen auf Fuhrwerken, mit denen sie ihre Waren transportierten. Andere trugen Kiepen mit Gemüse oder Holz auf dem Rücken. Manche hielten Kinder an den Händen, die lautstark quengelten, da sie lieber umherlaufen wollten.
Es war nur ein Traum, dachte Pierre und schaute enttäuscht hoch. Abermals blickte er in das Gesicht des Alten.
»Oh, es war nur ein Traum«, grinste der.
Da der Bauer anscheinend seine Gedanken lesen konnte, drehte Pierre sich von ihm fort und lehnte sich gegen sein Pferd, das neben ihm stand, ebenso müde war wie er und döste.
Wie kann ich mich hier nur einem Traum hingeben?, schimpfte sich Pierre in Gedanken selbst und schüttelte beschämt den Kopf. Wie lange war er wohl hier schon gestanden? Lang genug, um zu träumen, dachte er spöttisch und sah gereizt hinüber zum Tor. Warum geht es nicht weiter? Ich will endlich zum Hafen und wissen, ob mein Traum wahr wird, dachte er und spitzte an den Leuten vorbei zum Tor. An diesem Tag schien nur ein Wachsoldat zu kontrollieren, erkannte Pierre und stützte die Hände auf seinen Oberschenkeln ab.
Erschöpft ließ er den Kopf hängen. Jeder Muskel seines Leibs schien zu schmerzen. Mit verkniffener Miene streckte er den Rücken. Seit seinem Fortritt aus Vernou-sur-Brenne am Vortag in aller Herrgottsfrühe hatte er sich und der Stute nur zweimal eine kurze Rast gegönnt. Eine innere Unruhe trieb ihn weiter. Ihn jagte die Angst, dass Florence nicht mehr auf ihn warten würde. Schließlich hatte er sich nicht persönlich von ihr verabschieden können, sondern eine Wahrsagerin gebeten, dem Mädchen eine Nachricht zu übermitteln. Ob Josianne seiner Bitte nachgekommen war, wusste Pierre nicht. Und er wusste auch nicht, wie Florence seine Nachricht aufgenommen hatte. Vielleicht war sie enttäuscht und wollte nichts mehr von ihm wissen. Pierre wäre am liebsten durch das Stadttor geprescht, um endlich zum Kettenturm am Hafen zu gelangen. Doch er zwang sich, ruhig zu bleiben, und atmete tief durch.
Ein Mann nickte ihm zu. Pierre erwiderte die Begrüßung. Wie die meisten wartenden Menschen war der Fremde in der dunklen Tracht der Hugenotten gekleidet. Pierre wusste aus der Erzählung seines Vaters, dass La Rochelle die heimliche Hauptstadt der Hugenotten genannt wurde, da sich die Gläubigen hier frei bewegen konnten und ihre protestantische Überzeugung offen leben durften – im Gegensatz zu den katholischen Städten, wo Protestanten nur geduldet wurden und sich an katholische Regeln halten mussten.
Pierre sah heimlich an sich herunter. Seine helle Kleidung fiel unter den dunklen Röcken der anderen auf. Als er um sich schaute, glaubte er manch unfreundlichen Blick zu sehen. Aber da man ihn in Ruhe ließ, hoffte er, sich zu täuschen. Wahrscheinlich hat mich das Gerede meiner Schwester Magali beeinflusst, sodass ich in jedem Hugenotten einen Gegner sehe, dachte er und unterdrückte den Gedanken. Er wollte nicht an seinen letzten Tag im Haus seines Vaters denken. Auch wollte er sich nicht erneut aufregen oder gar ärgern, denn Magalis abfälliges Gerede über die Hugenotten hatte ihn schwer getroffen.
Bevor Pierre weiter nachdenken konnte, erblickte er einen Wachmann, der sich vor ihm aufbaute. Der Mann, dessen Kopf von einem Helm eingeschlossen wurde, musterte ihn mürrisch. Sein Blick galt Pierres Erscheinung.
»Wohin des Wegs?«, fragte er, ohne eine Miene zu verziehen.
»Ich will in die Stadt.«
»Im Gefängnis sitzen achtzehn Gefangene. Sie alle wollen da raus, doch das ist kein Wunschkonzert«, spottete der Mann und verzog keine Miene. »Was will ein Katholik in unserer Stadt?«
Pierre konnte dem Mann nicht sagen, dass er hoffte, das Mädchen Florence am Kettenturm zu treffen. Hastig überlegte er sich eine Ausrede. »Ich suche meine Eltern. Sie sind Korbflechter und verkaufen ihre Ware am Hafen.«
»So, so! Korbflechter.«
Pierre nickte.
»Wie lange willst du in La Rochelle bleiben?«
»Das kommt darauf an, wie lange der Vater meine Hilfe benötigt. Er sieht nicht mehr gut, sodass die Körbe schief und krumm werden. Deshalb werde ich wohl einige für ihn flechten müssen«, log Pierre und grinste dabei.
»Darüber spaßt man nicht«, rügte ihn der Wachmann. »Schlimm genug, wenn man von Krankheiten geplagt wird. Ein Sohn, der seinen Vater nicht ehrt, weil er nicht mehr gut sieht...«
»Er ist Katholik!«, spottete derselbe Bauer, der sich über Pierres Träumerei lustig gemacht hatte. »Was erwartest du von so einem?«
Pierre sah den Mann entgeistert an. Wie konnte der Alte
so über ihn reden? Sie kannten sich nicht, hatten kaum ein Wort miteinander gewechselt. Pierre öffnete den Mund, um zu sagen, dass er aus einer hugenottischen Familie kam. Doch da rief jemand hinter ihnen: »Wenn das nicht bald weitergeht, verdirbt meine Ware!«
»Halt die Klappe, sonst kannst du wieder umkehren«, rief der Wachmann und sah den Störenfried böse an.
»Wir stehen uns die Beine in den Bauch, weil es nicht weitergeht«, rief eine Frau. »Warum bist du heute allein, Vincent? Wo ist der zweite Wachmann, der an anderen Tagen mit dir kontrolliert?«
»Ihn plagt das Fieber«, antwortete der Soldat.
»Du kennst uns, Vincent. Wir stehen mindestens zweimal in der Woche hier, um auf den Märkten unsere Ware zu verkaufen. Warum kontrollierst du uns, als ob wir Schmuggler wären?«
»Den Katholiken kenne ich nicht.«
»Der will seinem Vater helfen. Also lass ihn gehen, damit wir alle weiterkommen.«
Nun wurden auch andere Stimmen laut. Der Wachmann sah Pierre durchdringend an. Wortlos winkte er ihn schließlich durch.
Pierre führte das Pferd am Strick durch die Gassen von La Rochelle. Obwohl er erst das zweite Mal in der Stadt am Atlantik war, hatte er das Gefühl, heimzukommen. Alles schien ihm vertraut. Doch für die Schönheit der Stadt hatte er im Augenblick keine Zeit, denn er wollte so schnell wie möglich zum Hafen.
Endlich lag das innere Stadttor mit der großen Turmuhr vor ihm. Die Portalflügel standen weit offen, sodass er den Hafen hätte sehen können. Doch eine große Traube Menschenköpfe versperrte ihm die Sicht. Pierre war versucht, in die Höhe zu springen, um über die vielen Hüte hinweg ei-
nen Blick auf das Meer zu werfen, als er auch schon von dem Menschenstrom mitgezogen wurde.
»Warum nehmt Ihr den Gaul mit in die Stadt?«, rief ein Mann verärgert, der sich seitlich an dem Pferd vorbeidrängte. »Er versperrt den schmalen Durchgang.«
»Wo soll ich das Pferd denn lassen?«, fragte Pierre.
»In der Rue Verdière gibt es einen Pferdestall«, rief der Mann ihm zu und wies in die entgegengesetzte Richtung.
»Und wie soll ich mich mit dem Pferd hier umdrehen?«, murmelte Pierre.
»Nahe dem Tor gibt es einen weiteren Stall, wo Ihr das Pferd unterstellen könnt«, verriet ihm ein anderer Mann, der neben ihm seine Tochter auf die Schultern hob, da diese weinte. »Beruhig dich, ma chère, hier oben bist du sicher«, versuchte er das Kind zu trösten. »Die vielen Menschen ängstigen sie«, entschuldigte er das Geschrei des Mädchens und verschwand in der Menge.
Als Pierre das Stadttor mit der Uhr durchschritten hatte, ging er in die Richtung, die der Mann ihm gewiesen hatte. Zwei Häuser weiter fand er den Stall, wo er das Pferd unterstellen konnte. Nachdem er bezahlt hatte, trat er hinaus in die Gasse. Unschlüssig sah er sich um. Die Sehnsucht nach Florence trieb ihn zum Kettenturm hinunter. Doch sein Pflichtbewusstsein forderte, dass er zuerst nach dem Ehepaar suchte, mit dem er drei Jahre lang umhergereist war. Unsicher blickte Pierre zu dem Stellplatz hinüber, wo er die beiden das letzte Mal gesehen hatte.
Sie müssen warten, entschied er gegen sein Gewissen und ging zum Hafen.
Kapitel 2
Pierre schaute zu dem Stadttor mit der großen Horloge. Die Zeiger der Uhr verrieten, dass es kurz vor Mittag war. »Wie soll ich die sechs Stunden Wartezeit überstehen?«, seufzte er und sah sehnsüchtig hinüber zum Kettenturm nahe der Hafeneinfahrt.
Als er vor drei Monaten zum ersten Mal nach La Rochelle gekommen war, hatte er Florence kennengelernt. Das erste Mal war er ihr am nördlichen Stadttor begegnet. Das zweite Mal hatte er sie hier am Hafen getroffen. Er erinnerte sich, wie ein lautes Rasseln ihre Unterhaltung gestört und sie ihm zugerufen hatte: »Das ist der Tour de la Chaîne, der Kettenturm. Lass uns hingehen, bevor die Kette vollends aus dem Wasser gezogen ist.« Kaum hatte sie zu Ende gesprochen, war sie seitlich am Hafenbecken vorbei in Richtung Turm gelaufen. Dort hatte sie ihm erklärt, man wolle durch das Hochziehen der Kette vermeiden, dass fremde Boote unverzollte Ware in die Stadt schmuggeln konnten. Da Pierre La Rochelle nicht kannte, hatte sie angeboten, ihm die Stadt zu zeigen. Doch weil seine freie Zeit eingeschränkt war, hatte Florence vorgeschlagen, jeden Abend zur sechsten Stunde hier am Kettenturm auf ihn zu warten. »Wenn deine Zeit es zulässt, weißt du, wo du mich finden kannst.«
Das ist nun fast drei Monate her, dachte Pierre, sicherlich hat sie mich vergessen, zumal ich mich nicht einmal persönlich von ihr verabschieden konnte. Was musste Florence wohl von ihm denken?, grübelte er. Und er dachte an die veilchenblauen Augen des Mädchens, die ihn vom ersten Augenblick an fasziniert hatten.
Wenn er den Namen ihrer Familie kennen würde, könnte er ihr Wohnhaus ausfindig machen, überlegte Pierre, doch im selben Augenblick lachte er bitter auf. Selbst wenn er den Straßennamen herausfände, würde er es nicht wagen, an der Wohnungstür zu läuten. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als zur vereinbarten Stunde am Kettenturm zu warten und zu hoffen.
Pierre stieß lustlos ein Steinchen mit seinem Schuh fort, das über das Kopfsteinpflaster rollte. Abermals schielte er zur großen Stadtuhr. Die Zeiger schienen zu kriechen. Irgendwie musste er die Zeit totschlagen, dachte er und marschierte über den Platz zum Hafen.
Dort waren zahlreiche Verkaufsstände aufgebaut, hinter denen Frauen fangfrische Fische und anderes Meeresgetier anboten. Über einem offenen Feuer hing ein großer eiserner Topf, in dem eine Frau Muscheln kochte. Als sie mit einem Holzpaddel in der Brühe rührte, zog der würzige Geruch des Weißweinsuds zu Pierre hinüber und ließ seinen Magen knurren. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er seit dem Abend zuvor nichts gegessen hatte. Er überlegte, ob er sich eine Portion Muscheln leisten konnte. Doch dann entschied er, das Geld, das der Vater ihm bei seiner Abreise gegeben hatte, nicht für Leckerbissen auszugeben. Stattdessen kaufte er bei einer Bäckersfrau ein kleines Baguette und bei einer Bäuerin ein Viertel Käse. Das muss reichen, um meinen Hunger zu stillen, dachte er, als ein dickbäuchiger Mann am Nebenstand ihm zurief:
»Das ist eine recht trockene Mahlzeit, Monsieur. Mein vin rouge wird die Krümel des Weißbrots fortspülen. Probiert diesen hervorragenden Wein!« Er hob eine Flasche hoch und goss einen Schluck in einen Becher, den er Pierre vor die Nase hielt. »Nur zu! Ich habe ihn selbst gekeltert«, grinste er breit, wobei die Augen in seinem runden Gesicht zu verschwinden schienen. Nur die Nase stach dick und rot hervor.
Zögerlich nahm Pierre den Becher entgegen und trank vorsichtig. Anerkennend nickte er. »Ihr habt recht, Monsieur. Euer Rotwein ist nach meinem Geschmack.« Jetzt merkte er, dass er nicht nur hungrig, sondern auch durstig war. »Ich nehme eine kleine Flasche«, sagte er, was den Weinbauern breit grinsen ließ.
»Ihr werdet sehen: Mit meinem Roten schmeckt Euer karges Mahl wie ein Festmenü, Monsieur«, lachte er und füllte aus einem Fass eine kleine Flasche ab.
Pierre bezahlte und ging hinüber zur Kaimauer, auf deren Rand er sich setzte. Dort ließ er seine Beine über dem Hafenbecken baumeln, in dem die kleinen Fischerboote, die an langen Stricken befestigt waren, im Schlick lagen.
Der Anblick war außergewöhnlich. Bei seinem ersten Besuch in La Rochelle hatte Pierre erschrocken beobachtet, wie das Wasser stetig aus dem Hafen verschwand und die Fischerboote auf den Grund des Beckens sanken. »Das sind die Gezeiten. Man nennt es Ebbe, wenn das Meer fort ist, und Flut, wenn es zurückkommt. Kindern erzählt man, dass das Meer abends zum Schlafen in sein Bett zurückkehrt«, erinnerte er sich an Florence’ Erklärung.
»Florence, Florence, Florence. Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf«, murmelte Pierre und grinste breit. Wenn Olivier das wüsste. Der Freund würde ihn sicher einen verliebten Gockel nennen. Pierre brach sich hungrig ein Stück Brot und ein Stück Käse ab und biss abwechselnd in jedes hinein. Zwischen zwei Bissen trank er von seinem Rotwein. Während er kaute, schaute er hinüber zu der Brücke auf die andere Seite des Ports. Dort konnte er beobachten, wie das Wasser in einem kleinen Bach zurück in den Hafen floss. Zuerst war es nur ein schwaches Rinnsal, doch immer schneller strömte es zwischen die Boote. Als Pierre sein Mahl beendet hatte, richteten sich die kleinen Fischerboote bereits im Wasser auf.
Satt und zufrieden erhob er sich von der Steinmauer. Er brachte die Flasche zurück zu dem Weinverkäufer, der gerade einen eigenen Becher leerte. »Soll ich sie Euch ein weiteres Mal mit meinem vin rouge auffüllen?«, fragte er mit schwerer Zunge.
Pierre schüttelte den Kopf. »Danke, das muss bis zum Abend reichen«, antwortete er und konnte das Lachen nur mit Mühe zurückhalten. Anscheinend war der Mann selbst sein bester Kunde.
Pierre sah zum Stadttor, um die Zeit abzulesen, als sein Blick an einer Frau hängen blieb. Sie war in der dunklen Tracht der Hugenotten gekleidet und fiel in der Menge kaum auf. Doch sie zog seinen Blick wie magisch an. Pierre traute seinen Augen nicht. Es war Florence. Sie betrachtete an einem Marktstand einen Hummer, den die Verkäuferin ihr vor die Nase hielt. Kaum hatte Pierre sie erkannt, begann sein Herz zu rasen. Es klopfte so heftig gegen seine Rippen, dass seine Brust schmerzte. Schon wollte er freudig auf sie zueilen, als sich Florence einem jungen Mann zuwandte, der neben sie trat, um das Krustentier anzuschauen. Als Pierre Florence’ Blick sah, mit dem sie diesen jungen Mann anlächelte, fürchtete er, sein Herz würde stehen bleiben.
Florence und ihr Begleiter hatten anscheinend das Interesse an dem Hummer verloren und schlenderten weiter. Pierre erkannte, dass sie seine Richtung einschlugen, und blickte sich hastig nach einem Versteck um. Nahebei stand ein Fischerboot, das mit dem Rumpf nach oben auf zwei Böcken ruhte. Am Boden unterhalb des Boots lag allerhand Werkzeug herum. Da nirgends ein Besitzer zu sehen war, tauchte Pierre unter das Boot und spähte zwischen den Holzböcken hindurch, um zu beobachten, wie Florence und ihr Begleiter auf sein Versteck zuschlenderten.
Der junge Mann schien Florence vertraut zu sein. Scheu
lächelnd schaute sie zu ihm hoch. Als sie näherkamen, erkannte Pierre, dass sie ihre Hände knetete, die sie vor dem Rock hielt. Während Florence kaum sprach, schien ihr Begleiter unaufhaltsam auf sie einzureden. In unmittelbarer Nähe des Fischerbootes blieben beide stehen. Pierre konnte ihre Worte verstehen.
»Ich muss zum Hafenmeister und nachfragen, wann die nächsten Schiffe aus England erwartet werden. Möchtest du mich begleiten?«, fragte der junge Mann.
Florence schüttelte den Kopf. »Ich soll Gewürze abholen in der Markthalle, die meine Mutter dort bestellt hat«, erwiderte sie.
»Sollen wir uns hier wieder treffen, wenn wir unsere Aufträge erledigt haben?«, wollte der junge Mann wissen.
Florence nickte schüchtern.
Als der junge Mann in Richtung Hafenmeisterei verschwand, nahm Pierre allen Mut zusammen, um Florence gegenüberzutreten. Doch seine Beine versagten. Sie schienen wie gelähmt. Er war unfähig, aus der Hocke aufzustehen. Hilflos musste er mit ansehen, wie Florence die entgegengesetzte Richtung einschlug und zwischen den Menschen aus seinem Blick verschwand.
Erst nach einer Weile erwachte Pierre aus seiner Starre und kroch unter dem Boot hervor. Verzweifelt lehnte er sich gegen den Bootsrumpf und blickte abwechselnd in die verschiedenen Richtungen, in die beide gegangen waren. Wer war der junge Mann, der nicht älter als er selbst zu sein schien? Unter dem schwarzen Hut des Fremden hatte Pierre rötliche Haare hervorspitzen gesehen. Auch sein Kinn und seine Wangen waren von rötlichem Flaum bedeckt. Pierre hatte beobachtet, wie der Mann mit seinen blauen Augen Florence unablässig fixiert hatte. Schon jetzt spürte er, wie eine Abneigung gegen den Burschen in ihm hochstieg. »Wie ein Schutzpatron ist er neben ihr einhermarschiert«, spottete er. Da sah er, dass Florence zurückkam. Sein Blick schnellte hinüber zur Capitainerie. Der Fremde war nirgends zu sehen.
Pierre trat hinter seinem Versteck hervor. Mit klopfendem Herzen ging er auf Florence zu. Sie bemerkte ihn nicht sofort, da sie züchtig zu Boden blickte. Doch als er sich ihr in den Weg stellte, schaute sie auf. Erschrocken sah sie ihn an, und ihre Augen weiteten sich.
»Du?«, flüsterte sie, als sie ihn erkannte, und ihr Blick flog sofort hinüber zur Hafenmeisterei.
»Ja, ich!«, antwortete Pierre, der nicht wusste, was er sagen sollte.
»Woher? Warum? Seit wann...«, stammelte sie und schien nach Worten zu ringen. Als sie verstummte, fasste Pierre all seinen Mut zusammen.
»Ich konnte nicht eher zurückkommen, weil meine Schwester geheiratet hat...«
Bevor er weitersprechen konnte, fiel ihm Florence ins Wort. »Du bist mir keine Rechenschaft schuldig, Louis. Schließlich kennen wir uns kaum«, sagte sie leise.
Erschrocken hörte Pierre, dass sie ihn mit dem Namen ansprach, auf den er nicht mehr hörte. Sie hatte keine Ahnung, wer er in Wahrheit war. »Ich heiße nicht Louis. Ich heiße Pierre ...«, begann er zu erklären.
»Was soll das heißen, du bist nicht Louis?«, unterbrach sie ihn stirnrunzelnd, als jemand rief: »Florence, belästigt dich dieser Katholik?«
Beide schauten gleichzeitig in die Richtung der Stimme und erblickten den rothaarigen Burschen, der auf sie zueilte.
»Ich frage dich abermals: Belästigt dich dieser Mensch?«
Trotz seiner energischen Worte klang seine Stimme freundlich. Doch obwohl sein Mund lächelte, blickten seine Augen abweisend. Pierre sah, wie sich Florence’ Wangen röteten.
»Nein, er belästigt mich nicht. Er hat lediglich nach dem Weg gefragt«, log sie und senkte den Blick. Dabei verschränkte sie die Hände auf dem Rücken. Pierre glaubte zu erkennen, dass sie die Finger kreuzte – eine Geste, die eine Lüge außer Kraft setzen sollte.
»Ja, das stimmt. Ich bin fremd in dieser Stadt und muss dringend einen Bader aufsuchen«, unterstützte Pierre Florence’ unwahre Aussage, da er sie nicht in Schwierigkeiten bringen wollte.
»Warum fragt Ihr nicht einen Mann, sondern belästigt eine junge Frau und bringt sie in Verlegenheit?«
»Ja, das hätte ich tun sollen. Verzeiht mir, Mademoiselle!«, entschuldigte sich Pierre und nickte Florence höflich zu.
»Den nächsten Bader findet Ihr nahe dem Turm mit der Uhr, in der Rue de la Noue«, erklärte der junge Mann und wies Pierre die Richtung. Auch jetzt klang seine Stimme freundlich, doch Pierre glaubte einen arroganten Unterton zu hören.
Pierre schielte vorsichtig zu Florence, die den Blick gesenkt hielt. »Ich danke Euch für Eure Auskunft«, sagte er.
»Nur wenn man selbstlos hilft, wird sich unser Herr im Himmel gnädig zeigen. Doch davon versteht ihr Katholischen nichts«, erwiderte der Mann freundlich. Seine Augen fixierten Pierre, seine Worte galten jedoch Florence. »Komm, meine Liebe, lass uns nach Hause gehen«, sagte er und reichte ihr den Arm.
Als das Paar sich umdrehte, schaute Florence kurz zu Pierre auf. Geistesgegenwärtig zeigte er ihr sechs Finger und nickte mit dem Kopf zum Kettenturm. Er hoffte inständig, dass sie seinen Wink verstand. Er glaubte ein schwaches Nicken ihres Kopfes zu erkennen.
»Ich wünsche den Herrschaften einen schönen Tag«, rief Pierre, dessen Laune sich mit einem Schlag hob. Er nickte dem Burschen zu und verbeugte sich vor Florence. Dann drehte er sich um und ging seines Weges.
Beim Weggehen hörte er, wie Florence’ Begleiter zischte: »Wie kommt dieser Katholik dazu, dich auf offener Straße anzusprechen?«
Kapitel 3
Florence hatte Mühe, sich auf den Weg zu konzentrieren. Sie hoffte inständig, dass Maurice ihren Schrecken nicht bemerkte. Das unerwartete Zusammentreffen mit Louis war so unwirklich gewesen, dass sie an einen Tagtraum dachte. Doch da ihre Beine zitterten, wusste sie, dass er tatsächlich vor ihr gestanden hatte. Wo war er so plötzlich hergekommen? Und warum sagte er, dass er nicht Louis, sondern Pierre hieß? Welcher Name war der richtige? Oder hatte sie womöglich doch geträumt?, dachte Florence verwirrt und schielte zu Maurice.
Seine sonst höfliche, aber stets unverbindliche Miene wirkte nach der Begegnung am Hafen verkniffen. Florence hoffte, dass Maurice ihre Aussage nicht anzweifelte, Louis habe sie nur nach dem Weg gefragt. Sie mochte sich nicht ausdenken, wenn er herausbekommen würde, dass sie unaufrichtig war. Weil sie zu einer Notlüge gegriffen hatte, plagte sie ein schlechtes Gewissen. Wie würde Maurice reagieren, wenn er erführe, dass sie Louis sogar die Stadt hatte zeigen wollen? War es nicht unschicklich, als unverheiratete Frau mit einem fremden Mann zu reden? Erst recht, wenn der Fremde auch noch Katholik war? Im Rückblick konnte Florence selbst nicht verstehen, was sie drei Monate zuvor veranlasst hatte, Louis vorzuschlagen, ihm La Rochelle zu zeigen. Wahrscheinlich hatte sie aus Mitleid gehandelt, weil er fremd in der Stadt war.
Doch zugleich musste sie sich eingestehen, dass sie sich selbst betrog. Es waren die rehbraunen Augen von Louis, die sie so fasziniert hatten. Sein warmherziger Blick war das Gegenteil von Maurice’ blauen Augen, die so hell wie Eiswasser waren und ebenso kalt wirkten. Wenn sich die Sonne in Louis’ Pupillen spiegelte, schienen seine Augen die Farbe von flüssigem Honig zu haben. Florence erinnerte sich, wie sie voller Ungeduld auf ihn am Hafen gewartet hatte und wie enttäuscht sie war, als die fremde Frau ihr berichtete, dass er überraschend hatte fortgehen müssen. Wie gern hätte sie von ihm persönlich gehört, dass er wiederkommen würde. Täglich war sie zu der vereinbarten Zeit zum Kettenturm geschlendert in der Hoffnung, ihn dort wieder zu treffen. Doch nach zwei Wochen hatte sie es aufgegeben und versucht, ihn zu vergessen. Mit einigem Abstand betrachtet war sie vielleicht sogar erleichtert gewesen, dass er nicht zurückgekommen war. Zwar hatte es sie nicht gestört, dass Louis Katholik war – schließlich hatte ihr Vater durch seinen Salzhandel engen Kontakt mit vielen Katholiken. Doch wäre ihre Familie sicherlich nicht über eine Beziehung zu einem Katholiken erfreut gewesen.
Abermals schielte Florence zu Maurice. Er schien übelgelaunt zu sein und stapfte stumm neben ihr her, während sie ihren Gedanken nachhing. So viele Fragen und keine Antworten, seufzte sie. Plötzlich stieß sie gegen jemanden. Erschrocken schaute sie auf und sah in Maurice’ fragendes Gesicht. Sie hatte nicht bemerkt, dass er sich ihr in den Weg gestellt hatte.
»Geht es dir nicht gut?«, wollte er wissen und forschte in ihrer Miene.
Florence sah ihn erstaunt an.
»Du scheinst geistesabwesend zu sein«, erklärte er.
Nun hob sie die Augenbrauen. »Wie kommst du darauf?«
»Ich habe dir bereits zwei Fragen gestellt, die du nicht beantwortet hast. Anscheinend langweile ich dich.«
»Du irrst dich. Ich habe dir gespannt gelauscht, Maurice, du weißt Interessantes zu berichten. Nur heute ist mir recht warm in meinem Kleid. Zudem bin ich durstig und erschöpft. Verzeih mir, wenn es den Anschein hat, als wäre ich geistesabwesend«, versuchte sie seine Bedenken zu zerstreuen.
»Es hat nichts mit diesem Katholiken zu tun?«, fragte er und kniff seine blauen Augen leicht zusammen.
»Du meinst mit dem Burschen am Hafen?«, tat Florence unwissend und vermied es, den Blick zu senken, auch wenn sie spürte, dass sich ihre Wangen verfärbten. »Warum sollte ich einen Gedanken an diesen Menschen verschwenden?«, fragte sie und bemühte sich, empört zu klingen. Als er sie schweigend ansah, versuchte sie zu lächeln. »Lass uns dieses Zusammentreffen schleunigst vergessen«, schlug sie vor. Doch trotz ihrer energisch klingenden Entschlossenheit schien Maurice ihr nicht zu glauben. »Was überlegst du?«, fragte sie vorsichtig.
»Verzeih mir, meine Liebe, wenn ich es unverblümt sage: Für mich hatte es den Anschein, als ob du diesen Burschen kennst.«
»Wie kommst du auf solch einen Gedanken?«, fragte sie entgeistert. Und dieses Mal musste sie ihr Entsetzen nicht spielen, denn sie war tatsächlich bestürzt. Hatte Maurice sie durchschaut? Er schien zu überlegen.
Schließlich sagte er nachdenklich: »Es lag etwas in seinem Blick, das mich misstrauisch werden ließ.«
Florence war sich sofort sicher, dass nur eine weitere Notlüge sein Misstrauen entkräften würde können. Unauffällig legte sie eine Hand hinter ihren Rücken und kreuzte Mittel- und Zeigefinger. »Du hast gehört, wie er sagte, dass er nicht aus La Rochelle ist und sich in der Stadt nicht auskennt. Das war der Grund, weshalb er mich ansprach und nach dem Weg fragte.«
Maurice schaute über ihre Schultern, als er erklärte: »Es geziemt sich nicht für eine Hugenottin, mit einem Katholiken befreundet zu sein.«
»Ich bin nicht mit ihm befreundet«, widersprach sie laut und stapfte mit dem Fuß auf, um dann trotzig aufzubegehren: »Es ist kein Verbrechen, mit einem Katholiken zu reden.«
Maurice’ Kopf ruckte herum, sodass sein schwarzer Hut verrutschte und eine breite Strähne seines roten Haars über seine Wange fiel. Widerstrebend nahm er die Kopfbedeckung ab, strich sich das Haar hinters Ohr und setzte den Hut wieder auf. Der Blick aus seinen eisigen Augen schien Florence zu strafen, als er sie zurechtwies: »Es schickt sich nicht für eine Frau, gegen einen Mann auf offener Straße aufzubegehren. Du solltest dein Temperament zügeln, Florence.«
Während er die Worte herauspresste, sah er sich um, ob jemand ihren Streit mitbekam. Als er merkte, dass niemand sie beobachtete, beruhigte er sich und sagte: »Lass uns gehen. Dein Vater erwartet mich. Ich will nicht noch mehr Zeit mit diesem unsinnigen Gespräch vertun.«
Als Florence nickte, entspannte sich Maurice’ Miene und fiel dann wieder in den üblichen gleichgültigen Ausdruck zurück.
Die restliche Wegstrecke verlief im Schweigen, was Florence angenehm war, da sie so ihren Gedanken nachhängen konnte. Maurice’ Verhalten hatte sie erschreckt. War er schon immer so bestimmend und kalt gewesen?, überlegte sie. Sie kannten sich seit Kindertagen und waren zusammen groß geworden. Da sein Vater im Unternehmen ihres Vaters mitarbeitete, kannten sich die Familien. Bisher hatte Maurice sich ihr gegenüber immer freundlich und aufmerksam gezeigt. Ein Benehmen wie soeben kannte sie nicht von ihm. Vielleicht hat er einen schlechten Tag, entschuldigte sie seine heftigen Worte und war froh, als sie schließlich in die Straße zu ihrem Wohnhaus einbogen.
Kaum hatte sie die Haustür geöffnet, rief sie Maurice zu: »Ich muss zu meiner Mutter. Sie wartet sicher schon auf die Gewürze. Vater findest du um diese Zeit in seinem Arbeitszimmer.« Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte sie durch den Flur hinaus in den Garten, wo ihre Mutter Blüten von Lavendelbüschen zupfte.
»Mutter, ich habe dir die gewünschten Gewürze mitgebracht«, sagte sie und kniete sich zu ihr nieder, um ihr zu helfen.
»Wunderbar!«, flötete ihre Mutter und sah sie strahlend an. »Hast du Fieber, ma belle? Du wirkst überhitzt.«
»Nein, mir geht es gut. Ich bin nur nach Hause geeilt, damit du rechtzeitig die Einkäufe bekommst. Zudem ist mir heiß in meinem dunklen Kleid«, erklärte Florence und versuchte zu lächeln.
»Dann bin ich beruhigt. Halt das Säckchen für die Lavendelblüten auf. Ist Maurice zu deinem Vater gegangen?«, fragte sie, während sie ihrer Tochter das nächste Säckchen in die Hand drückte, nachdem das erste gefüllt war.
»Ich denke schon«, murmelte Florence.
Ihre Mutter schaute auf. »Hat er es dir nicht gesagt?« »Was?«
»Dass dein Vater ihn sprechen möchte.«
»Doch, natürlich. Warum fragst du? Es ist nichts Außergewöhnliches, dass Vater ihn sprechen möchte.«
»Heute könnte es ein besonderer Tag werden.«
Florence wurde hellhörig. »Wie meinst du das, Mutter?«
»Ich muss mich beherrschen, damit ich nichts ausplaudere, denn eigentlich weiß ich nichts. Es geht um Geschäftsangelegenheiten deines Vaters, die er nur mit Männern bespricht und die mich nichts angehen. Durch Zufall konnte ich einige Worte auffangen, als er laut sinnierte. Da habe ich eins und eins zusammengezählt«, kicherte die Mutter.
Stirnrunzelnd sah Florence vom Lavendelstrauch auf. »Du verwirrst mich«, sagte sie und erhob sich.
Ihre Mutter winkte ab. »Ach, hör nicht auf das Gerede einer alten Frau. Komm und hilf mir in der Küche. Heute werde ich die Leibspeise deines Vaters vorbereiten, gefüllte rougets barbets.«
Erneut zog Florence die Stirn kraus. »Rotbarbe gibt es nur zu besonderen Anlässen«, überlegte sie laut, während sie die letzten dunkelblauen Blüten von ihrer Handfläche in das Leinensäckchen fallen ließ. Weil ihre Mutter den Geruch von Fisch nicht ertragen konnte, weigerte sie sich, Fischspeisen selbst zuzubereiten. Meist mussten an solchen Tagen Florence oder eine der Mägde das Kochen übernehmen.
»Wie ich bereits sagte, heute könnte es ein besonderer Tag werden«, flüsterte die Mutter ihrer Tochter augenzwinkernd zu.
Florence konnte sich das Gerede ihrer Mutter nicht erklären. »Entschuldige, Maman, ich muss mich frisch machen. Es war sehr warm unten am Hafen, sodass das Kleid an meinem Körper klebt.«
»Geh nur, mein Kind. Wenn der Fisch ausgenommen werden muss, rufe ich dich, damit du mir hilfst«, sagte sie und verzog dabei das Gesicht.
Florence nickte und ging vom Garten in die Küche und von dort in den Flur. Als sie am Arbeitszimmer ihres Vaters vorbeikam, sah sie, dass die Tür nur angelehnt war. Zuerst hörte sie die Stimme ihres Vaters, dann die von Maurice. Er klang überrascht, denn er antwortete stotternd, und Florence hörte ihren Vater leise lachen. Sie konnte jedoch nur vereinzelte Worte aufschnappen, da sie am anderen Ende des Gangs stand. »Monsieur ... Warum ... Meinen Vater fragen ...«, drangen die Wortfetzen zu ihr.
Nun war ihre Neugier geweckt, und sie schlich auf Zehenspitzen heran. Mit angehaltenem Atem stand sie vor der Tür und legte den Kopf schief, um zu lauschen. Jetzt konnte sie das Gespräch klar und deutlich wahrnehmen.
Und sie verstand, was ihre Mutter gemeint hatte.
Kapitel 4
Pierre versuchte, gelassen zu wirken. Nichts sollte seine Aufregung verraten. Als er an dem aufgebockten Boot vorbeikam, verschwand er blitzschnell darunter. Er wollte einen letzten Blick auf Florence erhaschen, bevor sie zwischen den vielen Menschen verschwunden war. Sehnsüchtig starrte er an den Holzböcken vorbei, bis sie aus seinem Blickfeld verschwunden war.
Er setzte sich auf den Boden unter dem Boot. Schnaufend ließ er die angehaltene Luft aus der Lunge, um dann gleichmäßig weiterzuatmen. Er konnte es nicht fassen, dass er Florence so schnell wiedersehen würde. Ob sie seinen Wink verstanden hatte und um sechs Uhr abends zum Kettenturm kam? Er grübelte, wer wohl ihr Begleiter war. War er ein enger Vertrauter, vielleicht ein Verwandter? Der Bursche wirkte nicht sympathisch. Sein Blick schien eisig, sein Verhalten besitzergreifend. Verwandte, dachte Pierre, kann man sich nicht aussuchen.
Da tauchten neben dem Boot nackte Füße auf. Eine runzlige Hand griff nach dem Hobel, der neben anderen Werkzeugen auf dem Boden lag. Schon hörte er, wie über ihm jemand das Arbeitsgerät gleichmäßig über den Rumpf des Fischerbootes schleifen ließ. Das Geräusch hörte sich im Hohlraum des Bootes laut und reißend an, sodass sich die Härchen auf Pierres Armen aufstellten. Als zusätzlich Hammerschläge einsetzten, kroch er aus seinem Versteck hervor.
»Wen haben wir denn hier?«, fragte eine tiefe Stimme, die zu dem kleinen Fischer mit dem schütteren Haar nicht recht passen wollte. »Was machst du unter meinem Kahn?«, fragte er und hob den Hammer schulterhoch, bereit zuzuschlagen.
»Ich will nichts Böses«, rief Pierre und hob abwehrend beide Hände in die Höhe.
»Was hast du dann unter meinem Boot zu schaffen?«
»Ich wollte unbemerkt meiner Liebsten hinterherschauen«, gestand Pierre.
Nun zeigten sich Lachfältchen in dem wettergegerbten Gesicht des Alten. »Sie weiß wohl nichts von deiner Zuneigung«, frotzelte er und ließ die Hand sinken.
Auch Pierre senkte die Hände. »Ich kenne sie kaum, weiß nicht einmal, ob ich sie je kennenlernen werde«, verriet er schüchtern.
»Ist sie aus La Rochelle?«
Er nickte.
»Wie heißt sie? Vielleicht kenne ich sie.«
»Das glaube ich nicht«, erklärte Pierre. Als er den fragenden Blick des Alten sah, bekam er rote Ohren. »Verzeiht! Ich meinte ...«
»Ich weiß sehr wohl, was du sagen wolltest. Sie kommt aus gutem Haus und hat mit meinesgleichen nichts zu tun.«
Pierre verzog ertappt das Gesicht.
»Sicherlich ist sie außerdem Hugenottin und meidet uns Katholiken«, schlussfolgerte der Mann und forderte: »Trotzdem kannst du mir ihren Namen verraten, denn nun hast du mich neugierig gemacht. Viele kaufen bei Pierre, dem Fischer, ihren Fisch.«
»Euer Name lautet Pierre?«
Der Mann nickte und setzte seine Arbeit mit dem Hobel fort.
»Ich heiße ebenfalls Pierre.«
»Kennst du die Bedeutung unseres Namens?«, fragte der Fischer, ohne aufzublicken.
Pierre schüttelte den Kopf, was der Alte zu spüren schien, denn er erklärte: »Pierre kommt von petros, und das ist griechisch. Ein Seemann aus dem fernen Griechenland, der vor vielen Jahren auf einem großen Schiff hier ankerte ...« – die rechte Hand des Fischers wies dabei hinüber zur Hafeneinfahrt, während er mit der linken über den glatten Bootsrumpf fuhr und die Schleifarbeit prüfte – »... und bei mir Fisch kaufte, klärte mich auf. Er sagte, dass petros Stein, aber auch Fels bedeutet. Daran muss ich immer denken, wenn sich mir Probleme in den Weg stellen. Ich lasse mich nicht unterkriegen, sondern bin wie ein Fels in der Brandung, an dem alles abprallt.« Er kam aus der gebeugten Haltung hoch und streckte sich. »Nichts und niemand kann mich aufhalten.«
Pierre sah ihn nachdenklich an. »Was wollt Ihr mir damit sagen?«
Der Alte schaute hinauf zum Himmel. Möwen kreisten schreiend über dem Meer. »Dort scheint ein Fischschwarm zu sein«, murmelte er und blickte Pierre dann an. »Wenn du etwas wirklich willst, dann lass dich nicht aufhalten. Und jetzt sieh zu, dass du verschwindest. Ich muss Weiterarbeiten«, erklärte er und setzte seine Arbeit fort.
Als Pierre den Hafenplatz verließ, sah er zu der großen Turmuhr. Er hatte noch genügend Zeit, um zum Wagenplatz zu gehen.
Anscheinend war halb La Rochelle unterwegs. Mühsam drängte er sich zwischen den Fischern, Marktleuten, Frauen, Kindern und anderen Menschen hindurch, die ihm den Weg zum Tour Saint-Nicolas versperrten. Oberhalb des Turms lag der Platz, auf dem die Planwagen der Reisenden abgestellt werden mussten. Auch heute konnte Pierre zwischen dem belaubten Geäst der Bäume die hellen Stoffe der Wagen erkennen.
Sonderbarerweise spürte er eine leichte Unruhe, je näher er dem Platz kam. Zahlreiche Fuhrwerke standen dort eng nebeneinander – ganz so, wie der Platzmeister es auch Pierre und seinen Zieheltern befohlen hatte, als sie drei Monate zuvor schon einmal an diesem Ort gewesen waren. Schon hörte er die Stimme des Alten, der zwischen den Wagenreihen mit dem Rücken zu ihm stand. »Du sollst dein Gefährt mit dem Hinterteil hier und mit der Achse zur Mitte ausrichten«, rief der Platzwart und zeigte mit ausladenden Gesten die Richtungen. Dann trat er näher an den neuen Gast heran und fragte: »Wie lange willst du bleiben?«
Pierre musste schmunzeln. Mit ähnlichen Worten war er auch damals begrüßt worden. Da der Mann noch beschäftigt war, suchte er den Platz, auf dem das Gefährt der Korbflechter stehen musste. Doch dort hatten andere Händler ihren Planwagen abgestellt. Suchend blickte Pierre umher. Auch das Zelt der Wahrsagerin war nicht mehr da. Da kam der alte Platzwart, der sich auf seinen langen Stock abstützte, zu ihm.
»Wo ist dein Fuhrwerk?«, fragte er ihn schon von Weitem.
»Ich habe keins, Monsieur!«
»Was willst du dann hier?«, wollte er wissen. Dann stockte er. »Ich habe dich schon einmal hier gesehen. Bist du nicht Josiannes Verehrer?«
»Wo denkt Ihr hin?«, erwiderte Pierre erregt. »Ich bin nicht ihr Verehrer.«
»Ich glaube dich in ihrem Zelt gesehen zu haben. Sie hat immer gekichert, wenn du kamst.«
Pierre schüttelte den Kopf. »Das war ich nicht«, begehrte er auf.
Der Alte klopfte mehrmals mit dem Stock auf den Boden und schien zu überlegen. »Ach nein, jetzt erinnere ich mich wieder. Du warst mit dem Korbflechterehepaar unterwegs. Bei Josianne war ein anderer Bursche«, sagte er. Als Pierre erleichtert seufzte, feixte er. »Die Frau des Weidenkorbflechters hatte Haare auf den Zähnen. Wie die den Alten angeschnauzt hat. Mit der wollte ich nicht verheiratet sein«, griente er und wollte sich schon von Pierre abwenden. Der fragte hastig:
»Wisst Ihr, wohin das Ehepaar gefahren ist?«
Der Alte zuckte mit den Schultern. »Ich weiß weder, woher die Menschen kommen, die hier ihre Fuhrwerke abstellen, noch, wohin sie gehen. Das alles interessiert mich auch nicht. Für mich ist nur wichtig, wie lange sie bleiben und dass sie für diese Zeitspanne ihre Abgaben bezahlen. Allerdings weiß ich, dass Josianne in zwei Monaten hier wieder auftauchen wird. Zwei Mal im Jahr führt sie ihr Weg nach La Rochelle, denn hier kann sie gutes Geld verdienen. Bevor die Seefahrer auf den großen Schiffen über das weite Meer in die neue Welt aufbrechen, wollen sie von ihr wissen, ob sie sicher den Heimathafen wiedererlangen oder ob die Ungeheuer sie auf dem Meer verschlingen werden.« Als Pierre sich bei der Vorstellung der Meeresbiester schüttelte, lachte der Alte auf, wobei er seinen zahnlosen Kiefer sehen ließ. »Du hast kein Glück, Jungchen, sie sind alle fort«, sagte er und ging hinüber zu einem Planwagen, der gerade angekommen war. »Du musst den Wagen mit der Achse zur Mitte ausrichten«, rief er den Leuten zu und fuchtelte dabei mit seinem Stock aufgeregt in der Luft herum.
Pierre sah zu den Menschen, die vor ihren Zelten am Feuer saßen oder ihren Arbeiten nachgingen. Er kannte nicht einen von ihnen. Seufzend wandte er sich um und ging zurück in Richtung Tour Saint-Nicolas.
Da er keine Lust hatte, das Treiben in der Stadt zu beobachten, und da er noch mehr als drei Stunden warten musste, schlug er den Weg zum Meer ein. Das Ufer bestand aus großen Steinbrocken, die mit glitschig-grünem Schleim überzogen waren. Vorsichtig kletterte er darauf entlang, bis er einen Platz fand, der erhöht lag, sodass er nicht nass wurde. Da der Stein breit genug war, setzte Pierre sich darauf nieder und streckte die Beine aus. Das Meer war ruhig. Nur schwach plätscherte das Wasser gegen die Uferböschung. Er zog die Knie an und blickte auf die scheinbar endlose Weite des Meeres. Weit hinten am Horizont konnte er schwach die Umrisse eines Schiffs ausmachen. Wohin man wohl kommt, wenn man immer geradeaus segelt?, überlegte er. Manche, hatte er gehört, sprachen von einer neuen Welt, andere glaubten, dass man abstürze, wenn man das Ende des Wassers erreicht.
Pierre wurde müde. Schläfrig streckte er die Beine wieder aus und sog die salzhaltige Luft, die würzig nach Tang und Fisch roch, in seine Lunge ein. Er erinnerte sich an die Frau des Weidenkorbflechters, die bei ihrer Ankunft in La Rochelle angewidert die Nase gerümpft hatte. Sie mochte das Meer nicht. Für sie stank die Luft nach faulem Meerwasser und verdorbenem Fisch. Da sie aber gute Geschäfte mit den Hummerreusen machten, die sie herstellten, mussten sie an in die Städte am Atlantik reisen, um sie dort zu verkaufen. »Fischer leben nun mal am Wasser«, murmelte Pierre und kniff die Augen leicht zusammen, da die hochstehende Sonne ihn blendete.
Er hatte gehofft, das Ehepaar wiederzusehen, mit dem er drei Jahre lang übers Land gezogen war im falschen Glauben, dass er ihr Sohn sei. Drei Jahre lang hatte er nicht gewusst, dass er nicht Louis hieß, sondern Pierre, und dass er aus Vernou-sur-Brenne stammte. Ein Unfall hatte ihm sein Gedächtnis genommen.
Pierre schüttelte sich, als er an die Winternacht vor drei Jahren dachte. Nach einem Streit mit dem Vater war er hinaus in die bitterkalte Nacht gerannt. Als er den zugefrorenen Dorfteich von Vernou-sur-Brenne überqueren wollte, war er eingebrochen und im Wasser versunken. Auch jetzt spürte er die Angst, die ihn damals erstarren ließ, als er immer wieder untertauchte und schließlich in der Tiefe des Teichs versank. Er glaubte sich erinnern zu können, wie er in einen Strudel geriet, der ihn gegen hartes Gestein schleuderte und ohnmächtig werden ließ. Danach war die Erinnerung an sein altes Leben ausgelöscht.
Wie er in den Wassergraben gelangt war, in dem die Korbflechter ihn gefunden hatten, daran konnte er sich nicht erinnern. Mehrere Wochen lang hatte ihn heftiges Fieber geplagt. Als er erwachte, hieß er Louis und war der Sohn eines Ehepaars, das seinen Lebensunterhalt als Weidenflechter verdiente.
Lange schöpfte Pierre keinen Verdacht, dass er Opfer einer Lebenslüge war. Durch Zufall kam die Wahrheit ans Licht. Weil er für die beiden Alten, die er Vater und Mutter nannte, nie Gefühle empfunden noch das Bewusstsein hatte, zu ihnen zu gehören, stellte er sie nach ihrer Ankunft in La Rochelle zur Rede.
An diesem Abend erfuhr Pierre die wahre Geschichte: Da er sich an nichts erinnern konnte und seine Retter nicht wussten, wer der bewusstlose Bursche war, den sie schwer verletzt aus dem Wassergraben gezogen hatten, hatten sie ihn an die Stelle ihres verstorbenen Sohnes gesetzt. »Gott hat uns unseren Sohn ein zweites Mal in den Weg gestellt«, waren sie sich sicher und hatten Pierre aufgenommen und gesund gepflegt.
Nach diesem Geständnis war Pierres Erinnerung schlagartig zurückgekommen. Als er die Einzelheiten seiner Rettung erfahren hatte, wusste er plötzlich wieder, wer er war. Er machte sich auf den Weg, seine wahre Familie wiederzufinden. In Vernou-sur-Brenne traf er seinen Vater Jacon Desgranges und seine Schwester Magali, die nach dem plötzlichen Verschwinden des Sohnes und Bruders fest geglaubt hatten, dass er nach einem Streit fortgelaufen sei. Ihr Wiedersehen wurde mit einem großen Fest gefeiert.
Doch dann hatte Pierre die Unruhe gepackt. Er wollte zurück nach La Rochelle, wo er die Hugenottin Florence kennengelernt hatte. Er war so fasziniert von diesem klugen Mädchen, dass er sich sofort in sie verliebt hatte. Überzeugt, die Frau fürs Leben getroffen zu haben, war er bald nach der Hochzeit seiner Schwester Magali, die seinen besten Freund Olivier geheiratet hatte, in die Stadt am Atlantik zurückgekehrt, in der viele Hugenotten lebten.
Seltsam, dachte Pierre, welche Wege das Leben manchmal geht. Ohne den Unfall hätte er niemals das Korbflechterehepaar kennengelernt. Ohne sie wäre er nie nach La Rochelle gekommen und hätte niemals Florence getroffen.
Er seufzte, als kalter Wind ihn streifte, und schlug die Augen auf. »Oh, ich muss eingeschlafen sein«, fluchte er, als er erkannte, dass die Sonne weitergewandert war. Sein Kreuz schmerzte vom harten Untergrund. Stöhnend setzte er sich auf. Das Meer war unruhig geworden. Wellen klatschten gegen die Ufersteine.
»Hoffentlich habe ich nicht die sechste Stunde verpasst«, murmelte er, als eine Welle hoch über einen Stein sprang und seine Hosenbeine durchnässte. »Merde!«, rief er und brachte sich in Sicherheit. Da hörte er die Turmuhrschläge, die leise an sein Ohr drangen. »Fünf!«, zählte er erleichtert und machte sich auf den Rückweg zum Hafen, um, wie er sehnlichst hoffte, Florence zu treffen.
Kapitel 5
Der Tag erwachte. Stück für Stück gab die aufsteigende Sonne die Landschaft frei. Wie jeden Morgen um diese Zeit saß Isabeau Beron an der Schießscharte des runden Saals und blickte hinunter auf das karge Sumpfgelände. Hin und wieder erschienen Farbkleckse in dem öden Grau. Weiße Pferde und schwarze Rinder, die für die Camargue typisch waren, wanderten durch ihr Bild und lenkten von der Tristesse der Umgebung ab. Manchmal ließ sich ein Schwarm Flamingos in den Sümpfen unterhalb des Turms nieder und bereicherte die eintönige Landschaft mit zartroten Tupfern.
Seit drei Jahren sah Isabeau nur diesen schmalen Ausschnitt der Gegend, in der sie geboren war und fünfunddreißig Jahre frei gelebt hatte. Bis eines Morgens katholische Soldaten in ihr Haus gestürmt waren, sie gefangen genommen und in den Turm gesperrt hatten. Isabeau war weder eine Diebin noch eine Betrügerin oder gar eine Mörderin. Als sie nach dem Grund ihrer Gefangennahme fragte, beschuldigte man sie, gegen den französischen König zu hetzen, da dieser katholisch getauft war und sie seinen Glauben nicht teilte. Isabeau konnte darüber nur lachen.
Zwar hatte König Heinrich III. von Frankreich den katholischen Glauben zur herrschenden Religion seines Landes bestimmt, doch nicht jeder Franzose folgte ihm. Die Hugenotten hingen treu dem Protestantismus an, und Heinrich duldete lange die Ausübung ihrer Religion. Doch da seine Mutter, Katharina von Medici, sich in seine Regierungsgeschäfte einmischte, sah sich der König schließlich genötigt, die Hugenotten mit Gewalt zu zwingen, ihrem Glauben abzuschwören.
Viele Hugenotten flohen aus Frankreich, andere suchten Schutz in den sicheren Städten wie La Rochelle oder Aigues- Mortes. Wieder andere traten zum katholischen Glauben über. Doch die meisten Hugenotten widerstanden – einerlei, wie hart die Bestrafungen waren.
Zu ihnen gehörte Isabeau Beron. Ihr Ungehorsam war der Grund, warum man sie einsperrte – das wurde ihr erklärt, als man ihr einen Strick um den Leib schnürte und sie in das Verlies hoch oben in den Turm zog. Doch Isabeau wusste es besser. Sie ahnte, dass man durch ihre Verhaftung versuchte, Druck auf ihren Bruder auszuüben, sich zu stellen.
Philippe Beron war der Anführer einer Bewegung, die sich gegen die katholische Kirche und somit gegen den französischen König auflehnte. Die combattants, wie sie sich nannten, hatten so viele Anhänger, dass die Katholiken in ihnen eine ernsthafte Bedrohung sahen. Isabeaus Bruder war ein einfacher Dorfschreiber, der nichts verbrochen hatte, als er seinen Freund Mathieu Fabré in seinem Haus predigen ließ. Diese Predigten und geheimen Treffen der Hugenotten waren verboten und wurden hart bestraft. Schon zweimal hatte sich ein Verräter in Philippes Gemeinschaft eingeschlichen und die beiden Freunde angezeigt. Doch jedes Mal konnten sie den Soldaten entkommen. Philippe und Mathieu flohen in die Schweiz, wo den Hugenotten Glaubensfreiheit gewährt wurde. Beide erwogen, in der Verbannung sesshaft zu werden. Doch da sie ihre Familien in Frankreich zurücklassen mussten, entschieden sie sich zurückzukehren. Das bedeutete für sie allerdings, das gefährdete Leben von Verfolgten aufzunehmen. Die combattants wurden ihrem Namen gerecht, denn wie wagemutige Kämpfer widersetzten sie sich allen katholischen Verboten, getrieben von ihrem protestantischen Glauben. Trotz der Gefahr, gefangen genommen und womöglich auf eine Galeere verbannt zu werden, wagten sie es, Nacht für Nacht Gläubige an geheimen Plätzen um sich zu versammeln und mit ihnen ihre verbotenen Gottesdienste abzuhalten. Trotz aller Vorsicht kam es immer wieder vor, dass ihre geheimen Versammlungen verraten wurden. Philippe und Mathieu zogen sich in die großflächigen Sümpfe zurück, in der Hoffnung, dort vor den Soldaten sicher zu sein. Da in der Tat jeglicher Versuch, ihrer habhaft zu werden, scheiterte, nahm man schließlich seine unbescholtene Schwester gefangen.
Sie nennen mich Ketzerin und mein Verlies den Ketzerturm, dachte Isabeau und versuchte, ihre Bitterkeit über diese Ungerechtigkeit zu unterdrücken. Sie musste dankbar sein, denn sie war in diesem Turm nicht allein. Zehn andere Hugenottinnen teilten das Schicksal mit ihr. Unter ihnen waren zwei Mütter, die ihre kleinen Kinder hatten mitbringen müssen. Diesen Frauen galt es Mut und Trost zu spenden. Deshalb durfte Isabeau nicht hadern, sondern sie musste Stärke zeigen.
Wegen der flammenden Sonne, die durch die längliche Lücke in der Mauer drang, kniff sie die Augen zusammen.
Es wurde Zeit, auch diese letzte Öffnung des Turms zu verschließen, um die Sommerhitze draußen zu halten. Besonders die beiden Kinder litten unter der stickigen Luft im Turm. Leider würden sie dann auch das Licht ausschließen.
Isabeau drückte ihr Gesicht in die Schießscharte. Sie wollte noch einmal ihre Lunge mit der salzhaltigen Luft füllen. Zwar würden sie im Herbst die Schießscharten wieder öffnen, doch das wäre nur von kurzer Dauer. Denn die Kälte und die Feuchtigkeit des Winters würden sie wieder zwingen, die Öffnungen erneut mit Stroh und Lumpen zu verschließen.
Isabeau blickte ein letztes Mal hinaus und nahm das Bild in sich auf, um sich in der Düsternis ihres Gefängnisses daran erinnern zu können. Schwermütig ging sie zu ihrer Pritsche und setzte sich nieder. Dort schob sie ihre Hand unter die Matratze und zog vorsichtig einen Umschlag hervor, den sie sich gegen die Brust presste. Tonlos und mit geschlossenen Augen murmelte sie das Vaterunser. Anschließend las sie zum wiederholten Mal den Brief, den einst Reformator Johannes Calvin an die gefangenen Hugenottinnen von Paris geschrieben hatte. Aus seinen Worten schöpfte Isabeau Kraft und Zuversicht, um die Hoffnung nicht zu verlieren, eines Tages den Turm verlassen zu können.
Nachdem sie den Brief gelesen hatte, steckte sie ihn zurück in den Umschlag. Selbst wenn man sie drei weitere Jahre einsperren würde, sie würde niemals von ihrem Glauben abfallen, schwor sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen. Dann legte sie den Brief zurück in sein Versteck.
Kapitel 6
Florence konnte kaum einen Bissen hinunterschlucken. Lustlos zerlegte sie ihr Essen in kleine Stücke, die sie vom rechten zum linken Tellerrand schob. Wie sollte sie es schaffen, rechtzeitig am Kettenturm zu erscheinen, wenn sie hier beim Essen aufgehalten wurde?, murrte sie in Gedanken und hoffte, dass den Eltern ihre Unruhe nicht auffiel. Zum Glück war die Mutter wegen Florence’ jüngeren Schwestern abgelenkt. Anstatt sittsam und ruhig bei Tisch zu sitzen, redeten die beiden Mädchen unaufhörlich und zappelten auf ihren Stühlen herum.
»Francine, Marie, benehmt euch!«, rügte die Mutter die Töchter.
Sofort verstummten die beiden, um kurz darauf loszuprusten und zu kichern.
Florence schaute vorsichtig zu ihrem Vater. Der sah die beiden Mädchen strafend an.
»Erst vor wenigen Tagen wurde ein Kind in deinem Alter, Francine, bei Wasser und Brot außerhalb der Stadt ausgesetzt, da es ungehorsam zu seinen Eltern war«, sagte er mit leiser Stimme, während er scheinbar ungerührt weiteraß.
Francines Augen weiteten sich. Ihre Gesichtsfarbe wurde fahl. Erschrocken sah sie ihre Schwester an, der Tränen in die Augen traten. »Ich werde gehorchen«, stammelte die Siebenjährige und senkte den Blick auf den Teller.
»Ich auch«, schniefte die fünfjährige Marie.
»So ist es gut«, pflichtete die Mutter den Kindern bei.
Nun war es still am Tisch. Nur das Klappern des Geschirrs und das Abstellen der Gläser waren zu hören.
Florence war ebenso wie ihre jüngeren Schwestern über den Bericht des Vaters betroffen. Zwar kam es selten vor, dass Kinder so hart bestraft wurden, aber man hörte immer wieder davon. Erst letzten Sommer war in einer anderen hugenottischen Gemeinde ein zehnjähriges Kind ausgepeitscht worden, weil es in der Wut über ein Verbot Steine nach der Mutter geworfen hatte. Nicht auszudenken, welche Strafe Florence erwarten würde, wenn man herausfände, dass sie sich heimlich mit einem jungen Mann treffen wollte.
Vorsichtig schielte die Fünfzehnjährige zum Vater hinüber. Er schien das Interesse an seinen drei Töchtern verloren zu haben und seinen Gedanken nachzuhängen. Immer wieder verzog er den Mund zu einem schwachen Lächeln. Einmal wurde es so stark, dass er den Bissen auf der Gabel zurück auf den Teller legen musste.
Trotz der Angst vor einer Bestrafung hielt es Florence kaum noch aus im Haus. Nur zu gern hätte sie das Messer auf den Tisch geworfen und wäre hinausgerannt. Alle Menschen, die sie kannte, nahmen ihr Nachtmahl am Abend zu sich. Nur ihre Familie muss bereits am Nachmittag essen, maulte sie in Gedanken und sah mürrisch zum Vater hinüber. Seine Verdauungsprobleme verlangten, dass sie bereits früh zu Abend aßen. Monatelang hatte er nicht schlafen können, da der Druck im Magen ihn wach hielt. Keine Arznei half. Erst als der Arzt ihm vorschlug, das Nachtmahl schon um fünf Uhr nachmittags einzunehmen, besserten sich seine Beschwerden. »So haben die Lebenssäfte länger Zeit, in Eurem Magen zu verdauen, bevor es Schlafenszeit ist«, hatte der weise Mann erklärt. Seitdem schlief der Vater wie ein Kleinkind.
Florence nahm einen kleinen Bissen Fisch zu sich, damit ihre Appetitlosigkeit nicht auffiel. Sie fürchtete, dass die Uhr sieben Mal schlagen würde, bis das Geschirr abgetragen und abgewaschen war. Dann brauchte sie nicht mehr loszugehen, denn Louis würde dann wohl nicht mehr am Kettenturm sein. Aber auch wenn sie rechtzeitig fortkäme, brauchte sie einen triftigen Grund, so spät das Haus zu verlassen. Die Kirchenzucht verlangte, dass Bürger um neun Uhr abends zuhause waren, da sie sonst mit einer strengen Bestrafung rechnen mussten.
Florence spürte heftige Unruhe in sich aufsteigen. Sie suchte angestrengt nach einer plausiblen Ausrede, als ihre Mutter sagte: »Es ist zu schade, dass Maurice nicht bleiben konnte, mein lieber Albert. Nun sind zwei Fische übriggeblieben, die ich für ihn geplant hatte. Ich habe mir solche Mühe gegeben«, seufzte sie und fügte hinzu: »Die Straßenkatzen werden ihre Freude daran haben.« Mit spitzen Fingern zog sie den Grätenstrang aus dem hellen Fischfleisch und legte ihn zur Seite.
»Ich könnte Émile diese Mahlzeit zum Kettenturm bringen«, schlug Florence hastig vor. Als sie die erstaunten Blicke ihrer Eltern erkannte, sah sie angestrengt auf ihren Teller. Sie befürchtete, Vater oder Mutter könnten ihr die Freude über den spontanen Einfall ansehen.
»Was bist du doch für ein freundliches Wesen, mein Kind! Denkst an meinen armen Verwandten, dessen Frau krank darniederliegt und sich deshalb kaum um sein leibliches Wohl kümmern kann«, lobte die Mutter die Tochter und sah sie wohlwollend an. »Sobald du mit deinem Mahl fertig bist, kannst du Émile das Essen von Maurice bringen. Ich werde mit deinen beiden Schwestern und der Küchenmagd den Abwasch erledigen«, bestimmte die Mutter und widmete ihre Aufmerksamkeit erneut den Fischgräten.
»Der Herr im Himmel wird es dir danken«, fügte der Vater hinzu und nahm einen Schluck Wasser.