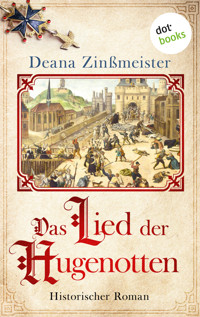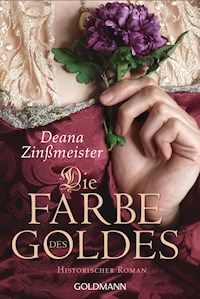9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine drohende Gefahr – eine beschwerliche Reise Ein Dorf in der Kurpfalz, um 1525. Anna Maria wächst mit ihren Brüdern auf einem Hof auf. Doch dann bricht der Bauernkrieg aus und sie kann ihren Vater nicht davon abhalten, zwei seiner Söhne, Peter und Matthias, in den Kampf zu schicken. Als Anna Maria die beiden im Traum sieht, weiß sie, dass ihnen eine unerwartete Gefahr droht – denn sie hat die Gabe, den Tod vorherzusehen. Um sie zu warnen, macht sie sich auf die gefährliche Reise an die Front. Aber bald darauf gerät sie wegen ihrer Fähigkeit in Gefangenschaft … Wird der Wolfsbanner Veit, der es als einziger gut mit ihr zu meinen scheint, ihr helfen? »Fesselnd und farbenprächtig – ein historischer Roman, den man nicht mehr aus der Hand legen möchte.« Iny Lorentz 500 Jahre sind seit den Bauernkriegen vergangen: Deana Zinßmeister lässt diese gleichermaßen schreckliche wie aufregende Zeit im ersten Band ihrer Wolfsbanner-Reihe wieder aufleben, die Fans von Sabine Ebert begeistern wird. Die Romane können unabhängig voneinander gelesen werden. In Band 2 kehrt Anna Maria mit Veit nach Hause zurück– doch er wird bezichtigt, ein Werwolf zu sein … »Ein historischer Roman, dessen Lebhaftigkeit und Fülle man sich nicht entziehen kann. Die Seiten fliegen nur so dahin, immer wieder überraschende Wendungen machen es fast unmöglich, das Buch beiseitezulegen.« Amazon-LeserIn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Dorf in der Kurpfalz, um 1525. Anna Maria wächst mit ihren Brüdern auf einem Hof auf. Doch dann bricht der Bauernkrieg aus und sie kann ihren Vater nicht davon abhalten, zwei seiner Söhne, Peter und Matthias, in den Kampf zu schicken. Als Anna Maria die beiden im Traum sieht, weiß sie, dass ihnen eine unerwartete Gefahr droht – denn sie hat die Gabe, den Tod vorherzusehen. Um sie zu warnen, macht sie sich auf die gefährliche Reise an die Front. Aber bald darauf gerät sie wegen ihrer Fähigkeit in Gefangenschaft … Wird der Wolfsbanner Veit, der es als einziger gut mit ihr zu meinen scheint, ihr helfen?
Über die Autorin:
Deana Zinßmeister widmet sich seit einigen Jahren ganz dem Schreiben historischer Romane. Bei ihren Recherchen wird sie von führenden Fachleuten unterstützt, und für ihren Bestseller »Das Hexenmal« ist sie sogar den Fluchtweg ihrer Protagonisten selbst abgewandert. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern im Saarland.
Die Website der Autorin: www.deana-zinssmeister.de
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin die Australienromane »Fliegen wie ein Vogel«, »Der Duft der Erinnerung« und den dazugehörigen Spin-Off-Roman »Sturm über dem roten Land«, die Pesttrilogie mit den Romanen »Das Pestzeichen«, »Der Pestreiter« und »Das Pestdorf« sowie die Hexentrilogie mit den Romanen »Das Hexenmal«, »Der Hexenturm« und »Der Hexenschwur«, die Hugenotten-Saga mit den Bänden »Das Lied der Hugenotten« und »Der Turm der Ketzerin« und die Wolfsbanner-Reihe mit den Titeln »Die Gabe der Jungfrau« und »Der Schwur der Sünderin«.
***
eBook-Neuausgabe November 2024
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: GRAFIKER unter Verwendung …
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-490-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Deana Zinßmeister
Die Gabe der Jungfrau
Historischer Roman
dotbooks.
Widmung
Für meinen Mann Helmut und in Erinnerung an vier »echte Pfälzer Buben« und »ein Mädchen ohne Namen«
Gedicht
Einer tritt vor.
Sein Mund ist ein brennendes Tor,
D’raus schreiten Worte glühend rot;
Bauer, dich hungert, wer hat dein Brot?
Bauer, dein Rücken ist krumm.
Wer schändet dein Weib und macht dich stumm?
Da braust’s in das Land, über Stein, Feld und Moos: Hütet euch,
Herren, der Bauer ist los!
Und ein Sturm bricht aus dem Dorfe vor -
Schlägt Flammen und Blut zu den Sternen empor.
Alfons Petzold
(aus dem Gedichtband »Der stählerne Schrei«)
Prolog
Frankenhausen 1525
Unaufhaltsam liefen dem jungen Mann Tränen über die Wangen, und wie den Regen spürte er sie nicht.
Keuchend saß er inmitten eines Waldstücks an einen Baumstamm gelehnt und presste den erstarrten Körper an sich. Der Halbmond erhellte den Nachthimmel, sodass er das Gesicht des Toten klar erkennen konnte.
Fast lautlos flüsterte er den Namen des toten Mannes und wischte mit seinen schmutzigen Fingern die Schlammkruste aus dessen Gesicht. Er verrieb den Moder auf der Haut, bis die Stirn des Toten fast sauber war. Dann drückte er seine Lippen darauf.
Weder die fahle Haut noch der Geruch störten ihn, denn es war sein Bruder, den er wie ein Kleinkind in den Armen hielt. Wieder berührte sein Mund die Stirn des Toten – ein letzter Kuss von Bruder zu Bruder.
Mit letzter Kraft und unter großer Anstrengung hatte er ihn seinem nassen Grab entrissen – ihn mit seinen eigenen Händen aus dem Erdboden geholt.
Der junge Mann spürte weder die Verletzungen, die er sich dabei zugezogen hatte, noch das Brennen der feinen Wunden auf den Fingerkuppen, wo er sich beim Graben die Haut abgerieben hatte. Auch den pochenden Schmerz, den seine tief eingerissenen Fingernägel verursachten, beachtete er nicht.
Für ihn zählte nur, dass sein Bruder nicht mehr in fremder Erde lag. Jetzt war es an der Zeit, dessen letzten Wunsch zu erfüllen und ihn heimzubringen.
Gegenseitig hatten sie sich dieses Versprechen gegeben – damals, bevor sie in diesen verdammten Krieg gezogen waren, weil der Vater es von ihnen verlangt hatte.
»Bist du nun zufrieden, Vater?«, hätte er am liebsten in die Nacht hinausgeschrien. Doch er blieb stumm. Stattdessen fuhr er sich mit der Hand über die Augen und wischte die Tränen und die Erinnerung fort.
Die Zeit drängte. Es war bereits kurz nach Mitternacht, und er hatte noch viel zu tun.
Behutsam legte er den Leichnam seines Bruders auf den nassen Boden, stand auf und lockerte die steifen Glieder. Nun spürte er den Schmerz, doch er schenkte ihm keine Beachtung, sondern fasste den Toten unter den Armen, um ihn tiefer in den Wald zu ziehen. Erschrocken stellte er fest, dass dabei die Fersen der Leiche verräterische Spuren im aufgeweichten Boden hinterließen. Doch dann sah er, wie der Regen Tannennadeln und Laub über die Vertiefungen spülte und sie wieder verwischte.
›Als ob die Natur meinen Plan gutheißen würde‹, dachte er und zog seinen Bruder weiter ins dichte Gehölz. Dann hatte er einen geeigneten Platz für sein Vorhaben gefunden.
Vom Schweiß der Anstrengung und vom Regen durchnässt, bettete er den Toten behutsam zwischen zwei Bäume und sah sich um. Zufrieden nickte er und flüsterte kaum hörbar: »Hier soll es sein! Hier werde ich mein Versprechen einlösen.«
Erster Teil
Kapitel 1
Mehlbach, ein kleiner Ort in der Kurpfalz, 1324
Die Luft war eisig und brannte doch wie Feuer in der Lunge der jungen Frau. Das flachsblonde Haar fiel strähnig und feucht auf ihre schmalen Schultern. Scheu schaute sie sich um.
Rauchschwaden hingen wie Nebel über der schneebedeckten Ebene, deren Erde wie mit Blut getränkt schien. Aufgespießte und zerstückelte Leiber von Toten, die ihr Leben auf dem Schlachtfeld ausgehaucht hatten, lagen zu Tausenden im Tal. Verwundete wanden sich schreiend in ihren Schmerzen.
Als die junge Frau eine Bewegung wahrnahm, wandte sie den Kopf zur Seite. Sie sah einen Reiter, der sein Schwert wie zum Angriff über dem Kopf schwang und auf die verwundeten Männer zu galoppierte. Mit gezielten Hieben tötete er die am Boden liegenden Verletzten.
Verzerrt drangen die Schreie der Männer zu ihr herüber, berührten sie jedoch nicht. Gleichgültig wandte sie ihre Aufmerksamkeit von dem Reiter ab und ließ den Blick über das Schlachtfeld schweifen.
Die junge Frau wusste nicht, wie sie an diesen Ort gekommen war und was sie hier sollte – zumal sie die einzig Unbeteiligte zu sein schien.
Als sie weitergehen wollte, glaubte sie auf der Stelle zu treten. Ihre Beine fühlten sich an, als ob sie durch Pfützen aus Blut, das ihr bis zu den Knien spritzte, watete. Sonderbarerweise schien es sie aber nicht zu stören. Auch dass Blut ihr weißes Gewand rot verfärbte, berührte sie nicht. Nur die vielen Toten um sie herum waren ihr unheimlich. Plötzlich stand sie dicht vor einem Totem. Er lag auf dem Bauch, und sie konnte sein Gesicht nicht erkennen.
Ihr Herz raste vor Angst, dass der Tote kein Unbekannter sein könnte. Zögerlich drehte die junge Frau den Leichnam auf den Rücken und blickte in die gebrochenen Augen eines Fremden. Auch das Gesicht des nächsten Toten war ihr nicht vertraut. Sie beugte sich über jeden leblosen Körper, über den sie hinwegsteigen musste – jedes Mal von Furcht erfüllt, dass es ein bekanntes Gesicht sein könnte.
Nachdem sie in zahllose tote Gesichter geschaut hatte, ließ sie den Blick über das Feld schweifen.
Rauch breitete sich aus, und nur noch schwach drangen die Schreie und Stimmen der Sterbenden an ihr Ohr. Erschöpft sank sie mitten hinein in eine Pfütze aus Schneematsch und Blut, was sie aber nicht zu erschrecken schien.
Und dann erblickte die junge Frau in der Mitte des Feldes einen jungen Mann. Er war niedergekniet, hatte seine Lanze als Stütze vor sich in den Boden gestemmt und hielt den Blick gesenkt. Sein Körper zitterte, und er blutete aus einer Wunde am Kopf. Obwohl sie sein Gesicht nicht sehen konnte, schien er ihr auf Anhieb vertraut.
Ein zweiter Mann stand neben dem Jüngling, versuchte ihm aufzuhelfen und redete auf ihn ein.
Zuerst verstand die junge Frau nur undeutlich, was er sagte, doch dann drangen die Worte »Es ist vorbei! Lass uns nach Hause gehen!« an ihr Ohr.
Sie glaubte die Stimme zu kennen, doch sie konnte ihr kein Gesicht zuordnen. Als sie den beiden Männern etwas zurufen wollte, kamen keine Laute über ihre Lippen.
Sie sah, wie der kniende Mann den Kopf schüttelte. Mit gebrochener Stimme sprach er: »Nun werden wir auf fremdem Boden sterben und in fremder Erde beerdigt werden!«
Bei diesen Worten brannten Tränen in den Augen der jungen Frau. Doch dann ergriff sie blankes Entsetzen, denn sie sah, wie der Reiter mit dem Schwert auf die beiden Männer zu galoppierte.
Sie erkannte die Gefahr und wollte die Ahnungslosen warnen, wollte auf sie zulaufen. Doch es war, als trete sie auf der Stelle. Völlig außer sich riss sie die Hände in die Höhe um zu winken, damit die beiden Männer die Gefahr erkennen würden.
Der fremde Reiter kam näher und näher. Erbarmungslos schwang er das Schwert über seinem Kopf. Da endlich lösten sich ihre Füße vom Boden, und sie rannte auf die beiden Unbekannten zu. Doch als sie kurz vor ihnen zum Stehen kam, bemerkte sie, dass die beiden Männer sie nicht wahrzunehmen schienen. Keiner der beiden zeigte eine Regung, gerade so, als sei sie unsichtbar. Dann flüsterte der am Boden Kniende: »Ich werde meine Liebste nie wieder sehen!«, und blickte ihr dabei geradewegs in die Augen. Voller Entsetzen erkannte die junge Frau nun den Verwundeten.
Schon spürte sie das Schnauben des Pferdes im Nacken, als ein Schrei sie aufschrecken ließ.
***
»Anna Maria, wach endlich auf. Herrgott Mädchen, du schreist ja den ganzen Hof zusammen.«
Erschrocken und verwirrt schaute Anna Maria in die weit aufgerissenen Augen von Lena, der Magd.
Ungläubig sah sie an sich herunter. Kein blutverschmiertes Kleid, kein Schlachtfeld, auf dem sie stand. Sie lag in ihrem Bett – daheim auf dem elterlichen Hof. Sie hatte nur einen furchtbaren Traum gehabt.
Doch als sie an die Worte dachte und sich an den Ritter mit dem Schwert in der Hand erinnerte, begann ihr Herz zu rasen. Angst schien ihre Kehle zuzuschnüren.
»Sie sind in Gefahr und ahnen es nicht!«, flüsterte sie. Tränen verschleierten ihren Blick, als sie aufsprang und rief: »Ich muss sie warnen! Sonst werden sie sterben!«
»Wen musst du warnen? Wer ist in Gefahr?«
»Meine Brüder! Peter und Matthias!«
Ungläubig sah die Magd das Mädchen an. »Wie willst du das wissen?«
»Ich habe sie gesehen – mein Traum hat es mir verraten. Ich muss sie suchen.«
Schon war Anna Maria aus dem Bett gesprungen und wollte an der Magd vorbeistürmen. Diese ergriff ihr Handgelenk, um sie aufzuhalten.
»Mädchen, du sprichst wirres Zeug? Es war nur ein Traum!«
»Es war nicht nur ein Traum!«, antwortete Anna Maria mit ernster Stimme.
»Wo willst du sie suchen? Etwa auf dem Schlachtfeld? Als Frau? Anna Maria, das ist dummes Zeug.«
Wütend sah das Mädchen Lena an und wand sich aus deren Umklammerung. Unbeirrt begann es sich anzukleiden.
Die Stimme der Magd klang nun verärgert: »Deine Brüder kämpfen auf Geheiß eures Vaters bei diesen Aufständen. Er würde nie und nimmer gestatten, dass sie nach Hause kommen, nur weil du glaubst, dass sie in Gefahr sind. Du würdest deinen Vater und auch deine Brüder zum Gespött der Leute machen.«
»Verstehst du nicht? Sie werden sterben, wenn ich sie nicht heimhole!«
»Herrgott, Anna Maria, nimm Vernunft an. Selbst wenn du eine Vorsehung hattest, wie willst du ihnen helfen! Du bist eine Frau und begibst dich nur selbst in Gefahr! Vielleicht sind sie schon tot!«
»Nein, sind sie nicht! In meinem Traum war die Erde schneebedeckt, doch jetzt ist Ende September. Ich muss sie gefunden haben, bevor der erste Schnee fällt.«
Als die Magd Anna Marias entschlossenen Blick sah, wusste sie, dass nichts und niemand das Mädchen aufhalten konnte. Lena wusste, wie sehr Anna Maria ihre beiden Brüder liebte. Schon seit frühester Kindheit hatten die drei immer zusammengehalten. Als die Mutter starb, waren Anna Maria deren Aufgaben und Pflichten zugefallen. Besonders für ihren jüngeren Bruder Matthias fühlte sie sich verantwortlich und mit ihrem älteren Bruder Peter verstand sie sich ohne Worte. Lena ließ Anna Marias Arm los.
Für einen Moment schloss die Magd die Augen und atmete tief durch. Dann sah sie Anna Maria an und sagte: »Nun gut, erzähl mir deinen Traum!«
***
Noch am selben Vormittag suchte Anna Maria ihren Vater in der Stube auf. Daniel Hofmeister stand am Fenster und rief dem Gesinde die letzten Anweisungen zu. Als sie ins Zimmer trat, fragte er überrascht: »Was willst du?«
Seit dem frühen Morgen hatte Anna Maria sich das Gespräch mit dem Vater in Gedanken zurechtgelegt. Sie wusste, wie sie es beginnen und wie sie seine Einwände niederreden wollte. Doch jetzt, als sie vor ihm stand, versagte ihr die Stimme.
Hofmeister baute sich vor seiner Tochter auf, stemmte die Hände in die Hüften und sah sie herausfordernd an. Als noch immer kein Ton über ihre Lippen kam, fuhr er sie an: »Bist wohl in Schwierigkeiten, was?«
Entsetzt schüttelte Anna Maria den Kopf, schwieg aber weiter. Der Bauer verlor nun endgültig die Geduld und raunzte mürrisch: »Verschwinde und mach dich an deine Arbeit!«
Anna Maria wusste, dass sie jetzt etwas sagen musste, sonst wäre die Gelegenheit vertan. Stockend erzählte sie von ihrem Traum und dem Plan, die Brüder zu retten.
Schweigend hörte Hofmeister ihr zu und zeigte keinerlei Regung. Als sie geendet hatte, drehte er sich zum Fenster. Anna Maria stand da und wartete. Nach einer Weile fragte sie leise: »Vater, gibst du mir deinen Segen?«
Er blickte sie wieder an, und seine Augen waren kalt.
»Wie kannst du erwarten, dass ich solch einen dummen Plan billigen würde? Da draußen herrscht Krieg. Gesinde, Bauern und Söldner kämpfen für die Rechte der armen Leute. Glaubst du, dass sie auf ein dummes Mädchen Rücksicht nehmen würden? Wie kannst du Weibsbild glauben, dass du die beiden Burschen finden würdest? Du weißt von der Welt da draußen gar nichts! Dein Platz ist hier auf dem Hof – nirgends sonst!«
Als er sich wieder umdrehen wollte, schrie Anna Maria: »Du hast sie in ihren Untergang geschickt, obwohl ich dich angefleht habe, sie nicht ziehen zu lassen. Sie haben keine Erfahrung und müssen für etwas kämpfen, was du für richtig hältst. Warum bist du nicht selbst gegangen?« Zorn lag in ihrer Stimme.
Bevor Anna Maria in der engen Kammer zurückweichen konnte, war der Vater mit einem Schritt bei ihr und gab ihr eine schallende Ohrfeige. Ihr Gesicht brannte wie Feuer, doch sie jammerte nicht und fasste sich auch nicht mit der Hand an die Wange. Mit trotzigem Blick sah sie den Vater an.
Hofmeisters Gesichtsausdruck war hart geworden. Anna Maria erkannte, dass er sich beherrschen musste, denn er hielt die Hände zu Fäusten geballt.
Sie fürchtete, dass er von seiner Meinung nicht ablassen würde, deshalb sagte sie gefasst: »In der Nacht, als sich Mutter von mir verabschiedete, habe ich ihr geschworen, dass ich auf meine Brüder aufpassen würde.«
Als ihr Vater aber selbst bei der Erwähnung der Mutter keinerlei Regung zeigte, verließ Anna Maria ohne ein weiteres Wort das Zimmer.
***
Gegen Abend kam Anna Marias jüngster Bruder Nikolaus zu ihr in den Hühnerstall gelaufen und sagte außer Atem: »Der Vater will dich in seiner Stube sprechen. Sofort!«
Anna Maria drückte dem Zehnjährigen den Futtereimer in die Hand und eilte ins Haus. Zaghaft klopfte sie an die Tür und trat auf Geheiß des Vaters ein.
Wieder stand er am Fenster und schaute sie ernst an. Die Härte war aus seinem Gesicht verschwunden. Anna Maria hatte sofort den Umhang auf dem Bett entdeckt, ebenso den Wanderstab. Auch war die Truhe geöffnet, das Allerheiligste des Vaters, zu der nur er den Schlüssel hatte. Bevor Anna Maria darüber nachdenken konnte, was das wohl zu bedeuten hatte, sagte der Vater mit ernster Stimme: »Anna Maria, ich werde dir meinen Segen geben!«
Die Augen des Mädchens weiteten sich ungläubig, und es wollte etwas erwidern. Doch der Vater hob die Hand, damit es schwieg.
»Allerdings«, fuhr er fort, »wirst du dich erst auf den Weg begeben, wenn ich es dir sage!«
»Warum, Vater? Jeder weitere Tag, den ich warte, ist vertan!«
»Herrgott, Anna Maria, musst du immer widersprechen? Kannst du dich nicht einmal fügen?«, fragte er ungehalten. Erschrocken sah sie auf, doch sein Blick ruhte verständnisvoll auf ihr. »Ich werde versuchen herauszufinden, wohin deine Brüder gegangen sind. Es gibt viele Möglichkeiten, und deshalb ...«
»Wie willst du das in Erfahrung bringen?«, wurde er von seiner Tochter unterbrochen.
Hofmeister seufzte vernehmlich und sagte mehr zu sich: »Du lässt mir tatsächlich keine andere Wahl.« Dann fuhr er an seine Tochter gerichtet fort: »Auch ich habe in jungen Jahren für die Rechte der armen Menschen gekämpft.«
Wieder unterbrach ihn Anna Maria: »Wann soll das gewesen sein? Du bist doch nur zu Wallfahrten aufgebrochen. Nie habe ich gehört, dass du auch gekämpft hast.« Zweifel lag in ihrer Stimme.
Hofmeister forderte seine Tochter auf, sich auf das Bett zu setzen, und nachdem er neben ihr Platz genommen hatte, wählte er seine Worte mit Bedacht: »Ja, das ist wohl wahr, Anna Maria. Niemand weiß davon! Auch deine Mutter hatte nichts geahnt. Deshalb werde ich dir nur so viel verraten: Nicht alle Wallfahrten führten mich ins Heilige Land. Schon bevor ich deine Mutter kennengelernt hatte, zog ich als Landsknecht übers Land. Deshalb kenne ich die Gefahren und weiß, was dich da draußen erwarten wird. Du hast gefragt, warum ich nicht selbst gegangen bin? Ich bin alt und habe genug gekämpft. Meine zwei Buben haben mein Erbe angetreten und werden für unsere Rechte kämpfen! Du glaubst, dass ich sie gezwungen habe? Nein, Anna Maria, sie gingen freiwillig, und nichts und niemand hätte sie aufhalten können. Sie fühlen denselben Drang, den ich als junger Mann gespürt habe. Nur deshalb ließ ich sie ziehen. Ich lasse auch dich gehen, weil ich weiß, dass nichts und niemand dich aufhalten kann.« Er lachte auf und klopfte ihr auf die Schulter.
»Nimm folgende Ratschläge von mir an, Tochter! Kleide dich mit meinem Pilgerumhang, und nimm meinen Pilgerstab. Wallfahrer werden geachtet, und man lässt sie in Ruhe. Ich hoffe, dass dies auch die umherziehenden Bauern beherzigen werden. Gehe die gebräuchlichen Wege, und nur für die Nacht suche dir einen geschützten Platz in einem Wald.«
Hofmeister stand auf, ging zur Truhe und holte eine kleine Glasflasche hervor. Er setzte sich wieder zu Anna Maria und drückte ihr das Fläschchen in die Hand.
»Kannst du dich daran noch erinnern?«
Anna Maria nickte.
»Auch an die Wirkung und wie viele Tropfen du nehmen darfst?«
Wieder nickte sie.
»Dann ist es gut, mein Kind! Nimm das Fläschchen, vielleicht wird es dir auf der Reise dienlich sein.«
Anna Maria sah zur Truhe und nahm all ihren Mut zusammen. Jetzt fragte sie den Vater, was sie sich vor vielen Jahren, als sie schon einmal einen Blick in die Truhe erhascht hatte, nicht zu fragen getraut hatte.
»Verbirgt diese Kiste deine Vergangenheit, Vater?«
Hofmeister bejahte.
»Erzählst du mir, welche Bedeutung das Zeichen auf dem Papier hat?«
Sein Blick erstarrte. »Nein, Anna Maria, du weißt schon mehr, als gut für mich ist! Morgen werde ich versuchen zu erfahren, in welche Richtung deine Brüder aufgebrochen sind. Es wird sehr schwer sein, sie zu finden, aber es gibt immer Leute, die weiterhelfen können. Wir müssen auf Gott vertrauen!«
Damit schien das Gespräch beendet, doch Anna Maria hatte noch etwas auf dem Herzen: »Vater, wenn ich fort bin, dann bitte ich dich, dass Sarah meinen Platz auf dem Hof einnehmen kann.«
Kaum hatte sie den Namen von Hofmeisters Schwiegertochter ausgesprochen, verfinsterte sich sein Gesicht. Doch Anna Maria ließ sich davon nicht beirren: »Sie hat bewiesen, dass sie eine anständige und fleißige Frau ist. Keine andere hätte nach einem solch schlimmen Unfall zu ihrem Liebsten gestanden. Doch Sarah ist trotz der schweren Verletzung bei Jakob geblieben. Obwohl du ihr das Leben nicht leicht gemacht hast, hat sie ihn geheiratet. Gesteh ihr das Recht der Bäuerin zu!«
Hofmeister wusste, dass er keine andere Wahl hatte. Er konnte die Schwiegertochter nicht übergehen, schließlich war sie die Frau des Hoferben.
»Ich werde es diesem Weibsbild aber nicht sagen!«
»Musst du nicht, Vater! Ich werde mit Sarah sprechen.«
***
Einige Tage später, am frühen Morgen stand Anna Maria, gekleidet in den Pilgerumhang und mit dem Pilgerstab in der Hand, auf dem Hof, um sich zu verabschieden. Liebevoll umarmte sie ihren ältesten Bruder Jakob, seine Frau Sarah und deren kleine Tochter Christel. Ihr jüngster Bruder Nikolaus klammerte sich an ihren Umhang. Ihm fiel der Abschied besonders schwer, deshalb versuchte sie ihn mit leisen Worten zu beruhigen. Auch die Knechte und Mägde hatten sich versammelt. Seit dem Tod der Mutter hatte Anna Maria die Pflichten der Bäuerin übernommen. Sie hatte mit strenger, aber gerechter Hand die Arbeit der Mutter fortgeführt und war beim Gesinde beliebt.
Nun ging sie zu ihrer Schwägerin Sarah und bat sie freundlich: »Solange ich fort bin, möchte ich, dass du meinen Platz als Bäuerin einnimmst.« Als Sarah etwas erwidern wollte, unterbrach Anna Maria sie sogleich: »Ich habe mit dem Vater gesprochen. Er ist einverstanden und wird es zulassen.«
Mit großen Augen sah Sarah nun zu ihrem Mann, der aufmunternd seinen gesunden Arm um sie legte. Dann wandte sie sich wieder Anna Maria zu und nickte stumm.
Die Magd Lena kam mit einem Bündel aus dem Haus gelaufen, das sie Anna Maria mit den Worten überreichte: »Hier, mein Kind, damit du nicht verhungerst. Komm gesund mit deinen beiden Brüdern nach Hause.«
Anna Maria war gerührt und rang für einen kurzen Augenblick um Fassung. Doch rasch fing sie sich wieder und erwiderte lächelnd: »Ja, Lena, das verspreche ich!«
Dann trat sie einige Schritte zurück und schaute hinauf zu der Stube ihres Vaters. Wie sie gehofft hatte, stand er am Fenster und blickte zu ihr herunter. Sie hatte nicht erwartet, dass er sich vor allen von ihr verabschieden würde. Doch als er seine Hand zum Gruß hob, überkam sie ein Gefühl der Ruhe. Wärme breitete sich in ihrem Körper aus. Das tiefe Gefühl der Verbundenheit zwischen sich und dem Vater hatte sie viele Jahre zuvor schon einmal spüren können. Damals, als ihr Bruder Peter schwer verletzt war und der Vater sie ins Vertrauen gezogen hatte.
Sie hob den Pilgerstab, um den Gruß des Vaters zu erwidern, und schritt entschlossen zum Tor hinaus.
Kapitel 2
Gegen Abend schmerzten Anna Marias Füße, und sie hatte Blasen an den Fersen. In einem Waldstück, etwas abseits des Weges, suchte sie sich an einem Bachlauf einen Schlafplatz für die Nacht.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht zog sie die neuen Lederbundschuhe aus, die der Vater ihr hatte anfertigen lassen. Erleichtert kühlte sie die Füße im kalten Wasser.
Sie nahm ein Stück Brot aus dem Beutel und schnitt sich eine dicke Scheibe von der Grauwurst ab, die Lena ihr eingepackt hatte. Zufrieden und hungrig nahm sie ihr Mahl zu sich. Den Durst löschte sie mit dem klaren Wasser des Bachs. Als sie nach einem Apfel im Beutel suchte, spürte sie die kleine Glasflasche in ihrer Hand. Mit gemischten Gefühlen zog sie das Behältnis hervor. Ein Lichtstrahl brach sich im Glas und ließ die Flüssigkeit dunkelblau leuchten. Anna Maria drehte die kleine Flasche hin und her.
Schon einmal war ihr Bruder Peter dem Tod nahe gewesen, und nur weil der Vater besonnen gehandelt hatte, war er am Leben geblieben. Anna Maria erinnerte sich genau an den Tag, der so harmlos begonnen hatte und beinahe in einer Tragödie geendet hätte.
Mehlbach, November 1520
Aufgeregte Stimmen drangen an das Ohr des schlafenden Mädchens. Zuerst hörte es diese nur schwach. Wie zarte Melodien, die langsam anschwollen, wurden die Geräusche lauter und weckten Anna Maria. Die Augen aber hielt sie geschlossen, sie spürte nur, dass ihre Nasenspitze und der rechte Arm, der unverhüllt auf der Decke gelegen hatte, kalt waren. Fröstelnd zog sie den Arm unter die warme Bettdecke und umschlang ihre Beine.
»Es ist eisig geworden, nicht wahr?« vernahm sie eine Stimme.
Erschrocken öffnete Anna Maria die Augen und schaute in das Gesicht ihres jüngsten Bruders Nikolaus, der vor ihrem Bett stand. »Bist du närrisch, mich so zu erschrecken?«, fuhr sie ihn an. Doch schnell beruhigte sie sich wieder, gähnte und fragte: »Was willst du?«
»Mutter schickt mich. Du sollst mehr Mehl mahlen. Außerdem sind die Tante und der Onkel von der Rauscher Mühle schon da.«
»Dann sind sie aber sehr früh losgefahren«, sagte Anna Maria verwundert. Obwohl es noch dunkel war, konnte man auf dem Hof bereits reges Treiben hören.
»Ist Vater schon unten?«
Nikolaus schüttelte den Kopf. »Nein, er schläft noch ... Das ist auch gut so ...«
Fast mitleidig sah sie ihren Bruder an. Erst gestern hatte Nikolaus vom Vater mit dem Riemen Schläge bekommen. Sie hatte ihn weinend im Hühnerstall gefunden und ihn getröstet. Auf ihre Frage, warum er eine Tracht Prügel bekommen hatte, wollte er nicht antworten. Das Mädchen wusste, dass der Vater keinen Grund benötigte, um seine Kinder zu züchtigen. Nur zu schnell rutschte ihm die Hand aus – besonders bei seinem Jüngsten.
»Dann werde ich mich jetzt ankleiden.«
Als ihr Bruder keine Anstalten machte zu gehen, sagte sie: »Dreh dich zur Seite, Nikolaus.«
»Warum?«, fragte er mürrisch und setzte sich auf die Bettkante.
»Damit du mir nicht beim Ankleiden zuschauen kannst.«
Seit Anna Maria festgestellt hatte, dass sich ihr Körper veränderte, hätte sie ihre Brüste am liebsten unter einem weiten Kittel versteckt. Es war ihr unangenehm, zumal sie nun, mit dreizehn Jahren, die Blicke der Knechte schon auf sich spürte.
»Aber ich weiß doch, dass deine Brust schon fast so groß ist wie die von Lena ...«
Mit hochrotem Kopf fauchte Anna Maria ihn an: »Dreh dich um oder ich werde dir eine Abreibung geben, die du nicht vergessen wirst. Außerdem erzähle ich es dem Waldgeist, und der zieht dich zwischen die Wurzeln der großen Eiche, wo er wohnt.«
Anna Marias Drohung hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Erschrocken sprang der Sechsjährige auf und verließ rasch die Kammer der Schwester.
***
Anna Maria ging ins Backhaus, wo die Magd Hilde gerade dabei war, Brotteig in den hohen Ofen zu schieben. Bereits mehrere fertig gebackene Brotlaibe lagen zum Abkühlen auf dem Tisch.
»Ich hatte doch genug Mehl gemahlen. Warum benötigst du noch mehr?«
Schwitzend zog die Magd die nächsten gebackenen Laibe aus dem Backofen hervor. Statt zu antworten wies sie mit dem Kinn in eine Ecke des Raumes. Dort lagen vier verkohlte Brote.
»Du dummes Ding hast sie verbrennen lassen!«, schimpfte Anna Maria. Obwohl sie jünger als Hilde war, konnte sie sich als Tochter des Bauern solch eine Zurechtweisung erlauben.
Die Magd blieb weiter stumm und legte erneut Teig auf den Schieber. Anna Maria konnte am Blick der Magd erkennen, dass ihre Schelte sie nicht berührte.
Mürrisch holte Anna Maria den Schlüssel aus ihrer Rocktasche, öffnete die Kornkiste und entnahm mit einer Holzschaufel Weizen. Vorsichtig, damit kein Korn verloren ging, füllte sie den Weizen in das Steinloch der Mehlmühle. Dann drehte sie gleichmäßig die Kurbel der Mühle und zerrieb die Schale. In dem Holzkasten, in dem die Steinmühle stand, sammelte sich das helle Mehl. Als Anna Maria genügend Weizen gemahlen hatte, füllte sie das Mehl in eine Schüssel und stellte sie der Magd auf den Tisch.
»Hier, das müsste reichen.« Im Hinausgehen fügte sie noch hinzu: »Aber pass dieses Mal auf, dass das Brot nicht wieder verbrennt!«
Anna Maria ahnte, dass ihr das Mädchen hinter ihrem Rücken die Zunge herausstrecken würde.
Erst im letzten Jahr hatte die Mutter der Tochter die Aufgabe des Mehlmahlens anvertraut, denn nur so konnte sie sichergehen, dass nicht ein Korn verschwendet würde.
Mit knurrendem Magen ging Anna Maria ins Küchengebäude. Als die Mutter sie sah, strich sie ihr liebevoll die Mehlspuren aus dem Gesicht.
»Hunger?«, fragte sie die Tochter. Ohne eine Antwort abzuwarten stellte sie ihr eine Schüssel mit warmem Hirsebrei und einen Becher Milch auf den Tisch.
»Zur Feier des Tages«, sagte die Mutter, als sie etwas Honig in den Brei fließen ließ. Mit einem breiten Lächeln bedankte sich Anna Maria und aß gierig das süße Frühstück.
Zwischen zwei Bissen sagte sie zur Mutter: »Nikolaus hat behauptet, dass die Tante und der Onkel schon da seien, aber ich habe sie nirgends gesehen.«
»Dein Onkel Willi ist im Stall und schaut nach dem Vieh, und deine Tante Margarete musste sich nach dem Frühstück ein wenig hinlegen, da sie die Anreise erschöpft hat.«
Erstaunt hielt Anna Maria inne und sah die Mutter fragend an. Diese zwinkerte nur. Tante Margarete war dafür bekannt, dass sie sehr gerne aß – meist so viel, dass ihr schlecht wurde. Außerdem suchte sie stets nach einer Ausrede, um sich vor der Arbeit zu drücken. Dazu hätte man ja schließlich das Gesinde, meinte sie. Dass es bei einem Schlachtfest hektisch zuging und man jede helfende Hand brauchen konnte, davon wollte sie nichts wissen. Mittlerweile war die Mutter sogar froh, wenn die Tante sich während der Arbeit nicht blicken ließ, da sie nur untätig im Weg herumstand.
Anna Maria hatte gerade den letzten Löffel in den Mund geschoben, als die Tür aufging und ihr Vater vor ihr stand.
»Hast du nichts zu schaffen?«, fragte er schroff.
»Doch, Vater!«, antwortete die Tochter und stand sogleich von ihrem Stuhl auf. Im Hinausgehen hörte sie, wie er gebratene Eier verlangte.
›Solche bekommen wir nur an Festtagen‹, dachte Anna Maria. Als sie auf den Hof trat, hörte sie die Schweine im Stall quieken und sah ihren ältesten Bruder, wie er mit einem Strick darin verschwand.
Plötzlich vernahm das Mädchen die donnernde Stimme des Vaters in ihrem Rücken. »Jakob!«, brüllte er über den Hof. Sogleich steckte dieser den Kopf aus der Stalltür.
»Du sorgst dafür, dass der Hannes nicht solch eine Sauerei macht wie beim letzten Mal. Ich will das Blut in der Schüssel und nicht auf dem Boden haben. Ist das klar?«
»Ja, Vater!«, erwiderte Jakob und ging zurück in den Stall.
»Du stehst ja noch immer unnütz herum! An die Arbeit, aber schnell!«, fuhr der Vater nun seine Tochter an.
Zwar tat Anna Maria, als befolge sie den Befehl. Aber als der Vater im Haus verschwunden war und ihr Bruder Jakob mit dem ersten Schwein am Strick erschien, lief das Mädchen die kleine Anhöhe hinterm Hof hinauf.
Seit vor einigen Jahren ein Schwein mit abgeschlagenem Ohr dem Schlachter entwischt und blutend und schreiend auf Anna Maria zugelaufen war, vermied sie es, beim Abstechen dabei zu sein.
Jakob würde auf zwei Fingern pfeifen, wenn die beiden Schweine tot waren. Da der Vater sich erst wieder blicken lassen würde, wenn die Schweinehälften am Haken hingen, würde er ihr Verschwinden nicht bemerken.
Als das Mädchen weit genug vom Hof weg war, sang es zuerst leise, dann mit kraftvoller Stimme ein Lied. Es wusste, dass sein Gesang auf dem Hof nicht zu hören war. Zum Glück! Denn weder malen noch singen erlaubte der Vater seiner Tochter.
An manchen Sonntagen, wenn die Arbeit ruhte und Anna Maria den Vater im Gasthof im Nachbardorf Katzweiler wusste, ging sie tief in den Wald zum stillgelegten Steinbruch.
Dort malte sie mit Holzkohle Bilder an die Steinwände. Aus der Erinnerung heraus konnte Anna Maria Tiere des Waldes zeichnen. Egal ob Fuchs, Hase oder Maus – jedes Bild sah so lebendig aus, als ob die Tiere einem entgegenspringen würden. Auf der Wand des Steinbruchs fand sich kaum eine Stelle, die nicht bemalt war.
Anna Maria hatte lange mit sich gerungen, bevor sie sich ihrem Bruder Peter anvertraute und ihm die bemalten Wände zeigte. Sie erinnerte sich, wie er die Zeichnungen voller Bewunderung betrachtet hatte.
»Kleine Schwester, du machst mir Angst. So etwas habe ich noch nie gesehen, als ob die Tiere jeden Moment anfangen würden zu atmen.«
Anna Maria hatte vor Stolz gestrahlt. Doch dann hatte Peter gemurmelt: »Wie von Teufelshand geschaffen!«
Das hatte sie so erschreckt, dass sie in Tränen ausgebrochen war. Als ihr Bruder begriff, was er da soeben gesagt hatte, versuchte er rasch, sie zu beruhigen: »So habe ich es nicht gemeint, Anna Maria! Es ist nur, ich kenne niemanden, der so etwas kann. Wenn Vater davon wüsste, er würde dich so schlimm züchtigen, dass du nicht mehr sitzen könntest. Du weißt, dass er das nie sehen darf.«
Das Mädchen wusste, wie sehr ihr Bruder Recht hatte. Käme ihr Vater je hinter ihr Geheimnis, so würde das schlimme Folgen für sie haben. Erst vor kurzem hatte er ihr eine schallende Ohrfeige gegeben, als sie beim Äpfelschälen laut ein Liedchen geträllert hatte. Dabei war es ein Dankeslied gewesen, das sie in der Kirche gehört hatte.
»Willst du unseren Herrgott verspotten?«, hatte der Vater sie mit zornig funkelnden Augen angeschrien. Allein um ihre hausfraulichen Pflichten solle sie sich kümmern. »Nur dafür hat dich unser Herrgott erschaffen!«
Anna Maria wusste, dass sie sich auf ihren älteren Bruder Peter verlassen konnte und ihr Geheimnis bei ihm sicher war. Schließlich hatte er oft am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie es sich anfühlte, wenn der Vater wütend war.
Als Jakobs Pfiff ertönte, ging Anna Maria zurück zum Hof. Das Stimmengewirr, das sie bereits kurz vor den Stallungen empfing, ließ die vielen Menschen auf dem Hof erahnen. Beim Schlachten halfen stets Nachbarn mit, zumal es hieß »Wurst wider Wurst« – was nichts anderes bedeutete, als dass bei jedem Schlachtfest jeder dem anderen von seinem Schwein etwas abgeben musste. Solange die Wege schneefrei waren, ließen es sich auch Verwandte aus den umliegenden Dörfern nicht nehmen, in das kleine Bauerndorf Mehlbach zu kommen. Konnten sie sich doch an der Wurstsuppe satt essen und über die neuesten Geschehnisse plaudern. So erkannte Anna Maria schon von weitem die schrille Stimme ihrer Tante von der Rauscher Mühle.
Beide Schweine lagen tot im Hof. Eines war bereits ausgeblutet, aus dem anderen lief nur noch ein schwaches rotes Rinnsal.
Jakob hatte sorgsam darauf geachtet, dass der Knecht das Blut in einem Trog auffing und kaum etwas danebenging.
Ein anderer Knecht übergoss die Schweine mehrmals mit heißem Wasser. Peter reichte seiner Schwester ein scharfes Messer, mit dem sie die Haut abschaben sollte. Eifrig sammelte Nikolaus die abgeschabten Borsten ein. Er wusch und sortierte sie der Größe nach, denn fahrende Händler würden sie im Frühjahr kaufen.
Nachdem Anna Maria die Schweine gesäubert hatte, band Peter beiden Tieren einen Strick um die Hinterläufe, um sie auf ein Gerüst hochziehen zu können.
Das Ausnehmen der Schweine ging den Knechten leicht von der Hand. Lachend und feixend trieben sie sich gegenseitig an, denn wenn die Hälften am Haken hingen, bekamen die Männer den ersten Selbstgebrannten zu trinken.
»Ist das Schweinchen hakenrein, muss erst mal getrunken sein«, riefen sie dann und prosteten sich zu. Bald würde es auch Essen geben, und darauf freuten sich alle.
Als Anna Maria den Knechten Tröge und Schüsseln für die Innereien auf den Boden stellte, sah sie, wie Jakob den Kindern aus der Nachbarschaft heimlich die abgeschnittenen Schweineschwänze zusteckte.
Es war ein alter Brauch, der vor allem die Jüngsten erfreute. Der abgeschnittene Schweineschwanz wurde einem Erwachsenem heimlich am Hinterteil befestigt. Und wenn der es nicht bemerkte und mit diesem Schwänzchen hin und her lief, hatten alle ihren Spaß.
Heute sollte der alte Stiegelmeier als Erster zum Gespött der Leute werden. Mit glühenden Wangen versuchte Nikolaus, ihm ein Schwänzchen anzubinden, was Anna Maria ein lautes Lachen entlockte.
»Wir brauchen frisches Wasser, um die Därme zu putzen!«, rief ihr Peter zu und hielt ihr den leeren Eimer hin.
Das Mädchen verscheuchte die Katzen, die das Blut aufleckten, das sich in kleinen Pfützen am Boden des Schlachtplatzes gesammelt hatte. Erschrocken krähend flog ein Hahn hoch und brachte sich auf dem Heukarren in Sicherheit.
Als sie am Brunnen Wasser schöpfte, kam der Vater aus dem Haus. Mit kritischem Blick prüfte er die Schweinehälften und das aufgefangene Blut. Wortlos nickend schickte er Peter den Selbstgebrannten holen.
Das Wasser schwappte aus dem Eimer und durchnässte Anna Marias Schürze, als sie ihn vor die Füße des Bruders stellte. Ihr Vater bedachte das Mädchen mit einem kurzen Blick.
»Rühr das Blut im Kessel, damit es nicht gerinnt!«, ordnete er an, bevor er einen Knecht anwies, die Haxe mit einem wuchtigen Schlag zu zerteilen.
Kaum hatte Anna Maria den großen Rührlöffel, der mehr einem Paddel als einem Löffel glich, in der Hand, als sie die Stimme ihrer Tante Käthe vernahm.
Käthe, genannt Kätsche, war die unverheiratete Schwester ihrer Mutter und verfolgte Anna Maria stets, indem sie von dem Mädchen ein Versprechen forderte: »Gell, Mädchen, du vergisst es Kätsche nicht und sorgst dafür, dass dein Vater ihr was vererben tut!«
»Aber Tante Kätsche, du bist doch älter als der Vater und wirst sicher vor ihm sterben«, entgegnete Anna Maria dann mit schonungsloser Ehrlichkeit.
Daraufhin verfinsterte sich der Ausdruck in den Augen der gebeugten Alten. Mit ihrem dünnen, krummen Zeigefinger fuchtelte sie vor den Augen des Mädchens herum und brachte krächzend hervor: »Der Herrgott hat gehört, dass du mir den Tod wünschst. Er wird dich richten, ebenso wie deinen Vater, den Saubauer!« Dabei sah sie ängstlich zu Anna Marias Vater hinüber, der mit kritischem Blick überwachte, wie die Rippenstücke der Schweine zersägt und zerteilt wurden.
Anna Maria hörte der Alten kaum zu, da sie sich bei fast jedem Zusammentreffen dieselbe Litanei von ihr anhören musste. Nach dem ersten Mal hatte sie dem Vater von Käthes Worten berichtet. Der hatte damals nicht gezögert, die Tante am Arm aus dem Hoftor zu zerren und ihr eine schallende Ohrfeige zu geben, als die Alte ihn verfluchte. Ein Jahr lang war Käthe nicht mehr auf dem Gehöft der Hofmeisters erschienen. Die Mutter hatte die Kinder mit Essen und Brennholz zu ihr geschickt. Erst die Verlockung, am Schlachttag ein ordentliches Stück Fleisch mit nach Hause nehmen zu können, ließ Käthe die Angst vor dem Bauern im folgenden Winter vergessen. Allerdings vermied sie die unmittelbare Begegnung mit dem alten Hofmeister. Der duldete sie zwar trotz des Zwischenfalls, bedachte sie aber hin und wieder mit einem bösen Blick.
Als Käthe merkte, dass sie Anna Maria auch dieses Mal kein Versprechen entlocken konnte, zog sie ihr schwarzes Kopftuch tiefer in die Stirn und ging zu den Knechten hinüber in der Hoffnung, etwas vom Schnaps abzubekommen.
Nachdenklich schaute das Mädchen der Frau hinterher. Im Herzen tat die Tante der jungen Anna Maria leid. Käthe hatte niemanden, der sich um sie sorgte. Sie lebte allein in einem zerfallenen Haus am Rande des Mehlbachs, der dem Ort seinen Namen gab. Selten ließ sich Käthe im Dorf blicken, nur sobald geschlachtet wurde, konnte man sie auf vielen Bauernhöfen der näheren Umgebung antreffen. Mitleidig steckten ihr die Bäuerinnen gepökeltes Fleisch für die kalten Tage zu.
Von der Mutter wusste Anna Maria, dass Käthe in jungen Jahren mit einem feschen Burschen aus der Nachbarschaft verlobt gewesen war. Doch als er eines Tages fortging und nicht mehr zurückkam, war Käthe dem Gespött der Leute ausgesetzt gewesen. Man hatte ihr voller Häme vorgeworfen, dass sie den Burschen mit ihrem ewigen Gezeter verscheucht hätte. Tatsächlich war Käthe kein einfacher Mensch, und ihretwegen hatte es manchen Streit in der Familie gegeben. Trotzdem leugnete sie jahrelang, dass ihre Verlobung aufgelöst worden war. Stattdessen behauptete sie stur, ihr Bräutigam würde eines Tages zurückkehren. Doch die Jahre gingen dahin. Käthe wurde alt, einsam und verbittert.
Das Kläffen der Hofhunde, die sich um einen Knochen stritten, lenkte Anna Maria von ihren Gedanken ab. Ihr Arm schmerzte vom Rühren, deshalb sah sie sich nach ihrem nur wenig jüngeren Bruder Matthias um. Er sollte sie ablösen, doch sie konnte ihn nirgends entdecken.
»Jakob, weißt du, wo Matthias ist?« Der Bruder blickte scheu zum Vater und schüttelte kaum merklich den Kopf.
»Er soll mich ablösen, mein Arm schmerzt«, fügte Anna Maria hinzu, doch statt einer Antwort trat der Vater an den Topf und steckte den Finger in die dunkle, heiße Masse.
»Nehmt den Topf vom Feuer«, befahl er seinen beiden Kindern und leckte sich die dickflüssige, braune Masse vom Finger. »Und du, Anna Maria, sag der Mutter, dass ich Hunger habe. Sie soll mir von dem Schweinehirn für die morgige Brotzeit etwas aufheben, bevor die Gäste alles auffressen.«
Würziger Bratengeruch empfing das Mädchen in der Waschküche, wo mehrere Frauen vor Hitze und Anstrengung schwitzten. Mit scharfen Wiegemessern zerkleinerten die beiden Mägde Lena und Hilde Fleischstücke, um später mit der Masse die Därme zu stopfen. Die Leber der Schweine wurde zu einem Brei zerschnitten und gewürzt. Gemeinsam hatten die Mutter und Lena bereits die Hälfte der Innereien in heißem Fett gebraten und mit gedünsteten Zwiebeln und ausgelassenem Speck abgeschmeckt. Anna Maria wiederholte, was der Vater ihr aufgetragen hatte, und die Mutter nickte.
»Dann stell schon einmal Teller und Becher auf den Tisch. Das Essen ist bald fertig«, wies sie die Tochter an, während sie das Brot aufschnitt.
Im Nebenraum war bereits einen Tag zuvor ein großer, langer Tisch aufgebaut worden, an dem alle Platz finden würden.
Kaum stand der letzte Becher, kamen der Bauer, seine Söhne und Helfer, sowie das Gesinde und die Gäste herein. Alle sprachen laut durcheinander, bis die gefüllten Schüsseln und Krüge mit kühlem Wein auf dem Tisch standen. Dann kehrte Ruhe ein. Nach einem kurzen Tischgebet langten allé kräftig zu. Zwischen zwei Bissen vom Schweineherz bemerkte ein Bauer aus der Nachbarschaft: »Ich vermisse deinen Sohn Matthias, Hofmeister. Wo steckt er denn?«
Plötzlich herrschte Stille am Tisch, und jeder schien auf die Antwort des Bauern zu warten. Anna Maria sah, wie die Hand der Mutter leicht zitterte, als diese ein Stück Brot zum Mund führte.
»Er ist unterwegs, um ...«
»Was schlägst du mich?«, schrie Nikolaus auf und rieb sich den Hinterkopf.
»Ich brauche keinen Grund. Du hast immer Schläge verdient«, antwortete sein großer Bruder Peter. Nun lachten alle und nickten Peter zu. Anna Maria sah erstaunt ihren Bruder an, der ihr eindringlich in die Augen blickte. Anna Maria ahnte, dass etwas nicht stimmte.
Das kleine Schauspiel hatte seinen Zweck erfüllt und die Leute abgelenkt. Man sprach über anderes, lachte und flachste. Dann erhob der alte Hofmeister seinen Weinbecher, schaute kurz in die Runde und sprach: »Da läuft der gute kühle Wein in den Hals hinein!«
Alle tranken einen kräftigen Schluck und stellten dann die Becher mit lautem Knall auf den Tisch. Damit war das Essen beendet. Während den Männern Wein nachgeschenkt wurde, gingen die Frauen zurück in die Waschküche. Fleisch musste zerkleinert werden, bevor man mit dem Unterheben der Gewürze beginnen konnte. Erst nachdem die Gewürze die Wurstmasse mit ihren Aromen durchzogen hatten, würde man damit die Därme füllen.
Derweil räumten Anna Maria und die Mägde das Geschirr ab. Als das Mädchen die letzte Platte mit dem kläglichen Rest Nierchen aufnehmen wollte, griff Bauer Schütter nach dem Stück.
»Richtig zubereitet schmeckt selbst so ein dreckiges Schwein. Aber zur Abwechslung ein schönes Stück Wild, dem wäre ich nicht abgeneigt«, sagte er und stocherte mit einem spitzen Stück Holz zwischen den wenigen Zähnen herum, die ihm geblieben waren.
»Bist du wohl ruhig, du Dollbohrer!«, fauchte ihn sein Gegenüber an. »Wie soll das Stück Reh auf deinen Teller kommen? Du weißt doch, dass wir nicht jagen dürfen!«
»Seid ruhig!«, stieß ein anderer Bauer hervor. »Wenn uns jemand belauscht, sind wir dran ...«
Doch Erwin Schütter ließ sich nicht einschüchtern: »Letzte Woche jagte mein Hund eine Krähe und bekam sie zu fassen. Ich hab dem Mistvieh den Kopf abgebissen ... wunderbares dunkles Fleisch ...«, schmatzte er.
»Halt dein Maul, Erwin! Wilddieberei wird hart bestraft.«
»Niemand wird sich diesem Wagnis aussetzten.«
Erschrocken hatte Anna Maria zum Vater geschaut, der jedoch kein Wort sagte. Das heimliche Jagen war eine große Leidenschaft des alten Hofmeister. Seinem Sohn Matthias hatte er diese Leidenschaft vererbt. Deshalb ahnte Anna Maria, dass ihr jüngerer Bruder wohl im Wald unterwegs war, um Wild zu erlegen. Denn bei einem Schlachtfest war es einfach, das Wildfleisch unter dem Schweinefleisch zu verstecken.
Doch Hofmeister blieb ruhig und nahm ungerührt einen weiteren Schluck aus seinem Becher und forderte dann die Männer auf: »Lasst uns zurück an die Arbeit gehen.«
Als sich die Männer von ihren Plätzen erhoben, krachten die Stuhlbeine lärmend auf den blanken Boden, sodass Anna Maria nicht verstehen konnte, was der Vater mit ihrem Bruder Peter sprach. Sie sah nur, dass Peter nickte und dann nach draußen verschwand.
***
Es war spät, als Anna Maria am Ende dieses langen, arbeitsreichen Tages die Schürze abnahm und müde die Holzstufen zu ihrer Kammer hochstieg. Sich den honigblonden Zopf aufbindend, schlich sie an der Schlafstube der Eltern vorbei. Die Tür war angelehnt, und die Stimmen von Vater und Mutter waren zwar leise, aber deutlich zu hören. Neugierig blieb das Mädchen stehen und lauschte, doch es konnte nur Satzfetzen verstehen: »... seit den frühen Morgenstunden ...«, klagte die Mutter.
»Frau, beruhige dich ... guter Schütze!«, hörte Anna Maria die gedämpfte Stimme des Vaters.
»Aber wenn der Grundherr ...«
»Nichts wird er ... der Junge weiß, was er tut!« Die Stimme des Vaters klang nun ärgerlich.
»Was sollen wir tun?«
»Peter wird ihn finden!«
Dann wurde die Tür geschlossen.
Anna Maria hatte kaum zu atmen gewagt. Ihr Herz pochte laut. Mit zittrigen Händen löste sie die Strähnen aus dem Zopf. Sie hatte es geahnt, und das belauschte Gespräch der Eltern war die Bestätigung.
»Matthias«, flüsterte sie, »sei vorsichtig!«
***
Anna Maria konnte nicht schlafen. Unruhig wälzte sie sich hin und her und lauschte angestrengt in die Stille der Nacht hinein.
Immer wieder schreckte sie hoch, da sie glaubte, Stimmen zu hören. Doch rasch merkte sie, dass sie sich getäuscht hatte. Angespannt knetete sie die Bettdecke zwischen ihren Fingern. Wie spät mochte es sein?
Plötzlich hörte sie das Knarren einer Tür. Hastig sprang Anna Maria aus dem Bett und lief auf Zehenspitzen zur Tür der Kammer. Rasch wich die Wärme aus ihrem Körper, und Kälte kroch die Beine herauf. Sie beachtete ihr Zittern nicht, blies ihren warmen Atem zwischen die gefalteten Hände und presste das Ohr gegen das Holz der Tür. Auf dem Gang war nichts zu hören. Dann – wieder ein Knarren! Sie hatte sich nicht getäuscht. Das musste die Tür der Burschenkammer gewesen sein. Die Stimmen, die sie erwartet hatte, blieben aber aus.
Enttäuscht und frierend kroch das Mädchen zurück unter die Bettdecke. Tränen brannten ihr in den Augen. Sie wollte nicht weinen und unterdrückte ein Schluchzen. Doch die Angst ließ sich nicht bezwingen. Wo waren ihre beiden Brüder? ›Lieber Gott, beschütze sie‹, dachte Anna Maria und faltete die Hände zum Gebet.
Vier Brüder hatte sie, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Jakob war der Älteste, vier Jahre älter als sie selbst, und stets ruhig und besonnen. ›Vermutlich kann er deshalb so gut mit Pferden umgehen‹, dachte Anna Maria. Niemals wurde seine Stimme laut, seine Worte nie böse oder gehässig. Er wusste alles über Pferde, und sein Geschick mit den Vierbeinern brachte ihm so manche Bewunderung der alten Bauern des Dorfes ein. Nur vom Vater hörte er selten ein lobendes Wort.
Anna Marias Gedanken wanderten zu Peter, und sogleich entspannte ein Lächeln ihr vor Angst verkniffenes Gesicht. Peter, der Zweitgeborene, war Anna Marias Lieblingsbruder. Ein unsichtbares Band schien sie mit ihm zu verbinden. Sie spürte, wenn Peter Kummer hatte, und er wusste ohne Worte, wann er sie aufmuntern musste. Auf ihn konnte sie sich verlassen – das stand außer Frage. Aber jetzt war er da draußen und suchte nach Matthias, und sie konnte nichts tun, als darauf zu hoffen, dass beide bald unversehrt zurückkehren würden.
Es fiel Anna Maria schwer, ihre Gedanken zu ordnen. Zu sehr lenkte die Angst sie ab. Sie versuchte sich einzureden, dass sie sich ihre Furcht nur einbildete. Mit geschlossenen Augen hörte sie in sich hinein. Doch da war sie, die Angst, die ihr die Luft zum Atmen nahm. Etwas war geschehen, und sie wusste, dass ihre Sinne sie nicht täuschten.
»O Gott, was soll ich tun?«, flüsterte das Mädchen und presste die Hände vors Gesicht. Anna Maria wollte weinen, schreien, toben. Doch stattdessen kroch sie tiefer unter die Bettdecke. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie in die Dunkelheit des Zimmers.
›Hoffentlich sind Peter und Matthias zusammen‹, schoss es ihr dann durch den Kopf. Da sie wusste, dass sich ihr ein Jahr jüngerer Bruder Mattias mit seinem ungestümen Wesen oft in Schwierigkeiten brachte, hoffte sie, dass Peter nun bei ihm war und achtgab, dass er keine Dummheiten machte. Stur und rechthaberisch, wie Matthias war, provozierte er so manchen Streit. Stets hatte er das letzte Wort und ließ schnell, viel zu schnell, seine Fäuste sprechen. Trotzdem fühlte sich Anna Maria auch ihm verbunden und hätte alles für ihn getan, wenn er in Not geriete. Doch heute war die Schwester machtlos. Nichts konnte sie tun, obwohl sie das Gefühl nicht loswurde, dass beide Brüder in Gefahr waren.
Wieder lauschte Anna Maria angestrengt, doch kein Geräusch drang in die Schlafstube. Lange würde sie den Schlaf nicht mehr abwehren können. Mit vor Müdigkeit brennenden Augen versuchte sie wach zu bleiben und dachte an ihren jüngsten Bruder.
Nikolaus war das Küken der Familie und wurde von den Geschwistern verhätschelt, was er schamlos ausnutzte. Anna Maria hatte früh Pflichten übernehmen müssen, die Schwestern kleiner Brüder zufallen. Doch je älter Nikolaus wurde, desto weniger duldete er ihre Anordnungen. Immer öfter begehrte er auf und erklärte ihr mit zorniger Miene: »Du bist nicht meine Mutter! Du hast mir nichts zu sagen!« Mit einer Ohrfeige wies Anna Maria ihn dann zurecht, sodass für einige Zeit Ruhe herrschte.
Anna Maria lachte leise auf, als sie an die wütenden Blicke ihres kleinen Bruders dachte. Seine blauen Augen schienen dann noch heller zu leuchten.
Dieses helle Blau, das ihr Vater immer stolz das »Hofmeister-Blau« nannte, hatten alle Hofmeister-Kinder geerbt. Ihre Brüder hatten auch alle das dunkelblonde Haar des Vaters, nur Anna Marias Haar, das glatt über ihre Schulter fiel, war von außergewöhnlichem Sonnengelb. Frisch gewaschen, glänzte es wie flüssiger Honig. Niemand in der Familie war mit solch wundervoller Haarpracht gesegnet. Deswegen hatte sich die Mutter manch dumme Bemerkung anhören müssen. Doch die durch und durch blauen Augen des Mädchens bewiesen dem Vater stets, dass Anna Maria seine Tochter war.
Anna Maria merkte nicht, wie sie einschlief. Langsam fielen ihr die Augen zu, und ihre Gedanken verloren sich im Nebel der Träume. Sie träumte von einer riesigen weißen Wand, auf der sie alle Tiere malen durfte, die sie kannte. Sie träumte von einem Ort, an dem sie laut singen durfte und niemand sie deshalb züchtigen würde.
Plötzlich schreckte sie hoch. Im ersten Moment wusste sie nicht, ob sie das Geräusch nur geträumt hatte. Sie setzte sich im Bett auf und wischte sich mit der Hand über die Augen, um den Schlaf zu verscheuchen. Konnte sie etwas hören, oder täuschte sie sich wieder? Nein! Da waren leise Stimmen.
Rasch stieg sie aus dem Bett und zog sich ihr Kleid über. Barfuß lief sie durch die dunkle Stube zur Tür, die sie geräuschlos öffnete.
Auf dem Gang war es stockfinster. Nichts wies darauf hin, dass jemand wach war – kein Licht, das durch eine Ritze, kein Laut, der durch eine Tür drang.
Anna Marias Körper versteifte sich, als sie hörte, wie die Tür zum Keller leise geschlossen wurde. Frierend verschränkte sie die Arme vor der Brust. Sie hasste den Winter!
Leise ging sie die Stiege vom Obergeschoss nach unten und lauschte an der Kellertür. Ihr Herz schlug so heftig, dass sie außer dem Pochen nichts hören konnte. Vorsichtig drückte sie die Klinke und öffnete die Tür einen Spalt breit. Als sie die Mutter leise weinen hörte, schloss sie die Augen. Ihr Gefühl schien sie nicht getäuscht zu haben – es war etwas geschehen.
Lautlos schob Anna Maria sich durch die Tür, schloss sie hinter sich und blieb auf der obersten Stufe der Kellertreppe stehen. Hier konnte sie alles hören, ohne gesehen zu werden. Der Schein der Kerzen an der Wand ließ die Schatten von Vater und Mutter gespenstig tanzen.
»Beruhige dich, Elisabeth! Sie sind wohlauf.«, hörte das Mädchen den Vater mit gedämpfter Stimme zur Mutter sagen.
Anna Maria atmete tief aus. Doch Erleichterung wollte sich nicht einstellen. Deshalb blieb sie wie angewurzelt stehen und lauschte angestrengt weiter.
»Und du sagst, dass sie das Wild nicht finden können?«
»Nein Vater, wir haben den Rehbock im Mehlbach versteckt. Äste und Wurzeln hängen an dieser Stelle ins Wasser und verdecken ihn. Niemand wird dort unsere Beute vermuten.«
»Gut! Wir werden einige Tage warten und ihn holen, wenn sich alles beruhigt hat.«
Das Weinen der Mutter war verstummt. Sie schniefte in ein Tuch und klagte: »Warum habt ihr euch nicht ruhig verhalten?«
Leise, aber in hitzigem Ton antwortete Matthias: »Was hätten wir tun sollen? Er hat auf einmal vor uns gestanden und direkt geschossen. Zum Glück ist der Pfeil an mir vorbeigeschwirrt. Bevor er die Armbrust nachladen konnte, habe ich ihm meinen Pfeil durch den Oberschenkel geschossen. So konnte er uns nicht folgen. Doch ich hätte den Saukerl besser umbringen sollen«, fluchte der Junge.
Ein Schlag und die zornige, aber verhaltene Stimme des Vaters waren zu hören.
»Bist du vollkommen närrisch? Willst du am Galgen landen? Man löscht nicht einfach ein Menschenleben aus. Ich kenne dich, Matthias! Wolltest wohl wieder den Helden spielen. Deine Mutter hat Recht. Hättet ihr euch ruhig verhalten, wären die Leute des Grundherrn an euch vorbeigezogen, und nichts wäre passiert. Peter, hast du dazu nichts zu sagen?«
›Peter‹, schoss es Anna Maria durch den Kopf. Ihr Herz begann zu rasen, und das ungute Gefühl verstärkte sich. Ohne zu überlegen, rannte sie die Steinstufen hinunter und sah sich nach ihrem älteren Bruder um.
»Wo kommst du denn her? Hast wohl gelauscht, was?«, hörte das Mädchen den Vater wütend schnauben. Doch es huschte an ihm vorbei zu seinem Bruder, der bleich an der Wand lehnte. Erst jetzt bemerkten die Eltern und Mattias, dass Peters Gesicht mit Schweiß bedeckt war. Seine Beine drohten einzuknicken, und der Vater trat vor seinen Sohn, um ihn aufzufangen. An der Stelle, an der Peter sich angelehnt hatte, war ein Blutfleck an der Wand.
Anna Maria hörte, wie die Mutter »Jesus und Maria!« flüsterte. Wortlos fegte der Vater alles vom Tisch und legte seinen Sohn bäuchlings darauf. Peter stöhnte. Mit wenigen Griffen zerriss der Vater das Hemd des Verletzten. Mutter und Tochter pressten gleichzeitig die Fäuste vor den Mund, um nicht laut aufzuschreien. Ein abgebrochener Pfeil ragte unterhalb des Schulterblatts hervor.
»Dich hat der Pfeil nicht erwischt, aber deinen Bruder!«, zischte der Vater, während er die Ränder der Wunde abtastete. Peters Stöhnen wurde lauter.
»Warum hat er nichts gesagt? Ich habe es nicht bemerkt«, stammelte Matthias.
Hofmeister wandte sich seiner Frau zu und zählte auf: »Ich brauche Schnaps, Tücher, heißes Wasser, und du, Matthias, bringst mir die Zange aus dem Schuppen. Seid leise, damit niemand im Haus wach wird.«
Eilig liefen die beiden die Treppenstufen hinauf. Anna Maria blieb bei ihrem Vater und Peter. Hilflos wischte sie dem Bruder mit der Handfläche den Schweiß vom Gesicht und rieb sich die Hände am Kleid trocken. Heiß waren seine Wangen, und seine Augenlider flackerten.
»Das gefällt mir nicht!«, murmelte der Vater und berührte den Pfeilstumpf. Peter jaulte auf.
Plötzlich sah der alte Hofmeister seine Tochter an und packte sie an den Schultern. Sie befürchtete schon, er wolle sie fürs Lauschen bestrafen, aber er fragte nur mit leiser eindringlicher Stimme: »Du weißt doch, wo meine Truhe steht?«
Das Mädchen nickte. Daraufhin zog Hofmeister einen Schlüssel aus der Jackentasche und fuhr fort: »Hier ist der Schlüssel zu der Schatulle, in der der Truhenschlüssel liegt.«
Ängstlich sah Anna Maria ihn an.
»Weißt du, wo die Schatulle sich befindet?«
Nun schüttelte sie den Kopf.
»Das will ich hoffen! Die Schatulle ist in der guten Stube, im Schrank hinter der Bibel versteckt. Mit diesem Schlüssel kannst du sie öffnen. In ihr befindet sich ein weiterer Schlüssel. Diesen nimm heraus, verschließe die Schatulle wieder, und stelle sie zurück unter das Leinen. Dann schließ die Truhe in unserer Schlafkammer auf, und nimm die kleine Flasche heraus, die unten auf dem Truhenboden steht. Ich verbiete dir aber, die anderen Gegenstände in der Truhe anzusehen! Hast du mich verstanden?«
Eingeschüchtert nickte sie. Als er sie leicht, aber unsanft schüttelte, wisperte sie: »Ja, Vater!«
Er legte seine große schwere Hand auf ihren Scheitel und fügte hinzu: »Und du wirst niemanden erzählen, was ich dir eben gesagt habe!«
»Ja, Vater!«
»Gut, Kind, dann beeil dich. Bring außerdem einen Topf mit glühenden Kohlen.«
Erschrocken riss das Mädchen die Augen auf, doch Hofmeister ließ das unberührt. Stattdessen blaffte er: »Was stehst du hier noch unnütz rum?«
Stumm rannte Anna Maria die Treppe hinauf.
***
Anna Maria fand, wie vom Vater beschrieben, die Schatulle in der Stube und konnte sie mühelos mit dem kleinen Schlüssel öffnen. Sie entnahm den schweren Eisenschlüssel, verschloss und versteckte die Schatulle wieder und lief ins elterliche Schlafgemach. Hinter der Tür stand die schwere Holztruhe, die aus grob zugehauenen, dicken Eichenbrettern gezimmert war.
Behutsam strich Anna Maria mit den Fingerspitzen über das Holz. Oft hatte sie heimlich vor dieser Truhe gestanden und sich gefragt, was sie wohl enthalten könnte? Geschickt führte sie den groben Schlüsselbart in das Schloss und drehte mit beiden Händen den Schlüssel um. Beim Öffnen knackte das Schloss. Nur schwer ließ sich der wuchtige Deckel heben. Als Anna Maria endlich hineinschauen konnte, verzog sie enttäuscht das Gesicht. Sie sah nur wertlosen Kram, wie einen Haufen Papiere, alte Stofffetzen, Dosen und Schachteln.
Lustlos räumte sie die Sachen zur Seite. Wie vom Vater beschrieben fand sie die Glasflasche, die in einer Ecke der Truhe stand. Sie war mit einem Korken verschlossen, der mit einer Wachsschicht überzogen war. Vorsichtig nahm Anna Maria die Flasche heraus und stellte sie sachte auf den Boden. Dann legt sie die Sachen zurück an ihren Platz, ließ langsam den Deckel zuklappen und verschloss die Truhe mit dem wuchtigen Schlüssel. Nachdem sie den Eisenschlüssel zurück in die Schatulle gelegt und aus der Küche einen Henkeltopf mit glühenden Kohlen geholt hatte, hastete sie, den Topf in der Hand und die Glasflasche unter den Arm geklemmt, zurück in den Keller. Dort übergab sie ihrem Vater sogleich das Fläschchen. Den Topf mit den heißen Kohlen stellte sie auf den Boden. Auch die Mutter und Matthias waren zurück und legten Schnaps, Leinenstreifen, das heiße Wasser und eine Zange auf die Bank, die neben dem Tisch stand.
Als die Mutter die Kohlen erblickte, zuckte sie zusammen.
»Daniel?«
Weiter kam sie nicht, denn der alte Hofmeister streifte seine Frau mit einem Blick, der sie verstummen ließ. Mit einem Messer schabte er die Wachsversieglung des Fläschchens ab und zog mit seinen Zähnen den Korken heraus.
Er zählte einige wenige Tropfen in einen Becher und goss Schnaps dazu. Mit dem Zeigefinger verrührte er die Mixtur. Sein Blick schweifte zurück zu seiner Frau, die ein Schluchzen kaum unterdrücken konnte. Er hielt kurz inne, nahm sie zur Seite, sodass Peter das Gespräch nicht verstehen konnte. Dann sprach er mit gedämpfter Stimme: »Elisabeth, die Pfeilspitze ist verdreckt, vielleicht sogar mit Mist verseucht. Ich weiß, was das für unseren Sohn bedeuten kann, denn ich habe schon viele solche Verletzungen gesehen. Auch die Folgen kenne ich. Der Pfeil sitzt im Knochen fest, ich muss ihn also herausziehen und vergrößere so durch die Widerhaken an der Spitze das Eintrittsloch. Wenn ich ihm die Wunde nicht ausbrenne, stirbt er in wenigen Tagen an Wundfieber. In der Glasflasche aber ist ein Mittel, das ich von einer meiner Wallfahrten mitgebracht habe und das ihn tief schlafen lassen wird, sodass ich die Wunde versorgen kann.«