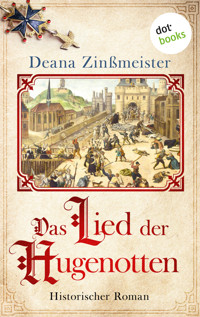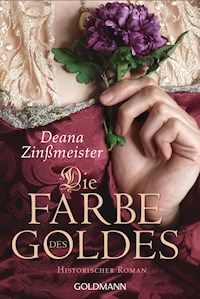
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Württemberg 1605. Elisabeth lebt mit ihren Eltern in einem kleinen Dorf, harte Arbeit bestimmt ihr Leben. Als sie 17 Jahre alt ist, begegnet sie dem charismatischen Frédéric und lässt sich auf ihn ein. Doch Frédéric ist nicht, wer er vorgibt zu sein. Als Elisabeth unerwartet schwanger wird, will er nur noch eins: sie um jeden Preis loswerden. Und so findet Elisabeth sich plötzlich als Gefangene in einem Freudenhaus wieder. Erst als sie den Alchemisten Johannes Keilholz kennenlernt, scheint es Hoffnung zu geben. Denn durch ihn trifft sie jemanden, dem sie mehr wert ist als alvillageles Gold der Welt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Deana Zinßmeister
Die Farbe des Goldes
Historischer Roman
Buch
Elisabeth lebt mit ihren Eltern und Geschwistern in einem kleinen Dorf in Württemberg zur Zeit von Herzog Friedrich I. Mit 17 Jahren ist sie noch niemandem versprochen, und ihr Vater meint, sie müsse den Rest ihres Lebens bei ihnen bleiben und arbeiten. Dann trifft sie eines Tages den charismatischen Frédéric und lässt sich auf ihn ein. Doch dies erweist sich als großer Fehler, denn Frédéric ist nicht der, der er zu sein scheint. Als Elisabeth ein Kind erwartet, greift er zu drastischen Maßnahmen: Sie findet sich weggesperrt in einem Bordell wieder. Hier wird aus der naiven Elisabeth eine Kämpferin. Und eines Tages lernt sie Johannes Keilholz kennen, einen Alchemisten, der ihr hilft. Doch die Spur des Goldes führt sie zu Frédéric zurück …
Weitere Informationen zu Deana Zinßmeister sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Oktober 2019 Copyright © 2019 by Deana Zinßmeister Copyright © dieser Ausgabe 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München Umschlagmotiv: Arcangel / Malgorzata Maj; FinePic®, München Redaktion: Eva Wagner AG · Herstellung: kw Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-23898-8V001 www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Literaturagentin Bettina Keil
Stuttgart um 1600
Personenregister
Personenregister
Mit einem Sternchen * versehene Figuren sind reale historische Personen
Elisabeth
Elisabeths Mutter
Karpfenfischer, Elisabeths Vater
Adelheid, ihre jüngere Schwester
Ulrich, ihr jüngerer Bruder
Johanna, Elisabeths Freundin
Wolfgang, Johannas Ehemann
Ursula, Kräuterfrau
Friedrich I.* (1557–1608), Herzog von Württemberg
Sibylla von Anhalt* (1564–1614), seine Ehefrau
Frédéric Thiery, Herzog Friedrichs Neffe, Bastard der Herzogsschwester
Georg, Herzog Friedrichs Sohn
Mathilde, Georgs Verlobte
Jakob von Baden-Durlach* (1562–1590), Markgraf von Baden-Hachberg, Vater von Mathilde
Christoph Wagner* (1571–1634), Laboratoriumsinspektor
Dorothea Wagner, seine Frau
Freiherr von Brunnhof und Grobeschütz* (1572–1597), Betrüger (richtiger Name Georg Honauer)
Lucas Osiander der Jüngere* (1571–1638), Theologe, Professor und Kanzler der Eberhard Karls Universität Tübingen
Johannes Keilholz, Alchemist
Sophia, seine Ehefrau
Christina, seine Tochter
Grete, seine Haushälterin
Baltasar, sein Lehrjunge
Matthäus, Apotheker, Freund von Johannes Keilholz
Lucilla und ihr Mann, Betreiber des Hurenhauses
Regina, Dirne
Christa, Reginas Tochter
Marie, Franziska, Agathe, Anna, Gerlinde, weitere Dirnen
Sebastian Klausen, Töpfer im Laboratorium
Klara, seine Ehefrau
Ein Teil des Transmutationsrezeptes des Backnanger Goldschmieds Justinus Psalinarius für Herzog Friedrich I.
…
Erstlichen Quecksilber
12 lotth
Schweffel
6 lotth
Crocum Martis
8 lotth
Mercurium supplimatum
8 lotth
Gelb Wachs
4 lotth
Brandtwein
4 Viertele …
Prolog
Prolog
Stuttgart 1606
Als der Morgen dämmerte, flammten Rottöne am Horizont auf. Es schien, als ob der Himmel brannte. Ein Hahn krähte. Vogelgezwitscher antwortete. Je heller es wurde, desto kräftiger erklangen die Stimmen in den Gassen, die zuvor geflüstert hatten. Als die Sonne aufstieg, brach sich ihr Licht in den Fensterscheiben der Häuser und brachte sie zum Leuchten. Ein neuer Tag war angebrochen.
»Es hätte einer dieser schönen Tage werden können! Doch nun wird er zu einem verdammten Tag«, murmelte Johannes Keilholz, der mit hängenden Schultern durch die Gitterstäbe starrte.
»Der Tag kann nichts für sein Schicksal«, erwiderte Frédéric Thiery und trat neben ihn ans Fenster. Beide sahen hinüber zum Schlossplatz von Stuttgart, in dessen Mitte ein Eisengalgen zu erkennen war, den man mit Blattgold verkleidet hatte. Im Glanz des Goldes brach sich das Sonnenlicht. Daneben stand ein zweiter Galgen, an dem ein mit Flittergold überzogener Strick angebracht war. Auf einer Tafel davor stand geschrieben:
Ich war zwar, wie Merkur wird fix gemacht, bedacht, doch hat sich’s umgekehrt, und ich bin fix gemacht.
Das war die Botschaft für die Zuschauer, dass ein Alchemist versagt hatte und gehängt werden sollte.
Als Thiery sich zu Keilholz umdrehte, erkannte er die Verbitterung im Blick des Mannes. »Ihr könnt es nicht ändern«, meinte er leise und fragte: »Seid Ihr bereit, Herr Keilholz?«
»Kann man dafür jemals bereit sein?«, erwiderte der Alchemist niedergeschlagen.
Kapitel 1
Kapitel 1
Württemberg 1605
Elisabeths Weg führte sie durch einen Wald, der zwei Täler miteinander verband.
Da sich in der Nacht der Winter zurückgemeldet hatte, überzog eine dünne Schneedecke die Natur. Rasch begann die weiße Pracht zu schmelzen. Die hellen Hauben der Bäume fielen herab und wurden zu Pfützen.
Die Schuhe der jungen Frau versanken im Morast und hinterließen Abdrücke im weichen Boden. Schon nach kurzer Zeit war das Leder vom Schmelzwasser aufgequollen und die Strümpfe vollgesogen. Elisabeth spürte ihre Zehen kaum noch. Immer wieder blieb sie stehen und stapfte fest mit den Füßen auf, damit das Blut in den Beinen wieder pulsierte. Dabei hauchte sie sich zwischen die Hände, die wegen der Kälte schmerzten, obwohl sie in gestrickten Handschuhen steckten. Bibbernd sah sie zwischen den Baumkronen zum Himmel empor. Hoffentlich kommt der Frühling bald zurück, dachte sie und marschierte weiter. Die Zeit eilte, denn in zwei Tagen würde ihre Freundin Johanna Hochzeit feiern, und dafür benötigte sie die Fische, die Elisabeth in einer Kiepe auf dem Rücken trug. Die Karpfen ersetzten den Schweinebraten, den es eigentlich als Festmahl hätte geben sollen. Doch da die Sau krank geworden war und deshalb nicht geschlachtet werden konnte, hatte Elisabeths Vater den Auftrag bekommen, Karpfen aus seinem Teich zu fangen.
Um sich vom Schmerz der eisigen Hände und den nassen Füßen abzulenken, dachte Elisabeth über ihre Freundin nach. Johanna und sie kannten sich seit Kindesbeinen, da beide aus demselben Dorf stammten. Erst vor sechs Monaten hatte Johanna die Arbeit in dem Wirtshaus zwei Orte weiter angenommen und sich gleich vom Wirtssohn schwängern lassen. Nun musste sie diesen ungehobelten Menschen heiraten, wenn sie nicht als ledige Mutter auf der Straße sitzen wollte. Wie konnte sie nur so dumm sein und sich Wolfgang hingeben, anstatt Martin, den Sohn des Müllers, zu nehmen? Ausgerechnet diesen Trunkenbold, der der beste Gast an der Theke seines Vaters war, hatte sie sich als Ehemann ausgesucht. Elisabeth schüttelte den Kopf. Zugegeben, auch der Müllerssohn wäre nicht ihre eigene erste Wahl gewesen, aber so groß war die Auswahl an heiratswilligen Burschen in ihrem nahen Umfeld nicht.
Elisabeth hatte für sich selbst den Sohn des Zimmermanns erwählt. Zwar wusste Peter noch nichts von seinem Glück, doch die Hochzeit der Freundin würde eine gute Gelegenheit sein, ihm ihren Entschluss als den seinen unterzujubeln.
Als sie an den rothaarigen Burschen dachte, verzog sie das Gesicht. Er war so alt wie sie, von hagerer, langer Statur, nicht sehr redselig und irgendwie auch begriffsstutzig. Aber gerade das war ein wichtiger Grund gewesen, ihn auszusuchen. Peter würde sie sicherlich nicht unter Druck setzen, sie nicht bevormunden und bestimmt auch nicht schlagen. Das hoffte Elisabeth, denn sie wollte nicht wie ihre Mutter tagtäglich mit der Angst leben müssen, etwas Falsches zu sagen oder zu tun, wofür sie Schläge kassierte. Außerdem war Peter ein guter Handwerker und fleißig.
»Trotzdem wird mein Leben an seiner Seite langweilig und nicht aufregend sein«, murmelte sie und ging in Gedanken die Alternativen durch, die ihr blieben. Abermals schüttelte sie den Kopf. Nein, dachte sie, unter den anderen Burschen ist keiner dabei, den ich heiraten möchte.
Keuchend stapfte Elisabeth durch den Matsch. Sie hielt den Blick gesenkt und achtete sorgsam auf den Weg, um nicht auszurutschen. Der Korb drückte schwer auf ihren Schultern. Als sie kurz den Kopf hob, konnte sie in der Ferne hinter den Bäumen Rauch aufsteigen sehen. Beflügelt, weil das Dorf, das sie durchqueren musste, vor ihr lag, ging sie weiter.
Plötzlich hörte sie hinter sich Pferdeschnauben und Hufgetrampel. Sie blieb stehen und schaute zurück. Da preschte auch schon ein Reiter dicht an ihr vorbei. Dreck spritzte hoch. Seine Stiefelspitze streifte den Korb auf ihrem Rücken. Der Leib des Pferdes riss Elisabeth herum. Sie fiel der Länge nach hin, und der Inhalt ihrer Kiepe ergoss sich in den Schneematsch. Das alles geschah so schnell, dass sie nicht einmal Zeit hatte aufzuschreien. Auf dem Bauch liegend, schaute sie dem Reiter ungläubig hinterher, der mit wehendem Mantel weiterritt.
»Hurenbock«, schrie sie ihm nach. Es war das einzige Schimpfwort, das ihr auf die Schnelle einfiel.
Als sie die Nässe und die Kälte spürte, schickte sie einen weiteren zornigen Schrei hinterher und erhob sich. Sie schluckte die Tränen der Wut und des Schmerzes hinunter, warf die Kiepe zu Boden und sammelte die Fische ein. Da sah sie, wie der Mann zurückgeritten kam.
Oje! Sicher hat er meine Beleidigung gehört und wird mich nun zurechtweisen wollen, dachte sie und tat, als ob sie ihn nicht sah.
»Bist du verletzt?«, rief er schon von Weitem.
Nun musste sie zu ihm aufblicken. »Was kümmert es Euch? Es war Euch ja auch einerlei, dass Ihr mich herumgerissen habt.«
»Ich habe was?«, fragte er verwirrt.
»Tut nicht so. Ihr wisst sehr wohl, dass Euer Fuß an meinem Korb hängengeblieben ist und Euer dämlicher Gaul mich herumgerissen hat, weil Ihr zu dicht an mir vorbeigeritten seid.«
»Das kann nicht sein! Ich hätte es bemerkt, wenn ich Schuld an deinem Sturz trüge. Sicherlich bist du gestrauchelt, weil der Korb zu schwer ist.«
Der Fremde zügelte das Ross neben ihr und stieg ab. »Ich habe dein Wehgeschrei gehört und dachte, du würdest sterben«, höhnte er.
Elisabeth funkelte ihn aus ihren blauen Augen an und musterte ihn dabei. Er schien einige Jahre älter als sie zu sein, überragte sie um einen Kopf und trug eine Pelzkappe gegen die Kälte. Sein Umhang war aus dichtem Filz hergestellt und an den Säumen mit edlem Pelz verbrämt. Auch am Rand der Stiefel konnte man Fell erkennen. Er sah wie ein reicher Edelmann aus, fand sie. Selbst sein Pferd schien wertvoll zu sein.
Sie wurde unsicher. Als sie seinen abschätzenden Blick bemerkte, hätte sie nur zu gerne gefaucht: Ihr habt mich herumgerissen. Aber wenn Euch diese Version besser gefällt: Es war mein eigener Fehler, dass ich gestrauchelt und gefallen bin! Damit tragt Ihr keine Schuld. Zufrieden? Doch sie schwieg.
Der Fremde blickte sie grinsend an. Anscheinend verriet ihre Miene ihre Gedanken. Sie wandte den Blick von ihm ab. Schon spürte sie, wie die Kälte durch die nasse Kleidung in ihre Knochen kroch. Bibbernd wischte sie sich das feuchte Haar aus dem Gesicht.
»Du zitterst«, stellte der Fremde fest und nahm seine Mütze ab, um sie ihr ungefragt über den Kopf zu stülpen. »Die darfst du behalten«, sagte er gönnerhaft. »Wohin musst du, Mädchen?«, wollte er wissen.
Obwohl Elisabeth die Wärme guttat, riss sie die Mütze hastig herunter und gab sie dem Mann zurück. »Ich muss ins übernächste Dorf«, antwortete sie frierend und wies nach vorn.
Sein Blick folgte ihrem Fingerzeig. »Bis dahin bist du erfroren. Deine Lippen sind bereits blau verfärbt. Sei nicht dumm und nimm die Mütze.«
»Ich will Eure Kappe nicht. Was kümmert es Euch, was mit mir ist?«, fragte sie mürrisch und sammelte die restlichen Karpfen ein.
»Sehr viel, denn so, wie du sagst, bin ich für deinen Unfall verantwortlich.«
Zweifelnd schaute sie auf.
»Ich werde dich in das Dorf bringen.«
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Das ist nicht nötig!«
»Auch wenn du das von mir denkst, aber ich bin kein Lump!«
Bevor Elisabeth wusste, wie ihr geschah, umfasste er ihre Hüfte und setzte sie hinter dem Sattel aufs Pferd. Dann half er ihr, die Kiepe anzuschnallen. Anschließend schwang er sich auf den Pferderücken.
»Aber …«, erwiderte sie schwach.
»Keine Widerrede! Ich werde dich in das Dorf bringen. Halt dich an mir fest«, forderte er sie auf und ließ das Pferd antraben.
Das werde ich sicher nicht, dachte sie und versteckte ihre Hände hinter seinem Rücken. Doch als sie hochhopste, umklammerte sie seinen Leib.
Elisabeth kam es vor, als würden sie fliegen. Sie erreichten das Dorf so schnell, dass sie fast enttäuscht war, als sie das Gasthaus vor sich sahen. Ihre Freundin Johanna, die gerade hineingehen wollte, schaute erstaunt zu ihr, als das Pferd vor ihr anhielt und Elisabeth von seinem Rücken rutschte.
»Habt Dank«, murmelte sie dem Fremden zu, der sie anlächelte.
»Es war mir ein Vergnügen!«, rief er, hob die Hand zum Gruß und ritt davon.
Mit offenem Mund schaute Elisabeths Freundin ihm hinterher. »Wer war das?«, fragte sie mit leuchtenden Augen.
Erst jetzt merkte Elisabeth, dass sie die beiden nicht einander vorgestellt hatte.
»Ich habe keine Ahnung«, erklärte sie mit heißem Gesicht.
»Das glaube ich dir nicht! Erzähl! Wer ist er?«
»Ich weiß es wirklich nicht.«
»Wie dumm kann man sein, nicht zu fragen? Er scheint ein Edelmann zu sein. Woher kennst du einen solchen Mann?«
»Ich erzähle es dir später, falls ich bis dahin nicht erfroren bin.«
»Ach du Schreck! Du zitterst ja. Komm schnell ins Warme. Ich gebe dir trockene Kleidung.«
Dankbar sah Elisabeth die Freundin an und folgte ihr ins Haus. Während Johanna trockene Kleidung holte, brachte sie die Karpfen hinaus zur Küchenmagd, die sie ausnehmen sollte.
Elisabeths Haut brannte von dem groben Handtuch, mit dem sie sich abgerieben hatte. Am offenen Herdfeuer trocknete sie ihr Haar. Dabei dachte sie an die sonderbare Begegnung mit dem Fremden.
»Jetzt erzähl endlich, wie du ihn kennengelernt hast«, forderte ihre Freundin. Als Elisabeth unwissend tat, meinte Johanna: »Ich sehe es dir an der Nasenspitze an, dass du unentwegt an deinen Verehrer denkst.«
»Er ist nicht mein Verehrer«, protestierte Elisabeth schwach und erzählte, was sich auf dem Weg ereignet hatte.
»Schade, dass du seinen Namen nicht kennst.«
»Was würde es mir nützen? Wie du sagtest, ist er wahrscheinlich ein Edelmann aus reichem Haus. Wir werden uns sicher niemals wiedersehen.«
»Er schien galant zu sein und wirkte zudem freundlich«, seufzte Johanna.
»Seit wann bist du eine Männerkennerin?«, lachte Elisabeth und zwirbelte ihr trockenes Haar zusammen. »Deine Kleidung werde ich dir übermorgen an deinem Hochzeitsfest zurückgeben«, meinte sie und wärmte ihre Hände über der Flamme.
»Das eilt nicht! Sie wird mir in absehbarer Zeit sowieso nicht mehr passen«, lachte Johanna und streckte ihren Bauch nach vorn.
»Bis jetzt sieht man noch nichts. Bist du dir sicher, dass du tatsächlich schwanger bist? Nicht dass du umsonst heiratest«, überlegte Elisabeth laut.
Johanna nickte und verzog das Gesicht. »Darauf verwette ich meinen Hintern. Ich spucke jeden Morgen. Außerdem hat es mir die Hebamme bestätigt. Es soll zum Erntedankfest kommen«, verriet sie freudig.
»Du scheinst glücklich zu sein.«
Johanna zuckte mit den Schultern. »Es hätte mich schlechter treffen können. Schließlich hat Wolfgang nicht gezögert, mich zu heiraten, als ich ihm von dem Kind erzählte.«
»Du erwartest sein Kind!«, empörte sich Elisabeth.
»Trotzdem gibt es genügend Kerle, denen das einerlei wäre. Nicht jeder heiratet die Mutter seiner Kinder.«
»Ja, das stimmt. Trotzdem würde ich nicht jeden wollen«, meinte Elisabeth ehrlich.
»Ich habe mir Wolfgang sehr bewusst ausgesucht.«
Elisabeth horchte auf. »Wie meinst du das? Ich dachte, das Kind war nicht geplant.«
»Denkst du das wirklich? Ich wollte ihn und sonst keinen.«
Zweifelnd sah Elisabeth die Freundin an, die erklärte: »Ich ahne, was du denkst. Aber so ist er nicht. Bei ihm werde ich keine Not leiden. Das Wirtshaus läuft gut. Gegessen und getrunken wird immer.«
»Aber sein bester Gast ist Wolfgang wohl selbst«, gab Elisabeth zu bedenken.
»Es ist in Ordnung, wenn er mal einen über den Durst trinkt. Schließlich muss er hart arbeiten.«
Elisabeth sah die Freundin stirnrunzelnd an. Anscheinend war sie mit ihrem Schicksal zufrieden. Sie holte tief Luft und ließ sie seufzend wieder entweichen. »Ich muss zurückgehen. Vater sagt, ihr könnt die Fische an der Hochzeit bezahlen.«
Johanna nickte und brachte sie vor die Tür. Dort umarmten sich die beiden Frauen. Dann folgte Elisabeth dem Weg, der sie zum Dorf hinausführte.
Während sie nach Hause marschierte, umschlang Elisabeth ihren Oberkörper mit beiden Armen. Sie war Johanna für die trockene Kleidung dankbar. Sicherlich hätte sie sich sonst den Tod geholt. Zwar wurden ihre Füße jetzt rasch wieder gefühllos, doch Elisabeth versuchte das zu ignorieren und trat fest auf. Da die Kiepe nun leer war, kam sie schnell vorwärts.
Plötzlich hörte sie einen Pfiff aus dem Wald neben sich. Erschrocken sah sie sich um.
»Ich habe schon befürchtet, ich würde hier festfrieren, bevor ich dich wiedersehe«, lachte der Fremde und trat zwischen den Bäumen hervor.
Kapitel 2
Kapitel 2
Der Schreck fuhr Elisabeth durch alle Glieder, als sie die Stimme des Fremden hörte. Schon trat er auf sie zu. Besorgt sah sie sich nach allen Seiten um. Nicht auszudenken, wenn man sie zusammen mit einem fremden Mann sah. Doch zum Glück schienen sie die Einzigen zu sein, die auf diesem Weg unterwegs waren.
Nervös presste sie die Lippen aufeinander und schaute zu Boden.
»Du schweigst? Freust du dich nicht, dass ich auf dich gewartet habe?«, fragte der Mann, sodass sie gezwungen war, aufzuschauen. »Anscheinend hat es dir die Sprache verschlagen. Nun, das passiert vielen Frauen, wenn sie mich sehen«, frotzelte er.
Sie wollte etwas sagen, irgendetwas, und holte tief Luft. Doch ihre Lippen konnten kein Wort formen. Es ärgerte sie, dass sie so befangen, so verkrampft und so schüchtern war. Bei den Burschen in ihrem Dorf war sie nie um eine Antwort verlegen. Dieser Fremde jedoch verunsicherte sie. Ihr kam kein Gedanke in den Sinn, der es wert gewesen wäre, laut ausgesprochen zu werden. Zaghaft schaute sie zu dem Mann auf. Was wollte er von ihr? Warum hatte er auf sie gewartet? Sie kaute auf der Unterlippe und forschte in seinen Augen. Das Glitzern, das sie zu erkennen glaubte, schien zu zeigen, dass ihn ihre Verlegenheit erheiterte. Sie spürte, wie Röte in ihren Wangen hochstieg.
»Müsst Ihr nicht Eures Weges gehen?«, flüsterte sie mit kehliger Stimme, so als ob sie heiser sei. Ihr Gesicht brannte wie nach einem Sonnentag im August.
»Das müsste ich tatsächlich, denn sicherlich fragt man sich schon, wo ich geblieben bin. Aber ich hatte Mitleid mit dir, als ich deine durchnässte Kleidung sah. Deshalb wollte ich dich mit meinem Pferd zurück in dein Dorf bringen. Schließlich ist es schon später Nachmittag. Die Sonne wird bald schwinden und Kälte vom Boden hochziehen. Doch wie ich sehe, war meine Sorge unnötig. Du hast das nasse Kleid gegen ein trockenes Gewand eintauschen können.«
Elisabeth sah an sich herunter und nickte. »Es gehört meiner Freundin Johanna. Sie ist schwanger, deshalb passt es ihr nicht mehr so recht. Nur ihre Schuhe konnte sie mir nicht geben, denn die benötigt sie selbst.«
Als sie aufblickte und die grinsende Miene des Fremden sah, wurde ihr bewusst, dass sie Unsinn sprach. Nur zu gerne wäre sie losmarschiert, um der Peinlichkeit zu entfliehen. Stattdessen wandte sie sich dem Pferd zu, das er am Zügel festhielt.
»Euer Pferd scheint ein kostbares Tier zu sein«, sagte sie und strich ihm über die Nüstern.
»Ach ja?«, fragte er und betrachtete die Stute, als ob er sie das erste Mal sah. »Woran erkennst du das? Bist du eine Pferdekennerin?«
»Beileibe nein! Es sieht nur anders aus als ein Ackergaul.«
»Ein Ackergaul ist sie nun wahrlich nicht. Hast du das gehört, Antonia? Sie sagt, du wärst hübscher als ihr Ackergaul.«
»Euer Pferd hat einen Namen?«
»Natürlich! Wie rufst du deinen Ackergaul?«
»Gar nicht. Wir besitzen kein Pferd«, antwortete Elisabeth.
»Meine Stute wurde in Italien geboren und ist tatsächlich wertvoll«, verriet er ihr. »Sie ist von einem edlen Gestüt in der Toskana.«
»Italien? Toskana? Solche Namen habe ich noch nie gehört. Diese Städte müssen weit von hier entfernt liegen«, überlegte Elisabeth laut und sah den Mann fragend an. Falten gruben sich um seine Augen und den Mund. »Ihr lacht mich aus, weil ich ungebildet bin«, klagte sie.
»Ich lache dich nicht aus. Ich finde dich hinreißend, so scheu und so unwissend, wie du bist. Verrätst du mir deinen Namen, hübsches Kind?«
Elisabeth zog die Stirn kraus. Er hatte sie hübsch genannt. Sicher wollte er sie verspotten. Vor allem, weil er sie »Kind« genannt hatte, dachte sie.
Er umfasste ihr Kinn und hob ihr Gesicht.
»Elisabeth«, stammelte sie.
»Elisabeth!«, wiederholte er. »Welch wohlklingender Name. Es gibt keinen passenderen für dich, meine Schöne.«
Sie schlug beschämt die Augen nieder.
»Ich muss nach Hause«, stotterte sie und stapfte mit den Beinen auf, da ihre kalten Füße inzwischen gefühllos und wie abgestorben waren. Zitternd sah sie zum Himmel hinauf. Langsam verschwand die Sonne auf der anderen Seite des Waldes, sodass die Bodenkälte aufstieg, vor der der Fremde sie gewarnt hatte.
»Dein Schuhwerk ist aufgeweicht. So kannst du unmöglich weitergehen. Ich werde dich auf meinem Pferd mitnehmen«, erklärte der Mann. Seine Stimme klang wie ein Befehl.
Doch sie schüttelte energisch den Kopf. »Das geht nicht! Niemand darf uns zusammen sehen.«
Ihre Sorge schien ihn nicht abzuschrecken, denn er sagte: »Keine Widerrede. Wir reiten in dein Dorf.«
Als sie sich hastig abwandte, rutschte sie auf dem schlammigen Boden aus und kam ins Straucheln. Blitzschnell umfasste er ihre Taille, um sie mit Schwung auf das Pferd zu heben. Doch dieses Mal gelang es Elisabeth, sich aus seinem Griff zu befreien.
»Nehmt Eure Hände von mir!«, schrie sie.
Tatsächlich ließ er sie los. Seine Augen verengten sich leicht. »Sind alle Mädchen in deinem Dorf so widerspenstig?«, wollte er wissen. »Wenn ja, dann muss ich sie kennenlernen. Wehrhafte Frauen gefallen mir.«
Sie erstarrte. Keinesfalls durfte der Fremde mit ihr ins Dorf kommen. Nicht auszudenken, wenn der Vater sie mit ihm sehen würde. Er würde sie als leichtfertiges Frauenzimmer beschimpfen und sie schlagen. Plötzlich dachte sie an die Nachbarstochter Veronica, die sich jedem Mann an den Hals warf. Veronica kannte keine Hemmungen und würde sich auch bei diesem Fremden anbiedern. Das darf nicht passieren, dachte sie.
»Was grübelst du, schöne Elisabeth?«, unterbrach der Fremde ihre Gedanken.
Ertappt schaute sie auf. »Ich grüble, wie Euer Name lautet, den ihr mir nicht verraten habt«, log sie errötend.
Er sah sie nachdenklich an. »Habe ich mich nicht vorgestellt?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Was bin ich ein ungehobelter Mensch«, tadelte der Mann sich selbst. Dann verbeugte er sich, machte eine galante Bewegung mit dem rechten Arm, streckte sich wieder und verriet: »Mein Name lautet G…«, um dann zu zögern. Er sah sie nachdenklich an. »Ich werde dir meinen Namen bei unserem nächsten Treffen verraten!«, versprach er augenzwinkernd.
»Ihr verspottet mich«, wisperte sie beschämt und stellte leise die Frage: »Warum sollte ein Edelmann mich wiedersehen wollen?«
»Du gefällst mir, kleine, scheue Elisabeth! So einfach ist das!«
»Nein«, erwiderte Elisabeth kaum hörbar, »wir dürfen uns kein weiteres Mal treffen.«
Nun lachte er schallend auf. »Du wärst die erste Frau, die es ablehnt, mich wiederzusehen«, erklärte er.
Elisabeth starrte auf die goldene Spange, die den Umhang des Fremden zusammenhielt. Uns trennen Welten, ich sollte gehen, dachte sie. Stattdessen fragte sie: »Was führt Euch in diesen Landstrich?«
»Ich bin mit einer Jagdgesellschaft unterwegs«, antwortete er.
Sie überlegte: »Auch der Fürstensohn soll hier in der Nähe zur Jagd unterwegs sein. Kennt Ihr ihn etwa?«
Der Fremde nickte.
Ihre Augen weiteten sich. Die Gedanken, die ihr durch den Kopf rasten, verschlugen ihr den Atem. »Ich muss nach Hause«, murmelte sie, wandte sich um und ließ den Mann abrupt stehen.
Mit gesenktem Kopf stapfte sie durch den Matsch in den Wald, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Kapitel 3
Kapitel 3
Nach einer Weile schaute Elisabeth über die Schulter zurück. Als sie den Mann nicht mehr sehen konnte, rannte sie los. Sie wollte so schnell wie möglich Abstand zwischen sich und den Fremden bringen. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal zwischen den Bäumen auf, dachte sie, als im selben Augenblick ihre Füße wegrutschten. Sie strauchelte, fing sich aber und lief weiter.
Die Luft war feucht und eisig. Winzige Wasserperlen legten sich auf ihr Haar und ihre Kleidung. Die Kälte brannte in ihrem Schlund. Sie versuchte durch die Nase zu atmen, doch sie hatte das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen. Schnaufend riss sie den Mund auf. Obwohl in der Kiepe nur ihr Kleid lag, schien der Korb so schwer, als sei er noch mit Karpfen gefüllt. Das ungewohnte Laufen strengte Elisabeth an. Ihr Herz pochte heftig und schmerzte unter ihren Rippen. Trotzdem verlangsamte sie ihre Schritte nicht.
Das schwindende Licht tauchte die Umgebung in helles Grau. Sie konnte kaum mehr den Weg erkennen. Doch schließlich nahm sie den Geruch von verbranntem Holz wahr. Ihr Dorf konnte nicht mehr weit sein. Erleichtert erkannte sie die Umrisse der Kirche am Ortsrand. Erst jetzt zügelte sie ihr Tempo. Mit schmerzverzerrtem Gesicht presste sie sich die Hand gegen den Rippenbogen.
Kurz vor den ersten Häusern blieb sie stehen und drehte sich um. Obwohl die Landschaft im Dunst verschwand, ließ sie den Blick umherschweifen.
Er ist mir nicht gefolgt, stellte sie erleichtert fest und bog in die Gasse ein, an deren Ende die Kate ihrer Familie stand.
Sie öffnete die Eingangstür, zog den Kopf ein und trat in den Raum, der durch einen zerschlissenen Vorhang in zwei Bereiche geteilt war. Im hinteren Teil der Hütte befanden sich die Schlafplätze der Familie sowie die Verschläge für vier Ziegen, acht Hühner und eine Sau. Während des Winters lebten die Tiere mit den Menschen unter einem Dach, damit sie sich gegenseitig wärmten.
Der Bereich, in dem Elisabeth nun stand, war Küche und Wohnraum zugleich. Ein Tisch mit fünf Schemeln, eine Truhe für die Wäsche sowie ein kleiner Schrank für das wenige Geschirr, das die Familie besaß, waren das einzige Mobiliar. An der schmalen Wand befand sich ein gemauerter Herd, von dessen Feuerstelle dichter Rauch aufstieg, der durch den Schornstein abziehen sollte. Doch der kalte Wind drückte ihn zurück in die Kammer. Da die Fenster mit Stroh verstopft waren, konnte er nur notdürftig entweichen.
Das Mädchen kniff die Augen zusammen, die vom Rauch zu brennen begannen. »Wie oft habe ich dir gesagt, dass du das nasse Holz erst vor dem Ofen trocknen sollst! Es brennt nicht, es qualmt nur, und wärmt kein bisschen«, maulte sie hustend ihren Bruder an, der mit ihrer Schwester Adelheid am Tisch saß und getrocknete Maiskolben schälte. Mit dem Schürhaken zog sie das rauchende Scheit zur Seite.
Dann schnallte sie den Tragekorb ab, lehnte ihn gegen die gekalkte Wand und öffnete den Eingang. »Wenn man nicht alles selber macht«, murmelte sie und wedelte mit dem Türblatt den Rauch nach draußen.
Da wurde der Vorhang zur Seite geworfen, und ihre Mutter erschien. »Warum ist es so kalt in der Stube?«, fragte sie. Kaum erblickte sie Elisabeth, keifte sie ihre Tochter an: »Wo bist du so lang gewesen?«
Elisabeth schloss die Tür wieder und legte ihren feuchten Umhang über den Stuhl. Sie war verärgert über den anklagenden Tonfall der Mutter. »Du weißt, dass Vater mich mit den Karpfen zu Johanna geschickt hat«, erklärte sie ihr.
»Das war am Mittag. Seit Stunden warte ich auf dich!«
»Der Korb war schwer und der Weg rutschig und mühsam«, verteidigte sich das Mädchen.
»Du weißt, dass meine Finger bei diesem Wetter schmerzen, sodass ich die Ziegen nicht melken kann.« Die Mutter streckte ihr die verkrüppelte rechte Hand hin, an der man Verdickungen an den Gliedern erkennen konnte. Ihre Miene verriet die Schmerzen, die sie plagten.
»Adelheid oder Ulrich hätten dir helfen können«, erwiderte Elisabeth und sah wütend zu ihren Geschwistern.
»Dein Bruder war mit dem Vater unterwegs. Und deine Schwester hat kein Geschick zum Melken, das weißt du doch.« Plötzlich wanderte der Blick der Mutter über Elisabeths Leib. Sie zupfte am Stoff des Kleids. »Wessen Gewand ist das?«, fragte sie misstrauisch.
»Es gehört Johanna. Ein Reiter hat mich umgerissen auf dem Weg zu ihr, sodass ich hingefallen bin und vollkommen durchnässt war …« Die Ohrfeige der Mutter unterbrach Elisabeths Rede. »Warum schlägst du mich?«, jammerte sie und hielt sich die Wange.
»Du lügst. Niemand hier besitzt ein Reitpferd.«
»Es war ein fremder Mann.«
Erneut brannte ihre Wange. Verwirrt schaute sie die Mutter an, die schnaubend vor ihr stand. »Du wagst es, deine Mutter abermals anzulügen? Anstatt deiner Arbeit nachzugehen, hast du dich herumgetrieben!«
»Ich spreche die Wahrheit. Es war ein Edelmann auf einem wertvollen Pferd.«
Als die Mutter erneut die Hand hob, wich Elisabeth dem Schlag aus.
»Ich glaube dir kein Wort. Was sollte ein Edelmann hier in dieser Gegend zu schaffen haben? Auch frage ich mich, woher ausgerechnet du wissen willst, dass er ein solcher war?« Mit hartem Blick fixierte die Mutter sie. »Warum hast du keine Entschädigung für dein ramponiertes Kleid verlangt, wenn der Fremde ein reicher Mann war?«
Elisabeth zuckte mit den Schultern.
»Du weißt es nicht? Dann werde ich es dir sagen. Weil deine Geschichte erlogen ist. Du bist ein liederliches Weibsbild, das sich vor der Arbeit drückt. Warte nur, bis dein Vater aus dem Gasthaus kommt. Dann setzt es Prügel.«
Elisabeth dankte mit einem Stoßgebet, dass ihr Vater nicht zu Hause war. Während die Mutter wegen ihrer kranken Hände nur wenige Male zuschlug, prügelte der Vater die Kinder nicht nur mit der Faust, sondern auch mit einem Rohrstock, den er ihnen über die Beine zog. Diesen Schlägen konnte man unmöglich ausweichen. Doch da der Vater in der Schankstube war, würde er sicherlich erst zurückkommen, wenn alle schon schliefen.
Sie versuchte die Mutter zu versöhnen und sagte: »Du irrst, Mutter! Ich schwöre dir bei allem, was mir lieb und teuer ist: Das Ross des Reiters hat mich zu Boden gerissen. Ich habe dem Mann Hurenbock nachgerufen, doch er ist unbekümmert weitergeritten. Alle Karpfen lagen auf dem Weg verstreut. Bis ich sie eingesammelt hatte, waren meine Finger steif gefroren«, erklärte sie und zeigte ihre geröteten Hände. Dabei sah sie die Mutter flehend an. Sie hoffte, dass diese ihre halb wahre Geschichte glaubte. Doch die sagte kein Wort, sondern taxierte sie nur mit mürrischem Blick.
»Ich friere und bin hungrig«, wisperte Elisabeth und umfasste ihre Oberarme.
Die Gesichtszüge der Mutter entspannten sich. Schließlich nickte sie. »Zieh dir meine dicken Strümpfe über. Ich habe Suppe gekocht, die dich wärmen wird. Anschließend melkst du die Ziegen«, erklärte sie mild gestimmt und verschwand hinter dem Vorhang.
Elisabeth schloss erleichtert die Augen. Als sie dann ihre Geschwister anschaute, konnte sie das Grinsen ihres Bruders und der Schwester erkennen.
»Was gib es da zu feixen?«
»Warte nur, bis der Vater davon hört«, höhnte der Elfjährige, der durch seine Größe und massive Gestalt älter wirkte, aber einen kindlichen Verstand hatte.
»Du holst sofort trockenes Holz aus dem Schuppen, Ulrich«, befahl Elisabeth ihm. Als er nicht gehorchte, sprang sie zu ihm und zog ihn am Ohr zur Tür.
»Du hast mir nichts zu sagen«, quiekte der Junge und sah sie zornig an, während er sich das rote Ohr rieb.
»Halt dein Maul«, fauchte Elisabeth, öffnete die Tür und stieß ihn hinaus in die Kälte. Dann ging sie zurück in die Kammer und nahm die dicken Strickstrümpfe ihrer Mutter aus der Wäschetruhe.
Seufzend setzte sie sich vor den Herd, zog ihre aufgeweichten Schuhe und Socken aus und streckte die Füße der Glut entgegen. Rasch fingen die Zehen an zu kribbeln, als ob Ameisen auf der Haut liefen. Sie zog die Strümpfe über und hängte ihre eigenen zum Trocknen auf. Dann füllte sie sich eine Schüssel mit der dünnen Suppe und setzte sich an den Tisch zu ihrer Schwester Adelheid.
Bereits nach wenigen Schlucken fühlte sie, wie die Wärme in ihren Körper zurückströmte. Während sie ein Stück trockenes Brot brach, um es in die Brühe zu tunken, spürte sie den Blick der Schwester auf sich. Fragend schaute sie die Fünfzehnjährige an.
»Wie sah er aus, dieser Edelmann?«, flüsterte Adelheid, wobei ihre Augen seltsam leuchteten.
Stirnrunzelnd betrachtete Elisabeth das Gesicht des Mädchens. »Warum willst du das wissen?«, fragte sie ebenso leise.
»Ich habe noch nie einen Edelmann gesehen.«
»Er war so schnell fort, wie er gekommen war«, erklärte Elisabeth und wandte sich ihrer Mahlzeit zu.
»Irgendetwas musst du von ihm zu berichten wissen.«
»Es gibt nichts, was ich dir erzählen könnte«, erklärte Elisabeth gereizt. Sie hatte Angst, sich zu verplappern, und wollte deshalb das Gespräch beenden.
»Du wirst rot«, spottete ihre Schwester.
»Das kommt von der heißen Suppe«, murmelte Elisabeth und wischte sich über das Gesicht.
»Ich glaube dir nicht. Du willst mir nur nichts über den Fremden verraten.«
Ertappt blickte Elisabeth ihre Schwester an.
»Ich werde dich nicht verpetzen«, versprach Adelheid leise und schielte zum Vorhang hinüber. Die beiden Mädchen wussten, dass die Mutter leidend auf ihrer Matratze lag und für ein rasches Ende des Winters betete. Denn erst wenn die Frühlingssonne die feuchte Kälte verdrängte, würden ihre Gliederschmerzen erträglich werden. Bis dahin mussten die beiden Mädchen die Arbeit im Haus und bei den Tieren erledigen.
»Woher willst du wissen, dass ich dir irgendetwas erzählen könnte?«, raunte Elisabeth.
»Ich weiß es, denn ich konnte es in deinem Blick erkennen. Jetzt erzähl endlich, bevor unser Bruder zurückkommt.«
Elisabeth kaute auf der Unterlippe. Sie zögerte. Ihre Schwester war nicht die Person, der sie ein Geheimnis anvertrauen wollte, da sie kein inniges Verhältnis zueinander hatten. Adelheid war unehrlich und verschlagen und galt im Dorf als Person, die jeden verpetzen würde, wenn sie dadurch einen Vorteil erhaschen konnte. Zudem war sie altklug und besserwisserisch. Sie spielte sich gern wie eine ältere Schwester auf, obwohl sie zwei Jahre jünger war als Elisabeth. Elisabeth sah nachdenklich auf den Boden der Suppenschale. Nur zu gern wollte sie sich jemanden anvertrauen, denn die Begegnung mit dem Fremden beschäftigte sie mehr, als ihr lieb war. Die einzige Person, der sie traute, war ihre Freundin Johanna. Doch die war nicht da.
Zweifelnd schaute sie die Schwester an. »Du verrätst mich wirklich nicht?«
»Ich schwöre es«, griente Adelheid und hielt ihre Schwurfinger hoch.
»Du weißt, was dich erwartet, wenn du den Schwur brichst. Du kommst in die Hölle«, versuchte Elisabeth sie zu warnen.
Adelheid nickte.
Elisabeth streckte den Kopf über den Tisch näher an ihre Schwester heran. Mit leiser Stimme berichtete sie vom Zwischenfall mit dem fremden Mann.
»Er brachte dich auf seinem wertvollen Pferd zu Johanna?«, wiederholte Adelheid zweifelnd.
»Das war ja wohl das Mindeste. Schließlich hatte mich sein Ross zu Boden geworfen. Meine Kleidung war vollkommen durchnässt. Ich wäre sonst sicherlich erfroren. Deshalb hatte er wohl Mitleid mit mir«, erklärte sie. Doch dann sah sie, wie Adelheid ungläubig die Stirn kräuselte und einen Mundwinkel anhob.
»Warum zweifelst du an meiner Schilderung?«, empörte sich Elisabeth.
»Weil es unwahrscheinlich ist, dass ein Edelmann Mitleid mit einem Bauernmädchen hat. Solch einem Menschen kann es einerlei sein, ob du nass wie eine Katze bist, frierst oder gar erfrierst. Ich kenne zwar keinen Edelmann, und ich weiß so gut wie nichts über solche Menschen. Doch ich bin mir sicher, dass sie mit unsereins nichts zu tun haben wollen. Deshalb glaube ich dir kein Wort.«
Elisabeth war gekränkt. Sie kaute auf der Unterlippe. Sollte sie Adelheid verraten, was der Fremde außerdem zu ihr gesagt hatte?, überlegte sie. Zwar zögerte sie, doch dann platzte es aus ihr heraus: »Er hat mich hübsch genannt«, verriet sie mit hochroten Wangen.
Nun weiteten sich Adelheids Augen. Dann lachte sie schallend los. »Er hat dich hübsch genannt? Wie meinte er das?«
»Wie soll er das gemeint haben? Ich verstehe dich nicht«, erklärte Elisabeth verunsichert.
Adelheids Lachen verstummte. Stattdessen musterte sie die ältere Schwester. »Was ist denn hübsch an dir? Hat er das begründet?«
»Das hat er mir nicht gesagt. Er meinte, ich wäre ein hübsches Kind«, erklärte Elisabeth mit schwacher Stimme. Als sie den spöttischen Blick der Schwester bemerkte, presste sie wütend die Lippen aufeinander.
Adelheid fragte nun mit gehässigem Tonfall: »Bist du so hübsch wie ein fetter Karpfen? Oder so hübsch wie die beste Ziege im Stall? Oder so wie Veronica, die die Männer als schön bezeichnen, weil sie die Beine breit macht?«
Als Elisabeth schwieg, meinte ihre Schwester: »Wahrscheinlich hat er dich nicht genau betrachtet. Ich finde dich nämlich nicht hübsch. Deine Nase ist zu lang, dein Körper zu dürr, und du hast keine Brüste.«
Erschrocken griff Elisabeth nach ihrer Nase und sah dann an sich herunter. Sie wusste nicht, wie sie aussah. Zwar spiegelte sich ihr Antlitz manchmal im Wassertrog, doch noch nie hatte sie ihr Gesicht deutlich erkennen können. »Sehe ich so schrecklich aus?«, fragte sie entsetzt.
Adelheid zuckte mit der Schulter. »Mich hätte er sehen müssen. Dann wüsste er, was hübsch bedeutet. Ich habe volle Brüste und ein breites Becken, mit dem ich eine Schar Kinder gebären werde.«
Elisabeth betrachtete ihre jüngere Schwester, die der Mutter glich. Ihr rötliches Haar kringelte sich in alle Richtungen. Zahlreiche Sommersprossen bedeckten ihre blasse Haut. Ihre Lippen waren voll, die Nase stupsig und die Augen so schwarz wie die Nacht.
Sie selbst hingegen ähnelte dem Vater. Sie hatte dunkles, glattes Haar und blaue Augen. Ihre Figur wirkte fast knabenhaft schlank, ihr Becken war schmal und ihre Beine lang. Sie blickte auf ihre Brüste, die man mehr erahnen als sehen konnte. Adelheid hatte recht! Sie schien in keiner Weise hübsch zu sein. Wahrscheinlich hatte sich der fremde Mann einen Spaß mit ihr erlaubt.
Aber warum hat er das gemacht?, überlegte sie, als ihre Schwester sie aus den Gedanken riss.
»Gib zu, dass du Mutter und mich belogen hast, du keinen Fremden getroffen hast und dich auch kein Gaul umgerissen hat«, forderte Adelheid sie auf. Als Elisabeth schwieg, triumphierte sie sichtlich.
Da wurde die Tür aufgestoßen, und ihr Bruder kam mit dem Feuerholz auf den Armen herein.
»Wir müssen in den Wald und Holz sammeln. Es ist kaum noch welches da«, sagt er und ließ die Äste vor dem Herd zu Boden fallen.
»Elisabeth ist dieses Mal dran«, erklärte Adelheid und meinte süffisant: »Pass aber auf, dass du nicht wieder zu Boden gerissen wirst, wenn dir ein Mann begegnet.«
Elisabeth hatte genug von dem Gespräch. »Ich melke jetzt die Ziegen«, sagte sie und verschwand hinter dem Vorhang.
Kapitel 4
Kapitel 4
In einem Waldgebiet in Württemberg
Frédéric hatte sich erschöpft an einen Baum gelehnt, als er keine dreißig Schritte entfernt einen prächtigen Hirsch entdeckte. Sofort ging er in die Knie. Da das Tier ihn nicht zu wittern schien, schlich er hinter einen mächtigen Baumstamm, der quer über dem Waldboden lag. Dort richtete er sich vorsichtig auf, beugte sich nach vorn und stützte sich mit einer Hand auf dem Holz ab. Als die abgestorbene Borke der Eiche unter seiner Berührung zerbröckelte, konnte er den glatten Stamm spüren. Die Wurzeln, die aus einem Krater emporragten, verbargen seinen Körper. Mit der freien Hand zog er einzelne Wurzelfäden vor seinem Gesicht zur Seite. Obwohl es dämmerte, konnte Frédéric die Umgebung deutlich erkennen. Welch prächtiger Bursche, dachte er. Noch nie hatte er einen lebenden Hirsch so dicht vor sich gesehen.
Das Tier stand zwischen den Bäumen und knabberte am Moos, das den Waldboden bedeckte und das es mit dem Huf vom Schnee befreit hatte. Frédéric schätzte, dass der Hirsch so lang und so schwer war wie ein ausgewachsener Mann.
Das struppige Haarkleid schimmerte dunkelbraun, und am Hinterteil waren helle Stellen zu erkennen. Die Brust des Tiers war breit, der Hals lang und schlank. Auf dem Kopf thronte ein prächtiges Geweih, das gleichmäßig gewachsen und unbeschädigt war. Nur selten hatte Frédéric ein solch tadelloses Geweih gesehen. Meist wurden die Stangen von Hirschen bei Machtkämpfen zwischen den Rivalen während der Brunftzeit beschädigt. Dieses Tier jedoch hatte ein perfektes Geweih, das eine außergewöhnliche Trophäe abgeben würde. Zwar wusste Frédéric, dass es seinen Kopfschmuck in den nächsten Wochen abstoßen und im Wald abwerfen würde. Doch dann wäre der Fund für Frédéric ohne Wert. Nur das Geweih am Schädel des Hirsches würde beweisen, dass er den König des Waldes erlegt hatte.
Frédéric spürte, wie sich jeder Muskel seines Körpers anspannte. In Sorge, dass ein Geräusch oder eine Witterung den Hirsch aufschrecken könnte, bevor er ihn zur Strecke bringen konnte, sah er sich nach allen Seiten um. Keiner der Treiber, deren Hunde oder andere Männer der Jagdgesellschaft waren zu sehen oder zu hören. Erst als er sicher war, allein in diesem Waldstück zu sein, löste sich seine Anspannung. Er konzentrierte sich auf das Tier und versuchte gleichmäßig zu atmen, um seine Aufregung zu unterdrücken.
Der Hirsch schien den Jäger nicht zu wittern. Während er beharrlich äste, schnaubte er leise. Helle Dunstwolken kamen aus seinen Nüstern und stiegen an seinem Kopf empor.
Es wird mir eine Ehre sein, dich zu erlegen, dachte Frédéric und ließ das Wurzelgestrüpp geräuschlos aus der Hand gleiten. Ohne den Blick von dem Tier abzuwenden, griff er neben sich an den Baumstamm, um seine Armbrust aufnehmen. Doch er griff ins Leere.
Als sein Blick suchend über den Waldboden glitt, fiel es ihm ein: Er hatte seine Jagdwaffe nicht mitgenommen, da er nicht zur Hatz aufgebrochen war. Bestürzt wurde ihm bewusst, dass er sich ja eigentlich von der Jagdgesellschaft entfernt hatte, um seinen Vetter zu suchen, der von der Verfolgung eines Wildschweins nicht zurückgekommen war. Zwar musste sich Frédéric nicht wirklich um den Cousin sorgen. Georg war ein geübter Jäger – wagemutig und schusssicher; auch saß er wie festgewachsen im Sattel. Doch da der erneute Wintereinbruch die Wege vereist hatte, konnte es durchaus sein, dass Georgs Stute gestürzt war und den Reiter unter sich begraben hatte.
Bei der Kälte käme das einem Todesurteil gleich, dachte Frédéric. Er ärgerte sich, dass ihm nach dem Halali-Signal, das das Ende der Jagd signalisiert hatte, nicht sofort aufgefallen war, dass Georg fehlte. Erst nachdem er mit den Männern zum Jagdhaus zurückgekehrt war, hatten sie sein Verschwinden bemerkt und dadurch kostbare Zeit verloren. Nun würde die Dunkelheit die Suche erschweren und gefährlich werden lassen. Sie kannten das Waldgebiet, das von Schluchten und Abhängen durchzogen war, nicht gut genug, um es bei Nacht zu durchforsten.
Unruhe bemächtigte sich Frédérics. Georg hatte ein ungestümes Wesen. Er war berauscht von der Jagd und ruhte nicht eher, bis er das anvisierte Tier zu Fall gebracht hatte. Dabei war es in der Vergangenheit zu gefährlichen Situationen gekommen, doch die hatten Georgs Wagemut eher entflammt statt gebremst. Hoffentlich ist er wohlauf, dachte Frédéric.
Seine bangen Gedanken kreisten um ein Gespräch, das er mit seinem Onkel, dem Herzog von Württemberg, zwei Tage vor ihrem Aufbruch geführt hatte. Mit ernster Miene hatte der Oheim Frédéric den Befehl erteilt, auf den Cousin zu achten und ihn nicht aus den Augen zu lassen. »Ich will, dass du Tag und Nacht bei ihm bist! Selbst wenn er zum Abort geht, folgst du ihm«, hatte der Herzog streng gefordert. Erstaunt und stirnrunzelnd hatte Frédéric seinen Onkel angesehen, der seinen Befehl so begründete: »Ich kenne meinen Sohn! Ich weiß um sein hitziges Temperament. Da ich nicht will, dass er Schaden nimmt oder in brenzlige Situationen gerät, verlasse ich mich darauf, dass du ihn bändigst. Du bist der Besonnene von euch beiden. Ich weiß natürlich, dass er kaum auf dich hören wird, aber bemüh dich trotzdem.«
Frédéric wollte erwidern, dass Georg ein erwachsener Mann war, der kein Kindermädchen benötigte. Doch dem Herzog widersprach man nicht, und so hatte er genickt und dem Oheim versichert, auf seinen Vetter aufzupassen.
Bei dem Gedanken daran rollte er nun innerlich die Augen. Als ob Georg sich maßregeln ließe, dachte er spöttisch. Allerdings wusste er auch den wahren Grund für die strenge Anweisung. Sein Vetter sollte schon bald heiraten, und diese Hochzeit war für die fürstliche Familie wichtig. Deshalb wollte Georgs Vater jede Gefährdung der Vermählung ausschließen. Frédéric wusste, dass sein Onkel den zahlreichen Frauengeschichten seines Sohnes kritisch gegenüberstand. »Nicht auszudenken, wenn Mathilde davon erfahren würde. Sie ist wohlbehütet und fromm aufgewachsen. Nie und nimmer würde sie Georgs Affären verstehen oder akzeptieren«, hatte sein Onkel ihm in dem vertraulichen Gespräch verraten.
»Was verlangt diese Frau von einem Mann im besten Alter? Soll er sich sein Verlangen aus den Rippen schwitzen?«, hatte Frédéric versucht, seinen Cousin zu verteidigen.
»Die Zeit ist vorbei, dass mein Sohn jedem Rock hinterhersteigt. In wenigen Monaten ist er ein verheirateter Mann und kann sich in seinem Ehebett beweisen und austoben«, hatte der Onkel rüde geantwortet und hinzugefügt: »Ich vertraue deinem Geschick, deinem Vetter Einhalt zu gebieten.«
Frédéric hatte den Kopf geschüttelt. Wie sollte er seinen Cousin auf den rechten Weg bringen, zumal der kein Interesse hatte, seine Manneslust zu zügeln? Georg liebte die Frauen, und sie liebten ihn.
Er blickte auf den Hirsch, der den Jäger noch immer nicht bemerkt hatte. »Heute ist dein Glückstag«, murmelte er, nahm einen Stein vom Boden auf und warf ihn auf die Lichtung. Aufgeschreckt hob der Hirsch den Kopf, um dann davonzuspringen.
Missmutig verließ Frédéric seine Deckung, um seinen Vetter zu suchen.
Am Ende des Waldwegs traf er auf die Männer der Jagdgesellschaft, die sich mit ihm auf die Suche gemacht hatten. Als er ihre Gesichter sah, wusste er, dass auch sie keine Spur von Georg gefunden hatten.
»Haben die Hunde keine Fährte aufgenommen?«, fragte er ungläubig.
Die Treiber schauten betreten zu Boden.
»Verfluchte Viecher! Sie sind zu alt. Wenn wir zurück sind, werdet ihr sie gegen jüngere austauschen«, schimpfte Frédéric.
»Ihre Nasen sind die besten weit und breit. Die Hunde stöbern jedes Wild auf, aber wenn der Herr nicht hier war, können sie keine Spur von ihm aufnehmen«, wagte einer der Jagdgehilfen zu erwidern.
Frédéric baute sich dicht vor ihm auf. »Wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen?«, presste er hervor. Er konnte nicht dulden, dass ein Jagdgehilfe sich ihm gegenüber respektlos verhielt, selbst wenn er nur der Bastard der Herzogsschwester war.
Beschämt schaute der Bursche zu Boden, als einer der Jäger meinte: »Er hat recht! Da die Hunde seine Fährte nicht aufgenommen haben, war der Herzogssohn nicht in diesem Waldstück. Wer weiß, zwischen welchen Schenkeln dein Vetter liegt.« Lachend und beifallheischend blickte er um sich.
Mit erstarrtem Gesichtsausdruck drehte sich Frédéric von dem Burschen weg und dem Mann zu, der noch immer breit grinste. »Was erlaubst du dir? Du hast keinen Freibrief, um über Georg zu spotten. Er ist der Sohn deines Regenten!«, schimpfte er und sah ihn strafend an. »Niemand beleidigt den Sohn Herzog Friedrichs, außer er sich selbst«, schnauzte er mit bösem Blick und wandte sich von den Männern ab.
»Lasst uns umkehren«, schlug einer der Älteren vor. »Es wird bald stockdunkel im Wald sein, sodass wir die Hand vor Augen nicht mehr erkennen werden.«
»Wir können die Suche nach dem Sohn des Herzogs nicht einfach so aufgeben!«, entrüstete sich ein anderer.
»Wir wissen nicht einmal, ob er hier im Wald ist. Zudem nutzt es niemandem, wenn wir uns in der Finsternis den Hals brechen. Sobald der Tag anbricht, werden wir uns erneut auf die Suche machen.«
Frédéric schloss die Augen und holte tief Luft.
»Georg ist ein guter Jäger und ein exzellenter Reiter. Vielleicht liegt er tatsächlich bei einer holden Maid«, erklärte einer der älteren Männer vorsichtig.
Müde öffnete Frédéric die Augen und rieb sich über das Gesicht. Seine Bartstoppeln verursachten ein kratzendes Geräusch. Das darf nicht wahr sein, dachte er. In all den Jahren, wenn er mit seinem Cousin zusammen auf der Jagd gewesen war, war nie etwas passiert. Ausgerechnet jetzt, wo sein Oheim ihm den Befehl gegeben hatte, auf Georg aufzupassen, verschwand er spurlos. Geistesabwesend schaute er in die Gesichter der Männer. Schließlich nickte er.
»Lasst uns zum Jagdhaus zurückkehren«, sagte er und marschierte los, ohne sich noch einmal umzusehen.
Als Frédéric in die Wohnhalle des Jagdhauses trat, traute er seinen Augen nicht. Vor dem Kamin saß sein Cousin, die Beine entspannt dem Feuer entgegengestreckt, in der Hand ein Glas Rotwein.
Als Georg Frédéric erblickte, sah er ihn verärgert an. »Wo bleibt ihr denn? Ich verhungere und langweile mich noch zu Tode, weil ich keinen habe, mit dem ich palavern kann.«
»Wo bist du gewesen?«, fragte Frédéric unwirsch.
»Gott sei Dank, Herr! Ihr seid wohlauf«, rief der ältere Jäger, als er eintrat und Georg vor dem Kamin sitzen sah. Und auch die anderen begrüßten ihn erleichtert.
»Was soll das?«, entrüstete sich Georg und schlug die Hände, die man ihm entgegenstreckte, wie lästige Fliegen fort. »Ihr tut, als ob ich von den Toten auferstanden wäre.«
»Wir haben bereits das Schlimmste befürchtet.«
Fragend hob der Fürstensohn eine Augenbraue. »Was sollte mir passieren?«
»Herrgott, Georg! Du hättest verletzt sein können, vom Pferd gefallen …«
»Halt dein Maul, Frédéric! Du vergisst wohl, mit wem du redest. Ich bin ein begnadeter Schütze und ein ebenso brillanter Reiter. Was sollte mir schon passieren?«, erklärte Georg hochnäsig.
»Wo bist du gewesen?«, wiederholte Frédéric, ohne auf die Rüge einzugehen.
»Das geht dich nichts an!«, erwiderte Georg und nippte am Rotwein.
Frédéric betrachtete seinen Vetter und erkannte das feine Zucken um seine Mundwinkel. Das darf doch nicht wahr sein, dachte er und forderte die Männer, die neugierig um die beiden herumstanden, auf: »Lasst uns allein!«
Als sie nicht sofort den Raum verließen, brüllte er: »Worauf wartet ihr?«
Sogleich eilten sie zu der doppelflügeligen Tür.
»Zieht die Tür hinter euch zu«, befahl er. Fast geräuschlos fiel sie ins Schloss.
Frédéric ging zu dem wuchtigen Eichentisch, der seitlich vor der langen Wand platziert war. Zwanzig schwere Stühle, deren Rücken und Sitzflächen mit Gobelinstickereien verziert waren, standen darum herum. Er beugte sich über einen der Sitzplätze und griff nach einem leeren Glas auf dem Tisch. Dann nahm er die schwere Karaffe auf, goss sich Rotwein ein und nahm einen tiefen Schluck. Erst dann wandte er sich seinem Cousin zu, der ihn missmutig taxierte.
»Was erlaubst du dir, mich vor den Männern zu rügen?«, schimpfte Georg lautstark.
Frédéric schnaubte. Er wusste, was Georg ihm eigentlich klarmachen wollte. Schon seit sie Kinder waren, bereitete es seinem Cousin unverhohlenes Vergnügen, ihn immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie von unterschiedlichem Stand waren. Auch wenn Frédéric der Sohn der Schwester von Herzog Friedrich war, so war sein Erzeuger nicht von adliger Herkunft gewesen. Seine Mutter hatte sich als Sechzehnjährige von einem Rittmeister schwängern lassen. Auch wenn sie beteuerte, dass dieser Mann ihre große Liebe war, musste Barbara auf sämtliche Titel verzichten. Sie wurde aufs Land verbannt, um heimlich dort ihr Kind zu gebären. Den Rittmeister schickte man in den Krieg, wo er bald darauf fiel. Frédéric hatte weder seinen Vater noch seine Mutter kennengelernt. Angeblich war Barbara kurz nach seiner Geburt am Fieber gestorben. Böse Zungen behaupteten hingegen, dass sie ins Wasser gegangen sei, als sie vom Tod des Geliebten gehört hatte.
Frédéric war bei einer Amme aufgewachsen, bis er im Alter von acht Jahren an den herzoglichen Hof kam. Dort wurde er unterrichtet und in das höfische Leben eingewiesen. Es hieß, sein Oheim fühlte sich der toten Schwester gegenüber verpflichtet und kümmerte sich deshalb um deren Sohn. Doch Frédéric vermutete eher, dass der Oheim ihn dazu ausersehen hatte, das ungestüme Wesen seines Sohnes zu befrieden. Die beiden Knaben waren fast gleich alt und wuchsen eng wie Geschwister auf. Trotzdem hatte Frédéric stets das Gefühl, am Hof nur geduldet, aber nie ebenbürtig anerkannt zu sein. Als Kind hatte es ihn verletzt, wenn seine Vettern und Basen ihn als einen Niemand bezeichneten. Er sehnte sich nach Zuneigung und Akzeptanz. Im Laufe der Jahre aber wurde sein Fell dick, und heute prallten die Beleidigungen an ihm ab. Auch wusste er sich zu wehren. Doch die Sehnsucht nach einer liebenden Familie blieb.
Er sah Georg gleichmütig an. »Ich allein muss deinem Vater Rede und Antwort stehen, wenn dir etwas passiert. Außerdem: Was soll ich Mathilde erzählen, wenn du verletzt wirst oder gar Schlimmeres mit dir geschieht?«, fragte er ernst, um anschließend die Lippen aufeinanderzupressen, damit ihn sein kaum unterdrücktes schadenfrohes Grinsen nicht verriet. Er erahnte die Reaktion seines Vetters, noch bevor er den letzten Buchstaben von Mathildes Namen geformt hatte.
»Pah«, grunzte Georg und verzog angewidert den Mund. »Diese Person kann mir gestohlen bleiben«, murmelte er und leerte sein Glas mit einem Zug.
»Bereits in wenigen Monaten läuten für euch die Hochzeitsglocken …«
»Halt’s Maul, du Bastard! Willst du mir den Tag heute vollends vermiesen?«
Frédéric sah ihn schadenfroh an. Niemand beneidete Georg um seine Verlobte, die in keiner Weise der Sorte seiner bevorzugten Frauen entsprach. Mathilde war von kleiner Statur mit ausladenden Hüften. Sie hatte eine hohe Stirn, und ihre Augen standen weit auseinander und erinnerten an die Glubschaugen einer Kröte. Weder in ihrem Gesicht noch an ihrem Körper war etwas, das man hübsch nennen konnte. Nicht einmal die Hände waren zierlich, sondern so breit wie die eines Handwerkers. Der Verlobungsring, der von der Herzogsmutter an die zukünftige Schwiegertochter weitergereicht worden war, musste dreimal geweitet werden, da er nicht über ihre wulstigen Finger passte.
Vor allem aber war ihm Mathilde durch und durch unsympathisch. Erst vor Kurzem hatte Frédéric beobachtet, wie sie ihr Reitpferd brutal mit der Peitsche schlug, da es vor ihrem ausladenden Rock scheute, gerade als sie aufsteigen wollte. Solche Menschen waren ihm zuwider, und deshalb mochte er Mathilde nicht.
Hätte sich Georg seine Braut selbst aussuchen dürfen, dann wäre es niemals Mathilde gewesen. Sein Vater Friedrich hatte die Siebzehnjährige erwählt, da sie eine großzügige Mitgift mit in die Ehe bringen würde. Nur darum ging es dem Herzog, der auf das Geld angewiesen war, denn er hatte ein kostspieliges Vergnügen, das Unsummen verschluckte: Herzog Friedrich war der Alchemie verfallen. Er träumte von Bergen aus Gold, die ihm die Alchemisten aus Eisenerz herstellen sollten. Doch die Wissenschaftler, die Laborutensilien und die Rohstoffe mussten erst einmal bezahlt werden.
Das wusste auch Georg, der sich dem Willen des Vaters beugen musste.
Frédéric zog einen Stuhl vom Tisch, um sich nahe bei seinem Cousin an den Kamin zu setzen, füllte beider Gläser mit Rotwein nach und fragte streng: »Wo bist du gewesen, Georg? Ich habe mir wahrhaftig Sorgen um dich gemacht.«
Erneut zuckte ein verräterisches Lächeln über Georgs Gesicht, das typisch war, wenn er eine Liaison mit einer Frau hatte. Deshalb fragte Frédéric geradeheraus: »Wo hast du die Maid getroffen? Sie wird wohl kaum im Wald unterwegs gewesen sein.« Er zwinkerte seinem Vetter freundschaftlich zu.
»Wie kommst du darauf …?«, begann der Herzogssohn, doch Frédéric hob die Hand und unterbrach ihn. »Halt mich nicht für dumm! Ich kenne diesen besonderen Gesichtsausdruck, wenn dir ein Mädchen durch den Kopf geistert.«
Georg beugte den Oberkörper nach vorn und legte die Unterarme auf den Oberschenkeln ab. Mit beiden Händen hielt er sein Glas, das er zwischen den Fingern hin und her drehte. »Ich habe sie tatsächlich auf einem Waldweg getroffen …« Mit leuchtenden Augen erzählte er von der Begegnung mit der Fremden.
»Ist sie etwa eine Magd? Oder gar ein Bauerntrampel?«, fragte Frédéric entsetzt.
»Als Trampel würde ich sie nicht bezeichnen. Würdest du sie in edle Stoffe kleiden, dann würde sie meine Zukünftige in allem ausstechen.«
Das könnte jede Frau auch ohne edle Kleider, spottete Frédéric in Gedanken und sah Georg kopfschüttelnd an. »Wegen einer Bauernmaid hast du uns warten lassen? Seit wann gibst du dich mit Fußvolk ab? Selbst die Dirnen, die du zu dir kommen lässt, sind erste Wahl.«
»Wie soll ich dir das erklären? Du müsstest sie sehen, dann würdest du mich verstehen.«
»Gott bewahre! Ich hoffe nicht, dass du sie noch einmal aufsuchst.«
Sein Vetter zuckte mit den Schultern. »Warum nicht?«
»Du willst sie unter dir haben?«
Georg rieb sich zwischen den Beinen. »Allein der Gedanke an sie lässt meinen Latz eng werden. Ich glaube, sie bedeutet mir etwas.«
»Wenn du schon nach dem ersten Treffen so begeistert bist, muss sie wie eine Göttin aussehen. Beschreib sie mir«, höhnte Frédéric.
Georg schien nachzudenken. »Sie hatte helle … nein, dunkle Haare. Ihr Körper scheint grazil zu sein … Jedenfalls ließ das ihre Kleidung erahnen … und sie war widerborstig.«
»Du bist von Sinnen! Du hast doch gar keine Ahnung, wie sie aussieht. Sie ist lediglich eine Beute, die du erlegen willst«, schimpfte Frédéric.
Georg zuckte mit den Schultern. »Nenn es, wie du willst. Bevor ich das Bett mit Mathilde teilen muss, will ich noch ein wenig Spaß haben. Nur so werde ich meine Hochzeitsnacht ertragen können. Doch nun lass es gut sein. Ich mache sowieso, was ich will«, lachte er, erhob sich und ging zur Tür.
Kapitel 5
Kapitel 5
Elisabeth spürte, wie jemand an ihren Haaren zupfte. Trotzdem stellte sie sich schlafend. Auch als sie am Arm gezogen wurde, hielt sie die Augen fest geschlossen und sagte kein Wort.
»Du musst aufstehen!«, hörte sie die Stimme ihres Bruders.
Blind griff sie nach der zerschlissenen Zudecke und zog sie sich bis zur Nasespitze hoch. »Muss ich nicht«, nuschelte sie und drehte Ulrich den Rücken zu.
»Vater hat gesagt, ich soll dich von der Matratze werfen, wenn du nicht gehorchst.«
Nun riss Elisabeth die Augen auf. »Was will er?«, flüsterte sie und setzte sich auf. Die mit Stroh zugestopften Fensternischen verbargen fast jegliches Licht, sodass Elisabeth den Bruder nur schemenhaft erkennen konnte. Als er leise gluckste, wusste sie, dass er log.
»Du Tunichtgut! Warum weckst du mich? Es ist noch tiefe Nacht«, erkannte sie mit einem Seitenblick zur Eingangstür. Wäre der Morgen angebrochen, hätte das Tageslicht seinen Weg durch den breiten Spalt zwischen Mauerwerk und Rahmen ins Innere der Hütte gefunden. Doch die Zwischenräume waren dunkel.
»Ich kann nicht schlafen, weil ich Hunger habe«, jammerte der Bursche leise.
»Nimm dir etwas zu essen.«
»Es ist nichts da.«
»Dann kann ich dir nicht helfen«, murmelte Elisabeth und legte sich wieder nieder.
»Mein Magen brennt«, erklärte der jüngere Bruder weinerlich.
»Ulrich, ich kann dir wirklich nicht helfen um diese Zeit. Sobald es hell ist, melke ich die Ziege, und dann bekommst du warme Milch zu trinken. Denk an Johannas Hochzeitsfest morgen. Da können wir uns satt essen.«
»Wirklich?«, fragte er skeptisch.
»Ich habe Johanna gestern eine Kiepe voll mit Karpfen gebracht. Die gibt es als Hochzeitsmahl.«
»Warum können wir uns keinen Fisch aus dem Teich fangen?«
»Weil nicht genügend Karpfen für die Zucht übrig bleiben, wenn wir sie für uns selbst angeln. Außerdem verbietet Vater das. Leg dich auf deine Bettstatt und versuch zu schlafen.«
Der Junge gehorchte und schlurfte zurück zu seiner Strohmatratze, die neben dem erloschenen Herdfeuer lag.
Elisabeth schloss die Augen. Auch sie kannte dieses schmerzende Hungergefühl, das ihren Bruder wachhielt. Das Brennen war manchmal so stark, das sie glaubte, der Magen würde sich verkrampfen. Dann versuchte sie den Schmerz mit reichlich Wassertrinken zu lindern, doch es ließ nie nach. Auch sie litt seit Tagen unter unsäglichem Hunger, doch sie schwieg. Sie versuchte, sich mit der Vorstellung zu beruhigen, wie es sich anfühlte, in ein Stück Brot zu beißen. Auch jetzt stellte sie sich den Duft von frisch gebackenem Gebäck vor. Sie kaute mit leerem Mund und schluckte Spucke, um den Körper zu täuschen.
Da der Winter in diesem Jahr besonders lang dauerte, waren die Essensvorräte fast gänzlich aufgebraucht. Erst am Tag zuvor hatte Elisabeth festgestellt, dass nur noch ein Säckchen Erbsen und einige vertrocknete Äpfel und Gelbrüben übrig waren. Wenn ihre Freundin Johanna die Karpfen für die Hochzeit gleich bezahlt hätte, dann wäre Elisabeth zum Bäcker gelaufen, um einen Laib Brot zu kaufen. Doch der Vater wollte selbst abrechnen. Elisabeth fürchtete, dass er die Fische gegen Bier bei Johannas Schwiegervater eintauschen werde. Selbst wenn die Speisekammer völlig blank gefegt wäre, wird er immer nur an sich und seinen Durst denken, schimpfte das Mädchen in Gedanken.
»Die Natur hat lange genug Winterschlaf gehalten. Es wird Zeit, dass der Boden auftaut, damit wir mit dem Pflügen und der Einsaat beginnen können«, murmelte Elisabeth und seufzte leise. Sogar auf die bittere Bettpisserpflanze freute sie sich. Die gezackten Blätter waren das erste Grün, das den Speiseplan bereichern würde. Wenn die Mutter ein bisschen gebratenen Speck über den Salat tat, wurde der herbe Geschmack der Pflanze abgemildert. Trotzdem würde Elisabeths Schwester wie jedes Jahr laut zetern und sich weigern, die Blätter zu essen. Dabei war es wichtig, den Körper nach der strengen Jahreszeit zu entgiften. Doch davon wollte Adelheid nichts wissen. Selbst als der Vater ihr einmal mit Gewalt das Essen in den Rachen gestopft hatte, hatte sie die Blätter wieder ausgewürgt.