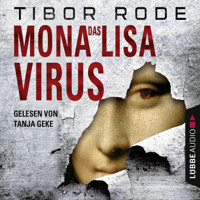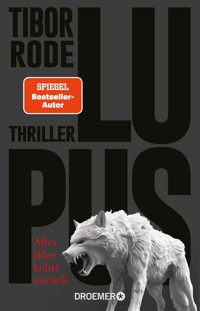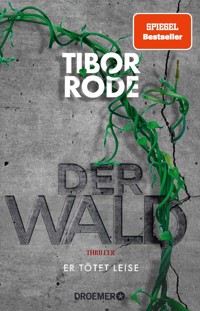9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Für was bist du bereit, deine Seele zu verkaufen? Diese Frage müssen sich vier Menschen in verschiedenen Teilen der Welt stellen, als ihnen ein mysteriöser Mönch die Teilnahme an einem jahrhundertealten Spiel anbietet. Ihr Einsatz: alles, was sie besitzen. Der Gewinn: ein Preis von unermesslichem Wert - die Erfüllung all ihrer Träume. Alle vier lassen sich auf das Spiel und seine Regeln ein. Aber dann geschieht ein Mord, und die Teilnehmer erkennen, wie hoch ihr Einsatz wirklich ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Nachwort und Danksagung
Tibor Rode
Das Los
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieser Titel wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Karin Schmidt
Textredaktion: Dr. Arno Hoven
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München
Einband-/Umschlagmotiv: Johannes Wiebel, punchdesign, München,
unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock/Ultrashock;
shutterstock/serazetdinov; shutterstock/Antonov Roman
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5314-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
FÜR SANDRA
Prolog
Er kauerte unweit des Treppenaufgangs neben einer der Säulen. Obwohl die einfahrenden Züge Schichten aufgeheizter Luft vor sich herschoben und mit aller Gewalt über den Bahnsteig drückten, fror er – wie immer, wenn er Hunger hatte.
Am gestrigen Mittag hatte einer der lauten weißen Touristen ihm vor dem Tea & Cold Drink House einen Pappbecher mit einem Rest Schwarztee und Ziegenmilch überlassen. Seine letzte Mahlzeit. Er hatte gehofft, mit dem leeren Pappbecher in der Hand ein paar Rupien zu erbetteln, um sich davon ein Fladenbrot oder eine Schüssel Linsenbrei kaufen zu können. Nachmittags hatte jedoch urplötzlich ein starker Regen eingesetzt und mit dem Staub der vergangenen Wochen auch alle Menschen samt ihrer Geldbeutel von den Straßen gespült. Wenigstens war der Pappbecher dazu gut gewesen, ein wenig vom Regen aufzufangen. Er hatte ganz vergessen, wie frisch Wasser schmecken konnte – ohne das faulige Aroma alter Wassertanks. Das Grollen der Unwetter über Bombay schien sich am Abend in seinen Magen verzogen zu haben. So schlief er irgendwann im Schutz des schmalen Daches, das den Bahnsteig von Andheri vor Regen schützte, hungrig ein. Als er am Morgen erwachte, war das Erstaunen darüber, dass die Polizisten ihn während der Nacht nicht aus dem Bahnhof verscheucht hatten, nur für einen kurzen Augenblick größer als das Loch in seinem Bauch.
Ein Blick auf die große Uhr zeigte ihm, dass er nun bereits über zwei Stunden an der ursprünglich gelb gestrichenen und inzwischen von der Witterung rostbraun gefärbten Säule lehnte. Über seinem Kopf hing an einem Draht ein großes Schild, auf das man ein Werbeplakat geklebt hatte. Diese Plakate waren überall in der Stadt zu sehen. Da er selbst versuchte, sich das Lesen beizubringen, war er stolz, die beiden Worte entziffern zu können, die in dicken braunen Buchstaben darauf gedruckt waren: Salaam Bombay!
Einer der großen Jungs hatte ihm erzählt, dass es eine Werbung für einen Film war, in dem es um Straßenkinder wie sie ging. Er fühlte sich von dem Plakat auf merkwürdige Art und Weise beschützt. Vielleicht hatten die Polizisten auf ihrer Patrouille ganz fasziniert darauf geschaut und deswegen ihn, der darunter lag, einfach übersehen. Er kroch noch näher an die Säule heran und bemühte sich, mit ihr eins zu werden, damit die vorbeiströmenden Menschenmassen ihn nicht versehentlich in einen der abfahrenden Züge mitrissen.
Mühsam kramte er in seinem Kopf nach den besten Ideen, um schnell an eine große Portion Essen zu gelangen. Doch irgendwie fiel ihm das Denken heute schwer. Zu dieser frühen Morgenzeit fuhren die Züge im Minutentakt. Eine Gruppe von Essensboten, Dabbawallas genannt, war damit beschäftigt, ihre großen rechteckigen Holzkästen in den Ladewaggon eines Zuges zu hieven. Mit ihren weiten weißen Hosen, den hüftlangen weißen Hemden und den schiffchenförmigen Mützen wirkten sie zwischen all den bunt gekleideten Menschen wie Reis, den man in ein Gemüsegericht eingerührt hatte. Plötzlich kam Hektik auf. Einer der Dabbawallas hatte einen Moment lang nicht aufgepasst und war mit seinem rechten Bein zwischen Bahnsteigkante und Zug gerutscht. Der Kasten, den er eben noch akrobatisch auf dem Kopf balanciert hatte, war heruntergefallen; und die darin gestapelten Essensboxen lagen nun verstreut auf dem Bahnsteig. Während einige Männer seiner Gruppe damit beschäftigt waren, die Dabbas zurück in den Kasten zu sortieren, versuchten zwei andere, ihren unglückseligen Kollegen aus dem Gleisbett zu ziehen und damit auch sein Bein vor der zermalmenden Gewalt des bald anfahrenden Eisenbahnrades zu retten. Keine Minute verging, und der Kasten sowie der verunglückte Dabbawalla waren sicher im Zug verstaut, der anschließend schnaubend anfuhr und wie ein gesättigtes Tier davonschwankte. Für einen kurzen Augenblick war der Bahnsteig menschenleer und fast wirkte es so, als hätte die Andheri Railway Station einmal kräftig ausgeatmet, bevor von dem Treppenaufgang her bereits der nächste Stoß Menschen auf die Bahnsteige strömte.
In diesem Augenblick sah er sie.
Sie stand genau dort, wo eben noch die Dabbawallas mit dem Missgeschick ihres Kollegen gekämpft hatten, und schien dem entschwindenden Zug einsam nachzublicken. Er zögerte nur eine Sekunde, dann war er bereits bei ihr, riss sie an dem Riemen hoch und schleppte sie zurück zu seinem Platz an der Säule. Er drückte die Beute eng an seinen ausgemergelten Körper. Sie sah aus wie eine eiserne Milchkanne mit ledernem Henkel. Oben auf dem Deckel waren in leuchtenden Farben Zahlen und Buchstaben aufgemalt, deren Bedeutung er nicht kannte. Er hatte aber schon oft beobachtet, wie die Menschen unten in Nariman Point zur Mittagspause aus den Hochhäusern drängten, als seien sie alle Teil einer gigantischen Feuerschutzübung, in der Hand ihre großen Lunchpakete. Er wusste daher, dass die Dabba aus fünf Metallschüsseln bestand, die übereinandergestapelt waren. Und er wusste auch, dass in jeder der fünf Schüsseln die köstlichsten Speisen auf ihn warteten. In seine Nase drang der Geruch von Koriander und Zwiebeln, und er stellte sich dazu Mango in Joghurt, Reis und Früchte vor. Speichel sammelte sich in seinem eben noch so trockenen Mund, und die Wärme der Dabba, die er nun noch fester an seine Brust drückte, breitete sich in seinem ganzen Körper aus. Auf das Wunder, dass er die Nacht neben der Säule unter dem Filmplakat hatte verbringen können, ohne aus dem Bahnhof geworfen zu werden, war ein zweites, noch viel größeres gefolgt. Dies hier war wirklich ein guter Platz. Ein Platz, wie er ihn schon so lange gesucht hatte.
Plötzlich klopfte etwas auf seine Schulter. Er schaute auf und blickte in das lächelnde Gesicht eines Polizisten, der einen langen schwarzen Stock in der Hand hielt. Die Mitte seines Gesichts zierte ein großer Schnauzbart. Neben ihm stand ein weiterer Ordnungshüter, der ihm nicht nur wegen der Uniform zum Verwechseln ähnlich sah, allerdings trug dieser Mann keinen Bart. Nun klopfte der Beamte mit dem Knüppel auf den Deckel der Dabba vor ihm.
»Wo hast du die denn gestohlen, Junge?«, verlangte er in einem strengen Tonfall zu wissen.
»Die hab ich gefunden!«, antwortete er ängstlich.
»Wo denn?«, fragte der zweite Polizist mit einem neugierigen Grinsen.
»Dort drüben!« Er zeigte mit dem Finger auf die Stelle, wo die Dabba gestanden hatte, nachdem der Zug weggefahren war.
Der erste Polizist holte aus und schlug ihm mit dem Stock auf den ausgestreckten Arm, sodass er vor Schmerzen aufjaulte. Ein brennender Schmerz lähmte seinen Arm bis hinunter zur Hand, und Tränen schossen in seine Augen.
»Lüg nicht, du Mistbengel!«, schrie der Polizist wütend und hob erneut drohend den Stock. »Mein Bruder arbeitet zufällig beim Nutan Box Suppliers Trust. Und weißt du, wie viele Dabbas jeden Tag zwischen dem Zuhause der Kunden und deren Arbeitsstätte transportiert werden, du Rotzlöffel?«
Er schüttelte den Kopf und kniff in Erwartung eines weiteren Schlages die Augen zu.
»Zweihunderttausend! Und das jeden Tag!«, brüllte der Polizist verärgert. »Und weißt du, wie viele dabei verloren gehen?«
Wieder schüttelte er den Kopf und hielt schützend seine Hände vor die Ohren. Stockschläge auf die Ohren schmerzten am meisten und konnten taub machen.
»Eine einzige Dabba von sechzehn Millionen Lieferungen! Kannst du dir das vorstellen? Eine von sechzehn Millionen!«
Der Polizist hörte auf zu brüllen und schnappte kopfschüttelnd nach Luft.
»Und die eine willst ausgerechnet du gefunden haben?«, fragte der andere Polizist mit einem höhnischen Grinsen. »Das wäre ja wie ein Lotteriegewinn. Dann wärst du ein verdammter Glückspilz!«
Beide Polizisten brachen in Gelächter aus.
»Bist du aber nicht!«, schrie der mit dem Schnauzer plötzlich und zog ihm den Stock quer übers Gesicht.
Blut sickerte aus seiner Nase und lief über seine Lippen. Eine Hand packte ihn am Kragen und zerrte ihn rüde hoch. Sein Fuß stieß dabei gegen die Kanne mit dem Essen, die umfiel und scheppernd den abschüssigen Bahnsteig hinab Richtung Gleisbett rollte.
»Jetzt kommst du mit auf die Wache!«, brüllte der mit dem Schnauzbart. »Du dreckiger Dieb!«
Seine Hände wurden auf den Rücken gebogen, sein Kopf nach unten gerissen. Eine Hand krallte sich in seinen Nacken.
Einer der Polizisten kam mit seinem Mund so nah an sein Ohr, dass er dessen Atem spürte. »Mal hat man Glück, und mal hat man Pech!«, zischte er.
Er wusste nicht, ob es das Wort »Glück« oder das Wort »Pech« oder der hämische Gesichtsausdruck seines Gegenübers war, aber irgendetwas verlieh ihm in diesem Moment übermenschliche Kräfte. Er vollführte mit der rechten Hand einen Stoß, der den Polizisten vor ihm zurücktorkeln ließ. Im nächsten Augenblick entwand er sich mit der geschmeidigen Bewegung eines Tigers dem Griff des anderen Mannes.
Mit großen Sprüngen rannte er der langsam davonrollenden Dabba hinterher und bekam ihren Riemen zu packen, kurz bevor sie ins Gleisbett fiel. Dann machte er kehrt und flog förmlich über den Bahnsteig auf den Ausgang zu. Eine Wand aus Menschen kam ihm entgegen, doch als er sie erreichte, öffnete sich wie von Geisterhand eine Schneise durch die aufgeheizten Körper. Die Kanne mit den ineinandergesteckten Essenschalen fest in der Hand, bahnte er sich seinen Weg nach draußen, und schon bald hatte er den Bahnhof weit hinter sich gelassen.
Mal hat man Glück, wiederholte er triumphierend in Gedanken die Worte des Polizisten, während er nach einem sicheren Platz für sein Festessen Ausschau hielt.
1
ARMLEY, LEEDS
Als Trisha Wilson vor ihrem Elternhaus stand, erinnerte sie sich, warum sie es damals vor sechs Jahren, an ihrem achtzehnten Geburtstag, verlassen hatte: Wer darin wohnte, konnte nur in eine Richtung aus dem Haus blicken. Das Reihenhaus, in dem ihre Eltern Gary und Valerie lebten, stammte aus den Dreißigerjahren und war in der damals typischen Back-to-Back-Bauweise errichtet. Ihr Heim stand wie die Gebäude, die rechts und links angebaut waren, Rücken an Rücken mit dem dahinter hochgezogenen Block. Es teilte sich somit drei seiner vier Wände mit Nachbarhäusern. Dies führte dazu, dass es nur an der Vorderfront Fenster gab, und zwar vier an der Zahl: zwei im Erdgeschoss und zwei im Obergeschoss.
Trisha musste keine Treppenstufe erklimmen, um den Klingelknopf zu drücken; die Eingangstür befand sich ebenerdig, der Gehweg führte direkt darauf zu. Das Schellen der Türklingel weckte in ihrem Gedächtnis weitere Erinnerungen, merkwürdigerweise kam ihr der Geruch von Lavendel in den Sinn. Sie überlegte noch, warum, als die Tür geöffnet wurde und sie in das strahlende Gesicht ihrer Mutter blickte, das sogleich verschwamm. Überrascht stellte Trisha fest, dass sie weinen musste. Dies ärgerte sie ein bisschen, da sie gelernt hatte, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Bevor ihre Mutter sie umarmen konnte, wischte sie schnell mit der Hand über ihre Augen. Ihre Mutter hingegen ließ ihren Tränen freien Lauf, ohne verlegen oder gar beschämt zu wirken.
Wenig später stand Trisha in dem kleinen Wohnzimmer, dem die Ehre zukam, eines der Fenster sein Eigen zu nennen. Ihr Vater erhob sich von seinem Sessel und trat auf sie zu. Während sie ihn umarmte – und dabei zum Glück nicht weinen musste –, bemerkte sie, dass er immer noch im selben Sessel, wie damals vor ihrer Abreise, zu sitzen pflegte. Überhaupt schien sich hier nichts verändert zu haben, die Zeit hinter diesen Mauern stillzustehen. Die Schrankwand, der alte Röhrenfernseher, der Tisch mit der gefliesten Platte, das dunkelbraune Sofa mit den abgesessenen Bezügen, die Anrichte in der Ecke, die Gardinen mit dem Rosenmotiv vor dem Fenster – alles war wie früher. Neu waren lediglich eine Reihe von Fotos in silbernen Rahmen, die auf der Anrichte standen und nur ein einziges Motiv zeigten: sie selbst. Sie erkannte darunter einige Bilder, die sie ihren Eltern in den vergangenen Jahren aus aller Welt geschickt hatte. Die meisten hatte sie mit dem Handy aufgenommen.
»Happy Birthday!«, sagte ihr Vater und klopfte ihr mit seiner großen, schweren Hand ein wenig zu kräftig auf den Rücken, während er sie weiterhin an sich gedrückt hielt.
Trisha lächelte und schob den massigen Körper ihres Vaters ein kleines Stück von sich weg, um besser atmen zu können. Dabei fiel ihr Blick auf zwei eintätowierte Buchstaben, ein »i« und ein »l«, die unter seinem hochgerutschten Hemdsärmel hervorschauten. The Lucky Devil hatte ihr Vater sich als junger Mann in geschwungenen Lettern auf den Unterarm tätowieren lassen. Früher war er ein erfolgreicher Dartspieler gewesen, der den Kampfnamen The Lucky Devil – »Der Glückspilz« – getragen hatte. Als Trisha noch ein kleines Kind gewesen war, hatte ihr Vater die nordenglische Pub-Meisterschaft im Darts gewonnen. Ein durchaus bedeutender Wettbewerb, dessen Sieger über die Pubs hinaus große Anerkennung genoss. Unwillkürlich schielte sie zum Schrank hinüber. Der Pokal stand immer noch dort, glänzend poliert, als wäre er gestern erst errungen worden. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, dass auch ihr Vater auf seine Art ein Spieler gewesen war.
»Alles Gute, Honey!«, beglückwünschte nun auch ihre Mutter sie.
Trisha fand, dass sie mit ihren sechsundfünfzig Jahren immer noch sehr attraktiv aussah. Mit dem roten, vollen Haar, das zu beiden Seiten in Locken über die Schultern fiel, dem gleichzeitig neugierigen und traurigen Blick und den klaren Gesichtszügen glich ihre Mutter ein wenig Sarah Ferguson, der Duchess of York, was ihr Mitte der Achtzigerjahre den Spitznamen Fergie eingebracht hatte. Trisha war froh, dass sie die dunklen Haare ihres Vaters geerbt hatte und daher noch nie jemand auf die Idee gekommen war, auch ihr diesen Spottnamen zu verpassen, obwohl sie ihrer Mutter im Gesicht ähnelte.
Trisha löste sich endlich aus der Umarmung ihres Vaters. Jetzt erst sah sie, dass auf dem Wohnzimmertisch eine kleine Tafel gedeckt war. Sie lächelte. »Du hast Teatime vorbereitet.«
Ihre Mutter hatte immer noch feuchte Augen, als sie erklärte: »Wie früher. Am Geburtstag gibt es doch immer Teatime.«
Das war eine der vielen Traditionen im Hause Wilson. Zum Geburtstag holte ihre Mutter die alten Rezepte heraus und bereitete eine Teatime. Solange Trisha zurückdenken konnte, war es so. Nur der Schuss Milch, mit dem der Darjeeling für die Tochter verdünnt wurde, fiel mit jedem Geburtstag kleiner aus.
»Du hast gar keinen Koffer dabei«, bemerkte ihr Vater plötzlich und zeigte auf die Handtasche, die Trisha noch nicht von der Schulter abgenommen hatte.
»Ich fahre heute Abend wieder«, antwortete Trisha leise, aber bestimmt. Für einen langen Moment herrschte betretenes Schweigen.
Schließlich unterbrach Trishas Mutter die unbehagliche Stille. »Dann freuen wir uns, dass du jetzt da bist!«, sagte sie, und man hörte eine Portion Tapferkeit aus ihren Worten.
Sie nahm Trisha die Handtasche ab, und kurz darauf saß die Familie Wilson seit vielen Jahren erstmals wieder vereint um den schmalen Couchtisch.
»Keine Milch. Ich trinke ihn ohne alles.« Trisha hielt ihre Hand schützend über ihre Teetasse.
»Unsere Trish ist erwachsen geworden«, bemerkte ihre Mutter, während sie das Milchkännchen wieder beiseitestellte.
»Probier die Scones!«, forderte ihr Vater sie auf. »Deine Mutter hat dafür die halbe Nacht in der Küche gestanden.«
»Mit Clotted Cream! Wie du sie liebst«, fügte sie hinzu, hob eine Schüssel mit dem geklumpten Rahm in die Höhe und hielt sie Trisha entgegen.
»Das sieht wirklich köstlich aus, aber ich bin gerade auf Diät«, entgegnete Trisha und legte ihre rechte Hand auf den flachen Bauch.
»Vielleicht später«, meinte ihre Mutter, und es klang so, als ob jemand zum Ausdruck bringen würde, dass er auf besseres Wetter hoffte.
»Wir haben uns sehr über deine Nachricht gefreut«, sagte ihr Vater, der in seiner rechten Hand die Tee- und in der linken die Untertasse hielt. »Das Wichtigste ist eine gute Ausbildung. Und du hast mit deinem schlauen Köpfchen alle Chancen!«
Ich habe so viele Leute mit hervorragender Ausbildung kennengelernt, die weniger verdienten als ein Kneipenwirt oder ein mittelmäßiger Drogendealer, dachte Trisha. Sie sprach es aber nicht aus.
»Nur wenige haben die Möglichkeit, an einer Eliteuniversität zu studieren!«, merkte ihre Mutter an.
Letztlich ist es nur eine Frage des Geldes, fuhr es Trisha durch den Kopf. Ein reicher Vater, eine großzügige Spende, ein Anruf bei einem der wichtigen Herren im Beirat – und selbst der größte Dummkopf konnte dort seinen Abschluss machen. Aber auch diesen Gedanken behielt sie für sich.
»Ich finde es verdammt anständig, dass diese Universität dir eine zweite Chance gibt, nachdem du das Studium schon einmal abgebrochen hast«, hob ihr Vater hervor. »Und dass sie sogar einen Teil der alten Studiengebühren anrechnen. Da hast du großes Glück!«
Trisha nickte zustimmend. »Bis auf die zehntausend Pfund«, bemerkte sie. Den Gesichtsausdruck, den sie nun aufsetzte, hatte sie in den vergangenen Jahren zigmal vor diversen Spiegeln geübt. Für gewöhnlich setzte sie ihn an anderen Tischen als diesem hier ein.
Aus dem Augenwinkel beobachtete sie, wie ihre Mutter mit glühenden Wangen erwartungsfroh zu ihrem Vater hinüberblickte. Der erhob sich daraufhin, erreichte mit zwei großen Schritten den Wohnzimmerschrank und öffnete eine der Glastüren, hinter der ein paar Zinnbecher aufgereiht waren. Dann ergriff er einen Briefumschlag, der dort versteckt wartete. Wortlos trat er zu Trisha und übergab ihr den Umschlag. Anschließend setzte er sich wieder in seinen Sessel und fixierte sie mit ernster Miene. Als Trisha bemerkte, dass ihre Hand zitterte, legte sie den Umschlag eilig auf ihrem Schoß ab. Wieder registrierte sie, wie sich in ihrem Hals ein Kloß bildete. Ihre Mutter streichelte ihr von der Seite übers Knie und tupfte sich mit einer Serviette ein paar Tränen ab. Alle schwiegen gerührt.
»Das ist für deine Zukunft!«, unterbrach ihr Vater die Stille.
»Danke. Vielen Dank. Ich werde es euch zurückzahlen. Jeden Penny. Mit Zinsen. Ich habe mir schon einen Job gesucht, in einem Restaurant.«
So viele Tage hatte sie auf diesen Augenblick hingefiebert. Doch statt sich zu freuen, bemerkte sie, wie ihr Herz sich nun zusammenkrampfte.
»Nun studiere erst einmal in Ruhe!«, sagte ihre Mutter. »Die Kreuzfahrt können wir auch später machen. Wir haben jetzt so viele Jahre darauf gespart, da kommt es auf ein paar Jahre mehr auch nicht an!« Ihre Mutter meinte dies scherzhaft, und so lachte sie herzlich.
Trisha merkte, wie ihr schlecht wurde.
»Außerdem hat dein Vater einen Job in einem Autohaus angenommen«, fuhr ihre Mutter fort. »Hier zu Hause fiel ihm als Frührentner die Decke auf den Kopf. Er fährt die reparierten Autos zu den Kunden.«
»Oder die Kunden, wenn ihr Auto repariert wird!«, ergänzte ihr Vater. Er lächelte.
Trisha spürte den großen Drang, aufzustehen und aus dem Haus zu rennen. So weit weg, wie es nur ging. Sie versuchte einzuatmen, doch der Atem blieb irgendwo kurz hinter dem Kehlkopf stecken.
»Es muss dir nicht unangenehm sein«, sagte ihre Mutter, die ihr einen sorgenvollen Blick zuwarf. »Wir sind doch deine Eltern!«
Trisha nickte. Sie kämpfte mit den Tränen. Ihre Mutter griff neben sich und hielt Trisha ein kleines Päckchen entgegen, das in dekorativem Papier eingewickelt war.
»Unser Geburtstagsgeschenk«, sagte ihre Mutter und lächelte.
Trisha schüttelte den Kopf. Nun rannen erste Tränen über ihre Wangen. Am liebsten hätte sie das Geschenk abgelehnt, aber das ging nicht. Ihre Eltern hätten nicht verstanden, dass sie es nur nicht wollte, weil sie es nicht verdient hatte. Trisha nahm es entgegen und löste vorsichtig die Klebestreifen, die das Papier zusammenhielten. Ein Kästchen kam zum Vorschein. Trisha blickte in die Gesichter ihrer Eltern, die sie gespannt beobachteten. Sie öffnete das Kästchen. Eine silberne Kette, die bereits ein wenig angelaufen war, kam zum Vorschein. Daran befand sich ein Anhänger mit einem großen ovalen Stein, der türkisfarben schimmerte. Am oberen Ende war der Stein silbern eingefasst, und zwei filigrane Schwingen aus feinem Silber gingen zu beiden Seiten ab. Darüber thronte eine kleine Perle, die ebenfalls silbern eingefasst und an der die Kette befestigt war. Alles zusammen deutete die Form eines Engels an.
»Ein Schutzengel«, erklärte ihre Mutter. »Ein Glücksbringer. Er ist von Grandma.« Sie deutete auf die Wand hinter sich.
Trisha folgte der ausgestreckten Hand und blickte auf das Foto, von dem ihre Großmutter mit gütigen Augen auf sie herabschaute. Mit ihrem altmodischen Kleid und dem großen Hut erinnerte sie ein wenig an Queen Mum.
»Grandma wäre stolz auf dich, wenn sie noch leben würde!«, sagte ihre Mutter mit großer Rührung.
Nun war es um Trisha geschehen. Die Tränen schossen ihr unter heftigem Schluchzen in die Augen. Sie beugte sich nach vorn, griff beide Hände ihrer Mutter und zog sie an ihre Brust. Ihre Mutter löste eine Hand und streichelte sanft ihren Kopf.
»Jetzt nimm noch einen Scone und etwas Clotted Cream!«, sagte sie tröstend und küsste das dunkelbraune Haar ihrer Tochter.
Einige Stunden später stieg sie aus dem GM ihres Vaters, der darauf bestanden hatte, sie zum Bahnhof zu fahren. Sie umarmte ihn zum Abschied über den Schaltknauf des Autos hinweg und blickte dem Wagen hinterher, bis er im Verkehr verschwunden war.
Trisha atmete tief durch und marschierte in das große Gebäude. Im Spiegel eines Bahnhofsgeschäfts, das Sonnenbrillen verkaufte, prüfte sie ihr durch das viele Weinen in Mitleidenschaft gezogene Make-up und entfernte einen Rest verschmierten Kajals. Im Mundwinkel entdeckte sie etwas Clotted Cream, die sie sorgfältig wegwischte. Zum Schluss ordnete sie ihre Haare. Auf dem Weg zum Bahnsteig kramte sie aus ihrer Handtasche ihr Handy und drückte auf die Wahlwiederholung. Am anderen Ende meldete sich eine verschlafene Männerstimme.
»Bei dir ist es Mittag. Schläfst du etwa noch?«, fragte sie vorwurfsvoll.
»Letzte Nacht ist es spät geworden. Ich war erst nach dem Frühstück im Bett.«
»Ich habe das Geld«, sagte Trisha triumphierend. Während sie die Worte sprach, spürte sie jedoch gleichzeitig ein Stechen in der Herzgegend.
»Cool.«
»Ich fliege morgen früh um acht mit British Airways von Heathrow ab, nonstop. Holst du mich in Las Vegas vom Flughafen ab?«
»Mal sehen. Ich habe gestern die nächste Runde erreicht. Wenn es spät wird, musst du ein Taxi nehmen.«
»Du bist weitergekommen? Glückwunsch!«, rief Trisha erfreut.
»Ja. Danke«, antworte ihr Freund müde.
»Ich liebe dich«, sagte Trisha.
»Guten Flug!«
Trisha beendete das Gespräch. Sie atmete tief durch und griff nach dem Anhänger ihrer neuen Kette, die sie um den Hals trug. »Dich werde ich brauchen«, flüsterte sie.
Erstaunlicherweise fühlte er sich ein wenig warm an.
2
LEIPZIG, DEZEMBER 1762
Der Wagen kam direkt vor dem Eingang des schlichten Hauses zum Stehen. Dampf stieg vom Rücken der abgekämpften Pferde in den winterkalten Abendhimmel empor. Nur widerwillig kletterte der Postillon vom Bock. Nachdem er sich einmal in jede Himmelsrichtung gereckt hatte, steuerte er auf den Kutschkasten zu, als ginge er zum Schafott. Einmal atmete er tief durch, dann öffnete er die Tür und wich einen Schritt zurück, um seinen Fahrgast aussteigen zu lassen. Dieser sprang mit einem Satz heraus und landete sicher auf dem vereisten Boden.
Der Passagier war einen halben Kopf größer als der Kutscher und fiel durch seine elegante, makellose Kleidung auf. Der Rock mit abstehendem gesteiftem Schoß war aus rötlich-braunem Samt gefertigt. Unter der hellen, nur halb geschlossenen Weste blickten eine beige Halsbinde und ein weißes Spitzenjabot hervor. Sein Haar, welches an beiden Schläfen sorgsam in waagrechte Lockenrollen gedreht und im Nacken zusammengefasst war, imitierte der Mode entsprechend den Körperbau einer Taube. Das sparsam eingesetzte Puder gab der Frisur einen silbrig-grauen Glanz, der den Mann deutlich älter erscheinen ließ, als er tatsächlich war.
»Endlich raus aus diesem Knochenknacker!«, rief der Passagier fröhlich und rieb sich fröstelnd die Hände. Der italienische Akzent war unüberhörbar.
Dann griff er in seinen Rock, holte eine Taschenuhr hervor und öffnete den Deckel. Mit ausgestrecktem Arm hielt er sie in das Licht der am Hauseingang noch brennenden Laterne und las mit zusammengekniffenen Augen die Zeit ab.
»Acht Uhr ist durch. Ein knappes Viertel einer Viertelstunde hat Euch gefehlt, mein Freund!« Er klappte die Uhr mit einer Hand zu und ließ sie wieder in seiner Kleidung verschwinden. Mit einem Grinsen blickte er den Kutscher an. »Somit schulde ich Euch für diese Fahrt – nichts. Nehmt es nicht so tragisch. Ihr hattet eine faire Chance auf den doppelten Fahrpreis. Nur einige wenige Minuten haben Euch gefehlt!«
»Wäre das Futter an der Umspannstation in Kletzke nicht gefroren gewesen … Ihr wisst, wir wären eine ganze Stunde früher hier gewesen«, brummte der Kutscher grimmig. »Die sechzehn Taler waren mir eigentlich sicher!« Er ließ das Gepäck neben dem Fahrgast fallen und warf wütend die Tür zu.
Der Italiener ließ sich dadurch die gute Laune nicht verderben und legte dem Postillon tröstend die Hand auf die Schulter. In dessen Augen blitzte die Zuversicht auf, dass der Fremde anständig genug war, ihm doch noch ein paar Taler für die lange Reise zu überlassen: Wette hin oder her. Doch diese Hoffnung erwies sich als vergeblich.
»So ist es mit dem ›Doppelt oder Nichts‹: Hat man am Ende nichts, ärgert man sich doppelt!«, spöttelte der Passagier. »Bietet die Wette Eurem nächsten Fahrgast an, und Ihr werdet sehen, Ihr werdet Euch das wiederholen, was Euch diesmal an Lohn entgangen ist!«
Mit einer großen Wolke gefrorenen Atems schob der Kutscher schnaufend die Hand von seiner Schulter und ließ seinen Passagier, den er von Berlin bis hierher transportiert hatte, einfach stehen. Schmunzelnd blickte der Zurückgelassene der Kutsche hinterher, bis eine jugendliche Stimme ihn herumfahren ließ.
»Signore Calzabigi?«
Vor ihm stand ein schmaler Knabe, kaum älter als fünfzehn. Seiner Uniform nach zu urteilen, war er ein Adjutant.
»Si!«
»Der König hat früher mit Eurer Ankunft gerechnet.«
»Ich auch.«
Der Adjutant war näher gekommen und bückte sich mit ausgebreiteten Armen, um die Kutschentruhe des Ankömmlings hochzuheben und zu den hölzernen Eingangstüren zu schleppen. »Wenn Ihr Glück habt, könnt Ihr den König heute noch sehen. Er geht immer sehr spät zu Bett!«
»Ich habe so viel Glück, dass ich Eurem König davon noch etwas abzugeben gedenke!«, entgegnete Calzabigi heiter.
»Er kann es gut gebrauchen«, ächzte der Jüngling, die Truhe vor der Brust. »Bei Gott, ganz Preußen braucht Glück.«
3
HAMBURG, SANTA FU
»Nicht hier. Komm mit in mein Arbeitszimmer!«
Henri Freihold drängelte sich an dem vor ihm stehenden Häufchen Elend vorbei und schritt voran. Seine weißen Sportschuhe quietschten auf dem Linoleumboden des Korridors, als er scharf rechts abbog. Vor der nächsten Holztür, die mit ihren schweren Beschlägen und den beiden Eisenriegeln genauso aussah wie alle anderen Türen auf dem Korridor, blieb er stehen. Aus der Tasche seiner Jogginghose beförderte er einen großen Schlüssel heraus und steckte ihn ins Schloss. Beim Öffnen gaben die Türangeln ein jaulendes Quietschen von sich, wie es täglich hundertmal durch den Gang hallte. »Hier weinen sogar die Türen!« war einer von Henris beliebten Sprüchen, wenn er die Neuankömmlinge in ihren neuen Alltag einwies.
Henri betrat den Raum, und sein Begleiter folgte ihm mit hängendem Kopf. Mit dem Betätigen des Lichtschalters nahm die Leuchtstoffröhre, die rechts an der Wand horizontal angebracht war, flackernd ihre Arbeit auf. Es war die einzige Zelle in der gesamten Anstalt, in der keines der schlichten Betten aus grün angemalten Holzpfosten und weißen Spanplatten stand. Der Raum wirkte tatsächlich wie ein Büro, allerdings sah man ihm den Widerwillen an, mit dem er ausgestattet worden war. In der Mitte stand ein einfacher Tisch, auf dem eine alte Schreibmaschine thronte. An der rechten Wand war ein Holzbrett angebracht. Darauf türmten sich Bücher. An der gegenüberliegenden Wand befanden sich zwei weitere Regale, die ebenfalls mit Büchern vollgestopft waren. Das Mobiliar in der Anstalt musste nach Henris Verständnis zwei Voraussetzungen erfüllen: Es musste aus Holz sein, damit die Metalldetektoren auf der Suche nach Ausbruchswerkzeug und Waffen leichtes Spiel hatten. Und es musste hässlich sein. Der Staat beraubte seine Gefangenen nicht nur ihrer Freiheit, sondern auch ihres Rechts auf Ästhetik.
Henri setzte sich hinter die Schreibmaschine und zeigte auf einen Holzstuhl vor sich. »Setz dich!«, befahl er.
Sein Begleiter folgte der Anweisung und platzierte sich ganz vorn auf der ohnehin schon kleinen Sitzfläche.
Verwundert blickte er sich um. »Sie haben zwei Zellen – wieso das denn?«
Henri verzog die Mundwinkel zu einem breiten Lächeln. Er war der einzige Gefangene, der von allen anderen gesiezt wurde. Niemand in der Anstalt konnte mehr mit Sicherheit erklären, warum ihm diese Ehre zuteil wurde. Es war einfach schon immer so gewesen, und alle hielten sich an diesen Brauch. Einige behaupteten, es würde an seinem gewandten Auftreten liegen, mit dem er eher einem Anwalt als einem Strafgefangenen glich. Andere meinten zu wissen, dass der Doktortitel, den Henri trug, zum respektvollen »Sie« geführt hatte. Wenn jemand in großer Runde diese Theorie vertrat, entgegnete meistens einer der Frischlinge: »Doktor? Ich dachte, er wäre Anwalt!«, und zog sich so den Spott der anderen zu.
Henri beugte sich vor und entnahm einer Holzkiste, die vor ihm auf dem Tisch stand, einen Zigarillo. Mit einem geübten Zungenschlag leckte er das Ende ab und fingerte sich einige Krümel Tabak aus seinem Mund. Dann entzündete er den Zigarillo mit einem Streichholz, das er anschließend auf den Boden warf und mit einer drehenden Bewegung seines rechten Fußes austrat.
»Warum ich zwei Zellen habe? Mir erlaubt man eben ein paar Extrawürste«, entgegnete Henri und beobachtete seinen neuen Klienten.
Der erwiderte nichts darauf, sondern nickte nur anerkennend mit zusammengepressten Lippen.
Henri hätte ihm erklären können, worin der Grund für seine zwei Residenzen bestand. Er hatte seine Haftstrafe bereits verbüßt und war nur noch hier, weil das Gericht ihm nachträglich eine Sicherungsverwahrung aufgebrummt hatte. Wegen »der amoralischen Grundhaltung eines notorischen Betrügers«, hatte in dem Beschluss gestanden. Eine Maßnahme, die normalerweise bei Sexualstraftätern oder Mördern angeordnet wurde, nur höchst selten bei bloßen Vermögensdelikten wie Betrug. Gegenüber den harten Jungs prahlte er damit, einer der wenigen Betrüger im Lande zu sein, die für so gefährlich eingeschätzt wurden, dass man sie auch nach Verbüßung der Haftstrafe vor der Gesellschaft wegschloss. Weil er aber nun nicht mehr für seine Taten büßen musste, hatte er vor Gericht für bessere Haftbedingungen geklagt und, wie so oft, gewonnen. Unter anderem stand ihm nun eine größere Zelle zu. Da es in »Santa Fu«, wie die Strafanstalt Fuhlsbüttel genannt wurde, ausschließlich sieben Quadratmeter große Einzelzellen gab, hatte man sich mit der Anstaltsleitung darauf geeinigt, dass er zukünftig zwei Zellen zur freien Verfügung erhalten sollte. Der Raum, in dem er gerade saß, diente ihm als Wohn- und Arbeitszimmer, während die Zelle nebenan sein Schlafzimmer war. All dies mussten die anderen Gefangenen aber nicht so genau wissen. Denn er genoss es, dass sie ihn für seinen Sonderstatus bewunderten. Die Tatsache, dass er als wohl einziger Häftling auf der Welt in zwei eigenen Zellen wohnte, schrieben sie seinem besonderen Einfluss zu. Wer dafür sorgen konnte, gleich zwei Zellen zugesprochen zu bekommen, der konnte hier drin vermutlich für alles Mögliche sorgen.
»Also, wie kann ich dir helfen?«, fragte Henri seinen Mandanten und lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
»Ich habe gehört, dass Sie Anwalt sind und man Sie, wie soll ich sagen, um Rat bitten kann«, antwortete der junge Mann, der auf der Stuhlkante unruhig hin- und herrutschte.
Henri fixierte sein Gegenüber. Als der Kerl in seiner Zelle aufgetaucht war – in seinem »Schlafzimmer«, genauer gesagt – und ihn um einen Termin bat, hatte er sofort gesehen, dass er es mit einem Alkoholiker zu tun hatte. Er schätzte ihn auf nicht älter als fünfundzwanzig, aber sein körperlicher Zustand war erbärmlich, und er wirkte ausgemergelt. Das Gesicht war hager. Ein Schneidezahn oben und einer unten fehlten, und auch ansonsten wirkte das Loch unter der Nase eher wie ein Müllschlucker als wie ein Mund. Die Augen lagen tief im Schädel und erinnerten ihn an eingeworfene Fensterscheiben. Die Haut war grau, und die Haare klebten fettig an der Stirn, hier und da erahnte man noch das Muster des Kamms. Die Finger waren gelb vom Tabak und zitterten unentwegt. Henri wettete, dass er einen »Geldbüßer« vor sich sitzen hatte. So nannten sie hier diejenigen Gefangenen, die eigentlich gar nicht zu einer Gefängnis-, sondern nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden waren, aber dennoch hinter Gitter mussten, weil sie die erforderliche Summe nicht aufbringen konnten. Es konnte beispielsweise passieren, dass bei einer Strafe von hundert Tagessätzen à fünf Euro hundert Tage Haft anfielen: einen Tag Haft für jeden Tagessatz. Wer nicht genug Geld hatte und auch keinen Kredit aufnehmen konnte, um sich vor einer Gefängnisstrafe zu retten, war wirklich das ärmste Schwein der Welt. So sahen es auch die anderen Mitgefangenen; und dies führte dazu, dass die Geldbüßer in der Knasthierarchie ganz unten standen, gerade noch über den Triebtätern und Kinderschändern. Hinzu kam, dass sie für Geld oder Alkohol in der Regel alles taten. An ihnen probierte man den selbst hergestellten Alkohol aus, auf ihrer Haut testete man die improvisierten Tätowiernadeln, und sie lutschten den Knastschwulen den Schwanz. Für Henri jedoch war Mandant gleich Mandant, solange sie nur bezahlen konnten.
»Hat man dir auch meine Preise genannt?«, fragte er.
»Ja. Eine Paketmarke.«
»Nur, wenn es ein kleiner Auftrag ist«, korrigierte Henri ihn sofort.
Paketmarken berechtigten dazu, sich von draußen Pakete ins Gefängnis schicken zu lassen. Jedem Häftling standen nur drei Paketmarken im Jahr zu, das machte drei Pakete. Die Marken waren daher eine beliebte Währung. In guten Zeiten kam Henri auf bis zu vierzig Pakete im Jahr. Sein Rekord waren zweiundsechzig.
»Warum brauchst du einen Anwalt?«
»Im Sommer hat mich so eine Sau von Autofahrer überfahren. Volle Kanne in mich reingebrettert. Alles war matsch. Drei Wochen lag ich auf Intensiv und danach auf ’ner normalen Station, anschließend kam die Scheiß-Reha. Hier.« Der Geldbüßer erhob sich vom Stuhl und zog das hässliche rote Sweatshirt hoch, das zur Anstaltskleidung gehörte. Quer über die Rippen, die einzeln hervortraten, und eine Bauchhälfte zogen sich zwei große, noch frische Narben. »Mein linkes Bein sieht noch beschissener aus. Wird nie wieder ganz. Bleibt steif. Ohne was zum Rauchen wären die Schmerzen nicht zu ertragen«, nuschelte er in abgehackten Sätzen. Schließlich schwieg er und starrte Henri erwartungsvoll an.
»Ich bin kein Arzt, ich bin Anwalt«, sagte Henri ohne jeden Anflug von Mitleid. Schon befürchtete er, dass wieder einmal jemand die Sache mit seinem Doktortitel falsch verstanden hatte.
»Ich weiß, bin ja nicht blöd. Es geht um meine Schmerzen. Mir hat einer gesteckt, dafür gibt es Penunsen!«
Jetzt verstand Henri das Anliegen seines Klienten. Der Kerl wollte Schmerzensgeld. Das konnte ein sehr attraktiver Auftrag werden, dachte er. Konnte …
»Kommt drauf an, ob du schuld gewesen bist«, erklärte Henri und spürte nun tatsächlich so etwas wie Erregung in sich aufsteigen. Bei derartigen Verletzungen konnten beträchtliche Summen zusammenkommen. Vielleicht ließ sich bei diesem Exemplar von Mandant sogar behaupten, dass er durch den Unfall blöd im Kopf geworden war. Oder abhängig. Henri verbot sich solche Hoffnungen jedoch sogleich. Wenn man im Knast etwas gelernt hatte, dann war es, aufkeimende Hoffnungen rasch zu unterdrücken. Vermutlich war der Unglücksvogel betrunken vor ein Auto gerannt. Dann gab es nichts. Im Gegenteil: Hatte der Autofahrer durch den Unfall einen Schock erlitten, würde er noch von dieser Schnapsdrossel Geld verlangen können.
»Keine Schuld«, entgegnete sein Gegenüber und grinste.
»Sicher?«, hakte Henri skeptisch nach.
»Ich lag auf dem Bürgersteig, als der mich über den Haufen fuhr. Ein friedliches Nickerchen. Nicht an der Straße, nicht in der Mitte, sondern schön ordentlich an der Hauswand. Der bretterte zu schnell in die Kurve. Rausgetragen, voll in mich rein. Hat auch die Polizei gesagt. Die haben den sogar verhaftet.«
Henri jubilierte innerlich. Warum auch immer der Kerl auf dem Bürgersteig geschlafen hatte: Das klang doch sehr nach unschuldigem Unfallopfer.
»Dann brauche ich alle Unterlagen, die du über den Unfall hast. Und du musst mir dies unterschreiben …« Henri erhob sich, kramte in einem Karton, der unter dem Schreibtisch auf dem Boden stand, und zog ein verknittertes Blatt Papier hervor. »Ich trage da später alles ein. Erst einmal brauche ich nur deine Unterschrift.« Henri gab dem anderen einen Stift und das Papier.
»Ist das so was wie eine Vollmacht, oder so?«, fragte der Geldbüßer überraschend skeptisch und versuchte, den Text zu lesen.
»Wenn man hier drin Anwalt ist, dann ist das alles ein bisschen schwieriger«, entgegnete Henri ausweichend. »Da kann ich nicht so praktizieren wie auf der anderen Seite der Gitterstäbe. Vollmachten gibt es hier nicht. Das ist eine Abtretungserklärung. Du trittst mir deine Ansprüche gegen den Unfallfahrer und seine Versicherung ab. Ich mache das dann im eigenen Namen geltend, und wenn das Geld bei mir eingeht, dann zahle ich es an dich aus. Ich behalte lediglich eine kleine Provision – zusätzlich zur Paketmarke.« Dass er eigentlich gar kein Anwalt mehr war, weil ihm mit der Verurteilung seine Zulassung entzogen worden war, erwähnte er nicht. Das war eine reine Formalie, die hier drin sowieso keiner verstand.
Das Gesicht des alkoholsüchtigen Unfallopfers verdüsterte sich jedoch noch mehr. »Muss … Muss das so sein?«, stammelte er unsicher. »Kann ich nicht einfach eine Vollmacht unterschreiben, so wie bei meinem Pflichtverteidiger auch?«
Henri stutzte. »Was ist dein Problem?«
»Es ist nur, was die Jungs so reden.«
»Was reden die Jungs denn so?« Henri richtete sich auf. Er ahnte, worauf das hinauslief.
»Na, die sagen, da muss man aufpassen.«
»Wo muss man aufpassen?«, hakte Henri mit wachsender Ungeduld nach.
»Ist nur so ’n Gerede. Die sagen, Sie säßen hier drinnen, weil Sie da draußen als Anwalt … Na ja, weil Sie Mandanten beschissen hätten. Sogar eine Behinderte.«
»Eine Behinderte?«, wiederholte Henri.
»Hey, ich erzähle Ihnen nur, was so geredet wird.«
»Und nun hast du Angst, dass ich dich anscheiße?«
Der neue Klient nickte unsicher.
Unter den ängstlichen Blicken seines Besuchers erhob sich Henri und ging mit langsamen Schritten zur Tür. Nachdem er sie geschlossen hatte, schlenderte er zurück zum Schreibtisch. Anstatt sich wieder hinzusetzen, lehnte er sich gegen den Tisch und baute sich mit verschränkten Armen vor dem jungen Mann auf.
»Wie heißt du?«, fragte er gutmütig und nahm einen Zug vom Zigarillo.
»Martin«, antworte der Klient.
»Martin«, wiederholte Henri, als würde der Name ihm irgendetwas sagen. Mit einer langsamen Bewegung streckte er den Arm aus und ließ, gleich einem Golfer, der einen Ball am Wasserhindernis droppt, den Zigarillo in den Schoß von Martin fallen. Dieser griff ebenso verdutzt wie erschrocken danach. Ein Schmerzensschrei begleitete das Aufeinandertreffen von Hand und Glut, nur übertönt von dem klatschenden Geräusch, das Henris Handrücken im Gesicht des Geldbüßers hinterließ. Vom Zigarillo und Henri gleichzeitig angegriffen, verlor Martin das Gleichgewicht, fiel vom Stuhl herunter und blieb stöhnend auf dem Boden liegen. Blut tropfte aus einer kleinen Risswunde über dem rechten Auge.
Henri hob den Zigarillo auf und zog daran, als wolle er testen, ob er noch brannte. Erfreut blies er den bläulichen Rauch in Martins Richtung.
»Pass auf, dass du dir hier drin nicht die Finger verbrennst. Ein falsches Wort kann tödlich sein. Glaub mir, mit Worten kennt sich hier keiner besser aus als ich.« Henri umrundete den Tisch und setzte sich wieder, als sei nichts gewesen. »Jetzt unterschreib den verdammten Zettel. Und pass auf, dass du den nicht vollblutest.«
Kurze Zeit später verließ Henri gut gelaunt sein Arbeitszimmer. Als er die Tür abschloss, hörte er, wie im Gang eine Lautsprecherstimme seine Nummer aufrief: »613, bitte bei der Wache melden!«
Henri seufzte. War es denn zu glauben? Hatte dieser Säufer nichts Besseres zu tun, als schnurstracks loszulaufen und ihn anzuschwärzen? Er hatte ihn nicht verletzen wollen. Zwar hatte er mittlerweile dreizehn Jahre seines Lebens im Knast verbracht, aber er war bei Weitem nicht so verroht wie die meisten anderen Häftlinge. Er hätte den anderen auch die Wahrheit erzählen können, warum er hier saß. Und dabei seine Unschuld beteuern. Doch derjenige, der sich selbst bemitleidete, war das leichteste Opfer. Hier waren alle unschuldig und schuldig zugleich. Henri hatte längst gelernt, dass hinter diesen Mauern die Rolle des Bösewichts gefragt war. Und die des Lehrmeisters. Er hatte dem Novizen nur eine schmerzhafte Lektion erteilt, die ihn vor noch schmerzhafteren Lektionen bewahren sollte. Hätte der Geldbüßer nicht seinen Verstand versoffen, wäre ihm das klar geworden, und er hätte auf der Krankenstation erzählt, dass er hingefallen sei. Nun würde Henri eine Anzeige wegen Körperverletzung bekommen.
Er seufzte erneut. Schweren Herzens steuerte er die mit Panzerglas versehene Wachstation in der Mitte des Stockwerks an. Als er angekommen war, klopfte er gegen die Scheibe. Rösler hatte Dienst. Er war einer der ältesten Wachhabenden, und eigentlich verstanden Henri und er sich gut. Rösler sah auf und lächelte. Was findet er daran lustig, fragte Henri sich. Der Beamte betätigte die Sprechanlage vor sich.
»Sie haben Besuch!«, klang es blechern aus dem in der Scheibe eingelassenen Lautsprecher.
Henri verstand nicht. Was meinte Rösler? Üblicherweise wurde man nach einer Schlägerei aufgefordert, in seine Zelle zu gehen und weitere Anweisungen abzuwarten.
Rösler bemerkte seine Irritation. »Holen Sie Ihre Sachen, es geht ab auf den Hof!«
Henri machte keine Anstalten, sich zu bewegen.
»Was ist los? Sie sind seit einer Ewigkeit in Santa Fu. Wissen Sie nicht, was man macht, wenn man Besuch hat?« Rösler lachte, doch dann erstarrte sein Lächeln plötzlich. »Ach du heilige Scheiße. Sie hatten hier drin noch nie Besuch, richtig?«
Henri stand immer noch dort wie versteinert. Doch langsam begriff er, was Rösler ihm mitzuteilen versuchte. Es ging gar nicht um den Vorfall eben. Irgendjemand wollte ihn besuchen. »Was für ein Besuch?«, fragte er wie ferngelenkt.
Nun begann der Beamte wieder breit zu grinsen. »Das ist es ja«, sagte er. »Der Kollege hat gefunkt, dass im Besucherraum ein Mönch auf Sie wartet.«
»Ein was?« Henri glaubte, sich verhört zu haben.
»Ein Mönch. So mit Kutte und allem Drum und Dran! Sind Sie auf Ihre alten Tage noch gläubig geworden? Denken Sie wirklich, Sie ergattern noch einen Platz da oben im Himmel?« Rösler lachte nun noch lauter.
»Sie haben recht«, antwortete Henri. Sein Blick prallte am Panzerglas ab.
»Womit?«, fragte Rösler und schnappte vor Lachen nach Luft.
»Ich hatte noch niemals Besuch. Ich habe keine Ahnung, wie das geht – Besuch zu bekommen.«
4
LAS VEGAS
Trisha erwachte erst, als das Flugzeug bereits die Parkposition erreicht hatte. Gewöhnlich bekam sie während eines Fluges kein Auge zu. Doch dieses Mal war sie kurz nach dem Start in einen tiefen, traumlosen Schlaf gefallen und erst aufgeschreckt, als ihr Sitznachbar sich erhob und dabei mit seinem Knie das ihre touchierte. Peinlich berührt, weniger vom körperlichen Kontakt mit dem Nebenmann als vielmehr wegen des durch den langen Schlaf erlittenen Kontrollverlusts, beeilte sie sich, ihre Haare zu ordnen und ihren Gurt zu öffnen, um das Flugzeug so rasch wie möglich zu verlassen. Erleichtert tauchte sie in die Anonymität des Flughafengebäudes ein.
Nachdem man sie ungewöhnlich schnell an der Passkontrolle abgefertigt hatte und ihr Koffer als einer der ersten auf dem Laufband aufgetaucht war, schritt sie in der Ankunftshalle langsam hin und her. Vergeblich suchte sie die Reihen der Wartenden nach Chads’ vertrautem Gesicht ab. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass das Flugzeug fast eine ganze Stunde früher als geplant angekommen war, was bei einer Atlantiküberquerung von Osten nach Westen eher ungewöhnlich war. Sie wählte die Nummer von Chads’ Handy, doch es antwortete nur seine Mailbox. Vielleicht schlief er ja noch. Vom McCarran Airport war es nicht weit bis zum Zentrum von Las Vegas, und so beschloss Trisha, sich ein Taxi zu nehmen. Bei normalem Verkehr würde sie in ihrem Hotel ankommen, noch bevor Chad sich auf den Weg zum Airport machte, um sie abzuholen.
Der Fahrer war ein mürrischer Mann mit grauem Bart und orangenem Turban, der während der gesamten Fahrt unverständliche Sätze in das Mikrofon seines Mobiltelefon-Headsets brabbelte und sich nicht weiter um sie kümmerte. Draußen flogen die überdimensionierten Werbetafeln vorbei, auf denen die großen Hotels ihre Abendshows bewarben. Trisha gähnte. Immer noch fühlte sie eine bleierne Müdigkeit, trotz des langen Schlafs auf dem Flug hierher. Bei diesem Gedanken bekam sie einen Schreck und griff an die Innentasche ihres Blazers. Sie war erleichtert, als sie den Umschlag mit dem Geld ertastete, den ihr Vater ihr gegeben hatte. Wieder überkam sie dieses schlechte Gewissen, an das sie sich nicht gewöhnen konnte.
Zwei Jahre war die erste große Lüge bereits alt, die seitdem wie ein Einwegspiegel zwischen ihr und ihren Eltern stand. Während ihre Eltern von ihrer Seite aus problemlos hindurchschauen konnten und sich manchmal lediglich über den trüben Blick wunderten, sah sie, wenn sie ihre Eltern betrachten wollte, nur noch sich selbst. Wie glücklich waren die beiden damals gewesen, als sie ihnen nach der langen Zeit des Umherstreunens vorgeflunkert hatte, dass sie einen Studienplatz an einer Eliteuniversität ergattert hätte. Ihr Vater war gerne bereit gewesen, ihr seine Ersparnisse für die Studiengebühren zu geben, und sie hatte das Geld genommen, felsenfest davon überzeugt, dass sie es schon bald doppelt und dreifach würde zurückzahlen können. Zuvor hatte sie es bei einigen Pokerturnieren in Übersee erstmals an den Final Table geschafft, und nicht nur Chad, sondern viele in der Pokerszene hatten ihr eine goldene Zukunft vorhergesagt. Schnell hatte sie den als Startgeld bei den größeren Turnieren eingesetzten Betrag vermehren können. Selbst Chad hatte sie für lange Zeit miternähren und ihm auch noch Geld für seine Startgelder leihen können.
Vor ein paar Monaten hatte dann urplötzlich ihre Pechsträhne begonnen, wobei dieser Begriff eigentlich nicht zutreffend war. »Pech« umschrieb etwas, das man selbst nicht in der Hand hatte. Sie hingegen hatte einfach schlecht gespielt. Nur Unwissende behaupteten, Poker sei ein Glücksspiel. Sicher, Glück konnte auch beim Pokern am Ende den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben, so wie ein Netzroller im Tennis. Aber ansonsten war es eine Sache von harter Arbeit, Geschick und Logik. Nicht ohne Grund trugen sich bei großen Turnieren immer wieder dieselben Spieler in die Gewinnerlisten ein.
Trisha umfasste den Anhänger, den sie von ihren Eltern geschenkt bekommen hatte, und wieder merkte sie, wie Tränen in ihr aufstiegen. Nun hatte sie ihre Eltern also zum zweiten Mal belogen. Als das Gefühl der Schuld sie zu überwältigen drohte, dachte sie daran, dass es eigentlich die Idee von Chad gewesen war …
»Frag doch noch einmal deine Eltern!«, hatte er vorgeschlagen, als sie feststellten, dass die Socke, in der sie ihr Geld aufbewahrten, nur noch ein paar müde Dollar enthielt. »Wenn es damals funktioniert hat, klappt es jetzt wieder!«
Zunächst hatte sie empört abgelehnt, doch schon bald wusste sie, dass es nur ein Scheingefecht war, das sie führte.
»Wenn du eines der größeren Turniere bei der Weltmeisterschaft gewinnst, kannst du ihnen alles mit Zins und Zinseszins zurückzahlen!«, hatte Chad argumentiert. »Die Summe genügt als Startgeld für uns beide. Doppelte Chance!« Und als sie sich weiter zierte, hatte er hinzugefügt: »Du bist jetzt soweit.«
Dann hatte er ihr zärtlich eine ihrer losen Haarsträhnen aus dem Gesicht gestrichen und ihr tief in die Augen geschaut; und sie hatte wieder dieses Kribbeln gespürt, so wie bei ihrer ersten Begegnung.
»Okay, ich mach es!«, hatte sie schließlich geantwortet, und er hatte sie wie zur Belohnung langsam ausgezogen und sie hatten miteinander geschlafen, zum ersten Mal seit Monaten.
Die Bremslichter der Fahrzeuge vor ihnen leuchteten auf, und ihr Taxi musste sich in die Schlange wartender Autos am Ende der Schnellstraße einordnen. Trisha schaute auf die Uhr. Immer noch hatte sie genügend Zeit. Eine Stretchlimousine überholte sie auf der freien Abbiegespur. In Las Vegas gehörten sie als fahrende Bars zum Straßenbild und lieferten allabendlich erlebnishungrige Gäste wie betrunken gemachtes Schlachtvieh bei den Kasinos ab. Doch am helllichten Tag wirkten sie auf Trisha fehl am Platz. Wie Vampire, die es bei Sonnenaufgang nicht schnell genug in ihre Gruft geschafft hatten.
Trisha zuckte zusammen, als der Taxifahrer wegen eines Lincolns hupte, der versuchte, sich vorzudrängeln. Erneut griff Trisha nach dem Kuvert mit dem Geld, als hätte es in den vergangenen paar Minuten doch noch verschwinden können. Nun würde sie davon also für Chad und für sich das Startgeld bezahlen, um an der bevorstehenden Poker-Weltmeisterschaft teilnehmen zu können, und dann würde sich zeigen, was das Schicksal mit ihr vorhatte. Denn auch wenn es sich nicht um ein Glücksspiel handelte – so war Pokern doch ein schicksalhaftes Spiel. Einer der älteren Spieler verglich es immer mit dem Leben an sich, »bei dem die Karten jeden Tag neu gemischt wurden und man auch nie wusste, welches Blatt man am Abend in der Hand halten würde«.
Endlich sah sie ihr Hotel am Straßenrand auftauchen. Manche würden es eine Absteige nennen. Aber sie wohnten nun schon seit fünf Wochen in Las Vegas, und wenn alles gut lief, würden sie noch einige Wochen dranhängen. Sie zahlten jeweils im Voraus eine Wochenpauschale, die für die Lage des Hotels wirklich fair war. Abgesehen von der Feuchtigkeit, die sich in Form großer schwarzer Flecke an den Wänden zeigte, waren die Zimmer sauber und ruhig. Da Chad und sie die meiste Zeit in den Kasinos verbrachten, benutzten sie das Hotelzimmer ohnehin nur zum Schlafen.
Der Taxifahrer bremste abrupt und sagte etwas. Trisha verstand nur das Wort »Dollars«. Sie rundete den Betrag, den sie vom Taxameter ablas, viel zu großzügig auf und hievte sich und ihren Koffer aus dem Wagen. Als sie auf dem Bordstein vor dem Hotel stand, breitete sich in ihr das wohlige Gefühl aus, wieder zu Hause zu sein. Ein Gefühl, das sie bei dem Besuch bei ihren Eltern erstaunlicherweise nicht gespürt hatte – und es hielt an, auch als sie auf den zwischen einem Burger-Restaurant und einem vergitterten Secondhand-Laden versteckt gelegenen Hoteleingang zusteuerte.
Erleichtert stellte Trisha fest, dass die Rezeption unbesetzt war. Hank – der Rezeptionist, über den sich unter den Stammgästen hartnäckig das Gerücht hielt, dass er auch der Eigentümer des Hotels sei – war selten gut gelaunt, und meist gab er seinen Gästen statt einer freundlichen Begrüßung einen Rüffel mit auf den Weg. Trisha mied den Aufzug, der noch launischer als Hank war und gern zwischen den Stockwerken stecken blieb, und eilte die Treppe ins erste Obergeschoss hinauf. Dank dieser kleinen Anstrengung fühlte sie sich endlich wieder richtig wach, und die Vorfreude darauf, Chad gleich wieder in ihre Arme zu schließen, ließ ihr Herz ein paar Sprünge vollführen. Obwohl sie nur ein paar Tage in Europa gewesen war, kam es ihr vor, als käme sie von einer langen Reise heim.
Tatsächlich lag es nicht an diesem schäbigen Hotel, dass sie sich hier wie zu Hause fühlte, sondern an Chads Gegenwart. Mit einem Mal wurde ihr bewusst: Sie war dort zu Hause, wo er war. Im Stillen hatte sie sich Hoffnung gemacht, dass sie vielleicht bei diesem Las-Vegas-Trip schon heirateten. Immerhin waren sie im Mekka der Heiratswilligen. Kennengelernt hatten sie sich vor zwei Jahren auf einer Party in London. Er war deutlich älter als sie, doch sie fühlte sich sofort zu ihm hingezogen. Und als sie erfuhr, dass er kein Banker, Werber oder Arzt war, sondern professioneller Pokerspieler, war es um sie geschehen. Sie hatten die Nacht miteinander verbracht, und seitdem war sie nicht mehr von seiner Seite gewichen. Zwei Jahre begleitete sie ihn nun bereits auf seinen Reisen von Spieltisch zu Spieltisch rund um die Welt. Anfangs lediglich als sein Maskottchen. Doch es war nur eine Frage der Zeit gewesen, bis auch sie das erste Mal am Pokertisch Platz genommen hatte, und ihr Erfolg war so bahnbrechend gewesen, dass auch sie zur Spielerin wurde.
Kurz vor ihrer Zimmertür zog sie die hochhackigen Schuhe aus und nahm sie in die Hand. Sie vermutete, dass Chad noch immer schlief, und hatte sich vorgenommen, ihn zu überraschen. Vielleicht konnten sie den Vormittag gemeinsam im Bett verbringen, so wie sie es früher oft getan hatten, mit nichts außer sich und ein paar Joints. Sie zog die Zimmerkarte durch den Schlitz am Türbeschlag, und die kleine grüne Lampe leuchtete auf. Als sie eintrat, musste sie sich beherrschen, um nicht zu kichern. Drinnen war es dunkel. Vorsichtig stellte sie ihren Koffer und ihre Schuhe im Eingang zum Badezimmer ab und schloss geräuschlos die Zimmertür hinter sich. Mit vorsichtigen Schritten, die auf dem abgenutzten Filzteppich kein Geräusch erzeugten, schlich sie durch den kurzen Flur in das Schlafzimmer vor sich.
Die Tür stand offen. Durch einen kleinen Spalt zwischen den zugezogenen Gardinen fiel ein schmaler Lichtstrahl und teilte das Zimmer in zwei Hälften. Mit Storchenschritten näherte sie sich dem Bett. Unter der Decke erkannte sie die Wölbung eines Körpers. Chad schien tatsächlich noch tief und fest zu schlafen. Niemals hätte er es pünktlich zum Flughafen geschafft. Aber sie war ihm nicht böse: Dass er lange schlief, war ein gutes Zeichen. Dann hatte er letzte Nacht vermutlich lange gepokert, und dies bedeutete, dass er nicht früh ausgeschieden war. Plötzlich kam ihr eine Idee. Mit geschickten Handgriffen öffnete sie ihren Rock und ließ ihn auf den Fußboden gleiten. Anschließend entledigte sie sich ihres Blazers und der Bluse. Slip und Büstenhalter folgten, und nun stand sie vollkommen nackt vor dem schmalen Doppelbett. Mit einer Hand hob sie vorsichtig die Bettdecke und schlüpfte mit einer geschmeidigen Bewegung darunter.
Wohlig presste sie ihren kalten Bauch gegen einen anderen nackten Körper – und spürte, wie ihre kleinen festen Brüste ein anderes Paar sehr viel prallerer Brüste berührten. Mit einem spitzen Schrei fuhr sie hoch, riss dabei die Decke zur Seite und starrte auf zwei nackte Leiber im Bett neben sich. Im Halbdunkel erkannte sie den wohlgeformten Hintern von Chad und die Figur einer fabelhaft gebauten Frau.
»Trisha?«
Zwar konnte sie sein Gesicht nicht erkennen, doch sie hörte aus diesem einzigen, verschlafen ausgesprochenen Wort alles heraus, was Chad in diesem Moment ihr mitzuteilen hatte: Überraschung, Bestürzung, Geständnis, Mitleid, Selbstmitleid und Entschuldigung.
Während der Raum um sie herum langsam unter einem feuchten Film verschwand, raffte sie ihre Kleidungsstücke zusammen. Sie stolperte in den Zimmerflur, griff nach dem Koffer, ihrer Tasche und den Schuhen und taumelte splitterfasernackt hinaus in den Korridor. Erst als sie den Fahrstuhl erreicht hatte und sich nach scheinbar ewigem Warten dessen Türen hinter ihr geschlossen hatten, ließ sie alles fallen, sank zu Boden, umklammerte ihre Beine und begann hemmungslos zu schluchzen. Niemals zuvor hatte sie sich so nackt gefühlt.
Ein heftiges Ruckeln, wie im Flugzeug beim Durchfliegen eines Luftlochs, ließ sie aufschauen.
Sie wusste, was das bedeutete: Der Fahrstuhl war stecken geblieben.
5
LEIPZIG, DEZEMBER 1762
König Friedrich saß an seinem Schreibtisch und beachtete ihn nicht.
Schon seit fast einer halben Stunde stand Giovanni Antonio Calzabigi in dem Raum, und zwar genau zwei Schritte neben der Tür. Der Lakai hatte sie ganz leise hinter ihm zugedrückt. Calzabigi hatte sich zweimal umdrehen müssen, um zu glauben, dass die Tür wirklich verschlossen war. Mittlerweile kannte er die Inneneinrichtung des bescheiden eingerichteten Appartements in- und auswendig. Er hatte jedes Möbelstück mindestens zweimal ausführlich mit seinen Blicken abgetastet. Viel hatten seine Augen dabei nicht zu tun gehabt: Außer einem Sessel, einem Sekretär, den der König zum Schreiben benutzte, einem einfach gefertigten Holzstuhl, auf dem der König saß, einer Wand mit Büchern und ein paar schlecht gemalten Gemälden war der Raum leer.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!