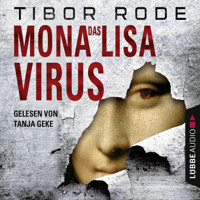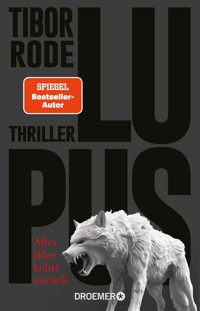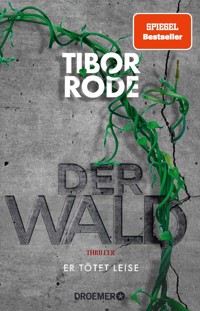9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Glaub nicht, was du siehst
Denn der schöne Schein trügt
In Amerika verschwindet eine Gruppe von Schönheitsköniginnen und taucht durch Operationen entstellt wieder auf. In Leipzig sprengen Unbekannte das Alte Rathaus, und in Mailand wird ein Da-Vinci-Wandgemälde zerstört. Gleichzeitig verbreitet sich auf der ganzen Welt ein Computervirus, das Fotodateien systematisch verändert.
Wie hängen diese Ereignisse zusammen? Die Frage muss sich die Bostoner Wissenschaftlerin Helen Morgan stellen, als ihre Tochter entführt wird und die Spur nach Europa führt - hinein in ein Komplott, das in der Schaffung des berühmten Mona-Lisa-Gemäldes vor 500 Jahren seinen Anfang zu haben scheint ...
Ein hochspannender Thriller um den "Bauplan Gottes" und die teuflische Seite der Schönheit - Für alle Fans großer Verschwörungs- und Geheimnisthriller
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
INHALT
Tibor Rode
DASMONA-LISA-VIRUS
Thriller
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch und erschienen Originalausgabe Dieser Titel wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln Lektorat: Karin Schmidt Textredaktion: Dorothee Cabras Umschlaggestaltung: Bürosüd, München Einband-/Umschlagmotiv: © mauritius images/United Archives; © www.buerosued.de E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-7325-2298-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
»Die Schönheit ist die größte menschliche Macht.«
PROLOG
Endlich schlief sie. Die Augenlider fest geschlossen, die vollen Lippen einen Spaltbreit geöffnet. Im Kontrast zu ihrem dunkelbraunen Haar erschien die makellose Haut im grellen Licht der OP-Lampe noch heller.
Sein Blick folgte ihren Wangenknochen bis zum Kinn, dessen Mitte ein kleines Grübchen markierte, und wanderte dann den langen Hals entlang, an dem die Schlagader im sanften Rhythmus ihres Herzschlags pulsierte. Kurz hielt er inne, zählte leise mit, dann widmete er seine Aufmerksamkeit ihren bloßen Schultern, deren Nacktheit sie verletzlich wirken ließ. Ihre Brüste waren tatsächlich perfekt geformt, Dr. Rahmani hatte nicht übertrieben. Sie waren klein, aber fest, besondere Assoziationen weckte jedoch die Form. Nicht rund, aber auch nicht oval. Bilder von Früchten zogen an ihm vorbei, dann glaubte er, durch den Mundschutz einen süßen Duft wahrzunehmen, der sich mit dem Geruch medizinischen Alkohols vermischte. Hatte seine Mutter ihn gestillt? Wir waren schließlich alle Opfer unserer Gedanken.
Er wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Der Latex seines Handschuhs blieb an seiner vernarbten Haut kleben. Ihr Bauch, der sich kaum merklich unter ihrem Atem hob und senkte, wirkte wie aus Marmor, gleichzeitig aber unendlich weich. Ein Paradoxon. Kurz verspürte er das Verlangen, seine Wange daran zu schmiegen, dann fiel sein Blick auf den kleinen, unechten Brillanten, der im Bauchnabel blitzte. Ein Piercing. Sein Magen zog sich zusammen, und er spürte etwas wie Ekel. So waren sie. In ihrem Streben nach Schönheit scheuten sie selbst den Schmerz nicht. Schreckten nicht davor zurück, ihr eigenes Fleisch zu verletzen. Er widerstand dem Impuls, den Stein einfach herauszureißen. Bald würde das Schmuckstück aufgewertet werden. Verblasste der Zirkonia jetzt noch neben dem Rest dieses nahezu perfekten Körpers, so würde er bald schon das Wertvollste an diesem Stück Fleisch sein.
Wieder fuhr er sich mit der Hand über das Gesicht. Das gleiche raue Gefühl. Fast erleichtert nahm er Notiz davon, dass der Rest der Weiblichkeit von einem Laken verdeckt wurde. Er war sich sicher, dass das giftgrüne Tuch endlos lange Beine verbarg. Intensiv hatte er darüber nachgedacht, wie sie mit den Beinen verfahren sollten. Sie hatten eine zufriedenstellende Lösung gefunden. Sein Blick schweifte hinüber zu einem Instrument, das für ihn aussah wie ein Gummihammer. Er atmete tief ein, dann sah er auf und schaute direkt in die Augen Dr. Rahmanis, die das Einzige waren, was nicht von dessen übertrieben großem Mundschutz verdeckt wurde. Das Licht der Lampen des provisorisch eingerichteten Operationsraumes spiegelte sich in seinen Pupillen, und an deren wilden Flackern erkannte er die Nervosität des Arztes. Oder war es Angst? Die buschigen Augenbrauen des Doktors glänzten feucht, und nun erst fiel ihm das Skalpell auf, das dieser in der Hand hielt. Dessen Spitze zeichnete in der zitternden Rechten leuchtende Bahnen in die Luft, als schwenkte er ein brennendes Streichholz. Diese optische Täuschung gefiel ihm. Der Gedanke an eine Lunte, deren Ende er zu entflammen im Begriff war, stieg in ihm auf. Er kratzte sich unter dem Auge. Der Latex an seinen Fingerkuppen ließ seine Gesichtshaut noch fremder erscheinen, als dies ohnehin der Fall war. Oder sollte er sagen, gefühlloser?
Er nickte dem Doktor aufmunternd zu, und während dieser sich schwer atmend vorbeugte und das Skalpell lautlos die erste Hautschicht zerteilte, überkam ihn ein tiefes Glücksgefühl. Ein letztes Mal betrachtete er das von Gott geschaffene Werk vor sich. Nun war es an der Zeit, dass die Menschheit sein Werk kennenlernte. Auch wenn die Welt zunächst Schwierigkeiten haben würde, es zu verstehen. Aber es war der erste Schritt zur Heilung. Und Medizin schmeckte bitter.
1
Acapulco
Für einen Moment schien die Rivalität vergessen. Miss Louisiana hatte es irgendwie geschafft, eine Flasche Tequila in den Bus zu schmuggeln, und nachdem diese, versteckt in einer braunen Papiertüte, einige Male durch die Busreihen gekreist war, wich die Anspannung der Kandidatinnen ausgelassener Fröhlichkeit. Dazu trug auch die allgemeine Vorfreude bei: Eine Woche Acapulco stand auf dem Programm, die letzte Etappe des Vorbereitungsmarathons für die große Abschlussveranstaltung zur Wahl der Miss America. Spätestens seitdem sie eine Stunde zuvor auf dem Rollfeld des Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez von einer Wand heißer Luft begrüßt worden waren, zweifelte keines der Mädchen mehr daran, dass eine großartige Woche an Mexikos schönsten Swimmingpools vor ihnen lag. Eine gute halbe Stunde würden sie bis zum Hotel fahren, hatte der mexikanische Busfahrer angekündigt, nachdem die Bustüren sich zischend hinter ihnen geschlossen hatten. Vorausgesetzt, er würde bei dieser hübschen Fracht den Blick vom Spiegel lassen können und sie nicht alle in einen Graben fahren, hatte er noch scherzend hinzugefügt.
Aus dem Handy der Miss New York dröhnte Rap-Musik. Die Hälfte der Strecke musste geschafft sein, als die beschwipste Miss Florida, die zu den Jüngsten unter den nationalen Schönheitsköniginnen gehörte, schließlich die Schuhe auszog und sich barfuß auf ihren Sitz stellte, um unter dem Gejohle der anderen tanzend die Hüften kreisen zu lassen. Bei jeder Bodenwelle des mexikanischen Highways katapultierte der gnadenlos weich gepolsterte Sitz die Vertreterin des Sunshine State gegen den Himmel des betagten Busses. Von den Anfeuerungsrufen ihrer Konkurrentinnen angestachelt, öffnete Miss Florida schließlich jauchzend den obersten Knopf ihres schneeweißen Polo-Shirts und posierte mit in die Luft gestreckten Armen im Blitzlicht der Smartphones, nicht ahnend, dass ihre Aussichten auf den Titel sich gerade in der alkoholgeschwängerten Luft auflösten.
Sie hatte keine Chance, als es zur Vollbremsung kam. In der ersten Sekunde wurde sie über die Köpfe ihrer kreischenden Kolleginnen drei Reihen nach vorne katapultiert, schlug mit dem hübschen Gesicht gegen Kopfstützen, mit dem Hinterkopf gegen die Decke, mit dem Arm gegen die Fensterscheibe, mit dem Knie gegen andere Körper. Als der Bus sich quer stellte, wirkten die Fliehkräfte in die seitliche Richtung und schleuderten sie gemeinsam mit Koffern, Taschen und fliegenden Getränkeflaschen auf die andere Seite der Sitzreihen. Schon lange bewusstlos, prallte sie dort längs gegen die Fensterfront und hinterließ einen langen Riss im Glas der Scheibe. Wie eine leblose Stoffpuppe mit seltsam verdrehten Gliedmaßen rutschte sie unter den Sitz.
So bekam sie nicht mehr mit, wie es zunächst ganz still wurde im Bus, nur unterbrochen von leisem Wimmern. Sie hörte nicht mehr den einen Schuss, der die Windschutzscheibe in gefährlicher Nähe zum Kopf des Fahrers durchschlug, und bemerkte nicht, wie dieser auf ein spanisches Kommando hin die Türen des Busses öffnete. Sie sah nicht die schweren Kampfstiefel keine Schuhlänge neben ihrem blutenden Kopf und hörte nicht das angstvolle Flehen des Fahrers, der aus seinem Sitz gerissen und durch die Tür ins Freie gestoßen wurde, wo er im Staub der Straße liegen blieb. Miss Florida blieb der stechende Schmerz erspart, als sie beim scharfen Anfahren des Busses mit dem Nasenbein von unten gegen die scharfen Unterkanten des Sitzes schlug, auf dem Miss Alabama und Miss South Carolina mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen zum ersten Mal in ihrem Leben in den abgewetzten Lauf eines Maschinengewehrs blickten.
2
Boston, eine Woche später
Das Klopfen wurde lauter. Energischer. War es zunächst nur zaghaft zu vernehmen, konnte Helen es jetzt nicht mehr ignorieren. Auch die Abstände zwischen den einzelnen Schlägen verkürzten sich. Das Pochen schien einem verborgenen Rhythmus zu folgen, dessen Schema sie zu entschlüsseln versuchte. Lang – lang – kurz – sehr lang. Blau – Blau – Gelb – Dunkelblau. Wie so oft erzeugten die Töne Farben vor ihrem inneren Auge. Helen zuckte erschrocken zusammen, als ein tiefes Brummen hinzutrat. Ein dunkles Rot breitete sich hinter ihren geschlossenen Augenlidern aus. Das Bild einer Blutlache stieg in ihr auf, verschwand jedoch sofort wieder, als das Rot ins Violette kippte. Das Klopfen wurde noch schneller, drohte, sie zu hypnotisieren. Sie fühlte sich, als hätte sie eine Flasche Rotwein geleert. Ja, das war es. Der Farbton, den sie mit dem Brummen assoziierte, erinnerte sie an die Farbe von Rotwein. An schweren Bordeaux.
»Helen? Schläfst du etwa? Helen!«
Eine blecherne Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Als würde jemand in eine leere Konservenbüchse sprechen. Schraffiertes Rosa.
Sie öffnete die Augen und verspürte den Drang, sich zu bewegen, zu strecken. Doch die enge Röhre, in der sie lag, ließ das nicht zu. Auf einem kleinen Spiegel, der eine Handbreit über ihren Augen befestigt war, erkannte sie das Bild eines lächelnden Mannes. Er war sicher keine fünfundzwanzig. Seine Haare waren perfekt frisiert, glänzten blauschwarz, als hätte sich frischer Tau darübergelegt. Eine einzelne Locke kringelte sich in seine Stirn, was in Helen den Reflex auslöste, den Arm auszustrecken und sie zur Seite zu streichen. Gerade noch rechtzeitig erinnerte sie sich daran, dass sie sich nicht bewegen durfte. Ihr Arm fühlte sich schwer an. Die Wangenknochen des Mannes waren markant, seine Zähne schneeweiß. Eine Andeutung von Bartschatten gab ihm ein besonders männliches Aussehen. Sein verwegener Blick verhieß Abenteuer. Ja, ihn würde vermutlich kaum eine Frau von der Bettkante stoßen. Helen schloss kurz die Augen. Schwarz. Ein Stechen durchfuhr ihre Brust.
»Und, findest du den schön?«, fragte die blecherne Stimme.
Helen glaubte, eine Spur Belustigung herauszuhören. Sie tastete mit den Fingern nach den Schaltern, sorgsam darauf bedacht, nicht die ganze Hand zu bewegen. Ein leichter Fingerdruck. Sie wartete.
»Dachte ich’s mir doch!«, hörte sie Betty sagen. »Und wir hatten schon Angst, du wärst uns eingenickt.«
Sehr lustig, ging es Helen durch den Kopf. Ihr Körper produzierte so viel Adrenalin, dass sie vermutlich heute Abend noch Probleme haben würde einzuschlafen. Für sie war das hier wie ein Ritt auf einem durchgegangenen Pferd. Wer würde dabei einnicken? Der kalte Schweiß stand ihr auf der Stirn. Einmal mehr schnappte sie nach Luft. Ihre Fingerspitzen begannen zu kribbeln. Es hatte seinen Grund, dass sie diese Prozedur so lange aufgeschoben hatte. Alle ihre Kollegen hatten sich Versuchsreihen im MRT-Gerät schon längst selbst unterzogen. Die meisten schon während des Studiums. Irgendwie hatte sie es immer geschafft, sich davor zu drücken. Bis jetzt. Doch wenn man ein Forschungsprojekt leitete, musste man mit gutem Beispiel vorangehen. Und niemand anderem als ihr oblag es, den Versuchsaufbau zu testen. Das Klopfen wurde nun von einer ganz neuen Farbe begleitet. Helen verscheuchte die Farbbilder vor ihrem inneren Auge, konzentrierte sich auf den Spiegel.
»So, jetzt das nächste Foto«, kündigte Betty an.
Diesmal erschien das Gesicht einer Frau. Zuerst dachte Helen, es sei ungeschminkt, doch bei genauerem Hinsehen erkannte sie einen Hauch von Lidschatten und Spuren von Make-up. Dennoch wirkte die Frau irgendwie fad. Blass. Die Haut an den Wangen war ein wenig schlaff. Die Lippen schmal. Die Nase nicht ganz gerade. Der Blick gelangweilt. Schlupflider. Klar, was dieses Bild aussagen sollte. Unattraktivität. Helen schloss die Augen. Hellrot. Wurde es vom Brummen verursacht? Sie bewegte wieder den Zeigefinger.
Ein skeptisches »Okay« kam aus dem Lautsprecher. »Sicher, dass du dich nicht verdrückt hast?«
Helen rang nach Luft, doch irgendwie schien ihre Brust wie zementiert zu sein. Sie hatte das Gefühl, zu ersticken.
»Ich will hier raus!«, sagte Helen plötzlich und war selbst überrascht über ihre Worte.
»Wir sind noch nicht fertig …«, setzte Betty unsicher an.
»Abbruch!«, sagte Helen bestimmt. Das Klopfen hatte eine Sequenz angenommen, die in ihrem Kopf düstere Schatten malte.
»Wirklich?«, fragte Betty ungläubig. »Wir haben noch zehn Fotos …«
»Wirklich!«, antwortete sie jetzt panischer. Helen wartete kurz, und als nichts geschah, tastete sie nach dem kleinen Gummiball, der neben ihrem rechten Arm liegen musste. Hunderte Male hatte sie die Klingel selbst neben die Testperson in das MRT-Gerät gelegt, verbunden mit dem beruhigenden Hinweis, der Proband könne den Ball zusammendrücken, sollte es einen Notfall geben. Selbstverständlich hatte es niemals einen Notfall gegeben. Noch nie hatte jemand ihn gedrückt. Und jetzt tat ausgerechnet sie selbst es.
»Ja, ja, ich komme. Over!«, ertönte Bettys Stimme, in der Bestürzung und Besorgnis mitschwangen. Ihr Sichtfeld wurde in grelles Lila getaucht.
Der Gedanke, dass sie sich nicht selbst aus dieser Röhre befreien konnte, löste in Helen noch mehr Panik aus. Sie spürte, wie ihr der kalte Schweiß nun aus allen Poren trat. Ihr Herz raste. Viel zu eng war es hier. Was, wenn jetzt der Strom ausfiel? Wie lange würde sie dann im Dunkeln liegen müssen?
Das Klopfen und Brummen erstarb plötzlich, das MRT-Gerät ruckelte und schüttelte sie durch. Langsam begann die Decke sich über ihr zu bewegen, und Helen vernahm das leise Surren der Fahrautomatik, während das Gestell, auf dem sie lag, aus der Röhre hinausfuhr. Kein Stromausfall.
Erleichterung durchflutete sie. Ein Paar Hände klappten die Kopfspule auf, und sie blickte in Bettys Gesicht. Was für ein Kontrast zu dem letzten Bild, das vor einigen Augenblicken noch über ihr geschwebt hatte! Umzingelt von Sommersprossen, schaute ein Paar besorgt dreinblickender, grüner Augen auf sie herab. Bettys rote Locken kitzelten Helen am Hals.
»Alles klar mit dir?«, fragte Betty mit gerunzelter Stirn.
»Hilf mir bitte mal hoch«, stöhnte Helen und streckte ihrer Mitarbeiterin die Hand entgegen. Beinahe entglitten ihre feuchten Finger Bettys Griff.
Als Helen sich endlich aufgerichtet hatte, war ihr schwindelig. Doch zum ersten Mal seit Minuten hatte sie das Gefühl, wieder atmen zu können. Es war besser, sie behielt die Wahrheit für sich. Als Leiterin eines Forschungsprojekts dieser Größe konnte sie sich keine solche Schwäche erlauben.
»Ich muss nur dringend zur Toilette. Zu viel Tee heute Morgen«, sagte sie betont locker und befreite sich von den Kabeln.
Sie bemerkte, wie Betty sie nachdenklich musterte. »Was?«, fragte sie lachend und hoffte, dass es nicht zu gekünstelt klang. »Glaubst du etwa, ich habe Angst in einem MRT-Gerät? Das Ding hier ist mein Leben!«
Betty kratzte sich an der Stirn. »Du hast den Notballon gedrückt …«
»Weil ich dringend muss!«, sagte Helen und schüttelte gespielt amüsiert den Kopf. »Liegt vielleicht an der Wärme. Kennst du das nicht?« Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, presste sie die Knie wie ein kleines Mädchen zusammen und machte sich etwas unbeholfen auf den Weg zur Tür. »Werte du schon einmal die Aufnahmen aus, die wir bisher haben. Ich bin gleich wieder da«, rief sie noch, bevor sie auf dem Korridor verschwand. Die Toilette war nicht weit entfernt.
Das kalte Wasser, mit dem Helen ihr Gesicht benetzte, tat ihr gut. Sie stöhnte leise auf, teils vor Kälte, teils vor Erleichterung. Es war genau das Desaster eingetreten, vor dem sie sich seit Jahren gefürchtet hatte. Sie spürte, wie das Blut in ihre Wangen schoss. Aber sie musste sich nicht schämen. Es gab Zahnärzte, die Angst vor einer Zahnbehandlung hatten. Polizisten, die zu schnell Auto fuhren. Und es gab eben Neuroästhetiker, die Panik vor dem Tunnel des MRT-Gerätes hatten. Helen trocknete ihr Gesicht mit den harten Papierhandtüchern, die etwas schwefelig rochen, ordnete mit einem kurzen Blick in den Spiegel ihr Haar und ging zurück in den Kontrollraum.
Sie würde einfach jede Diskussion über den Vorfall im Keim ersticken. Das war der Vorteil, wenn man das Sagen hatte.
Betty war allein. Sie saß an einem Pult, das an ein Flugzeug-Cockpit erinnerte. Hinter einer Glasscheibe war der nun verwaiste Magnetresonanztomograf zu sehen. Betty schaute konzentriert auf einen großen Monitor.
»Wo ist Claude?«, fragte Helen. Zu gern hätte sie seine Reaktion auf ihren Abbruch des Experiments gesehen und auch ihm gleich eine schlüssige Erklärung geliefert. Bevor die Sache sich unter den Kollegen herumsprach.
»Er holt sich nur schnell etwas zu essen«, antwortete Betty gedankenverloren.
»Da waren ja ein paar ganz schnuckelige Typen dabei«, sagte Helen. Bloß normal wirken.
»Ich dachte mir, dass sie dir gefallen.«
Helen massierte sich die Schläfen. Sie bildete sich ein, immer noch ein leises Brummen zu hören. »Die Geräusche in der Röhre machen einen ja echt fertig«, sagte sie. »Drinnen sind sie noch viel intensiver. Geradezu psychedelisch!«
Betty hob eine Hülle empor, in der eine CD steckte, ohne dabei den Blick vom Bildschirm abzuwenden. Helen entzifferte auf der CD den Schriftzug Magnetic Sounds. »Claude hat die Geräusche während der MRT aufgenommen und auf CD gebrannt. Er meint, wenn er das abmischt und abends im Auto hört, ist das besser als jede Lounge-Musik. Er hat mich gefragt, ob ich dazu etwas singe.«
Helen schmunzelte. Dass zwischen Betty und Claude etwas im Busch war, hatte sie schon länger vermutet. »Hat er mir gar nicht erzählt.«
Betty lachte laut auf. »Wahrscheinlich hat er Angst, dass er dafür Ärger bekommt. Ist ja kein Tonstudio hier.«
»Den bekommt er jetzt auch«, bemerkte Helen trocken. Als Betty sie bestürzt anblickte, legte sie ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. »Das war nur ein Scherz!«
Während ihre Kollegin sich sichtlich entspannte, fiel Helens Blick auf die Abbildung auf dem Monitor vor ihnen. Was wie eine überdimensionierte Hälfte einer geöffneten Walnuss aussah, war in Wahrheit der Querschnitt ihres Gehirns. Oben rechts stand ihr Name: Helen Morgan. Zum ersten Mal sah sie ihr eigenes Gehirn auf dem Monitor. Zwischen korallenartigen grauen Konturen leuchteten rot-gelb eingefärbte Areale, die wie kleine Brandherde wirkten.
»Sag mal, ist das deine erste MRT?«, fragte Betty mit unüberhörbarer Sorge in der Stimme. Offenbar hatte sie den Vorfall trotz Helens Versuch, ihn zu verharmlosen, immer noch nicht abgehakt.
»Ich sagte doch, ich musste nur einmal zur Toilette …«
»Das meine ich nicht.« Betty beugte sich vor, um etwas auf dem Monitor vor sich genauer zu betrachten. »Ich meine das hier«, sagte sie.
Helen spürte, wie ihr Herzschlag sich beschleunigte, als sie an Betty vorbei auf die Abbildung ihres Gehirns schaute. Jetzt erst fiel ihr etwas auf, was sie eben offenbar übersehen hatte. Einige Zentimeter entfernt von den rot eingefärbten Flächen, auf der ganz anderen Seite ihres Gehirns, stach ein weiterer Fleck aus der Abbildung hervor. Ein Fleck, der dort, wie sie als Neurologin nur zu gut wusste, eigentlich nicht hätte sein dürfen. Direkt darunter klebte nun Bettys Zeigefinger am Bildschirm.
Sie wusste sofort, was dieser hellrote Punkt in der Größe eines Daumennagels zu bedeuten hatte.
Betty drehte sich zu ihr um und blickte sie mit zusammengezogenen Augenbrauen an.
Helen ignorierte sie und starrte weiter auf den Monitor. Sie hatte viel darüber gelesen, Bilder in Lehrbüchern studiert und es sich auch so vorgestellt. Doch jetzt, da sie es vor sich sah, in ihrem eigenen Gehirn, machte es ihr mehr Angst als erwartet. Dies war der bildhafte Beweis für das, was sie schon lange geahnt hatte.
Sie hatte das Gefühl, als spürte sie Bettys Finger, der noch immer mitten auf dem Abbild ihres Gehirns ruhte, hinter ihrer Stirn, tief im Inneren ihres Schädels. Helen hatte nicht damit gerechnet, dass die Abnormität so gut zu erkennen sein würde, hatte vielmehr gehofft, dass sie Betty nicht auffallen würde. Ausgerechnet Betty. Bei ihr war ein medizinisches Geheimnis ungefähr so gut aufgehoben wie an der Pinnwand im Gemeinschaftsraum.
Es würde sie einiges kosten, damit sie das hier für sich behielt.
Ohne ihren Blick vom Bildschirm abzuwenden, streckte Helen die rechte Hand aus und gab der Tür neben sich einen Stoß, sodass sie krachend ins Schloss fiel. Ein schrilles Gelb blitzte dabei vor ihren Augen auf. Betty drehte sich erschrocken zu ihr um.
»Was würdest du sagen, wenn ich Claude und dir das Labor am Wochenende einen Tag für eure Musikaufnahmen überlasse?«
Ein breites Lächeln brachte die Sommersprossen in Bettys Gesicht zum Tanzen.
3
San Antonio
»Fühlst du dich nicht wohl, Madeleine?« Sei ehrlich zu mir!, schien der Blick des Doktors zu sagen.
Sie schüttelte energisch den Kopf. Diesmal musste sie nicht lügen. Es ging ihr gut. In den vergangenen Wochen war es ihr Tag für Tag besser gegangen. Was an den Sitzungen mit dem Doktor lag. Aber auch an Brian. Bei dem Gedanken an seinen braunen Wuschelkopf hüpfte ihr Herz. »Mir geht es wirklich gut. Richtig gut«, sagte sie mit fester Stimme und hielt Dr. Reids Blick stand.
Der skeptische Ausdruck in seinem Gesicht wich einem Lächeln. »Das ist gut. Sehr gut«, bemerkte er und schaute auf die Mappe mit den Unterlagen auf seinem Schoß, als suchte er darin nach einem Eintrag.
Sie reckte den Hals, glaubte, einen Scheck in der Akte zu erkennen. Vielleicht von ihrer Mutter für den Aufenthalt in der Klinik. Ihr Blick wanderte zur Uhr, die über der Tür hing. Schon fünf nach halb vier. Um vier war sie mit Brian im Park der Klinik verabredet. Wie langsam der Minutenzeiger sich bewegte!
Nun legte der Doktor die Unterlagen zur Seite und verschränkte die Arme, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen. Sein Brustkorb hob sich unter einem tiefen Atemzug. Offenbar hatte er ihr etwas Unangenehmes zu sagen.
»Madeleine, es freut mich, nein, uns alle freut es, dass es dir besser geht. Aber erlaube mir eine Frage. Und bitte sei nicht böse. Als dein Therapeut darf ich sie dir so direkt stellen.«
Madeleine nickte irritiert. So wie jetzt hatte sie ihn in all ihren bisherigen Gesprächen noch nicht erlebt. Er, der Pol der Ruhe und Hort der Zuversicht, wirkte zum ersten Mal angespannt. Seine Stimme klang ernsthaft besorgt. Plötzliche Unruhe breitete sich in ihr aus. »Ja klar«, sagte sie mit gespielter Gelassenheit. »Fragen Sie ruhig!«
Wieder hoben sich die Schultern des Therapeuten, und er räusperte sich umständlich. »Madeleine«, begann er schließlich und fixierte sie noch intensiver als zuvor. »Bist du fett geworden?«
Sie glaubte, sich verhört zu haben, öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Versuchte, ein Echo seiner Worte aufzufangen, das es in diesem Raum nicht gab. Hatte … hatte er tatsächlich »fett« gesagt?
»Versteh mich nicht falsch«, fuhr Dr. Reid, der sich nun sichtlich unwohl fühlte, fort. »Aber als du zu uns gekommen bist, warst du ein so schlankes und attraktives Mädchen. Viel hübscher als all die anderen hier. Und nun sitzt du da mit deinem selbstzufriedenen Lächeln, dem Doppelkinn, dem kleinen Bauch und wirkst auf mich …« Der Doktor machte eine Pause und beugte sich langsam vor. »Verzeih die Ehrlichkeit: fett!« Bei den letzten Worten hatte sein Gesicht einen angewiderten Ausdruck angenommen.
Madeleine spürte, wie ihre Kehle sich zusammenschnürte, wie ihr das Herz schmerzhaft gegen die Rippen schlug, die jahrelang ein sichtbares Zeichen ihres schlechten körperlichen Zustands gewesen waren. Sauer stieß sie auf. Mit Mühe unterdrückte sie einen Würgereiz.
Die warme Hand des Therapeuten legte sich auf ihr Knie. »Madeleine«, sagte er mitfühlend. »Wir wollen dich hier heilen. Aber wir wollen aus dir keinen selbstgefälligen Menschen machen. Wenn du hässlich und fett bist, nützt dir deine psychische Gesundheit in der gemeinen Welt da draußen auch nichts. Die Welt ist böse, Madeleine. Vergiss das nicht!«
Sie starrte auf die gefurchte Stirn des Doktors, die im gelblichen Licht der Bürolampe leicht glänzte. Der Brechreiz verstärkte sich. Sollte das ein Test sein? Madeleine suchte in den Augen Dr. Reids nach etwas, was das Ganze als Scherz enttarnte. Als Prüfung, wie stark sie inzwischen geworden war. Doch sie entdeckte in seinem Blick nichts, was die Grausamkeit seiner Worte abschwächte. Er schien vielmehr ernsthaft besorgt um sie zu sein. Beinahe traurig.
Ihr ganzer Körper verkrampfte sich. Sie hatte nicht bemerkt, dass sie fett geworden war. Was war mit Brian? Warum hatte er ihr nichts gesagt? Stand er gar auf dicke Frauen? War er in Wirklichkeit vielleicht deswegen hier in Behandlung und nicht wegen seiner Drogensucht, wie er ihr erzählt hatte? War er ein perverser Fetischist? Sie musste hier raus! Schon sprang sie auf und stürzte auf wackeligen Beinen zur Tür. Madeleine brauchte all ihre Kraft, um die Türklinke herunterzudrücken. Der Flur schwankte unter ihren Füßen wie das Deck eines Schiffes bei schwerem Seegang. Der Geschmack von Erbrochenem breitete sich in ihrem Mund aus.
4
Warschau
Patryk Weisz blieb stehen und lauschte in den leeren Flur. Kein Laut hallte durch das riesige Haus.
Die Leere kam ihm unheimlich vor. Er selbst hatte niemals hier gelebt. Aufgewachsen war er in London. Erst vor einigen Jahren hatte sein Vater nach dem Tod der Mutter seinen Wohnsitz wieder hierher verlegt, in seine alte Heimat. Patryk fühlte sich hingegen kaum noch als Pole; seinen Vater hatte er in den vergangenen Jahren nur dreimal zu Hause besucht. Dieses Anwesen war ihm daher fremd, und ohne seinen Vater war es nur irgendein Gebäude für ihn. Sein Blick fiel auf ein gerahmtes Foto an der Wand. Es zeigte ihn selbst mit vielleicht zwei Jahren. Er saß, nur mit einer überdimensionierten Windel bekleidet, am Rand einer Sandkiste, in der Hand ein blaues Schäufelchen. Er blickte skeptisch in die Kamera, mit der kleinen Linken zeigte er auf den Fotografen. Vermutlich hatte er sich gewundert, wer der Mann war, der dort durch den Fotoapparat auf ihn herabschaute. Sein Vater, so hatte seine Mutter es stets erzählt, war nicht oft zu Hause. Sein Zuhause war das Büro gewesen, seine wirkliche Familie die Mitarbeiter. Sein »Lebenswerk«, wie sein Vater selbst stets betont hatte. Patryk seufzte. Der Ruhestand musste für ihn eine unvorstellbare Qual gewesen sein. Dazu die Schmerzen nach dem Unfall. Über die er niemals ein Wort verlor, die ihn aber, so die Ärzte, bis an sein Lebensende verfolgen würden. Wieder entfuhr Patryk ein Seufzer.
Ein Geräusch ließ ihn aufhorchen. Vielleicht einer der Jagdhunde. Oder einer der wenigen verbliebenen Bediensteten, deren Hauptaufgabe nun darin bestand, die Hunde zu versorgen. Und die sechsundzwanzig Zimmer in Schuss zu halten, davon allein fünf Badezimmer und sieben Schlafräume.
Er schüttelte den Kopf und lachte verächtlich. Sechsundzwanzig Zimmer für einen einzigen Mann. Viel Platz, um allein zu sein. Sagte man nicht immer, Reichtum mache einsam? Hier spazierte er durch den Stein auf Stein erbauten Beweis. Die Leere, die er spürte … Ihm wurde klar, dass sie in diesem Haus stets vorhanden war, nicht nur jetzt, da sein Vater fehlte. Genau acht Wochen war es heute her, seit Pavel Weisz für die Welt spurlos verschwand.
Patryks Blick löste sich von dem Foto und wanderte zur gegenüberliegenden Wand. Von einem Gemälde über einem kleinen Beistelltisch schaute eine Person mit an die Ohren gelegten Händen und weit geöffnetem Mund aus leeren Augen zu ihm herüber. Die abgebildete Person schien zu schreien. Er kannte das Gemälde. Es stammte von einem norwegischen Maler. Er wunderte sich. Bis jetzt war ihm dieses Bild noch niemals in diesem Haus aufgefallen. Ob es das Original war? Normalerweise gab sein Vater sich nicht mit Kopien zufrieden. Sofort kam ihm der Keller wieder in den Sinn. Seine Hand wanderte in seine Hosentasche, und er beförderte einen kleinen Zettel zutage.
Helen Morgan, stand dort in der wackeligen Handschrift seines Vaters geschrieben.
Er betrachtete die Ziffern hinter dem Namen und schaute auf die Uhr an seinem Handgelenk. Dann wandte er sich um und versuchte, sich zu erinnern, wo entlang es zum Arbeitszimmer ging. Dort gab es ein Telefon.
5
Florenz, um 1500
Ein junger Mann erschien heute nach dem Mittagsmahl in unserem Haus. Elegant gekleidet. Der Kragen gesäumt vom Fell eines Luchses. Locken von solcher Pracht. Wangen wie Pfirsiche. Volle, rosige Lippen. Ein Blick, selbstsicher, als wäre er ein Prinz. Zunächst hielt ich ihn für einen meiner Schüler und wollte ihn mangels jeglicher Ankündigung seines Besuches des Hauses verweisen. Doch aus einem mir unbekannten Grund konnte ich nicht. Konnte es so wenig, wie man den Tag zur Nacht kehren kann. So wenig, wie man den Tod auszusperren vermag, wenn er beschließt, einen heimzusuchen. Nur dir, mein Tagebuch, vertraue ich es an, wohl wissend, dass du es für immer in dir verschließt. Ich konnte es nicht, weil ich mein Leben lang auf ihn gewartet habe. Er ist kein Schüler, und er ist auch kein Prinz.
Etwas tief in meinem Innersten sagt mir, dass er nicht von dieser Welt ist.
Und daher ließ ich ihn ein.
6
Boston
Ein lauer Herbstwind wehte ihr ins Gesicht. Sie sog die Luft tief in ihre Lungen und spürte förmlich, wie der Knoten in ihrem Magen sich dabei löste. Um sie herum leuchteten die Bäume im Park in den buntesten Farben. Im Vorbeigehen beobachtete sie ein junges Pärchen, das turtelnd auf einer der Bänke saß. Der Indian Summer zeigte sich augenblicklich von seiner schönsten Seite und hüllte die Stadt in sein romantisches Flair.
Als Wissenschaftlerin wusste Helen die Phänomene der Natur zu deuten. Durch die kalten Nächte und die immer noch warmen Tage produzierten die Bäume um diese Jahreszeit eine Substanz, die den Flüssigkeitsaustausch zwischen Ästen und Blättern blockierte. Die Folge war ein dramatisches Absinken des Chlorophyllgehaltes; der Zucker in den Blättern verlieh ihnen die wärmsten Farben. Ein chemischer Prozess, mehr nicht. Wie die Liebe auch. Fast hätte sie ihr Herz mit dieser biologisch-rationalen Erklärung überzeugt, doch nun wurde es ihr plötzlich schwer. Sosehr sie es sich wünschte und sosehr sie ihr Idealbild einer Wissenschaftlerin vor sich hertrug, nur selten gelang es ihr, wirklich abgeklärt und vernunftgeleitet zu bleiben. So wie vorhin, als sie Betty verpflichtet hatte, über die Ergebnisse ihrer MRT Stillschweigen zu bewahren. »Warum? Das ist doch nichts, wofür man sich schämen muss«, hatte Betty eingewandt und damit aus Helens Sicht eine unsichtbare Grenze überschritten. Ihr Körper gehörte ihr, und es war allein ihre Entscheidung, mit wem sie medizinische Fotoaufnahmen ihres Gehirns teilte und mit wem nicht.
Schließlich hatte sie Betty von Kollegin zu Kollegin darum gebeten, es für sich zu behalten. Bis Claude hereingeplatzt war und das Gespräch durch sein Erscheinen abrupt beendet hatte. Als er die Stille im Raum bemerkt hatte, war er sichtlich peinlich berührt gewesen. »Habt ihr etwa Streit?«, hatte er gefragt, und beide waren mit einem Lächeln über seine Verlegenheit hinweggegangen.
Dann hatte Helen sich den Rest des Tages spontan freigenommen, nicht ohne zuvor sicherzustellen, dass sämtliche Aufzeichnungen ihres Selbstversuchs gelöscht waren.
Nun fühlte sie sich wie erschlagen. Ihr Kopf schmerzte, wie so oft bei lauten Geräuschen. Sie massierte sich mit gespreiztem Daumen und Zeigefinger die Augenbrauen. Nachher würde sie eine Tablette nehmen oder besser gleich zwei.
»Mein Körper gehört mir«, wiederholte sie leise die Worte, die sie zu Betty gesagt hatte. Das war nicht immer so gewesen. Hatte sie deshalb ein Problem damit, anderen Einblick in die Geheimnisse ihres Körpers zu gewähren? Hatte sie deshalb gegenüber Betty so heftig reagiert? Aus Sorge, dass die Aufnahme ihres Gehirns die Runde machen würde? Für einen kurzen Moment sah sie das Cover der Vogue mit der Abbildung ihres Gehirns vor sich, dann kniff sie die Augen zusammen, um das Bild zu verscheuchen. Seufzend hielt sie das Gesicht in die Sonne, spürte die Wärme auf ihrer Stirn. Hoffte, dass die UV-Strahlen ihre düsteren Gedanken einfach wegbrennen würden.
Helen griff in ihre Manteltasche und fühlte den Briefumschlag unter ihren Fingern. Sie zog ihn heraus und entnahm das Schreiben, das den Briefkopf des Louvre in Paris trug. Darunter stand der Name des Leiters der Gemäldesammlung, Monsieur Louis Roussel. Sie überflog die Zeilen. Monsieur Roussel äußerte seine Freude darüber, eine Kapazität wie sie bald im Centre de recherche et de restauration des musées de france, kurz C2MRF genannt, in Paris begrüßen zu dürfen. Alles sei für die anstehenden Untersuchungen vorbereitet. Zudem wies er noch einmal auf die Notwendigkeit höchster Geheimhaltung hin. Aus Sicherheitsgründen. Noch nicht einmal ihre engsten Mitarbeiter Betty oder Claude durften wissen, was genau der Zweck ihres Aufenthaltes in Paris war. Dies kam ihr ein wenig übertrieben vor, aber es machte auch den Reiz dieser Exkursion aus.
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Der Gedanke an Paris weckte in ihr frohe Erinnerungen. Wie die an einen vergangenen Sommer. In Paris hatte sie ihre schönsten Momente erlebt … aber gleichzeitig auch ihre schlimmsten.
Sie faltete den Briefumschlag wieder zusammen, damit er in ihre Manteltasche passte, und stieß mit der Hand gegen ihr Handy. Umständlich kramte sie das Headset hervor und steckte den kleinen Kopfhörer ins Ohr. Seitdem sie in einem der Fachmagazine eine schwedische Studie darüber gelesen hatte, wie Handystrahlung das Gehirn verändert, verzichtete sie darauf, sich das Mobiltelefon direkt ans Ohr zu halten.
Sie wählte Madeleines Handynummer. Es dauerte eine Weile, bis sie ein Freizeichen erhielt, das einen stechenden Schmerz erzeugte, der von ihrem Innenohr bis in die Schläfe zog. Nach dem fünften Ton meldete sich die Mailbox. Helen freute sich, die helle Stimme ihrer Tochter zu hören, die darum bat, nach dem Piepton eine Nachricht zu hinterlassen. Doch noch lieber hätte sie jetzt direkt mit ihr gesprochen. Sie legte auf. Vermutlich hatte Madeleine gerade eine Therapiesitzung. Der Klinikalltag in San Antonio war klar strukturiert. Dies war Teil der Therapie. Wie lange hatte sie Madeleine jetzt schon nicht gesehen? Sechs lange Wochen. Aber so wollten die Ärzte es, weil Madeleine es so wollte. Helen stieß einen lauten Seufzer aus. Beim Gedanken an ihre Tochter wurde ihr das Herz noch schwerer.
Ein weiteres Pärchen schlenderte Händchen haltend auf sie zu. Mit ihrer modischen Kleidung wirkten die beiden, als wären sie geradewegs dem Herbstkatalog der großen Modemarken entsprungen. Helen schüttelte schmunzelnd den Kopf. Arbeitete in dieser Stadt tagsüber denn niemand mehr? Doch gleich erstarb das kleine Lächeln, das in ihren Mundwinkeln genistet hatte, wieder.
Das Liebesglück der anderen schlug ihr aufs Gemüt. Schon bereute sie ihren Entschluss, den sonnigen Nachmittag für einen Spaziergang zu nutzen.
Die Trennung von Guy lag nun drei Monate zurück. Und seitdem hatte sie, zumindest außerhalb ihrer Arbeit am Institut, nicht mehr richtig zurück ins Leben gefunden. Immer noch fühlte sie sich in der neuen Wohnung fremd. Sie war es nicht mehr gewohnt, allein zu leben. Allein zu schlafen. Allein einkaufen zu gehen. Allein fernzusehen. Nun konnte sie Frauen verstehen, die sich eine Katze anschafften. Oder gleich mehrere.
Helen blieb vor einem prächtigen Rot-Ahorn stehen und legte den Kopf in den Nacken, um ihn bis in die Krone hinauf zu betrachten. Welcher Kontrast zu dem Grün des Sommers! Eine kurze, vergängliche Phase der Aufmerksamkeit. Wie oft hatte sie in den vergangenen Monaten diesen Baum passiert, ohne ihn näher zu beachten! Und nun, da er sich mit leuchtendem Rot schmückte, konnte man nicht daran vorbeigehen, ohne ihn anzuschauen. So wenig, wie der Agent der Modelagentur seinerzeit an ihr hatte vorbeigehen können, als sie sechzehn Jahre alt gewesen war und er sie auf der Straße in New York angesprochen hatte. Ein von ihr als peinlich empfundenes Fotoshooting in einem Loft in Brooklyn, erste Castings bei den großen Modelabels, und sie wurde praktisch über Nacht zu einem leuchtenden Pixel der Modelbranche. Sie lief auf Shows in New York, Mailand, Paris und Berlin, manchmal war sie innerhalb einer Woche gleich in mehreren Städten gebucht. Im ersten Jahr ihrer Modelkarriere hatte sie mehr Meilen mit dem Flugzeug zurückgelegt als ihre Eltern in ihrem gesamten Leben.
Und wie sie geleuchtet hatte als Model! Ein kalter Schauer rieselte ihr den Rücken hinunter. Die Erinnerungen an ihre Modelkarriere waren untrennbar mit den Gedanken an Madeleines Vater verbunden.
Bis heute wusste sie nicht, ob sie auch ohne die Sache mit ihm erkannt hätte, dass das Blitzlicht, vor dem sie tagtäglich posierte, sie in erster Linie blendete. Von einem Tag auf den anderen hatte sich der Schleier aus dunklen Farben über alles gelegt. Oder war, im Gegenteil, ein Schleier weggerissen worden, der zuvor den Blick auf die Wahrheit verstellt hatte? Sie wusste es nicht. Aber sie wusste, dass alles Leuchten irgendwann verblasste. Unaufhaltsam. Genau wie bei diesem Rot-Ahorn vor ihr. In wenigen Wochen schon würde hier nur noch ein kahles Gerüst aus Ästen und Zweigen in den Himmel ragen, und der Baum würde wieder für alle unsichtbar werden.
Nach dem unerwarteten Ende ihrer Modelkarriere hatte sie noch während der Schwangerschaft ein Studium begonnen, und sie hatte Glück gehabt. Nicht nur, dass ihre Mutter ihr während des Studiums mit Madeleine den Rücken frei gehalten hatte und sie alle Prüfungen trotz der Doppelbelastung als junge Mutter problemlos bestand. Auch hatte sie frühzeitig auf die gerade erst neu gegründete Disziplin der Neuroästhetik gesetzt. So war sie schon als Studentin zu einer in diesem jungen Gebiet bekannten Forscherin aufgestiegen. Nach dem Studium hatte sie sich vor Job-Angeboten gar nicht retten können.
Sie bekam Nackenschmerzen und wandte den Blick vom Ahorn ab, während sie sich orientierte. Der Ausgang des Parks lag in östlicher Richtung. Mit langsamen Schritten setzte sie sich wieder in Bewegung. Der Gedanke an Madeleines Vater ließ sich nicht abschütteln. Als Neurologin wusste sie, dass der Satz »Gedanken sind frei« so nicht stimmte: Tatsächlich waren wir alle Gefangene unserer Gedanken, und wirklich frei war nur derjenige, dem es gelang, seine Gedanken zu unterwerfen.
Rückblickend hatte sie nur noch Scham gespürt. Als sie erfahren hatte, dass sie nicht die Einzige war, die auf die vorgespielte Verliebtheit des Starfotografen hereingefallen war. Glaubte man den Gerüchten, hatte er Hunderte von Mädchen von dem Objektiv seiner Kamera direkt in sein Bett gequatscht. Aber soweit sie wusste, war sie die Einzige, die er dabei geschwängert hatte. Ihre Model-Agentur hatte sie nach dem Vorfall, bei dem Madeleine gezeugt worden war, im Stich gelassen. Sie hatten ihr, nicht ihm, mangelnde Professionalität vorgeworfen und sich bei ihm sogar noch für ihr Verhalten entschuldigt.
Helen habe ihn verführt, hatte er mit gespielter Betroffenheit gegenüber ihrem Agenten behauptet. Sie, ein unverdorbenes, unschuldiges Mädchen, das von Sex noch weniger wusste als von der Modewelt, in die sie hineingestolpert war. Genau andersherum hatte es sich abgespielt, und sie hatte sich nicht getraut, so heftig zu protestieren, wie es angebracht gewesen wäre. Wie naiv sie gewesen war, wie dumm! Spätestens als er plötzlich angefangen hatte, sich beim Fotografieren seiner Kleider zu entledigen, hätte sie sich der Situation entziehen müssen. Um ihr beim Bikini-Shooting die Angst zu nehmen, hatte er mit einem breiten Lächeln erklärt. Einem sympathischen Lächeln. Es war ein Shooting für einen der ganz großen Designer gewesen, und sie hatte sich nicht getraut, die Session abzubrechen. Helen schämte sich dafür. Und sie schämte sich für den Gedanken, dass sie es hätte verhindern müssen. Denn hätte sie diesem Mann Einhalt geboten, wäre sie nicht auf seine Avancen eingegangen, würde es Madeleine heute nicht geben. Wünschte sie sich, dass es nicht geschehen wäre, wünschte sie sich gleichzeitig, dass Madeleine niemals geboren worden wäre. Denn trotz der unglücklichen Umstände ihrer Zeugung und trotz ihrer problematischen Gefühle für Madeleines Vater war ihre Tochter das Wertvollste in ihrem Leben. Madeleine hatte sie mit ihrer Ankunft auf diesem Planeten aus einer Welt voller Missgunst, Verlogenheit und Egoismus gerettet. Madeleines erster Schrei im Kreißsaal war für Helen wie ein Weckruf gewesen, ihrem Leben eine andere Richtung zu geben.
Wieder passierte sie zwei innig umschlungene junge Leute. Es war dasselbe Pärchen, das vorhin auf der Bank gesessen hatte. Für einen Augenblick erinnerte sie sich an das Gefühl, verliebt zu sein. So wie sie beim Duft ausgeblasener Kerzen stets an Weihnachten dachte.
Ein Vibrieren breitete sich unter ihrem Mantel aus. Sie brauchte einen Moment, bis sie verstand, dass es ihr Handy war, das in der Tasche ihres Blazers vibrierte. Bestimmt Madeleine, die zurückruft, dachte sie und fühlte sich gleich ein wenig getröstet. Umständlich versuchte sie, das Telefon aus ihrer Tasche zu befreien. Eine unterdrückte Nummer. Also Betty, die immer anonym anrief. Bestimmt wollte sie wissen, ob wirklich alles mit ihr okay war. Helen seufzte. Nun ging das also los.
Sie kramte das Headset hervor, entwirrte die Schnur und stöpselte es in ihr Ohr. Mit der rechten Hand packte sie das kleine Mikrofon am Kabel und hielt es sich vor den Mund. »Mir geht es gut«, sagte sie. Sie hörte, dass sie schnippischer klang, als sie eigentlich beabsichtigt hatte.
»Schön zu hören«, meldete sich eine Männerstimme, bei der sie sicher war, dass sie sie noch niemals zuvor gehört hatte. »Spreche ich mit Helen Morgan?«
Sie bejahte vorsichtig. Die Stimme klang fremd, aber nicht unsympathisch.
»Sehr gut. Mein Name ist Patryk Weisz. Also, wie soll ich anfangen? Kennen Sie Pavel Weisz?«
Helen blieb stehen, um sich ganz auf das Telefonat konzentrieren zu können. Dies schien keiner der üblichen Anrufe zu sein. Sie überlegte. Der Name Weisz sagte ihr tatsächlich etwas, sie kam aber nicht gleich darauf, in welchem Zusammenhang sie ihn schon einmal gehört hatte. »Meinen Sie den Software-Milliardär?«, fragte sie schließlich.
»Genau«, bestätigte ihr Gesprächspartner erfreut. »Sind Sie ihm persönlich begegnet?«
»Leider nein.«
Ein enttäuschtes Schnauben tönte aus dem Kopfhörer. »Ich bin sein Sohn.«
»Ich verstehe nicht …«, setzte sie an.
»Ich auch nicht. Zumindest nicht so ganz …« Kurz wurde es still, und Helen dachte schon, die Verbindung wäre unterbrochen. Vielleicht ein Scherzanruf. Steckte Claude dahinter, um sie in Bettys Auftrag ein wenig aufzuheitern?
»Es ist so«, fuhr ihr Gesprächspartner fort. »Mein Vater wird seit einigen Wochen vermisst.«
»Das tut mir leid«, entgegnete sie und setzte langsam ihren Weg fort.
»Ich bin in seinem Haus in Warschau. Das liegt in Polen. In Europa.«
Sie wusste, wo Warschau lag, sie war für eine Modenschau sogar schon einmal dort gewesen.
»Auf der Suche nach Hinweisen, die das Verschwinden meines Vaters erklären können, bin ich auf Ihren Namen und diese Telefonnummer gestoßen.« Wieder trat eine Pause ein. Offenbar hoffte der Mann am anderen Ende der Leitung, dass sie etwas erwiderte.
»Wie gesagt, ich kenne Ihren Vater nicht. Es tut mir wirklich leid, und ich hoffe, Sie finden ihn.« Sie stutzte. »Woher genau, sagten Sie, haben Sie diese Telefonnummer?« Sie telefonierte nicht gern mit dem Handy, und aus irgendeinem irrationalen Grund hielt sie ihre Handynummer weitestgehend geheim. Außer ein paar Freunden, ihrer Familie und wenigen Kollegen kannte niemand diese Nummer.
»Deshalb rufe ich Sie an. Das Letzte, was mein Vater vor seinem Verschwinden auf einem Schreibblock neben dem Telefon notiert hat, den ich hier in seinem Haus in Warschau gefunden habe, war offenbar Ihr Name und diese Telefonnummer. Zumindest hat einer seiner Angestellten mir das gesagt.«
»Seltsam. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen da helfen kann …« Mittlerweile war Helen beinah am Ausgang angekommen und spürte den starken Wunsch, dem Park und diesem merkwürdigen Telefonat so schnell wie möglich zu entkommen.
»Neben Ihrem Namen steht noch ein Vorname«, fuhr ihr Gesprächspartner fort. Sie glaubte, das Rascheln von Papier zu vernehmen. »Madeleine. Sagt Ihnen dieser Name etwas?«
Helen blieb abrupt stehen und spürte einen Stich in der Herzgegend. Von einem Moment auf den anderen begann ihr Herz schneller zu schlagen. Was hatte Madeleine mit Pavel Weisz zu tun? Dieser Mann musste um vieles älter sein als sie.
»Ja, so heißt meine Tochter«, bestätigte sie vorsichtig. Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Sie dachte an ihren vergeblichen Versuch, Madeleine in der Klinik zu erreichen.
»Ihre Tochter?« Ihr Gesprächspartner klang verblüfft. »Ist sie bei Ihnen?«
»Nein, sie ist …« Helen stockte. Es ging den Fremden nichts an, dass Madeleine sich derzeit in einer psychiatrischen Klinik befand. »… im Moment nicht bei mir.«
»Haben Sie Ihre Tochter in letzter Zeit gesehen?«
»Wie meinen Sie das?«
»Wie alt ist sie, wenn ich fragen darf?«
»Sechzehn. Warum wollen Sie das alles wissen?« Nein, sie sollte nicht mit einem Unbekannten über Madeleine sprechen, sondern lieber auflegen.
Ein leises »Mmmh« kitzelte sie im Ohr.
»Was ist?«, fragte sie, nun eindringlicher, denn sie spürte, wie ein Gefühl der Angst sie befiel.
»Na ja, um den Namen Madeleine ist ein Herz gemalt.«
»Ein Herz?« Ihr Mund fühlte sich mit einem Mal trocken an. »Das ist unmöglich! Meine Tochter ist noch ein Teenager. Wie alt ist Ihr Vater?«
»Sechsundsechzig.«
Helen spürte, wie Übelkeit in ihr aufstieg. Wieder blieb es in der Leitung für einige Sekunden still. »Hallo?«, rief sie in das Mikrofon. »Sind Sie noch da?«
»Da ist noch etwas notiert, hinter dem Namen Ihrer Tochter«, meldete er sich zurück.
»Was?« Helen bemerkte, dass ihre Stimme nun zitterte.
»Ich kann es nicht richtig deuten, es ist auf Polnisch geschrieben …«
»Sagen Sie schon! Bitte …« Sie hatte diese Aufforderung lauter und fordernder ausgesprochen als beabsichtigt. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie, wie eine Frau mit einem Kinderwagen sich erschrocken nach ihr umdrehte.
»Da steht unter dem Namen Ihrer Tochter Piêkna i Bestia.«
»Und das heißt …?«
»Mein Polnisch ist nicht das Beste«, wich ihr Gesprächspartner erneut aus. »Aber wenn ich mich nicht täusche, bedeutet das so viel wie: Die Schöne und das Biest.«
»Die Schöne und das Biest?«, wiederholte Helen ungläubig und spürte, wie ihr flau wurde. »Was zum Teufel soll das bedeuten?« Sie hörte ihren Gesprächspartner einmal laut ein- und ausatmen.
»Haben Sie in den vergangenen Jahren einmal ein Foto meines Vaters gesehen?«
»Nein.« Zumindest konnte sie sich nicht daran erinnern.
»Ich schlage vor, Sie gehen jetzt zu Ihrer Tochter und fragen sie, ob sie meinen Vater wirklich nicht kennt. Und wenn doch, rufen Sie mich wieder an. Ich sende Ihnen meine Telefonnummer gleich per SMS. Wollen wir es so machen?«
»Ich …« Helen stockte. Sie wusste nicht, was sie antworten sollte. »Ich verstehe immer noch nicht …« Sie verstummte.
»Fragen Sie Ihre Tochter, bitte!«
»Okay, ich werde sie fragen …«
»Danke. Bis später dann – vielleicht«, verabschiedete sich ihr Gesprächspartner.
Helen steuerte mit weichen Knien eine leere Parkbank an, ließ sich darauf nieder und starrte auf das Display ihres Handys. Sie überlegte kurz, dann wählte sie erneut Madeleines Telefonnummer. Nach mehreren Freizeichen meldete sich wieder nur die Mailbox. Helens Besorgnis wuchs. Nervös suchte sie in ihren Kontakten nach der Nummer der Klinik und tippte auf das grüne Hörer-Symbol.
Die leuchtenden Rot- und Orangetöne um sie herum wirkten mit einem Mal nicht mehr romantisch, sondern bedrohlich.
7
São Paulo
Ihre Mandibeln klaubten die Pollen aus den Staubbeuteln der Blüte. Dann hob sie wieder einige Zentimeter ab und schwebte wie ein Helikopter über der Blüte. Emsig begann die Biene, mithilfe der Bürsten an ihren Hinterbeinen die mehlartige Pollenmasse aus ihrem Pelz zu putzen. Der Kamm am unteren Ende der Schienbeine beförderte den Blütenstaub zum Pollenhöschen an der Außenseite ihrer gegenüberliegenden Beine, wo das so geschnürte Pollenpaket bedrohlich bröselte. Rasch gab sie einen Tropfen aus ihrer Honigblase ab und reichte ihn mit ihren Vorderbeinen nach hinten weiter. Angefeuchtet mit der klebrigen Flüssigkeit, fügten die Pollen sich zu einem Teig, der nun sicher im Körbchen haften blieb. Wegen der Schwere der Last erhöhte sie die Anzahl ihrer Flügelschläge und drehte ab, um mit ihrer Ernte in den Stock zurückzukehren. Ein weiterer Kirschbaum versperrte ihr den Weg; deshalb musste sie eine große Kurve fliegen. Sie versuchte, an Höhe zu gewinnen, sackte jedoch immer weiter ab. Eine unsichtbare Kraft brachte sie aus dem Gleichgewicht, und sie schlug mit dem Hinterleib gegen einen Zweig mit zartrosafarbenen Blüten. Taumelnd rang sie um Stabilität, doch die schwere Fracht zog sie hinab wie Blei. Hektisch schaufelten die Flügel Luftschichten zur Seite. Das Summen schwoll zu einem hohen Ton an, der beinahe wie ein Schrei klang. Mit einem Mal stockte die Flügelbewegung, und die Beine streckten sich aus, als suchten sie nach Halt. Das Luftpolster, auf dem die Biene eben noch zu schweben schien, verschwand wie von Zauberhand, und sie stürzte senkrecht, den Hinterleib voran, zu Boden, wo sie am Fuß des Baumes auf dem Rücken liegen blieb.
Einige Sekunden lang zuckte sie noch, dann verharrte sie plötzlich still und leblos, die gefalteten Beinchen gen Himmel, wie zum Gebet.
8
New York
Die letzte Operation des Tages hatte deutlich länger gedauert als erwartet. Bevor sie in den Feierabend verschwunden war, hatte Susan, seine Assistentin, noch das Abendessen mit Dr. Ivory, einem der Gesellschafter der Schönheitsklinik, abgesagt. So hatte Dr. Ahmed Rahmani nun einen freien Abend. Er hatte sich entschieden, ein paar überfällige Büroarbeiten zu erledigen. In seiner Schublade war er auf eine Packung Sesamcracker gestoßen, die schon merkwürdig weich, aber doch noch genießbar waren. Neben ihm dampfte im schummrigen Licht der Schreibtischlampe eine Tasse Kräutertee, ansonsten war es stockdunkel in seinem Büro.
Seine Augen brannten, wie so oft, wenn er den ganzen Tag über im grellen Schein der OP-Lampen operiert hatte. Er brütete über einem Vortrag, den er in der nächsten Woche auf einem Kongress in London halten musste. Doch er war unkonzentriert. Immer wieder öffnete er zwischendurch den Browser und surfte im Internet. Er überflog die neuesten Nachrichten. Weiterhin fehlte jede Spur von den in Mexiko entführten Schönheitsköniginnen. Der Reporter vermutete, dass hinter den Kulissen um ein hohes Lösegeld verhandelt wurde. Dr. Rahmani checkte die Facebook-Seite der Klinik, auf der eine Patientin sich vor einer Stunde mit einem schön anzusehenden Foto für die Operation bedankte. Dann landete er auf einem Dating-Portal, auf dem er sich vor einigen Wochen angemeldet hatte. Es fehlte ihm als erfolgreichem plastischen Chirurgen nicht an Angeboten junger Frauen, die sich nichts sehnlicher wünschten, als dass er Hand an ihre Oberweite legte. Dabei ging es ihnen jedoch weniger um seinen leidlich trainierten Körper, als vielmehr darum, durch ein paar Nächte mit ihm die immer noch beachtlichen Kosten einer Brustvergrößerung zu sparen. Lange hatte ihm das nichts ausgemacht, hatte er für Sex operiert. Eine besondere Art von Vorher-Nachher-Test. Doch nun hatte er ein Alter erreicht, in dem sich entschied, ob er in diesem Leben noch eine Familie gründen würde oder nicht. Auch für ihn war es nicht einfach, eine Frau losgelöst von seiner professionellen Sichtweise zu betrachten. Sein Geschäft bestand darin, Frauen schöner zu machen. Manchmal auch erotischer. Er formte das zur Perfektion, was die Natur nur unzulänglich geschaffen hatte. Wie sollte es ihm da möglich sein, eine Frau aufrichtig zu bewundern, vielleicht sogar zu lieben, deren Nase einen Höcker hatte, die mehr Fett mit sich herumtrug als nötig?
Ein Klingeln riss ihn aus seinen Gedanken. Auf dem Bildschirm öffnete sich ein Fenster. Mona, stand dort.
Mona war eine junge Frau, die er in einem Internetforum kennengelernt und mit der er sich bereits ein paar Mal hin- und hergeschrieben hatte. In der vergangenen Woche hatten sie zum ersten Mal auch über die Webkamera gechattet. Mona war unglaublich sexy und offensiv. Zugegebenermaßen nicht die Frau, mit der er eine Familie gründen wollte, aber das konnte auch noch bis nachher warten. Rasch fuhr er sich mit den Händen durch die schwarzen Locken, überprüfte den Kragen seines Hemdes. Dann drückte er auf Annehmen.
In der Mitte des Monitors baute sich eine Verbindung auf, schließlich erschien ein Bild. Was er sah, beschleunigte sofort seinen Puls. Mona lag bäuchlings auf einem Bett; das Kinn in die Hände gestützt, schaute sie in die Kamera ihres Laptops. Über ihre Schultern hinweg sah er, dass sie nichts anhatte außer einem BH und einem schwarzen Höschen.
»Ich hatte Sehnsucht«, tönte ihre samtweiche Stimme aus den Lautsprechern seines Monitors. »Und fühlte mich so allein.« Ihre Lippen deuteten einen Kussmund an.
»Ich bin noch im Büro …«, antwortete er, um überhaupt etwas zu sagen. War er tatsächlich verlegen?
»Irgendwie war mir so … heiß«, fuhr Mona fort und lächelte. Ihre Zähne waren perfekt.
»Das sehe ich …«, bemerkte er knapp.
»Hast du was dagegen, wenn ich es mir ein wenig bequem mache?«, fragte sie. Das Bild wackelte, kurz war eine Deckenleuchte zu sehen, dann eine Kommode, ein Teppichboden. Es raschelte, endlich kam wieder Mona ins Bild. Jetzt lehnte sie an einem Turm aus Bettwäsche. Die Kamera filmte sie von unten. Tatsächlich trug sie nichts außer der Unterwäsche. Schwarz mit Rüschen am Rand. Sie sah umwerfend aus.
Er spürte, wie auch ihm heiß wurde. Er reckte den Kopf und blickte hinüber zur geschlossenen Bürotür. Eine unsinnige Geste. Um diese Zeit war er allein in diesem Teil der Klinik. »Ich mache so etwas normalerweise nicht«, sagte sie nun und lächelte scheu. »Aber du löst irgendetwas in mir aus.«
Er musste lächeln. Mit Sicherheit war sie nicht so unschuldig, wie sie gerade tat. Umso besser.
»Was meinst du genau mit so etwas?«, fragte er. Seine anfängliche Scham verflog langsam.
»So etwas!«, antwortete sie, griff sich mit der rechten Hand in den BH und begann, ihre Brust zu streicheln. Ihre andere Hand wanderte langsam in Richtung ihres Bauchnabels. Dabei blickte sie auffordernd in die Kamera.
Er spürte in seinem Schoß deutliche Anzeichen von Erregung. Vielleicht war sie auch betrunken? Na, wenn schon, ein wenig Entspannung konnte er nach diesem Arbeitstag gebrauchen.
Plötzlich hielt sie inne und lächelte triumphierend. »Du zuerst!«, sagte sie und kicherte.
»Ich bin im Büro …«, wich er aus.
»Das macht mich an«, entgegnete sie keck und leckte sich mit der Zunge über die Lippen. »Stell dir vor, ich sitze auf deinem Schreibtisch.« Sie spreizte langsam die Beine.
Er hielt die Luft an.
»Zieh dich aus!«, befahl sie.
Er schaute sich um. Die Jalousien in seinem Rücken waren heruntergelassen.
»Sonst ziehe ich mich auch wieder an!«, klang es beleidigt vom Bildschirm. Ihre Hand griff nach der Bettdecke und zog einen Zipfel über ihre nackte Haut.
»Schon gut!«, sagte er etwas hektischer als beabsichtigt. Umständlich knöpfte er sein Hemd auf, zog es aus der Hose und ließ es schließlich neben sich gleiten. Zufrieden sah er, wie auch sie sich wieder des Stückes Decke entledigte.
»Jetzt die Hose!«, hauchte sie. Ihre Hand fuhr dabei in ihren Slip. Er erhob sich, öffnete den Gürtel und ließ seine Anzughose samt Boxershorts zu Boden fallen. Mit den Füßen löste er sie von seinen Knöcheln. Jetzt, da er nur noch in Socken auf seinem Bürostuhl saß, kam er sich schon ein wenig komisch vor. Ein sanftes Stöhnen drang aus seinem Computer, und was er jetzt sah, ließ ihn seine letzten Zweifel vergessen.
»Und nun … berühr dich!«, verlangte Mona. »Siehst du das hier?«
Er gehorchte. Ihr Verlangen erregte ihn.
»Stell die Lampe so, dass ich ihn sehen kann!«
Er erhob sich und bog den Schirm der Bürolampe so, dass der Schein die Sitzfläche des Bürostuhls erleuchtete. Dann setzte er sich wieder.
»Prächtig!«, lobte sie mit einem tiefen Seufzer.
Lustvoll beobachtete er, wie sie ihren BH öffnete. Nicht schlecht, dachte er. Vielleicht könnten sie ein paar Gramm Silikon mehr vertragen.
»Bist du geil?«, fragte sie.
»Ich bin geil«, bestätigte er unverzüglich und stöhnte wie zum Beweis laut auf. Seine rechte Hand massierte mittlerweile sein bestes Stück.
»Und nun sag deinen Namen!«, verlangte sie in schmachtendem Ton.
Dieser Wunsch war ihr leicht zu erfüllen. »Ahmed Rahmani!«
»Doktor Rahmani?«, wollte sie wissen, während ihr Körper sich durchbog.
»Dr. Ahmed Rahmani«, bestätigte er keuchend. Kaum hatte er seinen Namen ausgesprochen, stutzte er. »Warum?«, setzte er an, da brach die Leitung plötzlich zusammen. Das Fenster mit Mona war verschwunden. Einen Augenblick blieb er nackt, wie er war, vor dem Bildschirm sitzen und hoffte, dass sich das Fenster jeden Augenblick wieder öffnen würde. Er fühlte sich, als hätte seine Partnerin sich mitten beim Sex unter ihm in Luft aufgelöst.
Nachdem er eine lange Minute regungslos vor dem Monitor verharrt hatte, begann er zu frieren. Um ihn herum lagen seine Kleidungsstücke verstreut. Je länger er so dasaß, desto mehr kam er sich vor, als erwachte er aus einem Rausch.
Was hatte er da gerade nur getan?
Mit einem Mal erschien es ihm so lächerlich. Er würde den Kontakt mit ihr abbrechen. Auch wenn sie jetzt noch einmal versuchen sollte, ihn zu erreichen, er würde nicht mehr antworten. Sein Kopf begann bei der Vorstellung zu glühen, dass er eben noch vor einer ihm eigentlich völlig Fremden masturbiert hatte.
Er war kein Teenager mehr.
Ahmed Rahmani bückte sich, hob die Hose auf und versuchte, seine Shorts aus deren Inneren zu schälen.
Vom Monitor hörte er plötzlich ein Stöhnen. Das klingt wie ich, dachte er. Er hob den Kopf. Dort, wo eben noch Mona sich in einem Fenster auf dem Bildschirm gerekelt hatte, sah er nun … sich selbst.
»Ich bin geil!«, hörte er sich sagen. Das fahle Licht seiner Bürolampe beleuchtete ihn, wie er zurückgelehnt auf dem Bürostuhl saß, ganz entblößt, außer einem Paar schwarzer Socken, seine Hand in seinem Schritt.
»Dr. Ahmed Rahmani!«, keuchte er nun direkt in die Kamera.
Plötzlich blieb das Bild wie eingefroren stehen und zeigte ihn in dieser überaus peinlichen Pose als Standbild.
Sein Herz begann wie wild zu klopfen.
»Was zum Teufel …«, fluchte er. In diesem Augenblick öffnete sich ein weiteres Fenster auf dem Bildschirm, in dem ein kleiner Cursor wild blinkte. Der Cursor begann, wie von Geisterhand Buchstaben, dann Worte zu schreiben.
Er ließ die Hose zu Boden fallen und beugte sich vor, um zu lesen.
Dieses kleine Video mit Ihnen als Hauptdarsteller wird in weniger als zwei Minuten an alle Ihre E-Mail- und Facebook-Kontakte verteilt. Es sei denn, Sie willigen ein, uns einen Gefallen zu tun. Können wir auf Ihre Unterstützung zählen?
Der Cursor blieb blinkend hinter dem Fragezeichen stehen.
Ungläubig starrte Ahmed Rahmani auf den Bildschirm. Was sollte er tun? All seine E-Mail-Kontakte? Darunter befanden sich all seine Kollegen und, noch schlimmer, all seine Kolleginnen. Ein Großteil seiner Patienten und Patientinnen. Seine Familie. Sogar seine Mutter.
Plötzlich bewegte der Cursor sich wieder.
Sagen Sie laut Ja, wenn Sie uns unterstützen!
Er blickte sich um, als stünde jemand hinter ihm. Sein Blick fiel auf das kleine Loch der Kamera, die oben im Monitor eingebaut war. Ob sie ihn noch immer …
»Ja!«, krächzte er. Sein Mund fühlte sich staubtrocken an, als hätte er eine Scheibe altes, geröstetes Toastbrot gekaut.
Er wartete, nichts geschah.
»Ja!!«, rief er noch einmal. Diesmal schrie er. Panik stieg in ihm auf.
Der Cursor bewegte sich erneut.
»Gut. Sie hören von uns. Stichwort ›Mona‹. Es ist für eine gute Sache«, las er laut ab. Der Cursor stockte. Dann setzte er zu einem weiteren Satz an. »Entspannen Sie sich. Vielleicht beenden Sie, was Sie begonnen haben.« Der Cursor schloss mit einem Doppelpunkt, einem Gedankenstrich und einer Klammer: :-)
Das Fenster verschwand und ein Bild erschien. Er stieß einen spitzen Schrei aus. Es zeigte das Foto einer nackten Frau, die große Ähnlichkeit mit Mona hatte. Jedoch war ihr Körper auf bizarre Weise entstellt. Fast wirkte er wie eine Karikatur. Die Augen verschwollen, die Nase grotesk verzerrt. Die Brüste asymmetrisch, eine prall, als würde sie jeden Moment platzen, die andere schlaff wie die einer alten Frau. Der Bauch einer Schwangeren, die Hüften ausgestopft. Die Beine waren merkwürdig verdreht und überzogen mit Haut, so ledrig wie die eines Elefanten. Ihm wurde schlecht.
Seine Hand fuhr hinter den Monitor, tastete nach dem Ausschalter und drückte ihn so lange, bis das Bild von einer Sekunde zur anderen erlosch. Mit der anderen Hand löschte er das Licht der Schreibtischlampe.
Kaum war er in vollkommener Dunkelheit versunken, ließ er sich schwer atmend rückwärts auf den Bürostuhl fallen. Er fühlte sich unendlich erschöpft. Das Leder der Sitzfläche klebte an seiner nackten Haut. In seinen Ohren rauschte das Blut. Angst, Scham und Verzweiflung stiegen in ihm auf.
Ihm kamen die letzten Zeilen auf dem Bildschirm wieder in den Sinn. Für eine gute Sache …
Seine Beine zitterten vor Kälte. Was immer man von ihm verlangen würde, damit diese Aufnahmen von ihm nicht veröffentlicht wurden, er war sich sicher, dass es nichts Gutes sein würde.
9
Acapulco
Greg Millner saß im Büro von Rafael Herrera und war genervt. Genervt von den Fliegen, die aus unerklärlichem Grund im Polizeirevier in Schwärmen unterwegs waren – er hoffte, dies hatte nichts mit der Pathologie im Keller zu tun –, und genervt von der Hitze. Auch um diese Jahreszeit war es in Acapulco drückend heiß, und die Klimaanlage schien ihren Geist aufgegeben zu haben.
Es war sein erster Einsatz nach »der Sache« in Brasilien. Unwillkürlich fasste er sich an die Wange und strich über das vernarbte Gewebe, das sich mittlerweile über dem Einschussloch gebildet hatte. Mit der Zunge strich er über die Reihe falscher Backenzähne. Wieder durchfuhr ihn dieser Schmerz. Phantomschmerzen, hatte der Arzt ihm erläutert. Dennoch warf er sich jeden Morgen ein paar der kleinen roten Pillen ein. Den Schmerztabletten war es vollkommen egal, ob sie Phantomschmerzen oder echte Schmerzen bekämpfen sollten. Nahm er sie nicht, war es nicht auszuhalten.