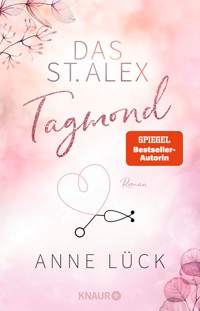2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auf den Flügeln des Lebens: eine junge Frau findet ihren ganz eigenen Weg. Johanna kann seit ihrer Kindheit den Tod von Menschen mittels einer Berührung sehen. Als sie auf diese Weise ihre einzige Freundin Carla verliert, ist Johanna vollkommen am Ende. Sie begeht Selbstmord. Auf der Schwelle zwischen Leben und Tod trifft sie auf Than – einen Todesengel, der ihr anbietet, ihr Leben ebenfalls als Todesengel fortzuführen. Als Johanna das Angebot annimmt, ahnt sie noch nicht im Geringsten, was sie erwarten wird – die Intrigen der Engel, eine neue Liebe und eine Freundschaft, die weit über den Tod hinausgeht. "Anne Lück hat es geschafft mich zu fesseln, mich mitfiebern, mich lachen und ein paar Tränen vergießen zu lassen - und mich oft einfach nur aus dem Alltag gerissen. Dafür danke ich dieser Autorin!" (Lynn Siezinger auf amazon.de)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die AutorinAnne Lück wurde 1991 in Sachsen-Anhalt geboren. Nach einem angefangenen Studium zog es sie nach München, wo sie derzeit eine Ausbildung zur Krankenschwester macht. Schon im Kindergarten wurden ihre Geschichten vor dem Mittagsschlaf erzählt, mit sechs Jahren schrieb sie ihre erste Geschichte. Seit ihrem dreizehnten Lebensjahr widmet sie sich schließlich voll und ganz ihrem Lieblingsgenre: der Urban Fantasy. 2013 erschien ihr erstes Buch: Endless Life – Der Weg des Unsterblichen, der erste Band der Endless Life-Trilogie.
Das BuchJohanna kann seit ihrer Kindheit den Tod von Menschen mittels einer Berührung sehen. Als sie auf diese Weise ihre einzige Freundin Carla verliert, ist Johanna vollkommen am Ende. Sie begeht Selbstmord.
Auf der Schwelle zwischen Leben und Tod trifft sie auf Than – einen Todesengel, der ihr anbietet, ihr Leben ebenfalls als Todesengel fortzuführen. Als Johanna das Angebot annimmt, ahnt sie noch nicht im Geringsten, was sie erwarten wird – die Intrigen der Engel, eine neue Liebe und eine Freundschaft, die weit über den Tod hinausgeht.
Anne Lück
Das Mädchen mit den Engelshänden
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Originalausgabe bei Forever Forever ist ein Digitalverlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Juli 2014 © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014 Umschlaggestaltung: Zero Werbeagentur, München Titelabbildung: © FinePic®
ISBN 978-3-95818-000-0
Teil 1
Dunkle Ahnung
Prolog
Es war ein regnerischer Sonntag und damit eigentlich kein Tag, an dem Anke Thomas ihre Wohnung verließ. Normalerweise pflegte sie an ihren freien Tagen das Ritual, ihre Beine hochzulegen und bei einer Tasse Tee den Nachmittagsklatsch im Fernsehen anzuschauen. Aber heute war sie doch aufgestanden. Die Umstände verlangten es so.
Auf der Straße befanden sich trotz des schlechten Wetters jede Menge Menschen. Mit der schwarzen Kleidung, die eigentlich so gar nicht ihr Stil war, fiel Anke noch mehr auf, als sie es sonst tat. Aber auch diese Sache wurde von den Umständen gefordert. Zwar war es schon lange keine Mode mehr – in Ankes Familie hatte man jedoch schon immer schwarze Kleidung getragen, wenn jemand gestorben war.
Die Straße, in die die ältere Frau nun einbog, lag in einer Gegend, in der sie noch nie zuvor gewesen war. Sie war verschrien als eine Ecke der Stadt, in der viele Verbrechen passierten, und Anke drückte ängstlich ihre Handtasche an sich. Sie hatte hier überhaupt nicht hingewollt, und wieder einmal fragte sie sich, warum man sie herbeordert hatte.
Vor einem großen, backsteinfarbenen Gebäude blieb Anke stehen, rückte unsicher ihre runde Brille zurecht. Nummer 44. Hier war sie richtig, diese Adresse hatte der Mann am Telefon ihr genannt. Auf dem großen, weißen Schild neben der Tür war zu lesen, dass es sich um ein Therapiezentrum handelte. Eigentlich hatte Anke große Lust, sich einfach wieder umzudrehen, den weiten Weg nach Hause zu laufen und diese Sache zu vergessen, wie sie es schon die ganze Zeit über versucht hatte. Und es wäre ihr sicher auch gelungen, wäre nicht besagter unheilvoller Anruf gekommen. Hier stand sie nun, unsicher, was sie tun sollte.
In diesem Moment ging die dunkle Metalltür auf, und ein Mann trat aus dem Gebäude. Er war jünger als Anke, vielleicht Ende zwanzig, Anfang dreißig. Seine Augen waren müde und wiesen tiefe Spuren schlafloser Nächte auf, vieler schlafloser Nächte. Auch sein Dreitagebart und sein nicht mehr so frisch wirkendes Hemd zeugten davon, dass er wohl keine Gedanken an die alltäglichen Dinge verschwendete.
Auch wenn es Anke wahnsinnig widerstrebte, einen derart schmuddeligen Menschen anzusprechen, der noch dazu aus einem solchen Gebäude herauskam, ging sie ein paar Schritte auf ihn zu.
Das Klacken ihrer Schuhe auf dem Asphalt verriet sie, und der Mann hob den Kopf. Seine wasserblauen Augen sahen unendlich traurig aus, auch wenn er sich jetzt an einem gezwungenen Lächeln versuchte. »Kann ich Ihnen helfen?«
Seine Stimme klang, wie Anke vermutet hatte: rau, angespannt und genauso traurig, wie es seine Augen waren. Aber das Wichtigste war, dass sie seine Stimme erkannte.
»Davon gehe ich aus«, antwortete Anke und konnte einen leicht pikierten Unterton nicht unterdrücken. »Ich denke, ich gehe richtig in der Annahme, dass wir telefoniert haben, oder? Sie sind doch Herr Karen?«
Schon leuchtete etwas in den Augen des Mannes auf. »Ja, da haben Sie Recht. Dann müssen Sie … Johannas Tante sein, nicht wahr?«
Sofort, um noch mehr unheilvollen Begegnungen vorzubeugen, schrieb Anke ein unsichtbares Kreuz in die Luft vor ihrem Gesicht. Dann zischte sie scharf: »Anke Thomas. Sie wollten mich sprechen?«
Etwas verwirrt wirkend von ihrer kalten Art nickte Herr Karen. »Ja, das ist richtig. Aber lassen Sie uns solche Dinge nicht hier draußen besprechen.« Er warf die Zigarette, die er sich eben angezündet hatte, auf den Boden und trat sie gedankenversunken aus, auch wenn sie mitten in einer Pfütze gelandet war. Dann lächelte er unsicher. »Wenn Sie mir bitte folgen möchten, Frau Thomas?«
»Eigentlich nicht, aber was bleibt mir denn jetzt noch für eine Wahl?«, brummte Anke und stolzierte hochnäsig durch die aufgehaltene Tür.
Im Inneren trat man sofort in kleines Wartezimmer, in dem ein paar Menschen auf bunten Plastikstühlen saßen, in Zeitschriften blätterten und aufsahen, als sie eintrat.
Anke Thomas wünschte sich in diesem Moment nichts sehnlicher, als die Zeit zurückdrehen zu können. Hätte sie diesen Anruf doch nur ignoriert! Wäre sie doch gar nicht erst ans Telefon gegangen, als es an ihrem freien Tag geklingelt hatte! Wenn die Leute aus ihrer Nachbarschaft hörten, dass sie sich an einem Sonntagnachmittag in einer Nervenheilanstalt aufhielt … was würden sie reden! Wahrscheinlich würde jeder denken, dass sie aufgrund des Todes ihrer Nichte nicht mehr ganz richtig im Kopf war, und Anke wollte sich gar nicht vorstellen, was das für furchtbare soziale Folgen nach sich zog!
»Hier entlang, Frau Thomas…« Herr Karen wies ihr die Richtung und lief dann den Flur entlang.
Anke Thomas schnaubte. Gut, der Typ hatte wenigstens ein paar Manieren. Leiden konnte sie ihn trotzdem nicht, immerhin war er schuld an ihrer derzeitigen Misere. Mit kleinen, aber energischen Schritten folgte sie ihm, nicht ohne den Menschen im Wartezimmer noch einen abschätzigen Blick zuzuwerfen. Armes, geisteskrankes Gesindel!
Herr Karen steuerte ein kleines Büro am Ende des Ganges an, öffnete die Tür und ließ Anke hinein. Sie sah sich einen Augenblick um, auch wenn es in diesem spärlich eingerichteten Zimmer nicht sonderlich viel zu sehen gab. Nur einen Schreibtisch, zwei Stühle und ein Beistelltischchen mit einer halb verwelkten Blume darauf, mit der wohl jemand krampfhaft versucht hatte, etwas Atmosphäre zu schaffen.
Anke unterdrückte ein verächtliches Lachen, bevor sie auf dem Stuhl gegenüber dem Schreibtisch Platz nahm und die kleine schwarze Tasche auf ihrem Schoß abstellte.
Herr Karen nahm nicht sofort Platz, sondern lief zuerst zum Fenster und sah kurz hinaus. Die ganze Zeit knetete er dabei seine Hände, als müsste er sich einen Moment lang sammeln. Dann fuhr er zu Anke herum und versuchte es erneut mit einem Lächeln. »Wie unhöflich von mir. Ich sollte Ihnen womöglich einen Tee oder einen Kaffee anbieten. Ich bin in letzter Zeit etwas durch den Wind, Sie verstehen …«
Natürlich wollte Anke einen Tee trinken! Auf ihrer heimischen Couch! »Machen Sie sich keine Umstände, Herr Karen, eine gemütlichere Atmosphäre können Sie kaum schaffen.«
Herr Karen bemerkte wohl ihren Blick über das Mobiliar seines Zimmers, denn er räusperte sich verlegen. »Ich muss mich auch dafür entschuldigen, dass es hier momentan nicht so gemütlich aussieht, wie man es wahrscheinlich bei einem Kindertherapeuten erwartet. Aber ich ziehe gerade aus, die Kündigung läuft bereits.«
»Ach, Ihnen wurde gekündigt?«, fragte Anke Thomas mit gelangweilter Stimme, die sofort suggerierte, dass es sie nicht im Geringsten interessierte. Auch Herr Karen schien das sofort zu merken, und dazu brauchte er wahrscheinlich nichts von dem Wissen über Psychologie, die er fünf Jahre lang studiert hatte. An dieser Stelle kam er mit ein wenig Smalltalk nicht weit. Es gab also keinen anderen Weg, als endlich aufs Ganze zu gehen. Herr Karen setzte sich auf seinen Schreibtischstuhl und stützte das Gesicht auf die zusammengefalteten Hände. »Der Verlust Ihrer Nichte tut mir wirklich leid, Frau Thomas. Es war sicher ein Schock für Sie.«
Anke ließ einen missbilligenden Laut hören. »Herr Karen, nun tun Sie doch nicht so. Das Mädchen, Gott sei seiner Seele gnädig, war ein psychisches Wrack, und das wissen Sie doch sicher am besten. Für niemanden, auch nicht für mich, kam ihr Selbstmord überraschend.«
Bei dieser eiskalten Antwort musste Herr Karen schlucken. Er hatte in seiner Laufbahn schon viele Gespräche mit Erziehungsberechtigten von Selbstmördern geführt. Er hatte Wut erlebt, Tränen, Verzweiflung und Unverständnis. Aber noch nie hatte jemand so abgeklärt auf den Tod eines nahen Familienmitgliedes reagiert. »Nun, anscheinend kam ihr Tod für mich überraschender als für Sie, Frau Thomas. Meiner Meinung nach hatte sie sich bereits auf dem Weg der Besserung befunden.«
»Weg der Besserung?« Anke lachte auf. »Ich erzähle Ihnen mal etwas, mein Lieber, es gibt Krankheiten und Leiden, die niemand bessern kann, und ihre gehörte dazu.«
Mit offensichtlicher Überraschung sah Herr Karen die Frau an, er schien gar nichts mehr zu verstehen. »Nun, Frau Thomas, die Heilungsquote von Kindern, die ihre Eltern verloren haben, steht gar nicht mal so schlecht, und soweit ich weiß …«
Doch Anke Thomas unterbrach sein Gerede mit einer wirschen Handbewegung. »Ich rede nicht von irgendwelchen Traumata, die das Kind angeblich erlitten haben soll.« Ein geheimnisvolles Lächeln umspielte ihren faltigen Mund. »Das Kind hatte größere Probleme als das, glauben Sie mir …«
Herr Karen musste sich anscheinend zusammenreißen, denn ihre Worte schienen etwas in ihm auszulösen. Nach ein paar Sekunden lächelte er nur müde. »Johanna hat mir des Öfteren erzählt, dass Sie eine dunkle, böse Seite an ihr gesehen haben …«
»Und die hatte sie!«, schoss Anke Thomas sofort wütend heraus. »Glauben Sie mir, ich bin nicht verrückt, im Gegensatz zu ihr. An ihr klebte, seit ich sie kannte, der Schatten des Teufels!«
Herr Karen konnte es gerade noch so unterdrücken, laut loszulachen oder aufzuseufzen. »Nun, wir vertreten offensichtlich verschiedene Meinungen, lassen Sie uns nicht darüber streiten.«
»Das ist keine Frage der Weltansicht, Herr Karen.« Anke Thomas schnaubte. »Aber nur aus reiner Neugierde … Warum haben Sie mich dann herbeordert? Was war denn so wichtig?«
»Ja, natürlich.« Herr Karen wischte sich einmal über das Gesicht, wahrscheinlich, um seine Gedanken wieder zu ordnen. »Auch wenn es mittlerweile nicht mehr mein Job ist, ich hatte Johanna gern. Und mir schien sie in letzter Zeit auf dem Weg der Heilung, wie ich bereits sagte. Sie schien sehr gelöst und glücklich. Nicht zuletzt, weil ich sie in ein soziales Projekt berufen hatte, um sie mit einem Mädchen ihrer Altersklasse zusammenzustecken, das ebenfalls bei mir in Therapie war. Es sollte den Mädchen das Kontakteknüpfen zu anderen Menschen erleichtern.«
»Sie reden von dieser Carla, nicht wahr?« Frau Thomas schien ernsthaft bestürzt, denn ihre aufgemalten Augenbrauen schossen unnatürlich weit nach oben, in Richtung ihrer Stirn. »Sie war auch in Therapie bei Ihnen? Ich kann nicht glauben, dass sie auch so ein psychisches Wrack war wie meine Nichte …«
»Ihre Nichte war kein psychisches Wrack!« Herr Karen bemühte sich ernsthaft, nicht seine Geduld zu verlieren mit dieser Frau, aber es fiel ihm zusehends schwerer. »Ja, Carla war auch eine meiner Patientinnen, die beiden sollten sich gegenseitig bei ihrem Heilungsprozess unterstützen.«
»Na, das hat ja wunderbar geklappt, nicht wahr? Und was ist mit Carla, ist sie noch in Behandlung bei Ihnen?«
»Sie ist ebenfalls tot.« Herr Karen lockerte seine Krawatte, denn auf einmal schien es ihm im Zimmer immer heißer zu werden. »Sie starb am selben Tag wie Johanna, bei einem Verkehrsunfall.«
Anke Thomas schlug sich entsetzt eine Hand auf die Brust. »Oh mein Gott, das arme Kind. Sie war wirklich ein unglaublich lieber Mensch.« Sie sah den Mann über ihre Brille hinweg eine Spur argwöhnisch an. »Jetzt kann ich auch verstehen, warum Sie Ihren Job hinschmeißen. So gut können Sie es ja nicht gemacht haben, wenn Ihnen hier alle Patienten wegsterben, nicht wahr? Ich bin mir fast sicher, dass meine Nichte mit alledem irgendwas zu tun hat!«
»Wie können Sie so etwas sagen?« Eigentlich hatte Herr Karen nicht vorgehabt, laut zu werden. Aber nun musste er die flache Handfläche auf den Tisch schlagen.
Anke Thomas zuckte nicht erschrocken zusammen, sondern schielte wieder über den Rand ihrer silbernen Brille hinweg. »Nun beruhigen Sie sich schon wieder, guter Mann. Ich sage ja nur die Wahrheit.«
»Ich bezweifle, dass Johanna etwas mit Carlas Tod zu tun hat. Die beiden mochten sich und Ihre Nichte war ein guter Mensch, egal was Sie für ein furchtbares Bild von ihr haben.« Herr Karen rang nach Fassung und Luft, bevor er gezwungen ruhig fortfuhr: »Und ob Sie es glauben oder nicht, Johanna machte einen heilenden Eindruck auf mich. Deswegen würde mich persönlich interessieren, ob sie sich Ihnen gegenüber in letzter Zeit irgendwie merkwürdig verhalten hat. Haben Sie etwas mitbekommen?«
Anke Thomas überlegte kurz, dann zuckte sie mit den Schultern. »Ich kann nicht behaupten, dass meine Nichte sich irgendwann mal normal verhalten hat. Aber an dem Abend bevor ich sie gefunden habe, war sie tatsächlich noch merkwürdiger als sonst.«
Herr Karen schaute aufmerksam auf und konnte es nicht verhindern, wieder seine Hände zu kneten. »Was meinen Sie genau damit?«
»Naja, Carla war an dem Abend bei uns. Johanna hatte sich den ganzen Tag schon in ihr Zimmer zurückgezogen und wollte nicht einmal etwas essen. Carla war eine Weile bei ihr oben im Zimmer, und irgendwann kamen die beiden die Treppe runtergestürmt, als wäre der Teufel persönlich hinter ihnen her. Johanna hat die ganze Zeit darauf bestanden, bei Carla zu übernachten.« Anke schüttelte missbilligend den Kopf. »So etwas hatte ich bei ihr noch nie erlebt, das können Sie mir glauben. Aber naja, sie hatte ja auch nie Freunde. Also habe ich sie eben gehen gelassen. Wer weiß … vielleicht haben die beiden sich gestritten und … Naja, man soll ja nicht schlecht über Tote reden, nicht wahr?«
Herrn Karens Nackenhaare stellten sich gefährlich auf. »Danke Frau Thomas, Sie haben mir sehr weitergeholfen. Das war auch schon alles, was ich von Ihnen wissen wollte. Vielen Dank für Ihre kostbare Zeit.« Er konnte diese Frau keine Sekunde mehr ertragen. Er wollte nur noch, dass sie endlich verschwand und ihn in Ruhe ließ, am besten für den Rest seines Lebens.
»Oh, was für eine Erleichterung.« Frau Thomas sprang sofort auf, als hätte man sie jahrelang auf diesem Stuhl gefesselt. »Dann wünsche ich Ihnen noch ein paar schöne Wochen. Halten Sie sich lieber von psychisch kranken Menschen fern, Sie scheinen denen ja nicht sonderlich gut helfen zu können.«
Herr Karen stützte den Kopf in die Hände und stöhnte genervt auf. »Bitte gehen Sie, Frau Thomas, ich habe anscheinend unser beider Zeit verschwendet.«
»Sie sollten nicht so unhöflich sein«, schnaubte Anke Thomas und hängte sich ihre Tasche über den Arm. »Immerhin habe ich meinen freien Sonntag geopfert, um hier herzukommen und mir das Geschwafel eines Möchtegern-Therapeuten anzuhören. Denken Sie, das hätten viele Menschen auf sich genommen? Da irren Sie sich! Und meine Lieblingsserie habe ich auch verpasst.«
»Das tut mir wirklich unheimlich leid, Frau Thomas, ich hoffe, Sie werden diese Enttäuschung ohne große Folgen überstehen.« Herr Karen bemühte sich gar nicht mehr, seine Abneigung gegenüber dieser Frau zu verstecken. Wahrscheinlich ging ihr das genauso nahe wie der Tod ihrer Nichte, offensichtlich.
»Das hoffe ich auch. Und bevor ich‘s vergesse …« Anke Thomas kramte in ihrer Handtasche und warf dem Therapeuten einen weißen, verschlossenen Umschlag auf den Schreibtisch. »Wenn Sie meine Nichte so unglaublich vergötterten, werden Sie sich sicher auch freuen, dass sie Ihnen einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Einem zweitklassigen Therapeuten, nicht der Frau, die sie großgezogen und durchgefüttert hat!« Frau Thomas schien sich absolut in Rage geredet zu haben, denn auf ihrer Stirn traten bereits kleine blaue Äderchen hervor.
Herr Karen starrte fassungslos auf den Briefumschlag auf seinem Schreibtisch. »Warum haben Sie nicht vorher einen Brief erwähnt? Warum haben Sie in den Tagen nach ihrem Tod keinen Kontakt mit mir aufgenommen, um mir davon zu erzählen?«
»Ich will mit dem Leben von Johanna absolut nichts mehr zu tun haben und mit ihrem Tod noch viel weniger. Sie hat eine ziemliche Schande über mich gebracht mit ihrem egoistischen Selbstmord! Sie haben ja keine Ahnung, wie es ist, wenn die ganze Nachbarschaft über einen redet!« Sie richtete den kleinen schwarzen Hut auf ihrem Kopf, der bei ihrem zitterten Wutausbruch verrutscht war. »Bitte kontaktieren Sie mich nie wieder wegen dieser Sache! Guten Tag!« Und mit wütendem Kampfschritt verließ sie das Büro des Therapeuten.
Herr Karen konnte einfach nicht anders, als ihr mit offenem Mund hinterher zu starren. So eine unverfrorene Frau war ihm im Leben noch nicht untergekommen!
Langsam richtete er seinen Blick wieder auf den Umschlag, nahm ihn vorsichtig auf und zog dann den Zettel heraus. Es standen nur ein paar Sätze darauf, in einer ziemlich wackeligen Handschrift, wie in großer Pein geschrieben. Als Herr Karen sich den Brief durchgelesen hatte von dem Mädchen, das er seit zehn Jahren kannte, stiegen ihm die Tränen in die Augen, und er konnte nicht anders, als den Brief zu umklammern und still in seinem leeren Büro zu sitzen und lautlos zu weinen.
Kapitel 1
Immer und immer wieder ließ sie ihre Fingernägel ungeduldig gegen den Tisch klacken und starrte abwechselnd auf die Uhr und aus dem Fenster. Draußen schien die Sonne. Nicht, dass es Johanna etwas ausgemacht hätte, bei solch schönem Wetter drinnen zu sitzen. Immerhin verbrachte sie ihr halbes Leben im Inneren von Häusern, insbesondere in ihrem Zimmer. Aber es war eine absolut grausame Sache für sie, acht Stunden am Tag mit so vielen Leuten in einem kleinen Raum eingesperrt zu sein. Ihre Tante nannte es eine Sozialphobie, sie selbst wollte überhaupt keinen Namen dafür finden. Schließlich hatte sie keine Angst vor Menschen – sie hatte einfach keine Lust, Zeit mit ihnen zu verbringen.
Normalerweise wollte Johanna auch nichts von dem Leben ihrer Mitmenschen wissen, aber gerade in solchen Momenten – in denen sie sich so gar nicht auf den Unterricht konzentrieren konnte – ließ sich das leider nicht vermeiden.
»Oh Mann, ich kann morgen Abend nicht erwarten! Auf diesen Samstag freue ich mich seit Monaten!« Stefanie, die vor Johanna saß, schüttelte ihre blonde Mähne. Sie war eins dieser typischen, braun gebrannten Cheerleader-Mädchen, die man aus amerikanischen Teenie-Komödien kannte. Johanna konnte solche Menschen auf den Tod nicht ausstehen. Nicht, dass sie sonst viele Menschen leiden konnte, aber diese Art war ihr noch mehr zuwider als andere.
»Du hast es gut«, erwiderte Lisa, ein eher unscheinbares Mädchen mit braunen Haaren und einer Stimme, die ebenso nichtssagend wie die Wahl ihrer Klamotten war. »Meine Eltern lassen mich nicht auf die Party gehen. Sie sind der Meinung, dass da viel zu viele Jungs sind, die eh immer nur das eine wollen.«
Abgesehen von der Tatsache, dass wohl keiner der pubertierenden Jungen ihres Alters auf ein Mauerblümchen wie Lisa stehen würde, fand Johanna, dass ihre Eltern vollkommen Recht damit hatten. Sie kannte solche Partys vom Hörensagen, und wenn man den Gerüchten glauben konnte, wurden dank solcher Partys mehr Teenager schwanger als Frauen mittleren Alters in einem ganzen Jahr. Aber Johanna dachte gar nicht daran, sich einzumischen. Sollten diese dummen Mädchen doch machen, was sie wollten. Sie würde ihre enttäuschten und entsetzten Gesichter genießen, wenn sie etwas verdammt Dummes getan hatten. Mit einem leichten Lächeln stützte Johanna ihr Gesicht in ihre Hand und wandte sich wieder dem Fenster zu, nicht ohne den Gesprächen ihrer Mitschülerinnen weiter mit gespitzten Ohren zu lauschen.
»Oh mein Gott, das können dir deine Eltern doch nicht ernsthaft antun, das wird die Party des Jahrhunderts!«, gab Stefanie mit entsetzter Stimme von sich. Ein kurzer Blick in die Richtung des Mädchens zeigte Johanna ein Blitzen in seinen Augen. Was für ein Schmierentheater. Es tat ihr offensichtlich nicht im Geringsten leid. Sie sah sogar ziemlich schadenfroh aus, hinter ihrer bedauernden Miene. Freundschaft in diesen Zeiten hatte wohl das Ziel, seinen Nächsten immer zu übertreffen.
»Genau … und das Schlimmste ist, dass ich schon alles versucht habe, um sie zu überreden! Aber absolut keine Chance bei diesen Sturköpfen!« Lisa klemmte sich eine braune Haarsträhne hinter ihr Ohr und warf einen ganz kurzen Blick zu Johanna herüber. Dann senkte sie die Stimme zu einem Wispern, bevor sie weitersprach. Johanna konnte ihre Worte trotzdem hören, und sie jagten einen glühenden Schmerz durch ihre Brust. »Ich wünschte, ich könnte auch bei meiner Tante wohnen. Die würde mich ganz sicher zu allen Partys unserer Stadt gehen lassen, sie ist viel cooler als meine Eltern. Das Leben ist doch echt ungerecht.«
Ohne es zu wollen, krampfte Johanna ihre Hand um den Bleistift. Sie spürte, wie er unter ihrer Hand bereits gefährlich zu zittern begann und kurz vorm Brechen war. Ja, das Leben war ungerecht, aber davon hatten diese zwei Gören nicht die geringste Ahnung. Hätte Johanna die Wahl, würde sie wahrscheinlich auf jede Party der ganzen Welt verzichten, und das für ihr restliches Leben, um wieder bei ihren Eltern leben zu können. Sie hatte nie darum gebeten, bei ihrer Tante zu wohnen, die sich nicht im Geringsten für sie interessierte. Aber wie hatte Lisa so schön gesagt? Das Leben war eben ungerecht.
Endlich ertönte die heiß ersehnte Schulglocke, und so schnell sie konnte wischte Johanna ihre Sachen vom Tisch in ihre Schultasche. Sie wollte raus aus diesem oberflächlichen Geplänkel, weg von den Mädchen, die eine Party ihren Eltern vorzogen. In Momenten wie diesen wurde Johanna wieder bewusst, warum sie Menschen so abgrundtief hasste.
Wie immer war sie die Erste an der Tür, um hinauszustürmen, aber ihre Lehrerin machte ihr einen Strich durch die Rechnung: »Frau Thomas, nicht so hastig!«
Johanna blieb ruckartig stehen und spürte, wie der weiße Rock ihre Knie umschlang. Sie ahnte bereits, was jetzt kommen würde. Und das war nichts Gutes. Langsam drehte sie sich zu der älteren Dame in dem lächerlich geblümten Kleid um. Musste das genau heute sein, wo sie solche wichtigen Dinge geplant hatte?
»Ja, Frau Medi?« In Gedanken schickte Johanna mit ihrer Frage noch ein paar ziemlich unschöne Wörter mit, für die sie wahrscheinlich von der Schule geflogen wäre, hätte sie sie laut ausgesprochen.
»Warten Sie einen kleinen Moment, ich würde Sie gern unter vier Augen sprechen.« Frau Medi setzte sich wieder an ihren Schreibtisch und begann, in ihren Unterlagen zu stöbern.
Johanna stöhnte innerlich genervt auf, blieb aber an der Tür stehen. Die Mitschüler, die an ihr vorbeiliefen, warfen ihr abwechselnd fragende und ziemlich gehässige Blicke zu. Johanna war vollkommen egal, was diese Menschen von ihr dachten. Sie hatte über die Jahre gelernt, solche Blicke zu ignorieren, egal wie viel Hass und Abneigung darin lagen.
Nur Momente später war sie auch schon mit ihrer Lehrerin allein, die sofort ein lautes Seufzen hören ließ und über ihre Brille hinweg mitleidig und doch irgendwie eine Spur arrogant ansah. »Ich weiß langsam wirklich nicht mehr, was ich noch mit dir anfangen soll. Durch meinen Kurs ist noch nie ein Schüler durchgefallen, und du stehst jetzt kurz davor. Schon wieder eine Fünf in der Schularbeit? Was hast du dazu zu sagen?« Die Frau wedelte mit einem Blatt herum, sodass der Speck an ihrem Unterarm gefährlich zitterte.
Johanna hielt es für besser, einfach zu schweigen und die zu erwartende Predigt über sich ergehen zu lassen.
Eine Weile starrte Frau Medi sie abwartend an, dann seufzte sie theatralisch. »Mädchen, dein Welpenschutz ist schon lange vorbei. Es ist schlimm, dass du deine Eltern verloren hast, aber das ist jetzt zehn Jahre her! Also werd langsam damit fertig und erwachsen.«
Johanna hatte große Lust, der Frau etwas an den Kopf zu werfen. Ein paar der schlimmsten Worte, die sie in ihrem Wortschatz hatte. Oder einen Stuhl vielleicht. Stattdessen lächelte sie. »Glauben Sie mir, ich erwarte nicht den geringsten Welpenschutz, und das habe ich auch nie.«
»Ändere etwas an deinen Noten, Kind, sonst sehe ich für deine Zukunft ganz schwarz.« Frau Medi machte eine wegwerfende Handbewegung, um anzuzeigen, dass das Gespräch von ihrer Seite aus beendet war.
»Wenn es nach meiner Tante geht, ist meine Zukunft schwarz, egal wie meine Noten in der Schule aussehen. Haben Sie‘s noch nicht gehört? Ich bin doch die Hexe mit der schwarzen Seele …«, erklärte Johanna leise, mit einem bitteren Lächeln auf den Lippen. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und verließ mit schnellen Schritten das Klassenzimmer.
Eigentlich hatte sie es nicht sonderlich eilig, nach draußen zu kommen, wo sich wahrscheinlich noch ihre Mitschüler tummelten. Wenn sie ausnahmsweise mit Johanna sprachen, dann stellten sie nur unangenehme Fragen, und darauf konnte sie ganz gut verzichten. Jetzt fing auch ihr Wochenende an, und das wollte sie sich nicht vermiesen lassen. Wenn Johanna ganz ehrlich zu sich selbst war, hatte auch sie sich schon die ganze Woche darauf gefreut. Kaum dachte sie wieder daran, füllte sich ihr Bauch mit einem Gefühl gespannter Erwartung.
Die Sonne hatte die Luft vor dem Schulgebäude auf über zwanzig Grad angeheizt, der Himmel war blau und wolkenlos. Es war seit Wochen der erste schöne Tag, und Johanna reckte genießerisch die Nase nach oben, um den Duft des Sommers einzuatmen. Zu ihrer Erleichterung war der Schulhof bis auf wenige Jugendliche leer. An den Fahrradständern hatte sich eine kleine Gruppe Raucher versammelt, und am Schultor gaben sich die Mädchen Abschiedsküsschen auf die überschminkten Wangen.
Langsam lief Johanna über den gepflasterten Hof und bog hinter dem Tor links ab. In Richtung des Verbrecherviertels. Eigentlich hatte diese Gegend ihren Namen überhaupt nicht verdient. Johanna lief schon seit zehn Jahren jede Woche hindurch, und bis jetzt war ihr noch nie etwas passiert, noch nie hatte sie ein Verbrechen beobachten können. Wahrscheinlich hatte das Viertel seinen unheimlichen Namen wegen der vielen baufälligen Gebäude erhalten, die nicht gerade eine vertrauenerweckende Fassade besaßen. Die meisten von ihnen hatten eingeschlagene Fenster und waren mit hässlichen Graffiti besprüht.
Als Johanna jetzt an ihnen vorbeilief, bemerkte sie wieder ein aufgeregtes Kribbeln in ihrem Bauch. Im Gegensatz zu den meisten Menschen war sie sehr gern hier, sie ging sehr gern zu Sebastian.
Sebastian Karen war seit zehn Jahren ihr Therapeut. Wahrscheinlich war es für Außenstehende schwer nachzuvollziehen, dass sie gern zu ihm ging. Aber auch wenn keine Therapie bei ihr anzuschlagen schien, hatte Sebastian Johanna nie aufgegeben. Er war sich vollkommen sicher, dass er ihr irgendwann würde helfen können. Und dafür war ihm das Mädchen wirklich dankbar.
Der Grund für ihre Aufgeregtheit war aber nicht Sebastian selbst, sondern das, was er in der letzten Sitzung gesagt hatte. »Ich habe ein ganz tolles neues Projekt für dich geplant, und ich bin mir sicher, dass es dir endlich helfen wird. Du kannst dich drauf freuen, es wird spannend!« Und dabei hatten seine gutmütigen, blauen Augen geleuchtet. Wie immer, wenn er mal wieder eine seiner genialen Ideen hatte, die Johanna »ganz sicher« helfen würden.
Sie musste lächeln, als sie die nächste Ampel überquerte. Ihr war es vollkommen egal, dass Sebastians Methoden nicht anschlugen. Es tat gut zu wissen, dass sich jemand um sie sorgte und alles dafür tat, dass es ihr gut ging. Die Wahrheit war nämlich, dass normale Methoden eines Psychologen wahrscheinlich nie anschlagen würden. Über die ganzen zehn Jahre ihrer Therapie hatte Johanna Sebastian nämlich die Sache verschwiegen, die der eigentliche Grund für ihre Abneigung gegen soziale Bindungen war. Und die konnte Sebastian nicht heilen, wahrscheinlich konnte das niemand.
Johanna schüttelte schnell die dunklen Gedanken ab, denn sie war endlich an dem orangefarbenen Backsteingebäude angekommen, vor dem das große Schild mit der Aufschrift Therapiezentrum für affektive Störungen und Traumata hing. Ein komischer Name für ein Haus, in dem drei Therapeuten in sehr familiärer Atmosphäre Hand in Hand arbeiteten. Johanna liebte diese Stimmung, und umso schneller waren auch ihre Schritte durch die dunkle Metalltür, hinein in das Wartezimmer mit den bunten Plastikstühlen und den grimmig blickenden Wartenden. Die Frau am Empfang lächelte ihr auch schon entgegen.
»Hallo Johanna. Geh ruhig schon nach hinten, du wirst bereits erwartet.«
»Danke«, sagte Johanna knapp, ohne die Überraschung in ihrer Stimme gänzlich verstecken zu können. Sie war wie immer zehn Minuten zu früh, und Sebastian hatte normalerweise die Angewohnheit, um Punkt drei Uhr durch die Tür seines Büros zu spazieren, keine Sekunde früher oder später. Wie kam es also, dass er heute bereits auf sie wartete?
Ein komisches Gefühl in ihrem Bauch sagte Johanna, dass das alles mit diesem neuen Projekt zusammenhing, von dem Sebastian gesprochen hatte. Ihre Hände zitterten nervös, als sie bis zum Ende des Ganges lief. Sie klopfte einmal an die mit Sebastian Karen, Diplompsychologe beschriftete Tür und trat dann ein.
Das Büro ihres Therapeuten strahlte wie immer eine ungemeine Gemütlichkeit aus. Überall standen kleine Kommoden und Kisten, das ganze Zimmer schien vollgestopft und doch wunderschön. Johanna wusste genau, dass sich in den kleinen Schränken jede Menge Spielzeug befand, denn in ihren ersten Sitzungen hier im Haus hatte sie oft einfach nur mit Sebastian auf dem dicken Teppich gesessen und gespielt, nichts weiter. Das hatte ihr damals unheimlich gutgetan.
Normalerweise musste Johanna bei der Erinnerung an diese Erlebnisse ihres sechsjährigen Ichs immer lächeln, aber heute blieb sie nur unsicher in der Tür stehen. Denn wer sie dort im Büro erwartete, war nicht Sebastian.
Auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch saß ein Mädchen. Es war blass, hatte rötliche Haare und warf Johanna einen erschrockenen Blick zu. Wie ein angeschossenes Reh. Ihr Gesicht wäre sicher hübsch gewesen, vor allem ihre blauen Augen, wenn es nicht so viele Sorgenfalten und tiefe Augenringe aufgewiesen hätte. Nach ein paar Schrecksekunden fand Johanna endlich ihre Stimme wieder: »Ich wollte zu Sebastian. Wer bist du?« Die Worte kamen unfreundlicher aus ihrem Mund, als sie es eigentlich beabsichtigt hatte.
»Carla … und ich will auch zu Sebastian«, sagte das Mädchen nur knapp, dann sah es wieder auf den Schreibtisch und presste seine Lippen aufeinander.
Eigentlich wollte Johanna das Mädchen am liebsten anschreien. Offensichtlich hatte dieses käsige Ding sich in der Zeit geirrt, und zwar gewaltig! Das hier war Johannas Termin, ihre Zeit mit Sebastian, und die hatte ihr niemand wegzunehmen!
Ohne noch weiter zu zögern, ging Johanna an dem Mädchen vorbei und setzte sich auf Sebastians Drehstuhl, der auf der anderen Seite des Tisches stand. Carla sah sie erschrocken an. »Was machst du da? Das dürfen wir nicht!«
Johanna zuckte mit den Schultern. »Du hast ja meinen Platz besetzt, und ich stehe doch nicht stundenlang wie eine Blöde in der Gegend rum.«
Carla zuckte zusammen, als hätte Johanna ihr mit voller Kraft in den Magen geschlagen. Dann starrte sie auf ihre Hände und begann, sie wie einen Klumpen Knete zu bearbeiten. Johanna kannte diese Geste von Sebastian. Das tat er immer, wenn er mal wieder nicht weiterwusste, und aus irgendeinem Grund machte das Johanna noch wütender.
Just in diesem Moment betrat auch schon Sebastian das Büro, ein hagerer Mann mit klugen Augen und kurzen, schwarzen Haaren. Wie immer trug er ein Hemd und eine Krawatte, die farblich überhaupt nicht zusammenpassten. Unter seinen Arm hatte er einen der bunten Plastikstühle geklemmt, wie sie im Wartezimmer standen, und sein Gesicht zeigte ein breites, wenn auch unsicher wirkendes Grinsen. »Wie ich sehe, habt ihr zwei euch schon kennen gelernt. Hanna, tu mir den Gefallen und setz dich hierhin, ok?« Er stellte den Stuhl neben Carla.
Sehr widerstrebend stand Johanna auf und nahm den angewiesenen Platz ein. Sebastian war der einzige Mensch auf dieser Welt, der ihr einen Spitznamen geben durfte, aber im Moment war ihr das auch nicht mehr recht. Sie fühlte sich verraten, denn anscheinend war es pure Absicht gewesen, dass sie und diese merkwürdige Carla aufeinandergetroffen waren. Johanna sah Sebastian böse an. »Ok, was soll das hier werden?«
Sebastian nahm ebenfalls Platz und lächelte. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich mir ein neues, soziales Projekt ausgedacht habe. Und da sitzt es.« Er wies auf das Mädchen. »Carla ist ebenfalls eine Patientin mit einer Sozialphobie. Sie hat ähnliche Probleme wie du.«
Johanna verengte ihre Augen zu Schlitzen. »Das glaube ich nicht«, fauchte sie leise, dann hob sie ihre Stimme wieder. »Du hast mir gar nicht gesagt, dass du noch eine Patientin in meinem Alter hast …« Sie hasste sich in diesem Moment
selbst dafür, dass aus ihrer Stimme die Eifersucht herausklang.
»Ich hatte auch nicht vor, dir so etwas zu verschweigen, Hanna. Carla kam erst letzte Woche mit der Bitte auf mich zu, ihr zu helfen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich sie ebenfalls aufnehmen soll, aber dann kam mir die Idee zu meinem Projekt. Sie könnte wesentlich zu deiner Heilung beitragen, und du zu ihrer, wenn alles klappt wie geplant!«
Johanna sah zu Carla rüber, die fast unmerklich zusammenzuckte. Dieses Mädchen sollte der Schlüssel zu ihrer Heilung sein? Dieses schüchterne Ding? Die sah doch noch kaputter aus als Johanna selbst! Als könnte die irgendwas ändern!
»Ach ja? Und wie sieht dein Plan dieses Mal aus?« Johanna konnte nichts gegen den respektlosen Ton in ihrer Stimme tun. Aber wenn sie ehrlich war, wollte sie das auch gar nicht. Ihr Therapeut sollte ruhig merken, dass sie alles andere als amüsiert war.
»Ihr zwei werdet ein bisschen Zeit miteinander verbringen.« Sebastian stützte sein Gesicht in die Hände. »Euer Problem ist, dass ihr Angst vor sozialen Bindungen und Kontakten mit Mitmenschen habt. Vielleicht ist das ein guter Weg, diese Angst abzulegen.«
Die Mädchen sahen erschrocken auf.
Zeit verbringen mit dieser Carla? Ein ekliges Gefühl der Wut brannte in Johanna auf. Dass Sebastian auf komische Ideen kam, kannte sie ja schon, aber DAS?
Wortlos fuhr Johanna hoch, und Sebastian sah sie aufmerksam an. »Bitte geh jetzt nicht, Hanna. Das hier ist wirklich wichtig für dich.«
»Da denke ich anders. Das hier ist Zeitverschwendung.«
»Du wirst es trotzdem versuchen.«
»Sonst?« Johannas Stimme war nur noch ein angriffslustiges Fauchen.
Sebastian seufzte. »Es tut mir leid, dass ich das sagen muss … aber wenn du hierbei nicht mitmachst, sind unsere nächsten Therapiestunden gestrichen. Ich brauche deine Mithilfe, wenn ich bei dir wirklich etwas bewirken soll.«
Nein, das konnte er nicht machen! Johanna riss ihre grünen Augen weit auf. Sebastian wusste ganz genau, dass diese Treffen überlebenswichtig für sie waren! Sie ballte ihre Hände zu Fäusten. Ja, natürlich wusste er das. Und er benutzte dieses Wissen, um sie zu erpressen. Aber da würde Johanna nicht mitspielen.
»Schön!«, rief sie aus. »Dann sehen wir uns wohl nicht wieder! Viel Spaß euch beiden noch, lebt wohl!« Und ohne ein weiteres Wort drehte sie sich auf dem Absatz um und rannte raus.
Noch eine Weile konnte sie Sebastian ihren Namen rufen hören, doch sie rannte immer weiter, aus dem Gebäude, die Straße entlang. Natürlich war es ihr wichtig, Zeit mit Sebastian zu verbringen. Aber das hier wollte sie nicht. Sie wollte keinen engen Kontakt zu irgendeinem anderen Menschen. Sie wollte niemanden mehr berühren müssen. Sie wollte nie wieder den Tod eines Menschen mit ansehen.
Kapitel 2
Als Johanna am nächsten Morgen erwachte, blieb sie noch eine Weile liegen. Sie ließ die Augen geschlossen und lauschte in das Innere des Hauses hinein. Erst als endlich das krachende Geräusch der ins Schloss fallenden Tür erklang, seufzte sie und drehte sich auf den Rücken.
Johanna wartete jeden Samstagmorgen auf die Zeit, in der ihre Tante endlich zu ihren Kunden verschwunden war, damit sie ihre Ruhe vor ihr hatte. Es war nicht so, dass das Mädchen seine Tante nicht mochte. Sie hasste die alte Frau.
Anke Thomas hatte Johanna nach dem tragischen Unfalltod ihrer Eltern bei sich aufgenommen. Aber anstelle von Liebe und Verständnis brachte sie ihrer Nichte nur Argwohn und manchmal sogar richtige Angst entgegen. »Ich sehe den Teufel in dir!« – dieser Satz klingelte Johanna immer in den Ohren, wenn sie ihre Tante ansah. Denn das war der Satz gewesen, der ihr in ihrer Kindheit am häufigsten entgegengeschlagen war.
Über die Jahre hatte Johanna verstanden, dass sie von ihrer Tante nichts zu erwarten hatte, und dass es besser war, ihr einfach aus dem Weg zu gehen. Und das ging nun mal am besten, wenn Anke bei der Arbeit war.
Natürlich war es keine normale Arbeit, der sie sich widmete. Anke war Wahrsagerin, Kartenlegerin und Handleserin. Jede Woche verbrachte sie den Samstag bei den größten Klatschweibern der Stadt, las ihnen aus der Hand und durfte sich dann als Belohnung die neusten Gerüchte anhören. Und dieses Leben empfand sie wahrhaftig als erfüllend. Das war noch eine Sache, die Johanna an der alten Frau nicht verstehen konnte.
Aber nun, da diese endlich gegangen war, konnte Johanna aufstehen. Langsam ließ sie sich aus dem Bett gleiten und trat vor den großen Spiegel, der ihrem Bett gegenüber stand. Ihre langen, dunklen Haare waren noch etwas zerzaust, und die Augen sahen müde aus. Obwohl sie eigentlich lang genug geschlafen hatte, empfand Johanna diesen Anblick nicht als ungewöhnlich. Immerhin hatte sie sich in der Nacht mit ständigen Albträumen herumgequält. Es war niemals eine gute Idee, mit Wut im Bauch schlafen zu gehen.
Johanna band sich einen lockeren Zopf und schlurfte dann die Treppe nach unten, um sich etwas zum Frühstück zu machen. Die ganze Zeit wurde sie von ihren dunklen Gedanken verfolgt. Gut, wahrscheinlich würde Sebastian seine Drohung von gestern eine ganze Weile durchziehen, in der Hoffnung, dass sie noch mitspielen würde. Aber das hatte Johanna definitiv nicht vor. Nachzugeben war noch nie ihre Stärke gewesen, im Gegenteil. Lieber würde sie sich alle Finger abhacken als zuzugeben, dass sie im Unrecht war.
Aber das würde auch bedeuten, dass sie in dieser schweren Zeit niemanden hätte, der für sie da wäre. Es würde niemanden geben, der sich in dieser um sie kümmerte, und wahrscheinlich würde Johanna noch einsamer sein als ohnehin schon. Das war ein erschreckend bedrückender Gedanke, denn eigentlich war Johanna die meiste Zeit ihres Lebens allein gewesen.
Auf einmal begann das Telefon neben ihr zu klingeln, und vor Schreck wäre Johanna beinahe die komplette Milchpackung in ihre Müslischüssel gefallen. »Verdammt!«, zischte sie wütend und stellte den Karton knallend ab. Doch bevor sie sich auch nur einen Zentimeter bewegen konnte, verstummte das Klingeln auch schon wieder.
Johanna sah überrascht auf. Wer ließ das Telefon denn bitte nur zwei Mal klingeln und legte dann wieder auf? Entweder war da jemand wirklich ziemlich ungeduldig oder … was auch immer. Johanna zuckte mit den Schultern, nahm ihre Müslischüssel und begab sich wieder in ihr Zimmer.
Dort warf sie sich auf die bequeme Couch, legte die Beine hoch auf den winzigen Kaffeetisch und seufzte zufrieden, bevor sie den Fernseher anschaltete. Endlich einfach mal nur entspannen.
Nicht, dass Johannas Leben über die Maßen anstrengend war, aber sie hatte es am Wochenende trotzdem lieber, nur vor dem Fernseher zu sitzen und sich das Gehirn von zweitklassigen Unterhaltungssendungen zermatschen zu lassen. Endlich mal nicht an den Schulstress, ihre Einsamkeit und andere unangenehme Aspekte ihres Lebens – und davon gab es nicht wenige – denken zu müssen. Einfach mal gar nichts denken und sich berieseln lassen.
Johanna hatte gerade eine äußerst bequeme Lage gefunden und die Müslischüssel auf dem Bauch abgestellt, als sie aus der unteren Etage wieder das Klingeln des Telefons vernahm.
»Ernsthaft jetzt?!«, fluchte sie. Ein paar Sekunden spielte sie mit dem Gedanken, gar nicht erst aufzustehen. Dann dachte sie aber daran, wie ihre Tante reagierte, wenn Johanna zu faul war, um ans Telefon oder an die Tür zu gehen. Das würde mächtig Stunk geben, wenn es etwas Wichtiges war. Und für Anke Thomas zählte alles als wichtig, was etwas mit ihrer eigenen Person zu tun hatte. Da war es Johanna doch lieber, wenn sich die Kommunikation der beiden auf »ich bin Zuhause« und »ich bin dann mal weg« beschränken ließ.
Also stellte sie, immer noch knurrend, die Müslischüssel auf den Tisch und hastete die Treppe hinunter. Sie war nur noch einen Meter vom Telefon entfernt, als das Klingeln auch schon wieder verstummte.
Sofort stoppte Johanna ab und verspürte große Lust, das Ding gegen die Wand zu werfen. Hätte sie gewusst, dass sie es eh nicht schaffte, wäre sie einfach liegen geblieben.
Doch sie hatte diesen Gedanken noch nicht einmal zu Ende geführt, als das Telefon schon wieder zu klingeln begann.
»Mann, hast du nerven!« Johanna überwand den letzten Meter zwischen sich und dem Glastisch im Flur und nahm den Hörer ab. »Thomas?«

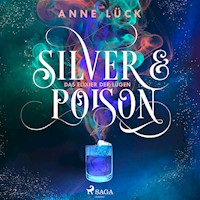
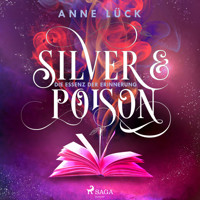
![Jewel & Blade. Die Wächter von Knightsbridge [Band 1 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ce22490997b3e6e0e807c8b632e07b21/w200_u90.jpg)




![Jewel & Blade. Die Hüter von Camelot [Band 2 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c7d0b6bb9c33b9a1b2b09f490d3cfe2a/w200_u90.jpg)