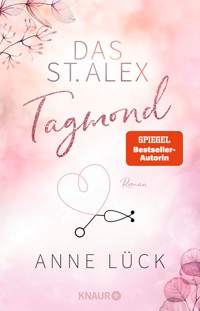9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die New-Adult-Reihe Das St. Alex
- Sprache: Deutsch
Nachts der Job im Krankenhaus, tagsüber Familien-Chaos - Samira hat absolut keine Zeit für die Liebe. Oder? »Das St. Alex – Nachtleuchten« ist der erste Liebesroman einer romantischen neuen New-Adult-Reihe um drei junge Krankenschwestern in Berlin. Samira hat keine Zeit für die Liebe: Neben ihrem Job auf der Kinder-Palliativstation des Berliner St.-Alex-Krankenhauses hat sie alle Hände voll damit zu tun, sich um ihre drei jüngeren Brüder zu kümmern. Ihre Mutter ist dazu offenbar nicht in der Lage. Deshalb übernimmt Sami auch so oft wie möglich Nachtschichten, um tagsüber für ihre Familie da zu sein. Der junge Arzt Louis hingegen zieht nach einem späten Feierabend gern noch durch die Berliner Clubs. Jemand wie er passt überhaupt nicht in Samis Leben, findet sie. Aber dann kommen die beiden bei einer gemeinsamen Nachtschicht dem seltsamen Fall einer jungen Patientin auf die Spur – und einander näher … Die romantische neue New-Adult-Reihe von Anne Lück erzählt die Geschichten von drei jungen, miteinander befreundeten Krankenschwestern in Berlin. Im zweiten Liebesroman der Reihe, »Das St. Alex – Tagmond«, fängt Samis Freundin Tessa auf der Kinderonkologie-Station an und muss feststellen, dass nicht alles im Leben ihren Pläne folgt – schon gar nicht die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ANNE LÜCK
DAS ST. ALEX
Nachtleuchten
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nachtschichten, Herzklopfen und heimliche Träume: Willkommen am St. Alex
Die junge Krankenschwester Samira hat keine Zeit für die Liebe: Neben ihrem Job auf der Kinder-Palliativstation des Berliner St.-Alexander-Krankenhauses hat sie alle Hände voll damit zu tun, sich um ihre drei Brüder zu kümmern. Der junge Arzt Louis hingegen zieht nach einem späten Feierabend gern noch durch die Clubs. Jemand wie er passt überhaupt nicht in Samis Leben, findet sie. Aber dann kommen die beiden bei einer gemeinsamen Nachtschicht dem seltsamen Fall einer jungen Patientin auf die Spur – und einander näher …
Start der romantischen New-Adult-Serie um drei junge Krankenschwestern am Berliner St. Alex-Krankenhaus
Inhaltsübersicht
Triggerwarnung Hinweis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Danksagung
Triggerwarnung
Liebe Leser*innen,
bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende dieses Buches eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen euch gute Unterhaltung mit Das St. Alex – Nachtleuchten!
Anne Lück und der Knaur-Verlag
Für all meine wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, die ich in meiner Zeit in der Klinik bisher treffen und von denen ich lernen durfte, und die mit so viel Herz und Seele jeden Tag bereit sind, Menschen zu helfen. Danke für alles.
Kapitel 1
Die Panik ergriff mich in dem Moment, in dem ich den Rauch roch.
In der einen Sekunde war ich noch durch ein Meer von hüfthohen, herrlich duftenden Blumen in allen erdenklichen Farben gewandert, hatte meine Hände durch die Blüten fahren lassen und den vollkommen wolkenlosen Himmel bewundert. Bis ich in der Ferne plötzlich jemanden gesehen hatte – einen Mann, der mit dem Rücken zu mir stand. Ich war auf ihn zugelaufen, bis Bewegung in seinen muskulösen Rücken gekommen war und er sich ganz langsam zu mir umgedreht hatte … Im nächsten Moment schlug ich die Augen auf und starrte an die grauweiße Raufasertapete an der Decke meines Schlafzimmers.
Winzige Lichtpunkte drangen durch das Rollo und erlaubten mir die Sicht auf das Chaos, die durcheinandergerutschten Blätterstapel auf meinem winzigen Schreibtisch, die Klamotten, die provisorisch über die Stuhllehne geworfen waren, und meine Bettdecke, die ich im Schlaf offensichtlich von mir gestrampelt hatte und die jetzt auf dem dunklen Laminatboden lag.
Ich trug kein leichtes, weißes Sommerkleid mehr, sondern ein durchgeschwitztes, schwarzes Tanktop und locker sitzende Schlafshorts. Und hier roch es auch nicht mehr nach einem üppigen Blumenmeer, es stank ganz fürchterlich nach …
Panik stieg in mir hoch, ich fuhr aus dem Bett, nur eine Millisekunde, bevor ein durchdringendes Piepsen durch die gesamte Wohnung tönte. In der actionfilmreif kurzen Zeitspanne, in der ich aus dem Bett sprang, zur Tür hastete und sie aufriss, schossen mir tausend Gedanken auf einmal durch den Kopf. Die Wohnung brennt. Ich habe vergessen, den Herd auszuschalten. Die Wohnung brennt! Ich muss das Feuer löschen, ich muss die Feuerwehr anrufen, ICH MUSS DIE JUNGS RETTEN!
Aus dem Flur strömte mir beißender Qualm entgegen, dann quietschte Max ein hohes »Sami, komm hier nicht rein« aus der Küche. Nur einen Herzschlag später stand ich im Türrahmen und scannte, was vor mir lag: dichter Qualm, der vom Herd kam und sich dort aus einem pechschwarzen Etwas in der Pfanne in die Luft hinaufdrehte. Ein panischer Max, der mit angelaufenen Brillengläsern mitten im Raum stand. Der wild mit den in seinem Pullover versunkenen Armen wedelte und seltsame Laute von sich gab, die an einen verwundeten Hund erinnerten. Und dann noch Jannis, der gerade dabei war, halb auf die Küchentheke gekniet das Fenster aufzureißen. Er warf mir über seine Schulter einen schuldbewussten Blick zu. »Äh. Sorry. Wir wollten eigentlich nur Frühstück für dich machen.«
Die Wohnung brennt nicht.
Mein unkontrolliert pochendes Herz begann augenblicklich, sich zu beruhigen, und die analytische, schnell denkende Samira übernahm wieder das Steuer in meinem Kopf. Die Jungs hatten das, was auch immer da in der Pfanne zu einem Haufen Kohle zusammengeschmort war, bereits von der Herdplatte genommen. Ich drehte den Herd aus und griff in derselben Bewegung nach dem neben dem Kühlschrank stehenden Besen. Den Knopf des Rauchmelders traf ich glücklicherweise beim ersten Versuch mit dem Holzstiel, und eine wunderbare Stille breitete sich im Raum aus.
Ich seufzte erleichtert und pustete mir eine braune Strähne aus dem Gesicht, bevor mein Blick langsam wieder zu der Pfanne wanderte. Jannis und Max waren in ihren Bewegungen eingefroren, und jetzt starrten wir alle drei den missglückten Kochversuch meiner Brüder an, während um uns herum der Qualm langsam durch das offene Küchenfenster abzog.
»Äh«, machte Jannis und fuhr sich mit einer Hand durch die wilden, dunklen Locken, die dringend mal wieder einen Friseur sehen mussten. »Also. Ja.« Er lehnte sich gegen den Schrank und ließ dieses kurze Lachen hören, das er immer machte, wenn er nervös war. »Überraschung.«
»Und was genau überrascht mich da?«, hakte ich mit ruhiger Stimme nach, den Blick immer noch auf das schwarze Stück Elend in der Pfanne gerichtet.
»Pancakes.« Maxi wischte seine Brille mit dem Saum seines Pullis sauber, bevor er nachdenklich den Herd anstarrte. »Das sollten sie zumindest werden. Irgendetwas ist da schiefgelaufen.«
»Ach, wirklich?« Meine Mundwinkel zuckten nach oben, weil der Ärger über mein unsanftes Wachwerden und das Chaos in der Küche längst nicht so groß waren wie die Erleichterung, dass es allen gut ging. Dass die Wohnung noch stand.
Maxi nickte, als hätte ich die Frage ernst gemeint. Sein Gespür für Sarkasmus war in den letzten Jahren nicht wirklich besser geworden. »Der war wohl zu lange in der Pfanne. Die anderen sind aber in Ordnung, denke ich.«
Ich folgte seinem Blick zu einem Teller mit hoch gestapelten Pancakes, die ich schon aus der Entfernung als bestenfalls experimentell bezeichnen konnte. Ein paar von ihnen waren offensichtlich noch nicht ganz durch, der Teig zerlief ein wenig, andere hatten verdächtig dunkle Flecken.
»Überraschung«, murmelte Jannis erneut und grinste breit. »Nachmittags-Frühstücks-Pancakes mit ganz viel Liebe und einer exotischen Räuchernote.«
Obwohl die beiden beinahe die Küche in Brand gesetzt hatten, erfasste mich in diesem Moment eine Welle der Rührung und auch etwas Stolz auf meine jüngeren Brüder. Wie sie mich ansahen, so erwartungsvoll und mit anscheinend angehaltenem Atem, konnte ich nicht anders, als kurz aufzulachen. »Wow. Ihr habt mich noch nie mit Pancakes geweckt. Das ist lieb von euch.«
Max nickte eifrig, offensichtlich ermutigt davon, dass ich ihren kleinen Unfall nicht mit einer Rüge quittierte. »Wir haben sie nach deinem Rezept gemacht.« Seine Schultern sanken wieder etwas ein. »Auch wenn sie irgendwie nicht ganz so geworden sind wie bei dir.«
Mein Rezept war eigentlich das unserer Großmutter, das sie selbst immer als »Eierkuchen der Armen« bezeichnet hatte, weil es tatsächlich nur aus Mehl, Zucker und Milch oder Wasser bestand, je nachdem, wie es um ihre Finanzen gerade stand. Es ging schnell und war eigentlich narrensicher – wenn man mit einem Herd umgehen konnte. Ich winkte ab. »Übung macht den Meister.« Hoffentlich bereute ich diese Aussage nicht. »Aber nicht mehr heute. Und nächstes Mal vielleicht auch erst mal unter Aufsicht«, schob ich deshalb schnell nach.
»Klingt vernünftig.« Jannis stieß sich von der Küchentheke ab. Er wirkte ebenfalls erleichtert, wahrscheinlich hatte auch er mit Ärger gerechnet. »Dann Spätstück?«
Ich schmunzelte. »Tisch decken und Kaffee, bitte. Bin gleich zurück.«
Mit dem freudigen Quietschen von Max im Rücken drehte ich mich um und lief durch den Flur zu meinem Schlafzimmer zurück. Wie immer zog ich zuerst das Rollo nach oben und wurde für eine Sekunde von der Sonne geblendet, bevor ich den gepflasterten Hof und die umstehenden Hochhäuser sehen konnte. Am Himmel standen keine Wolken, fast wie in meinem himmlischen, ruhigen Traum. Ich seufzte sehnsüchtig, bevor ich auf den alten Radiowecker schielte, der neben meinem Bett auf der kleinen Kommode stand. Kurz vor sechzehn Uhr. In ein paar Minuten wäre er sowieso angesprungen und hätte mich geweckt – wenn auch wahrscheinlich ein wenig sanfter. Damit war ich auf meine sechs Stunden Schlaf gekommen und sollte problemlos den Nachtdienst meistern können.
Ich legte meine Bettdecke zusammen, schlüpfte in meine Hausschlappen und zog die graue Strickjacke über, die auf meinem Stuhl gehangen hatte. Es war Frühherbst und eigentlich warm genug für Shorts und Tanktops – aber wenn ich aus dem Nachtdienst-Schlaf erwachte, fröstelte ich immer ein wenig. Als müsste mein Körper sich erst langsam wieder auf den Tagmodus umstellen.
Als ich in unser kleines Wohnzimmer trat, war Max gerade dabei, Teller auf den Couchtisch zu stellen. Wir hatten nicht viel Platz in der Wohnung, deshalb hatten wir auch keinen Esstisch. Da wir aber alle drei nicht besonders anspruchsvoll waren, was unsere Umgebung anging, verursachte das selten Probleme. Ich ließ mich auf eine Ecke der Couch sinken, und mir wurde bewusst, dass wir schon eine ganze Weile nicht mehr zusammengesessen und gegessen hatten. Schmunzelnd sah ich zu Max auf, der die Gabeln und Messer mit übertriebener Präzision neben die Teller legte. Als er einigermaßen zufrieden war, rieb er die Hände aneinander und strahlte mich dann an. »Willst du Schlagsahne und Beeren auf deine Pancakes?«
Für einen Moment stutzte ich und ging meine Einkaufsliste der letzten Woche durch. Diese Woche war ich, zu meiner eigenen Schande, noch nicht dazu gekommen. »Wir haben weder das eine noch das andere, Maxi.«
»Doch. Vinz und Bine haben uns vorhin was vorbeigebracht. Deshalb sind wir ja erst auf den Gedanken gekommen, Pancakes für dich zu machen.«
»Das ist aber lieb von ihnen. Wir sollten uns bei Gelegenheit mit etwas Gebackenem bedanken. Allerdings am besten ohne Kohle.«
Max nickte heftig, bevor er in die Küche rannte, um Sahne und Beeren zu holen. Er kam nur einen Moment später mit Jannis im Schlepptau zurück, der mir grinsend ein großes Glas reichte. »Halb Kaffee, halb Hafermilch und drei große Eiswürfel«, sagte er in seiner besten Kellnerstimme, und ich nahm dankend meinen geliebten Eiskaffee an und beobachtete die beiden, wie sie sich um die am besten geratenen Pancakes stritten.
In mir stieg ein warmes Gefühl auf, das alle Zweifel, alle Sorgen und Probleme des letzten Jahres wieder einmal erfolgreich verdrängte. Die Tatsache, dass ich mit dreiundzwanzig in einer WG mit zweien meiner kleinen Brüder zusammenlebte, die Angst, dass ich nie ein ausreichender Mutterersatz sein konnte, und das schrumpfende Bankkonto verbannte ich in den hintersten Winkel meines Gehirns, als ich den ersten Schluck meines großartigen Kaffees nahm. Das waren alles Probleme für die Zukunfts-Samira. Obwohl – nicht alle.
Ich zeigte mit einem strengen Blick auf Jannis, der sich gerade genüsslich ein großes Stück Pancake mit viel zu viel Schlagsahne in den Mund schieben wollte. »Blutzucker«, knurrte ich, und er erstarrte sofort in der Bewegung. »Ups.«
»Ich geb dir gleich ups. Messen, jetzt.«
Er kramte sofort nach seinem Messbesteck, das in einer kleinen Stofftasche mit Dinoaufdruck unter dem Couchtisch lag. Als er sich die Nadel in den Finger pikste, wandte ich den Blick Max zu, der gerade hoch konzentriert versuchte, eine herumrollende Blaubeere mit seiner Gabel aufzuspießen. »Hast du deine Hausaufgaben gemacht?«
Er nickte, ohne aufzublicken. »War heute nur Deutsch, das habe ich direkt nach der Schule gemacht.«
Natürlich hatte er das. Max liebte die Schule. Manchmal musste ich am Abend dreimal in sein Zimmer gehen und ihm irgendein Schulbuch aus der Hand nehmen, damit er sich endlich schlafen legte. Einmal hatte ich ihn mit einem Biobuch und einer Taschenlampe unter der Bettdecke erwischt und nur den Kopf schütteln können.
Mein Blick wanderte zu Jannis, der wohl mit dem Ergebnis seines Blutzuckerspiegels zufrieden war, denn er hatte sich noch Sahne nachgenommen und kaute jetzt genüsslich. »Und du?«
Jannis’ Kaubewegungen wurden langsamer, als sich seine Augen, die wie meine beinahe schwarz waren, auf mich richteten. »Wollte ich noch machen.«
»Ist klar. Und wann?«
»Nach dem Essen.«
»Brauchst du Hilfe?«
Er verzog das Gesicht, wie es Dreizehnjährige nun einmal taten, wenn man sie nach den Hausaufgaben fragte. »Mathehausaufgaben, Sami. Falls ich Hilfe brauche, frage ich Maxi, keine Sorge.«
Unser jüngster Bruder strahlte sofort wie eine angeknipste Glühbirne. Obwohl er gerade einmal neun Jahre alt war, war er schon der Überflieger unserer Familie, und ich musste Jannis innerlich recht geben, dass er mit Fragen wahrscheinlich besser bei ihm dran war. Vor allem, wenn es um Mathe ging. »In Ordnung. Dann hoffe ich, dass du das wirklich nachher erledigst und ich das nicht kontrollieren muss.« Selbst in meinen eigenen Ohren hörte ich mich an wie eine überfürsorgliche Helikoptermutter und musste mir auf die Unterlippe beißen.
Jannis quittierte meinen Kommentar nur mit hochgezogenen Augenbrauen und einem »Du kannst mir nachher einen Bienchen-Stempel in mein Muttiheft machen«, bevor er sich wieder seinem Schlagsahnehaufen mit Pancake zuwandte.
Die zufriedene Stille einer essenden Familie legte sich für einen Moment über uns, und ich genoss sie fast so sehr wie meinen Eiskaffee. Und auch wenn gerade Fynn fehlte, fühlte es sich gut an. Ich liebte diese kurzen Zeitspannen, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich mein Leben im Griff hatte. Dass ich UNSER Leben im Griff hatte. Denn in der Regel hielten diese Momente nicht sonderlich lang an, und ich hatte im letzten Jahr gelernt, sie zu nehmen, wie sie kamen.
Meinen Brüdern und ihren Anstrengungen zuliebe zwängte ich mir einen ihrer halb rohen, halb verbrannten Pancakes rein, die nicht ganz so scheußlich schmeckten, wie sie aussahen, dann räumten wir zusammen den Wohnzimmertisch auf. Ich schickte Jannis in sein Zimmer, um seine Hausaufgaben zu machen, und Maxi trottete ihm treu hinterher, um ihm zu helfen oder ihm einfach nur Gesellschaft zu leisten, während er in seinen Schulbüchern blätterte. Mir kam unsere Nachbarin Bine in den Sinn, wie sie die beiden einmal als »den großen und den kleinen Klaus« betitelt hatte, weil sie immer zusammenhingen, und widmete mich grinsend dem Abwasch.
Als ich wieder zurück in mein Schlafzimmer kam, fiel mein Blick sofort auf die zerstreuten Papiere, die ich heute Vormittag auf dem Schreibtisch zurückgelassen hatte. Meine Hand streifte erst die Einladung zum Klassentreffen, die ich bisher ignoriert hatte, und dann die Mahnung, die ich heute Morgen nach meinem Nachtdienst aus dem Briefkasten gefischt hatte. Es war bereits die zweite, die auf die Nachzahlungsforderung unserer Stromrechnung gefolgt war, und wie es aussah, mussten sie auch noch ein bisschen auf den Betrag warten. Bis Anfang des Monats, bis mein Gehalt kam. Ein seltsames Ziehen fuhr durch meinen Magen, als ich daran dachte, dass das den nächsten Monat finanziell ganz schön durcheinanderwerfen würde, aber ich wusste auch, dass ich dieses Problem jetzt nicht lösen konnte. Es würde nichts ändern, sich jetzt mit Bauchschmerzen rumzuplagen, und bisher waren wir immer irgendwie über die Runden gekommen. Das würden wir auch diesmal.
Ich zog mein Handy unter dem Kopfkissen hervor und stopfte mir die Kopfhörer in die Ohren. Kaum durchflutete mich die Musik von Florence and the Machine, wurden die Sorgen in meinem Gehirn wieder leiser. Halb tanzend schnappte ich mir den Wäschekorb, warf die herumliegenden Klamotten rein und wackelte dann durch den Flur, während ich die Lyrics zu Cosmic Love wahrscheinlich unheimlich schief mitsang. Mit der Hüfte stieß ich die Tür zum Zimmer meiner Brüder auf, die sofort beide von ihren gegenüberliegenden Betten aufsahen. Jannis sagte etwas, das unter meiner Musik unterging, und ich deutete grinsend auf meine Kopfhörer, die ich für sein Gemecker über meinen Gesang ganz sicher nicht rausnehmen würde. Er machte eine Geste, als würde er sich erhängen, und mein Grinsen wurde noch breiter.
Maxi hingegen sprang sofort auf, um eifrig die Dreckwäsche der Jungs zusammenzusammeln und in meinen dargebotenen Korb zu werfen. Ich machte auf dem Absatz kehrt und krächzte extralaut das nächste Lied mit. Diesmal konnte ich Jannis’ aufgeschrienen Protest sogar über die Musik hinweg hören.
Ich stellte die Waschmaschine an, dann saugte ich Staub im Wohnzimmer und in der Küche, knotete den vollen Müll zusammen, um ihn an die Wohnungstür zu stellen, und machte dann eine Runde mit dem Staubwedel. Nur für eine Sekunde schoss mir während meiner Putzaktion der Gedanke durch den Kopf, dass mein Leben plötzlich so anders war, als ich es mir noch vor ein paar Jahren erträumt hatte. Ich ertränkte ihn in noch mehr Eiskaffee und noch lauterer Musik.
Als ich die Wäsche aufgehängt hatte, warf ich Handy und Kopfhörer auf mein Bett, holte eine Jeans und eine gestreifte Bluse aus meinem Kleiderschrank und schloss mich im Bad ein, um mich für den Nachtdienst fertig zu machen. Aber heute schaffte es nicht einmal die viel zu heiße Dusche, meine Sorgen über die hohe Rechnung komplett auszuschalten. Immer wieder drängte sich die Frage, auf was ich dafür im nächsten Monat verzichten konnte, in mein Bewusstsein zurück. Ich würde wohl später einen Plan machen müssen, um das Gedankenkarussell ein wenig in Zaum zu halten.
Gerade als ich das heiße Wasser abdrehte und aus der Dusche trat, hörte ich, wie im Flur die Wohnungstür ging und eine empörte Stimme rief: »Wieso riecht es hier drin wie in einer Räucherkammer?«
Ich schmunzelte meinem etwas zu blassen, etwas zu müde wirkenden Gesicht im Spiegel zu. »Maxi und Jannis haben Räucherpancakes gemacht«, rief ich zurück, während ich mir ein Handtuch umwickelte und die dunklen, schulterlangen Haare zurückkämmte. Gefolgt von einer Dampfwolke trat ich auf den Flur, wo der älteste meiner kleinen Brüder gerade die Schuhe von seinen Füßen kickte und mich unter seiner tief sitzenden Kapuze mit skeptischer Miene musterte. »Du siehst aus, als hättest du seit vierzig Jahren nicht mehr gepennt.«
»Ich finde es auch schön, dich zu sehen, Fynn«, gab ich schmunzelnd zurück und drückte mich an ihm vorbei in Richtung meines Schlafzimmers. »Du hingegen siehst aus wie das blühende Leben. Rieche ich da Rauch an dir?« Hatte er etwa mit Zigaretten angefangen? Als ich prüfend an ihm schnupperte, trat er einen empörten Schritt zurück. »Lass das. Das ist die Bude hier, die stinkt nach Kohlewerk.«
»Vorhin war es noch eine Räucherkammer.« Ich beschloss, den an ihm haftenden Geruch zu ignorieren, auch wenn der Gedanke mich störte, dass er rauchen könnte. Er war fast achtzehn, er war durchaus in der Lage, selbst zu entscheiden, was er anstellte. Und ich hoffte zumindest, dass er keine allzu dummen Entscheidungen traf. »Bleibst du diesmal die ganze Nacht?«
Fynn zuckte mit den Schultern. Offensichtlich war er in den letzten Wochen zu cool geworden, um in der Wohnung seine Kapuze abzusetzen. Ich sah, wie sich an der Stirn seine braunen Haare hervorkringelten – nicht ganz so wild gelockt wie die von Jannis, aber mehr als meine oder Maxis. Wir konnten einen Verwandtschaftsgrad definitiv nicht abstreiten.
»Du weißt es noch nicht?«, hakte ich nach. Fynn sah wohl die Hoffnung in meinem Gesicht, denn seine Mundwinkel zuckten nach oben. »Denk schon«, sagte er versöhnlich, und ich lächelte. Ich kam nicht umhin, mich ein wenig unvollständig zu fühlen, wenn er nicht hier war. Fynn, Maxi, Jannis und ich – wir waren immer eine Einheit gewesen. Die unverwüstlichen Frey-Geschwister, die es mit jeder Herausforderung aufnehmen konnten, egal, wer sich ihnen in den Weg stellte. Dass ich uns auseinandergerissen hatte, nagte noch an mir, und es wurde immer schlimmer, wenn Maxi nach ihm fragte … oder nach unserer Mutter.
Ich presste die Lippen zusammen und schlüpfte ins Schlafzimmer, um mich anzuziehen. Wieder Gedanken und Sorgen, die mir nichts brachten, die die Situation nicht besser machen würden. Ich musste sie abschütteln, wie ich es immer tat, bis sie mich dann alle auf einmal überfielen, wenn ich eigentlich im Bett lag, um zu schlafen.
Als ich fertig angezogen ins Wohnzimmer trat, saßen meine Brüder schon zusammengerottet auf dem Sofa unter einer grauen Kuscheldecke und sahen sich einen im Fernsehen laufenden Film mit Vin Diesel an. Über den Bildschirm zuckte eine von wahrscheinlich unzähligen Explosionen, und auf dem Wohnzimmertisch lag eine offene Tüte Chips, die Fynn wohl in seinem Rucksack mitgebracht hatte.
Ich setzte zu meiner allabendlichen Rede an: »Ich habe das Handy dabei und immer auf …«
Jannis unterbrach mich, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden: »… Vibration in der Hosentasche, damit wir dich erreichen können. Die Nummer der Station steht auf dem Post-it am Kühlschrank, obwohl wir sie längst in- und auswendig können. Genau wie die Nummer sämtlicher Hilfsstellen, des Giftnotrufs, der Feuerwehr, und zur allergrößten Not klingeln wir bei Bine und Vinz. Aber wirklich nur, wenn einer von uns im Sterben liegt. Ansonsten benehmen wir uns, essen nicht mehr zu viel Fettiges vor dem Schlafen und gehen rechtzeitig ins Bett, damit wir morgen fit für die Schule sind.« Er hob den Kopf mit einem stolzen Grinsen. »Hab ich was vergessen?«
Fynn gab ein grunzendes Lachen von sich, für das er einen strengen Blick von mir kassierte. »Nein«, gab ich zu. »Das war alles korrekt. Füg nur das nächste Mal so etwas wie sei nicht so frech zu der Schwester, die dich durchfüttert hinzu.«
Jannis machte eine abschließende Geste vor seinem Mund, und Maxi sah mit einem milden Lächeln zu mir auf. »Wir machen keinen Blödsinn mehr, versprochen.«
»Dir glaube ich sofort. Also hab ein Auge auf die anderen beiden, okay?« Ich gab ihm einen flüchtigen Kuss auf den Kopf, bevor ich in den Flur ging und meinen Schlüssel vom Schlüsselbrett nahm. Ich hatte die Wohnungstür schon geöffnet, als mir noch etwas einfiel. »Kein True Crime, bevor Maxi im Bett ist, Jannis.«
Er stöhnte ein: »Och Mann, komm schon, Sami«, und ich schloss grinsend die Tür hinter mir.
Kapitel 2
Es war noch hell, als ich auf den gepflasterten Parkplatz des Sankt-Alex-Krankenhauses einbog und mein Fahrrad zu den überdachten Ständern lenkte. Ich brauchte einen Moment, um zwischen den ganzen Rädern des Spätdienstes noch einen Platz zu finden, aber nach dem Anschließen sagte mir die Uhr auf meinem Handy, dass es erst zwanzig nach neun war – wie immer überpünktlich.
Ich lief um das Gebäude herum, bis ich der verspiegelten Vorderansicht gegenüberstand, und der Kies knirschte laut unter meinen Schuhen. Im Glas spiegelte sich der lilafarbene Abendhimmel. Mein Blick wanderte daran hinauf, als ich mich dem Eingang näherte, und eine seltsame Art des Stolzes stieg in mir auf. Das Alex war das wahrscheinlich modernste Krankenhaus Berlins, es hatte erst wenige Jahre auf dem Buckel, und der Vorstand tat alles dafür, dass es seinen Topruf behielt.
Das Gebäude hatte nur drei Etagen, aber es wirkte trotzdem imposant auf jeden, der ihm gegenüberstand. Ich erinnerte mich noch daran, als ich vor knapp zwei Jahren das erste Mal über den von Lichtern gesäumten Weg zwischen den beiden Rasenflächen hindurch auf die Glastüren zugelaufen war, kurz vor meinen Ausbildungsprüfungen, um mich dem Vorstellungsgespräch auf meiner jetzigen Station zu stellen. Ich erinnerte mich an mein flatterndes Herz, meine schwitzigen Hände und den Moment, an dem mir Esra mit einem wissenden Lächeln die Tür geöffnet hatte.
Die Glastüren des Krankenhauses teilten sich vor mir, und ich ließ einen kurzen Blick über die Messingbuchstaben darüber schweifen: Sankt-Alexander-Krankenhaus für Onkologie und Palliativmedizin.
In der Mitte der imposanten Eingangshalle saß Theodor hinter dem Tresen und sah von seinem Buch auf, als er das Quietschen meiner Schuhe auf dem weiß-blauen Linoleumboden hörte. Er lächelte mir breit entgegen, und ich musste wieder einmal daran denken, dass er mit seinem runden Kopf und den dicken Brillengläsern wie eine alte Eule wirkte. »Du siehst erholt aus, Samira.«
»Deinen nächtlichen Level an Eleganz werde ich wohl trotzdem nie erreichen, Theo«, gab ich, mit Nicken in Richtung seines braunen Anzuges, schmunzelnd zurück. Jeder, der im Sankt Alex Nachtdienste machte, kannte Theodor. Er war seit der Eröffnung des Krankenhauses der beinahe permanente Nachtportier. In meinem ersten Nachtdienst hier hatte er mich sehr herzlich begrüßt, und weil ich seit über einem Jahr keine Tagdienste mehr machte, hatten wir uns mittlerweile angefreundet.
Theo lächelte, und die Augen hinter seinen dicken Brillengläsern wurden ganz klein. »Einen guten Nachtdienst.«
»Ebenso.« Ich winkte ihm und klapperte dabei mit den Schlüsseln, bevor ich nach rechts in den Palliativflügel abbog. Die breiten Gänge waren leer und still, wie ich es schon von dieser Uhrzeit kannte, und auch über mich legte sich langsam die Ruhe, die das Sankt Alex in mir immer auslöste.
Als die Türen des modernen Aufzuges sich vor mir teilten, starrte mir mein Spiegelbild von allen Seiten entgegen. Ich wählte die zweite Etage an und lehnte mich dann auf die Seitengriffe, um einen besseren Blick in mein Gesicht werfen zu können. Ein großes Hoch auf die magische Wirkung von Concealer – meine Augenringe waren kaum noch zu erkennen unter dem Make-up. Auch wenn meine dunklen Augen mir noch müde entgegenstarrten, würde das wohl kaum sonst wem auffallen.
»Halt!«, rief eine Stimme vom Flur, und ich schaffte es gerade noch, meine Hand zwischen die Türen zu halten. Der Aufzug ging wieder auf, und Maya hastete hinein, die dunklen Haare in allen Richtungen vom Kopf abstehend. »Danke«, sagte sie etwas fahrig, den Blick noch halb in der Tasche, in der sie offensichtlich nach etwas kramte. Vielleicht nach ihrem Schlüssel. Erst nach ein, zwei Sekunden hob sie den Kopf, sah mich, und ihr Gesicht entspannte sich etwas. »Oh, Sami, ich hab dich gar nicht bemerkt.«
»Was du nicht sagst«, gab ich grinsend zurück und drückte den Knopf für die dritte Etage – die der Erwachsenenpalliativ, auf der meine ehemalige Ausbildungs-Sitznachbarin arbeitete.
»Danke.« Sie ließ seufzend die Tasche sinken und lehnte sich an die verspiegelte Wand.
Die Aufzugtüren glitten zu, und der Aufzug setzte sich in Bewegung. Maya sah aus, als würde sie jeden Moment einfach an die Wand gelehnt einschlafen, und ich hoffte, dass ihre Station sie mit genug Grünem Tee versorgen würde, damit sie den Nachtdienst überlebte. Kaffee trank sie nämlich nicht.
Der Aufzug piepte, und ich tippte sie sanft an. »Ruhigen Nachtdienst.«
»Dir auch.« Maya öffnete die Augen, und nach einer Sekunde schreckte sie auf. »Hey, Sami, denk dran, dass bald das Klassentreffen ist! Du hast noch nicht offiziell zugesagt, aber ich hoffe, du weißt, dass Ausreden nicht akzeptiert werden!« Ihr Blick war beinahe streng, und ich hatte das Gefühl, dass sie es tatsächlich todernst meinte.
»Klar«, gab ich zurück, auch wenn ich insgeheim hoffte, dass mir noch eine Ausrede einfiel, die sie akzeptieren konnte, damit ich nicht dahin musste. Damit ich IHN nicht sehen musste.
Ich klemmte mir meine Haare links und rechts hinter die Ohren, nickte mir selbst noch einmal aufmunternd im Spiegel zu und verließ dann den Fahrstuhl.
Über meinem Kopf waren an einem Schild aus Milchglas die Worte Station 7, Kinderpalliativmedizin zu lesen. Ich ging darunter durch, und die Flügeltüren meiner Station öffneten sich mit einem Klicken vor mir. Das Erste, was mir wie jeden Abend in die Augen fiel, war die Fensterfront, die sich rechts von mir ausbreitete und hinter der sich ein dunkelblau-lila gefärbter Himmel über dem Park abzeichnete. Die Kinder hatten wieder mit unseren Acrylstiften an die Scheiben gemalt, ich sah ein paar Sonnen, Bäume, Blumen und einige motivierende Sprüche in einer tollen Schönschrift, die sicher unsere älteste Patientin Marnie in mühevoller Kleinstarbeit angebracht hatte. Ich musste schmunzeln, als ich »Heute ist der perfekte Tag, um glücklich zu sein« lesen konnte, bevor ich auf der linken Seite in die Mitarbeiterumkleide trat.
Meine Bereichskleidung anzulegen, also die dunkelblaue Hose und das dazu passende Oberteil, war für mich wie ein Wechsel in einen anderen Modus meiner Selbst. Ich betrat den kleinen Raum, der bis in die hinterste Ecke mit Spinden vollgepackt war, als Sami, die große Schwester von Maxi, Jannis und Fynn, die sich Gedanken machte um das halb leere Konto und was sie im Haushalt noch zu erledigen hatte – und verließ ihn als Samira, die Krankenschwester. Fokussiert auf meine Patienten, auf meine Arbeit, und nichts anderes war mehr wichtig in diesem Moment. Es war seltsam heilsam, auch nach über zwei Jahren hier auf Station. Hier zu sein setzte meine Probleme von zu Hause in eine völlig andere, neue Perspektive, ließ sie oft ein bisschen kleiner und unwichtiger erscheinen. Weniger schlimm, in jedem Fall.
Die Erleichterung, meine Sorgen in der Umkleide zurücklassen zu können, hielt an diesem Abend allerdings nicht sonderlich lange an. Ich war gerade durch die Tür wieder nach draußen in den Gang der Station getreten, da merkte ich schon, dass etwas anders war. Im Vorbeigehen wurde mir dann auch klar, was genau es war: Zimmer 4, das letzte vor der Stationsküche, hatte eine neue Beschriftung. Die Patienten, die zu uns kamen, schrieben ihre Namen immer selbst auf die kleine Tafel vor ihrem Zimmer. Vorher hatten hier verschnörkelte, pinke Buchstaben gestanden, die nun durch eine eckige, kleinere Schrift in Blau ausgetauscht worden waren. Aus Emma war Miriam geworden. Ich konnte nichts gegen das unangenehme Ziehen in meinem Magen tun, nichts gegen das schwere Gefühl, das sich in meinem Körper ausbreiten wollte, obwohl ich schon so viele Namenswechsel mitbekommen hatte. Es war jedes Mal wieder aufs Neue ein Schock.
»Sami!«
Ich zuckte zusammen, so sehr war ich in Gedanken versunken gewesen, und riss den Kopf zur Küche herum. Meine Kollegin war gerade herausgetreten, ihre mit Blumen bedruckte, dampfende Thermostasse in der Hand, und strahlte mich begeistert an. »Wir hatten ewig keinen Dienst zusammen.«
»Wenn du mich vermisst, musst du einfach öfter Nachtdienst machen, Lilly«, gab ich lächelnd zurück. Wir drückten uns kurz, und ich spürte, dass sie mir auch gefehlt hatte. Lilly und ich hatten am gleichen Tag vor zwei Jahren auf der Kinderpalliativ angefangen und die aufregende erste Zeit zusammen durchgestanden. Als ich vor einem Jahr dann in den permanenten Nachtdienst gewechselt hatte, hatten wir uns etwas aus den Augen verloren – aber ich freute mich trotzdem jedes Mal, wenn wir zusammen arbeiteten oder uns auf dem Stationsflur begegneten.
Lilly schob sich eine Strähne ihrer langen, blonden Haare hinters Ohr und grinste. »Ich bin nicht für den Nachtdienst geschaffen, das weißt du. Zwei Nächte reichen schon, dass ich einen Jetlag für die nächsten Wochen habe. Keine Ahnung, wie du es schaffst, mit deinen ganzen Nächten noch einen vernünftigen Tagesablauf auf die Reihe zu bekommen.«
»Schlafmangel und Koffeinsucht, von Vernunft kann keine Rede sein.« Ich lachte bei ihrem zweifelnden Blick, bevor meine Augen wieder zu der Tür neben mir wanderten.
Lilly gab ein trauriges Brummen von sich. »Emma ist heute Vormittag eingeschlafen. Wohl sehr friedlich, hat der Spätdienst gesagt. Ihre Mutter war die ganze Zeit da und hat ihre Hand gehalten.«
»Ach, Emma.« Ich atmete tief durch und konnte mich gerade noch davon abhalten, über das helle Holz der Tür zu streichen. Ein lautes Seufzen hob zumindest einen Teil der Schwere von meiner Brust. Ich drehte mich zu Lilly um, die mich schon in Richtung des Stationszimmers winkte. »Woher weißt du das eigentlich? Hast du schon mit dem Spätdienst gesprochen?«, wollte ich überrascht wissen. Ein Blick auf meine Uhr bestätigte, dass der Nachtdienst noch nicht offiziell begonnen hatte.
»Ja, ich habe sie gerade nach Hause geschickt.« Lilly zuckte mit den Schultern, bevor sie die Tür des Schwesternzimmers hinter uns schloss. Durch die Fensterfront lag die dunkler werdende Station vor uns, die Stille von dort draußen schien noch drückender zu werden. »Ich bin immer so unruhig vor dem Nachtdienst, vielleicht, weil ich die Uhrzeit nicht gewohnt bin. Deshalb bin ich viel zu früh von zu Hause los und habe mir schon eine Übergabe geben lassen. Bis auf Emma und ihre Nachfolgerin Miriam gibt es auch gar nichts Neues für dich – du warst ja gestern Nacht schon da.«
»Stimmt.« Mein Blick glitt immer wieder zu dem Zimmer, ich konnte mich gar nicht davon abhalten. Ich biss mir auf die Unterlippe. »Es ist gut so, oder? Ihr ging es schon lange so schlecht.«
»Sie hat sich ungewöhnlich lange ans Leben geklammert«, gab Lilly leise zu. »Aber manchmal ist das so, das wissen wir ja. Ich glaube, sie hatte einfach Angst.«
»Und heute nicht mehr?«
Meine Kollegin zuckte wieder mit den Schultern und ließ sich auf den Schreibtischstuhl sinken. Ich setzte mich ihr gegenüber, und wir schwiegen eine kurze Weile wie in stiller Übereinkunft, bevor sie einfach zu reden begann und mir erzählte, was ich tagsüber verpasst hatte. Es war nicht viel. Nur bei der neuen Patientin hörte ich genauer hin. Miriam, sechzehn Jahre, Zustand nach überstandener Chemotherapie. Danach war sie krebsfrei gewesen, doch aus irgendeinem Grund hatten sich ihre Nierenwerte nicht verbessert, waren sogar weiter abgerutscht und auf ein Nierenversagen zugeschlittert, und nun stand die Sechzehnjährige auf der Transplantationsliste. Unsere Oberärztin Frau Doktor Katharina Fischer hatte wohl wenig Hoffnung auf eine Genesung, weil niemand so richtig wusste, was die Werte verschlechterte.
»Traurige Geschichte, wirklich«, endete Lilly und sank ein wenig in sich zusammen. Bei ihrem Anblick ertappte ich mich bei dem Gedanken, den ich in der Vergangenheit schon öfter gehabt hatte: dass Lilly vielleicht auf einer anderen Station besser aufgehoben wäre. Viele Schicksale der Patienten nahmen sie sehr mit, mehr noch als mich, und im letzten Jahr war sie mir immer stiller und trauriger vorgekommen. Dabei war Lilly eigentlich ein absoluter Sonnenschein, immer mit einem Grinsen im Gesicht.
Weil es mir aber nicht zustand, das für sie zu entscheiden, versuchte ich, sie auf eine andere Weise abzulenken: »Und gibt es etwas aus dem Tagdienst, das ich verpasst habe? Stationsklatsch?« Ich presste die Lippen zusammen, bevor ich hinterherschob: »Wie geht es zum Beispiel Esra?«
Es funktionierte. Lillys vorher noch traurig-nachdenkliches Gesicht nahm eine etwas dunklere Farbe an. »Gut, denke ich. Aber das könntest du sie auch selbst fragen.« Sie wich meinem Blick aus, und ich spürte, wie meine Mundwinkel nach oben wanderten. »Es ist aber viel spannender, DICH nach ihr zu fragen. Vor allem, um den schönen Farbwechsel in deinem Gesicht zu sehen.«
Sie boxte mich in die Seite, hatte aber selbst auch wieder ein Grinsen auf dem Gesicht. »Hör auf.«
»Unmöglich. Dass du in unsere Stationsleitung verknallt bist, ist nahezu meine einzige Aufmunterung im Leben.«
»Ich bin nicht verknallt in sie«, gab Lilly mit einem äußerst verdächtigen Quietschen in der Stimme zurück und stand etwas zu energisch von ihrem Stuhl auf. »Wir sollten einen Rundgang machen. Willst du die linke oder die rechte Seite übernehmen?«
»Eigentlich will ich noch mehr Infos über dein Nicht-verknallt-Sein«, meinte ich schmunzelnd. »Aber dann wohl nach dem Rundgang.« Mein Blick wanderte über den Flur und blieb wieder an dem Zimmer hängen, in dem vorher Emma gewohnt hatte. Ich musste mich zusammenreißen. Es gab noch Patienten, denen ich helfen konnte, Patienten, die mich brauchten. »Rechte Seite. Ich schau mir unsere neue Patientin mal an.«
»In Ordnung.« Lilly war schon an der Tür, aber sie warf mir noch einen Blick über ihre Schulter zu. »Keine Esra-Fragen mehr, sonst kannst du die nächsten Nachtdienste allein machen.«
Ich grinste, bevor ich mich ebenfalls vom Stuhl erhob. Zeit für den Krankenschwester-Modus.
Mein erster Weg führte mich zu Luisa, einer Zehnjährigen, die bereits mit Fehlbildungen des Gehirns geboren worden war. Sie kam seit vielen Jahren immer wieder zu uns, wenn sich ihre Symptome verschlimmerten, und brachte immer ihren übergroßen Teddybären Bruno mit, der im Bett mehr Platz einnahm als das zierliche Mädchen. Sie begrüßte mich mit ihrem zahnlückigen Grinsen, ihr schien es heute ganz gut zu gehen, und als ich das Zimmer nach einer kurzen Plauderei wieder verließ, war ich sicher, dass wir sie bald nach Hause entlassen könnten. Ein Zimmer weiter saß Enrico im Schneidersitz auf seinem Bett und spielte mit einem Plastiktruck, während sein Vater wie jeden Abend auf dem Stuhl daneben zusammengesackt und eingeschlafen war. Ich weckte ihn, um ihn nach Hause zu schicken, und kontrollierte anschließend Enricos Infusionen. Es waren im Moment noch drei – flüssige Nahrung und Kochsalzlösung, weil der Tumor in seinem Mund ihn aktuell am Essen hinderte, sowie ein Medikament gegen seine Schmerzen. Er blickte zu mir auf, als ich zwei der Infusionen absteckte, weil sie leer waren. »Doktor Fischer hat gesagt, dass ich wohl wieder fit genug bin, um zurück nach drüben verlegt zu werden.«
»Das habe ich in der Übergabe auch schon gehört. Freust du dich?«, hakte ich lächelnd nach, während ich alles verräumte und ihn dann zudeckte.
Enrico verzog ein bisschen das Gesicht und drückte seinen kleinen Plüschelefanten an sich, bevor er ebenfalls lächelte. »Na ja. Klar. Irgendwie.«
»Es ist verständlich, dass du Angst vor der erneuten Chemo hast. Aber dass du wieder loslegen kannst, ist ein sehr gutes Zeichen. Dann hast du es schneller hinter dir.«
»Ich hoffe, dass ich nicht wieder dem Chefarzt auf die teuren Schuhe kotzen muss«, gab er etwas kleinlaut zurück.
Ich lachte über sein Gesicht, das irgendwo zwischen Belustigung und Scham lag. »Und wenn schon. Er ist der Chefarzt – wenn sich jemand ein neues Paar Schuhe leisten kann, dann wohl er.« Ich grinste schelmisch. »Versuch einfach, uns arme Krankenschwestern zu verfehlen, okay?«
Als Antwort reckte Enrico einen Daumen nach oben und sank dann in seinem Kissen zusammen. Er sah so erschöpft aus, dass ich sicher war, beim Türenschließen bereits sein Schnarchen zu hören.
Vor dem nächsten Zimmer blieb ich einen Moment stehen. Der Flur kam mir jetzt noch stiller vor, vielleicht, weil ich den Schlaf langsam spürte, der sich über die Patienten gelegt hatte. Lilly musste wohl in einem ihrer Zimmer sein, denn von ihr war keine Spur zu entdecken. Ich ließ den Blick kurz über den pinkblauen Himmel schweifen, der sich mir durch das große Fenster am anderen Ende des Ganges in all seiner Pracht zeigte, bevor ich mich wieder meiner letzten Tür zuwandte und dem Namensschild daneben. Ich konnte mich noch gut an Emma erinnern, wie sie an ihrem ersten Tag hier mit zitternder Hand ihren Namen gekrakelt und sich dann mit einer erhobenen Augenbraue zu mir umgedreht hatte. »Einen Schönschreibwettbewerb gewinnt meine Schrift nicht mehr.«
Wir hatten gelacht, als gäbe es den größer werdenden Tumor in ihrer Brust nicht. Aber hier holte einen die Realität immer wieder ein – früher oder später.
Ich atmete tief durch, mehr als einmal, bevor ich meine Hand hob, um an die Tür zu klopfen. Beinahe im selben Moment wurde sie von innen aufgerissen, und eine etwas erschrocken wirkende Frau stand vor mir. Sie sah nicht älter aus als vierzig, ihr Gesicht war dezent geschminkt, und ihre langen, blonden Haare standen denen der Models auf der Vogue in nichts nach.
»Hallo«, grüßte sie, immer noch etwas überrumpelt, und zog mit einer Hand den Cardigan enger um sich. »Sind Sie die Nachtschwester?«
»Ja, mein Name ist Samira. Und Sie müssen Frau Zimmer sein?« Als sie nickte, lächelte ich freundlich. »Ich wollte mich nur kurz bei Miriam vorstellen und sehen, ob sie vor der Nacht noch irgendetwas braucht. Wollten Sie gerade gehen?«
Frau Zimmer zögerte für einen Moment, warf einen Blick in den Raum hinter sich und schenkte mir dann ebenfalls ein warmes, wenn auch sehr müdes Lächeln. »Ja. Ich wohne derzeit im Elternhaus hinter der Klinik. Großartig, dass das Sankt Alexander das anbietet. Aber vielleicht komme ich kurz doch noch mit rein, wenn Sie sich vorstellen.«
Lilly hatte mich schon vorgewarnt, dass Miriams Mutter eine Glucke war – bei der Erkrankung ihrer Tochter war das aber auch kein Wunder. Ich bemühte mich um ein aufmunterndes Lächeln, als wir nebeneinander in den Raum traten, denn wenn ich in meiner Zeit hier etwas gelernt hatte, dann, dass Hoffnung wirklich Berge versetzen konnte – das war nicht nur ein leerer Spruch auf dieser Station.
»Hallo, Miriam, ich bin Samira«, grüßte ich meine Patientin, die aber nicht einmal von ihrem Handy aufblickte. Sie brummte nur etwas Unverständliches und wischte sich mit der linken Hand den violett gefärbten Pony tiefer ins Gesicht.
Ihre Mutter sah mich entschuldigend an, bevor sie sanft sagte: »Samira ist die Nachtschwester. Falls du irgendetwas brauchst, solange ich weg bin, kannst du dich an sie wenden.«
Miriam sah nun doch für eine Sekunde auf, und ich spürte einen Stich in meinem Inneren. In diesen grünen Augen lagen so viel Düsternis und Hoffnungslosigkeit, dass mir selbst ganz anders wurde. »Hey«, sagte sie mit leiser Stimme, bevor sie sich wieder dem Handy zuwandte.
Viel weiter würden wir heute Abend wohl nicht kommen. »Du kannst jederzeit nach mir oder meiner Kollegin klingeln, wenn dir etwas fehlt. Auch wenn du nur reden willst. Ansonsten schlaf gut.« Ich nickte Frau Zimmer zu, die immer noch mit sorgenvollen, großen Augen ihre Tochter anstarrte, und bedeutete ihr, mich nach draußen zu begleiten.
Kaum war die Tür hinter uns geschlossen, seufzte die Frau tief und schlang die Arme um ihren Oberkörper. »Es tut mir leid, sie ist sonst nicht so. Das ist alles schwierig für sie.«
»Machen Sie sich keine Gedanken, Frau Zimmer.« Ich lächelte sie verstehend an. »Und für Sie ist das sicher auch alles andere als leicht. Legen Sie sich ein wenig hin und tanken Sie Kraft für morgen, in Ordnung?«
Sie nickte, aber bevor sie sich abwandte, fügte sie noch hinzu: »Bitte, nennen Sie mich Susanne. Danke für alles.«
Ich sah ihr nach, wie sie mit gebeugtem Rücken über die Station zum Ausgang lief, und spürte eine Mischung aus Mitleid und Unbehagen in mir. Plötzlich hatte ich Bilder von einer ganz bestimmten Person im Kopf, die blass und kraftlos im Krankenhaus gelegen hatte. Ich holte tief Luft und jagte die Gedanken fort, bevor ich wieder zum Stationszimmer ging.
Kapitel 3
Die Nacht verlief überwiegend ruhig, und ich war froh, mich von Lillys Ausführungen über ihr neu gekauftes Blumen-Regencape mit passenden Gummistiefeln von den Dingen ablenken zu lassen, die mir eigentlich im Kopf herumgingen. Über die verstorbene Emma zu der hoffnungslosen Miriam bis hin zu meinen eigenen Problemen, die ich ganz gut verdrängen konnte, bis Lilly fragte: »Wie geht es eigentlich deinen Brüdern?«
Ich nahm mit düsterem Blick einen Schluck von meinem Kaffee. »Jannis und Max haben heute Nachmittag beinahe die Wohnung in Brand gesetzt. Weitere Fragen?«
Lilly schnappte nach Luft und hustete einmal in ihren Thermobecher. »Äh ja, um ehrlich zu sein, jede Menge Fragen.«
»Sie haben versucht, mir Frühstück zu machen«, erklärte ich, ohne ein Schmunzeln unterdrücken zu können. »Pancakes. Ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen.«
»Das ist … süß. Und ein bisschen gefährlich.« Sie stützte das Gesicht auf ihre Hand und ließ den Blick durch das Fenster über die leere, im Dunkeln liegende Station schweifen. »Kein Wunder, dass du fast so eine Gluckenmama bist wie Miriams Mutter.«
Bei meinem schnellen Aufsetzen im Drehstuhl hätte ich beinahe meinen Kaffee verschüttet. »Ich bin keine Gluckenmama«, zischte ich. »Aber die beiden leben bei mir und haben nur Unsinn im Kopf. Ich bin verantwortlich für sie und zufällig auch für die Wohnung, in der wir leben. Es wäre mir um einiges lieber, wenn wir nicht in einen Park umziehen müssten.«
»Schon gut, schon gut.« Lilly winkte ab. »Du hast ja recht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es ist, in unserem Alter für einen Teenager und einen Fast-Teenager verantwortlich zu sein, so als … Mama-Ersatz?« Sie sah mich fragend an, wie um sicherzugehen, dass mir dieses Wort besser passte. Ich beantwortete es mit einem Schnauben und schluckte die Bemerkungen runter, die ich am liebsten darauf gesagt hätte.
»Es ist sicher hart«, murmelte sie abwesend, und beinahe sofort kam mir der Brief wieder in den Sinn, der zu Hause auf meinem Schreibtisch lag. Der mit der horrenden Nachzahlung, die ich kaum stemmen konnte, ohne dass meine Brüder etwas davon mitbekämen. Und gerade das wollte ich eigentlich vermeiden – schließlich hatte ich mir geschworen, dass sie sich keine Sorgen mehr machen mussten. Dass ich auf sie aufpassen würde, komme, was wolle.
»Hör auf«, sagte Lilly neben mir.
Ich drehte überrascht den Kopf zu ihr. »Womit?«
»Du denkst so heftig nach, dass du dir schon wieder die Lippe zerkaust.« Sie schenkte mir einen tadelnden Blick, und ich presste schuldbewusst den Mund zusammen. Lilly deutete auf das Bord, das vor uns über dem Schreibtisch an der Wand hing und an dem gerade ein rotes Licht aufblinkte. »Miriam klingelt. Ich würde dir ja anbieten, für dich zu übernehmen, aber ich glaube, dir tut die Ablenkung gerade ganz gut.«
Ich warf einen Blick auf die Uhr. Kurz nach eins. Seufzend erhob ich mich vom Stuhl. »Wer ist jetzt die Gluckenmama von uns beiden?«
Das quittierte sie nur noch mit einem Grinsen.
Miriam lag, die Decke bis zum Kinn gezogen, auf ihrem Bett und sah mich mit großen Augen an, als ich zur Tür reinkam. »Ich brauche mein Medikament zum Einschlafen«, krächzte sie sofort ohne Umschweife.
Etwas überrumpelt blieb ich in der Tür stehen. »Vielleicht können wir es erst mal mit einem Schlaftee oder einer heißen Milch mit Honig probieren?«
Sie stöhnte genervt und setzte sich auf. »Die Ärzte in der Charité haben mir immer Dormicum gegeben.«
Das war ein ziemlich starkes Schlafmittel. Als ich skeptisch die Augenbrauen nach oben zog, seufzte Miriam. »Ich kann nicht schlafen. Seit Wochen. Die Schmerzen und die … Angst«, sagte sie etwas sanfter. Es war ihr deutlich anzusehen, dass es sie Überwindung kostete, das auszusprechen. »Dormicum war das Einzige, was half.«
»Wie lange nimmst du das schon?«
Sie zuckte mit den Schultern und zwirbelte eine violette Haarsträhne um ihren Finger. »Etwa eine Woche. Seitdem geht es mir tagsüber auch besser.«
Ihr Blick ging wieder nach unten, und sie begann, ihre Hände auf der Bettdecke zu einem nervösen Knoten zu verschlingen. Es war deutlich erkennbar, dass es ihr nicht gut ging, und die dunklen Ringe unter ihren Augen würden nach einer kurzen Nacht sicher auch nicht besser werden.
Ich seufzte ergeben. »Ich spreche mit dem Dienstarzt, ob er es dir anordnen kann.«
»Danke.« Miriam sah mich wieder an und brachte tatsächlich ein kurzes Lächeln zustande, bevor sie sich unter der Decke verkroch und mit leerem Blick aus dem Fenster starrte.
Nachdenklich ging ich zurück ins Schwesternzimmer.
»Kannst du den Dienstarzt anpiepen?«, fragte ich an Lilly gewandt, während ich die Kurve von Miriam heraussuchte. Wir hatten die Medikamentenzettel ihrer vorherigen Station in der Charité da, und tatsächlich war ihr abends an den letzten acht Tagen Dormicum verschrieben worden – eine geringere Dosis, um ihre Niere nicht weiter zu belasten, aber dennoch ein starkes Mittel.
»Mit größtem Vergnügen«, sagte Lilly neben mir und nahm das Telefon in die Hand. Ich warf ihr über meine Schulter einen Blick zu. »Wer hat denn heute Dienst?«
Ich hoffte inständig auf unsere Oberärztin Katharina, aber Lillys Gesicht sprach eine andere Sprache. Sie steckte das Telefon wieder in die Ladestation und wippte mit den Augenbrauen. »Louis Reichert hat die nächsten Nächte bekommen.«
Also nicht unsere Oberärztin, sondern einer der Assistenzärzte. Noch dazu ein ziemlich frischer – ich wusste, dass Louis Reichert erst seit ein paar Monaten bei uns am Sankt Alex war. Ich hatte ihn erst einmal beim Frühlingsfest getroffen, als Katharina uns die neuen Assistenzärzte vorgestellt hatte, und sonst nur ab und zu flüchtig im Flur oder auf Station. Er war wirklich eine Erscheinung. Wenn jemand auch nur ansatzweise beweisen wollte, dass Ärzte auch wie in den beliebten Netflix-Serien aussehen konnten, dann musste er nur Louis als Beispiel nehmen. Er war blond, groß, sicher beinahe einen Kopf größer als ich, und ich hatte ihn noch nie ohne dieses charmante Lächeln gesehen, das sehr viele der weiblichen Mitarbeiter geradezu unwiderstehlich fanden. Obwohl ich ihn kaum älter schätzte als mich, nicht älter als dreiundzwanzig oder vierundzwanzig also, hatte er eine unglaublich selbstsichere Ausstrahlung. Vielleicht lag es an dem Arztkittel, der Menschen oft einen Attraktivitätsbonus verlieh. Nicht, dass Louis Reichert den gebraucht hätte. Er hatte ein sehr schön geschnittenes, kantiges Gesicht und so strahlend blaue Augen, dass es schon beinahe lächerlich war.
Ich war niemand, der auf Gerüchte hörte oder Menschen vorschnell verurteilte. Aber wie es bei einem kleinen Haus wie unserem nun einmal war, hörte man unweigerlich jeglichen Klatsch, der so übereinander erzählt wurde. Ganz besonders unter den Pflegern. Und über Louis Reichert wurde verdammt viel erzählt.
Er hatte vor einem halben Jahr im Sankt Alex angefangen und war wohl keiner dieser Überflieger-Medizinstudenten, die nichts anderes taten als lernen. Von Natascha, unserer anderen Assistenzärztin, wusste ich, dass er eher durchschnittliche Noten im Studium hatte und dass er sich die Wochenenden gern in den Berliner Clubs um die Ohren schlug. Seine Mutter war eine deutschlandweit bekannte Chirurgin, die in der Charité arbeitete und ihrem Sohn eine sehr schicke Wohnung in Mitte bezahlte. Jemand mit einer großen Karriere vor sich, laut unserer Oberärztin. Louis sollte wohl in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter treten, hatte im ersten Anlauf aber keine Assistenzarztstelle in der Charité bekommen.
Wenn ich meinen Kollegen aus dem Tagdienst glauben konnte, hielt er sich nie länger als unbedingt notwendig in einem Patientenzimmer auf, hielt kaum Augenkontakt mit den Kindern und betrachtete sie auch nicht als Patienten, sondern als spannende Diagnosen, die man erforschen konnte. Typisch junger Chirurg wahrscheinlich, behaupteten böse Zungen. Aber ich wusste auch, dass meine Kollegen gern übertrieben, und wollte mir lieber mein eigenes Bild von ihm machen. Und dazu bekam ich heute Nacht anscheinend Gelegenheit.
Es dauerte eine Weile, bis der angepiepte Assistenzarzt kam, und ich wandte mich meiner Computerdokumentation zu. Etwa fünfzehn Minuten später hörte ich schließlich die Tür zu unserer Station und blickte von meinen Kurven auf. Durch die große Fensterfront unseres Schwesternzimmers konnte ich ihn schon von Weitem über den Gang gehen sehen. Mit wehendem Kittel über der hellblauen Bereichskleidung, eine Hand locker in der Tasche, in der anderen Hand hielt er sein Handy, auf das er kaugummikauend starrte. Er sah verdammt gut aus, und seine selbstbewusste, lockere Haltung ließ vermuten, dass er das wusste.
Im Licht seines Displays konnte ich sehen, dass er schmunzelte. Im selben Moment, in dem ich darüber nachdachte, ob er wohl einer der Schwestern schrieb, die ihn so anhimmelten, hob Louis den Kopf. Unsere Blicke trafen sich, er ließ das Handy sinken und lächelte breit. So ein Ich-wurde-noch-nicht-für-Grey’s Anatomy-gecastet-aber-es-wird-bestimmt-noch-passieren-Lächeln, mit perfekten, weißen Zähnen und einem etwas frechen Ausdruck in den Mundwinkeln. Ich hielt seinem Blick so neutral wie möglich stand, das schien ihm aber nichts weiter auszumachen.
Mit fast schon federndem Schritt ging er um das Stationszimmer herum und stellte sich in die offene Glastür. »Hey, alles in Ordnung?«
»Hey, Louis«, grüßte Lilly hinter mir. Ich konnte ihrer Stimme anhören, dass sie grinste. »Kein Notfall, nur eine kleine Anordnungssache. Meine Kollegin hat dich angepiept, kennst du Samira schon?«
Was sollte das denn jetzt? Ich warf ihr über meine Schulter einen entsetzten Blick zu und sah, dass sie bereits einen Sicherheitsabstand zwischen uns gebracht hatte. Wahrscheinlich, weil sie Angst hatte, dass ich ihr in die Hacken fuhr. Sie grinste mich nur an und zuckte für eine Millisekunde mit den Augenbrauen. Lang genug, um zu verstehen, dass sie mich anscheinend wirklich mit dem Assistenzarzt verkuppeln wollte. Das konnte unmöglich ihr Ernst sein!
»Tue ich.«
Louis’ dunkle Stimme direkt neben mir ließ mich erschaudern. Ich fuhr zurück und sah, dass er die Hände in die Taschen seines Kittels gesteckt und sich in den Türrahmen gelehnt hatte. Er lächelte fast schon geheimnisvoll, und seine blauen Augen funkelten vergnügt.
Langsam zog ich meine linke Augenbraue nach oben. »Tust du das?«
»Von der Klinikfeier im Frühling. Katharina hat uns kurz einander vorgestellt. Erinnerst du dich nicht?«
Doch tat ich. Louis war der Einzige gewesen, den wir nicht von diversen Praktika kannten, weil er diese in der Charité absolviert hatte und nicht bei uns im Haus, deshalb waren die meisten von uns besonders neugierig auf ihn gewesen. Aber er hatte niemanden von uns länger gemustert, und ich wunderte mich, dass er sich überhaupt daran erinnerte.
Aber das war jetzt auch nicht von Relevanz. Ich hielt ihm die Kurve hin, an der ich gerade gesessen hatte.
»Miriam Zimmer, sechzehn Jahre, Zustand nach Nierenkarzinom, Nierenversagen, steht relativ weit oben auf der Transplantationsliste.«
Erstaunt sah Louis auf die Kurve runter, wahrscheinlich weil er eigentlich damit gerechnet hatte, dass ich mehr auf ihn einging, statt ihn direkt mit meiner Patientin zu konfrontieren. Er nahm die Kurve in die Hand, sein Blick wanderte wieder zu mir. Seine blauen Augen suchten mein Gesicht ab, bevor wieder ein Lächeln auf seinem Mund auftauchte. »Ich fürchte, das übersteigt ein wenig meine Kompetenzen. Die Gerüchte, dass ich Kontakte zum Organ-Schwarzmarkt hätte, sind leider ziemlich übertrieben.«
Okay, er hatte Humor. Das musste man ihm lassen.
»Ziemlich?« Ich zog die Augenbrauen nach oben, schüttelte dann aber den Kopf. »Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Du sollst auch gar kein Organ besorgen, sondern nur ein Schlafmittel ansetzen. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher …« Ich stoppte ab, und Louis sah mich fragend an. »Weswegen?«
»Es ist ein starkes Medikament.«
»Wenn nichts anderes hilft.« Er zuckte mit den Schultern und blätterte durch die Kurve wie ich zuvor. »Die Dosis ist vertretbar. Ich ordne es an.«
Während Louis den schnell angebotenen Kuli von Lilly annahm und ihr dafür ein sicher sehr bezauberndes Lächeln zuwarf, zog ich die Augenbrauen zusammen. »Willst du nicht zumindest kurz mit ihr sprechen?«
Meine Worte klangen etwas schärfer, als ich es beabsichtigt hatte. Aber die Tatsache, dass er Miriam nicht einmal sehen wollte, bestätigte irgendwie ein wenig die Gerüchte, die ich schon über ihn gehört hatte. Dass er sich nur für die Diagnosen interessierte, nicht für die Menschen dahinter. Komm schon, beweis mir, dass die anderen sich irren. Sprich kurz mit Miriam. Ich wusste gar nicht, warum es mir so wichtig war, dass er sich als besser herausstellte, als die Gerüchte über ihn waren. Vielleicht, weil ich immer noch das ein wenig verklärte Bild von Ärzten hatte, denen das Wohl ihrer Patienten das Wichtigste war. »Ich hatte gehofft, dass du sie vielleicht doch noch einmal zu einem Schlaftee oder etwas Sanfterem überreden könntest. Als Arzt vertraut sie deinem Urteil vielleicht mehr als meinem.«
Louis blickte mich an, und für einen kleinen Moment hatte ich das Gefühl, dass meine Worte ihn tatsächlich verunsicherten. Oder besorgten. Dann war da aber wieder dieses unverwüstliche Grinsen von vorher. »Ich denke, dass das nicht nötig ist. Es ist spät, und sie muss schlafen, um sich zu erholen. Und die Charité-Kollegen werden sich ja auch was dabei gedacht haben.«
Er kritzelte etwas in die Kurve, und ich spürte, wie der Widerstand in mir wuchs. Vielleicht hatte er recht. Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass er es wenigstens versuchte. Mit Miriam sprach und ihr möglicherweise ein bisschen die Angst nahm. Er war immerhin Arzt, verdammt, und wir waren hier auf einer Palliativstation. Aber in Louis Reicherts Fall schienen die Gerüchte doch zu stimmen. Manche Ärzte, schoss es mir durch den Kopf, sind wirklich nicht für die Arbeit mit Patienten geschaffen.
Louis reichte mir die Kurve und beugte sich dabei so nah zu mir runter, dass ich den Weichspüler seiner Klamotten riechen konnte. »Aber falls noch etwas sein sollte, lasst es mich wissen. Ich bin schneller auf Station, als ihr bis drei zählen könnt.«
»Danke«, gab ich kühl zurück und verwendete dann seine eigenen Worte: »Aber das wird wohl nicht nötig sein.«
Ich stand von meinem Platz auf, warf die Kurve auf den Tisch und drehte mich zu Lilly um, die ganz verdutzt aussah von meiner Reaktion. »Ich gebe Miriam schnell ihr Schlafmedikament und mach dann noch eine Runde bei den anderen, um die letzten Infusionen abzustecken.«
»Okay«, gab sie vorsichtig zurück. Ihr Blick zuckte kurz zu dem Assistenzarzt und dann wieder zu mir zurück. Ihre gut gemeinten Verkupplungspläne schienen wohl gerade vor ihrem inneren Auge durch das Fenster davonzufliegen.
Louis stand noch immer in der Tür, also gab ich ein lautes Seufzen von mir. »Darf ich bitte?«
Er sah mich an, offensichtlich vollkommen verwirrt, dass ich seinem Charme nicht so erlegen war wie die anderen Damen im Krankenhaus. Aber damit musste er heute wohl leben. Ein paar Sekunden funkelten mich seine zugegebenermaßen beeindruckenden blauen Augen noch an, dann trat er zur Seite und machte mir den Weg frei.
»Danke«, sagte ich und würdigte ihn keines weiteren Blickes, als ich zum Behandlungsraum ging, wo unser Medikamentenschrank stand. Seine Blicke spürte ich auf dem ganzen Weg dorthin auf meinem Rücken brennen, aber ich drehte mich nicht mehr um, um mich zu verabschieden und ihm einen guten restlichen Nachtdienst zu wünschen, was ich sonst normalerweise täte. Aber die Tatsache, dass er den Test nicht bestanden hatte, nagte an mir. Vielleicht, weil es für mich nicht nur um Miriam ging, nicht nur um die Patienten hier auf Station, die schwer krank und verängstigt waren und die empathische Ärzte brauchten. Vielleicht, weil ich an jemand anderen dachte, totenblass in einem Krankenhausbett liegend, an den ich nur einen Arzt gelassen hätte, der zu hundert Prozent hinter seinen Patienten stand. Ohne dass ich es wollte, verkrampfte sich meine Hand zu einer Faust.
Als ich nach zehn Minuten wieder ins Schwesternzimmer zurückkehrte, war Louis nicht mehr da. Es blieben nur die verwirrten Blicke von Lilly und der Geruch nach Weichspüler in der Luft.
Kapitel 4
Durch die kleinen Fenster im Treppenhaus drang bereits Sonnenlicht in den Flur, als ich zu unserer Wohnung nach oben ging. Irgendjemand hatte vor ein paar Wochen eine kleine Zimmerpflanze in einem giftgrünen Topf auf das Fensterbrett unter unserer Etage gestellt, und im Vorbeigehen bemerkte ich, dass sie schon wieder neue Knospen trieb. Ich war jeden Tag überrascht und ein bisschen erfreut, dass sie noch lebte. Es war in den letzten Monaten beinahe schon üblich geworden, dass jemand einfach die alten, vertrockneten Blumen im Treppenhaus durch neue ersetzte, statt sie einmal zu gießen. Jeder verließ sich auf den anderen, dass er es tat, statt selbst einmal die Gießkanne in die Hand zu nehmen – aber um diese hier schien sich jemand wirklich zu kümmern.
Als ich am oberen Treppenabsatz angekommen war, blickte ich noch einmal über meine Schulter zurück, und für eine Sekunde überlegte ich, wer das wohl gewesen sein könnte. Aber ich war todmüde vom Nachtdienst, meine Muskeln schmerzten, und meine Gedanken wollten nicht mehr richtig fließen. Und eigentlich war es ja auch egal. Es war schön, sich einfach mal an so etwas Kleinem zu erfreuen, und erstaunlicherweise zauberte mir der Anblick tatsächlich ein Lächeln aufs Gesicht.
Ein ziehender Schmerz breitete sich in meinem Kopf aus, als ich den Schlüssel in unsere Wohnungstür steckte. Im selben Moment öffnete sich die Tür neben unserer, und ein helles Lachen drang heraus. »… kannst du dir morgen deine Arbeitsbrote einfach selbst machen, du elender Miesepeter!«, kicherte jemand neckisch, dann wurde die Tür von außen zugeworfen, und unsere Nachbarin Bine stand neben mir im Flur. Überrascht sah sie mich an. »Oh, Samira! Kommst du oder gehst du gerade?«
Mehr als ein müdes »Nachtdienst« brachte ich gar nicht mehr zustande. Wir mussten in dieser Sekunde wie ein Negativ des jeweils anderen aussehen – Bine mit ihren wachen, blauen Augen, dem dezenten Make-up und der schicken, weißen Bluse sah aus, als würde sie das Wort »Schlafmangel« höchstens aus dem Wörterbuch kennen. Ich hingegen hatte mittlerweile wahrscheinlich Augenringe bis zu den Knien und war mir sicher, dass der Krankenhausmief noch an mir klebte und gegen den frischen und sauberen Zitronenduft ankämpfte, den sie verströmte.
Bine lächelte breit und steckte eine ihrer glänzenden, blauen Locken hinters Ohr. »Wenn ich Schichtdienst machen müsste, würde ich um die Uhrzeit sicher nicht so gut aussehen wie du.«
»Ich weiß, dass du lügst, aber bitte hör nicht auf damit«, gab ich schwach grinsend zurück.
Sie lachte, und mir fiel ein, was Maxi am Vortag gesagt hatte. »Danke, dass ihr uns Beeren und Schlagsahne vom Einkaufen mitgebracht habt, aber das müsst ihr wirklich nicht machen. Wir kommen schon klar.« Für den letzten Satz hätte ich mir eine Millisekunde später am liebsten auf die Zunge gebissen. Ich war sicher, dass unsere Nachbarn nur hatten nett sein wollen, auch wenn sich mir bei so etwas ständig der ungewollte Gedanke aufdrängte, dass ich mit Anfang zwanzig als Familienoberhaupt schlichtweg nicht ernst genommen wurde.
Zum Glück überging Bine meine Bemerkung diplomatisch. »War alles im Angebot. Zwei zum Preis für eins, da mussten wir zuschlagen.«
»Trotzdem. Ihr habt schon so viel für uns getan.« Ich konnte nicht ganz die Scham in mir abschütteln, die sich bei dem Gedanken daran in mir ausbreitete und die Tatsache, dass sie und ihr Mann die Wohnung mit uns getauscht hatten, mir ihre große überlassen hatten, damit ich Platz für die Jungs hatte. Und das, obwohl wir uns zu diesem Zeitpunkt kaum gekannt hatten.

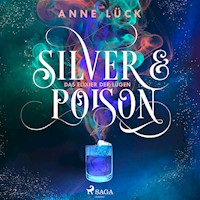
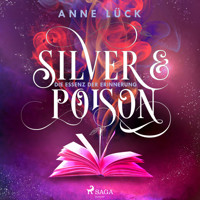
![Jewel & Blade. Die Wächter von Knightsbridge [Band 1 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ce22490997b3e6e0e807c8b632e07b21/w200_u90.jpg)




![Jewel & Blade. Die Hüter von Camelot [Band 2 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c7d0b6bb9c33b9a1b2b09f490d3cfe2a/w200_u90.jpg)