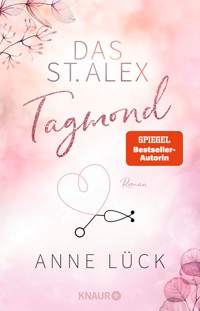9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Berlin-in-Love-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Woran merkst du, dass es Liebe ist? Der New-Adult-Roman»Zeig mir Für immer« ist der zweite Band der herzerwärmenden Berlin-in-Love-Dilogie rund um Freundschaft, Zusammenhalt und Sich-zum-ersten Mal-so-richtig-verlieben von Bestseller-Autorin Anne Lück. Aus persönlichen Gründen ist es Emilias größter Wunsch, Onkologin zu werden. Die Ausbildung an der St.-Alex-Krankenpflegeschule in Berlin soll der erste Schritt sein, anschließend will sie Medizin studieren. Unterstützung und Rückhalt findet sie in ihrer WG im Wohnheim der angehenden Krankenpflegerinnen und -pfleger, und vor allem bei ihrer Freundin und Mitbewohnerin Alica und ihrem Zwillingsbruder Lio. Als Emilia den jungen Onkologen Jasper kennenlernt, der als absolutes Ausnahmetalent gilt, ist sie nicht nur von seinen überragenden Fähigkeiten als Arzt begeistert. In seiner Nähe schlägt ihr Herz so stark wie niemals zuvor. Jasper scheint sich jedoch wenig für andere Menschen oder gar Beziehungen zu interessieren … oder ist das anders mit Emilia? Und dann bekommt Emilia eine Chance, die sie vor eine fast unmögliche Entscheidung stellt ... Entdecke auch den ersten Liebesroman der romantischen, zu Herzen gehenden New-Adult-Dilogie: In »Versprich mir Morgen« erzählt Bestseller-Autorin Anne Lück die Geschichte von Alica, die nach Berlin kommt, um Krankenpflegerin zu werden, und sich bald in einem Liebeschaos wiederfindet: Liebt sie Felix … oder Lio?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Lück
Zeig mir Für immer
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Aus persönlichen Gründen ist es Emilias größter Wunsch, Onkologin zu werden. Die Ausbildung an der St.-Alex-Krankenpflegeschule in Berlin soll der erste Schritt sein, anschließend will sie Medizin studieren. Unterstützung und Rückhalt findet sie in ihrer WG im Wohnheim der angehenden Krankenpflegerinnen und -pfleger, und vor allem bei ihrer Freundin und Mitbewohnerin Alica und ihrem Zwillingsbruder Lio.
Als Emilia den jungen Onkologen Jasper kennenlernt, der als absolutes Ausnahmetalent gilt, ist sie nicht nur von seinen überragenden Fähigkeiten als Arzt begeistert. In seiner Nähe schlägt ihr Herz so stark wie niemals zuvor. Jasper scheint sich jedoch wenig für andere Menschen oder gar Beziehungen zu interessieren … oder ist das anders mit Emilia?
Und dann bekommt Emilia eine Chance, die sie vor eine fast unmögliche Entscheidung stellt ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Illustrationen
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Epilog
Danksagung
Für Marie, meine beste Freundin und liebste Stütze.
Kapitel 1
Emilia
Tu es schon.«
Alica, die hinter mir auf der Kante meines Bettes saß, tippte ungeduldig mit den Füßen. Ich spürte ihre Unruhe überdeutlich in der Luft, als wäre es meine eigene. Dabei war ich eigentlich ruhig. Ich fühlte mich so ruhig wie lange nicht mehr, obwohl der Cursor meiner Maus gerade über dem vielleicht wichtigsten Button meiner Zukunft schwebte. Zum zweiten Mal in meinem Leben.
Und obwohl ich nicht wusste, ob es diesmal klappen würde.
Ganz leicht legte ich den Kopf schief, damit ich meine beste Freundin ansehen konnte, die auf meinem Bett im Wohnheimzimmer saß. Sie trug bereits ihren Pyjama, obwohl es erst acht Uhr abends an einem Freitag war. Aber das zweite Ausbildungsjahr war deutlich anstrengender als das erste, und vor allem diese Woche war wegen der bevorstehenden Jahresprüfungen anspruchsvoll gewesen. Wir hatten so viel Anatomie-Unterricht gehabt, dass selbst mir der Kopf rauchte, und da war es nur verständlich, dass Alica völlig fertig war. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, als ich sie ansah. Trotzdem strahlte sie, wie immer, eine unbändige Lebendigkeit aus.
»Klick drauf«, drängte sie mich. »Sonst mache ich es!«
Langsam drehte ich mich wieder zu meinem Laptop um. Meine Augen brannten von dem hellen Licht, aber mein Blick wanderte sofort wieder zu dem Button, auf dem stand: »Bewerbungsunterlagen hochladen«.
Okay, vielleicht war ich doch nicht so ruhig, wie ich gedacht hatte. Aber weil ich das auf keinen Fall zeigen wollte, riss ich mich zusammen und betätigte den Knopf. Ein paar Sekunden lud die Seite, dann erschien in großen Buchstaben: Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre Unterlagen eingereicht. Sie werden in wenigen Wochen über den Stand Ihrer Bewerbung informiert!
Ich ließ die Luft entweichen, und Alica hinter mir tat es zeitgleich.
Ich hatte es getan. Ich hatte mich für das Medizinstudium beworben.
Es war nicht einmal ein besonders großer Act gewesen. Die Unterlagen, mit denen ich mich vor anderthalb Jahren beworben hatte, waren noch größtenteils aktuell gewesen.
Die Unterlagen, mit denen ich damals abgelehnt worden war.
Ich versuchte, nicht zu viel darüber nachzudenken, aber es war wirklich schwer, weil ich mich noch gut an mein gebrochenes Herz erinnerte. Vielleicht war auch das der Grund, warum ich mich letztes Jahr nicht beworben hatte – nicht etwa, weil ich die Ausbildung unbedingt hatte durchziehen wollen, wie ich es den anderen hatte weismachen wollen.
Sondern aus Angst.
»Wie fühlst du dich?«
Ich drehte mich auf meinem Schreibtischstuhl wieder zu Alica um und zuckte mit den Schultern. »Wie soll ich mich schon fühlen? Ich habe ja nur die Unterlagen eingereicht. Jetzt kann ich nur abwarten.«
Meine Freundin hob sofort die Augenbrauen, als würde sie meinen Worten auf keinen Fall glauben. »Komm schon, Emilia. Wir wissen beide, dass es nicht so einfach ist. Das ist dein großer Lebenstraum, also muss es doch was mit dir machen.«
Langsam ließ ich eine Hand zu meiner Brust wandern. Legte sie darauf ab und tastete nach meinem Herzschlag, obwohl er eigentlich durch meinen ganzen Körper donnerte. »Na ja«, gab ich dann leise zu. »Vielleicht war es ein wenig aufregend.«
Alica lachte laut auf, bevor sie sich rücklings auf mein Bett fallen ließ. »Du bist wirklich gut darin, deine Gefühle zu verstecken.«
War ich das? Meine Mundwinkel zuckten. »Ich versuche nur, mich nicht verrückt zu machen. Letztes Mal hat es mir ja auch nichts gebracht.« Da war er wieder. Dieser kleine, aber deutlich spürbare Stich in meinem Herzen, der mich an das erinnerte, was ich vor anderthalb Jahren gefühlt hatte, als die Absage reingeflattert war. Unwillkürlich fragte ich mich, ob ich den Schmerz endlich vergessen konnte, falls es diesmal klappte.
WENN es diesmal klappte.
Ich musste positiv denken, das hatte Filina mir gesagt. Das Universum wird dir schon antworten, hatte sie außerdem gesagt, aber weil ich nicht an so etwas glaubte, klammerte ich mich vor allem an dem ersten Teil fest.
Alica beobachtete mich vom Bett aus, als ich zum Balkon ging und die Tür aufriss, um frische Luft in mein Zimmer und meine Gedanken zu lassen.
»Klappt das? Das Nicht-verrückt-Machen, meine ich.« Das Bett hinter mir raschelte, wahrscheinlich, weil meine Freundin sich auf die Seite gerollt hatte. »Denn ich weiß, dass es das bei mir ganz sicher nicht würde.«
»Die Effektivität hält sich tatsächlich in Grenzen.«
Sie lachte wieder. »Ist das der Grund, warum du nicht wolltest, dass Lio dabei ist?«
Bei der Erwähnung meines Zwillingsbruders konnte ich nicht verhindern, dass ich leicht zusammenzuckte. Etwas schuldbewusst schielte ich über meine Schulter und bemerkte, wie Alica die Augen aufriss. »Halt, es gibt noch einen anderen Grund? Ich dachte, dass das nur wieder so ein komisches Ding zwischen euch ist, dass du keine Schwäche mehr vor ihm zeigen willst, seit … du weißt schon. Entschuldige.«
Ich schüttelte sanft den Kopf. Dann setzte ich mich wieder auf meinen Schreibtischstuhl, diesmal in Blickrichtung zu Alica. Sie richtete sich auf, vielleicht, weil sie die plötzliche Ernsthaftigkeit der Situation wahrnahm. Ein paar Sekunden starrten wir uns nur an, dann seufzte ich tief. »Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?«
Sofort wirkte Alica verunsichert, und ich verstand, warum. Sie und mein Bruder waren jetzt seit fast einem Jahr zusammen, und ich bezweifelte, dass sie viele Geheimnisse voreinander hatten. Sie waren selten ohne einander anzutreffen, und es war immer noch seltsam, Lio in einer Beziehung zu sehen, nachdem er sich so lange gegen alles gewehrt hatte, was Commitment bedeutete. Schön, aber seltsam.
Trotzdem wartete ich ihre Reaktion ab. Und als Alica endlich nickte, wusste ich, dass sie definitiv dichthalten würde. Auch vor Lio.
Ich seufzte erneut und griff eher unbewusst nach dem kleinen Frosch auf meinem Schreibtisch, den ich letzte Woche fertig genäht hatte. Mir war der grüne Stoff ausgegangen, also war dieser hier mein erstes blaues Exemplar zwischen mittlerweile bestimmt dreißig grünen. Anfangs hatte ich sie gemacht, um das Nähen zu üben – irgendwann war es einfach nur ein seltsames Hobby geworden. Ich drückte ihn in meiner Hand zusammen, bevor ich sagte: »Wir haben dieses komische Ding, dass ich nicht mehr so gut Schwäche vor Lio zeigen kann, weil er sich solche Sorgen um mich macht. Da hast du recht. Aber es ist wirklich nicht nur das.« Alica wirkte irgendwie nervös, und das brachte mich wieder zum Lächeln. »Kennst du dich mit dem Prozess der Bewerbung um ein Medizinstudium aus?«
»Überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass du dich online beworben hast.« Sie deutete auf meinen Laptop, der immer noch aufgeklappt hinter mir stand. »Und dass es offensichtlich sehr schwer ist, einen Platz zu bekommen. Selbst für jemanden wie dich.«
Ich wusste, was sie meinte. Die Menschen, die mich kannten, taten das als eine verdammt gewissenhafte Person, die die meiste Zeit ihres Lebens damit verbrachte, zu lernen. Das war schon in meiner Schulzeit so gewesen – ich hatte immer gern gelernt. Aber seit meiner Diagnose vor ein paar Jahren hatte sich das auf ein neues Höchstmaß gesteigert. Es gab in meinem Leben kaum noch etwas, das wichtiger war als mein Medizinstudium. Als Ärztin zu werden. Onkologin. Ich dachte seit Jahren an nichts anderes.
Nur meine Freunde waren da noch. Und Lio.
Leider war das genau das, wo meine Probleme ansetzten.
»Man kann seine Wunsch-Unis angeben«, sagte ich leise. »Und natürlich habe ich die Unis hier in Berlin angegeben und in der Umgebung. Aber das heißt nicht, dass ich unbedingt einen Platz dort bekomme. Es kann sein, dass ich bei einer anderen Uni eine Chance bekomme.«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis Alica realisierte, was ich damit sagen wollte. Dann wurden ihre Augen wieder tellergroß. »Es kann sein, dass du irgendwo anders hinmusst?«
»Ja.«
»Irgendwo in Deutschland, auch wenn es ganz weit weg ist?«
Ich nickte. Und Alicas Schultern sanken ein. Ich hatte befürchtet, dass sie so reagieren würde, und ich verstand es. Sie war mir über die letzten anderthalb Jahre wirklich, wirklich wichtig geworden. Meine beste Freundin. Ich konnte mir nur schwer vorstellen, dass wir uns nicht mehr jeden Tag auf dem Flur des Wohnheims über den Weg liefen. Aber lieber sagte ich es ihr zuerst als Lio. Wie mein Bruder auf die Nachricht reagieren würde, dass ich vielleicht wegziehen musste, wollte ich mir gar nicht erst vorstellen.
Er würde wahrscheinlich durchdrehen. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich damit umgehen sollte. Mein Bruder war ein Freigeist, und wenn man ihn nur flüchtig kannte, würde man ihn wahrscheinlich für sehr locker halten. Das war er auch … wenn es nicht um mich ging. Wir hatten schließlich unser ganzes Leben zusammen verbracht, ganz lange hatte es nur uns beide gegeben. Er hatte die Jungen, die mich in der Grundschule ärgerten, verprügelt und nach meinem ersten Liebeskummer nächtelang mit mir Videospiele gespielt. Meine Krankheit damals und dass unser Vater uns verlassen hatte, hatte uns nur noch enger zusammengeschweißt. Ich wusste, dass er mich immer beschützen würde. Ich wusste, dass er sich Sorgen um mich machte. Wie würde das erst werden, wenn wir uns nicht mehr täglich sehen konnten?
»Okay.« Alica versuchte offensichtlich, sich zu sammeln. Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Vor dem Kapuzenpulli von Lio, den ich in den letzten Monaten nur noch an ihr gesehen hatte. »Es kann also sein, dass du einen Platz in einer anderen Stadt bekommst. Was ist dann mit deiner Ausbildung? Willst du sie abbrechen?«
Ich schüttelte sofort den Kopf und drückte den armen Frosch in meiner Hand noch etwas fester. »Ich ziehe durch, was ich angefangen habe. Aber du weißt auch, dass wir das dritte Jahr, das praktische Jahr, in jedem Klinikum in Deutschland machen können. Es sollte also kein Problem sein.« Eigentlich hatte ich keine Ahnung, ob ich es schaffte, noch genug Praxisstunden reinzuquetschen, wenn ich erst mein Studium begann. Aber ich hatte vor, es mit allen Mitteln zu versuchen – bis es meine Leistungen beeinträchtigte und ich die Reißleine ziehen musste.
Etwas erhellte sich in Alicas Gesicht. »Na, dann passt es ja.«
Überrascht musterte ich sie. »Tut es?«
»Ja. Denn wenn du dein letztes Jahr in einem anderen Klinikum machen kannst, dann können wir das doch auch, oder?«
Ich starrte sie an. Dann, ganz langsam, breitete sich etwas Warmes in meinem Magen aus. Etwas Süßes, das einen bitteren Touch hatte. Denn sosehr ich den Gedanken schätzte, dass sie mich begleiten würde, wenn es mich woandershin verschlug – ich wusste, wie sehr sie Berlin inzwischen liebte.
Alica hatte sich ihren Platz hier regelrecht erkämpft. Sie war zu Beginn der Ausbildung aus München hierhergekommen, hatte alles, was sie kannte, das üppige Geld ihrer Familie und alle Sicherheiten zurückgelassen, um die Ausbildung hier zu machen. Sie war geblieben, als alles dagegen gesprochen hatte, und mittlerweile war sie beinahe ein Teil meiner Familie.
Ich wusste außerdem, wie sehr mein Bruder Berlin liebte. Wir waren hier aufgewachsen, unsere sicher nicht jünger werdende Mutter lebte hier. Er hatte seine Freunde hier.
Und obwohl das alles auch auf mich zutraf, würde mich hier nichts mehr halten, wenn es um meinen Traum ging.
Ich lächelte Alica an und warf ihr den blauen Frosch zu, den sie überrascht auffing. »Wir machen uns darüber Gedanken, wenn es so weit ist, ja? Momentan gehen wir davon aus, dass ich endlich meinen Platz in Berlin bekomme, in Ordnung?«
»Klar.« Sie grinste breit. »Und jetzt, wo der erste Schritt in deine glorreiche Zukunft getan ist, können wir dann endlich etwas essen? Filina hat vorhin eine riesige vegane Lasagne gemacht, und ich bin mir sicher, dass ein großer Teil davon noch in der Küche steht.« Sie wackelte mit den Brauen, was mich zum Lachen brachte.
Aber dann fiel mein Blick auf mein Handy, und ich sprang sofort vom Schreibtischstuhl auf. »Leider keine Zeit.«
»Wie, keine Zeit?« Alica starrte mich entrüstet an, als ich zur Tür eilte und in meine Schuhe schlüpfte. »Wo willst du denn hin? Ich dachte, dass wir uns heute, wo Lio mit Gino unterwegs ist, einen schönen Mädelsabend machen. Filme schauen, ungesunden Kram essen und die Theoriewoche ausklingen lassen. Das gesamte Programm.«
»Tut mir leid, das müssen wir verschieben.« Beim Aufstehen schlug mir das Herz wieder bis zum Hals hoch. Aber dieses Mal aus Vorfreude. Aus dem kribbelnden Gefühl von etwas Verbotenem, das mich seit ein paar Wochen jeden Freitag begleitete. Ich drehte mich zu Alica um. »Filina und Marlon wollten einen Filmmarathon machen, da kannst du dich doch sicher anschließen.«
Alica wirkte ein wenig beleidigt, aber ich wusste, dass sie das nicht wirklich war. Dafür funkelten ihre Augen zu sehr. »Was hast du denn vor an einem so schönen Freitagabend?«
»Das kann ich dir leider nicht sagen.«
»Also eine verbotene Liebe? Ein geheimes Date?« Sofort schoss sie vom Bett hoch und tapste mir hinterher, bis sie auf der Schwelle meines Zimmers stand. »Als beste Freundin hast du übrigens die Verpflichtung, mir alles ganz genau zu berichten, das weißt du hoffentlich.«
»Von dieser Verpflichtung wusste ich nichts«, sagte ich, während ich mir im Laufen die Jacke über die Arme zog.
»Stand im Kleingedruckten.«
»Natürlich.« Ich blieb auf dem Gang stehen. Aus dem Wohnzimmer waren leise Stimmen zu hören, ansonsten lag das Wohnheim still vor uns. Ein Gefühl von Heimat überfiel mich so warm und plötzlich, dass ich mir auf die Unterlippe beißen musste.
Bitte, Universum, gib mir diesen Studienplatz in Berlin, flehte ich in meinen Gedanken, obwohl ich wirklich nicht an diesen Kram glaubte. Dann schenkte ich Alica ein Lächeln über meine Schulter. »Ein Date, ja. Mit meiner großen Liebe.«
Eine steile Falte bildete sich auf ihrer Stirn, als sie meine Zimmertür hinter sich zufallen ließ. »Ich bin verwirrt. Aber ich bin mir plötzlich ziemlich sicher, dass es nichts Romantisches ist.«
Ich lachte und hob zum Abschied die Hand. Wenn ich mich jetzt nicht beeilte, dann würde ich zu spät kommen, und das konnte ich mir wirklich nicht leisten. Nicht, wenn das, was ich da tat, eigentlich verboten war. Ich war schon an der Tür zu den Aufzügen, als ich noch einmal abstoppte und mich umdrehte. Alica hob sofort den Kopf.
»Danke«, sagte ich mit Inbrunst. »Für deine seelische Unterstützung gerade. Das hat wirklich geholfen.«
Kurz wirkte Alica überrascht, aber dann begann sie übers ganze Gesicht zu strahlen. Sie winkte ab. »Du wirktest nicht so, als würdest du sie brauchen.«
Oh doch, das habe ich. Mehr, als du denkst.
Diesmal verließ ich den Flur wirklich in Richtung Treppenhaus. Mein Herz raste, aber wie immer, wenn es um das ging, was ich am meisten liebte, war ich mir so sicher wie sonst nie, dass ich das Richtige tat.
Auch wenn es vielleicht ein paar Herzen brach.
Oder ein paar Regeln.
Kapitel 2
Emilia
Die Gänge des Sankt Alex waren beinahe menschenleer, als ich durch den Haupteingang hetzte. Immer wieder warf ich einen Blick auf meine Uhr und zählte die Minuten, die mir noch blieben.
Drei Minuten. Noch drei Minuten, dann würde die Vorlesung offiziell starten, und ich hatte keine Chance mehr, unerkannt in den Raum für das Seminar zu kommen. Und das bedeutete, dass ich auch keine Chance mehr hatte, überhaupt daran teilzunehmen.
Denn die Abmachung, die ich mit Doktor Schober hatte, war von Anfang an eindeutig gewesen: nicht auffallen. Nicht erwischen lassen. Und vor allem: ihn nicht verpfeifen.
Während ich den Gang entlanghetzte, schickte ich wieder einmal tausend Dankesgebete an den freundlichen Oberarzt der Onkologien im Haus, auf dessen einer Station ich im letzten Halbjahr meinen Praxiseinsatz gehabt hatte. Dass er mich, als ich ihm von meinem Wunsch erzählt hatte, auf sein abendliches Seminar hingewiesen hatte. Er hatte im selben Atemzug erklärt, dass es für Nicht-Medizinstudenten natürlich verboten war, daran teilzunehmen. Und dass jemand, der es trotzdem tat, unheimlich vorsichtig sein musste, um nicht erwischt zu werden. Es hatte in der Vergangenheit Fälle gegeben, in denen Nichtstudenten sich reingeschlichen, den Datenschutz des Krankenhauses verletzt und TikTok-Videos gedreht hatten. Seitdem gab es die strenge Vorschrift, dass man beim Klinikum beantragen musste, wenn man ein Seminar besuchen wollte. Aber den Anträgen wurde eigentlich nie stattgegeben. Ich hatte es versucht und nie Antwort erhalten.
Doktor Schober hatte mir mit seiner Aussage quasi trotzdem ein Ticket zu einem seiner großartigen Onkologie-Seminare zukommen lassen. Und in den ersten zwei Wochen hatte ich nicht einmal darüber nachgedacht, es einzulösen. Ich hatte viel zu große Angst davor gehabt, die Regeln zu brechen. Weil meine Ausbildung möglicherweise daran hängen könnte. Im schlimmsten Fall sogar meine Zukunft. Und weil ich in meinem Leben noch nie irgendetwas Verbotenes getan hatte. Ich war schon als Kind viel zu brav gewesen. Während mein Bruder Lio irgendwann angefangen hatte zu rebellieren, sich rauszuschleichen, heimlich mit seinen Freunden feiern zu gehen, hatte ich die Abende immer zu Hause verbracht. Hatte gelernt und mich eingeigelt.
Aber dann war die Diagnose gekommen, und ich war monatelang ans Bett gefesselt gewesen – mit der Aussicht, dass ich vielleicht nie wieder daraus aufstehen würde, wenn alles ganz schieflief.
Seitdem hatten sich meine Prioritäten etwas verschoben. Ich war natürlich immer noch jemand, der sich an die Regeln hielt. Meistens. In neunzig Prozent der Fälle. In den anderen zehn Prozent ging es um etwas, das ich mehr liebte als alles andere: die Medizin. Die Onkologie. Sie ließ mich alles vergessen, was sonst wichtig war. Sie ließ mich nach vorne blicken.
Und sie ließ mich Regeln brechen.
Nur deswegen hatte ich vor drei Wochen das erste Mal einen Blick in das Seminar von Doktor Schober geworfen. Hatte gesehen, wie viele Medizinstudenten auf den langen Bankreihen saßen, unter denen ich beinahe ganz verschwinden konnte. Berlin war riesig, und es gab unzählige Medizinstudenten, die sich nicht alle untereinander kannten. Und weil Doktor Schober so eine Koryphäe in seinem Gebiet war, gab es hier Studenten von mehreren Unis in Berlin, die seine Vorlesungen besuchten.
Also hatte ich mich getraut, den Raum zu betreten. Ich hatte mich ganz hinten hingesetzt, hatte jeden Kontaktversuch von anderen Studierenden abgebrochen und nur den Ausführungen von Doktor Schober gelauscht. Seinen Ausführungen über die Onkologie, die mich so faszinierte. Und obwohl das Risiko nicht gering war, war ich wiedergekommen. Woche für Woche. Hatte mich in die Veranstaltung geschlichen, während Doktor Schober so getan hatte, als würde er mich nicht bemerken. Wir hatten nie darüber geredet, auch nicht auf Station. Aber es war zu meiner liebsten Freitagabendbeschäftigung geworden. Zu etwas, auf das ich mich jede Woche freute.
Noch eine Minute.
Ich beschleunigte noch einmal und prallte endlich gegen die Tür des Seminarsaals. Geschafft! Erleichtert riss ich sie auf und stockte im nächsten Moment.
Denn es war nicht Doktor Schober, der vor den Studierenden stand, die sich schon in den Saal gedrängt hatten und sich laut unterhielten. Und der Mann drehte mir auch nicht, wie Doktor Schober es sonst immer demonstrativ tat, den Rücken zu, als würde er mich nicht bemerken. Nein, er drehte sich sogar zu mir um und musterte mich eindringlich aus seinen messerscharfen grauen Augen, als wäre ich schreiend hereingekommen. Als hätte ich seine Ausführungen unterbrochen, die er noch nicht einmal begonnen hatte.
Was zur Hölle war hier los?
Ich wandte mich ab, sah mich um. Aber da stand »Onkologie« an der Wand, wie immer, wenn dieses Seminar stattfand. Und die Gesichter, die in der ersten Reihe saßen, kamen mir auch bekannt vor. Es waren die gleichen wie immer. Das hier war definitiv das richtige Seminar – das von Doktor Schober.
Aber das war ganz sicher NICHT Doktor Schober. Auch wenn der Typ hier mir seltsam bekannt vorkam. Ich wusste nur in der Schrecksekunde nicht, woher.
Er hatte eine unheimlich gerade Haltung. Beinahe wie ein Soldat. Seine Miene wirkte kühl, aber nicht feindselig, als er fragte: »Haben Sie sich verlaufen?« Seine Stimme war deutlich zu hören, obwohl die Gespräche um uns herum noch laut waren.
Ich erstarrte. »I-ich weiß nicht«, brachte ich mühevoll hervor.
»Das ist das Seminar von Doktor Schober«, sagte der Typ langsam und verschränkte die Arme hinter dem Rücken. »Ich vertrete ihn heute. Also … haben Sie sich verlaufen?«
Doktor Schobers Vertretung. Es war das richtige Seminar, aber er war nicht hier. Und ich hatte gerade gegen die oberste Regel verstoßen: Ich war aufgefallen. Obwohl – momentan machte das noch nichts, oder? Immerhin hatte ich immer noch die Möglichkeit, einfach zu gehen. So zu tun, als hätte ich mich nur in der Tür geirrt, oder?
Aber ein Blick zur Seite zeigte mir, dass die Ersten mich schon anstarrten. Sich verwirrt fragten, was mich denn so zögern ließ. Schließlich kam ich seit Wochen in dieses Seminar. Und obwohl ich mit niemandem sprach, wusste ich, dass ein paar von ihnen sicher mein Gesicht erkannten.
Ich war aufgefallen, und es gab keinen Weg zurück.
»Setzen Sie sich bitte, oder verlassen Sie den Raum. Ich möchte gern mit meinem Vortrag anfangen«, sagte Doktor Schobers Vertretung. Zu meiner Überraschung klang er immer noch nicht verärgert. Seine Stimme war ein ruhiger Bariton, und aus irgendeinem Grund brachte mich das tatsächlich dazu, endlich etwas zu tun.
Mein Körper setzte sich wie von selbst in Bewegung, und ich huschte die Reihen entlang nach hinten. Diesmal fand ich keinen Platz mehr in der letzten Reihe, auch wenn ich gerade heute am liebsten in der Menge verschwunden wäre. Stattdessen setzte ich mich auf einen freien Stuhl in der dritten Reihe von hinten und sank so tief wie möglich hinter dem Pult zusammen. Versteckte mich vor den Blicken des Dozenten, nur um nach ein paar Sekunden zu merken, dass er mich gar nicht mehr beachtete.
Er räusperte sich laut, und langsam wurde es leiser im Vorlesungssaal. Jetzt traute ich mich doch, mich ein wenig nach vorn zu beugen und ihn etwas näher zu betrachten, um meinem Gedächtnis vielleicht auf die Sprünge zu helfen. Er war jung, vielleicht Ende zwanzig, Anfang dreißig, und sein Gesicht war eine neutrale Maske, in der man nicht die geringste Empfindung lesen konnte. Sein Kittel war lang, er war also definitiv ein vollwertiger Arzt. Und verdammt, er sah gut aus. So richtig. So »Model war mir zu langweilig, deswegen bin ich Arzt geworden«-gut, dass Marlon wahrscheinlich schon angefangen hätte, ihm vor die Füße zu sabbern.
Halt. Marlon. Langsam formte sich tatsächlich eine Erinnerung in meinem Gehirn.
»Sie alle haben sicher Doktor Schober erwartet.« Der Arzt brauchte nicht einmal ein Mikro, seine Stimme war so laut und klar, dass sie durch den ganzen Raum schallte. Allerdings fiel mir bereits bei seinen ersten Worten auf, dass er nicht ins Publikum sah, sondern auf einen unsichtbaren Punkt vor seinem Gesicht. »Er ist leider krank und lässt sich deshalb von mir vertreten. Ich bin Doktor Jasper Bennik, Onkologe im Sankt Alexander, und arbeite unter der Leitung von Doktor Schober auf der Erwachsenenonkologie. Und auch wenn er nicht hier ist, knüpfe ich nahtlos an der Stelle an, an der Sie letzte Woche mit ihm aufgehört haben: bei der Klassifizierung maligner Tumore.« Ohne Umschweife drehte er sich um und startete den Vortrag auf seinem Laptop, der sofort auf die große Wand hinter ihm projiziert wurde, und begann mit seinen Ausführungen.
Doktor Jasper Bennik. Natürlich. Ich hatte ihn bereits getroffen. In unserem ersten Ausbildungsjahr hatte er die Aufsicht über eine unserer Prüfungen gehalten. Im Sankt Alex war ich ihm noch nicht begegnet, aber offensichtlich, weil er auf anderen Stationen arbeitete als ich bisher.
Er kannte mich also nicht. Weder als Auszubildende noch als Studentin.
Langsam beruhigte sich mein Herz, denn ich wusste, dass so keine Gefahr für mich bestand. So sehr, wie er bereits nach wenigen Minuten in seinen Vortrag vertieft war, hatte er mich sicher schon wieder vergessen. Also lehnte ich mich nach vorn und lauschte seinem Vortrag, als wäre er Doktor Schobers.
Doktor Bennik hielt offensichtlich nichts davon, den Unterricht abwechslungsreich und spannend zu gestalten, denn er ratterte einfach seine Fakten runter und raste durch die vorbereiteten Folien, als würde er einen Wettbewerb gewinnen wollen. Hätte ich mir in den letzten Jahren nicht so viel Onkologiewissen angeeignet, wäre es mir wahrscheinlich unheimlich schwergefallen, ihm zu folgen. So wie den Studierenden um mich herum, denn mit jeder Minute wurden die Gesichter etwas verzweifelter, die Kulis etwas schneller auf den Blättern und das Geflüster mehr.
Es war offensichtlich, dass Doktor Bennik sonst keine Vorträge hielt. Als er sich das erste Mal wieder an das Publikum wandte und eine Frage stellte, waren alle so verwirrt, dass er keine Reaktion bekam.
Er wartete kurz, dann fragte er erneut: »Maligne Tumore, die keine Metastasen bilden.« Noch ein paar Sekunden, dann wanderten seine Brauen nach oben. »Weiß das wirklich niemand von Ihnen?«
Oje. Den leeren Gesichtern um mich herum nach zu urteilen, tat das tatsächlich niemand. Doktor Schober war das mit uns durchgegangen, letzte Woche. Aber er hatte nur an der Oberfläche gekratzt, und ich war mir sicher, dass er diese Information schuldig geblieben war. Niemand wusste es.
Außer mir.
Die Bilder, die der Beamer an die Wand hinter Doktor Bennik warf, kamen mir nur allzu bekannt vor. Ich hatte sie schon Hunderte Male gesehen, war sie noch öfter in meinem Kopf durchgegangen – und ich wusste die Antwort auf seine Frage.
Aber durfte ich sie aussprechen?
Durfte ich auffallen, nur weil Doktor Schober heute nicht da war?
Konnte ich das wirklich riskieren?
Doktor Bennik wartete noch ein paar Sekunden. Dann seufzte er tief. Er wollte sich gerade wieder seinem Laptop zuwenden, als er stockte und den Kopf hob. Überrascht sah er mich an. »Ja?«
Ich blinzelte. Und merkte erst eine Sekunde später, dass ich offensichtlich meinen Arm in die Höhe gerissen hatte, ohne darüber nachzudenken. Ganz langsam ließ ich ihn sinken, während sich immer mehr Studierende zu mir umdrehten und mich anstarrten.
Shit. Jetzt kam ich aus der Nummer nicht mehr raus, oder?
Ich räusperte mich. »Das Basaliom.«
Doktor Benniks Brauen hüpften wieder nach oben. Plötzlich lag unverhohlene Neugierde in seinem Blick. »Korrekt.«
Das Wort floss durch meinen Körper wie ein warmer Strom. Korrekt. Ich hatte eine Frage in einem Medizinseminar korrekt beantwortet, obwohl ich noch nicht einmal Studentin war. Mir wanderte ein breites Lächeln ins Gesicht.
Etwas in Doktor Benniks Gesicht klärte sich auf. »Und können Sie mir auch erklären, was der Begriff Carcinoma in situ bedeutet?«
»Ja«, kam es mir über die Lippen. Jetzt war ich nicht mehr zu bremsen, das ganze angesammelte Wissen wollte raus. »Das ist ein Oberflächenkarzinom, das die Basalmembran noch nicht durchbrochen hat.«
Seine Augen weiteten sich ein Stück mehr, und ich erkannte, dass der Ausdruck auf seinem Gesicht Anerkennung war. Anerkennung für meine Antwort. »Sehr gut.« Er wandte sich ab, um die nächste Folie aufzurufen.
Mein Herz flatterte in meiner Brust. Das war ein berauschendes Gefühl. Und jetzt, wo ich davon gekostet hatte, wollte ich mehr.
Es war in Ordnung, oder? Doktor Schober war nicht da. Niemand hier kannte mich. Und ich konnte endlich so richtig mitmachen. Wenigstens heute. Wenigstens in diesem Seminar.
Also tat ich es. Ich warf meine Bedenken über Bord und hob direkt bei Doktor Benniks nächster Frage wieder die Hand. Beantwortete sie wieder richtig und ließ mich von der Anerkennung in seinem Gesicht fluten, als wäre sie eine Droge. Es fühlte sich zumindest so an, wie ich mir das vorstellte.
Bei der dritten Frage, die er am Ende der sechsten Folie stellte, zuckte sein Blick sofort zu mir. Es wirkte wie ein Reflex, aber er sah nicht weg, bis ich wieder den Arm hob.
»Die OP nach Wertheim-Meigs«, sagte ich, fast eine Spur atemlos.
Wieder drehten sich von allen Seiten Studierende zu mir um, und ich versuchte, sie zu ignorieren. Es war mir egal, ob die anderen mich für eine Streberin hielten. Das war es schon immer gewesen. Ich wollte heute nur auskosten, was ich vielleicht bald auf legale Weise haben konnte. Jetzt, wo ich meine Bewerbung erneut abgeschickt hatte.
Das Spiel wiederholte sich das ganze Seminar lang. Ich beantwortete zehn Fragen von Doktor Bennik mit Bravour, und als er die Stunde beendete, brannten meine Wangen vor Stolz. Es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ich vielleicht bald haben würde, und er hatte mir gefallen. Der Gedanke, dass ich nächste Woche wieder still wie ein Mäuschen in der hintersten Reihe sitzen und mich unsichtbar machen musste, war beinahe ein wenig drückend.
Nicht mehr lange, sagte ich mir in Gedanken, als ich die Reihen des Vorlesungssaals vorbeiging Richtung Ausgang. Dann sitzt du offiziell in diesem Vorlesungssaal und kannst alle Fragen beantworten, die gestellt werden.
Der Gedanke trieb mich an, und meine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Als ich auf der untersten Ebene angekommen war, breitete sich plötzlich ein Kribbeln in meinem Nacken aus, als würde mich jemand beobachten. Ich drehte mich um, und mein Blick wurde direkt von den hellen Augen von Doktor Bennik angezogen. Er war gerade dabei, seinen Laptop einzupacken, aber jetzt musterte er mich. Sein Blick bohrte sich in meinen, abwartend, neugierig, und aus irgendeinem Grund fegte das einen großen Teil meiner Euphorie wieder weg.
Wirkte er etwa … misstrauisch? Ahnte er etwas? Dass ich nicht hierhergehörte, dass ich illegal hier war?
Als er sich aufrichtete, bildete sich Eis in meinen Blutbahnen. Aber statt etwas zu sagen, nickte er mir nur zu. Wie ein kurzer, harter Abschiedsgruß. Nach kurzem Zögern tat ich es ihm gleich, dann wandte ich mich abrupt ab und stürmte aus dem Vorlesungssaal.
Das hier, das war riskant gewesen. Es durfte nicht wieder passieren, wenn ich nicht aus meiner Ausbildung fliegen wollte.
Und doch konnte ich mich nicht gegen den Gedanken wehren, dass es sich verdammt gut angefühlt hatte.
Kapitel 3
Emilia
Als ich am Montagmorgen die Station betrat, auf der ich die nächsten Wochen meinen Praxiseinsatz machte, spürte ich sofort, wie sich meine Eingeweide ineinander verknoteten. Ich hatte bereits vor ein paar Wochen, als ich erfahren hatte, wo es mich hin verschlagen würde, ein seltsames Kribbeln in meiner Magengegend verspürt. Aber ich hatte mir eine ganze Weile erfolgreich eingeredet, dass das alles hinter mir lag und ich kein Problem mehr damit hatte.
In dem Moment, in dem ich allerdings unter dem Schild mit der Aufschrift »Onkologische Ambulanz« hindurchlief, war trotzdem alles wieder da. Die Erinnerung an die Zeit vor drei Jahren, wo ich dreimal die Woche auf eine ähnliche Station musste, wenn auch in einem anderen Krankenhaus. Die Angst von damals. Die Übelkeit. Die Schmerzen. Wie von selbst wanderte meine Hand an die Stelle kurz über meinem Schlüsselbein, und ich rieb über die kleine Narbe, unter der sich mein Port befunden hatte. Der, in den die Nadeln immer gestochen wurden. Der, durch den die Chemotherapie in meinen Körper gelaufen war.
Ich rief mich selbst zur Ordnung, als ich am Empfang die Stationsleitung Mona entdeckte, die mir aufmunternd entgegenlächelte. Ich hatte sie bereits letzte Woche getroffen, als ich hier meinen Dienstplan abgeholt hatte, und genau wie damals kam sie auch jetzt mit offener Miene auf mich zu.
»Emilia, schön, dich zu sehen«, sagte sie. »Wie ich sehe, bist du auch schon umgezogen. Dann kannst du dich mir auch direkt anschließen.«
Ich nickte und folgte ihr über den Gang. Immer wieder zuckte mein Blick zu den offenen Räumen, in denen die Patienten saßen. Manche hatten den Vorhang vor ihren Sitzen zugezogen, um etwas Privatsphäre zu bekommen – andere saßen ganz offen da, lasen Bücher, unterhielten sich mit ihren Begleitpersonen oder starrten einfach die Beutel mit der Chemotherapie an, die über ihren Köpfen in ihre Körper floss.
Ich verstand sie alle, aber ganz besonders die letzte Gruppe. Die meiste Zeit über hatte ich wie sie hier gesessen und dieses teuflische Zeug angestarrt. Hatte gedanklich entweder darauf geschimpft oder es angefleht, mir endlich zu helfen. Ich musste hart schlucken und mich abwenden, um nicht weiter darüber nachzudenken.
»Du weißt ja sicher von der Schule, wie es auf einer Onkologie-Ambulanz wie unserer abläuft.« Die Stationsleitung sah mich über ihre Schulter hinweg freundlich an. »Morgens kommen die ersten Patienten, die du hier schon siehst, und lassen sich ihre Chemotherapie anschließen. Während der Behandlung kümmern wir uns um sie. Um ihre Schmerzen, ihre Übelkeit, alles, was gerade für sie ansteht. Manche brauchen es, dass wir uns zu ihnen setzen und ein wenig mit ihnen reden, was wir natürlich immer machen, wenn die Zeit es zulässt. Am Ende werden sie abgesteckt und dürfen zurück nach Hause – und dann geht es mit den nächsten Patienten weiter. Warst du schon auf einer Onkologie?«
Ich nickte gedankenversunken, weil ich gerade eine junge Frau mit aschfahlem Gesicht beobachtete, die am Ende des Raums saß und den Arm über ihre Augen gelegt hatte.
»Hier im Sankt Alex?« Mona blieb stehen, und endlich schaffte ich es, mich wieder ihr zuzuwenden.
Ich blinzelte zweimal, bevor ich über die Lippen bekam: »Äh ja, letztes Jahr war ich drei Wochen auf der Kinderonkologie hier im Haus.«
»Ah, bei Tessa?« Sie schmunzelte. »Da hast du sicher ein paar gute Erklärungen bekommen.«
Tatsächlich war die Stationsleitung dort, Theresa, immer sehr auskunftsfreudig gewesen und hatte mir viele Dinge erklärt. Insgesamt hatte ich aber auch festgestellt, dass es auf Station für die Krankenpfleger tatsächlich nur noch wenige Dinge gab, die für mich neu waren. Die ich lernen konnte. Ich hatte mir in den letzten Jahren so viel Wissen zum Thema Onkologie angeeignet, dass es außerhalb von den Vorlesungen und dem Seminar von Doktor Schober kaum noch Dinge gab, die die Schwestern mir beibringen konnten. Es war zum Teil eine Bestätigung für mich, aber auch ein wenig frustrierend.
»Ja, Theresa war super«, sagte ich trotzdem, ehe ich fragte: »Was kann ich tun?« Ich ließ den Blick erneut über die Patienten schweifen. Ich erkannte nur wenige Pflegekräfte, die zwischen ihnen herumhuschten, und konnte mich auch nicht groß daran erinnern, in meiner eigenen Zeit auf so einer Station viele gesehen zu haben.
Mona lächelte wieder. »Du kommst jetzt mit auf meine Runde. Wir schauen mal, wie es den Patienten geht und ob sie etwas brauchen. Danach gebe ich dir eine kleine Einweisung zu den Medikamenten, in Ordnung?«
»Ja«, murmelte ich, weil mir auch irgendwie keine andere Wahl blieb, und folgte ihr in den ersten Raum. Die Patienten dort wirkten relativ entspannt, einige scherzten mit Mona und schenkten mir ein freundliches Lächeln.
Es war seltsam, bei den Gesprächen zuzuhören, weil sie so fernab von dem waren, was ich damals gehabt hatte. Die ganze Angst hatte mich immer permanent an die nächste Untersuchung denken lassen und an das, was man mir dann wohl sagen würde. An die Gesichter von meiner Mutter und von Lio, die immer versucht hatten, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die immer nur geweint hatten, wenn sie dachten, dass ich sie nicht sah oder hörte.
Ich presste die Lippen zu einer dünnen Linie zusammen.
Andererseits war es ja genau das, was ich machen wollte. Genau das, was später meine Arbeit sein sollte, wenn ich mit dem Studium fertig war. Ich konnte also genauso gut daran arbeiten, jetzt damit klarzukommen. Also achtete ich darauf, was Mona zu ihnen sagte und wie sie darauf reagierten. Machte mir die ganze Zeit innerlich Notizen. Die Kommunikation war seltsamerweise immer noch das, was mir am meisten zu schaffen machte, obwohl ich eigentlich wusste, wie man sich auf der anderen Seite fühlte. Trotzdem war es interessant, das Ganze von einem neuen Blickwinkel aus zu beobachten.
Nach der Patientenrunde gab Mona mir eine Einweisung in die Chemotherapien und die Begleitmedikamente. Obwohl ich alles davon wusste, hörte ich angestrengt zu, filterte nach neuen Informationen und begann irgendwann, tiefere Fragen zu stellen. So hatte ich es schon die letzten Monate getan, immer wenn ich auf Station war. Meistens wurden meine Fragen nur bis zu einem gewissen Grad beantwortet, irgendwann wussten die Schwestern auch nicht weiter, und ich bekam dann Sätze wie »So was müssen wir nicht wissen«. Es war immer leichter, so etwas zu sagen, als »Das weiß ich leider nicht« – das hatte ich mittlerweile kapiert.
Bei Mona kam der Punkt, an dem sie nicht weiterwusste, als ich sie nach der Zusammensetzung einer Chemotherapie fragte und warum gerade diese Medikation für diese Patienten genutzt wurde. Sie lachte auf meine Frage hin und meinte: »Du willst es ja ganz genau wissen. Denkst du, dass das für deine Prüfungen wichtig sein könnte?«
»Nein«, gab ich knapp zurück. »Aber es interessiert mich einfach.«
»Leider kann ich dir diese Frage nicht beantworten«, gab sie zu – eine ungewöhnliche Antwort. Sie lächelte trotzdem. »Aber vielleicht kannst du nachher Doktor Wehner danach fragen, sie wird es ganz sicher wissen. Sie hat nur leider immer nicht so viel Zeit, weil sie aktuell eine der wirklich wenigen Ärzte ist, die die Ambulanz betreuen.«
Bei dem Namen klingelte irgendetwas in meinem Gedächtnis. Ich runzelte die Stirn. »Doktor … Nina Wehner?«
»Ja, sie ist unsere Stationsärztin. Kennst du sie?«
»Flüchtig. Sie hat die Palliativwoche in unserer Ausbildungsklasse gehalten«, murmelte ich und folgte Mona, die sich gerade die Kurven unter den Arm geklemmt hatte und schon wieder auf dem Weg aus dem Stationszimmer war.
»Davon hat sie, glaube ich, erzählt.«
Hoffentlich nicht zu viel. Die Palliativwoche war in unserem ersten Ausbildungsjahr eine ganze Woche gewesen, in der wir uns mit dem Tod beschäftigt hatten. Es war faszinierend gewesen, das Wissen aus dieser Zeit hatte mir noch einmal auf einer ganz anderen Ebene geholfen und neue Erkenntnisse gebracht. Das war allerdings auch nicht der Grund dafür, dass mir etwas Kaltes den Rücken hinabzulaufen schien. Denn leider konnte ich mich nur zu gut an den letzten Tag dieser Woche erinnern, an dem ich vor allen aus meiner Klasse, der Klassenleitung Luna Seeger UND Doktor Nina Wehner über meine Erkrankung gesprochen hatte.
Es war ein Emotionsding gewesen. Eine Affekthandlung. Ich war so in dem Moment gewesen, dass es mir einfach über die Lippen gekommen war, weil ich mich so wohl gefühlt hatte. Aber jetzt war ich auf der Station von Doktor Wehner gelandet, und sie wusste von meiner Vergangenheit. Ich wollte nicht, dass irgendwer wegen so etwas Rücksicht auf mich nahm oder meine Kompetenzen infrage stellte, nur weil ich selbst … Ich schüttelte den Kopf.
Hoffentlich erzählte sie niemandem davon. Hoffentlich erwähnte sie nichts. Hoffentlich hatte sie mich einfach schon vergessen.
Nachdem Mona mit mir noch einmal alle Patienten durchgegangen war, wurde ich ziemlich schnell auf sie losgelassen. Es war eigentlich nicht verwunderlich, immerhin war das mittlerweile mein sechster Einsatz auf Station, und bei meinen Aufgaben hier konnte nicht besonders viel schiefgehen. Ich brachte den Patienten Essen, half ihnen, sich bequemer hinzusetzen, maß ihre Vitalwerte oder brachte ihnen Mittel gegen Übelkeit. Ab und zu, wenn ich das Gefühl hatte, dass die Patienten es brauchten, blieb ich auch ein paar Minuten stehen und unterhielt mich mit ihnen. Entgegen meiner Befürchtungen fiel es mir gar nicht so schwer, sie ein wenig abzulenken. Und ich schlug auch direkt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil sie mir bereitwillig alles erklärten, was sie bereits mit ihrer Erkrankung durchgemacht hatten. Welchen Krebs sie hatten und welche Chemotherapien bisher nicht angeschlagen und welche doch endlich Verbesserungen gezeigt hatten. Das war interessanter als alles andere, deswegen ging der Vormittag für mich relativ schnell rum.
Gegen Mittag stand dann plötzlich mein Zwillingsbruder Lio in der Tür der Stationsküche. Ich war gerade dabei, die Spülmaschine einzuräumen, als er sich an den Rahmen lehnte und breit grinste. »Na, Emmi, wie läuft’s?«
Ich richtete mich nur sehr langsam auf und warf ihm einen prüfenden Blick zu. »Gut«, gab ich dann zurück. »Willst du mir vielleicht erklären, was du hier machst? Du hast doch heute auch deinen ersten Tag auf Station.«
»Ja, aber ich habe Mittagspause und wollte nur mal sehen, was meine allerliebste Schwester so treibt.« Er legte den Kopf schief, und dabei fielen ihm ein paar seiner schwarzen Locken ins Gesicht. Dieser verdammte Hundeblick, der immer bei mir funktionierte, auch wenn ich es wirklich nicht wollte. Knurrend schlug ich die Spülmaschine zu. »Du kontrollierst, ob ich schon zusammengebrochen bin unter der Last?«, fragte ich unschuldig.
Lio zuckte zusammen, das konnte ich selbst im Augenwinkel sehen. »Unsinn, ich dachte nicht, dass du zusammenbrichst«, sagte er dann etwas sanfter. »Aber … vielleicht wollte ich sehen, ob es etwas mit dir macht, hier zu sein. Du warst schließlich selbst …« Er brach ab und lächelte entschuldigend. Natürlich machte er sich Sorgen, andersherum wäre es wahrscheinlich genauso gewesen.
Seufzend winkte ich ab. »Du erinnerst dich schon noch daran, dass ich Onkologin werden will, oder? Früher oder später werde ich auf einer solchen Station arbeiten. Ich muss also damit klarkommen.« Ich stockte, bevor ich anfügte: »Und das tue ich auch.«
»Na ja, aber dann ist eben auch schon einiges an Zeit vergangen.« Lio schüttelte den Kopf, als würde er sich selbst von ein paar Gedanken befreien wollen, dann grinste er wieder breit. »Ich hätte mir nie Sorgen machen sollen, und eigentlich habe ich das auch nie. Vergiss, dass ich etwas gesagt habe.«
Ich boxte ihm freundschaftlich gegen die Schulter und konnte mich nicht gegen das Schmunzeln wehren, das mir auf die Lippen wanderte. »Hast du mir dann wenigstens etwas zum Mittagessen mitgebracht, um von deiner offensichtlich nicht vorhandenen Sorge abzulenken?«
»Äh. Ehrlich gesagt nicht. Ich habe den Plan nicht so weit gedacht.«
Ich verdrehte die Augen und merkte, dass hinter Lio Mona auf uns zukam.
Ihr Lächeln wurde breiter. »Lio, wie schön, dich mal wiederzusehen! Wie läuft die Ausbildung?«
»Frau K!« Er strahlte sie an. »Sehr gut, kann mich nicht beschweren. Wie läuft es hier?«
Natürlich kannten die beiden sich. Mein Bruder hatte im Sankt Alex ein FSJ gemacht und kannte fast jeden, der in diesem Krankenhaus arbeitete. Ich wandte mich von ihrem Gespräch ab und ließ den Blick über die Station schweifen. Als ich in der Ferne Doktor Nina Wehner sah, die gerade aus einem der Büroräume trat, dachte ich kurz darüber nach, mich mit meinen Fragen von vorhin an sie zu wenden. Oder sie darum zu bitten, niemandem zu erzählen, dass ich selbst schon einmal als Patientin auf einer onkologischen Ambulanz war.
Aber ich hatte gerade einmal einen Schritt in ihre Richtung gemacht, als ich wieder innehielt. Denn sie war nicht allein. Und ich kannte denjenigen, mit dem sie sich unterhielt. Den geraden Rücken. Die ernsten grauen Augen. Diese unglaubliche, kühle Ausstrahlung. Doktor Jasper Bennik.
Unwillkürlich machte ich einen Schritt zurück und verschwand halb hinter der Tür der Küche, damit er mich nicht entdeckte. Es war wahrscheinlich lächerlich, weil er sich sicher nicht mehr an eine einzelne Studentin erinnerte, aber mir schoss trotzdem Angst durch meine Glieder.
»Emmi?«
Ich hob den Kopf und bemerkte, dass Lio mich irritiert ansah. Mona war nicht mehr da, ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie gegangen war. »Ja?«
»Ob wir Mittagessen gehen wollen, hab ich gefragt.« Er lachte. »Was hat dich denn so abgelenkt?«
Er folgte meinem Blick zu den zwei Ärzten, die sich gerade offensichtlich voneinander verabschiedeten und in unterschiedliche Richtungen davongingen. Seine Augenbrauen wanderten nach oben. »Hast du Nina oder Jasper so angegeiert? Ich würde dich für keinen von ihnen verurteilen, ich bin nur neugierig.«
»Ich habe niemanden angegeiert«, gab ich brummend zurück. Erst als sie außer Sichtweite waren, traute ich mich wieder hinter der Tür hervor. »Und du bist mit beiden per Du?« Warum war ich eigentlich überrascht?
»Eigentlich nur mit Nina. Doktor Bennik ist nicht der Typ, der viel mit anderen redet.« Lio verschränkte die Arme vor der Brust, und an seinen Lippen zupfte ein Lächeln. »Wieso fragst du?«
Ich zuckte mit den Schultern, konnte mich aber nicht daran hindern, Doktor Bennik hinterherzusehen. Hoffentlich würde er mich nicht erkennen, solange ich hier war. Oder mich verpfeifen, wenn er es tat.
»Ich will dir nicht deine Hoffnungen nehmen«, sagte Lio mit einem süffisanten Grinsen. »Aber es geht das Gerücht um, dass die beiden zusammen sind. Dr. Bennik und Dr. Wehner. Sie werden sehr viel zusammen gesehen, und sie kennen sich wohl schon seit Ewigkeiten.«
Das passte irgendwie. Die beiden sahen wirklich gut zusammen aus. »Das ist mir wirklich egal«, gab ich zurück und hakte mich bei meinem Bruder unter. »Lass uns essen gehen.«
Lio ließ sich zum Glück ablenken. Während er mir von seinem ersten Tag erzählte, warf ich noch einen Blick über meine Schulter und fragte mich, ob es besser war, Doktor Schobers Seminar erst einmal fern zu bleiben, damit ich nicht aufflog.
Und ob ich das überhaupt noch konnte.
Kapitel 4
Jasper
Ich war kein großer Fan von Medizinstudenten.
Das war ich nicht einmal gewesen, als ich selbst noch einer gewesen war. Sie verkörperten in der Regel eine unangenehme Mischung aus »Ich bin der König der Welt, niemand kann mir das Wasser reichen« und gefährlichem Halbwissen, das sie für volles Wissen hielten. Sie wussten wenig, waren aber der festen Überzeugung, ALLES zu wissen.
Dass ich ab und zu die Seminare von Ullrich Schober übernahm, lag also an dem massiven Respekt, den ich ihm entgegenbrachte – und sicher nicht an der Freude an der Sache. Auch wenn Ulli, wie er genannt werden wollte, der Meinung war, dass ich »ein großartiger Lehrer sein würde, wenn ich mich nicht so dagegen sträuben würde«.
Dem konnte ich nicht zustimmen. Denn meiner Meinung nach waren Menschen, die ihren Job nur halbherzig machten, nicht geeignet – für was auch immer. Auch wenn sie das nötige Wissen hatten.
Wenn also wieder einer dieser unleidlichen Freitage kam, an denen Ulli wegen seiner Arthrose nicht aus dem Bett kam, machte ich es mir zur Aufgabe, die Überflieger-Studenten auf den Boden der Tatsachen zurückzubefördern. Ihnen Fragen zu stellen, die sie nicht beantworten konnten, ihnen Aufgaben zu geben, die ihnen auf ihrem aktuellen Wissensstand nicht gelingen konnten. Nicht, weil ich sie schikanieren wollte oder mich an der aufkeimenden Verzweiflung in ihren Gesichtern ergötzte, sondern weil ich ihnen den Spiegel vorhalten wollte.
Du hast keine Ahnung von diesem Thema. Also hör gefälligst zu, denk mit, beschäftige dich damit. Sonst wirst du nie ein guter Arzt.
Ich hatte mich langsam daran gewöhnt, dass es in den Seminaren, die ich übernahm, still war wie auf Beerdigungen, weil niemand auf meine Fragen antworten konnte. Ich hatte mich an diese Gesichter gewöhnt.
Bis letzten Freitag.
Und als ich jetzt, das zweite Mal in Folge, in den Vorlesungssaal im Sankt Alexander trat, ließ ich den Blick sofort über die Reihen an Studierenden wandern. Suchte nach diesem Gesicht, das sich letzte Woche so hervorgetan hatte. Und fand es schließlich in der letzten Reihe, halb verborgen hinter einem Buch. Ich sah nur eine Millisekunde zu ihr, bevor ich zum Pult ging, aber es reichte merkwürdigerweise, um eine Welle an Zufriedenheit durch meinen Körper zu schicken.
Sie war wieder da. Die junge Frau, die vor einer Woche ALLE meine Fragen hatte beantworten können. Das hier war ein Kurs für Zweitsemester, in ihrem aktuellen Studienjahr konnte sie das alles also gar nicht wissen – außer sie hatte sich außerhalb des Studiums mit dem Thema beschäftigt. Und das hatte sie. Definitiv.
Während ich meine Sachen auf das Pult packte, zuckte mein Blick noch einmal nach oben. Jetzt blitzte nur noch ihr Haaransatz hinter dem Buch hervor, der Rest ihres Gesichts war verborgen. Beinahe, als würde sie sich verstecken wollen. Das war mehr als ungewöhnlich. Normalerweise saßen Studierende mit ihrem Wissensstand in den ersten Reihen und beugten sich bereits vorfreudig über ihre Tische, sobald die Dozenten hereinkamen.
Ein Gefühl breitete sich in mir aus. Ich war mir nicht ganz sicher, was genau es war, aber es fühlte sich an wie … War das Sympathie? War mir eine Medizinstudentin tatsächlich sympathisch? Das war ungewöhnlich. Vielleicht war es, weil sie mich merkwürdigerweise an den einzigen Menschen erinnerte, den ich größtenteils verstand – mich selbst. Ich sah beinahe schon ein Bild von meinem jüngeren Ich vor mir, wie ich in der letzten Reihe der Vorlesung saß. Still, niemals den Arm erhoben, um ja nicht aufzufallen.
Ich räusperte mich laut, und sofort drehten sich auch die letzten Studierenden zu mir um. Im Saal wurde es still, und ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Wie Sie vielleicht sehen, ist Doktor Schober noch nicht wieder gesund, und Sie müssen erneut mit mir vorliebnehmen. Für die, die mich letzte Woche verpasst haben: Mein Name ist Doktor Bennik, und ich knüpfe heute nahtlos an meine Ausführungen von letzter Woche über die Einordnung maligner Tumore an.«
Das Rascheln von Schreibzeug, das Klicken von Kulis. Ich wartete die Geräusche ab, und wieder zuckte mein Blick zu der jungen Frau in der letzten Reihe. Sie hatte das Buch endlich auf dem Tisch abgelegt, aber sie hatte weder Stift noch Papier gezückt, im Gegensatz zu den anderen. Sie schien vielmehr auf die Folien konzentriert zu sein, die ich über den Beamer auf die Wand hinter mir geworfen hatte.
Interessant.
Ich begann mit meinem Vortrag über die Physiologie von Tumorzellen, ohne auf die Notizen zu achten. Ich brauchte sie nicht, das Thema hatte sich in mein Gehirn gebrannt, seit ich auf der Onkologie im Haus angefangen hatte. Irgendwo in meinem Hinterkopf meldete sich Ullis Stimme, dass es wichtig war, den Unterricht für die Studenten ansprechend und spannend zu gestalten. Ich hatte das schon nicht verstanden, als er das erste Mal darüber gesprochen hatte. Wenn man das hier wirklich wollte – Arzt werden und über Medizin lernen –, dann brachte man doch seine eigene Lernmotivation mit, oder etwa nicht?
Als ich aufsah, bemerkte ich, dass sich schon wieder Verzweiflung auf den Gesichtern meiner Studierenden abbildete, und stieß ein innerliches Seufzen aus. War ich zu schnell? Ein paar von ihnen wirkten beim Mitschreiben gehetzt. Also bemühte ich mich, etwas langsamer zu sprechen, aber vielleicht war das jetzt auch zu langsam, denn mir begegneten ein paar neue, verständnislose Gesichter.
Wie zur Hölle konnte Ulli diesen Kram hier gern machen?
»Das ist eine ganz neue Generation an Ärzten, und wir sind in der Lage, sie zu formen«, hörte ich seine Stimme in meinem Kopf.
Ich presste die Lippen zusammen und entschied mich, an meiner Methode zu arbeiten. Also stoppte ich ab, wartete, bis alle fertig waren mit Mitschreiben, und fragte dann: »Weiß jemand noch ein oder zwei Merkmale maligner Tumoren?«
Das war eine einfache Frage. Eine, die sie leicht beantworten konnten, wenn sie mir letzte Woche ordentlich zugehört hatten. Vielleicht die erste Frage von mir, die sie definitiv wussten.
Aber kein Arm in dem Meer an Studenten ging in die Höhe. Auch nicht, als ich ein paar Sekunden abwartete und meinen Blick immer wieder über sie alle schweifen ließ. Nicht einer meldete sich. Da lag wieder nur Unverständnis auf ihren Gesichtern.
Jetzt war nur die Frage: Hatte keiner von ihnen Lust auf die ganze Sache, oder lag es an mir? Wenn ich in der Schule etwas nicht verstanden hatte, hatte das meistens an den Erklärungen des Lehrers gelegen. Vielleicht sollte ich das nächste Mal doch einfach ablehnen, wenn Ulli mich darum bat, damit ich nicht die neue Generation an Ärzten versaute, in die er so viel Hoffnung legte.
In meinem Augenwinkel war eine Bewegung zu sehen. Und als ich mich zur Seite drehte, war tatsächlich ein Arm in der Luft. Und es war, natürlich, der der jungen Frau von letzter Woche. Irgendwann während meiner Ausführungen der letzten Minuten hatte sie ihre braunen Locken zu einem unordentlichen Knoten nach oben gebunden. Ihr Gesicht wirkte angespannt, ihre Lippen waren zu einer dünnen Linie zusammengepresst – beinahe so, als würde sie gerade gegen sich selbst kämpfen und verlieren.
Mein Körper stockte nur für eine Sekunde. Dann hob ich die Hand und deutete auf sie.
Sofort ließ sie den Arm wieder sinken. Ihre Stimme war beinahe eine Oktave zu hoch, als sie laut sagte: »Schnelles Wachstum und die unscharfe Abgrenzung zu anderem Gewebe.«
Richtig. Eine richtige Antwort. In meinem Mundwinkel zuckte etwas, was mich noch mehr überraschte als ihre Antwort. Ich nickte anerkennend, verschränkte die Arme vor der Brust und fragte: »Und können Sie mir sagen, was eine Präkanzerose ist?«
Ich musste es einfach tun. Ich musste sie aus sich herauslocken. Dieses Thema hatte ich letzte Woche noch nicht behandelt, es war Teil meines heutigen Vortrages. Aber irgendwo in mir drin war ich mir sicher, dass sie auch diese Frage beantworten konnte.
Es wirkte, als würde die junge Frau die Luft anhalten. Darüber nachdenken, ob ich wirklich sie meinte. Und obwohl ich es in der Regel nicht sehr angenehm fand, Blickkontakt zu halten, tat ich es in diesem Moment.
Na, komm schon. Zeig mir, dass Doktor Schober recht hat mit dieser Generation.
»Eine Krankheit, die häufig, aber nicht zwangsläufig zu Krebs führt.« Sie platzte mit der Antwort heraus, als hätte sie sie schon eine ganze Weile auf der Zunge, aber noch überlegt, ob sie es wirklich sagen sollte. Jetzt leuchtete ihr Gesicht auf, und bevor ich nachhaken konnte, schob sie noch hinterher: »Wie Darmpolypen oder Gallenblasenentzündungen.«
Ich atmete tief durch. Spürte, wie meine Brust sich hob und senkte, wie die Luft durch meine Lunge strömte. Okay, Ulli, nächstes Mal höre ich wieder besser auf dich. Offensichtlich hast du doch auch manchmal recht, wenn ich das Gefühl habe, dass du es nicht hast.
»Sehr gut.« Mir wanderte tatsächlich ein kleines Lächeln aufs Gesicht.
Ihre Mundwinkel verzogen sich ebenfalls nach oben, sie schien sich ehrlich zu freuen. Dass die anderen neugierig zu ihr hochsahen oder sich eindeutige Blicke zuwarfen, schien sie auch nicht zu stören. Obwohl sie vor fünfzehn Minuten noch hinter ihrem Buch verschwinden wollte. Ihre Wangen waren etwas rot geworden, und ihre Augen leuchteten. Das bemerkte ich selbst auf die Distanz.
Und Nina hatte immer behauptet, dass es keinen größeren Nerd in Bezug auf die Onkologie gab als mich.
Schmunzelnd wandte ich mich ab und machte mit meinem Vortrag weiter. Ich versuchte mich an den Methoden von Doktor Schober und sprach bewusst langsamer, sodass man mir besser folgen konnte. Zu meinen Fragen meldete sich trotzdem kaum jemand, auch die restliche Stunde nicht. Nur sie. Immer und immer wieder schnellte ihr Arm in die Höhe. Und wenn sich doch mal jemand anderes mit meldete, musste ich mich wirklich zwingen, die andere Person zu Wort kommen zu lassen. Denn die Antworten der jungen Frau waren einfach immer besser. Detaillierter. Richtiger.
Himmel, wenn ich einen Vorlesungssaal voller Studierender wie sie hätte, würde ich diesen Job wahrscheinlich genauso gern machen wie Doktor Schober. Vielleicht konnte ich seine Begeisterung jetzt ein bisschen besser verstehen. Wenn auch wirklich nur ein bisschen.
Denn die meisten Gesichter waren am Ende meines Vortrages so leer wie am Anfang, und ich war mir ziemlich sicher, dass einige von ihnen es nicht mal durch das Latinum schaffen würden. Oder durch die nächsten Semester. Die Abbruchquote würde einem großen Teil das Genick brechen. Es tat mir beinahe ein wenig leid. Für sie, nicht für die Patienten.
Als ich meinen Vortrag beendete und die Studierenden entließ, brachen sofort wieder laute Gespräche aus. Im Saal summte es, als alle sich erhoben, lachten, zusammen zum Ausgang strömten. Ich griff nach meinem Laptop, und wieder – warum nur? – ging mein Blick nach oben. Folgte der jungen Frau, die in den Strom aus anderen Studierenden eintauchte und in Richtung des Ausgangs verschwand. Sie hob den Kopf. Und diesmal schenkte sie mir ein breites Grinsen. Die Stunde hatte ihr offensichtlich gefallen.
Wieder zuckten meine Mundwinkel nach oben. Ich konnte mich gar nicht dagegen wehren. Aber plötzlich erstarrte sie. Ihre Augen weiteten sich. Da stand Schreck in ihrem Gesicht, als hätte sie ein Gespenst gesehen.
Etwas überrascht wandte ich mich zum Eingang des Vorlesungssaals, um zu sehen, was ihr so einen Schreck eingejagt hatte, und entdeckte Nina. Sie hatte sich an ein paar der Studierenden vorbeigequetscht und kam nun mit großen Schritten auf das Pult zu, hinter dem ich immer noch stand.
»Wusste ich es doch, dass du Ullis Bitte nicht abschlagen konntest, Jasper«, sagte sie mit einem frechen Lächeln. Offensichtlich hatte sie schon vor einer Weile Feierabend gemacht, denn statt eines Kittels trug sie ein knielanges, enges Kleid, und ihre blonden Haare, die immer noch einen letzten Rest Rosa von ihrem letzten Färbeversuch trugen, waren offen und fielen ihr auf die Schultern.
»Mir sind die Gegenargumente ausgegangen«, sagte ich ruhig und schob meinen Laptop in die Hülle. Dann erst hob ich den Kopf wieder und sah über Ninas Schulter zurück zu der Studentin. Sie hatte sich in Windeseile an allen anderen vorbeigedrängt und … floh. Anders konnte man es nicht bezeichnen.
Sehr seltsam.
»Dabei sollte er doch eigentlich wissen, dass deine Methoden nicht für die Studierenden gemacht sind.« Nina tätschelte meinen Arm, ihr Blick war warm. »Und dass du das nicht so gern machst.«
Ich atmete tief durch. »Es … war in Ordnung.«
»Wirklich?« Ihre Augen weiteten sich, als ich neben ihr ebenfalls zum Ausgang des Vorlesungssaals ging. »Das sind ja ganz neue Töne. Entdeckst du deine Liebe für die Studierenden doch noch?«
»Sicher nicht.« Zumindest nicht für alle. Ich blieb stehen, um in dem großen Schlüsselbund der Uni nach dem zu suchen, mit dem ich den Vorlesungssaal absperren konnte.
Nina wippte neben mir auf den Füßen herum, sie wirkte wie immer außerordentlich gut gelaunt. »Bekommst du dann jetzt wenigstens mehr Gehalt, wenn sie dich schon extra schuften lassen?«
»Für ein paar Vertretungsstunden? Nein.«
Sie blies sich eine rosa-blonde Strähne aus dem Gesicht wie ein Teenager, dann hakte sie sich bei mir unter. »Ich verstehe schon – alles für den Oberarztposten nächstes Jahr. Den würde Ulli dir aber sicher auch überlassen, wenn du ab und zu nach Hause gehst.« Nina zog mich vom Saal weg zur Pforte, wo ich den Schlüsselbund abgab, und dann weiter in Richtung Ausgang.
Das war nicht der Weg, den ich eigentlich einschlagen wollte.
»Ich muss noch mal hoch auf Station«, brummte ich.
»Das sagst du immer. Aber das kannst du sicher auch noch morgen machen«, gab Nina gnadenlos zurück. »Jetzt gehst du erst mal mit mir essen. Ich hatte einen wirklich irren Vierundzwanzig-Stunden-Dienst, und mein Magen hängt mir in den Kniekehlen.«
Ich schmunzelte. »Und du hast außerdem deinen Geldbeutel vergessen?«
»Erwischt.« Sie grinste breit und atmete gierig die kühle Abendluft ein, als wir auf den Platz vor dem Alex traten. Als wäre sie seit Wochen nicht draußen gewesen. Bei ihrem Anblick strömte etwas Wärme in meinen Magen, und ich schmunzelte. »In Ordnung. Unter einer Bedingung.«
Nina zog fragend die Brauen nach oben. »Ich soll die nächste Vorlesung für dich machen, wenn Ulli dich wieder bittet, ihn zu vertreten?«
»Nein«, kam es mir, vielleicht eine Spur zu schnell, über die Lippen. Huch, hatte eine einzige Studentin etwa wirklich meine Meinung dazu geändert? Ich schüttelte abwehrend den Kopf und ließ mich bereitwillig über den Platz ziehen. »Du übernimmst den Pflanzendienst für mich. Ich verstehe sowieso nicht, wieso wir so etwas überhaupt machen müssen, aber die Stationsleitung von der Erwachsenenonkologie hat mir letzten Monat schon dreimal auf dem Gang die Hölle heiß gemacht, weil ich es vergessen habe.«
»Ich soll nur die Pflanzen in den Arztzimmern gießen?« Nina zuckte mit den Schultern. »Das mache ich mit Freuden. Schon allein, weil du bei deinen letzten Diensten dafür verantwortlich warst, dass zwei Kakteen das Zeitliche gesegnet haben. KAKTEEN.« Sie schüttelte ungläubig den Kopf und schmiegte dann ihren Kopf an meinen Arm. »Dann gehen wir jetzt Sushi essen.«
»Was immer du willst«, gab ich lächelnd zurück und verabschiedete mich endgültig von dem Gedanken, heute noch mal auf Station zu kommen.
Und von dem Gedanken an die Studentin.
Zumindest größtenteils.
Kapitel 5
Emilia
O

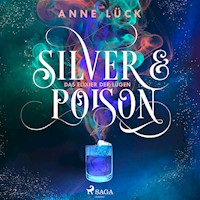
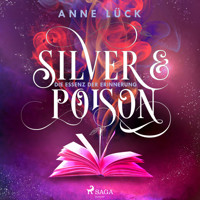
![Jewel & Blade. Die Wächter von Knightsbridge [Band 1 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ce22490997b3e6e0e807c8b632e07b21/w200_u90.jpg)




![Jewel & Blade. Die Hüter von Camelot [Band 2 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c7d0b6bb9c33b9a1b2b09f490d3cfe2a/w200_u90.jpg)