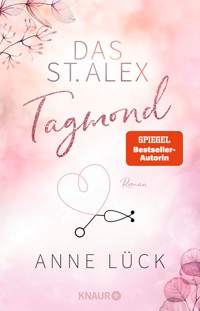
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die New-Adult-Reihe Das St. Alex
- Sprache: Deutsch
Wenn sich das Leben nicht an deine Pläne hält, vertrau der Liebe! In »Das St. Alex – Tagmond«, dem 2. Liebesroman der romantischen New-Adult-Reihe um drei junge Krankenschwestern in Berlin, gerät das perfekt durchgeplante Leben von Tessa ziemlich durcheinander – woran Rettungsassistent Beck nicht ganz unschuldig ist … Tessa hat für alles im Leben einen Plan: Nach der Ausbildung zur Krankenschwester will sie neben der Arbeit im Berliner St.-Alex-Krankenhaus ein Studium absolvieren und dann im Management Karriere machen. Und irgendwann ihre Jugendliebe Martin heiraten. Länger als unbedingt nötig auf der Kinderonkologie-Station des St.-Alex-Krankenhauses zu bleiben, gehört nicht zu Tessas Plan. Auch nicht, dass das Schicksal ihres zwölfjährigen Patienten Luca, der schon viel Schlimmes durchgemacht hat, sie so berührt. Und schon gar nicht Beck, der planlose Rettungsassistent mit dem großen Herzen. Aber es läuft eben nicht alles im Leben nach Tessas Plan … »Mit dieser Geschichte hat Anne Lück sich selbst übertroffen. Authentische Charaktere, berührende Schicksale und medizinisches Fachwissen on point. Absoluter Suchtfaktor mit Herzklopfgarantie!« - Ava Reed Anne Lücks New-Adult-Reihe spielt jeweils auf einer anderen Station des Berliner St.-Alex-Krankenhauses und erzählt die Geschichten von drei jungen, miteinander befreundeten Krankenschwestern. Im ersten Liebesroman der Reihe, »Das St. Alex – Nachtleuchten«, hat Tessas Freundin Sami zwischen ihrem anspruchsvollen Job und der Sorge um ihre jüngeren Brüder einfach für nichts anderes mehr Zeit – auch nicht für die Liebe?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Anne Lück
DAS ST. ALEX
Tagmond
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wenn sich das Leben nicht an deine Pläne hält, vertrau der Liebe
Tessa hat für alles im Leben einen Plan: Nach der Ausbildung zur Krankenschwester will sie neben der Arbeit im Berliner St.-Alex-Krankenhaus ein Studium absolvieren und dann im Management Karriere machen. Und irgendwann ihre Jugendliebe Martin heiraten. Länger als unbedingt nötig auf der Kinderonkologie-Station zu bleiben, gehört nicht zu Tessas Plan. Auch nicht, dass das Schicksal ihres zehnjährigen Patienten Luca sie so berührt. Und schon gar nicht Beck, der planlose Rettungsassistent mit dem großen Herzen. Aber es läuft eben nicht alles im Leben nach Tessas Plan …
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Danksagung
Für Natascha, die von Anfang an dabei war, mich unterstützt und gefeiert hat – und bei der ich nicht widerstehen konnte, ihr einen Auftritt in meinem Buch zu geben. Ich bin sicher, du wirst die großartigste Ärztin für deine zukünftigen Patienten.
Kapitel 1
Die Decke kam näher.
Je länger ich den Kopf leicht in den Nacken gelegt hatte und nach oben starrte, desto sicherer war ich mir. Die graue Raufasertapete wurde vor meinen Augen dunkler, klarer, ich konnte immer mehr Details sehen. Vielleicht lag es an dem Geruch der vielen Kerzen im Raum, der mir den Kopf vernebelte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass die Kapelle im Sankt Alex eigentlich viel zu klein war für so viele Menschen und die anderen mir den Sauerstoff wegatmeten. Nur kurz ließ ich meinen Blick über die Menge schweifen, über die Krankenschwestern, die entweder gerade im Dienst waren oder diesen für heute bereits beendet hatten, über die Ärzte in ihren Kitteln, die Psychologen und dann … die Eltern. Sarahs Eltern. Sie standen ganz abseits, nicht wie die anderen um den kleinen runden Tisch versammelt, der in der Mitte der kleinen Kapelle stand. Ihr Vater hatte einen Arm um seine Frau gelegt und sie verschwand beinahe darin, weil sie so schmal und klein war. Noch schmaler als damals, als Sarah auf unsere Station gekommen war. Noch blasser. Noch verzweifelter.
Ich blickte wieder nach oben und fokussierte mit den Augen die Faserung der Decke. Mein Herz raste in meiner Brust, egal, wie viele von den Lampen ich zählte. Egal, wie sehr ich versuchte, mich nur auf meinen Atem zu konzentrieren. Mein Mund war staubtrocken, meine Handinnenflächen dafür umso feuchter. Ich kann das hier nicht.
»Du kriegst noch eine Nackensteife, Tessa«, raunte unsere Assistenzärztin Natascha neben mir. Sie hatte sich fester in ihren Kittel gewickelt und die langen blonden Haare hinter die Ohren geschoben. Schon seit sie in den Raum gekommen war und sich neben mich gesetzt hatte, wirkte sie, als würde sie jeden Moment anfangen zu weinen.
Statt der Decke warf ich jetzt ihr einen Blick zu und verschränkte die Arme vor der Brust. »Das hier ist schrecklich«, flüsterte ich. Meine Stimme fühlte sich rau an und ich konnte den Kloß in meinem Hals nicht herunterschlucken. Jedes Mal, wenn ich durch den Raum blickte, sah ich dieses verdammte Krankenhausbett vor mir, sah die unzähligen Menschen in Kitteln um es stehen, hörte unsere Oberärztin Anweisungen brüllen und dann …
»Ja.« Natascha riss mich mit diesem Wort aus dem Gedankenstrudel. Ich richtete meinen Blick wieder nach vorn, wo Malik gerade die erste der sieben Kerzen auspustete. Sieben Kerzen. Sieben Kinder. Ich atmete tief durch und spürte, wie sich meine Fingernägel in meine Arme gruben, ohne dass ich es verhindern konnte.
Vielleicht können sie mich doch versetzen, ging es mir wieder durch den Kopf, sicher zum dritten Mal in dieser Woche. Vielleicht verstehen sie es.
Ich hatte mein Pflegemanagement-Studium am »Sankt Alexander-Krankenhaus für Onkologie und Palliativmedizin« erst vor ein paar Monaten begonnen, weil es der einzige Standort in Berlin und Umgebung war, der mich mit meiner geringen Arbeitserfahrung angenommen hatte. Himmel, wie sehr hatte ich mich damals über den Zulassungsbrief gefreut, was für Luftsprünge hatte ich gemacht. Immerhin strebte ich seit Beginn meiner Ausbildung zur Krankenschwester eine Karriere auf den höheren Hierarchieebenen an: Stationsleitung. Bereichsleitung. Und wenn es ging, noch weiter. Ich hatte beinahe das Gesicht von Martin vor mir, wie er mir mit diesem Lächeln, das ich früher für überheblich gehalten hatte, sagte: »Du bist zu Größerem berufen, Tessa.« Und mittlerweile hätte ich ihm zugestimmt.
Aber das hier, diese Momente – das konnte doch kein Mensch auf Dauer aushalten. Als Malik die zweite Kerze auspustete und eine Frau laut zu schluchzen begann, musste ich mich abwenden. Ich hatte die Patientin kaum gekannt und trotzdem konnte ich die Gänsehaut auf meinem ganzen Körper nicht wegreiben. Wieder kam der Augenblick in mein Gedächtnis, als ich neben ihrem Bett gestanden hatte und der Alarm losgeschrillt war. Die furchtbaren Millisekunden, in denen ich wie erstarrt gewesen war, und dann, wie ich wie mechanisch zur Herzdruckmassage übergegangen war. Wie die Ärzte dazugekommen waren, wie es im Zimmer immer hektischer geworden war. Rufe. Durchdringendes Piepen. Und dann die Stimme der Oberärztin, die sich nach einer gefühlten Ewigkeit über alle anderen erhoben hatte: »Zeitpunkt des Todes …« Den Kloß in meinem Hals konnte ich nicht hinunterschlucken. Ich war gerade einmal seit drei Wochen auf Station und hatte die meiste Zeit mit Malik in seinem Büro verbracht, hatte mich in die Dienstplanung einarbeiten lassen, die Aufgaben einer Stationsleitung gelernt und nur selten am Patienten gearbeitet. Ich war gut als Krankenschwester, in der Ausbildung war ich die Jahrgangsbeste gewesen. Auf der Intensivstation, auf der ich danach gelandet war, hatte ich kaum Probleme gehabt, mich einzufinden. Deshalb hatte ich schließlich nach so kurzer Zeit schon den Studienplatz bekommen.
Allerdings war meine persönliche Grenze definitiv erreicht. Die Kinder waren meine Grenze.
Malik wartete einen Moment in der Mitte der Kapelle, die Arme hinter dem Rücken verschränkt, sein Gesicht die Ruhe selbst. Es war unverkennbar, dass er im Gegensatz zu mir für diesen Job geschaffen war. Er wartete geduldig, bis das Schluchzen der Mutter neben ihm etwas abgeflacht war, bevor er ganz ruhig vortrat, seine Brille richtete und dann den nächsten Namen auf seiner Liste vorlas: »Hannah Krüger.« Die restlichen Kerzen flackerten leicht, als er die nächste ausblies.
Natascha seufzte neben mir und ich sah sie wieder an. »Ich habe sie ein paar Tage begleitet. Akute lymphatische Leukämie. Sie war erst acht«, erklärte sie mit belegter Stimme. Sie strich die Haare wieder nach hinten, obwohl sich keine Strähne verirrt hatte, und gab ein leises Stöhnen von sich. »Gott, das hier ist echt übel.«
Ich wusste genau, was sie meinte. Es war übel. Ursprünglich war ich Krankenschwester geworden, um Menschen zu helfen. Das schwere Gefühl, das sich in dieser Kapelle über mich legte, das sich so erdrückend und verzweifelnd anfühlte, bestätigte mich wieder einmal in meiner Entscheidung, der Pflege den Rücken zu kehren. Ich hätte niemals für möglich gehalten, dass ich mich in einem ganz normalen Büroalltag wünschen würde, mit Jobroutine und ohne böse Überraschungen.
Die letzte Kerze erlosch und einen Moment legte sich Stille über die gesamte Menschenmenge. Eine Minute nur, aber sie fühlte sich ewig und niederschmetternd an. Als sich allmählich alle von ihren Stühlen erhoben, spürten meine Fingerkuppen die Druckstellen, die meine Nägel auf meinen Oberarmen hinterlassen hatten. Die Anspannung wich nur langsam aus meinem Körper, als ich mit Natascha an dem Tisch vorbei den Ausgang der Kapelle ansteuerte.
Wir blieben in dem weiten Flur vor der Tür stehen, und ich blickte zurück zu meiner Stationsleitung Malik, der sich noch mit leiser Stimme mit der Mutter unterhielt, die während der Gedenkstunde so laut geschluchzt hatte. Ich lehnte mich an eine der Säulen im Flur, um auf ihn zu warten, und seufzte dabei laut. Der wolkenlose Himmel, der sich durch die große Fensterfront hinter uns zeigte, passte absolut nicht mehr zu meiner Stimmung.
Natascha, die gerade dabei war, sich wieder einen hohen Zopf zu machen, sah mich fragend von der Seite an. Ihre Augen waren rot, auch wenn sie nicht geweint hatte. »Was machst du eigentlich hier, wenn du das nicht magst? Die Gedenkstunde ist doch für euch optional.«
»Der Frühdienst ist schon weg und der Spätdienst musste auf Station bleiben. Malik meinte, dass wenigstens ein paar von uns da sein sollten – und wo er hingeht, gehe ich mit.« Ich zuckte mit den Schultern, als würde es mir nichts ausmachen, aber meine Arme fühlten sich seltsam steif und wund an. Sicher sollte ich für mein Studium, sooft es ging, Malik begleiten, aber solche Termine stellte er mir immer frei. Die Alternative wäre allerdings gewesen, auf Station zu bleiben und mit dem Spätdienst zu arbeiten. Und wir hatten aktuell einige Patienten, bei denen ich mir sicher war, dass sie nächsten Monat ebenfalls eine Kerze in dieser Kapelle bekommen würden. Allein beim Gedanken daran zog sich mein Magen unangenehm zusammen.
Die Assistenzärztin musterte mich einen Augenblick lang, dann nickte sie verstehend. »Klar. Ich war auch nur wegen Hannah hier und weil ich eh im Dienst war. Das nächste Mal schicke ich definitiv wieder Louis, der kommt mit so etwas eindeutig besser klar.«
»Du hast dich doch gut gehalten«, gab ich aufmunternd zurück, doch sie winkte ab. »Ich muss wieder zurück zu Doktor Fischer, sie wollte mit mir noch ein paar Untersuchungen durchgehen. Dir einen ruhigen Feierabend heute.«
»Danke.« Ich sah ihr gedankenversunken nach, wie sie mit wehendem Kittel über die Flure des Sankt Alex in Richtung Aufzüge verschwand. Für einen Moment streifte mich kurz der Gedanke, dass ich noch in meiner Ausbildung daran gedacht hatte, auch irgendwann Medizin zu studieren. Ärztin zu werden. Jetzt fühlte sich dieser Gedanke so weit weg an, beinahe als hätte ich ihn in einem völlig anderen Leben gehabt.
»Alles in Ordnung?«
Ich riss erschrocken den Kopf zu Malik herum, der in diesem Moment aus der Kapelle getreten war und sanft lächelte. Obwohl er den gleichen magentaroten Kasack trug wie ich, wirkte er darin irgendwie professioneller. Vielleicht lag es an seiner besonnenen Art. An seinem sanften Blick. Oder daran, dass er um einiges größer war als ich. »Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken.«
»Alles gut, ich war nur in Gedanken.« Ich ließ die Hände in die großen Taschen meines Kasacks sinken und folgte ihm zum Zwischengang des Krankenhauses, der den Palliativtrakt mit dem der Onkologie verband. Im Licht der durch die Glasfronten scheinenden letzten Sonnenstrahlen des Tages sah er müde aus. Heute entsprach sein Gesicht tatsächlich mal seinem Alter. Ich erinnerte mich noch genau, als ich ihn das erste Mal getroffen und gedacht hatte, dass dieser Mann auf keinen Fall vierzig sein konnte. Oder Stationsleitung. Er hatte so jung und dynamisch gewirkt, sein Lächeln so verschmitzt und die Art zu reden so ungeheuer lustig und entspannt. So war Malik auch immer noch, aber heute wirkten seine dunklen Augen erschöpft und seine bronzefarbene Haut etwas grau.
»Es ist besonders schlimm, wenn man die Kinder und ihre Eltern schon seit Jahren begleitet«, erklärte er mit einem schwachen Lächeln, weil er meinen durchdringenden Blick wohl bemerkt hatte.
»Vielleicht brauchst du auch mal wieder Urlaub«, gab ich zurück und drückte den Knopf des Aufzugs. »Wann war der letzte? Vor vier Monaten? Fünf?« Normalerweise redete ich mit den Stationsleitungen nicht so salopp, aber ich wusste, dass man das mit Malik konnte. Dass er es sogar begrüßte. Sein breiter werdendes Lächeln bestätigte das. »Fünfeinhalb. Sei nicht so frech.« Er trat vor mir in den Aufzug und blickte mich von der Seite an, als die Türen sich vor uns schlossen.
»Wir schauen nur noch schnell, ob der Spätdienst uns noch braucht, dann kannst du gern gehen. Ich muss mich noch einmal an den Dienstplan setzen.«
»Ich kann dir dabei helfen.«
»Auf keinen Fall. Du bist diese Woche fast jeden Tag länger geblieben und hast Papierkram für mich erledigt, du gehst heute pünktlich nach Hause.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Wenn du meinst.« Unbedingt unglücklich war ich nicht darüber, nach Hause zu kommen. Aber ich mochte Malik und wollte ihn gern unterstützen, bevor er sich noch irgendwann in ein Burn-out arbeitete. Auf der anderen Seite war er ein erwachsener Mann und wusste wahrscheinlich, was er tat.
Die Kinderonkologie lag im obersten Stockwerk. Als wir aus dem Aufzug traten und auf die große Milchglastür zuliefen, drehte sich Malik wieder zu mir um. »Morgen nehme ich dich endlich mit zur Leitungsrunde. Es wird Zeit, dein Einsatz bei uns läuft schließlich schon seit ein paar Wochen.« Er fuhr sich durch die schwarzen Haare und grinste jungenhaft.
»Ja, das wäre toll«, gab ich zurück, auch wenn sich bei seinen Worten ein schlechtes Gewissen in mir ausbreitete. Der Gedanke, der Kinderonkologie den Rücken zu kehren und mich woandershin versetzen zu lassen, war in meinem Kopf so präsent wie noch nie. Tatsächlich würde es mir aber leidtun, nicht mehr mit Malik zusammenzuarbeiten. In meiner Ausbildung hatte ich schon Stationsleitungen kennengelernt, die wesentlich weniger erträglich waren als er, und ich wusste schließlich nicht, wohin es mich verschlagen würde. Außerdem wusste ich, dass Malik sich tatsächlich eine stellvertretende Stationsleitung wünschte. Er hatte schon ein paar Mal scherzhaft durchblicken lassen, dass er mich vielleicht nach meinem Einsatz einfach nicht mehr gehen lassen würde.
Nicole kam uns schon entgegen, da waren wir kaum durch die Tür auf Station getreten. Ihr ganzes Gesicht wirkte genervt, was ein ungewohntes Bild war. Eigentlich war die Schwester mit den kurzen grün-schwarzen Haaren immer gut gelaunt, wenn sie Spätdienst machen musste. Heute sprang ihr die miese Laune schon aus dem Gesicht, bevor sie den Mund aufmachte: »Luca Albrecht ist hier. Er sollte ja eigentlich ins Zimmer zwei, aber da das erste jetzt auch frei ist, würde ich ihm lieber das zuweisen. Das ist näher am Stationsstützpunkt. Wäre das okay für dich?«
Während Malik mit ihr das Für und Wider abwägte, glitt mein Blick den Flur entlang zu dem Jungen, der auf der niedrigen Bank vor der Glasfront saß. Er war dick in einen Anorak gewickelt und sein Blick sah noch düsterer aus als der von Nicole. So jung er auch wirkte, ich hätte mich nicht gewundert, wenn er jede Sekunde eine Prügelei angefangen hätte. Seine Hände waren auf seinem Schoß zu Fäusten geballt und seine ganze Haltung war auf Abwehr geschaltet. Auf »Lasst mich in Ruhe und keinem passiert etwas«.
Ich hatte schon von Luca Albrecht gehört. Das hatte wahrscheinlich jeder in diesem Krankenhaus. Er war auf dieser Station eine lebende Legende, und seit die anderen Schwestern wussten, dass er wiederkommen würde, wurde darüber gestritten, wer ihn übernehmen musste, was mich bereits ab der ersten Sekunde schrecklich wütend gemacht hatte. Ich wusste eigentlich nur, dass er seit frühester Kindheit im Heim lebte, und das war mir eigentlich schon Information genug. Ja, anscheinend war er immer mies gelaunt, anscheinend hatte er oft einen sehr respektlosen Umgangston mit den Pflegerinnen, anscheinend hatte er eine eher aggressive Grundstimmung. Aber ich kannte Kinder wie ihn. Kinder, die seit Jahren im System festhingen, die niemanden hatten und nur wussten, dass sie irgendwie auf sich selbst aufpassen mussten. Und seine Prognose war auch einfach niederschmetternd. Lungenkrebs. Zum dritten Mal im Rezidiv. Eine Heilung war mittlerweile eher unwahrscheinlich. Die Chemozyklen, die er vor sich hatte, würden schrecklich werden. Ob er wohl wusste, wie es um ihn stand?
Gerade hob er den Gameboy, den er in der Hand hielt, hoch und zeigte das Display dem Rettungssanitäter, der neben ihm stand. Seine Miene änderte sich kaum, aber ich sah die Wolken in seinen Augen, die ich schon so oft an anderen gesehen hatte – und wie sie sich für eine Sekunde etwas lichteten.
»Gut«, sagte Nicole gerade seufzend. Sie winkte mir kurz, wünschte mir einen schönen Feierabend und ging dann zu Luca, der sofort den Blick hob und ihr düster entgegensah. Beinahe, als würde er ihr jeden Moment ins Gesicht springen. Die beiden unterhielten sich sehr knapp. Dann, ganz plötzlich, blickte er zu mir, runzelte die Stirn und deutete auf mich, als wäre ich ein ekliger Käfer, der auf seinem frisch geputzten Fenster saß. Nicole sah über ihre Schulter, bevor sie ihm mit einem verkniffenen Lächeln antwortete: »Das ist Tessa, sie macht ein Praktikum hier auf Station.« Ihr war selbst auf die Entfernung anzumerken, dass sie das Gespräch am liebsten so kurz wie möglich halten wollte, und ich spürte, wie sich mein gesamter Körper verkrampfte.
Luca starrte mich mit unverhohlenem Misstrauen an, als wäre er sich sicher, dass ich ihm Böses wollte. Aber ich sah immer noch nur die Wolken in seinen Augen. Die Augen, die schon so viel gesehen und erduldet hatten, dass mir ganz flau im Magen wurde. Ich bemühte mich um ein Lächeln und hob grüßend die Hand, und damit hatte Luca wohl nicht gerechnet. Seine Augen weiteten sich ein wenig und dann brach er den Blickkontakt schnell ab. Starrte auf seinen Gameboy und ignorierte mich. Diese Reaktion brachte auch den Rettungssanitäter dazu, überrascht aufzusehen. Einen Moment kreuzten sich unsere Blicke und mir fuhr durch den Kopf, dass ich ihn schon einmal gesehen hatte – ich konnte mich nur nicht daran erinnern, wann und wo. Als er mir ebenfalls zulächelte, war es, als würde in seinem Gesicht ein Licht angeknipst werden. Seine dunklen, fast schwarzen Augen, die kleinen Lachfältchen darum, seine Grübchen, alles an ihm schien zu leuchten. Zu strahlen. Ich hielt die Luft an, ohne es zu merken.
»Tessa?«
Ich fuhr etwas irritiert zu Malik herum, der ein süffisantes Lächeln aufgesetzt hatte. »Bist du geistig wieder anwesend?«
»Klar«, gab ich zurück, konnte mir einen weiteren Blick in Richtung der beiden Stationsbesucher aber nicht verkneifen. Der Rettungssanitäter hatte gerade Lucas Tasche aufgenommen und folgte dem Jungen und Nicole ins Zimmer. Aber auch er drehte sich noch einmal um, sah mich noch einmal kurz an, diesmal abwartend, abschätzend.
»Wie vorhin besprochen, kannst du gerne nach Hause gehen. Es ist relativ ruhig hier und der Spätdienst braucht gerade keine Unterstützung.« Malik verschränkte die Arme hinter dem Rücken, wie er es schon in der Kapelle getan hatte, und folgte meinem Blick. Glücklicherweise interpretierte er ihn falsch. »Du wirst Luca morgen näher kennenlernen. Ich bin gespannt, wie gut ihr miteinander klarkommen werdet.«
Ich grinste, auch ein wenig um die Irritation in mir abzuschütteln, die der kurze Blickkontakt zwischen dem Rettungsassistenten und mir gerade in mir ausgelöst hatte. »Aye, aye, Chef. Mach nicht mehr so lange«, gab ich zurück.
Malik lächelte erneut. »Mal sehen.«
Wir verabschiedeten uns und ich verließ die Station zu den Umkleiden der Mitarbeiter. Es fühlte sich herrlich an, endlich aus der Bereichskleidung zu schlüpfen, wieder zurück in mein eng anliegendes Kleid und den eleganten Wintermantel. Den Pferdeschwanz zu lösen, bis meine blonden Haare wieder auf die Schultern fielen. Wie ein Befreiungsschlag. Ich schnappte meine Tasche und spürte, wie sich meine Stimmung langsam hob, während ich die Umkleide verließ und zum Aufzug ging. Endlich raus aus dem Krankenhaus, an die frische, wenn auch schneidend kalte Winterluft.
Es war nicht viel los auf dem Platz vor dem Sankt Alex, nur ein paar Besucher tummelten sich am Eingang. Da der Leitungsdienst später anfing als der Frühdienst und länger ging, waren kaum noch Pfleger zu sehen, die ihren Feierabend einläuteten.
Ich kramte in der Tasche nach meinem Handy, während ich zum Parkplatz lief. Drei Nachrichten. Die erste war von meiner Mutter und bereits ein paar Tage alt – ich hatte sie noch nicht geöffnet und es auch jetzt nicht vor. Eine andere war von Nela, dass ihre Nachmittagsvorlesungen ausgefallen waren, und die letzte von Martin. Ich wusste bereits, was darin stehen würde, bevor ich sie überflog.
»Komme heute später nach Hause. Chef verlangt Überstunden.«
Ich antwortete gar nicht erst, sondern ließ das Handy wieder in meine Tasche gleiten. Es würde mittlerweile mehr Sinn ergeben, wenn er mir an Tagen schrieb, an denen er pünktlich nach Hause kam.
Meine gute Laune konnte mir das trotzdem nicht nehmen, als ich endlich mein Auto erreichte – in erster Reihe geparkt, weil ich Maliks Parkplatz benutzen durfte. Er kam im Winter lieber mit der Bahn, weil er nicht gern bei Schnee und Eis fuhr. Ich ließ mich auf den Fahrersitz fallen, warf die Tasche achtlos auf die Beifahrerseite und stellte das Radio an. Der Moderator kündigte ein nasskaltes Novemberende an, bevor ein Popsong startete. Ich summte leise mit, während ich ausparkte und endlich das Gelände des Sankt Alex verlassen konnte.
Weil Malik mich eher hatte gehen lassen, kam ich nicht in den Feierabendverkehr, der in Berlin wirklich die Hölle war, und schaffte es in unter fünfzehn Minuten nach Charlottenburg. Zwischen den hohen, wunderschönen Altbauten, die die Straße einrahmten, begann ich endlich, mich zu entspannen. Mein Antrag auf Stationswechsel war bereits ausgefüllt. Zwar hatte ich ihn Malik noch nicht auf den Schreibtisch gelegt und es würde mich einige Überwindung kosten, es zu tun – aber ich wusste, dass ich es jeden Moment tun konnte. Dass es mich nur ein wenig Überwindung kosten würde, meine Lage zu ändern. Und das würde ich bald in Angriff nehmen.
Ich schaffe das, ermutigte ich mich selbst, bevor ich endlich in die Straße unserer Wohnung einbog.
Kapitel 2
Schon als ich in den Hausflur mit den hohen, edel wirkenden Steinwänden trat, erfüllte mich ein angenehmes Kribbeln. Wie schon vorhin bei der Arbeit hob ich den Blick, doch jetzt sah ich statt einer Raufasertapete eine wunderschöne verstuckte Decke, die typisch für die hochwertigen Altbauwohnungen in Charlottenburg war. Ein Lächeln trat auf mein Gesicht und ich machte mich auf den Weg nach oben. Ein Nachteil daran, wenn man in einem so geschichtsträchtigen Gebäude wohnte: Sie hatten in der Regel keinen Aufzug. Auch unsere Wohnung nicht. Doch selbst jetzt, wo ich völlig erschöpft von der Arbeit kam und die Treppenstufen hochschnaubte, konnte ich nicht wirklich etwas Negatives daran finden. Dafür freute ich mich immer noch zu sehr darüber, hier wohnen zu können.
Martin und ich waren erst vor etwas über zwei Jahren hergezogen – ich aus dem Schwesternwohnheim, er aus der Wohnung seiner Familie. Als ich im ersten Stock an der Tür vorbeilief, hinter der seine Mutter wahrscheinlich gerade die Nase in ein altes Fotobuch steckte, entfuhr mir gegen meinen Willen ein Seufzen. Sehr weit war mein über alles geschätzter Freund nicht von ihr weggekommen. Aber bei der Wohnung, die wir hier bekommen hatten, würde ich sicher einen Teufel tun und mich darüber beschweren, dass meine Schwiegermutter, wie ich sie liebevoll trotz dem fehlenden Ring an meinem Finger nannte, nur ein Stockwerk von uns entfernt war. Zumal sie eigentlich herzensgut war, wenngleich auch manchmal ein wenig übergriffig. Aber wieder kein Grund für Beschwerden, wenn man das Gesamtbild betrachtete.
In der zweiten Etage steckte ich meinen Schlüssel in die Tür und in dem Moment, in dem sie aufschwang, entfuhr mir ein zutiefst zufriedenes Seufzen. Noch als ich die Schuhe ordentlich auf dem dafür vorgesehenen Abtreter abstellte und meinen Mantel an den Haken hängte, glitt mein Blick durch die Wohnung. War es normal, dass man auch nach zwei Jahren noch so verliebt war in einen Ort? In die hohen Wände, die bodentiefen Fenster und das offene Raumkonzept, das alles noch viel größer erscheinen ließ? Die hochwertigen Möbel, die teure Deko, die edlen Vorhänge? Die geschwungene Treppe, die in das halbe offene Obergeschoss führte, in dem nur ein gemütlicher Sessel und dahinter ein wandausfüllendes Bücherregal standen?
Vielleicht lag es daran, dass ich in meiner Jugend nie so viel Platz gehabt hatte. Nie so viele Dinge, die nur mir gehörten und auf die niemand sonst Anspruch erhob. Und vor allem nie das Geld für das alles. Aber ich konnte nicht anders, als mich mit einem breiten Grinsen in dem offenen Wohnzimmer zu drehen, die Arme ausgebreitet. Den sonnendurchfluteten Raum zu genießen, den Geruch nach Freiheit und Leder und … Tomatensoße?
Ich stoppte so abrupt in der Bewegung ab, dass ich beinahe auf dem hellen Parkett ausgerutscht wäre. Noch einmal reckte ich meine Nase ein wenig in die Luft, schnupperte, und dann sanken meine Schultern ein. Tomatensoße, ganz eindeutig. Und auch ganz eindeutig nach dem alten Rennig-Familienrezept, denn ich konnte die Paprika und den Zimt herausriechen. Niemand sonst kochte so etwas, außer …
»Marion?« Ich versuchte, meine Stimme nicht genervt klingen zu lassen, als ich das Wohnzimmer durchquerte und einen Blick in die Küche warf. Natürlich, sie war es. Stand mit einer Selbstverständlichkeit am Herd und rührte in einem dampfenden Topf, eine Hand in die Hüfte gestützt und einen Oldie summend. Sie trug sogar die lächerliche Kochschürze, die Martin mir mal aus Spaß geschenkt, die ich aber noch nie getragen hatte. Jetzt blickte sie überrascht über ihre Schulter und strahlte mich an, als hätte sie überhaupt nicht mit mir gerechnet, in meiner eigenen verdammten Wohnung. »Theresa, Liebes, wie schön, dass du zu Hause bist. Ich habe für euch gekocht!«
»Das sehe ich«, gab ich zurück und lehnte mich mit vor der Brust verschränkten Armen an den Türrahmen. »Hat Martin dich darum gebeten? Hat er schon keine Lust mehr auf meine Kochkünste?« Das wäre eigentlich gar nicht so abwegig. Ich konnte überhaupt nicht kochen, außer vielleicht die Klassiker wie Pfannkuchen oder Rührei.
Marion lachte und spritzte dabei etwas von der Familiensoße an die Wand hinter ihr. Ich spürte, wie ein Nerv in meiner Stirn zu zucken begann. »Nein, natürlich nicht. Ich habe mich unten in der Wohnung so einsam gefühlt, weil Nela heute so lange Uni hat. Und da dachte ich, dass ich euch ja eine kleine Freude bereiten und für euch kochen kann.«
So viel zum Thema Übergriffigkeit. Innerlich fluchte ich auf Martin, weil er ihr bereits zu unserem Einzug einen Wohnungsschlüssel gegeben hatte mit den Worten, dass sie natürlich immer willkommen war. Was war das nur mit Männern und ihren Müttern? So gern ich Marion hatte, aber solche Aktionen waren ein absolutes No-Go. Es gab Tage, da freute ich mich natürlich darüber, wenn sie kochte, aber es gab eben auch solche wie heute, wo ich einfach nur in Ruhe meine Füße hochlegen wollte. Der Tag war verdammt lang und anstrengend gewesen und ich wollte die Stille meiner eigenen vier Wände genießen.
»Das wäre doch nicht nötig gewesen«, versuchte ich es so sanft wie möglich.
»Ach, das macht doch keinen Umstand, Liebes.«
»Du musst trotzdem nicht ständig für uns kochen.« Obwohl ich einen energischen Unterton in meine Stimme legte, schien sie den Wink mit dem Zaunpfahl nicht zu verstehen. Sie lächelte mich nur wohlwollend an. »Du kannst ja schon mal den Tisch decken.«
Ich stöhnte innerlich und beschloss, mich meinem Schicksal einfach zu ergeben. So schnell wurde ich meine Schwiegermutter sowieso nicht mehr los. »Es sind nur wir beide zu Hause«, erklärte ich müde, als ich in den Schrank über der Spüle griff, um Teller rauszuholen.
Marion sah mich überrascht an. »Arbeitet Martin wieder länger?«
»Wie so ziemlich jeden Abend.«
Sie schüttelte etwas entrüstet den Kopf. »Ich hoffe wirklich, dass er auf einen großen Urlaub für euch beide spart, so wenig wie ihr euch in letzter Zeit seht.«
Ich wusste genau, dass sie eigentlich sich beide meinte, brummte aber trotzdem nur zustimmend. Das war noch eins der Themen, über die ich nicht reden wollte. Nicht mit ihr. Vor allem, weil es mich tatsächlich mehr störte, als ich vor Marion je zugegeben hätte. Nach kurzem Zögern nahm ich trotzdem drei Teller aus dem Schrank. Selbst wenn Martin nicht kam – und das konnte man in den letzten Wochen wirklich nie genau sagen –, würden Marion und ich sicher nicht allein bleiben.
Beim Decken des Tisches in unserem Essbereich gegenüber der Küche ließ ich mir besonders viel Zeit, um nicht noch einmal zurückzumüssen. Sie war viel zu gut gelaunt, viel zu redselig für meinen momentanen Gemütszustand. Obwohl ich Hunger hatte, wollte ich mich eigentlich nur auf meinem Lesesessel zusammenrollen, statt ein Familienabendessen mit Marion über mich ergehen zu lassen. Und wie sie die gleichen Fragen wie immer stellte: Bist du immer noch in dem kleinen, süßen Krankenhaus? Wann gehst du zurück an die Charité? Wie laufen die Prüfungen? Weißt du schon, wo du als Stationsleitung arbeiten willst? Ja, Marion. Hoffentlich bald, Marion. Ganz gut, Marion. Nein, Marion.
Ich stöhnte bei dem Gedanken an das Gespräch und meine Schwiegermutter rief aus der Küche ein »Hast du was gesagt, Tessa?«.
»Nur, dass ich mich aufs Essen freue«, gab ich schnell zurück. Immerhin mein Magen würde das tun.
Zum Glück klingelte es in diesem Moment an der Tür. Erleichtert durchquerte ich das Wohnzimmer und schlitterte schon beinahe in den Flur. Als ich öffnete, stand, wie vermutet, Martins Schwester Nela vor der Tür. Ihre braunen Haare standen wild von ihrem Kopf ab, als hätte sie sich gerade erst eine Mütze vom Kopf gerissen, und die Wangen unter ihren dunklen Augen waren leicht gerötet von der Kälte draußen. »Ist meine Mutter hier?«, wisperte sie mit strengem Unterton.
Ich ließ mich gegen den Rahmen sinken. »Ich wollte nur Feierabend. In meinem Lesesessel. Meinen Stress in Rotwein ertränken.«
»Tut mir leid«, sagte Nela leise und holte eine Flasche hinter ihrem Rücken vor. »Für Letzteres kann ich zumindest sorgen. Und dafür, dass sie nicht allzu lange bleibt.«
»Du bist die Beste!« Grinsend nahm ich die Weinflasche entgegen und bat Nela nach drinnen. Sie kickte sofort die Schuhe von den Füßen und brüllte durch die Wohnung: »Ma, ist das dein Ernst, dass du schon wieder in die Wohnung von Martin und Tessa einbrichst, ohne sie vorher zu fragen?«
»Ich bin nicht eingebrochen!«, brüllte Marion zurück.
Nela verdrehte die Augen und ich musste kichern. Ja, danke dir Gott für die jüngere Schwester meines Freundes, für ihr loses Mundwerk und die Tatsache, dass sie manchmal die Einzige war, die mir in dieser verrückten Familie den Rücken stärkte.
»Wir bleiben höchstens eine Stunde!«, rief sie in diesem Moment. »Tessa muss sich irgendwann auch mal von der Arbeit erholen.«
Wer erzog hier eigentlich wen?
Nela nickte mir verschwörerisch zu und steuerte sofort die Vitrine mit den Weingläsern im Wohnzimmer an. Im Gegensatz zu Marion machte es mir gar nichts aus, dass Nela sich hier so gut auskannte und sich wie zu Hause fühlte. Tausendmal lieber sie, die wenigstens Wein mitbrachte und nicht bis in die Puppen blieb.
»Wie war die Uni?«, fragte ich, während ich mich auf einen der Stühle im Esszimmer fallen ließ.
Sie verdrehte die Augen und goss sich das Weinglas noch einen Tick voller als das, was sie mir über den Tisch schob. »Erinnerst du dich an diese Winnie, von der ich dir erzählt habe? Meine Mitstudentin mit den sechs Kindern, die immer ein bisschen seltsam riecht?«
Als ich nickte, ließ sie sich mir gegenüber auf den Stuhl fallen und stöhnte. »Sie hat anscheinend beschlossen, dass wir jetzt beide beste Freunde sind und immer nebeneinandersitzen und alle Gruppenarbeiten zusammen erledigen. Jetzt hat sie uns ein Projekt aufgebrummt, für das ich ihr die nächsten acht Wochen nicht mehr aus dem Weg gehen kann.« Mit den Lippen formte sie ein gequältes HILFE, bevor sie einen großen Schluck vom Wein nahm.
Ich stützte mich auf meine Hand und nippte ebenfalls an meinem Glas. »Du nimmst doch sonst kein Blatt vor den Mund – wieso sagst du ihr nicht einfach, dass du nicht mir ihr arbeiten willst?«
Nela winkte ab. »Weil auch niemand sonst mit ihr arbeiten wollen würde. Ich bin die Einzige, die sich überhaupt mit ihr unterhält, weil sie jedem immer gleich ihre sicher gut gemeinten, aber absolut nicht gefragten Ratschläge erteilt und jeden Lebensstil kritisiert. Aber wenn sie ganz allein ist, tut sie mir auch leid. Mann, meine verdammte soziale Ader.«
Ich lachte. »Und deshalb ist ein Studium in sozialer Arbeit ganz sicher genau das Richtige für dich. Oder eben genau das Falsche.«
»Amen, Schwester.« Sie nahm noch einen Schluck Wein, wie um auf diese Tatsache anzustoßen, dann sah sie mich mit gehobenen Augenbrauen an. »Und bei dir? Wie läuft’s auf der Kinderkrebs?«
»Frag nicht. Wir hatten heute Andachtsstunde für die verstorbenen Patienten. Ich bräuchte die Flasche Wein eigentlich für mich allein.«
»Shit. Und du kannst echt nicht die Station wechseln?«
Ich schüttelte den Kopf, auch wenn ich das Formular dafür noch gar nicht eingereicht hatte. Die Kinderonkologie war viel, ja. Aber ich mochte Malik wirklich gern, und auch die anderen Schwestern auf Station waren unheimlich nett, wenn sie nicht gerade wieder viel zu gestresst waren. »Der Stationsleiter gibt sich wirklich viel Mühe, mir alles zu erklären und mich ordentlich einzuarbeiten, das hat man nicht auf jeder Station. Die paar Wochen werde ich schon noch durchhalten.«
»Ich könnte das ja nicht«, stellte Marion fest, die gerade mit dem dampfenden, nach Tomaten und Zimt riechenden Topf das Esszimmer betrat. Sie stellte ihn in der Mitte des Tisches ab und warf mir einen mitleidigen Blick zu. »So viele Kinder, die sterben, so viele schrecklich kranke Kinder. Nein, um Himmels willen, das wäre nichts für mich, da müsste ich immer an meine eigenen denken.«
Nela verdrehte wieder die Augen. Im Gegensatz zu mir hatte sie überhaupt keine Probleme damit, ihrer Mutter ihre Missbilligung zu zeigen. »Du bist im Gegensatz zu Tessa ja auch keine Krankenschwester. Und außerdem hat sie ja auch keine eigenen Kinder, an die sie bei so etwas denken müsste.«
Ich hätte mich beinahe an meinem Wein verschluckt und gab Nela ein schnelles, wahrscheinlich etwas aggressiv wirkendes Zeichen, das Thema sofort wieder fallen zu lassen. Doch Marion warf mir schon ein breites Lächeln zu. »Noch nicht. So lange wird das aber sicher nicht mehr dauern, nicht wahr, Liebes?«
Nela zuckte entschuldigend mit den Schultern, als ihre Mutter sich umdrehte, um die Nudeln aus der Küche zu holen. Ich knurrte und drohte ihr mit der Gabel, was Nela nur mit einem breiten Grinsen kommentierte.
Glücklicherweise kam das Thema bei Tisch nicht mehr auf. Vielleicht hatte Marion aufgrund des Kommentars ihrer Tochter tatsächlich ein schlechtes Gewissen, mich in meinem wohlverdienten Feierabend noch gestört zu haben. Sie konzentrierte sich vollkommen auf Nela, löcherte sie mit Fragen über die Uni und ließ mich in Ruhe essen. Den beiden einfach nur zuzuhören und dabei die wirklich leckere Familiensoße zu essen, beruhigte mein gereiztes Inneres ein wenig. Besonders als Nela noch mehr wirklich unterhaltsame Geschichten aus ihrem Unialltag auspackte und Marion weiter von mir ablenkte, setzte doch endlich die Entspannung ein.
Nach dem Essen stand sie auch sofort auf und scheuchte ihre Mutter aus der Wohnung. Auch wenn Marion noch versuchte, den Tisch abzuräumen und die Küche zu putzen, schob Nela sie gnadenlos nach draußen. »Den lass ich dir mal da«, sagte sie noch mit einem Zwinkern in Richtung Wein, bevor die Tür hinter den beiden zufiel.
Stille breitete sich in der Wohnung aus. Wunderbare, heilende Stille, die ich wie ein angenehmes Kribbeln auf meiner Haut spürte. Oh, es war so herrlich. Ich räumte schnell den Tisch ab, packte alles in die Spülmaschine und schrubbte noch ein wenig die mit Tomatensoße bekleckerten Fliesen, bevor ich endlich die geschwungenen Treppenstufen nach oben ging und mich in meinen Lesesessel fallen ließ.
Von hier oben konnte ich durch das große Fenster blicken. Es war bereits dunkel draußen und kleine Wassertröpfchen liefen an der Scheibe nach unten. Verdammter November. Es war kalt, aber nicht kalt genug für echten Schnee. Ich nahm mir das dicke, rot eingebundene Buch, das auf meinem kleinen Beistelltischchen lag und das ich mir erst einmal auf den Schoß hieven musste. Es war ein unglaublich schwerer Wälzer, den ich schon seit Tagen für mein Studium durchblättern wollte. Endlich kam ich mal wieder ein bisschen dazu.
Während ich versuchte, mich aufs Lernen und Verstehen zu konzentrieren, glitt mein Blick immer wieder auf die schmale Uhr an meinem Handgelenk. Es wurde immer später, aber von Martin weiterhin keine Spur. Es war nicht ungewöhnlich, dass er länger im Büro blieb, vor allem in den letzten Wochen. Er hoffte schon länger auf eine Beförderung und wollte seinem Chef die volle Bereitschaft zeigen, ganz für die Firma da zu sein, wenn auch auf Kosten unserer gemeinsamen Zeit. Ich musste mir fest auf die Innenseite meiner Wange beißen, um die Enttäuschung in mir runterzuschlucken. Du bist gerade auch viel bei der Arbeit oder lernst für dein Studium, beschwichtigte mich meine innere Stimme. Es ist ja nicht für immer. Es ist eine absolut absehbare Zeit, also hab dich nicht so.
Es half ein wenig, sich das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Ich konnte mich noch eine Weile auf mein Buch konzentrieren, bevor meine Augen zu müde wurden. Dann schlich ich in unser wunderschönes Badezimmer mit der Regendusche und der frei stehenden Wanne mit den kleinen Löwenfüßen. Ich entschied, dass ich etwas Gutes verdient hatte, ließ mir ein heißes, nach Lavendel duftendes Bad ein, trug mir danach eine Gesichtsmaske auf und cremte mich mit der teuersten Creme ein, die ich zwischen meinen Kosmetikartikeln finden konnte.
Anschließend ließ ich mich endlich in die frischen Laken unseres Himmelbettes fallen und seufzte zufrieden. Mein Blick blieb an dem feinen Stoff hängen, der sich über unser Bett spannte. Keine verdammte Raufasertapete. Nie wieder verdammte Raufasertapete.
Mit diesem Gedanken schloss ich die Augen und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Wann Martin nach Hause kam, bekam ich nicht mit, aber das war in dem Moment auch nicht mehr wichtig.
Kapitel 3
Der Wecker klingelte zu früh, wie jeden Morgen. Als ich mich knurrend umdrehte, um ihn auszustellen, spürte ich eine warme Hand an meinem Rücken. Ich strich mir mit den Fingern die Haare aus dem Gesicht und blickte zur rechten Bettseite. Martin schlief seelenruhig, als hätte er den Wecker überhaupt nicht wahrgenommen. Die Decke lag halb auf seiner wirklich ansehnlich trainierten Brust, ein Arm unter seinem Kopf, der andere ausgestreckt neben ihm. Er nahm mal wieder zwei Drittel des Bettes ein, obwohl es wirklich groß war, aber das störte mich im Moment auch nicht.
Ich rutschte näher an ihn heran, küsste sanft seinen dunkelblonden Haaransatz, seine Wange, seine gerade Nase, das hübsche Kinn. Bis er mit geschlossenen Augen die Stirn runzelte. »Was?«, murmelte er schlaftrunken und zog die Decke zu meinem Bedauern über seine Brust bis zum Hals hoch.
Er war offensichtlich sehr spät nach Hause gekommen und musste auch erst in ein oder zwei Stunden aufstehen. Eigentlich hatte Martin einen normalen 9-to-5-Job, aber er war letztes Jahr in die Chefetage der Aktienfirma gezogen, bei der er arbeitete. Nun war er seinem Traum, direkt unter dem Chef zu arbeiten und ihn irgendwann vielleicht sogar abzulösen, verdammt nah. Er hatte mir schon mehrfach erklärt, dass es wichtig war, Überstunden zu machen, um Präsenz zu zeigen und sich unverzichtbar zu machen. Ich verstand zwar nicht, wo er in seinem Berufsleben noch hinwollte, wenn er jetzt schon sicher dreimal so viel verdiente wie ich, aber so war Martin eben. Egal, wie viel Entbehrungen in anderen Bereichen das für ihn bedeutete. Vielleicht lag es daran, dass er ein paar Jahre älter war als ich. Vielleicht würde ich mit 28 auch so sein.
Trotzdem stupste ich ihn noch einmal sanft an, ließ den Finger über seine stoppeligen Wangenknochen gleiten. »Ich habe mich gefragt, ob du mit mir vielleicht einen Kaffee trinken möchtest, bevor ich zur Arbeit muss?«
Martin brummte. Erst dachte ich, dass er schon wieder eingeschlafen war, dann entfuhr ihm plötzlich ein tiefes Seufzen. »Nicht heute, Tess. Ich bin todmüde.« Seine Hand suchte kurz meine Wange, um sie zu tätscheln, dann drehte er sich von mir weg und vergrub sich wieder unter der Decke.
Ich presste die Lippen zusammen. Klar. Eigentlich hatte ich auch nicht damit gerechnet. Aber einen Versuch war es wert gewesen. Also schob ich mich allein aus den Laken, tapste barfuß ins Bad rüber und machte mich fertig. Während mein Cappuccino in den To-go-Becher lief, ging ich die Einträge in meinem Planer durch. Noch acht Tage bis zur nächsten Prüfung und zwei Lektionen dafür zu lernen. Ein paar letzte Termine für diese Woche. Unten auf der Seite stand: Bald mit Weihnachtsgeschenken shoppen anfangen! Ich seufzte tief, zum zweiten Mal an diesem Morgen. Das reichte für die kurze Zeit, die ich erst wach war, definitiv an negativen Gedanken.
Also schnappte ich mir meinen Cappuccino, ein Blick auf meine Armbanduhr sagte mir, dass ich eigentlich noch trödeln könnte. Egal, hier herumsitzen brachte mir auch nichts. Schnell zwei Spritzer Parfüm drauf, noch einmal die Haare im Flurspiegel richten und los. Ich war froh, dass mein Auto nicht allzu weit geparkt war, denn es war verdammt kalt draußen. Glücklicherweise hatte es nachts noch keinen Frost gegeben, also musste ich die Scheiben wenigstens nicht freikratzen.
Ich ließ mich auf den Sitz fallen, stellte den Becher auf die vorgesehene Ablage und drehte dann schnell die Heizung an, die meinen Hintern auf der Fahrt schön warm toasten würde. Im Winter war sie mein bester Freund. Um den Rest schlechte Laune abzuschütteln, stellte ich die Radiomusik extra laut und fuhr los.
Dank der Leitungsdienste, die etwas später begannen als der Frühdienst, geriet ich oft schon in den normalen Berufsverkehr. Aber weil ich heute so zeitig dran war, kam ich ziemlich gut durch und war innerhalb von fünfzehn Minuten auf dem Parkplatz neben dem Sankt Alex. Ich stieg aus, eine Hand an dem noch schön warmen Cappuccino, die andere zog den Wintermantel enger. Als ich auf das bereits hell beleuchtete Glasgebäude zulief, das seinen topmodernen Ruf wirklich verdiente, kribbelte wieder ein wenig Aufregung in mir hoch. Vor der Arbeit, die mich heute erwartete. Vor den Patienten, die hoffentlich heute den Tag gut überstanden. Aber auch ein wenig vor der Leitungsrunde, zu der Malik mich heute mitnehmen wollte. Ich hatte keine Ahnung, warum, weil da in der Regel nur Neuigkeiten besprochen wurden und es ansonsten eher eine unspektakuläre Veranstaltung war, zu der alle Stationsleitungen des Alex kamen. Aber es war immerhin das erste Mal, dass ich mit hin durfte und das schien mich um eine Stufe nach oben zu heben. Tessa, die zukünftige Stationsleitung. Es rückte langsam in greifbare Nähe. Genau wie das, was danach kommen würde. Tessa, die Pflegedienstleitung in ihrem eigenen Büro. Tessa, Assistentin der Krankenhausleitung. Vielleicht sollte ich dann doch wieder anfangen, mich von allen Theresa nennen zu lassen. Auch wenn ich meinen Namen eigentlich nicht mochte, strahlte er doch noch ein wenig mehr Autorität aus.
Völlig in die Gedanken versunken, was meine nähere Zukunft bringen würde, zog ich mich um und marschierte auf Station. Das Erste, was ich bemerkte, war, dass Malik schon da war. Das war ungewöhnlich, normalerweise kam er immer etwa eine Minute vor Dienstbeginn auf Station geschneit, entschuldigte sich für die unmöglich fahrenden Bahnen und musste dann erst einmal seine Dienstkleidung zurechtzupfen, weil er sie so schnell hatte anziehen müssen. Heute stand er schon am Stationszimmer und redete mit Maria, die ihre rotblonden Locken zu einem hohen Zopf gebunden hatte, der schon wieder sehr locker saß. Als wäre sie bereits den halben Morgen im Affenzahn über die Station gerannt.
Als ich näher kam, blickte Malik über seine Schulter und lächelte mich an. Es war kein grüßendes Lächeln, das erkannte ich sofort. Es war ein entschuldigendes.
»Was ist denn nun schon wieder?«, brummte ich, was mir einen etwas entsetzten Blick von Maria einbrachte. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und antwortete an Maliks Stelle: »Caro hat sich krankgemeldet. Anscheinend hat sie über Nacht Fieber bekommen.«
Ihrer Stimme war anzuhören, dass sie ihrer Kollegin nicht glaubte, und aus irgendeinem Grund machte mich das wirklich sauer. Ich konnte mich noch gut an meine Ausbildung erinnern und wie schuldig ich mich immer gefühlt hatte, wenn ich mich hatte krankmelden müssen. In der Charité war der Personalschlüssel noch um einiges schlechter als im Sankt Alex, deshalb fühlte jeder, der sich krankmeldete, sich immer irgendwie schuldig, weil er seine Kollegen im Stich ließ. Dabei war das absolut irrsinnig – wenn man krank war, war man krank. So einfach. Und solche bissigen Kommentare wie die von Maria halfen dann wirklich überhaupt nicht.
»Das wundert mich nicht«, sagte ich deshalb in kühlem Ton. »Sie war gestern schon da, obwohl sie völlig erschöpft war. Die Arme hat sich offensichtlich übernommen. Hoffentlich geht es ihr bald besser.« Keine Ahnung, ob Caro wirklich erschöpft gewesen war, ich hatte nicht mehr als zwei Sätze mit ihr am Vortag gewechselt. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, sie verteidigen zu müssen.
Es schien zu klappen, Maria war das schlechte Gewissen sofort ins Gesicht geschrieben. »Ja, hoffentlich«, setzte sie an, bevor sie sich wieder zu Malik umdrehte. »Aber dadurch sind wir jetzt leider ziemlich am Limit. Jaron ist noch da, er übernimmt die aufwendigere rechte Seite. Und Philipp ist zur Betreuung da, er spielt mit den Patienten, bei denen keine Eltern da sind. Aber er kann sich ja auch nicht vierteilen und ich habe auf meiner Seite ein paar wirklich betreuungsintensive Patienten, Luca zum Beispiel …«
»Das ist doch kein Problem«, sagte Malik mit einer Stimme, als könnte ihn nichts aus der Ruhe bringen. Die Stimme einer Stationsleitung. Ich kam nicht umhin, ihn wieder einmal dafür zu bewundern. Aber nur, bis er mir ein weiches Lächeln zuwarf. »Tessa wird sich um Luca kümmern, dann hast du den Rücken frei für die restlichen Patienten.«
Ich konnte mein Kinn gerade noch daran hindern, nach unten zu klappen. Maria schien absolut überrascht, aber kein bisschen unglücklich. »Denkst du wirklich …« Ihr Blick wanderte kurz zu mir, bevor sie verstummte. Ich presste die Lippen zusammen, weil ich eigentlich gar nicht hören wollte, was sie im Begriff war zu sagen – es insgeheim aber natürlich trotzdem wusste. Denkst du, sie ist geeignet dafür? Die, die erst seit ein paar Wochen hier ist und kaum Onkologie-Erfahrung hat? Denkst du, sie kann mit solchen Patienten umgehen, wenn nicht einmal wir das können, die schon ewig hier sind?
Obwohl die meisten anderen Schwestern nett zu mir waren, wusste ich doch, dass sie mir nicht allzu viel zutrauten. Für sie war ich ein Frischling, kaum aus der Ausbildung, die schon versuchte, Chefin zu spielen. Ich wusste, dass man sich Respekt erst verdienen musste, aber es ärgerte mich trotzdem.
»Was ist mit der Leitungsrunde?«, fragte ich und versuchte wirklich, nicht ungeduldig zu klingen.
»Ist nicht so wichtig wie der Stationsalltag«, gab Malik zurück. Er nickte Maria zu, die sich sofort verzog, bevor er mir eine Hand auf die Schulter legte. »Tut mir leid, ich weiß, dass du gern mitwolltest und ich es dir ja auch versprochen hatte.«
Ich spürte in meinem Inneren nach und fand zu meiner eigenen Überraschung keine Verärgerung darüber. Ich war ein wenig enttäuscht, aber das war alles. »Du musst dich nicht entschuldigen. Als Stationsleitung hast du die Aufgabe, dass hier alles läuft, und das tust du damit.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Und ich kann auch mehrere Patienten übernehmen. Ich habe die Ausbildung auch gemacht und über ein Jahr auf einer Intensivstation gearbeitet, falls du das vergessen hast. Nicole hat mich in den ersten Wochen schon bei den Chemotherapien eingearbeitet und ich prüfe alles immer tausendmal oder frage nach, wenn ich mir unsicher bin. Ich kann das.« Auch wenn es mir ein wenig davor graute. Die Intensivstation in der Charité war für Erwachsene gewesen und ich war verdammt gut in meinem Job. Damit kam ich irgendwie klar, aber momentan hatten wir hier eine Menge Kinder, die wirklich auf der Schwelle standen. Ich würde es tun, weil es mein Job war. Ich würde meinen Job gut machen, auch wenn mir bei dem Gedanken heiß und kalt wurde.
Malik wusste das. Er wusste, dass ich mir gewünscht hatte, auf eine andere Station zu wechseln, weil krebskranke Kinder wirklich außerhalb meiner Komfortzone lagen. Und ich wusste, dass er mich deshalb so aufmunternd musterte, und hasste es. Am liebsten hätte ich ihm mein Ausbildungszeugnis unter die Nase gerieben, mit jeder einzelnen Eins, und meine verdammt gute Bewertung von meiner letzten Station. Aber das wäre wahrscheinlich kindisch gewesen, also schob ich nur ein festes »Ich bin eine gute Krankenschwester« hinterher.
Der Stationsleiter riss sofort die Augen auf. »Wenn ich das nicht denken würde, wärst du nicht mehr hier, Tessa. Es ist auch nicht so, dass ich dir nicht zutrauen würde, mehr Patienten zu übernehmen. Himmel, ich würde dir vertrauen, die ganze Station in meiner Abwesenheit zu schmeißen.«
Mein Bauch begann augenblicklich zu kribbeln. Tat er das? Ich konnte nichts gegen das Zucken in meinen Mundwinkeln tun und versuchte, es mit verschränkten Armen vor der Brust zu entkräften. »Und wieso zum Teufel soll ich dann nur einen Patienten übernehmen?«
»Weil Luca ein wenig aufwendiger ist. Und damit meine ich nicht unbedingt medizinisch, sondern … betreuungstechnisch. Seine Pflegeeltern können nicht die ganze Zeit hier sein, und er ist noch sehr jung, auch wenn er nicht will, dass man es ihm anmerkt. Er braucht jemanden, der sich wirklich um ihn kümmert.« Maliks Augenbrauen zuckten nach oben. »Jemand, der etwas mehr für ihn da ist.«
Meine Gedanken hingen noch für eine Sekunde an dem Wort »Pflegeeltern«, dann sah ich Malik wieder an. Sein Blick wirkte bittend und ich konnte mir denken, was dahinterlag. Dass die ganze Station eigentlich keine Lust darauf hatte, Zeit mit Luca zu verbringen. Ich dachte an die Wolken in seinen Augen, die so vielen anderen Kindern ähnelten, die ich bereits getroffen hatte, und Mitgefühl stieg in mir auf. »In Ordnung. Ich soll mich also ein wenig mehr mit ihm beschäftigen?«
»Genau. Nimm dir die Zeit, die er braucht, bis der Betreuer dich ablöst.«
Ich nickte. Die meisten unserer Patienten waren so schwer krank, dass sie die ganze Zeit ihre Eltern bei sich haben durften. Einige schliefen sogar mit in den Zimmern, in speziellen Elternbetten. Ich fragte mich, warum Lucas Pflegeeltern das nicht auch taten, musste aber sofort an meine eigene Mutter denken und wie beschäftigt sie immerzu gewesen war. Und dann erinnerte ich mich an den düsteren Blick, den Luca mir am Vortag zugeworfen hatte, und an die Tatsache, dass kaum eine der Pflegerinnen auf Station in die Nähe seines Zimmers wollte. Der Junge würde wahrscheinlich ein verdammt harter Brocken werden. Aber mit denen kannte ich mich schließlich aus. Mehr als mit im Sterben liegenden Kindern auf jeden Fall.
Also straffte ich die Schultern. »Geht klar, Chef.« Ich hob drohend, aber nicht ohne ein Lächeln die Hand. »Aber nächste Woche nimmst du mich mit zur Leitungsrunde, okay?«
Er erwiderte das Lächeln, bevor er mich mit einem Wink davonscheuchte. Ich versuchte, tief durchzuatmen, als ich mir die Kurve von Luca holte und zu Maria lief, um mir eine Übergabe geben zu lassen. Es war nicht viel anders als am Vortag. Er war zwölf Jahre alt, hatte einen immer wiederkehrenden Lungenkrebs, und die Ärzte versuchten es jetzt mit einer aggressiveren Chemotherapie als die letzten Male. Er hatte bereits am Vorabend damit gestartet. Leichte Übelkeit, aber die Nacht über hatte er gut geschlafen. In zehn Minuten musste ich die nächste Chemo anschließen. Maria kaute auf ihrer Unterlippe, als sie mit der Übergabe fertig war. »Viel Freude mit ihm«, sagte sie dann mit ausdruckslosem Gesicht und machte sich aus dem Staub, um sich um ihre Patienten zu kümmern.
Himmel, ihr Unwillen war beinahe mit Händen zu greifen gewesen. Es wurde Zeit, dass ich mir mein eigenes Bild zu dem kleinen Stationsteufel machte.
Ich schnappte mir den Beutel mit der Chemotherapie und steuerte das Zimmer an, das dem Stationsstützpunkt am nächsten war. Als ich langsam die Tür öffnete und prüfend den Kopf reinsteckte, saß Luca aufrecht auf dem Bett und sah mir mit seinen großen blauen Augen entgegen. Seine blonden Löckchen waren durcheinander, wahrscheinlich vom vielen Liegen auf dem Kissen, und seine Haut war blass. Ohne den düsteren Ausdruck in seinen Augen hätte er wahrscheinlich ausgesehen wie ein Fleisch gewordener Engel. Ich hatte noch nicht einmal richtig den Raum betreten, als er mir schon ein »Was ist denn?« entgegenschleuderte.
Ich ließ die Tür zufallen und starrte ihn nur eine Sekunde lang überrascht an, in der ich mich ein wenig sammeln musste. Sein Gesicht war feindselig, aber mich konnte er damit nicht erschrecken. Ich war Schlimmeres gewohnt. »Charmant«, sagte ich deshalb nur trocken. »Ich freue mich auch schrecklich, dich kennenzulernen, Luca.«
Er klappte den Mund auf und wieder zu, als wäre er ein Fisch an Land. Offensichtlich hatte er nicht mit Sarkasmus als Antwort gerechnet. Das wunderte mich nicht – die Pfleger waren wahrscheinlich höflich zu ihm, egal, was er sagte. Weil sie das sein mussten, weil es von ihnen erwartet wurde. Weil er schwer krank war und keine Eltern hatte. Aber dieses Spielchen würde ich nicht mitspielen, weil ich es nicht gewinnen konnte gegen jemanden wie Luca.
Also hob ich nur den Beutel mit der Chemotherapie in die Höhe. »Mein Name ist Tessa und ich bin heute für dich zuständig. Wenn es dir also recht ist, würde ich dir gern das hier anhängen und deine Vitalwerte kontrollieren.«
Luca starrte mich an und presste die Lippen zusammen. Als er nicht antwortete, ging ich mit festem Schritt zum Infusionsständer und hängte die Chemotherapie um. Er schwieg weiter eisern, und als ich ihm wieder den Blick zuwandte, starrte er auf den Gameboy in seinen Händen, ohne das darauf blinkende Spiel weiter zu spielen. Offensichtlich hatte ich ihn aus dem Konzept gebracht. Sein Gesichtsausdruck war ernst und immer noch düster und ich wunderte mich darüber, dass er wirklich erst zwölf Jahre alt war. Er wirkte viel reifer. Aber nach dem, was ich von ihm wusste, war das eigentlich auch nicht sonderlich überraschend.
Ich ließ die Infusion noch hängen, ohne sie anzustecken, und drehte mich wieder zu ihm, eine Hand ausgestreckt. Er wusste sofort, was ich von ihm wollte, und reichte mir seinen Arm. Während das Gerät seinen Blutdruck maß, sah ich ihn weiter unverhohlen an, suchte sein Gesicht nach Emotionen ab, die er mir aber nicht zeigen wollte. Er wich meinem Blick aus. Also nickte ich in Richtung seines Gameboys. »Was spielst du?«
Luca sah auf, die Augenbrauen zusammengezogen. »Das geht Sie nichts an«, erklärte er schroff. Wahrscheinlich wollte er mich damit zum Schweigen bringen, aber ich ging gar nicht darauf ein. Stattdessen ließ ich die Mundwinkel nach oben wandern und neckte: »Was denn, ist es dir etwa peinlich? Ist schon in Ordnung. Ich bin sicher, viele Jungs in deinem Alter finden Barbie-Spiele cool, die meisten wollen das nur nicht zugeben.«
Jetzt riss er entsetzt die Augen auf. »Ich spiele keine Barbie-Spiele.«
»Ach so, na gut«, gab ich unschuldig zurück. Er ließ sich also wirklich aus der Reserve locken, das war ein gutes Zeichen. Eines, das bewies, dass es noch möglich war, an ihn heranzukommen. Noch keine komplette Mauer. Ich las die Vitalwerte vom Gerät ab, und als ich Luca wieder ansah, starrte er immer noch in meine Richtung. Es wirkte ein wenig, als versuchte er, sich einen Reim auf mich zu machen. Nach kurzem Schweigen sagte er noch einmal energisch: »Ich spiele keine Barbie-Spiele.«
»Ich glaube dir doch«, versicherte ich grinsend.
»Das ist ein Spiel von Aquaman.« Er hielt mir den Gameboy hin und ich war sicher, dass er genervt klingen wollte. So, als würde ihn das alles eigentlich gar nicht interessieren. Funktionierte nur leider nicht, denn seine Augen funkelten dabei mit viel zu viel Leidenschaft.
Ich tat ihm den Gefallen und betrachtete das Display. »Ah, ja, Aquaman. Cool. Du bist also DC-Fan?« Ich kannte mich nicht wirklich damit aus, aber momentan nahm ich gern jedes Thema, das er mir bot.
»Nee«, gab Luca zurück, ließ den Gameboy sinken und begann wieder, weiterzuspielen. »Nur Aquaman.«
»Verstehe.« Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Wie sieht’s aus? Ich könnte mit der Infusion erst einmal warten, dann könntest du vorher duschen gehen. Ich helfe dir dabei.«
Lucas Blick zuckte zu der Infusion und einen Moment lang konnte ich so etwas wie Angst durch den Schleier in seinen Augen erkennen. Furcht vor dem, was die Chemo mit ihm machen würde. Symptome, die er schon kannte, und welche, die vielleicht neu dazukommen würden. Eine Sekunde musste ich gegen den Impuls ankämpfen, nach seiner Hand zu greifen, denn das hätte er wahrscheinlich nicht zugelassen. Stattdessen ließ ich ein Lächeln auf meine Lippen wandern. »Ich weiß. Ist scheiße mit der Chemo.«
»Als hätten Sie eine Ahnung davon«, sagte er bitter und starrte dann wieder auf den Gameboy. Seine Finger bewegten sich langsamer als zuvor und sein Kiefer war angespannt.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich würde mir nie anmaßen, dass ich das verstehen kann. Aber ich kann es ein wenig nachvollziehen, glaub mir.«
Er brummte nur statt einer Antwort, also hakte ich noch einmal nach: »Duschen?«
»Kein Bock.«
Da hatte jemand die Pubertät ein wenig zu früh erreicht. »In Ordnung. Kommst du selbst auf uns zu, wenn es nötig wird, oder soll ich dir einen dezenten Hinweis geben, wenn du anfängst zu müffeln?«
Ganz langsam hob er den Kopf wieder und starrte mich erneut mit diesem »Wer zur Hölle sind Sie eigentlich«-Blick an. Als ich grinste, schnaubte er. »Arbeiten Sie hier wirklich als Krankenschwester?«
»Was hat mich verraten? Der Kasack oder die Tatsache, dass ich dir deine Medikamente gebracht habe?«
Wieder ein Schnauben. »Sie reden wie eine dieser Sozialarbeiterinnen.«
Ich musste an Nela denken und das Gespräch, das wir gestern geführt hatten. Lachend winkte ich ab. »Dafür wäre ich nicht geeignet, glaube ich.«
»Aber als Krankenschwester schon?«
Er wollte mich offensichtlich provozieren. Mich so weit bringen, dass ich bei ihm ebenfalls das Handtuch warf und ihn in Ruhe ließ. Und plötzlich kam mir der Gedanke, dass es mir wahrscheinlich viel Freude bereiten würde, ihm das Gegenteil zu beweisen. »Du bist ganz schön frech. Denk nur nicht, dass ich dir das die ganze Zeit durchgehen lasse.« Lächelnd wandte ich mich dem Infusionsständer zu. »Wenn du nicht duschen willst, hänge ich deine Chemo direkt an.«
Das Funkeln verschwand aus seinen Augen und die Wolken waren wieder da. Er wandte sich ab und presste die Lippen zusammen, als wollte er den Beutel unter keinen Umständen ansehen. »Von mir aus«, sagte er mit einer Stimme, die eigentlich ein Nein schreien wollte. Das spürte ich genau. Ich schloss die Chemo trotzdem an, weil es nötig war, und wandte mich ihm dann wieder zu. »Kann ich dir vielleicht irgendetwas Gutes tun, das es dir leichter macht?«
»Sie könnten mich in Ruhe spielen lassen.«
»Vielleicht etwas Leckeres zu essen? Ich habe gehört, dass du dein Frühstück heute nicht wolltest.«
»Ignorieren Sie einfach, was ich sage?«
»Vielleicht einen Smoothie?«
Luca stöhnte und ließ den Gameboy wieder sinken. Sein düsterer Blick traf mich, aber er funkelte wieder. Na endlich. »Wenn Sie so fragen: Ich habe keinen Bock auf dieses widerliche Krankenhausessen. Wenn Sie allerdings zu viel Zeit haben, was offensichtlich der Fall ist, sonst hätten Sie mich schon längst in Frieden gelassen, können Sie gern für mich zu McDonald’s laufen. Ein Cheeseburger-Menü, bitte. Und einen Schokomilchshake.«
»Da war ja sogar ein ›bitte‹ dabei, Luca. Wunderbar«, sagte ich mit meiner bestgelaunten Stimme. »Leider absolut ungeeignetes Essen für einen Patienten mit Chemotherapie. Aber ich glaube, wir haben noch Fruchtriegel da. Mit Schokolade, das ist doch fast genauso gut. Ich hole dir einen, in Ordnung?«
Luca starrte mich an, als hätte ich den Verstand verloren. Und vielleicht hatte ich das, denn ich begann langsam wirklich, mich zu amüsieren. Ohne eine Antwort von ihm abzuwarten, die wahrscheinlich negativ ausgefallen wäre, machte ich auf dem Absatz kehrt und verließ das Zimmer, um die Fruchtriegel aus der Küche zu holen.
Als ich wieder über den Flur zu seinem Zimmer ging, öffnete sich gerade ein anderes Patientenzimmer. Ein dunkles Lachen ertönte, gefolgt von einem »Ich schau in ein paar Stunden noch mal nach dir, Lisa«. Ich blickte neugierig über meine Schulter und der Typ, der auf den Flur trat, hob in derselben Sekunde den Blick. Sofort erkannte ich die kaffeebraunen Augen, die dunklen Locken, das aufflammende Lächeln mit den Grübchen darüber.
Der Rettungssanitäter von gestern. Heute allerdings trug er keine leuchtend orangefarbene Jacke, sondern Alltagsklamotten. Eine schwarze Jeans und ein T-Shirt mit Nasa-Aufdruck. An seiner rechten Brust hing ein grünes Schild, das bei uns im Haus alle ehrenamtlichen Betreuer trugen. Die, die auf allen Stationen schwer kranke Kinder bespaßten, wenn ihre Eltern nicht da sein konnten. Hatte der Typ etwa zwei Jobs hier im Krankenhaus?

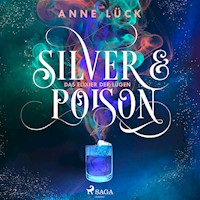
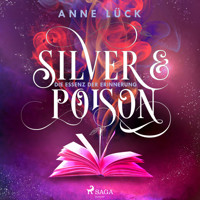
![Jewel & Blade. Die Wächter von Knightsbridge [Band 1 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ce22490997b3e6e0e807c8b632e07b21/w200_u90.jpg)




![Jewel & Blade. Die Hüter von Camelot [Band 2 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c7d0b6bb9c33b9a1b2b09f490d3cfe2a/w200_u90.jpg)




















