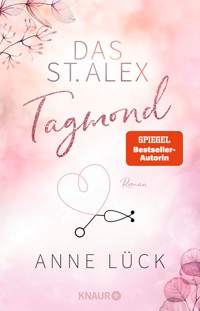9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Besonders, berührend, bunt: Der New Adult Liebesroman »This is our show« entführt dich in die faszinierende Welt des Jax, einer Bar, in der jeder ganz er selbst sein darf. Auf der Flucht vor einer Entscheidung, die sie einfach nicht treffen kann, landet die 20-jährige Dawn im Jax. In der warmen und herzlichen Atmosphäre der Bar mit ihrem bunten Publikum fühlt Dawn sich zum ersten Mal frei und gleichzeitig geborgen. Das liegt nicht zuletzt an Silas, dem zurückhaltenden Besitzer der Bar, der ihre Liebe zu Büchern teilt. Ehe Dawn es sich versieht, hat sie sich in das Jax verliebt, in die roten Samtvorhänge, die schillernden Gäste, die Drag-Queen-Abende - und auch in seinen Besitzer Silas. Doch nicht nur Dawn verbirgt ein Geheimnis, und die scheinbar heile Welt des Jax ist von mehr als einer Seite bedroht ... Mit viel Gefühl erzählt Anne Lücks romantischer New Adult Liebesroman »This is our show« von verlorenen Träumen, zweiten Chancen und einer bunten Welt, in der jeder ganz er selbst sein darf. "Anne Lücks Geschichte hat mich ab der ersten Seite süchtig gemacht und in eine tolle, detailreiche Welt voller vielseitiger Charaktere entführt. Ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen und wollte gar nicht, dass das Buch endet und ich dem Jax Lebewohl sagen muss." - Maren Vivien Haase, Buchbloggerin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Anne Lück
This is our show
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Besonders, berührend, bunt:
Der New Adult Liebesroman »This is our show« entführt dich in die faszinierende Welt des Jax, einer Bar, in der jeder ganz er selbst sein darf.
Auf der Flucht vor einer Entscheidung, die sie einfach nicht treffen kann, landet die 20-jährige Dawn im Jax. In der warmen und herzlichen Atmosphäre der Bar mit ihrem bunten Publikum fühlt Dawn sich zum ersten Mal frei und gleichzeitig geborgen. Das liegt nicht zuletzt an Silas, dem zurückhaltenden Besitzer der Bar, der ihre Liebe zu Büchern teilt. Ehe Dawn es sich versieht, hat sie sich in das Jax verliebt, in die roten Samtvorhänge, die schillernden Gäste, das künstlerische Programm - und auch in seinen Besitzer Silas. Doch nicht nur Dawn verbirgt ein Geheimnis, und die scheinbar heile Welt des Jax ist von mehr als einer Seite bedroht …
Mit viel Gefühl erzählt Anne Lücks romantischer New Adult Liebesroman »This is our show« von verlorenen Träumen, zweiten Chancen und einer bunten Welt, in der jeder ganz er selbst sein darf.
»Anne Lücks Geschichte hat mich ab der ersten Seite süchtig gemacht und in eine tolle, detailreiche Welt voller vielseitiger Charaktere entführt. Ich hatte sehr viel Spaß beim Lesen und wollte gar nicht, dass das Buch endet und ich dem Jax Lebewohl sagen muss.«
Maren Vivien Haase, Buchbloggerin
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Danksagung
Kapitel 1
Der kleine Parkplatz der Liberton University war gänzlich vollgestellt, als ich meinen alten Jeep darauf rollen ließ. Ich beugte mich nach vorn, um besser zu sehen, während ich langsam an ein paar schrottreif aussehenden Kleinwagen vorbeifuhr, die entweder Studenten oder unterbezahlten Professoren gehören mussten. Es war fast dunkel und dieser Teil des Campus erschreckend schlecht beleuchtet. Ich spielte schon mit dem Gedanken, umzukehren und in einer der vielen Seitenstraßen mein Glück zu versuchen, da konnte ich von Weitem endlich eine freie Lücke sehen. Stiles, wie ich meinen Wagen liebevoll nannte, gab ein zufrieden klingendes Brummen von sich, als ich darauf zusteuerte.
Der Stellplatz war klein, aber im Gegensatz zu den hiesigen Studenten war ich ein Profi im Einparken – eine notwendige Eigenschaft, wenn man zum sechzehnten Geburtstag einen wenig empfindlichen, kurz vor der Ausrangierung stehenden Jeep geschenkt bekam. »Der ist robust, da kann dir nichts drin passieren«, hatte mein Dad damals vor fünf Jahren betont. Ich brauchte nur zwei Züge, dann stand Stiles perfekt in der Lücke, als wäre er schon immer hier gewesen.
Ich war angekommen. Endlich.
Langsam löste ich die Finger vom Lenkrad, ließ für einen Moment zu, dass sie unkontrolliert zitterten, bevor ich sie zu einer Faust zusammenpresste und so zur Ruhe zwang. Mein Herz raste, aber das hatte es die gesamte Fahrt getan – beinahe drei Stunden über den Highway, seit ich High Stowe verlassen hatte.
Ich atmete tief durch, während ich durch die Windschutzscheibe das große Lehrgebäude am Ende des Parkplatzes anstarrte. Einige Fenster waren beleuchtet, obwohl es bereits nach neun Uhr abends war, anscheinend fanden dort auch um diese Uhrzeit Vorlesungen oder AGs statt. Weil das Licht im Innenraum meines Autos beim Abstellen des Motors ausgegangen war, knipste ich es manuell wieder an und griff nach der Sporttasche auf dem Beifahrersitz. Mein Handy lag ganz oben, und mir wurde übel, als ich das Display anschaltete. Die Anzeige erinnerte mich an die zwölf Anrufe in Abwesenheit, die ich beim Fahren geflissentlich ignoriert hatte, sobald ich den Namen der Anruferin sah. Mom. Zusätzlich hatte sie mir unzählige Nachrichten geschickt, die neuste ploppte gerade erst auf: »Dawn ruf mich sofort zurück das kann nicht dein Ernst sein«, wie immer komplett in Großbuchstaben und ohne Satzzeichen, weil sie nicht wusste, wie man die benutzte. Ich drückte die Nachricht weg.
Nellie hatte mich nicht zurückgerufen, obwohl ich ihr in der letzten Stunde gefühlt hundert Mal auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte. Ich versuchte noch einmal, sie zu erreichen, aber sie ging nicht ran.
Das war nicht ungewöhnlich für meine beste Freundin. Manchmal vergaß sie stundenlang, dass sie überhaupt ein Handy besaß. Sie liebte es, Briefe und Postkarten zu schreiben, aber mit regelmäßigen, elektronischen Nachrichten tat sie sich für jemanden in unserem Alter überraschend schwer. Ich war komplett allein in einer mir fremden Stadt.
Was habe ich getan? Ist das tatsächlich alles passiert?
Plötzlich hatte ich das Gefühl, in der warmen, schweren Luft im Inneren meines Wagens zu ersticken. Ich stieß die Fahrertür auf und atmete hektisch ein. Kurz drehte sich die Welt wie nach einer wilden Karussellfahrt, bevor sich alles langsam in seine festen Formen zurückbewegte. Als der Drang, sich zu übergeben, nachgelassen hatte, suchte ich fieberhaft nach einer Lösung und erinnerte mich an ein Gespräch mit Nellie. Eigentlich war sie kein Mensch, der sich beklagte, aber bevor sie nach Liberton gezogen war, hatte sie sich immer wieder über ihre Zimmernummer aufgeregt. »66? Wirklich? Das ist meine Unglückszahl, doppelt gleich! Das kann doch kein guter Start in mein Studentenleben sein«, hatte sie geschimpft, bevor sie immer ihr Grinsen wiedergefunden hatte. »Denkst du, er hat auch in diesem Zimmer gewohnt und dort die ersten Seiten getippt?«
Einen Moment überlegte ich, ob ich die Sporttasche mitnehmen sollte. Dann entschied ich, dass ich erst einmal mit Nellie reden musste, bevor ich mit der Tür ins Haus fiel. Also zog ich nur die Jeansjacke fester um meine Schultern, stieg aus und gab Stiles einen letzten Klaps auf die geschlossene Fahrertür. »Bin bald zurück, Kumpel.«
Der Campus der Liberton University war nicht besonders groß, was wahrscheinlich daran lag, dass Liberton an sich nicht besonders groß war. Es war eine Kleinstadt, auf deren Universität nur Einwohner und Menschen aus der näheren Umgebung studierten. Nellie hatte mir am Anfang ihres ersten Semesters vor einem Jahr erzählt, dass fast alle Studenten sich untereinander kannten oder zumindest jemanden kannten, der jemanden kannte. Alle, bis auf sie. Sie war aus einem anderen Grund hier.
Als ich über den gepflasterten Weg zwischen den Lehrgebäuden entlanglief, kribbelte Vorfreude in meinem Magen, trotz der beängstigenden Situation, in der ich mich befand. Das hier war die Stadt. Die Universität, auf die mein größtes Kindheitsidol gegangen war, und es machte mich ein wenig atemlos. Was für ein verrücktes Gefühl. Wahrscheinlich war er genau hier lang gelaufen, jeden Tag, auf dem Weg zu seinen Kursen. Da, wo ich jetzt einen Schritt vor den anderen setzte.
Es waren noch einige Studenten unterwegs, deren gleichmäßiger Strom mich in Richtung des Studentenwohnheimes führte, ohne dass ich groß danach suchen musste. Das Gebäude war weitaus weniger eindrucksvoll als die alten, backsteinfarbenen Bauten, die sonst hier auf dem Campus standen. Es war nicht sonderlich hoch und von einem geschmacklosen Mausgrau. Einzig die dunkle Holztür und die gleichfarbenen Fensterrahmen nahmen dem Gebäude ein wenig den Anblick einer Einrichtung für jugendliche Straftäter.
Statt dem Äußeren des Wohnheims weiter Beachtung zu schenken, erklomm ich die drei Stufen zum Eingang und drückte mich an ein paar Studenten vorbei durch die offen stehende Tür, wobei ich das Gefühl nicht loswurde, dass sie mich anstarrten. Vielleicht spielte mir aber nur meine Nervosität einen Streich, und mich beachtete gar keiner. Zumindest hielt mich niemand auf.
Im Erdgeschoss waren nur die Zimmer 1–50, deshalb machte ich mich auf den Weg nach oben. Währenddessen überlegte ich, wie ich das Gespräch auf das bringen sollte, was passiert war. Wie ich ihr alles erklären sollte, ohne dass sie so durchdrehte wie die anderen. Als ich vor Zimmer Nummer 66 stand, hatte ich immer noch keine Idee. Also verließ ich mich auf mein Improvisationstalent und klopfte laut an die helle Holztür. Bitte flipp nicht aus.
Aber es öffnete niemand. Ich wartete ein paar Momente und klopfte dann wieder. Plötzlich stieg in mir die Angst auf, dass sie gar nicht hier war. Vielleicht hatte sie sich zu einem spontanen Heimatbesuch entschieden. Vielleicht schlief sie heute bei einer Studentenkollegin oder war ausgegangen.
»Nellie?« Ich klopfte erneut. »Bist du da? Himmelherrgott, bitte sei da, Nellie.«
»Dawn?«
Erschrocken fuhr ich herum, als die Stimme aus einer anderen Richtung kam, als ich sie erwartet hatte. Nellie steckte ihren Kopf aus einer der Türen auf der linken Seite des Flures. Ihre Haare waren in einen Handtuchturm gewickelt, sie trug einen weißen Pyjama, und sie hatte die Augen weit aufgerissen. »Dawn, was machst du denn hier?«
Ein helles Strahlen erleuchtete ihr gesamtes Gesicht, und sofort fühlte ich mich leichter. Meine Probleme rückten etwas in den Hintergrund, hinter die Freude, sie endlich wiederzusehen. Allerdings nur, bis ihr plötzlich die gute Laune aus dem Gesicht fiel. »Moment. Sag mir, dass du nicht an der Tür geklopft hast. Bitte.«
»Was? Warum?«, fragte ich alarmiert, als sie schon auf Socken über den Flur zu mir geeilt kam. Im selben Moment ging ganz plötzlich, einem Knall gleich, die Tür vor mir auf.
»SAG MAL, SPINNT IHR, UM DIE UHRZEIT HIER TERROR ZU MACHEN?«
Erschrocken sah ich das Mädchen im Türrahmen von Zimmer Nummer 66 an. Sie trug einen Bademantel, und ihre kurzen, schwarzen Haare standen in alle Richtungen ab, als wäre sie gerade aus dem Bett gefallen. War sie wohl auch, ihrer wütenden Miene und dem improvisierten Outfit nach zu urteilen.
»Entschuldige!«, mischte sich Nellie neben mir ein. »Meine Freundin wusste nicht, dass sie um diese Uhrzeit nicht mehr klopfen kann. Wir sind jetzt still, versprochen.«
»Das hoffe ich!«, fauchte das Mädchen, bevor sie die Tür direkt vor meiner Nase zuknallte. Ich blinzelte irritiert. »Was … war denn das?«
»Meine Mitbewohnerin«, erklärte Nellie atemlos. »Hannah. Sie geht jeden Abend um zwanzig Uhr dreißig ins Bett und steht um vier Uhr dreißig auf, nach, wie sie es sagt, ihren dringend benötigten acht Stunden Erholungsschlaf. Sie geht dann joggen, frühstückt und lernt vor den ersten Vorlesungen. Total verrückt.« Sie verdrehte die Augen, dann musterte sie mich von oben bis unten, und das Strahlen kehrte in ihr Gesicht zurück. Im nächsten Moment lag ich in ihren Armen. »Dawn, ich freue mich so, dass du da bist! Was für eine Überraschung, wieso hast du nicht vorher angerufen?«
Ich wollte ihr sagen, dass ich es mehrere Male versucht hatte, aber bei ihrer Umarmung blieben mir die Worte im Hals stecken. Ich merkte, wie ich plötzlich mit den Tränen kämpfen musste, jetzt, wo ich keine Fassade mehr aufrechtzuerhalten hatte. Wie eine Ertrinkende klammerte ich mich an meine alte Freundin, und sie ließ es zu. Erst nach ein paar Sekunden fragte sie: »Was ist passiert?«
Ihre Stimme war ernst, wachsam. Ich löste mich von ihr und sah in ihre besorgten Augen. »Ich hab Scheiße gebaut, Nellie«, brachte ich erstickt hervor. »Ich kann nicht mehr nach Hause.«
Der Aufenthaltsraum im zweiten Stock erinnerte mich auf eine seltsam beruhigende Art und Weise an das Ferienlager im Wald, in dem Nellie und ich in der Grundschule unsere Sommer verbracht hatten. Der große Esstisch, der Bücherschrank, die Stühle – einfach alles war aus einem hellen, fast orangefarbenen Holz, abgesehen von der Couch, auf der Nellie und ich saßen. Das einstmals braune Kunstleder war abgegriffen, an manchen Stellen heller, an anderen dunkler geworden.
Ich starrte auf den Rücken des Buches, das aufgeschlagen neben mir lag und erklärte, weshalb Nellie den Abend nicht in ihrem Zimmer, sondern hier verbracht hatte. »Zwei Reisende in Neuseeland« von River Lexington, Nellies Lieblingsbuch. Sie las es bestimmt schon zum vierzigsten Mal.
»Hab ich dich richtig verstanden –« Nellie schüttelte leicht den Kopf. »Du tauchst hier spätabends auf, ohne richtige Vorankündigung, willst für eine Weile – die du nicht definierst – in Liberton bleiben, brauchst einen Schlafplatz, einen Job – aber willst keinerlei Erklärung liefern, warum das so ist?«
So, wie sie das sagte, klang es wirklich verrückt. Trotzdem nickte ich leicht. »Ich bin hergekommen, weil ich wusste … dachte, dass du nicht nachfragen wirst. Genau das ist es, was ich gerade brauche. Und ich weiß, dass das ohne viele Informationen schwierig ist, aber …« Mehr als ein Schulterzucken bekam ich nicht mehr zustande.
Nellie starrte mich an, sekundenlang. Dann seufzte sie tief. »Hast du jemanden umgebracht? Ist die Polizei hinter dir her?«
»Nein.« Ihre Worte brachten mich zum Lachen.
»Ich frage nur, um zu wissen, wie gut ich dich verstecken muss.«
»Du musst mich nicht verstecken. Es ist, wie ich es sage: Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken, einen Schlafplatz und möglicherweise einen Job.«
Sie hielt meinen Blick mit ihrem fest. Es war eindeutig, dass sie weiter fragen wollte, dass sie wissen wollte, was passiert war. Aber das Einzige, was noch über ihre Lippen kam, war ein: »Okay.«
»Okay?« Eine Welle der Erleichterung schwappte durch meinen gesamten Körper. »Wirklich?«
Nellie lachte. »Wenn du mit einer anderen Antwort gerechnet hättest, wärst du wahrscheinlich nicht hier. Und ich werde auch nicht nachfragen, versprochen.«
»Ich erzähle dir alles, wenn ich so weit bin«, versicherte ich ihr. Und ich hoffte wirklich, dass ich das bald sein würde, denn eigentlich hatte ich dringend Redebedürfnis, aber jetzt gerade brauchte ich jemanden, der sich mir gegenüber normal verhielt. Jemanden, der mein früheres Ich kannte und bei dem ich dieses Ich sein konnte.
»Ich brauchte einen Tapetenwechsel, so viel Info kann ich dir schon geben. Deshalb hatte ich gehofft …« Ich beendete den Satz nicht, er blieb einfach zwischen uns stehen.
Und bei einem Blick in ihr Gesicht wusste ich bereits, wie die Antwort lauten würde.
Nellie biss sich auf die Unterlippe, als würde sie fieberhaft nach einem Ausweg suchen, aber ich schüttelte bereits den Kopf. »Ich kann nicht bei der übernachten.«
»Dawn, du weißt, ich würde alles für dich tun, aber die Regeln hier sind unheimlich streng, und Hannah ist die schrecklichste Petze der Welt.« Eine steile Falte bildete sich auf ihrer Stirn. »Weißt du was? Vergiss Hannah. Zumindest heute Nacht kannst du hier schlafen, und morgen finden wir dann einen anderen Ausweg. Wir müssen uns mein Bett teilen, aber das geht schon. Vielleicht kann ich Hannah irgendwie bestechen … irgendeine Lösung finden wir schon.«
Ich musste lachen, auch wenn mein Herz schwer wurde. »Ich weiß das zu schätzen, Nellie, wirklich. Aber ich will dir keinen Ärger einbringen.«
»Als hätte ich jemals Angst vor Ärger gehabt!«
»Hattest du nie, ich weiß. Aber trotzdem. Vielleicht finde ich noch spontan ein Hotel.« Selbst in einer Kleinstadt wie Liberton würde es doch irgendwo eine Unterkunft für Touristen geben, oder?
Nellies zweifelndem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, eher nicht. Ich konnte förmlich sehen, wie sie sich das Gehirn zermarterte. Und dann machte es »Bing«, wie bei einer Mikrowelle, und sie grinste. »Ich habe eine Idee. Gib mir ein paar Minuten, ich geh in mein Zimmer und ziehe mir etwas Hübsches an.«
Sie war schon aufgesprungen, und mein Blick folgte ihr durch den Raum. »Etwas Hübsches? Wo gehen wir denn hin?«
»Dein Problem lösen.« Im Türrahmen drehte sie sich noch einmal um und zwinkerte verschmitzt. »Und nebenbei tun wir noch etwas Gutes für unsere Seele. Ich glaube, wir können beide einen Drink vertragen.«
Kapitel 2
Hallo Stiles!« Nellie gab meinem Auto einen liebevollen Klaps auf das Dach, bevor sie die Tür öffnete.
Ich tätschelte kurz die Motorhaube. »Schmeiß die Sporttasche einfach nach hinten«, sagte ich, während ich mich in die enge Lücke zwischen einem weißen Prius und meinem eigenen Wagen quetschte, um einsteigen zu können.
Nellie tat, wie ihr geheißen, auch wenn sie dabei wieder eine steile Stirnfalte bekam. »Das ist ja nicht gerade viel Gepäck für einen längeren Aufenthalt.«
»Nein, ich … hatte nicht besonders viel Zeit zum Packen.« Ich ließ mich auf den Sitz fallen und sah zu ihr rüber. »Das reicht höchstens für vier oder fünf Tage. Bis dahin brauche ich also dringend einen guten Plan oder eine Waschmaschine im Dauerbetrieb.«
»Bekommen wir hin.«
Ich steckte den Schlüssel ins Schloss und fuhr vorsichtig aus der Parklücke und über den vollen Parkplatz.
Nellie gab ein seltsames Glucksen von sich. »Ich saß bestimmt seit einem Jahr nicht mehr hier drin. Weckt Erinnerungen.« Sie verrenkte sich, um die Bilder an Stiles’ Decke zu sehen, die ich irgendwann einmal vor ein paar Jahren ausgedruckt und in den Stoff gepinnt hatte. Fotos von Zebras und Löwen in der Savanne, von der Skyline Johannesburgs und weite Blicke über berühmte Sehenswürdigkeiten. Und in der Mitte eine große Karte von Afrika, durch die eine rote Linie gezogen war. Ich spürte, wie Nellies Blick wieder zu mir wanderte. »Und, wie ist es, in Rivers Heimatstadt zu sein?«
»Hör auf, ich muss mich auf die Fahrt konzentrieren«, brummte ich, spürte aber, wie das aufgeregte Kribbeln zurückkehrte. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, dass meine Mundwinkel nach oben wanderten. Schließlich stieg ich auf das Thema ein: »Wie schaffst du es bitte, hier nicht durchzudrehen?«
»Oh, glaub mir, die erste Zeit in Liberton bin ich durchgedreht.« Nellie rutschte auf dem Beifahrersitz herum. »Bei jedem Café, jeder Buchhandlung, jeder Straßenecke habe ich überlegt, ob River hier schon mal war, ob das vielleicht sein Lieblingsplatz war. Und weißt du, was das Beste ist? Hier kennt ihn jeder. Jeder weiß, wer River Lexington ist, und jeder ist ein stolzer Fan.«
River Lexington. Ich ließ einen tiefen Seufzer der Zufriedenheit hören. »Wie wunderbar. Seit du weg bist, kann ich mit niemandem über ihn und seine Bücher reden. Hast du schon gesehen, dass sein neues Buch in einem Monat erscheint?«
»›Auf dem Fahrrad durch Panama‹? Darauf kannst du einen lassen.« Nellie lehnte sich nach vorne. Wir waren gerade zur Ausfahrt des Parkplatzes gekommen, und sie wies nach links. »Da lang. Übrigens ist in ein paar Wochen eine Signierstunde von ihm, hier in Liberton.«
Beinahe wäre ich mitten in der Kurve wieder voll auf die Bremse gestiegen. Mein Kopf fuhr zu ihr herum, und ich spürte, wie mir der Unterkiefer runterklappte. »Du machst Witze.«
»Nein, Miss, mache ich nicht.« Nellie lachte schallend über mein Gesicht. »Die ganze Stadt redet seit Tagen von nichts anderem. Solltest du planen, so lange hier in Liberton zu sein, werde ich sehen, ob ich Karten für uns bekomme. Die waren nämlich innerhalb weniger Stunden ausverkauft.«
Ich schnappte nach Luft. »Das wäre großartig.«
Seit wir als Teenager auf die Romane von River Lexington gestoßen waren, verband uns eine große Liebe zu diesem Autor. Wir hatten jedes einzelne seiner Bücher verschlungen und uns danach stundenlang über die bittersüßen Liebesgeschichten ausgetauscht. Allein der Gedanke, ihm gegenüberstehen zu können, raubte mir fast den Atem.
»Sagst du mir eigentlich irgendwann, wo wir hinfahren?«, fragte ich, damit sich mein Herz wieder beruhigte. Nur kurz streifte mein Blick meine beste Freundin, aber der enge rote Lederrock und die schwarze Bluse darüber machten den Eindruck, dass sie irgendetwas Besonderes vorhatte.
»Es ist nicht weit von hier«, gab Nellie vage zurück und deutete dann auf die nächste Straßenkreuzung. »Da vorne rechts und danach gleich noch mal rechts.«
»Komm schon, ich muss doch wissen, worauf ich mich einlasse.«
»Das Problem hattest du aber nicht, als du dich heute Nachmittag in den Wagen gesetzt hast, um nach Liberton zu fahren.« Sie grinste mich von der Seite an. »Vielleicht hat meine Abenteuerlust doch endlich ein wenig auf dich abgefärbt. Jetzt abbiegen.«
Ich tat, was sie sagte. »Nicht genug. Jetzt rede schon.«
»Meinetwegen. Ich habe einen guten Freund, Emery, der vielleicht eine Schlafgelegenheit für dich haben könnte.«
»Ich soll bei einem wildfremden Typen schlafen?«
»Du hast recht, das mit der Abenteuerlust üben wir noch.« Sie verdrehte die Augen. »Emery ist ein Kommilitone von mir. Er ist ein unheimlich netter Kerl, das wirst du sofort wissen, wenn du ihn triffst, man muss ihn einfach lieben. Du musst mir einfach vertrauen.«
»Das machst du mir nicht unbedingt leicht.«
Ich versuchte, etwas aus der Umgebung zu schließen, aber die wurde mit jedem Meter, den wir zurücklegten, unauffälliger. Reihenhäuser, dazwischen in unregelmäßigen Abständen gepflegte Vorgärten, als wären wir plötzlich in ein abgeschiedenes Wohngebiet gefahren. Immer mal wieder tauchten ein paar Cafés auf, man sah ein paar Läden, die relativ neu wirkten, aber sonst wirkte alles hier … ruhig.
Wir waren keine zehn Minuten unterwegs, als Nellie auf ihrem Sitz unruhiger wurde. Sie begutachtete die Autos, die an der Straßenseite standen, und irgendwann rief sie triumphierend aus: »Da! Der Parkplatz ist perfekt!«
Ich trat auf die Bremse, weil ihr Kommentar zu spät kam, und wir wurden beide im Auto ein wenig nach vorn gedrückt. Glücklicherweise war die Straße hinter uns komplett frei, sonst wäre uns in diesem Moment jemand reingefahren.
Nellie warf mir einen entschuldigenden Blick zu, während ich das Lenkrad mit einem abschätzigen Geräusch zum Einparken einschlug. »Sorry.«
»Wenn du uns umbringen willst, dann sag es einfach.«
Der Motor war kaum verstummt, da war Nellie schon aus dem Wagen gesprungen. Die Müdigkeit, die sie vorhin im Pyjama ausgestrahlt hatte, war nicht mehr zu bemerken. Ich stieg ebenfalls aus und betrachtete das Gebäude, auf das Nellie zuhüpfte. Es war ganz offensichtlich eine Bar, aber eine, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Schon gar nicht in einem so schicken Wohngebiet.
Offensichtlich war das hier früher eine Boutique oder etwas in der Richtung gewesen, denn an der Front waren, links und rechts von der golden angemalten Tür, zwei riesige Schaufenster zu sehen. Man konnte nicht hindurchblicken, weil sie von innen mit rotem Samtstoff verhangen waren, aber über ihnen hing ein leuchtendes, blau-violettes Neonschild mit der Aufschrift »Jax«, das die Form eines Flügels hatte.
»Du denkst, der Typ ist mitten in der Woche in einer Bar?« Ich folgte der beschwingt aussehenden Nellie über den Gehweg, die Hände in die Taschen meiner alten Jeansjacke vergraben. Ich war definitiv nicht zum Ausgehen angezogen. Schon gar nicht für so eine schicke Bar.
»Nein«, gab meine Freundin lachend zurück. »Ich weiß, dass er mitten unter der Woche in dieser Bar ist. Es ist nämlich Donnerstag.«
»Und das heißt?«
»Wirst du schon sehen.«
Noch ein Rätsel, großartig. Ich ergab mich einfach.
Nellie hatte das Ganze eh schon für uns entschieden, und ich konnte nicht mehr tun, als ihr zu vertrauen. Als sie die goldene Tür aufriss, dröhnten uns laute Musik und Jubel entgegen. Ich war überrascht, direkt auf den ersten Blick so viele Menschen zu sehen. Sie ringten sich um eine kleine Bühne, auf der eine Frau zu einem Song performte, ihre langen Haare schwang und leidenschaftlich ihren Mund zu den Lyrics bewegte.
Ihr Auftritt hielt mich für einen Moment vollkommen in ihrem Bann. Sie bewegte sich so fließend und rhythmisch, als wäre sie eins mit der Musik. Und dann fiel mir ein kleines Detail an ihr auf, das mir beinahe die Kinnlade herunterklappen ließ. »Moment. Das ist …«
»Eine Drag Queen.« Nellie grinste mich über ihre Schulter an, während sie dem Security-Typen ihre kleine Handtasche hinhielt. »Donnerstag ist Drag-Queen-Abend im Jax.«
»Du machst Witze.« Ich hob die Hände, um der Security zu zeigen, dass ich keine Tasche dabeihatte, und der muskulöse Türsteher winkte mich zu Nellie durch. Es gab keinen Vorraum, und so standen wir direkt mitten in der jubelnden Menschenmenge, die sich um die Bühne drängte. Das Jax war relativ klein. Die Wände waren mit Stoff behangen, die Hocker vor der Bar samtig rot bezogen. Goldenes Metall an der Bar, der Bühne, an den Türen, alles sah unglaublich hochwertig aus und glänzte in einem warmen Licht.
»Toll, oder?« Nellie hatte meinen verträumten Gesichtsausdruck wohl bemerkt, denn sie grinste. »Hier steckt richtig viel Liebe drin.«
»Das sieht man.«
»Komm.« Sie packte meinen Arm und zog mich durch die Menschen zur Bar hin. »Holen wir uns erst mal einen Drink. Ich geb dir einen aus, damit du ein wenig runterkommst.«
»Sollten wir nicht nach deinem Freund Emery suchen?«
»Oh, das müssen wir nicht. Er wird uns schon finden, wenn er die Zeit dafür hat.«
Ich erinnerte mich daran, dass ich Nellie die Kontrolle für diesen Abend übergeben wollte, und seufzte ergeben. »In Ordnung.«
»Gutes Mädchen.« Sie grinste und drückte mir einen Schein in die Hand, dann gab sie mir einen leichten Schubs auf die Bar zu. »Bestell dir, was du willst, ich muss die Toilette aufsuchen. Hätte ich vorhin nach dem Umziehen direkt noch erledigen sollen.«
»Du willst mich hier allein lassen?«
»Entspann dich. Das ist eine Bar, kein Löwenkäfig. Bestell was, ich bin gleich bei dir.« Und schon war sie von der Menge verschluckt worden. Den Menschenmassen nach zu urteilen, würde es wahrscheinlich eine Weile dauern, bis sie zurückkam. Ich seufzte tief und stellte mich an der Bar an. Ich wollte es wirklich wie sie halten und mir zur Abwechslung mal keinen Kopf machen. Mich treiben lassen von dem, was auf mich zukam.
Aber zwei Minuten ohne Nellie reichten, und meine Gedanken wanderten schon wieder in alle Richtungen davon. Ich hätte meine Mutter anrufen sollen. Heute Nachmittag hatte ich ihr eine Nachricht geschrieben, dass ich wegfahren würde, aber das war mehrere Stunden her. Sie sollte wenigstens wissen, dass es mir gut ging.
Die Bässe der Musik schwollen an, und automatisch wanderte meine Hand hinter mein rechtes Ohr. Irgendwo dort schlummerte der ungeliebte Freund, dank dem ich von zu Hause abgehauen war und an einem Donnerstagabend in einer vollen Bar stand.
Bevor ich Kopfschmerzen von der Musik bekommen konnte, war das Lied zu Ende, und die Menge brach erneut in lauten Jubel aus. Mein Blick wanderte wieder zu der Bühne, wo die Drag Queen sich gerade tief verbeugte und dann zum Rand lief, um ihr entgegengestreckte Dollarscheine anzunehmen.
»Macht noch einmal richtig Lärm für meine Freundin Banana Split!«
Die Moderatorin kam auf die Bühne, einen Arm in die Luft gestreckt und ein Mikro direkt vor den Mund gehalten. An ihrer Stimme war zu erkennen, dass es wohl ein relativ junger Typ war, der da unter den dunklen langen Haaren steckte. Die Menge jubelte, und über die Miene der jungen Drag Queen breitete sich ein solches Strahlen aus, dass es im Raum heller zu werden schien. Banana Split bedankte sich mit einer Verbeugung und verschwand dann hinter dem Vorhang, während sich die Moderatorin auf der Mitte der Bühne platzierte und einen Moment abwartete, bis der Applaus leiser geworden war. Nur vereinzelt war noch ein Ruf wie »Wir lieben dich, Grace!« zu hören.
Die Moderatorin zwinkerte verschmitzt. »Amazing Grace, bitte. So viel Zeit muss sein!«
Erneuter Applaus, lauter noch als zuvor. Grace strahlte so glücklich, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Herz stehen blieb. Himmel, sie sah so unglaublich schön aus. Ihr Make-up saß perfekt, genau wie das leichte, rosafarbene Kleid, unter dem sie schwarze Boots trug. Wie eine schmale Elfe, die aus Versehen in einen Rockerladen gestolpert war.
»Die nächste Performerin rockte das Jax schon häufiger. Also will ich jetzt einen ordentlichen ›Willkommen zurück‹-Applaus hören, für –« Grace ließ eine kurze, bedeutungsvolle Pause, bevor sie in das Mikro schrie: »– Karla Kolumbia!«
Unter tosendem Beifall verließ Elfe Grace die Bühne und machte Platz für eine Dame mit pompösem Kleid, starkem Augen-Make-up und einem so dichten Bart, dass jeder Bauarbeiter neidisch geworden wäre.
»Hey, hallo? Erde an die Dame?«
Ich fuhr erschrocken zur Bar herum, als mir jemand ins Ohr schrie. Der Typ im schwarzen »Jax«-T-Shirt grinste breit und verschränkte die Arme vor der Brust. Er war groß, bestimmt einen ganzen Kopf größer als ich, hatte schwarze Haare, und ich konnte nicht anders, als meinen Blick über die Ringe in seinem Ohr wandern zu lassen. »Ja, Grace ist wundervoll. Trotzdem brauche ich kurz deine Aufmerksamkeit, du hältst den Verkehr auf.«
»Tut mir leid«, sagte ich schnell und bemerkte im selben Moment, dass ich noch nicht einmal in die Karte gesehen hatte. Verdammter Mist, was sollte ich bestellen?
Der Typ hinter der Bar bemerkte meine Verzweiflung wohl, denn sein Grinsen wurde breiter, und er lehnte sich über den Tresen zu mir hin. »Wie wäre es mit einer Empfehlung?«
»Oh Gott, ja, danke«, gab ich erleichtert zurück. Er lachte, und ich war froh, dass er nicht sauer war, weil ich einen Stau verursachte.
»In Ordnung. Süß oder salzig?«
»Eher süß.«
»So richtig bonbonsüß oder eher was Fruchtiges?«
»Fruchtig.« Ich merkte, wie sich in meine Mundwinkel ein Grinsen schlich, weil er ein nachdenkliches Gesicht auflegte, als wäre das hier eine wirklich wichtige Lebensentscheidung. Dann begannen seine dunklen Augen zu leuchten. »Okay, dann empfehle ich dir einen Drink passend zu unserem Abend: unseren Pride-Cocktail. Den gibt es immer nur donnerstags, du hast also wirklich Glück, dass du heute in den Genuss kommst.«
»Klingt großartig. Den bitte zweimal, für mich und meine Freundin.«
Er zwinkerte und machte sich direkt daran, die Drinks zu mixen. Ich beobachtete ihn dabei, wie er mit geschickten Bewegungen Flüssigkeiten mit verschiedenen Farben mischte und schließlich in zwei große Gläser gab. Es war ein faszinierender Anblick, denn in dem Glas entstand ein Regenbogen: von Rot über Orange und Gelb hin zu Grün, Blau und schließlich Violett am Boden des Glases. Als er die Cocktails über den Tresen schob, hatte er ein so unbeeindrucktes Gesicht aufgelegt, als hätte er gerade nicht einen waschechten Zaubertrick vollführt.
»Wow«, machte ich nur, weil ich nicht mehr über die Lippen brachte.
Er zuckte mit den Schultern und grinste wieder bis über beide Ohren. »Ja, das höre ich öfter. Macht zwölf Dollar. Du kannst ihn übrigens durchmischen oder Schicht für Schicht trinken. Ich empfehle Letzteres.«
Ich war so fasziniert von den Drinks, dass ich erst, als ich den Schein über die Bar reichen wollte, bemerkte, dass es zu wenig war. Nellie hatte mir nur zehn Dollar gegeben, die ich jetzt mit großen Augen anstarrte. »Oh.« Ich spürte, wie mein Gesicht rot wurde. »Mist.«
Nellie war auf dem Klo verschwunden. Wer wusste, wann sie es durch die Menschenmassen wieder herschaffen würde, und ich hatte in der ganzen Aufregung natürlich meinen Geldbeutel im Auto vergessen.
Der Barmann legte den Kopf leicht schief, und ich stammelte: »T-Tut mir leid, ich habe nur diesen Schein. Aber meine Freundin …« Etwas verzweifelt drehte ich mich auf der Suche nach Nellie herum, die wie vom Erdboden verschluckt blieb. Hinter mir drängten sich immer mehr Menschen, die zur Bar durchkommen wollten, und mein Herz begann zu rasen.
»Schon in Ordnung. Schreib den Rest auf meinen Zettel.«
Als die Stimme neben mir erklang, wandte ich mich ihr zu und sah nur wenige Zentimeter von mir entfernt Grace an der Bar lehnen. Sie lächelte mich an, als würden wir uns schon seit Ewigkeiten kennen, dann winkte sie dem Barmann zu. »Und bring mir bitte schnell ein Wasser, Colton. Ich habe das Gefühl, ich kriege gleich kein Wort mehr über die Lippen, und wir haben noch zwei Künstlerinnen.«
Der Barmann, Colton, schüttelte missbilligend den Kopf. »Ich habe dir gesagt, du sollst mit deiner Erkältung nicht so ins Mikro schreien, Grace.« Er ging das verlangte Wasser holen, und ich nutzte die Pause, um die junge Drag Queen anzulächeln. »Danke. Du bekommst es gleich wieder, sobald meine Freundin vom Klo zurück ist.«
»Mach dir keine Gedanken.« Grace winkte strahlend ab. »Du bist das erste Mal hier, oder? Ich kenne die meisten Leute im Jax, und wenn du ein Neuling bist, dann muss ich ja dafür sorgen, dass du Stammkundin wirst.« Sie zwinkerte und lachte dann.
Ich merkte, wie mir wieder der Atem stockte. Irgendwie hatte ich mir unter Drag Queens immer etwas anderes vorgestellt. Selbst in meinem Kopf brachte ich bei dem Anblick von Grace die Pronomen durcheinander und wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Bis auf: »Ich komme auf jeden Fall wieder.«
»Yes, Ziel erreicht.« Grace nahm das Glas von Colton entgegen, trank zwei große Schlucke und stellte es dann auf die Bar. »Dann bis bald.« Mit wehendem Tüllröckchen verschwand sie in Richtung Bühne, um die nächste Künstlerin anzusagen.
Ich drehte mich zu Colton um. »Wow. Ich meine … sie … er …?«
Er lachte. »Solange sie im Drag ist, einfach sie. Und ja, Grace ist großartig. Lass dir deinen Cocktail schmecken.«
»Danke.«
Colton wandte sich den anderen Gästen und ich mich dem bunten Drink vor mir zu. Bereits nach den ersten Schlucken bemerkte ich die großzügige Menge an Alkohol.
Als Nellie endlich vom Klo wiederkam, war ich bereits etwas angeheitert. Sie sah mich entschuldigend an. »Tut mir leid. Irgendjemand hat eine der Toiletten im Damenklo geflutet, und es war deshalb nur noch eine frei – für eine ganze Reihe an Ladys mit voller Blase. Was hast du uns denn da bestellt?«
»Einen Pride-Cocktail«, gab ich grinsend zurück. Sie probierte und hob anerkennend die Augenbrauen. »Schmeckt super.«
»Oder?« Ich schlürfte den letzten Rest aus meinem Glas. »Und wenn du mir mehr Geld leihst, bestelle ich mir direkt noch einen.«
»Na, so gefällt mir meine beste Freundin. Lass die Sorgen von heute die Sorgen von morgen sein. Cheers.«
Wir ließen klirrend unsere Gläser gegeneinanderstoßen und lachten, keine Ahnung, worüber.
Und für einen Moment war der gesamte aufreibende Tag einfach vergessen.
Kapitel 3
Das Erste, was ich beim Aufwachen spürte, war der stechende Schmerz, der sich durch meinen gesamten Kopf bohrte. Ich gab ein klägliches Wimmern von mir. »Mom? Dad?«
Niemand antwortete, also öffnete ich die Augen. Die Sonne, die durch das Fenster auf der linken Seite schien, brannte in ihnen wie Feuer. Ich spürte, wie mir noch schlechter wurde, weil die Angst von mir Besitz ergriff, die mich schon seit zwei Wochen täglich begleitet. Die Angst, dass es endgültig zu spät war.
Ich blinzelte wieder zum Fenster.
Moment.
Die Erinnerungen an den gestrigen Abend kamen zurück, an die Party im Jax und die vielen Cocktails. Mich überrollte eine Welle von solcher Erleichterung, dass ich am liebsten heulen wollte. Die Schmerzen lagen nicht an der Sache, an die ich gedacht hatte, ich hatte einfach einen monstermäßigen Kater.
Die Erleichterung wich Verwirrung, als ich mich weiter umsah. Das hier war nicht das Wohnheimzimmer von Nellie, dessen war ich mir sicher. Nur ein Bett – nämlich das ausladende Himmelbett, in dem ich lag – und keine nervige Hannah weit und breit. Auch sah das Zimmer überhaupt nicht aus, wie meine beste Freundin einen Raum einrichten würde. Hier war nichts kitschig, chaotisch und voller Pflanzen, sondern geordnet und klassisch. Ich entdeckte eine weiße Kommode am anderen Ende des Zimmers, auf der eine Vase mit einer einzigen Sonnenblume und ein Bilderrahmen mit dem Foto zweier grinsender Jungen stand. Einen Schreibtisch, auf dem nach Farben sortierte Ordner lagen, beschriftet mit »Unikram«, »Barkram« und ein paar anderen Dingen, die ich auf die Entfernung nicht lesen konnte. Dahinter hingen geschmackvolle Schwarz-Weiß-Bilder von wunderschönen Frauen an der Wand. Vor dem Bett lag ein Teppich aus weißem Kunstfell, daneben ein Nachttisch mit einer gebogenen Lampe und einem Buch ohne Umschlag. Eine Autobiografie von jemandem, dessen Namen ich noch nie gehört hatte.
Wo zum Teufel war ich?
Was war gestern in der Bar passiert, dass ich einen solchen Filmriss hatte?
Definitiv zu viel Alkohol, das war schon mal sicher. Als ich mich aufsetzte, schwoll die Übelkeit in meinem Magen auf ein Maß an, das ich nicht mehr kontrollieren konnte.
Verdammt, ganz egal, wo ich war – ich musste dringend eine Toilette aufsuchen.
Ich schlug die geblümte Bettdecke zurück und bemerkte im selben Moment, dass ich nur noch mein Shirt und meinen Slip trug. Jemand hatte meine Hose fein säuberlich über den Schreibtischstuhl gehängt, und ich hoffte inständig, dass ich das trotz des Alkoholpegels selbst gewesen war. Als ich mich in ihre Richtung bewegen wollte, rebellierte mein Magen sofort wieder, und ich wusste, dass ich keine Zeit mehr hatte, wenn ich nicht den hübschen Kunstteppich versauen wollte.
Also stolperte ich ohne Hose zur Tür und riss sie auf.
Der Flur war leer, nur weiße Tapete und ein schicker Holzboden. Ich schlitterte barfuß um die Kurve und griff nach der nächstbesten Tür, in der Hoffnung, eine Toilette zu finden.
Kaum hatte ich sie aufgerissen, realisierte ich zwei Dinge: Das hier war erstens definitiv der richtige Ort, und zweitens war ich nicht allein. Mir starrte ein Typ entgegen, der, nur mit einem Handtuch um die Hüfte gewickelt, am Waschbecken stand und sich gerade die Zähne putzte. Jetzt sah er mich überrascht an und hob fragend die Augenbrauen.
Mein Blick huschte einen Moment über seinen nackten, definierten Oberkörper, die hellen Augen, die einen irren Kontrast zu seiner gebräunten Haut bildeten, und dann zu der Toilette hinter ihm.
Keine Zeit für Höflichkeiten. »Aus dem Weg!«, warnte ich, und der Typ riss sofort die Zahnbürste aus dem Mund und sprang einen Schritt zurück. Ich stolperte zum Klo, ging auf die Knie und übergab mich geräuschvoll in die Schüssel.
Dabei spürte ich den Blick des unverschämt heißen Typen die ganze Zeit auf mir. Als mein Magen leer war, brachte ich ein qualvolles: »Tut mir leid« hervor.
Der Kerl brummte. Ich hob den Kopf ein Stück von der Schüssel und starrte in zwei ernst blickende, grüne Augen. Erst dann merkte ich, dass er offensichtlich während meiner Kotztirade meine Haare gegriffen hatte, um sie mir vom Gesicht fernzuhalten. Seine Zahnbürste lag neben mir am Boden, und seine Hände waren noch in meinen blonden Wellen versunken. Er war ein ganzes Stück größer als ich, seine Haut wirkte neben meinem blassen Teint besonders dunkel, und er hatte kurze, tiefschwarze Haare, die etwas länger sicher krause Locken gewesen wären. Die Linien in seinem wirklich gut aussehenden Gesicht waren streng und doch fein, und jetzt verzogen sie sich skeptisch. »Geht’s wieder?«
Ich nickte langsam, und er strich mir zur Sicherheit die Strähnen hinters Ohr. »Danke«, murmelte ich völlig von der Rolle. Dann fügte ich hinzu: »Wer bist du? Und wo bin ich?«
»Aber wer du selbst bist, weißt du schon noch, oder?« Er zog eine Augenbraue nach oben, aber in seinem Mundwinkel war beinahe so etwas wie ein amüsiertes Schmunzeln zu sehen, als er die Zahnbürste vom Boden aufhob und unter dem Wasserhahn abspülte. »Ich bin Silas, und das hier ist meine Wohnung.«
Silas? Sagte mir gar nichts. War ich ernsthaft mit einem wildfremden Typen nach Hause gegangen nach der Party?
Ich musste ziemlich entsetzt aussehen, denn Silas seufzte. »Nein, du bist nicht mein Gast, sondern der meines Mitbewohners. Er hat dich gestern hier mit hochgeschleppt.« Er ließ seine Zahnbürste in den Becher fallen, dann stieß er die Klotür auf und rief auf den Flur hinaus: »Emery, dein Gast ist wach.«
Emery! Ja, an diesen Namen konnte ich mich definitiv erinnern. Ich atmete erleichtert aus. Das war der Kerl, den Nellie und ich gestern Abend gesucht hatten. Ihr Studienfreund, bei dem ich übernachten sollte. Ich war also am richtigen Ort gelandet, wie auch immer ich das geschafft hatte. Ich konnte mich nicht einmal mehr daran erinnern, Emery kennengelernt zu haben.
Auf dem Flur erklangen Schritte, und im nächsten Moment steckte jemand den Kopf zur Tür rein. »Was ist denn hier passiert?«
Emery wirkte nicht viel jünger als Silas und ich, und momentan war er der Einzige im Raum, der voll bekleidet war. Er trug ein etwas zu großes Bandshirt und darunter eine rot-schwarz karierte Hose. Seine dunkelbraunen Haare waren an den Seiten bis kurz über seine Ohren abrasiert, der Rest kringelte sich als wirre Locken über die linke Seite des Kopfes.
»Sie ist hier ins Klo geplatzt und hatte direkt ein inniges Gespräch mit der Toilettenschüssel«, meinte Silas. Ich warf ihm einen pikierten Blick zu, den er kühl erwiderte. Sein Mundwinkel zuckte wieder. Dann schüttelte er den Kopf und drängte sich an seinem Mitbewohner vorbei aus dem Bad.
»Bist du in Ordnung, Dawn?«
Emery hockte sich neben mich auf den Boden, und seine großen blauen Augen musterten mich sorgenvoll. »Geht es deinem Magen gut? Erkennst du mich überhaupt?«
Ja, in meinem Hinterkopf regte sich eine Erinnerung. Ich atmete tief durch, um sicherzugehen, dass ich meine Übelkeit wirklich im Griff hatte, dann sagte ich mit kratziger Stimme: »Grace.«
Er grinste, und ich fragte mich, warum ich dieses strahlende Gesicht nicht sofort erkannt hatte. »Ohne Drag einfach Emery. Nellie hat dich gestern in meiner Obhut gelassen, weil du dringend einen Schlafplatz brauchtest. Du hast in meinem Bett geschlafen.« Er griff sanft nach meinem Arm, und ich fühlte mich sofort sicher. »Kannst du aufstehen?«
»Ich kann es versuchen.«
Mit seiner Hilfe kam ich zurück auf die Füße. Einen Moment hielt er mich fest, dann breitete sich wieder das Strahlen auf seinem Gesicht aus. »Scheint ganz gut zu klappen. Also. Wie wäre es erst mal mit Frühstück?« Ich verzog das Gesicht, und Emery lachte. »Okay, aber Kaffee?«
»Das schon eher. Aber erst will ich meine Hose anziehen.«
»Verständlich. Ich warte in der Küche auf dich, am Ende des Ganges. Nimm dir die Zeit, die du brauchst.« Er rieb mir noch kurz den Arm, dann ließ er mich allein im Bad zurück.
Mir entfuhr ein tiefer Seufzer, bevor ich ans Waschbecken trat und mein Gesicht wusch. Da hatte ich ja einen wunderbaren ersten Eindruck hinterlassen. Erst die Sache mit dem Geld gestern Abend, dann hatte ich mich offensichtlich vollkommen abgeschossen, und jetzt musste man mich am nächsten Morgen auch noch vom Toilettenboden aufsammeln.
Ich betrachtete für einen Moment mein Spiegelbild mit den wirren blonden Haaren und den dunklen Augenringen und wollte gar nicht wissen, für was für einen Menschen die beiden mich hielten. Dann spülte ich den Mund aus und verließ das Bad.
Als ich keine fünf Minuten später das große offene Wohnzimmer mit Kochecke betrat, roch es schon verführerisch nach Kaffee. Links stand ein einladend aussehendes Sofa, große Pflanzen zierten die Ecken. In der Mitte des Raumes ging eine kleine Wendeltreppe nach oben, rechts saß Silas an einer schmalen Kücheninsel und las irgendwas auf einem Tablet in seiner Hand, die krausen Haare unter einer dunklen Mütze versteckt. Er hob kurz den Blick, betrachtete mich und wandte sich mit einem beinahe schadenfrohen Schmunzeln wieder seiner Lektüre zu. »Magen im Griff?«
»Ja«, gab ich peinlich berührt zurück. Wenigstens hatte er jetzt ein Shirt und ich eine Hose an. Dafür, dass er einer Wildfremden vor wenigen Minuten noch die Haare beim Kotzen gehalten hatte, wirkte er in diesem Moment erstaunlich kühl.
»Setz dich.« Emery kam mit einer dampfenden Kanne aus der Küchenecke und stellte mir eine Tasse auf die Ablage. Als ich mich auf einen der dunklen Hocker fallen ließ, goss er mir Kaffee ein. »Danke.« Ich lächelte. »Auch für die Übernachtungsmöglichkeit.«
»Keine Ursache.« Emery setzte sich neben mich, das Gesicht in seine Hand gestützt, und betrachtete mich von der Seite. »Und, was ist deine Geschichte?«
»Meine Geschichte?« Beinahe wäre mir vor Schreck die Tasse aus der Hand gefallen. Ich sah ihn mit großen Augen an, und er grinste. »Na ja, du hast sehr spontan nach einem Schlafplatz gesucht, und ich frage mich einfach, was dahintersteckt.«
Ich fixierte die marmorne Platte der Kücheninsel und presste die Lippen zusammen. »Ich musste für eine Weile von zu Hause weg.«
»Das tut mir leid.« Emery senkte den Kopf. »Du musst nicht mehr sagen. Wenn wir uns mit etwas auskennen, dann damit, dass man manchmal eine Weile nicht nach Hause kann.« Er starrte in eine unbestimmte Ferne, und Silas nickte hinter seinem Tablet, ohne aufzusehen. Ich fragte mich unwillkürlich, was wohl ihre Erfahrungen damit waren.
»Du bist herzlich eingeladen, eine Weile hierzubleiben. Solange du es eben brauchst.«
Ich verschluckte mich an meinem Kaffee und hustete. Emery klopfte mir auf den Rücken, und als ich wieder Luft bekam, stieß ich hervor: »Das kann ich nicht annehmen.«
Emery zuckte nur lächelnd mit den Schultern, als würde er sagen wollen: Das Angebot steht.
Ich nahm einen weiteren Schluck von dem Kaffee, der einfach wunderbar schmeckte und meinen Kopf etwas klarer machte. Dann sah ich mich wieder in der großen Wohnküche um. »Es ist ein bisschen peinlich, dass ich diese Frage überhaupt stellen muss, aber: Wie bin ich eigentlich hierhergekommen?«
»Das war ganz einfach: Du bist einfach an mich gelehnt die Treppe hochgewackelt.«
»Nur die Treppe hoch?«
Emery deutete auf den Boden. »Das Jax ist direkt unter uns im Erdgeschoss.«
Ich sah verblüfft unter mich. »Ihr wohnt über dem Jax?«
Silas ließ das Tablet sinken und sah mich mit seinen stechend grünen Augen an. »Direkt über der eigenen Bar zu wohnen, ist eben sehr praktisch.«
»Moment. Das ist eure Bar?«
Die beiden nickten, und mir klappte der Mund auf. Emery war sicher nicht älter als neunzehn oder zwanzig, Silas vielleicht Anfang oder Mitte zwanzig, und die beiden waren ernsthaft schon Barbesitzer? Auf einmal kam mir mein erfolgloses Leben noch kläglicher vor als ohnehin schon.
»Das ist beeindruckend.«
»Danke.« Emery strahlte mich an, und selbst Silas schmunzelte für eine Sekunde in sich rein.
Das erinnerte mich an etwas. »Ich muss dringend telefonieren.« Meine Hände tasteten die Hosentaschen ab, aber ohne Erfolg. »Wo ist meine Jeansjacke?«
»An der Garderobe.« Emery rutschte sofort vom Hocker, um sie zu holen. Ich spürte, wie Nervosität in mir aufstieg. Meine Eltern hatten seit meiner Flucht gestern Nachmittag nichts mehr von mir gehört. Mein Vater war zwar entspannt und gab mir alle Freiheiten, die ich brauchte, aber meine Mutter war das komplette Gegenteil. Es würde mich nicht wundern, wenn sie bereits die Polizei informiert hätte.
»Alles in Ordnung?« Silas hob eine Augenbraue. Er klang nicht besorgt, eher misstrauisch.
Ich winkte ab, aber so leicht ließ er nicht locker: »Emery hat natürlich recht, du musst uns nichts erzählen, was du nicht willst. Aber solltest du eine gesuchte Verbrecherin sein, dann wäre es vielleicht nützlich, wenn wir es wüssten. Nur, um Vorkehrungen zu treffen.«
Ich starrte ihn schockiert an, und er legte leicht den Kopf schief. »Das sollte ein Scherz sein. Du hast doch nicht wirklich irgendetwas …?«
»Nein, natürlich nicht!«, protestierte ich. »Ich weiß, ich habe gestern und heute Morgen nicht den besten Eindruck gemacht, aber wirke ich wirklich wie jemand, der im Konflikt mit dem Gesetz steht?«
Silas ließ sich mit der Antwort provozierend lange Zeit. Er hob den dampfenden Tee an seinen Mund und nahm einen geräuschvollen Schluck davon, ohne auch nur für eine Sekunde die Augen von mir zu nehmen. Ich spürte, wie mir flau wurde. Nicht nur, weil er einen bohrenden Blick hatte, der in mein tiefstes Innerstes vorzudringen schien – sondern auch, weil ich ganz plötzlich wieder das Bild von seinem nackten Oberkörper vor meinem inneren Auge hatte und seine beruhigenden, starken Hände auf meinem Rücken spürte.
Schließlich setzte er die Tasse wieder ab und stützte sein Kinn auf eine Hand. »Die besten Verbrecher sind doch die, denen man es nicht ansieht, oder?« Er sagte es ernst und ohne zu lächeln, und diesmal war ich mir wirklich nicht sicher, ob es nur ein blöder Scherz war. Besonders, als er leise hinzufügte: »Emery vertraut Menschen schneller als ich. Bring ihn nicht in Schwierigkeiten.«
Ich schnappte nach Luft und wollte eine bissige Bemerkung zurückgeben, konnte mich in der letzten Sekunde aber noch bremsen. Der Typ wollte mich provozieren, das war eindeutig. Den Gefallen würde ich ihm nicht tun. Außerdem hatte er jedes Recht, mir zu misstrauen, bisher hatte ich nicht gerade den besten Eindruck gemacht. Also zuckte ich nur mit den Schultern. »Tja, das Risiko musst du jetzt wohl eingehen.«
Silas hielt meinem Blick stand. Für einen Moment sah es aus, als würde er etwas sagen, dann kam Emery zurück zur Kücheninsel. Er hob die verblichene Jeansjacke, die meine Mutter mir von ihren wilden Teenagerjahren vererbt hatte, triumphierend über seinen Kopf. »Gefunden. Irgendwie ist sie doch nicht an der Garderobe, sondern im Wäscheschrank gelandet.«
»Danke.« Ich nahm sie ihm ab und war erleichtert, als ich mein Handy in der Tasche spüren konnte. Wenigstens hatte ich es gestern, neben meiner Würde und meinem Gedächtnis, nicht auch noch verloren. »Entschuldigt mich kurz.«
Schnell rutschte ich vom Hocker und ging den Flur zurück wieder in das Zimmer, in dem ich die Nacht verbracht hatte. Kurz bevor ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, konnte ich Emerys gedämpfte Stimme hören: »Hast du irgendetwas zu ihr gesagt?« Dann war ich allein.
Seit meinem letzten Blick aufs Handy gestern Abend hatte meine Mutter noch achtmal versucht, mich anzurufen. Ihre letzte Nachricht klang eher verzweifelt als wütend, und ich beeilte mich, ihre Nummer zu wählen. Es klingelte nur ein einziges Mal, dann hob sie auch schon ab und brüllte mir sofort ins Ohr: »WO ZUR HÖLLE BIST DU?«
»Beruhige dich«, versuchte ich es sanft, aber darauf ließ sie sich nicht ein.
»ICH WERDE MICH NICHT BERUHIGEN! Weißt du eigentlich, was dein Vater und ich uns für Sorgen gemacht haben?!«
Ich seufzte, weil ich es mir sehr gut vorstellen konnte. »Es tut mir leid. Ich wollte dich eigentlich anrufen, aber … ich habe es gestern in der ganzen Aufregung vergessen.«
Sie schnappte schon nach Luft, um die nächste Schimpftirade vom Stapel zu lassen, und ich nutzte die kurze Pause schnell: »Hör mir zu. Ich meine das ernst, es tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Das wollte ich nicht. Aber ich konnte diese OP nicht machen. Nicht im Moment.«
»Erklär es mir«, verlangte sie mit vorwurfsvollem Unterton. »Ich will verstehen, warum du so unverantwortlich bist und mit einem Tumor im Kopf durch die Weltgeschichte fährst.«
Ich öffnete den Mund, bekam aber keinen Ton heraus. Mir wurde auch schnell bewusst, warum: Für meine Mutter war nur wichtig, dass ich so schnell wie möglich operiert wurde und sie keine Angst mehr um mein Leben haben musste – die Folgen spielten keine Rolle. Sie würde mich mein restliches Leben im Rollstuhl herumfahren oder mir wieder das Sprechen beibringen. Ihr war egal, ob ich mein Augenlicht verlor, solange ich bei ihr blieb.
Das konnte ich ihr nicht vorwerfen, denn wahrscheinlich hätte ich in ihrer Lage genauso gedacht und gehandelt. Das Leben war kostbar, der Verlust des Sehvermögens oder der Beweglichkeit meines Körpers nur ein verdammtes, großes Vielleicht. Aber dieses Vielleicht ließ mich daran zweifeln, ob ich ein Leben ohne Augenlicht überhaupt wollte. So schwer es für sie war, ich musste meine eigene Entscheidung treffen. Musste das für mich Richtige tun, auch wenn ich im Moment keine Ahnung hatte, was das überhaupt war. Genau deshalb brauchte ich Abstand von zu Hause. Ich dachte an Emery und Silas, und wie viel sie in ihrem Leben erreicht hatten, obwohl sie gerade einmal so alt waren wie ich. Auf den Stolz in ihren Augen, wenn sie über das Jax sprachen. Ich wollte auch etwas, auf das ich zufrieden zurückblicken konnte, selbst wenn sich mein ganzes Leben veränderte. Ich wollte etwas in meinem Leben erreichen, an das ich immer denken konnte, wenn ich mich nicht mehr bewegen und nicht mehr sprechen konnte. Etwas Bedeutungsvolles, nur für mich.
»Dawn?«
Ich holte tief Luft. »Es ist kein Krebs, Mama. Doktor Diaz sagt, dass der Tumor noch eine ganze Weile vollkommen unverändert bleiben kann, ohne mich in Gefahr zu bringen. Und … Ich werde für eine Weile nicht nach Hause kommen. Vielleicht auch für etwas länger, ehrlich gesagt, weiß ich das noch nicht. Du hast das Recht, wütend auf mich zu sein, aber ich habe auch das Recht, selbst zu entscheiden. Glaub mir für den Moment einfach, dass ich mein Leben nicht sinnlos aufs Spiel setze. Ich brauche nur … Zeit.«
Eine ganze Weile sagte sie gar nichts, und ich musste immer wieder nachschauen, ob das Gespräch unterbrochen wurde. Irgendwann hielt ich die Stille nicht mehr aus. »Ma?«
Sie gab ein Geräusch von sich, das sich nach einer Mischung aus Seufzen und Schluchzen anhörte. »Es ist deine Entscheidung.« Ihre Worte klangen enttäuscht und immer noch wütend, und mir sackte das Herz in die Hose. »Ruf wieder an, wenn du vernünftig geworden bist.«
Dann legte sie auf.
Ich lehnte meinen Kopf an die kühle Wand und ließ langsam das Handy sinken. Verdammt, war das, was ich hier machte, dumm und verantwortungslos? Verhielt ich mich wie eine ängstliche, bockige Teenagerin? Denn plötzlich fühlte ich mich gar nicht mehr so vernünftig und erwachsen, wie ich es meiner Mutter am Telefon hatte weismachen wollen.
Bevor mich mein Gedankenchaos und die Verzweiflung vollständig übermannten, hob ich das Handy und wählte Nellies Nummer. Es dauerte eine Weile, bis sie ranging, und als sie es tat, klang ihre Stimme gequält: »Dawn?«
»Hey. Wo bist du?«
»Im Wohnheim. Hab meine erste Vorlesung verpennt.« Es raschelte am anderen Ende, dann erklang ein Stöhnen. »Die zweite auch.«
Sie klang so elend, wie ich mich gerade fühlte, und aus irgendeinem Grund tröstete mich das. »Können wir uns auf einen Kaffee treffen?«
»Unbedingt. Auf dem Campus gibt es eine Mensa, kommst du dorthin?«
»Ich bin in fünfzehn Minuten bei dir.«
»Gut.«
Ich legte auf und verließ Emerys Zimmer wieder in Richtung der Wohnküche. Die beiden saßen immer noch an der Kücheninsel, und ich hatte das Gefühl, dass ihr Gespräch verstummte, als ich eintrat. Sie sahen mich fragend an. »Bist du okay?«, wollte Emery wissen, und ich zwang mich zu einem Lächeln. »Ja, alles in Ordnung. Danke noch mal, keine Ahnung, was ich ohne diesen Schlafplatz gemacht hätte. Aber ich muss los, Nellie klang am Telefon, als bräuchte sie dringend etwas Beistand.«
Emery stand auf und trat zu mir. Zu meiner Überraschung nahm er mich in den Arm und drückte mich fest. »Nellie hat meine Nummer. Nur falls …« Er sprach nicht weiter, und ich spürte, wie meine Augen zu brennen begannen. Seine Fürsorge rührte irgendetwas tief in mir, vor allem, weil wir uns gestern erst begegnet waren. Jetzt wusste ich, was Nellie gemeint hatte: Man konnte Emery nur lieben.
Er löste sich von mir und tätschelte lächelnd meine Wange. In seinen Augen lag so viel Wärme, dass ich ihm am liebsten direkt wieder um den Hals gefallen wäre. »Alles Gute, Dawn.«
»Danke«, sagte ich und räusperte mich verlegen, weil meine Stimme belegt klang. Dann sah ich zu Silas, der zwar nicht aufgestanden war, mich aber musterte. Ein Schmunzeln legte sich auf seine Lippen, als hätte das seltsame Gespräch zwischen uns gar nicht stattgefunden. »Viel Glück bei was auch immer.«
Wenigstens verkniff er sich einen Spruch über meine angebliche Verbrecherkarriere.
Ich drückte Emerys Arm zum Abschied, warf mir die Jeansjacke über die Schultern und ging zur Tür. Bevor ich die Wohnung der beiden verließ, drehte ich mich aber noch einmal um. »Wisst ihr … das Jax ist wirklich wunderschön. Ihr könnt unheimlich stolz darauf sein.«
Emery strahlte bis über beide Ohren, und für einen Moment sah ich ihn wieder in dem rosa Kleid auf der Bühne stehen. Grace war der Hammer, und der Kerl unter ihrem Make-up auch.
Silas’ Blick war unergründlich, aber ich bildete mir ein, dass etwas Wärme darin lag. Mehr zumindest als noch einen Moment zuvor. »Mach’s gut, Dawn.«
Ich nickte und trat auf den Flur hinaus.
Kapitel 4
Die Straßen waren tagsüber deutlich belebter, weshalb ich etwas über zwanzig Minuten brauchte, bis ich wieder auf dem Parkplatz der Uni stand. Ich lehnte mich zum Beifahrersitz und kramte in meiner Sporttasche nach einem Deo. Eine Dusche hatte ich Emery nicht auch noch abringen wollen, er hatte genug für mich getan, und der Gedanke, dass sich das Malheur mit Silas in vertauschten Rollen wiederholen könnte, jagte hitzige Gefühle durch meinen Körper.
Als ich die Flasche zurückgesteckt hatte, beschloss ich, meinen Bestand zu überprüfen, was nur die Sachen waren, die ich ins Krankenhaus mitgenommen hatte: Ich hatte Unterwäsche für fünf Tage. Meine Mutter hatte zwar darauf bestanden, mir nach der OP neue Sachen vorbeizubringen, doch jetzt war ich unheimlich froh, dass ich nicht auf sie gehört und mehr eingepackt hatte. Neben ihrer Jeansjacke befanden sich noch ein alter Kapuzenpulli meines Vaters sowie einige Shirts und eine Jogginghose in der Tasche. Zudem fand ich eine Flasche Wasser, mein Notizbuch und schließlich das Buch, das ich seit meiner Teenagerzeit überall mit hinschleppte: »Auf Sandalen durch Südafrika«. Es war mein absolutes Lieblingsbuch von River Lexington – eine emotionale Geschichte von zwei Geschwistern, die durch Afrika wanderten, um ihren Vater zu finden. Das Exemplar war uralt und abgegriffen, und als ich es in die Hand nahm, durchfuhr mich eine so starke Liebe für die Geschichte, dass mir ganz warm wurde.
Mein Blick wanderte an die Autodecke mit der selbst gemalten Afrikakarte, und ich strich mit dem Finger über die rote Linie, die ich dort eingezeichnet hatte. Der Weg der Geschwister, jeder Halt, den sie gemacht hatten, jedes ihrer Abenteuer war dort eingetragen. Ich erinnerte mich noch gut daran, wie ich auf dem Sitz gehockt und die Karte aus meinem Notizbuch abgezeichnet hatte. Es war ein Versprechen an mich selbst gewesen.
Atemlos warf ich das Buch wieder zurück in die Tasche und schob den Gedanken in meinem Kopf nach hinten. Nachdem ich einen kontrollierenden Blick durch die Heckscheibe geworfen hatte, wechselte ich auf dem Vordersitz meine Klamotten und zog mir den Pulli über. Dann putzte ich mir mit dem Wasser aus der Flasche die Zähne, schnappte mir meinen Geldbeutel und mein Notizbuch und sprang aus dem Auto.
Die Mensa zu finden, war nicht schwer. Die Seite des Gebäudes, die zum Mittelweg des Unicampus zeigte, bestand aus einer einladenden Glasfront, hinter der ich einige Studenten zusammensitzen und essen sah.
Nellie war noch nicht hier, also bestellte ich mir bei der mies gelaunten Kantinenfrau einen schwarzen Kaffee und ein belegtes Sandwich und nahm an einem der runden Tische am Fenster Platz. Während ich die billig schmeckende Brühe trank, blätterte ich gedankenversunken in meinem Notizbuch. Es war in den letzten Wochen mehr zu einem Tagebuch verkommen, als es ursprünglich geplant war, aber wenn ich etwas weiter zurückblätterte, stieß ich auf wahre Schätze: kleine Gedichte, kurze Geschichten und liebevoll geklebte Collagen aus Bildern, die ich mir in mühevoller Kleinstarbeit aus Zeitschriften oder dem Internet zusammengesucht hatte. Ganz vorn auf den ersten Seiten fand ich eine Doppelseite über Südafrika, von der ich das Bild in Stiles’ Innerem abgezeichnet hatte. Daneben stand ein kurzes Gedicht, das ich schon beinahe wieder vergessen hatte.
Ich kniff die Augen zusammen, weil ich zum Lesen eigentlich eine Brille benötigte und meine eigene Schrift nicht die leserlichste war. »Sehnsucht. Heimweh nach einem Ort, der mir fremd und doch so vertraut ist. Das Verlangen nach dem ersten Schritt, nach der Sonne und den trockenen Wegen, nach dem Abenteuer, das schon so lange auf mich wartet.«
Mir entfuhr ein Seufzen, und ich strich über das Bild einer von Gazellen bevölkerten Serengeti, das ich aus dem TV-Programm einer Zeitschrift ausgeschnitten hatte. Der Text war schon älter, aber ich konnte mich noch genau an das Gefühl erinnern, das er ausgelöst hatte. Es war gar nicht so anders gewesen als das, was ich heute fühlte.
»Sorry für die Verspätung. Ich brauchte dringend eine sehr lange, sehr heiße Dusche.« Nellie rutschte mit so viel Schwung auf den Stuhl mir gegenüber, dass ich aus meinen Gedanken aufschreckte und automatisch das Notizbuch zuklappte, wie ich es zu Hause in meinem Zimmer immer gemacht hatte, wenn meine Mutter reingeplatzt war.
Meine beste Freundin hob misstrauisch eine Augenbraue, und bevor ich etwas dagegen tun konnte, hatte sie sich auch schon das Heft geschnappt. »Was ist das?« Sie blätterte kurz hindurch, ohne etwas zu lesen, und warf mir dann von der anderen Seite des Tisches einen zweifelnden Blick zu. »Dein Tagebuch?«
»Nicht direkt. Eine kleine Sammlung, könnte man sagen.« Ich hielt die offene Hand hin, und sie gab mir das Heft mit einem Seufzen zurück.
»Schreibst du noch? Ich habe seit Ewigkeiten kein Gedicht mehr von dir bekommen.« Nellie grinste, bevor sie sich meinen Kaffee unter den Nagel riss und einen großen Schluck davon nahm. Ihre blonden Haare waren noch feucht von der Dusche, nach der ich ebenfalls Sehnsucht verspürte, und sie roch nach einer Mischung aus Pfirsich und Seife. »Du könntest mir einfach mal ab und zu eins in die Briefe schreiben, die übrigens immer viel zu lange brauchen.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich schreibe in den letzten Wochen nicht mehr so viel.«
Sie setzte den Kaffee wieder ab. Ihr Gesichtsausdruck war für einen Moment bedauernd, hellte sich aber innerhalb weniger Sekunden auf. »Und, wie war die Nacht?«
»Interessant, könnte man sagen. Abgesehen von dem mordsmäßigen Kater und einem etwas unglücklichen Zusammentreffen mit Silas aber eigentlich gar nicht so schlecht.«
»Ach ja, Silas.« Nellie stützte ihr Kinn auf die Hand und seufzte übertrieben. »Gut aussehender Typ, oder? Schade, dass er so ein Griesgram ist.«
Ich wischte ihre Aussage mit einem Wink aus der Luft. Darüber wollte ich jetzt wirklich nicht reden, eigentlich nicht einmal nachdenken. »Du hattest recht, Emery ist großartig.«

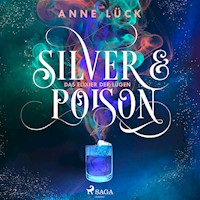
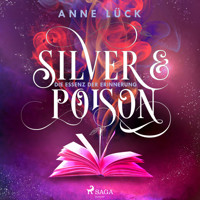
![Jewel & Blade. Die Wächter von Knightsbridge [Band 1 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ce22490997b3e6e0e807c8b632e07b21/w200_u90.jpg)




![Jewel & Blade. Die Hüter von Camelot [Band 2 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c7d0b6bb9c33b9a1b2b09f490d3cfe2a/w200_u90.jpg)