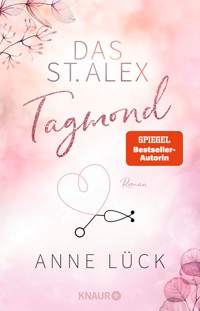Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Spiegelscherben
- Sprache: Deutsch
Spiegelscherben, Lampenfieber und Schlossgespenster – ihren Start auf dem Musikinternat Sankt Engelbert hatte die sechzehnjährige Thea sich anders vorgestellt. Als wären ihre schnöseligen Mitschüler nicht schon anstrengend genug, muss Thea außerdem feststellen, dass sie sich den scheinbar verlassenen Wohntrakt im Westflügel des alten Schlosses mit drei Geisterjungen teilt. Es bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich mit den Streichen des aufgedrehten Juli, der Überfürsorglichkeit des ehemaligen Schülersprechers Felix und der schlechten Laune des wortkargen Jonah zu arrangieren. Und bald wirft das nahende Halloweenfest seine bedrohlichen Schatten auf sie und die drei Geister.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum neobooks
Kapitel 1 – Thea
Behutsam stellte ich den Instrumentenkoffer ab. Meine Hand zitterte nicht, als ich sie nach der Türklinke ausstreckte. Ich besaß den ruhigen und präzisen Griff einer Geigerin. Dagegen, dass meine Handinnenflächen vor Nervosität nassgeschwitzt waren, konnte ich allerdings nichts ausrichten. Ich atmete kontrolliert ein und aus, bevor ich die Klinke herunterdrückte. Entschieden stieß ich die Tür auf und trat in mein neues Leben.
Im gleichen Moment ließ mich ein ohrenbetäubendes Scheppern zusammenfahren und die Reisetasche rutschte mir aus der Hand, als mir eine weiß wabernde Gestalt entgegensprang. Fast wäre ich rückwärts wieder aus dem Zimmer herausgehastet, doch der vom Sonnenlicht erleuchtete Stoff erschlaffte plötzlich. Es war bloß die Gardine! Das Fenster war vom Windzug aufgedrückt und gegen die Wand geschlagen worden. Der Kunststoffrahmen hatte den daneben hängenden Spiegel erwischt und ein Stück Glas herausgeschlagen, das nun zersplittert im Waschbecken darunter lag. Die restliche Spiegelfläche, aus der mir meine eigenen Augen entgegen starrten, war von einem Netz aus Rissen überzogen.
Ich wollte gerade zu einem Fluch ansetzen, da fegte ein zweiter Windstoß durch den Raum, schmiss die kleine Lampe vom Nachttisch herunter und warf mir die Zimmertür mit solch einer Wucht entgegen, dass ich nur noch strauchelnd ausweichen konnte. Dabei stolperte ich über meine Reisetasche und landete auf den Knien. Mein Aufschrei wurde von der zuschlagenden Tür übertönt. Die Vibration des Knalls schickte ein Beben durch den Boden und die Zimmerwände. Die weißen Bilderrahmen, die man rundherum aufgehängt hatte, rutschten alle zeitgleich von ihren Nägeln und krachten zu Boden. Glas sprang und Holz splitterte.
Dann war es totenstill.
Fassungslos blickte ich mich in dem verwüsteten Zimmer um. Die Glühbirne der Nachttischlampe war glücklicherweise heil geblieben, doch im papierartigen Stoff ihres Schirms war ein Riss. Die hellen Holzdielen waren voller Glassplitter und ich entdeckte einige Macken, die vermutlich vorher nicht da gewesen waren. Von zwei der Bilderrahmen, die allesamt Kupferstiche berühmter Komponisten rahmten, war an den Kanten die Farbe abgeplatzt. Einer war komplett zerbrochen. An einer Stelle der Wand hatte ein abgestürzter Komponist – wahrscheinlich Liszt, der Mann des überschwänglichen Dirigierstils – den Nagel aus dem Putz gerissen und nun klaffte dort ein kleines Loch, aus dem feiner Staub rieselte. Das Einzige, was noch an der Wand hing, war der zerbrochene Spiegel.
„Echt jetzt?“ Mein Flüstern war heiser und mir war anzuhören, dass mein Körper noch immer von Adrenalin durchflutet wurde. Fast gelang es mir vor lauter Zittern nicht, mich aufzurappeln. Wankend kam ich auf die Beine und schluckte trocken. Mein Puls raste. So hatte ich mir den Start meiner vorbildlichen Schülerkarriere auf Sankt Engelbert nicht vorgestellt. Aber immerhin hatte der Schock die Endlosschleife von Happy Birthday, die mir schon seit Stunden auf die Nerven ging, aus meinen Kopf vertrieben.
Ich hatte den 02. August noch nie so herbeigesehnt wie dieses Jahr. Und ich hatte ihn noch nie so gefürchtet. Heute war einer der wichtigsten Tage meines Lebens und das hatte rein gar nichts mit meinem sechzehnten Geburtstag zu tun. Wenn ich das hier versaue, werde ich es ewig bereuen.
Ich zerrte die Gardine beiseite und schloss das Fenster, bevor der Wind noch mehr Unheil anrichten konnte. Ein prüfender Blick auf das Glas verriet mir, dass zumindest die Scheibe heile geblieben war. Kurz wanderte meine Aufmerksamkeit nach draußen. Die Augustsonne schien durch die Eschenblätter vor meinem Fenster und bemalte sie mit grün leuchtenden Tupfern. Der Anblick beruhigte mich ein wenig. Ich war froh, dass ich von meinem Fenster aus nicht den Pausenhof oder die Zimmer der anderen Schüler sehen konnte. Nur die Sonne, den Himmel und das Blätterdach der Esche. Außerdem war ich dankbar dafür, keine Zimmernachbarn – oder noch schlimmer: Mitbewohner – zu haben. Der Trakt, den ich von nun an bewohnte, war frisch renoviert, sollte aber eigentlich erst im nächsten Schuljahr bezogen werden. Zehn neue Schüler würden hier Platz finden, hatte der Direktor Dr. Herzog mir erklärt. Doch momentan fehlte noch eine zusätzliche Lehrkraft, um sie zu unterrichten. Der Betreuungsschlüssel auf Sankt Engelbert war hervorragend. Es handelte sich schließlich um eines der renommiertesten Musikinternate Europas und das Schulgeld war entsprechend hoch. Dass ich dieses Stipendium tatsächlich verdient haben sollte, konnte ich immer noch nicht fassen. Setz das bloß nicht in den Sand, ermahnte ich mich erneut und löste meinen Blick vom grünen Farbenspiel der Sonne.
„Sorry, Franz … Tut mir leid, Claude … Kommt nicht wieder vor, Ludwig …“ Während ich die gerahmten Bilder der Komponisten aufsammelte und auf den Schreibtisch legte, achtete ich peinlich genau darauf, mich nicht an den Scherben zu schneiden. Ich sollte gleich morgen meine neue Geigenlehrerin kennenlernen und eine Handverletzung war jetzt wirklich das Letzte, was ich gebrauchen konnte. „Sehr clever, Wolfgang.“ Fast hatte ich den Eindruck, Mozart schmunzelte mir zu, als ich ihn von meinem Kopfkissen nahm und wieder an den Nagel neben dem Bett hängte. Nachdenklich betrachtete ich die Flugbahn des unversehrten Bildes. „Wie hast du das denn angestellt?“
Die nächste Viertelstunde verbrachte ich damit, die Spuren des Unfalls zu beseitigen und dabei mein neues Zimmer zu erforschen. Wobei es da wirklich nicht viel zu entdecken gab. Es besaß zwei gegenüberliegende Nischen mit zwei schmalen Betten darin, doch nur auf einem davon lagen pastellgrüne Bezüge bereit. Links und rechts von der Tür standen schlichte Holzschreibtische, zu denen jeweils eine fest installierte Leselampe und ein Hocker gehörten. Die Wandschränke neben den Schlafnischen waren recht flach, doch ich hatte ohnehin kaum etwas mitgebracht. Meine Schwester Josi und ich hatten nicht gerade denselben Klamottengeschmack und da meine Garderobe sich aus ihrer ausgemusterten Kleidung zusammensetzte, bestand sie aus wenigen ausgewählten Stücken. Diese hatte ich schnell auf die Regalbretter verteilt und an die Kleiderstange gehängt. Dabei entdeckte ich auch einen Handfeger, mit dem ich die Glassplitter zusammenfegte. Nachdem ich sie klirrend in den Mülleimer befördert hatte, wusch ich meine Hände an dem winzigen Waschbecken. Davon gab es nur eines, aber darüber konnte ich mir immer noch Gedanken machen, wenn ich im nächsten Schuljahr tatsächlich eine Mitbewohnerin bekommen sollte. Falls ich dann überhaupt noch hier war. Ich schüttelte den Kopf und blickte fest in den zerbrochenen Spiegel. Mein Gesicht war etwas blass und durch die Risse im Glas grotesk verzerrt, schaute mir aber voller Entschlossenheit entgegen. Ich würde in jeder freien Minute wie eine Besessene Geige üben und für den Unterricht büffeln. Man hatte mir eine einmalige Chance geboten und die würde ich nicht verstreichen lassen!
Ich hatte mein kupfernes Haar hochgesteckt, wie immer, wenn ich mich auf etwas Wichtiges konzentrieren musste. Natürlich hatte sich ausgerechnet die weiße Strähne aus dem Knoten gelöst, als wollte sie sagen: Schaut her, ich bin besonders. Ich zog eine Haarnadel aus meinem Dutt und arbeitete sie mit routinierten Bewegungen in meine Frisur ein, bis sie darin verschwunden war. Dabei fiel mein Blick zwangsläufig auf die Pigmentstörungen an meinen Händen. Die hätten mich eigentlich genauso wenig gestört wie die Sommersprossen auf meiner Nase – wenn ich nicht ständig darauf angesprochen worden wäre. Ich hatte mir angewöhnt, meine Hände häufig in meinen Hosentaschen verschwinden zu lassen, aber beim Geigen konnte ich sie nicht verstecken.
Schließlich fand mein Blick meine eigenen Augen, die mir dunkel und kalt entgegen starrten. Wow, das war kein Gesichtsausdruck, mit dem ich mich meinen neuen Mitschülern vorstellen sollte. Ich verzog mein Gesicht zu einem gequälten Lächeln und versuchte dabei, ein kleines Leuchten in meine Augen zu zaubern. Keine Chance. Das Grün meiner Iris war kühl und wenn ich angespannt war, sah ich schnell missmutig und abweisend aus. Jetzt gerade wirkte ich, als würde ich nach einem potentiellen Mordopfer Ausschau halten.
Plötzlich hatte ich das Gefühl, als würde jemand meinen Blick erwidern. Ich runzelte die Stirn.
Ein Klopfen erklang und ich wich vom Spiegel zurück. „Theresia Thalheim?“ Die gedämpfte Jungenstimme kam nicht, wie ich im ersten Augenblick geglaubt hatte, durch den Spiegel, sondern durch die Tür hinter mir. Irgendwie logisch. Es klopfte erneut und ich strich mein cremefarbenes Shirt glatt. Jetzt war es soweit. Am Ende unseres Gesprächs hatte Dr. Herzog mir den Weg zu meinem Zimmer beschrieben und angekündigt, dass mich dort jemand abholen würde. In diesem Moment fühlte ich mich plötzlich furchtbar einsam und wünschte ich mir meine Eltern herbei, was wirklich nicht oft vorkam. Die beiden hatten mich mit dem Auto hergebracht, waren aber schon vor meinem Gespräch mit dem Direktor wieder gefahren, weil Josi müde geworden war. Warum meine schwangere Schwester überhaupt mitgekommen war, verstand ich noch immer nicht. Wir hatten während der dreistündigen Fahrt vier Mal zum Pinkeln anhalten müssen. Außerdem hatte Josi die ganze Zeit über nur gejammert und sich mit meinem Vater gezankt. Ihre Launen waren früher schon echt anstrengend gewesen, aber jetzt … Vielleicht war es doch ganz gut, dass meine Familie bereits abgereist war.
Mein Magen rumorte und ich holte zittrig Luft, bevor ich die Tür aufriss.
Der Junge auf dem Flur hob kaum merklich die Augenbrauen. Wahrscheinlich fragte er sich gerade, warum die Neue ihn angaffte, als würde sie ihm die Pest an den Hals wünschen. Ich bemühte mich um ein Lächeln, doch meine Mundwinkel zuckten nur unkontrolliert. Der Junge war einen Kopf größer als ich und ein wenig stämmig. Sein Haar war dunkelbraun, die Nase etwas knubbelig und er hatte ein Grübchen am Kinn. Über seinen Schultern hing ein an den Ärmeln zusammengeknoteter Pullover und zu dem weißen Hemd darunter trug er eine Krawatte. Herrgott, ging ich wirklich auf eine Schule, an der die Jungs Krawatten trugen?
„Ich bin Till Strauss. Mit ss wie die legendäre österreichische Musikerfamilie. Verwandtschaft nicht ausgeschlossen.“ Mein Mund war wie zugeklebt. „Ich bin der Schulsprecher“, fügte Till Strauss mit ss erklärend hinzu, als wollte er seine Krawatte vor meinem ungläubigen Blick verteidigen.
„Nenn mich Thea“, presste ich mit rauer Stimme hervor. Was wie ein freundliches Angebot gemeint war, klang eher nach einem Befehl.
Till deutete mit dem Kopf auf den Geigenkoffer vor meiner Zimmertür. „Du solltest dein Instrument nicht achtlos herumstehen lassen. Hier auf Sankt Engelbert wird Wert auf Ordnung, Umsicht und Bildung gelegt.“
Offensichtlich. Ich hatte das Wort Umsicht noch nie aus dem Mund eines Jungen in seinem Alter gehört. Schuldbewusst zog ich die Tür ein wenig zu und versuchte, Till den Blick auf die demolierte Einrichtung meines Zimmers zu versperren. Das wäre allerdings nicht nötig gewesen, denn er war ohnehin damit beschäftigt, meine inzwischen lila angelaufenen Knie zu mustern. Erst jetzt bemerkte ich das schmerzhafte Pochen. Ich fühlte mich auf einmal schrecklich unwohl in meinen luftigen Shorts, fragte mich aber gleichzeitig, wie Till es bei den sommerlichen Temperaturen in einer langen schwarzen Stoffhose aushielt. Er schien meine Gedanken erraten zu haben.
„Wir haben hier keine Kleiderordnung. Dennoch würde ich dir empfehlen, deine … Freizeitkleidung?“ Er betonte das Wort wie eine Frage. „… nicht während des Unterrichts zu tragen. Wir sind hier schließlich nicht an irgendeiner Schule.“ Er grinste stolz und ich vermutete, dass es nicht seine Absicht gewesen war, mich zu demütigen. Dennoch spürte ich, wie das Blut heiß in meinen Ohren rauschte, die wahrscheinlich gerade rot anliefen. „Bist du bereit für einen Rundgang, Theresia?“
Nein. Ich fühlte mich kein bisschen bereit. Dennoch schob ich den Geigenkoffer in mein Zimmer und schloss die Tür. Man hatte mir gesagt, ich bräuchte meine Geige nicht mitzubringen, doch ich wäre im Traum nicht auf die Idee gekommen, Gerti zurückzulassen. Ich ließ die Hände in meinen Hosentaschen verschwinden, was mir einen skeptischen Blick von Till einbrachte, und nickte tapfer.
„Na dann.“ Mit federnden Schritten lief er los. „Folge mir, Neuling.“
Kapitel 2 – Felix
Als ich das neue Mädchen das erste Mal mit unsicheren Schritten über den Gang gehen sah, zog sich unwillkürlich mein Herz zusammen. Ich konnte mich noch sehr gut an meinen ersten Tag auf dem Sankt Engelbert erinnern. Daran, wie überwältigend die alten Gemäuer auf mich gewirkt hatten, die langen Gänge, und wie gespannt meine Hände sich um den Griff meines Geigenkoffers verkrampft hatten. Es hatte sehr lange gedauert, bis die ehemalige Königsburg zu einem zweiten Zuhause für mich geworden war. Aber ich war zu keinem Zeitpunkt während dieses Prozesses allein gewesen.
Dieses Mädchen hingegen – Theresia, wenn ich ihren Namen richtig verstanden hatte – strahlte mit jeder noch so winzigen Bewegung ihres Körpers Einsamkeit aus. Unterschwellig, aber als ein mittlerweile renommierter Experte dieses Gefühls konnte ich es trotzdem spüren. Während der letzten Jahre hatte ich viele junge Menschen über die Türschwelle des Sankt Engelbert kommen und gehen sehen. Manche waren mit Geschwistern gekommen, Mitschülern, ihren Familien. Manche sogar mit kleineren Haustieren, die sie irgendwie hier hereingeschmuggelt hatten.
Noch nie hatte ich jemanden vollkommen allein kommen sehen. Bis sie den Gang betreten hatte, ihren Geigenkoffer genauso fest umkrampft wie ich damals. Umso faszinierter blickte ich ihr hinterher, als sie kurze Zeit später mit hängenden Schultern ihrem neuen Fremdenführer folgte.
Es war ein Unglück, man konnte es wirklich nicht anders sagen, dass ihr erster Bekannter auf der Schule ausgerechnet eine Oberpfeife wie Till Strauss war. Das Sankt Engelbert war ein Eliteinternat, das war unbestreitbar, aber manche der Schüler ließen das etwas mehr raushängen als andere. Till Strauss tat das vom ersten Tag an wie der König dieser musikalischen Welt. Umso ärgerlicher empfand ich es, dass er mittlerweile meine ehemalige Position als Schülersprecher innehatte. Ein Kerl, dem das Wort Gemeinschaftsgefühl ebenso fremd schien wie das Wort Bescheidenheit.
Ihm war von der ersten Sekunde anzusehen, was er von Theresia hielt. Sein abschätziger Blick über ihre Kleidung, seine arrogante Ignoranz, als sie ihm ihren Spitznamen anbot. Thea. Du tust mir ernsthaft leid, Thea.
Ich fühlte mich ihr verbunden, weil wir das gleiche Instrument spielten, und wie gern wäre ich derjenige gewesen, der sie durch das Sankt Engelbert führte. Ich hätte ihr meinen gemütlichen Lieblingsplatz in der Bibliothek gezeigt, wäre mit ihr über die beeindruckende Bühne der Aula spaziert und hätte ihr all die kleinen Tipps und Kniffe gezeigt, um auf dem Internat ein schöneres Leben zu haben. Wie man die Damen in der Kantine umgarnte, um einen doppelten Nachtisch zu bekommen. Wie man eine Strafe verhinderte, wenn man ein Bibliotheksbuch überzog. Und so vieles mehr, was ich mir in meinen Jahren hier angeeignet hatte.
Zumindest aber hätte ich nicht die ganze Zeit über mich selbst, meine Familienabstammung und die zahlreichen Auszeichnungen geredet, wie Till Schnösel Strauss es tat. Mit dem zusammengeknoteten Pullover über den Schultern und der Nase so weit oben in der Luft, dass er Angst haben musste, an den Deckenlampen hängen zu bleiben.
Obwohl ich mich normalerweise aus solchen Dingen raushielt, konnte ich nicht anders, als den beiden zu folgen. Vielleicht, weil ich gerade nichts Besseres zu tun hatte, als mich über Schnösel Strauss aufzuregen.
Thea war anzusehen, dass sie sich in seiner Gesellschaft alles andere als wohl fühlte. Sie hatte den Kopf zwischen ihre Schultern gezogen und die Arme um ihren Oberkörper geschlungen, als müsste sie sich vor ihm schützen. Oder eher vor seiner arroganten Aura. Wer wusste schon, ob die ansteckend war?
Wieso fragte er sie nichts? Versuchte nicht, etwas über sie herauszufinden? Es gab kaum Menschen, denen ich in den letzten Jahren begegnet war, die auch nur ansatzweise so interessant wirkten wie Thea. Einfach alles an ihr schrie Ich bin besonders, auch wenn sie es offensichtlich zu verbergen versuchte. Von den kupferfarbenen Haaren, in denen vorn eine einzelne weiße Strähne aufblitzte, bis hin zu den hellen Pigmentflecken, die sich über ihre Hände zogen wie eine kryptische Schatzkarte. Sie war so faszinierend, dass ich den beiden auf leisen Sohlen bis zum Ende des Ganges folgte, vollkommen eingenommen von ihrem Anblick.
Solange, bis plötzlich eine Stimme hinter mir erklang: „Wo willst du hin, Felix?“
Bereits bevor ich mich umgedreht hatte, wusste ich, dass es Juli war. Er hatte die Hände in seine Hosentaschen gestopft und grinste so schief wie er stand. Jeder Orthopäde hätte bei seinem Anblick einen Schreikrampf bekommen. Als ich ihm nicht antwortete, reckte er sich nach vorn und seine Augen begannen, herausfordernd zu funkeln. „Wolltest du etwa den Gang verlassen und der Neuen folgen?“
„Unsinn.“ Ich rückte meine Brille zurecht und blinzelte die Unsicherheit weg. „Ich war nur neugierig.“
„Wenn ich mal neugierig bin, bekomme ich immer direkt Ärger von dir.“
Wohl wahr. Mir kam wieder das Klirren und Poltern in den Sinn, das Thea beim Betreten ihres Zimmers empfangen hatte. Ich konnte förmlich spüren, wie mein Blick sich verfinsterte. „Wir müssen reden, Juli.“
Kapitel 3 – Thea
Es dauerte ewig, bis ich das Salz riechen konnte. Aber als es so weit war, spürte ich, wie sich ein Lächeln auf meinem Gesicht ausbreitete. Ein echtes Lächeln. Nicht so eine verkrampfte Grimasse, wie ich sie den ganzen Tag über zur Schau gestellt hatte.
Ich lag auf dem Rücken, halb versunken in der zu weichen Matratze, und hielt beide Hände gewölbt über meine Ohrmuscheln. Den Trick hatte meine Oma mir vor meiner ersten Klassenfahrt gezeigt. Sie war die einzige Person gewesen, die jemals verstanden hatte, was das Meer mir bedeutete. Ihr war es genauso gegangen, deshalb hatte sie etwas abseits unseres Dorfes direkt am Wasser gewohnt. Dort, wo der Strand nicht mit feinem Sand und trendigen Cafés für die Touristen zurechtgemacht worden war. Um nach der Schule zu ihr zu kommen, hatte ich nur am Wasser entlanglaufen müssen, durch die Dünen und den salzigen Wind. Das Rauschen der Wellen hatte man bis in Omas Haus hören können.
Als meine Eltern mich am Abend vor der Klassenfahrt dort abgeholt hatten, war ich in Tränen ausgebrochen. Meine Mutter hatte mich so verwirrt und ratlos angeschaut, als hätte sie ihr eigenes Kind zum ersten Mal heulen gesehen. Das war beinahe vorstellbar, denn soweit ich mich zurückerinnern konnte, hatten sie und mein Vater schon immer rund um die Uhr gearbeitet. Trotzdem reichte das Geld kaum aus, um uns über Wasser zu halten. Im Gegensatz zu meiner Mutter hatte Oma den Grund für meine Tränen sofort erkannt. Sie hatte gewusst, wie schwer ich mich mit Gleichaltrigen tat, besonders in großen Gruppen. Sie hatte die Angst davor, fünf Tage lang unter fremden Menschen und weit weg von ihr und dem Meer sein zu müssen, nachvollziehen können. Also hatte sie mir den Zaubertrick gezeigt. Sie hatte meine Hände in ihre genommen und ich wusste auch heute noch genau, wie warm sich die Berührung ihrer faltigen Finger angefühlt hatte. Ich habe das Wellenrauschen für dich eingefangen, hatte sie erklärt. Stundenlang habe ich damit verbracht, es aus der Luft zu fischen, und jetzt liegt es hier in deinen Händen. Sie hatte ihre und meine Hände über meine Ohren gelegt. Wenn du nachts lauschst, kannst du das Meer hören, Thea. Und wenn du es hören kannst, kannst du es auch riechen, denn unsere Sinne sind miteinander verbunden. Wenn du also Heimweh hast, dann schließe die Augen und kehre mit all deinen Sinnen ans Meer zurück. Denn hier werde ich immer auf dich warten und solange du diesen Trick nicht vergisst, bist du niemals allein.
Rückblickend war das die liebevollste und weiseste Lektion, die ich jemals erhalten hatte, und ich hätte ihr dafür um den Hals fallen und sie küssen sollen. Stattdessen hatte ich mir trotzig die Tränen vom Gesicht gewischt und gesagt: Ich bin doch kein Idiot, Oma. Niemand kann das Wellenrauschen fangen.
Wie sich herausgestellt hatte, war ich doch ein Idiot, denn das Wellenrauschen meiner Oma hatte mein Heimweh schon häufig gelindert. Sie hatte über meine patzige Antwort gelacht, so als hätte sie es damals schon gewusst.
In der heutigen Nacht war es mir schwergefallen, alles aus meinem Kopf zu verbannen und nur den Wellen zu lauschen. Doch jetzt, wo ich das Meer endlich riechen konnte, schmeckte ich auch das Salzwasser auf meinen Lippen. Ich spürte, wie die Salzkristalle auf meinem Gesicht kribbelten, so als würde meine Haut gerade nach dem Schwimmen trocknen. Den Sand und das Wasser würde ich dieses Mal nicht an meinen Füßen fühlen, dafür war ich zu aufgewühlt. Und ich würde auch das Haus meiner Oma nicht entdecken. Das gelang mir äußerst selten, aber es machte mich jedes Mal wahnsinnig glücklich, die blaue Fassade und das Reetdach vor meinem inneren Auge in der Ferne auftauchen zu sehen. Dann rannte ich barfuß und gegen den Wind darauf zu und manchmal kam ich nah genug, um Oma auf der Veranda sitzen zu sehen, bevor ich einschlief. Oder aufwachte. Ich konnte im Nachhinein nie sagen, welche von meinen Eindrücken ich dem Zaubertrick meiner Oma zu verdanken hatte und welche im Traum zu mir gekommen waren. Mit Sicherheit sagen konnte ich nur, dass ich schon unzählige Male mit der Sehnsucht nach dem Meer und meiner Oma zu Bett gegangen, aber noch nie damit eingeschlafen war.
Bis heute.
Die Erinnerung an den zerbrechenden Spiegel ließ mich unter der Bettdecke zusammenfahren. Der Nachhall des klirrenden Schepperns, das mich in meinem neuen Zimmer erwartet hatte, schnitt durch das Rauschen der Wellen und das Salz auf meinen Lippen und Wangen war plötzlich nur noch eine trockene Tränenspur. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass ich geweint hatte.
„Spiegelscherben bringen Unglück“, flüsterte ich heiser in die Dunkelheit. Obwohl ich eigentlich nicht abergläubisch war, war ich mir plötzlich sicher, dass es stimmte. Jetzt konnte ich mich nicht mehr dagegen wehren, dass mein Kopf sich wieder mit sämtlichen Erinnerungen des Tages füllte. Da war die abgestandene und nach Zitronenputzmittel riechende Luft des Schultraktes, den ich ganz alleine bewohnte. Meine schweißnassen Hände, mein blasses Gesicht von Glasrissen entstellt. Der Rundgang mit Till Strauss und sein endloses Gerede über die Musiker in seiner Familie. Die ganze Zeit über hatte ich panische Angst gehabt, er würde mich nach meiner Familie fragen. Unter meinen Verwandten gab es niemanden, der musikalisches Talent besaß – geschweige denn sich für mein Geigenspiel interessierte. Ich vermutete fast, meine Eltern hatten mich nur an dieses Musikgymnasium geschickt, um durch das Stipendium Geld zu sparen und in der winzigen Doppelhaushälfte etwas mehr Platz zu haben. Was ich ihnen kaum verübeln konnte. Glücklicherweise war es Till nicht in den Sinn gekommen, mich überhaupt irgendetwas zu fragen. Er war durch die Schule stolziert, als wäre sie sein Königreich, hatte den Schülern und Lehrern mit wichtiger Miene zugenickt und mich überall als Theresia vorgestellt. Ich hatte noch nicht einmal den Mut aufgebracht, erneut die Kurzform meines Namens anzubieten. Stumm war ich Till hinterhergeschlichen und hatte mich gelegentlich an einem Lächeln versucht, bis mein Kiefer schmerzhaft protestiert hatte. Dabei hatte ich mir so fest vorgenommen, mutig zu sein, Interesse zu zeigen und Freundschaften zu schließen. Ich wollte es besser machen als auf meiner alten Schule. Stattdessen war ich so eingeschüchtert von meinen gut gekleideten und tuschelnden Mitschülern gewesen, dass ich den Blick nur selten von meinen Füßen gehoben hatte. Trotz der ausgiebigen Führung hatte ich kaum etwas von Sankt Engelbert gesehen und mir auch nicht die Wege zu den Büros der Lehrer, zur Aula, dem Speisesaal oder den Unterrichtsräumen gemerkt. Wenn ich daran dachte, wie ich mich an meinem ersten Schultag morgen zurechtfinden sollte, schnürte sich mir die Kehle zu.
Ich hatte Angst. Noch mehr Angst als vor der Klassenfahrt damals. Denn das hier waren nicht nur fünf Tage. Ich würde drei volle Jahre auf Sankt Engelbert verbringen, bis ich meinen Abschluss hatte. Und das war mit bloßem Absitzen der Zeit nicht getan. Till Strauss war nicht müde geworden, mich daran zu erinnern, dass wir uns auf einer elitären Musikschule befanden und dass man von den Schülern dieses Internats Engagement und Leistung erwartete. Die Vorstellung, in wenigen Stunden schon vor meiner neuen Geigenlehrerin vorspielen zu müssen, ließ Übelkeit in mir aufsteigen und meine Augen brennen.
Ich hielt erneut beide Hände an meine Ohren, doch da waren nur mein hämmerndes Herz und mein unkontrollierter Atem zu hören. Also vergrub ich das Gesicht im Kissen und begann zu schluchzen, denn hören würde mich auf diesem verlassenen Flur ohnehin niemand.
Ich war allein. Omas Zaubertrick hatte versagt. Gegen das Pech des zerbrochenen Spiegels kam er nicht an.
Kapitel 4 – Felix
Ich liebte Sankt Engelbert bei Nacht. Wie sich langsam die Stille über die alten Gemäuer der Burg senkte, bis nur noch der Wind zu hören war, der durch die Ritzen im Mörtel pfiff. Wie die Lichter der Schlafzimmer erstarben und der Weg durch die Flure nur noch durch den Schein des Mondes beleuchtet wurde.
Es war ein großartiges Gefühl.
Schon als kleiner Junge hatte ich mich nie vor der Dunkelheit gefürchtet. Ich hatte bereits früh damit angefangen, mir die große Taschenlampe meines Vaters aus seinem Büro zu stibitzen und unser Haus bei Nacht zu erkunden. Auf einmal waren dort keine Besenecken mehr gewesen oder langweilige Freiräume zwischen Schränken und unter der Treppe – nein, jetzt waren dort mystische Wesen versteckt, Übergänge zu anderen Welten und jede Menge Abenteuer für mein fünfjähriges Ich.
Und diese Faszination für die Nacht hatte ich mir über die Jahre bewahrt. Als ich also den langen Flur meines alten Schlaftraktes entlang ging, senkte sich eine angenehme Ruhe über meine Gedanken. Beinahe konnte ich die wohlige Gänsehaut spüren, die sich früher in solchen Situationen über meine Arme und den Nacken gezogen hatte.
Dabei war der nächtliche Zauber meines Elternhauses nicht einmal ansatzweise mit dem des Sankt Engelbert zu vergleichen. Eine alte Burg, vor Jahrhunderten erbaut, barg so viel mehr Geheimnisse als der moderne Neubau in dem kleinen Dorf, in dem meine Familie lebte. So viele Dinge waren hier geschehen, so viele Menschen waren im Laufe der Zeit durch die Gänge gewandert.
Während meiner ersten Nacht in der Schule hatte ich es nicht einmal zwei Stunden im Bett ausgehalten, bevor ich die Decke zurückgeschlagen und meinen ersten Streifzug durch die leeren Flure begonnen hatte. Das Kribbeln eines Abenteuers war so stark gewesen wie noch nie in meinem Leben.
Das, was ich jetzt fühlte, war nicht mehr ganz das Gleiche. Es war das Gefühl eines Jungen, der fast erwachsen war, kein kleines Kind mehr mit einer blühenden Fantasie. Aber immerhin konnte ich mich noch gut daran erinnern, wie es damals gewesen war, und der Gedanke trieb mir ein Lächeln ins Gesicht.
Es war gerade Vollmond, das silberne Licht schien durch die großen Fenster im fast leeren Trakt. Eine faszinierende Kulisse, durch die ich mit lautlosen Schritten schlich. Und während ich vor mich hinwanderte, kam das neue Mädchen mir wieder in den Sinn. Wie war ihr Name gewesen?
Thea.
Ich fragte mich, ob sie den öden Rundgang mit Till Strauss überlebt hatte. Ob er ihn überlebt hatte, denn an ihrer Stelle wäre ich ihm wahrscheinlich nach den ersten Minuten bereits an die Gurgel gegangen. Obwohl Thea nicht wie jemand wirkte, der körperliche Gewalt anwandte, wollte ich nicht von meinem ersten Eindruck darauf schließen. Und wenn ich ehrlich war, wünschte ich mir auch ein wenig, dass sie Till Strauss gezeigt hatte, wo die Geige hing.
Wie ich so über sie nachdachte, trugen mich meine Füße fast automatisch Richtung Westflügel, und als ich um die Kurve bog, war ich auch schon im Flur ihres Schlafzimmers.
Wie immer beschlich mich beim Betreten des Gangs ein seltsam niederdrückendes Gefühl, das unangenehme Erinnerungen in meinem Inneren hervorbrachte. Außerdem hing hier nicht nur die wohlige Stille der Nacht in der Luft. Ganz im Gegenteil.
Ich runzelte verärgert die Stirn. „Juli! Was machst du da?“
Der kleine Unruhestifter zuckte erschrocken zusammen, als er meine Stimme hörte. Gerade noch hatte er die Hand nach der Tür ausgestreckt, jetzt zog er den Arm schnell zurück und zeigte mir einen mehr oder weniger schuldbewussten Gesichtsausdruck.
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. „Wolltest du schon wieder die Neue erschrecken?“
Statt einer Antwort grinste er und entblößte dabei seine Zahnspange. Heute hatte ich allerdings nicht so viel Geduld mit ihm wie sonst.
„Sie ist gestern erst angekommen und hatte offensichtlich einen anstrengenden Tag. Kannst du ihr nicht zumindest eine ruhige Nacht lassen?“
„Es kommt so selten jemand her.“ Trotzig schob Juli die Unterlippe nach vorn. „Du gönnst mir überhaupt keinen Spaß. Echt nicht knorke.“
Ich verkniff mir einen Kommentar, sondern gab ihm nur einen knappen Schubs. „Los, verschwinde hier. Lass dem Mädchen ein bisschen Ruhe.“
Im Gang hinter uns erklang völlig unvermittelt eine dunkle Stimme: „Und außerdem solltest du dir Begriffe wie knorke verkneifen. Die sind nämlich überhaupt nicht mehr knorke.“
Juli streckte Jonah die Zunge raus, der gerade den Flur entlangkam und nur müde abwinkte. „Lass stecken, Kleiner.“
Ich packte beide am Arm und zischte: „Jetzt reicht’s aber echt. Könnt ihr nicht woanders rumgeistern? Hast du nicht gehört, dass wir eine neue Mitbewohnerin hier haben? Ein Mädchen, das wahrscheinlich gerade versucht, zu schlafen.“
Jonah zog die Augenbrauen hoch, sodass sie beinahe an seinen dunklen Haaransatz stießen. „Und was machst du dann hier, Chef?“
Darauf hatte ich keine schlagfertige Antwort. Zumindest nicht in der ersten Sekunde. Als ich schließlich doch den Mund öffnete, um etwas zu entgegen, wurde die Stille der Nacht von einem Geräusch durchbrochen. Es war leise, eigentlich kaum zu hören, aber es erschütterte mich trotzdem bis ins Mark.
Vergessen war der Ärger über meine Mitbewohner, als ich mich zu Theas Tür drehte und betroffen feststellte: „Sie weint.“
Als würde jemand eine geladene Pistole auf ihn richten, hob Juli blitzschnell die Arme. Sein Gesicht wirkte erschrocken. „Ich hab nichts gemacht!“
Jonah brummte nur. „Wir sollten hier abhauen. Es geht uns nichts an, und es ist auch nicht unser Problem.“ Mit dem Mitgefühl eines Eisschranks steckte er die Hände in seine Hosentaschen, drehte sich um und schlenderte den Gang entlang in die Richtung, aus der er gekommen war.
Juli schien von der Situation überfordert. Er verschränkte die Hände hinter dem Kopf und meinte mit trotziger Miene: „Aber morgen erschreck ich sie“, bevor er verschwand.
Ich konnte ihn nicht einmal zur Ordnung rufen. Mein Blick war gebannt auf Theas Tür gerichtet, hinter der sie wahrscheinlich in ihrem Bett lag und bitterlich weinte. Hatte Till Strauss etwas Unangebrachtes gesagt? Sie beleidigt? Oder war es das Heimweh, was viele in der ersten Nacht überfiel?
Jonah hatte recht. Es ging mich wirklich nichts an. Nichtsdestotrotz wollte ich diesem Mädchen aus irgendeinem Grund helfen. Vielleicht kam da der alte Schülersprecher in mir hoch, der niemals ein Problem hatte im Raum stehen lassen. Oder es war meine soziale Ader, wenn man es denn noch so bezeichnen konnte.
Nur wie sollte ich das anstellen?
Ich blieb noch wenige Momente vor der Tür stehen, dann gab ich mir selbst einen Ruck und setzte meinen Rundgang durch die alten Gemäuer des Sankt Engelbert fort.
Und der Mond wanderte mit mir.
Kapitel 5 – Thea
„Sankt Engelberts Aula ist 1750 von dem Errichter und Namensgeber dieses Anwesens, Joseph Engelbert I., als dessen persönliches Theater erbaut worden.“ Während seiner Ansprache auf der Bühne gestikulierte Dr. Herzog, als würde er ein Symphonieorchester dirigieren. Sein Blick flog stolz über die Schüler auf den rot gepolsterten Sesseln hinweg, streifte das Kollegium, das in den zwei kleinen oberen Rängen Platz genommen hatte, blieb kurz an dem Kristallleuchter und der mit Stuck verzierten Decke hängen, bevor er wieder zu seinem imaginären Orchester zurückkehrte. Entgegen meiner Angewohnheit saß ich in der ersten Reihe, denn es hatte mich so viel Überwindung gekostet, mein Zimmer zu verlassen, dass ich beinahe zu spät gekommen war. Das Frühstück hatte ich ausfallen lassen, denn mir war beim besten Willen nicht mehr eingefallen, wo sich der Speisesaal befand. Jetzt saß ich hier, genauso hungrig wie übermüdet, und klammerte mich an Gertis Geigenkoffer fest. Auch einige der anderen adrett gekleideten Schüler hatten Instrumentenkoffer bei sich und so fiel es zum Glück nicht auf, dass ich meine Geige nur mitgebracht hatte, weil sie mir Sicherheit gab. Da sie alt und nicht sonderlich hochwertig war, würde ich auf einem Leihinstrument spielen müssen.
Ich trug die einzige von Josis Hosen, die ich nicht mit Flicken, Knöpfen und Bändern hatte reparieren müssen. Sie war lang und schwarz, was hier anscheinend der Norm entsprach, leider etwas zu weit und streng genommen hatte ich sie meiner großen Schwester aus dem Kleiderschrank geklaut. Das würde sie allerdings nicht merken, solange sie Umstandsmode tragen musste. Also hatte ich noch bis Weihnachten Ruhe vor ihrem Gezeter.
Dr. Herzog berichtete von den musischen Gaben und der Leidenschaft für Musik und Tanz, die sich durch die Generationen der Dynastie Engelbert gezogen hatten. Mit leicht verklärtem Blick erzählte er von den pompösen Kostümfesten, die regelmäßig im Theater veranstaltet worden waren. Ich blinzelte gegen das Scheinwerferlicht und betrachtete sein streng zurückgekämmtes Haar, das voll und dunkel, aber bereits von silbernen Strähnen durchzogen war. Seine Augenbrauen waren dicht und nah beieinander, sodass sie seiner Miene etwas Energisches verliehen. Seine Zähne waren ein wenig zu weiß und wenn er sie zeigte, erreichte das Lächeln die braunen Augen nicht. Dr. Herzogs Stimme war angenehm tief und kräftig genug, um die Aula ohne Mikrofon zu füllen. Er war ein charismatischer Redner und es schien unmöglich, ihm nicht zuzuhören. Ich hatte mir noch keine Meinung darüber bilden können, ob ich den Direktor mochte, denn sein Verhalten schien eine andauernde Performance zu sein.
Da die Bühnenbeleuchtung hinter seinem Kopf mich blendete und seine ausladenden Gesten mich noch nervöser machten, als ich ohnehin schon war, fixierte ich meinen Blick schließlich auf seine glänzenden Lackschuhe, wodurch ich mir jedoch meiner ausgelatschten Sneaker umso bewusster wurde.
„Zu den Bällen auf Sankt Engelbert, das damals natürlich noch den Namen Schloss Engelbert trug, reisten nicht nur adlige Gäste aus aller Welt an. Die gesamte umliegende Stadt verkleidete sich zu diesen Anlässen und jeder, der ein prächtiges Kostüm zur Schau stellen konnte, durfte den spektakulären Festen beiwohnen. Im Sinne dieser Tradition veranstaltet unser Musikgymnasium wie ihr wisst immer zu Beginn der Ferien einen Kostümball, …“ Ein aufgeregtes Tuscheln ging durch die Reihen der Schüler und Dr. Herzog musste seine Stimme heben. „… mit dem das Kollegium die harte Arbeit und das Engagement seiner Schüler belohnt. Uns Lehrern ist bewusst, wie sehr ihr dem Halloweenball vor den Herbstferien entgegenfiebert und dass die meisten von euch jetzt schon mit der Planung ihrer extravaganten Kostüme begonnen haben.“ Das immer weiter anschwellende Murmeln der Schüler bestätigte diese Aussage und mir drehte sich beinahe der Magen um. Ich hatte es kaum geschafft, eine vernünftige Hose für dieses Schuljahr aufzutreiben. Wo sollte ich denn in den nächsten Wochen ein Kostüm herbekommen, das neben denen der anderen nicht vollkommen lächerlich aussah? Meine Eltern hatten mein Taschengeld halbiert, weil sie für Josis Baby sparen mussten. Das konnte ich ihnen nicht übelnehmen, denn ich wusste, wie groß ihre finanziellen Probleme waren. Doch bis zu den Herbstferien waren es kaum drei Monate und wenn ich mein Taschengeld bis dahin zu meinem kümmerlichen Ersparten addierte, kam ich gerade einmal auf vierzig Euro.
Das Gemurmel der Schüler ebbte ab und ich schielte nach oben, um zu sehen, wie Dr. Herzog gebieterisch die Hände hob. „Ich möchte euch an dieser Stelle daran erinnern, dass eine solche Festivität verdient sein will. Es ist in der Vergangenheit schon häufig vorgekommen, dass Schüler aus Gründen verschiedenster Art von den Feierlichkeiten ausgeschlossen werden mussten.“ Nach einer bedeutungsvollen Pause fuhr er mit der Geschichte von Sankt Engelbert fort und erzählte, wie der Schlossherr sich als Förderer der Künste hervorgetan und wie einer seiner Nachfahren die Musikschule gegründet hatte. „Lange Zeit verblieb der Westflügel noch im Besitz der Familie Engelbert, …“ Bei der Erwähnung meines Wohnflügels erfüllte erneut aufgeregtes Geflüster den Saal. „… aus der wie ihr wisst im Laufe der Jahrzehnte auch einige unserer besten Lehrer stammten. Bevor der Wohnflügel dann der Schule überschrieben und von Schülern bezogen wurde.“ Dr. Herzog räusperte sich betont laut, um die Schüler zur Ruhe zu mahnen. „Wir freuen uns darauf, diesen Wohntrakt, der zwei Jahrzehnte leer stand, nach einer aufwendigen Renovierungsphase zukünftig wieder in Betrieb nehmen zu können.“
„Hast du mitbekommen, dass da schon jemand eingezogen ist?“ Die Frage stammte von einem Mädchen, das direkt hinter mir saß. Ich neigte leicht den Kopf, um die Antwort ihrer Nachbarin besser verstehen zu können. „Ne, Quatsch. Alle, die dort einziehen sollten, haben ihre Anmeldung von Sankt Engelbert zurückgezogen.“
„Woher hast du denn den Blödsinn? Der Strauss hat erzählt …“
„Das Kollegium und ich hoffen, dass ihr der Tradition Sankt Engelberts die gebührende Würde erweist.“ Ich biss mir auf die Unterlippe, als Dr. Herzogs feierliche Stimme das Getuschel der Mädchen unterbrach. Hatten sie gerade von mir gesprochen? Was hatte Till ihnen erzählt? „Und dass ihr eure schulische und auch musikalische Ausbildung mit Strebsamkeit und Leidenschaft verfolgen werdet. Solltet ihr auf eurem Weg Problemen begegnen, die ihr nicht eigenständig lösen könnt, wendet euch bitte an unsere Vertrauenslehrerin, Frau Sanddorn. Ihr dürft euch nun zu euren Instrumentallehrern begeben, die euch die Stundenpläne für dieses Halbjahr aushändigen werden. Wie immer erwartet euch Herr Mühlmann in Raum E 15, Frau Fröhlich ist in Raum …“ Der Rest der Aufzählung ging gnadenlos im Lärm der hundertfünzig aufbrechenden Schüler unter. Insbesondere die Jüngeren waren bereits aufgesprungen und zum Ausgang gehastet. Was Geduld anging, waren wohl alle Schüler gleich – Privatschule hin oder her.
Ohne es zu merken, hatte ich mich ebenfalls erhoben und meine Arme fest um den Geigenkoffer geschlungen. Mein Herz hämmerte wie wild und ich blickte ratlos zwischen Dr. Herzog und den scherzenden und lachenden Schülern herum, die in einem chaotischen Pulk die Aula verließen. Ich wusste, dass Frau Fröhlich meine Instrumentallehrerin war, aber ich hatte nicht verstanden, in welchem Raum ich sie treffen sollte. Ein Mädchen mit Geigenkoffer schob sich an mir vorbei und ich öffnete den Mund, doch die Frage blieb mir im Hals stecken. Ich schluckte trocken und blickte zur Bühne, wo ich Dr. Herzogs fragenden Blick traf. Schnell wandte ich mich ab und hastete den anderen hinterher. Das war doch bescheuert! Ich konnte nicht einfach irgendjemandem folgen und hoffen, dass ich so zufällig zur richtigen Lehrerin kam. Ich musste nach dem Weg fragen.
Während ich mit zitternden Knien in die Masse der Schüler eintauchte, sah ich mich nach Till um. Er war Schülersprecher, ihn konnte ich fragen. Es war schließlich seine Aufgabe, den anderen Schülern zu helfen. Doch ich konnte den stämmigen Jungen mit dem dunklen Haar nirgends entdecken. Stattdessen rempelte ich ein Mädchen an, weil ich übersah, dass der Strom der Schüler sich am Ausgang der Aula staute. „Pass doch auf“, zischte sie genervt und ich wich vor ihrem giftigen Blick zurück, als hätte sie mich gestoßen. Dabei trat ich rückwärts einem Jungen auf den Fuß. Erschrocken fuhr ich herum, sah nur ein Hemd und eine seidig glänzende Krawatte und hatte noch nicht einmal den Mut, dem Geschädigten ins Gesicht zu blicken. „Alles in Ordnung bei dir?“
„Ja“, stieß ich viel zu laut und beinahe aggressiv hervor.
„Kann ich dir helfen?“
Statt einer Antwort, bekam er nur ein gepresstes „Entschuldigung.“ und ich stürmte an den beiden vorbei nach draußen.
„Was ist denn mit der los?“, hörte ich das Mädchen noch murmeln.
Berechtigte Frage. Was war eigentlich mit mir los? Da bot mir schon jemand seine Hilfe an und ich lief einfach weg.
Mein Gesicht pulsierte heiß vor lauter Ärger über mich selbst und mein Atem ging flach und unregelmäßig, als ich mich von den Schülern durch einen Trakt ziehen ließ, der die Aula mit dem weitläufigen Foyer verband. Dort verlor sich die Menschenmasse in kleinen Grüppchen. Manche eilten die breite Treppe hoch, andere verschwanden gemächlichen Schrittes in den seitlichen Gängen. Ich blieb wie angewurzelt in der Mitte der Eingangshalle stehen. Keiner nahm Notiz von mir. Zweimal lief jemand so nah an mir vorbei, dass ich beinahe nach dem Weg gefragt hätte, doch meine Stimme versagte mir den Dienst.
Schließlich war ich allein.
Ich seufzte resigniert und ließ die Schultern hängen. Langsam löste sich meine schweißnasse Umklammerung um den Geigenkoffer und ich ließ die vor Anspannung schmerzenden Arme sinken. Ich betrachtete meine löchrigen Sneaker. Wenn ich schon damit überfordert war, überhaupt zu meiner Geigenlehrerin zu finden, wie um alles in der Welt sollte ich dann den Anforderungen gewachsen sein, die eine Eliteschule wie das Engelbert an seine Schüler stellte? Der Vorsatz, eine Musterschülerin zu sein, hatte mir vor meiner Anreise noch Mut gemacht. Jetzt kam er mir lächerlich vor. Mein Magen zog sich krampfhaft zusammen. Ich wusste nicht, ob es an dem verpassten Frühstück oder dem verpassten Treffen mit meiner Lehrerin lag.
„Hast du dich verlaufen?“
Ich fuhr zusammen und starrte die junge Frau erschrocken an, die gerade die Treppe hinabschwebte. Sie trug einen schwarzen Stiftrock und eine weinrote Bluse. Das honigblonde Haar fiel ihr in leichten Wellen über die Schulter und die warmen Augen musterten mich aufmerksam. Sie war hübsch und strahlte eine überaus sympathische Aura aus.
„Ich …“ Mehr kam mir nicht über die Lippen.
„Mein Name ist Hannah Sanddorn. Ich bin die Vertrauenslehrerin auf Sankt Engelbert.“ Lächelnd kam sie vor mir zum Stehen. „Du bist neu hier, nicht wahr? Wie heißt du denn?“
Ungläubig betrachtete ich die elegante Erscheinung der Lehrerin. Ihr seidiges Haar, den perfekten Lidstrich, die sorgfältig nachgemalten Lippen. Als wäre ich mir nicht schon ungepflegt genug und absolut fehl am Platz vorgekommen.

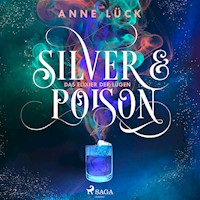
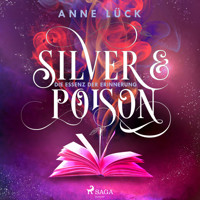
![Jewel & Blade. Die Wächter von Knightsbridge [Band 1 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ce22490997b3e6e0e807c8b632e07b21/w200_u90.jpg)




![Jewel & Blade. Die Hüter von Camelot [Band 2 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c7d0b6bb9c33b9a1b2b09f490d3cfe2a/w200_u90.jpg)