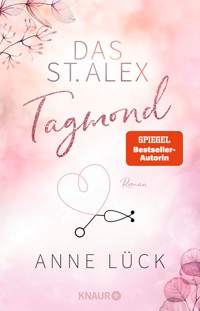9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Berlin-in-Love-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Der Anfang von etwas Wunderschönem »Versprich mir Morgen« ist der erste New-Adult-Roman der gefühlvoll-romantischen Berlin-in-Love-Dilogie um große Träume, Freundschaft und erste Liebe von Bestseller-Autorin Anne Lück. Als Alica am Wohnheim ihrer Krankenpflegeschule in Berlin eintrifft, schlägt ihr das Herz bis zum Hals. Sie hat ihr bisheriges Leben und ihre wohlhabenden Eltern in München zurückgelassen, um eine Ausbildung als Krankenpflegerin in Berlin anzufangen … und um Felix wiederzufinden. Felix – ein Krankenpfleger am dortigen Krankenhaus, der in einer schwierigen Zeit für sie da war und dessen warme Augen Alica einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Nie hätte Alica zu hoffen gewagt, dass sie sich in ihrer WG im Wohnheim gleich so wohl fühlt. Besonders mit Emilia und deren Zwillingsbruder Lio versteht sie sich sofort sehr gut. Ihre Freundschaft macht die erste Zeit in der anspruchsvollen Ausbildung um einiges leichter. Dabei kommen sie und Lio sich langsam, aber sicher immer näher. Doch dann trifft Alica auf Felix … und ihre Gefühle geraten völlig durcheinander … In ihrer New-Adult-Dilogie erzählt Bestseller-Autorin Anne Lück die Geschichte angehender Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die sich eine WG und den fordernden Ausbildungsalltag teilen und füreinander beste Freundinnen und Freunde werden – oder mehr … Entdecke auch den zweiten Roman der New-Adult-Dilogie, »Zeig mir Für immer«, in dem sich Emilia in den Onkologie-Überflieger Jasper verliebt, der selbst bisher noch nie romantische Gefühle hatte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anne Lück
Versprich mir Morgen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Alica am Wohnheim ihrer Krankenpflegeschule in Berlin eintrifft, schlägt ihr das Herz bis zum Hals. Sie hat ihr bisheriges Leben und ihre wohlhabenden Eltern in München zurückgelassen, um eine Ausbildung als Krankenpflegerin in Berlin anzufangen … und um Felix wiederzufinden. Felix – ein Krankenpfleger am dortigen Krankenhaus, der in einer schwierigen Zeit für sie da war und dessen warme Augen Alica einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Nie hätte Alica zu hoffen gewagt, dass sie sich in ihrer WG im Wohnheim gleich so wohl fühlt. Besonders mit Emilia und deren Zwillingsbruder Lio versteht sie sich sofort sehr gut. Ihre Freundschaft macht die erste Zeit in der anspruchsvollen Ausbildung um einiges leichter. Dabei kommen sie und Lio sich langsam, aber sicher immer näher. Doch dann trifft Alica auf Felix … und ihre Gefühle geraten völlig durcheinander …
Der erste eigenständige Band der romantischen Berlin-in-Love-Dilogie.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Charakterillustrationen
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Danksagung
Für die wunderbaren Menschen in meiner Ausbildung und im Wohnheim, in denen ich sehr viel Inspiration für dieses Buch gefunden habe.
Kapitel 1
Alica
An einem der Balkone im vierten Stock des Wohnheims hing ein Typ, der nur mit einem Handtuch bekleidet war.
Ich war gerade auf den schmalen Gehweg getreten, der von der Straße aus zu dem kleinen Gebäude hochführte, als er mir ins Auge fiel. Es war spät am Nachmittag, kurz nach vier Uhr, aber hier in der Gegend waren trotzdem kaum Menschen unterwegs. Schon als ich mit dem Taxi durch die Straßen von Tegel immer weiter an den äußeren Rand des Viertels gefahren war, war mir das aufgefallen. Berlin war hier heute wie leer gefegt – abgesehen von mir und dem Handtuchtypen da oben.
Stirnrunzelnd blieb ich stehen und legte den Kopf in den Nacken, während ich die große Tasse mit der kleinen Erdbeerpflanze darin an mich drückte. Was zum Teufel tat er da oben?
Der Kerl hatte gerade ein Bein um die Abtrennung zwischen zwei Balkonen geschlungen, und das weiße Handtuch um seine Hüfte wehte im warmen Herbstwind. Er hatte es fest genug um sich gebunden, sodass er nicht mehr zeigte, als eh schon frei war – definierte Arme, angespannte Rückenmuskeln und schwarze Haare, die seinen Nacken umschmeichelten, als er sich etwas von der Brüstung des Balkons abstieß. Außerdem wanden sich überall über seine Haut Tattoos. Schwarze Linien, dunkle Ringe um seine Arme, kleine Figuren, die ich aus der Ferne nicht erkannte, einzelne Wörter, die von hier unten ebenfalls nicht lesbar waren.
Ein paar Momente hing er in der Luft, und ich merkte, dass ich den Atem angehalten hatte. Er fällt gleich, fuhr es mir durch den Kopf. Er fällt gleich vier Stockwerke in die Tiefe. Aber das tat er nicht. Stattdessen drehte er den Körper beinahe elegant, sein Fuß berührte die Brüstung des anderen Balkons, und dann sprang er ganz leichtfüßig in Sicherheit. Nur in ein Handtuch gekleidet hatte er es geschafft, sich wie Tarzan von einem Balkon auf den anderen zu schwingen. Eine beeindruckende Leistung, warum auch immer er das getan hatte.
Als sich der Schreck ein wenig von mir löste, bewegten sich meine Hände wie von selbst. Ich klemmte die Erdbeerpflanze zwischen Arm und Brust und klatschte, als wäre ich bei einer Zirkusvorstellung.
Bravo, du hast überlebt.
Der durchtrainierte Rücken des Typen spannte sich an, als das Geräusch zu ihm nach oben schallte, und kurz darauf fuhr er zu mir herum. Zu sehen bekam ich dadurch eine ansehnliche, braun gebrannte Brust und einen flachen Bauch, beide ebenfalls mit Tattoos verziert. Das konnte ich selbst auf die Distanz sehr gut ausmachen.
Eine Sekunde lang starrte er mich beinahe ein wenig erschrocken an, ehe seine Mundwinkel nach oben wanderten. Sein Grinsen erhellte sein ganzes Gesicht, und dann trat er an die Brüstung und hob die Arme. Wie ein Preisboxer, der sich nach seinem Sieg von der Menge feiern ließ.
Mir entfuhr ein Lachen, und ich ließ die Hände wieder sinken. Er zwinkerte mir noch einmal zu und verschwand schließlich im Inneren des Zimmers, das hinter dem Balkon lag. Erst in diesem Moment wurde mir klar, dass ich vielleicht jemandem applaudiert hatte, der gerade ein Verbrechen beging. War er in einem anderen Zimmer eingebrochen?
Unwahrscheinlich, nur mit einem Handtuch bekleidet.
Dann vielleicht aus einem Bett geflohen? Weil ein Partner unerwartet zurückgekommen war?
Ich schüttelte den Kopf und beschloss, dass das eher nicht mein Problem war. Direkt an meinem ersten Tag in Berlin wollte ich meine Nase ganz sicher nicht in Angelegenheiten stecken, die mich in Schwierigkeiten bringen konnten. Aber zumindest hatte diese skurrile Szene dazu geführt, dass ich nun mit einem Schmunzeln auf die Tür des Wohnheims zuging. Die Nervosität, die mich beim Aufwachen heute Morgen überfallen und seitdem nicht mehr losgelassen hatte, war beinahe komplett aus meinem Kopf verschwunden.
Mit etwas mehr Zuversicht, als ich sie vor ein paar Minuten noch gehabt hatte, drückte ich die Tür auf und trat in den lichtdurchfluteten Flur. Meine große Sporttasche schnitt ein wenig in meine Schulter ein, so voll hatte ich sie gestern Abend gepackt, und auch der Koffer ließ sich nur schwer über den Fliesenboden bewegen. Doch irgendwie schaffte ich es, vorbei an einem kleinen, geschlossenen Kiosk und der Reihe an Briefkästen, auf denen einige Namen den Zusatz »Dr.« davor hatten, dann stand ich endlich vor dem Aufzug.
Er ratterte nur langsam aus dem obersten Stockwerk nach unten, und das gab mir einen Augenblick, um durchzuatmen und mein Handy aus der Jeans zu ziehen. Ich rief die E-Mail auf, die ich vor zwei Wochen bekommen hatte, und scrollte bis zu dem Absatz »Einzug im Wohnheim« runter. Mein Magen kribbelte vor Aufregung, als ich die Worte überflog. Es war immer noch absurd, was hier gerade passierte. Was ich hier machte, so weit weg von zu Hause. Von meiner Familie. Von allem, was ich kannte und was mir vertraut war.
Als ich gestern mit dem Zug in Berlin angekommen war, war ich mir ein wenig wie ein Alien vorgekommen, weil es so anders war als München. Dreckiger irgendwie. Chaotischer, was vor allem an den vielen vollkommen unterschiedlich aussehenden Menschen lag. Aber irgendwie auch lebendiger. Summender. Voller Straßenmusiker und Geschrei und Lachen, voller Baustellenlärm und lauten Gesprächen in allen möglichen Sprachen. Es war schwer zu beschreiben, aber die Stadt hatte mich sofort gleichzeitig angezogen und abgestoßen. Wie ein Magnet, der beide Pole auf der gleichen Seite hatte.
Und auch jetzt pochte mein Herz laut in meiner Brust.
»Erster Stock«, wiederholte ich das, was in der Mail stand, um mich irgendwie selbst zu beruhigen. »Karl Schulz, der Hausmeister, hat den Zimmerschlüssel. Einfach dort melden.«
Die Aufzugtüren gingen auf, und ich zog den Koffer in den kleinen, beleuchteten Kasten. Von den verspiegelten Wänden blickte mir mein Gesicht entgegen, und ich versuchte, die blonden Haare etwas zu ordnen. Es war kein guter Tag für einen Bad Hair Day, aber ich hatte sie heute nicht einmal mit einem geflochtenen Zopf bändigen können. Jetzt, zwanzig Minuten nachdem ich das Hotel verlassen hatte, sprangen mir schon wieder einzelne Haare aus allen Richtungen ins Gesicht und in die Luft. Ich sah so chaotisch aus, wie Berlin sich anfühlte. Aber vielleicht passte ich damit jetzt ein bisschen besser hierher.
Ich strich mir ein paar der Strähnen aus den grünen Augen, glättete die glänzende Bluse und atmete tief durch. Alles wird gut. Du kriegst das hin.
Als die Aufzugtüren sich im ersten Stock wieder teilten und ich nach meinem Koffer griff, hallte mir eine laute Stimme aus dem Flur entgegen.
»… muss es doch einen Weg geben«, flehte jemand, dem Klang nach eine junge Frau.
Ein Mann antwortete in genervtem Tonfall: »Ich habe deinem Bruder schon dreimal gesagt, dass er den Kopf zusammennehmen soll. Er hat bereits den Zweitschlüssel, weil er den ersten irgendwo verloren hat. Und jetzt schon wieder so etwas.«
Ich zog den Koffer in den Flur und sah mich um. Das Treppenhaus war eng und dunkel, aber von der linken Seite fiel ein Sonnenstrahl auf den gefliesten Boden. Die Tür auf dieser Seite stand offen und führte zu einem weiteren Flur mit weiteren Türen. Die Stimmen kamen aus dieser Richtung.
Neugierig warf ich einen Blick um die Ecke.
Ein paar Meter entfernt stand eine junge Frau im Flur. Ich schätzte sie auf etwa mein Alter – neunzehn, höchstens zwanzig Jahre. Sie schüttelte gerade den Kopf und quetschte etwas in ihrer Hand, das vielleicht ein plüschiger Stressball war. »Karli, was glaubst du denn, wie oft ich ihm das schon gesagt habe? Ich bin am Ende meines Lateins. Und es tut mir leid, dass ich zu dir kommen muss, aber was soll ich denn sonst tun? Er hat sich ausgeschlossen und steht jetzt nur im Handtuch oben im Flur. Du musst ihm das Zimmer aufbrechen. Bitte.«
Der Mann, den ich nicht sehen konnte, weil er in einem der offenen Zimmer stand, schnaubte belustigt.
»Hat dein Bruder schwarze Haare?«, fragte ich, während ich auf sie zuging. »Und Tattoos auf dem ganzen Oberkörper?«
Verwirrt sah sie mich an. »Ja?«, sagte sie schließlich gedehnt.
»Dann hat er sein Problem schon selbst gelöst.« Grinsend deutete ich mit dem Finger nach oben. »Ich habe gerade draußen gesehen, wie er von einem Balkon auf den anderen geklettert ist.«
Innerhalb eines Herzschlages wurde das Mädchen noch blasser, als es eh schon war. »Nein«, hauchte sie.
»Doch.« Ich nickte.
»Nur im Handtuch?«
»Nur im Handtuch«, bestätigte ich.
Sie starrte mich völlig entsetzt an. Eine Mischung aus kratzigem Lachen und Raucherhusten drang aus dem Zimmer, vor dem die junge Frau stand. Nur eine Sekunde später steckte ein älterer Mann mit schulterlangen rötlichen Haaren und unordentlichem Bartwuchs den Kopf nach draußen. Er funkelte mich amüsiert an, bevor er sich wieder der Frau zuwandte. »Sieht aus, als müsste ich das Zimmer nicht aufbrechen. Sind doch gute Nachrichten, oder, Emilia?«
»Ich werde ihn umbringen«, sagte die junge Frau, Emilia, und fuhr sich durch die hellbraunen Locken, bevor sie ein Handy aus ihrer Tasche zog und wütend darauf herumhackte.
»Ist ja anscheinend alles gut gegangen«, beruhigte Karli sie. Karl Schulz, der Hausmeister, vermutete ich. Er sah mich fragend an. »Oder?«
Ich beeilte mich, zu nicken. »Er ist heil angekommen.«
»Siehst du. Kein Grund zur Panik, Emilia.« Karli lachte, es ging wieder in ein Husten über, bevor er den Blick über meine Taschen schweifen ließ. »Ah, noch eine neue Auszubildende?«
»Ja, richtig. Ich sollte mich heute hier melden und meinen Schlüssel holen.«
Seine Augenbrauen zuckten nach oben. »Name?«
»Alica Mangold.«
Er nickte und verschwand wieder in seinem Zimmer.
Emilia, die sich in ihrer Erleichterung an die Wand im Flur gelehnt hatte, drehte sich wieder zu mir. Eine Weile musterte sie mich neugierig, und ich fragte mich, ob es an meinem Aufzug lag. Ich hatte mich bemüht, nicht allzu offensichtliche Designerteile anzuziehen. Mein Kleiderschrank bot leider nicht viel anderes, also hatte ich das genommen, womit ich an meinem ersten Tag nicht auffallen würde. So, wie ihr Blick über die schicke Bluse wanderte, war mir das aber nicht besonders gut gelungen.
Schließlich sah sie mir wieder in die Augen. Sie presste die Lippen zusammen, und es wirkte, als würde sie kurz mit sich ringen. Wieder malträtierte sie das Etwas, vermutlich eine Art Stressball, in ihrer Hand. Dann erst kamen ihr gequält die Worte über die Lippen: »Hat man von unten …? War irgendetwas …?«
»Man hat nichts gesehen«, gab ich auf der Stelle zurück. »Nichts, was das Handtuch verdecken sollte, zumindest.«
Sie starrte mich an. Ich starrte zurück. Und dann konnte ich nicht mehr an mich halten. Ich musste lachen über diese wahnsinnig skurrile Situation, und glücklicherweise stimmte Emilia nach einer Sekunde mit ein. Sie fasste sich an die Stirn und schüttelte wieder den Kopf. »Er macht immer so einen Mist. Ohne über die möglichen Konsequenzen nachzudenken. Ich weiß nicht, was ihn dann immer reitet.«
Ihre Worte lösten ein Bild in meinem Kopf aus, das ich eigentlich hatte aus meinem Gedächtnis löschen wollen. Ich biss mir auf die Unterlippe. »Ja. Mit verantwortungslosen Geschwistern kenne ich mich leider nur zu gut aus.«
Einen Moment wirkte Emilia so, als würde sie nachhaken wollen. Aber dann stockte sie, nickte nur und stieß sich von der Wand ab. Ich wusste nicht, ob es Schüchternheit war, weil wir uns gerade erst begegnet waren, oder ob es ihr vielleicht unangenehm war, dass es hier um ihren Bruder ging. Beide Fälle konnte ich gut nachvollziehen – immerhin war ich selbst nicht besonders gut darin, neue Freundschaften zu schließen, und wenn ich erst an meine eigene Schwester dachte und an ihr unverantwortliches Verhalten …
Emilias Blick klebte schon wieder an ihrem Handydisplay, wahrscheinlich machte sie ihrem Bruder gerade die Hölle heiß. Jetzt erst erkannte ich, dass das Ding in ihrer Hand kein Ball, sondern ein kleiner grüner Plüschfrosch mit schwarzen Knopfaugen war.
»Alica Mangold, da haben wir sie ja.« Im Zimmer des Hausmeisters erklang ein helles Klirren, bevor er den Kopf wieder nach draußen steckte und mir lächelnd die Schlüssel hinhielt. »Zimmer 401. Damit seid ihr dann wohl jetzt komplett, Emilia.«
»Danke«, sagte ich an den Hausmeister gewandt und griff nach dem silbernen Ring, an dem zwei Schlüssel hingen – ein großer, vermutlich der Zimmerschlüssel, und ein kleiner, der sicher für den Briefkasten war.
»Du bist auf unserem Flur«, erklärte Emilia, und ihr Lächeln wirkte ein wenig schüchterner als noch zuvor. »Falls also irgendwann mal an deinem Balkon jemand Halbnacktes vorbeiklettert, weißt du, dass es mein Bruder ist.«
Ich steckte die Schlüssel in meine Jeanstasche und gluckste. »Solange ich ihn nicht von meinem Balkon FALLEN sehe, ist das in Ordnung, denke ich.«
Emilia winkte ab. Wie jemand, der so etwas schon gewohnt war und es langsam überdrüssig wurde, es zu rechtfertigen.
»Ich bin rund um die Uhr hier«, mischte sich Hausmeister Karli wieder in unser Gespräch ein. Er klopfte an den Rahmen seiner Tür. »Das hier ist mein Büro, da bin ich tagsüber. Und das …« Er deutete den Gang hinunter auf die nächste Tür. »Das ist das Zimmer, in dem ich schlafe. Falls nachts mal etwas sein sollte. Ausgesperrte Brüder, explodierende Mikrowellen, Waschbärenangriffe, das normale Zeug eben.«
Meine Augenbrauen schossen nach oben. »Waschbärenangriffe?«
Karli nickte, als wäre das das Normalste der Welt, und Emilia stöhnte wieder. »Wieso ist das eigentlich das Einzige in der Aufzählung, mit dem Lio nichts zu tun hat?« Sie winkte ab, bevor sie sich wieder an mich wandte. »Ich kann dir dein Zimmer zeigen, wenn du möchtest. Ich muss jetzt eh wieder da hoch.«
»Gern.« Ich schenkte Karli noch ein dankbares Lächeln, bevor ich Emilia zurück zum Aufzug folgte.
»Der Waschbär hat übrigens einen der offenen Balkone gekapert und sich an einer alten Pizza zu schaffen gemacht, bis der Bewohner des Zimmers aufgewacht ist«, erklärte sie müde und drückte auf den Knopf. »Es gab lautes Geschrei und angeblich eine Prügelei zwischen Mensch und Tier, bei dem der Waschbär gewonnen hat. Aber das sind alles nur Gerüchte, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht hier gewohnt. Brauchst du Hilfe mit deinen Taschen?«
»Äh, nein, danke«, gab ich zurück, noch ein wenig verwirrt von dem schnellen Themenwechsel. Ich hievte den Koffer zurück in den Aufzug, strich mir die wirren Haare aus dem Gesicht und sah dann wieder zu Emilia auf. »Eine Prügelei zwischen Mensch und Tier?«
»Ich bin sicher, dass Marlon ihn nicht wirklich geschlagen hat. Eigentlich hat er nur behauptet, dass der Waschbär ihn verprügelt hat.«
Um Himmels willen, wo war ich denn hier reingeraten? Meine Lippen verzogen sich wieder zu einem Grinsen. »Keine weiteren Fragen.«
»Ist auch besser so.« Emilia lehnte sich an die verspiegelte Wand und verschränkte die Arme vor der Brust. »Du fängst auch nächste Woche deine Ausbildung am Sankt Alex an?«
Ich nickte. »Ja, die für die Palliativ- und Onkologiepflege.«
»Deswegen haben sie uns wahrscheinlich auf das gleiche Stockwerk gepackt«, sagte sie. »Wir fangen auch nächste Woche an.«
»Wirklich? Irgendwie wirkte das eben, als wärt ihr schon etwas länger hier«, stellte ich überrascht fest.
Emilia zuckte mit den Schultern. »Mein Bruder Lio lebt schon seit einem Jahr hier im Wohnheim. Er hat mit ein paar Freunden im Alex sein FSJ gemacht. Ich bin wie du neu, aber ich habe ihn ab und zu besucht. Deshalb kenne ich mich hier ganz gut aus. Mit den Leuten, den Geschichten und mit Karli.« Sie lächelte wieder, und es war, als würde sich eine leichte Decke über die Ängste in mir legen. Über die Zweifel der letzten Monate, der letzten Wochen, die sich wie ein Parasit an meinen Magen geklammert hatten und so mein ständiger Begleiter waren. Über die Ungewissheit, was auf mich zukommen würde.
Als sich die Aufzugtüren teilten, zuckte ich trotzdem zusammen. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als würde sich eine völlig neue Welt auftun. Eine, für die ich mich entschieden, aber von der ich kein Rückfahrticket gebucht hatte. Etwas in mir wollte sich am Inneren des Aufzuges festhalten, wollte seine Sachen wieder packen und verschwinden. Zurück ins Taxi, zurück zum Bahnhof, zurück nach München.
Zurück zu meiner Familie.
Dann machte Emilia einen Schritt nach draußen und lächelte mich erneut über ihre Schulter an. Diesmal aufmunternd. »Willst du, dass ich dir alles zeige?«
Ich erwiderte ihren Blick und kratzte den letzten Rest Mut zusammen, den ich noch besaß, um zu nicken. »Das wäre großartig.«
Kapitel 2
Alica
Emilia zog die schwere Glastür auf, die das dunkle Treppenhaus, in dem sich der Aufzug befand, vom Flur trennte, und ließ mich mit meinen schweren Taschen zuerst durch. Es sah hier genauso aus wie im ersten Stock: mehrere Türen auf beiden Seiten des schmalen Flures und darüber kalte Neonröhren. An den Räumen auf der rechten Seite hingen Namensschilder, die mal mehr, mal weniger bunt ausgemalt waren.
»Dein Zimmer ist hier.« Emilia deutete auf die Tür schräg gegenüber dem Treppenhaus. Wieder verzogen sich ihre Lippen zu einem Lächeln. »Mein Zimmer ist direkt daneben. Und wie du von unten vielleicht sehen konntest, ist das Zimmer meines Bruders neben meinem. Der hat sich wahrscheinlich gerade wieder hingelegt, weil er die ganze Nacht feiern war.« Sie verdrehte die Augen, während wir an die Tür herantraten, die zu meinem Zimmer führte. Das Zimmer, in dem ich die nächsten zwei Jahre wohnen würde, wenn alles gut ging.
Ich spürte, wie mir ein Kloß in den Hals wanderte, als ich das dunkle Holz mit dem kleinen Spion auf Augenhöhe vor mir anstarrte. Das hier fühlte sich groß an. Wahrscheinlich fühlte es sich größer an, als es wirklich war, weil ich das erste Mal allein so weit von zu Hause weg war. Aber mein Innerstes vibrierte trotzdem vor Nervosität.
»Auf der rechten Seite des Flures sind nur noch die Zimmer von den anderen. Auf der linken Seite sind das Bad mit Toiletten und Duschen, dann die Küche und ganz hinten das Wohnzimmer. Waschmaschinen gibt es im Keller.« Emilia deutete auf die einzelnen Türen, dann drehte sie sich wieder zu mir um. Ein leichtes Zögern lag in ihrem Gesicht. »Willst du … alles sehen?«
Ich stellte meine Tasche auf dem Koffer vor dem Zimmer ab und nickte. »Wenn es dir nichts ausmacht«, sagte ich erleichtert darüber, dass ich auf diese Weise etwas hatte, das mich von meinen Gedanken ablenkte. Von den Zweifeln, ob das hier wirklich die richtige Entscheidung gewesen war, und davon, dass ich gleich das Zimmer betreten musste, das hoffentlich irgendwann ein Zuhause für mich sein würde.
»Ich muss ja irgendwie wieder den ersten Eindruck gutmachen, den du durch meinen Bruder bekommen hast.« Sie zuckte mit den Schultern und deutete dann in Richtung der Gemeinschaftsräume.
Ich folgte ihr langsam durch den weiten Flur, auch wenn ich ein wenig das Gefühl hatte, dass sie es nur aus Schuldbewusstsein tat. Ich wollte ihr ungern zur Last fallen, aber ich wollte gerade auch einfach noch nicht allein sein.
Die Bäder waren sehr einfach gehalten. Links zwei abschließbare Toiletten, auf der rechten Seite drei Duschkabinen. Die graugelben Fliesen waren noch feucht von der letzten Dusche, und ich versuchte, nicht auf den Schmutz in den Ecken und die Spinnweben an der Decke zu achten. Doch ich spürte, wie sich ein wenig Widerwillen in mir regte. Das hier … war definitiv anders als alles, was ich bisher gehabt hatte. SEHR anders. Bisher hatte ich mir mein Bad mit niemandem sonst teilen müssen, aber ich hatte gewusst, dass das mit dem heutigen Tag vorbei sein würde.
Lass dich darauf ein, schimpfte mich meine innere Stimme streng. Du wolltest dich auf alles einlassen, was jetzt kommt. Das hier war deine Entscheidung, also zieh sie jetzt durch.
Emilia führte mich weiter, schien jedoch nicht so recht zu wissen, was sie sagen sollte. Interessanterweise machte sie das in meinen Augen nicht unsympathisch – mit sozialen Unsicherheiten kannte ich mich schließlich aus. Ich hatte nie sonderlich viele Freunde gehabt und wusste selbst nicht, worüber ich mit Emilia sprechen sollte, auch wenn ich es eigentlich wirklich wollte. Oder aber sie hatte mich aufgrund meiner teuren Klamotten schon in die Schublade »verwöhntes Rich Kid« gesteckt.
Schweigend trottete ich ihr nach und versuchte, nicht zu viel darüber nachzudenken, sondern mich auf das Wohnheim zu konzentrieren.
Zum Glück sah die Küche weniger abschreckend aus als das Bad. Der Raum hatte hohe Fenster und war mit hellem Holz und weißen Schränken eingerichtet. Auf den vielen Regalbrettern waren bunte Tassen angeordnet, außerdem Gläser voller Nudeln, Reis, Haferflocken und billiger Cornflakes. So etwas hatte es zu Hause auch nie gegeben. Ich konnte beinahe meinen Vater mit strengem Blick vor mir stehen sehen, der mir einen Vortrag über Nahrungsmittel mit neunzig Prozent Chemie und Zucker hielt.
»Alles in Ordnung, Emmi? Ich habe dich eben fluchen hören, aber als ich nachgesehen habe, warst du schon weg.«
Erst als die Stimme erklang, bemerkte ich die junge Frau, die am Küchentisch saß. Sie hatte ein Bein an ihren Körper gezogen, ihre langen, hellen Haare fielen ihr nass über die Schultern, und sie lächelte uns über eine dampfende Tasse freundlich an.
»Lio. Frag besser nicht«, brummte Emilia, bevor sich ihr Gesicht wieder erhellte. »Das hier ist unsere neue Mitbewohnerin Alica.« Sie zeigte erst auf mich und dann auf die junge Frau in der Küche. »Das ist Filina, sie wohnt im Zimmer neben meinem Bruder Lio. Die beiden haben zusammen das FSJ gemacht, unter anderem mit Marlon. Sein Zimmer ist das ganz hinten auf dem Flur.«
Ich hob grüßend die Hand, und Filina legte ein wenig den Kopf schief.
»Willkommen im freundlichsten Chaos der Welt«, sagte sie.
»Klingt eigentlich ganz nett«, gab ich schmunzelnd zurück.
Sie nickte und richtete den Blick dann wieder auf das Tablet auf dem Tisch vor ihr.
Als Letztes zeigte mir Emilia noch das Wohnzimmer am Ende des Ganges. Darin standen drei völlig unterschiedliche Sofas mit großen und kleinen bunten Kissen um einen alten Fernseher herum. Es hingen unzählige Bilder an den Wänden, sodass man kaum noch die verputzte Wand dahinter sehen konnte, und auf dem kleinen Tisch in der Mitte lagen sicher zehn oder fünfzehn verschiedene TV-Zeitschriften.
»Hier ist es immer etwas unordentlich. Aber gemütlich, wenn man sich in dem Chaos wohlfühlt.« Emilia stemmte die Hände in die Hüften, als würde sie sich ärgern. »Versuch am besten gar nicht erst, hier Ordnung zu schaffen. Ist besser für dein Seelenheil, glaub mir.«
»Werde ich mir merken«, sagte ich grinsend. Ich war eh nicht so affin mit dem Putzen. Oder mit Aufräumen.
Sie wischte nachdenklich etwas Staub von einem der runden Kissen, das auf dem Sofa neben ihr lag. Dann sah sie wieder auf. »Das war’s dann eigentlich. Vielleicht hast du es schon gesehen, aber unten im Erdgeschoss gibt es noch einen kleinen Kiosk, bei dem du eigentlich alles bekommst, was du brauchst. Er wird von Karli betreut, hat aber nur vormittags und nachmittags je zwei Stunden geöffnet. Ansonsten …« Sie zuckte mit den Schultern. »War das der ganze Zauber. Brauchst du … noch irgendetwas?«
»Nein, danke«, wehrte ich verlegen ab. Ich hatte ihre Zeit mittlerweile wirklich genug beansprucht. »Ich werde erst mal auspacken und mich etwas ausruhen. Aber vielen Dank für die Führung und den netten Empfang.«
Emilia nickte, und wieder wanderte ihr Blick über meinen viel zu schicken Aufzug. Dann schüttelte sie den Kopf, und ihre Augenbrauen zogen sich zusammen wie Gewitterwolken. »Und ich werde meinem Bruder einen Vortrag über Balkonabstürze halten. Zum zweiten Mal diesen Monat, als würde sich dadurch irgendetwas ändern.« Sie seufzte, und ich musste wieder schmunzeln.
Ich folgte ihr den Flur zurück, und als sie an der Tür ihres Bruders stehen blieb, wandte sie sich noch einmal mir zu.
»Willkommen im Wohnheim, Alica«, sagte sie. »Du lebst dich bestimmt schnell ein.«
»Danke.« Ich lächelte sie an, bevor ich mein Zimmer aufschloss und meine Sachen hineinbeförderte. Als die Tür hinter mir zufiel, war ich allein in der Stille meiner eigenen fünfzehn Quadratmeter.
Ich seufzte tief und lehnte mich von innen an die Tür, um erst mal alles auf mich wirken zu lassen.
Es war verdammt eng hier drin. Ich hatte wahrscheinlich noch nie in meinem Leben einen so kleinen Lebensraum für einen ganzen Menschen gesehen. Aber wenigstens gab es hier nur wenige Möbel, die nicht zu viel Platz wegnahmen. Ein Einzelbett mit einem kleinen Nachtschrank, auf der anderen Seite ein Schreibtisch mit einem alten Drehstuhl. Direkt neben der Tür gab es noch einen winzigen Kleiderschrank, und ich war froh, dass ich nicht so viele Klamotten mitgenommen hatte. Ihm gegenüber, in einer kleinen Nische, hing ein Waschbecken an der Wand, und darüber ein Spiegel, aus dem mir mein blasses Gesicht entgegenstarrte. Außerdem war da ein kleiner Balkon, den ich schon von außen gesehen hatte. Mehr gab es hier nicht. Das war alles, was mir für die nächsten zwei Jahre gehören würde.
Einen Moment stand ich etwas unschlüssig an der Tür und versuchte, mich nicht von Angst überwältigen zu lassen. Es war eigentlich absurd, dass ich jetzt, da langsam Ruhe einkehrte, wieder nervös wurde. Vielleicht lag es daran, dass in diesem Zimmer alles plötzlich so schrecklich real wurde. Das hier war jetzt wirklich mein Leben. Für eine gewisse Zeit nur, aber noch vor einem halben Jahr hatte ich nicht einmal entfernt daran gedacht, dass es mal so aussehen könnte. Dass ich irgendwann mal in so einem kleinen, engen Zimmer leben würde. Aber so war das Leben nun einmal, was?
Die Tragweite meiner Entscheidung wurde mir mit einem Mal so bewusst, dass ich tief durchatmen musste. Ich ließ den Koffer und meine Tasche einfach stehen, stellte die große Tasse mit der Erdbeerpflanze darin aufs Fensterbrett und ließ mich anschließend auf die Bettkante sinken. Die Matratze war so dünn, dass ich beinahe direkt den Lattenrost darunter spüren konnte. Meine Hände zitterten, als ich das Handy aus meiner Jeans zog und das Display entsperrte.
Die rote Eins einer ungelesenen Nachricht leuchtete mir entgegen. Ich wusste, dass sie von meiner Mutter war, doch ich hatte sie bisher ignoriert, weil ich Angst vor ihren Worten gehabt hatte. Jetzt nahm ich meinen Mut zusammen und öffnete den Chatverlauf.
Ich weiß, Papa kann sehr stur sein, und er sagt gerade noch etwas anderes – aber ich hoffe, dir ist bewusst, dass du jederzeit zurückkommen kannst. Überleg dir das alles gut, Alica. Es geht hier um deine Zukunft.
Ein dumpfer Schmerz breitete sich in meiner Brust aus, und ich versuchte, ihn mit meiner freien Hand wegzureiben. Gerade als ich die Nachricht schloss, ploppte eine neue auf. Diesmal von meiner Schwester Viktoria. Eigentlich rechnete ich schon mit einer Stichelei, doch sie schrieb nur:
Und, hast du deinen Prinzen schon getroffen? ;-)
Und natürlich mit einem dieser Smileys, den mittlerweile eigentlich nur noch alte Leute benutzten.
Ich schnaubte, ließ mich rücklings auf das Bett fallen, und tippte zurück:
Natürlich nicht. Was denkst du denn? Dass er mir schon am ersten Tag vor die Füße fällt?
Ihre Worte lösten trotzdem etwas in mir aus. Ein leichtes Kribbeln, das sich langsam und warm von meinem Bauch bis in meine Zehenspitzen ausbreitete. Eine Vorfreude, von der ich mich nicht komplett einnehmen lassen wollte.
Ich sah, wie Viktoria tippte, und kurz darauf ploppte der nächste Text auf meinem Display auf:
So läuft das doch in den Märchen immer, oder etwa nicht?
Jetzt war es offensichtlich, dass Vicky mich aufzog. Sie war keine Romantikerin, im Gegensatz zu mir.
Aber als ich nicht antwortete, tippte sie nach ein paar Sekunden wieder. Ihre nächste Nachricht klang deutlich sanfter:
Wie ist es in Berlin?
Ich las die Nachricht mehrfach, bevor ich das Handy auf meinem Bauch ablegte und an die Raufasertapete über mir starrte. Ja, wie war es in Berlin? Anders als erwartet, irgendwie. Und irgendwie auch nicht. Das Wohnheim war so einfach und klein, wie ich es mir ausgemalt hatte. Und doch war es erschreckend für mich. Denn die Vorstellung war noch einmal etwas anderes als die Realität. Etwas ganz anderes. Enge Räume mit einfachen Möbeln. Gemeinschaftsduschen und -toiletten. Plötzlich hatte ich ein wenig Angst vor meiner eigenen Courage, ganz allein nach Berlin gezogen zu sein. Ganz allein für eine Ausbildung gekommen zu sein, über die ich ewig recherchiert hatte und auf die ich mich eigentlich kein bisschen vorbereitet fühlte.
Auch wenn ich immer noch zurückkönnte. Betonung auf noch.
Einen Moment schnürte mir der Gedanke die Luft ab.
Dann rief ich mich selbst zur Ordnung. Es brachte nichts, zu viel darüber zu grübeln. Ich war jetzt hier, und wenn es sein musste, würde ich mich durch alles durchbeißen, was da auf mich zukam. Ich würde meiner Familie beweisen, dass ich diesen Rückweg nicht mehr brauchte. Ich stand jetzt auf eigenen Beinen.
Also schrieb ich Viktoria nur, dass es schön war in der Stadt und dass die Leute im Wohnheim sehr nett waren. Nichts von den Toiletten oder dem winzigen Zimmer. Nichts davon, dass irgendwo vom Fenster ein Luftzug kam, der das ganze Zimmer abkühlte und mir eine Gänsehaut bescherte. Und auch nichts davon, dass der Wasserhahn meines Waschbeckens tropfte – was bis zum Bett zu hören war. Sie musste nicht noch mehr wissen, was sie gegen mich verwenden konnte.
Sobald ich auf Senden gedrückt hatte, legte ich das Handy weg und machte mich daran, meinen Koffer auszupacken. Die Klamotten fanden glücklicherweise genug Platz in dem kleinen Kleiderschrank. Als sie an den Kleiderbügeln hingen, hatte ich sogar das Gefühl, dass es zu wenige waren. Entweder musste ich demnächst im Akkord waschen, oder ich beeilte mich, schnell neue Klamotten zu kaufen, bevor ich noch jeden Tag das gleiche Outfit tragen musste.
Ein kurzer Blick auf meinen Kontostand sagte mir jedoch, dass ich kaum noch hundert Euro hatte. Die Fahrt nach Berlin hatte doch ziemlich viel geschluckt, das Taxi hierher dann noch mal einen großen Teil, weil ich mit dem riesigen Koffer nicht in die U-Bahn hatte steigen wollen. In einer Stadt, in der ich mich nicht auskannte, in einem vielleicht etwas zu teuren Outfit. Ein Glück, dass wenigstens die Wohnheimmiete von dem Gehalt der Ausbildung abgezogen wurde, aber das war auch sehr dürftig, weshalb am Ende nicht viel übrig bleiben würde. Und da ich nicht auf die finanzielle Unterstützung meiner Eltern hoffen konnte, musste ich also tatsächlich öfter waschen – oder ich ließ mir etwas anderes einfallen.
Mit einem Seufzen räumte ich meine Badsachen aus und setzte mich dann wieder auf das Bett. Draußen wurde es schon etwas dunkler, und neben der Erschöpfung dieses anstrengenden Tages kletterte so langsam auch ein wenig der Einsamkeit in mir auf, die ich bisher gut unterdrückt hatte. Mein Dad hatte mir nicht geschrieben. Er hatte nicht einmal versucht, mich anzurufen. Aber vielleicht war das auch nicht verwunderlich nach unserem Streit, der nur der Gipfel unserer Meinungsverschiedenheiten der letzten Wochen gewesen war. Er konnte meine Entscheidung nicht nachvollziehen. Ich seine Sturheit nicht. Wir hatten uns angeschrien, und wenn ich nur daran dachte, wie wütend er war, wurde mir wieder ganz anders. Mein Vater war nie wütend auf mich. Niemals. Ich hatte ihn noch nie so außer sich gesehen, und dieses Bild wollte mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Ich brauchte Trost. Dringend.
Also ignorierte ich den schlechten Stand meines Kontos und suchte in der App nach Lieferdiensten in der Nähe. Bei einem Japaner bestellte ich mir eine riesige Portion von meinen liebsten Sushis, weil mich das an das Stammlokal erinnerte, in dem ich öfter mit meiner Schwester gegessen hatte. Himmel, dass ich sogar Viktoria nach einem Tag vermissen würde, hätte ich wirklich nicht gedacht.
Eine halbe Stunde später holte ich das Sushi unten an der Tür ab, und als ich wieder hochkam, fiel aus dem Wohnzimmer Licht nach draußen. Ich konnte Stimmen hören, unter anderem auch die von Emilia und Filina. Es wurde geredet und gelacht, und einen Moment blieb ich unschlüssig auf dem Flur stehen und starrte den Gang hinab. Eine Stimme in meinem Kopf flüsterte mir zu, dass ich mich zu ihnen gesellen sollte. Kontakte knüpfen. Freundschaften schließen.
Aber obwohl ich mich so sehr danach sehnte, fühlte ich mich heute nicht gut genug, um ein Lächeln und Zuversicht aufzusetzen. Meine Sozialfähigkeiten mit neuen Menschen waren eh nicht besonders gut, und heute erst recht nicht. Ich fühlte mich ausgebrannt, also ging ich zurück in mein Zimmer und aß das Sushi allein auf meinem Bett. Danach machte ich mich an dem kleinen Waschbecken bettfertig und kuschelte mich dann mit dem Handy unter die Decke. Es war noch früh, aber ich hatte einfach keine Energie mehr, weshalb ich mir nur noch irgendwelche Videos ansah, bis ich irgendwann wegdämmerte.
Und so traurig es auch war, so endete der erste Tag meines neuen Lebens.
Kapitel 3
Alica
Aus irgendeinem Grund sah die Waschmaschine so aus, als würde sie mich verhöhnen.
Je länger ich im Keller des Wohnheims stand und sie anstarrte, desto mehr kam es mir so vor. Wahrscheinlich hatte sie nicht sonderlich oft Gäste, die wirklich nicht die geringste Ahnung hatten, wie man sie bediente. Die gewissermaßen mit einem silbernen Löffel im Mund groß geworden waren, wie man es so gern über mich sagte, und die deshalb selbst an so etwas normalerweise Simplem versagten. Und genauso kam ich mir gerade vor: wie eine Versagerin.
Während ich verzweifelt auf meinem Handy herumtippte, um eine einfache Anleitung fürs Wäschewaschen zu suchen, stieg die Erkenntnis immer wieder in meinem Kopf auf wie Seifenblasen. Du kannst das nicht allein. Du kannst gar nichts allein. Zusammen mit einem freundlichen Gesicht und den Worten: Komm, lass es doch einfach mich machen.
Frustriert ließ ich das Handy sinken. Es hatte keinen Sinn, das WLAN reichte einfach nicht bis in den Keller runter. Vielleicht hätte ich vorher die Waschanleitung raussuchen sollen, aber der Gedanke war mir gar nicht gekommen. Stattdessen hatte ich mir, als ich mit den Klamotten unter dem Arm in den Waschraum gekommen war, noch eingebildet, dass Waschmaschinen sicher selbsterklärend waren. Wie schwer konnte schon etwas sein, das so viele Menschen regelmäßig machten?
Die Antwort war niederschmetternd: zu schwer für mich.
Ich blickte auf die Maschine runter, in deren großem Maul die Sachen von gestern lagen und noch ein paar Klamotten aus meiner Tasche, die beim Ausräumen nach Zigarettenrauch und Berlin gerochen hatten. Kurz überlegte ich, einfach in die Stadt zu fahren und neue Klamotten zu kaufen. Oder alles in eine Wäscherei zu bringen. Aber das war keine Dauerlösung. Denn mein Kontostand war schon jetzt kurz vor dem Zusammenbruch. Und ich hatte mir geschworen, dass ich das alles allein hinbekommen würde. Wie ein verdammter, normaler Mensch. Wie eine Erwachsene, ganz ohne Silberlöffel.
Also musste ich jetzt wohl in den sauren Apfel beißen und das Ganze hinter mich bringen. Ich hätte noch einmal nach oben gehen und ordentlich googeln können, aber ich hatte Angst, dass mir jemand von den anderen begegnete. Nicht nur, weil sie nicht mitbekommen sollten, dass ich allein absolut aufgeschmissen war, sondern auch, weil ich noch keine Lust gehabt hatte, mich herzurichten. Ich war ungeschminkt, hatte Augenringe, und meine Haare hatten sich noch nicht an die Bettbezüge gewöhnt, die es hier im Wohnheim gab. Als ich vorhin in den Spiegel gesehen hatte, hatte ich augenblicklich neue Bettwäsche auf meine gedankliche Einkaufsliste gesetzt.
Ich ließ den Blick über das Holzregal über der Waschmaschine wandern. Da standen verschiedene Flaschen, Pulverpackungen und Töpfchen. Manche waren mit Namen beschriftet, manche mit »für alle«. Ich war froh, dass ich mich zumindest damit nicht auch noch beschäftigen musste, und griff nach einer großen Pulverpackung. Denn so viel wusste ich zumindest: Zum Waschen brauchte man Waschpulver. Glücklicherweise konnte man auf der Packung ablesen, wie viel man in die Maschine geben sollte. Jetzt war nur die Frage – wohin? Direkt in die Maschine? Oder in das Fach oben?
Probeweise zog ich es auf, aber das brachte mich nicht wirklich weiter. Da waren ganze drei Fächer – mit einer Eins, mit einer Zwei und einer kleinen Blume beschriftet. Aber das hätten genauso gut chinesische Zeichen sein können, ich kapierte gar nichts.
Ich stöhnte frustriert auf und pustete mir eine Strähne aus dem Gesicht. Wie kompliziert konnte man das Ganze eigentlich machen?
»Du siehst aus, als hättest du Streit mit der Maschine. Hat sie deine Mutter beleidigt?«
Die plötzliche Stimme hinter mir ließ mich vor Schreck nach Luft schnappen. Ich fuhr herum und starrte den Typen an, der in der Tür aufgetaucht war und einen vollen Wäschekorb unter dem Arm trug. Er grinste mich schief an und lehnte sich dann mit der Schulter an den Türrahmen, als würde er auf ein Unterhaltungsprogramm warten.
»Quatsch.« Ich presste die Lippen zusammen und drehte mich wieder von ihm weg. Meine Gedanken rasten. Wieso hatte ich nicht gehört, dass er gekommen war? Wieso musste er so früh am Morgen hier unten Wäsche waschen? Ich hatte die Zeit nur gewählt, weil ich mir sicher gewesen war, dass niemand sonst so früh schon auf den Beinen sein würde und die Chance, jemanden zu treffen, mir deshalb verschwindend gering vorgekommen war.
»Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken«, sagte er und stellte seine Wäsche auf die Maschine links neben meiner.
Als ich aufblickte, wanderten seine Mundwinkel wieder nach oben, und Grübchen erschienen auf seinen Wangen. Durch das dichte schwarze Haar, das oben etwas länger und an den Seiten abrasiert war, konnte ich an seinem rechten Ohr mehrere Ringe blitzen sehen.
»Du bist sicher Alica, oder?«
Meine Augenbrauen schossen nach oben. »Woher weißt du das?«
»Meine Schwester hat mir von unserer neuen Mitbewohnerin erzählt.« Er zwinkerte verschmitzt, bevor er seine Wäsche in die Maschine warf und sie so schnell einschaltete, dass ich nicht sehen konnte, in welches Fach er das Waschpulver gegeben hatte. »Ich bin übrigens Lio.«
Lio. Emilias Bruder. »Du bist der Typ, der gestern halb nackt über den Balkon geklettert ist.«
»Schuldig.« Er stand aus der Hocke wieder auf. »Emilia besteht darauf, dass ich mich für den Anblick bei dir entschuldige.« Seine Miene war ernst, aber seiner Stimme war anzuhören, dass er die Situation mehr als lustig fand.
»Dir sei verziehen«, gab ich schmunzelnd zurück.
»Zu gütig.« Lio lehnte sich an die Waschmaschine. »Also, was ist das Problem zwischen dir und der Maschine? Vielleicht kann ich vermitteln. Ich kenne sie schon eine Weile.«
Ich spürte, wie ich mich versteifte. Was sollte ich denn jetzt sagen? Ich kann leider einfach keine Wäsche waschen? Dann hielt er mich wahrscheinlich für genauso eine Versagerin, wie ich es selbst im Moment tat. Hilflos zuckte ich mit den Schultern.
Etwas in Lios Augen blitzte auf. »Lass mich raten, ihr habt eine andere Maschine zu Hause, und du weißt nicht, wie man diese alten Dinger hier bedient?«, half er mir auf die Sprünge.
Erleichtert, dass er mir eine Erklärung lieferte, nickte ich. »Ja, wir haben zu Hause so ein Hightech-Teil, das eigentlich quasi alles allein macht«, sagte ich. »Deshalb bin ich gerade etwas überfordert.«
Hoffentlich war mir nicht an der Nasenspitze anzusehen, dass ich noch nie unseren Waschraum von innen gesehen hatte. Geschweige denn das Modell unserer Maschine kannte.
Lios Mundwinkel kräuselten sich wieder. Er griff zu mir rüber und zog das Fach wieder auf, das ich in meinem Frust zugeschoben hatte. »Hier …« Mit dem Finger tippte er auf das Fach mit der großen Zwei. Dabei fielen mir die schwarzen Ringe an seinen Fingern auf und die dazu passenden tätowierten Ringe um sein Handgelenk. »… kommt das Waschpulver rein.«
»Danke.« Ich versuchte, einen souveränen Eindruck zu machen, während ich das Pulver in das angewiesene Fach kippte.
Lio war nicht anzusehen, was er von mir hielt, aber immerhin schien ich ihn zu amüsieren. Das Funkeln verschwand nicht aus seinen Augen. »Welches Programm?«, fragte er, als ich fertig war.
Ich konnte nicht anders, ich hob den Blick und sah ihn verwirrt an. Woher sollte ich das denn wissen?
Lio presste die Lippen zusammen. Es wirkte, als würde er sich bemühen, nicht zu lachen. Statt aber Witze zu machen, deutete er auf die Trommel. »Darf ich?«, fragte er, und als ich nickte, öffnete er die Tür der Waschmaschine. Seine Augen wurden groß beim Anblick der Designerteile.
Meine Wangen wurden heiß. »Die waren … Geschenke«, stammelte ich.
Er ging in die Hocke und zog eins der Teile raus, um auf das Schild zu schielen. »Ist das ein Synonym für etwas Illegales?«
»Was?« Ich starrte auf seinen schwarzen Haaransatz hinab, bis mir klar wurde, was er damit sagen wollte. In meinem Magen stiegen Bläschen der Wut auf. »Denkst du etwa, ich habe die geklaut?«
Lio zuckte mit den Schultern, tat das Teil zurück in die Maschine und schloss die Trommel wieder. »Klang nur etwas dubios.«
»Ich habe sie nicht geklaut«, fauchte ich etwas heftig.
Lio, der sich neben mir aufrichtete, sah mich eine Spur erschrocken an. »Entschuldige«, sagte er. »Das war nur ein blöder Spruch. Ich wollte dir damit nicht zu nahe treten.«
Als ich seinen ernsten Gesichtsausdruck sah, verpuffte die Wut in mir sofort wieder. Ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Irgendwie war ich es nicht gewohnt, dass Menschen ihre Fehler zugaben und sich gleich entschuldigten. Nach einer Sekunde nickte ich. »Okay.«
»Okay.« Lio drehte sich wieder der Waschmaschine zu. »Auf den Schildern steht das, was ich mir schon gedacht habe: Handwäsche.«
»Handwäsche?« Ich starrte ihn entgeistert an. »Ich muss die per Hand waschen?« Plötzlich war der Gedanke, mir einfach neue Klamotten zu kaufen, wieder mehr als verführerisch.
Lio, der schon dabei gewesen war, an dem Rädchen zu drehen, riss den Kopf zu mir herum. Sein Blick schien mich zu fragen, ob ich das wirklich ernst meinte. Und ich starrte zurück, ohne eine Antwort zu haben. Was wollte er denn jetzt?
»Das Programm …« Er tippte auf das Rädchen. »Es heißt Handwäsche. Du musst nicht selbst waschen.«
»Oh.« Verdammter Mist. »Klar. Gut.«
»Du hast dich schon an einem Fluss sitzen und deine Klamotten auf einem Waschbrett reiben sehen?« Er grinste wieder, als er auf den Start-Knopf drückte.
»So ähnlich.« Ich räusperte mich verlegen und deutete auf die Waschtrommel, die just in diesem Moment begann, sich zu drehen. »Ich dachte immer, dass die Schildchen in den Sachen nur dafür da sind, damit man weiß, dass man die Klamotten richtig herum anhat.«
Lio lachte auf. »Guter Witz«, gab er zu. Zwischen seinem Haaransatz und der Kapuze seiner Jacke blitzte ein schwarzes Tattoo hervor. Es sah aus wie Jahreszahlen, aber der Großteil davon war bedeckt.
Ich zwang mich, ihn nicht anzustarren, und fragte: »Und wie lange läuft das Programm jetzt?«
»So etwa zwanzig, dreißig Minuten«, sagte er. »Dann kannst du mal runterschauen. Ich würde die Sachen allerdings nicht hier unten aufhängen, sondern den Wäscheständer auf deinen Balkon stellen. Hier im Wohnheim wohnen auch manchmal ein paar dubiose Gestalten auf Zeit, und ab und zu kommen doch ein paar Sachen weg.«
»Großartig«, kommentierte ich sarkastisch, während ich ihm aus dem Wäscheraum zurück zum Aufzug folgte. »Was sind das denn für dubiose Gestalten? Ich dachte, hier im Wohnheim wohnen nur Auszubildende und ein paar Angestellte des Sankt Alex?«
Lio drückte den Knopf und sah mich dann über seine Schulter an. »Nicht nur. Auch Praktikanten, Studenten und ein paar Leute, die hier ihr Freiwilliges Soziales Jahr machen.«
Ja, da klickte tatsächlich was in meinem Gedächtnis. »So wie du?«
Seine Augenbrauen zuckten. »Du bist gut informiert.«
»Genau wie du.«
Als wir in den Aufzug stiegen, konnte ich wieder einen Blick auf mein chaotisches Erscheinungsbild werfen. Meine Haare standen tatsächlich immer noch in alle Richtungen ab und waren nicht einmal mit dem sonst so gut funktionierenden Handkamm zu entwirren. Ich unterdrückte ein Seufzen. Was sollte es, jetzt war es eh schon zu spät. Ich gab es auf und wandte mich wieder zu Lio um. »Es gibt keine Wäscheständer, die man sich hier ausleihen kann, oder?«
Er lehnte sich mit dem Rücken an die Spiegel und schüttelte den Kopf. »Meine Schwester hat schon gesagt, dass du nur mit einem Koffer und einer Tasche angerückt bist.«
»Deine Schwester redet viel«, murmelte ich, auch wenn das eigentlich nicht stimmte – Emilia war mir gegenüber eher ein wenig verhalten gewesen. Ich senkte den Blick. Erst jetzt fiel mir auf, dass Lio nur seltsam bunte, nicht zusammenpassende Socken trug, was auch erklärte, warum ich ihn nicht hatte kommen hören. Doch meine Aufmerksamkeit blieb auf den schwarzen Tattoos hängen, die sich sogar auf seinen Waden, unter der kurzen Hose, über seine Haut zogen.
»Im Gegenteil«, gab er zurück.
Ich hob den Kopf und begegnete dem Blick aus seinen dunklen Augen. Er musterte mich, als würde er versuchen, mich abzuschätzen. Das leichte Schmunzeln in seinen Mundwinkeln war nicht unattraktiv.
»Mit anderen ist sie in der Regel etwas … vorsichtiger«, fuhr er fort. »Aber ja, mir erzählt sie eigentlich alles, ob sie will oder nicht. Zwillingsempathie.« Er tippte sich an die Stirn, als würde das irgendetwas erklären.
Ich sah von den Ringen an seinen Fingern zurück zu den dunklen Augen. »Ihr seid Zwillinge?«
Lio nickte und steckte entspannt die Hände in die Taschen seiner Hose.
»Ihr seht euch nicht ähnlich«, sagte ich. Und damit meinte ich: wirklich gar nicht.
Emilias Haare waren hellbraun, ihre Haut weiß und ihre Augen blau und wunderschön. Lio wirkte eher ein wenig wie ihr Negativ: beinahe schwarze Haare, dunkelbraune Augen und nicht ganz so blass wie seine Schwester. Die Form ihrer vollen Lippen vielleicht, und die kleine, gerade Nase – die ähnelten sich. Wenn man ganz genau hinsah.
Lio zuckte mit den Schultern, als hätte er das schon öfter gehört. »Zweieiige Zwillinge sind eigentlich nur wie normale Geschwister. Zumindest biologisch.« Er blickte auf meine Klamotten runter, genau wie seine Schwester am Vortag, und fragte dann neugierig: »Also, werden deine Möbel und deine restlichen Sachen noch geliefert?«
»Ganz schön neugierig«, konterte ich.
Erneut wanderte ein Grinsen auf sein Gesicht. »Sorry. Wenn die Frage übergriffig ist, nehme ich sie zurück. Aber ja, ich bin neugierig.«
Diesmal war ich es, die mit den Schultern zuckte. Aus irgendeinem Grund kroch wieder die Einsamkeit vom Vorabend in meine Glieder, und die Erinnerung an die letzten Worte meines Vaters, bevor ich unser Haus verlassen hatte, legte sich wie ein Eisfilm auf meine Haut. »Nein, es kommt nichts mehr«, sagte ich deshalb leise. »Das ist alles, was ich habe.« Jetzt zumindest. Das hatte mein Vater deutlich gemacht.
Von einer Sekunde auf die andere verschwand die Amüsiertheit aus Lios Gesicht und machte ehrlicher Betroffenheit Platz. »Entschuldige«, sagte er, und ich winkte sofort mit einem Lachen ab.
»Quatsch, das macht gar nichts. Ich brauche nicht viel.« Wenn meine Schwester das gehört hätte, sie hätte laut gelacht und mich auf meinen vollen Kleiderschrank und meine überquellenden Badschränke hingewiesen.
Lio hingegen lächelte wieder, und diesmal sah es tatsächlich ein wenig zurückhaltend aus. Jetzt konnte ich doch die Ähnlichkeit zwischen ihm und Emilia sehen.
Wir stiegen in unserem Stockwerk aus, und als Lio schon fast an seiner Tür war, drehte er sich noch einmal zu mir um. »Kannst du meiner Schwester sagen, dass ich mich bei dir entschuldigt habe, wenn sie danach fragt? Sie lässt mich sonst nie damit in Ruhe.«
Ich hatte meine Tür bereits aufgeschlossen, aber jetzt blickte ich ihn an und lachte. »Verstanden, mache ich.«
»Danke.« Sein Schmunzeln erhellte wieder sein ganzes Gesicht.
Definitiv nicht unattraktiv. Wenn mir nicht schon seit Monaten ein anderer Typ im Kopf herumgeistern würde, könnte er mir tatsächlich gefallen.
»Dafür kannst du dich auch jederzeit an mich wenden, falls du mal Hilfe brauchst«, fügte er hinzu. »Beim Wäschewaschen zum Beispiel.«
»Oder wenn ich mich aussperre und jemanden brauche, der halb nackt über den Balkon klettert?«, hakte ich neckend nach.
Er warf lachend den Kopf in den Nacken, wobei die silbernen Ringe in seinen Ohren funkelten. »Auch dann stehe ich dir gern mit meiner gesamten Erfahrung zur Verfügung.« Lio hob die Hand zum Gruß, ehe wir beide in unser Zimmer gingen.
Als ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, spürte ich, dass ich lächelte. Vielleicht würde ich das hier doch ganz okay hinbekommen – wenn auch mit ein wenig mehr Unterstützung, als ich mir erhofft hatte.
Das Gefühl, eine Versagerin zu sein, ließ sich nicht ganz abschütteln, aber es fing an, sich langsam in meiner Brust wieder aufzulösen.
Kapitel 4
Lio
Chiara wartete auf einer Parkbank auf mich, und selbst aus der Entfernung konnte ich sofort erkennen, dass sie nervös war. An der Art, wie sie mir entgegensah. An dem Wippen ihres Fußes. Wie immer versuchte sie natürlich, es hinter ihrer coolen Fassade zu verstecken – die Zigarette zwischen den Fingern, ihren Arm locker um das an den Körper rangezogene Bein geschlungen –, und wie immer gelang es ihr nicht.
Während ich über den Boxhagener Platz auf sie zuschlenderte, die Hände in den Hosentaschen, versuchte ich, mich daran zu erinnern, wie sie bei unserem ersten Treffen ausgesehen hatte. Es war nur noch eine verschwommene Erinnerung, aber es musste in einem unserer Stammclubs gewesen sein. Ich wusste noch, dass sie mit ihrer wilden Lockenmähne und den aufgemalten Sommersprossen wahnsinnig attraktiv in dem roten Licht ausgesehen hatte. Dass wir getanzt hatten. Und dass ich am nächsten Morgen neben ihr in einer beinahe schon spießig eingerichteten Wohnung in Kreuzberg aufgewacht war. Dass sie mich zum gemeinsamen Frühstück überreden wollte, weil sie mich eben noch nicht kannte. Mittlerweile waren wir wohl so etwas wie Freunde. Zumindest rief sie mich immer an, wenn sie reden musste oder wenn es Probleme gab, mit denen sie nicht allein klarkam. So wie heute.
Als ich vor ihr stehen blieb, nahm sie noch einen Zug von ihrer Zigarette und blinzelte mich dabei betont gelassen an. Doch jeder Muskel in ihrem Körper war angespannt. Jeder Nerv wahrscheinlich überstrapaziert. Aber sie versuchte so eisern, es zu verstecken, dass ich mich kaum davon abhalten konnte, meine Augenbrauen nach oben zu ziehen.
Ich hatte noch nie verstanden, warum die meisten Menschen nicht einfach ehrlich mit sich und ihren Gefühlen waren. Warum sie nicht zugaben, wenn sie Angst hatten oder wütend waren oder sich verloren fühlten. Es gab kaum etwas, das das Gewissen so sehr erleichterte, wie ehrlich zu sein. Schon allein das Aussprechen löste oft so viele Probleme.
Aber so simpel waren die meisten Menschen wohl einfach nicht. Und eigentlich ging es mich auch nichts an.
»Na?« Sie grinste und hielt mir ihre Kippe hin. »Willst du ’nen Zug?«
Augenblicklich spannte sich alles in mir an. »Ich rauche nicht«, erinnerte ich sie mit betont geduldiger Stimme. »Das weißt du. Und du solltest mit dem Mist auch aufhören.«
Etwas flackerte in ihren grünbraunen Augen auf. Vielleicht eine Erkenntnis. Sie wirkte auf jeden Fall ein wenig geknickt, als sie umgehend die Zigarette ausdrückte und auf den Boden warf. »Sorry. Hatte ich vergessen.«
Ich blickte auf den Stummel hinab, der zwischen ihren Füßen auf den Steinplatten gelandet war.
Chiara brauchte nicht einmal einen Hinweis. Sie lachte einfach nur und hob den Stummel wieder auf. »Sorry, das hatte ich auch vergessen.« Leichtfüßig erhob sie sich von der Bank und warf die Zigarette in den nächsten Mülleimer, der nicht einmal zwei Meter von ihr entfernt stand. Dann drehte sie sich zu mir um und grinste breit. »Zufrieden?«
Zur Antwort schenkte ich ihr ein Lächeln. »Wie ist der Plan?«
Chiara zuckte mit den Schultern. Auf der Stelle war die Unsicherheit in ihrer ganzen Haltung wieder zurück. »Hab keinen«, gab sie etwas gequält zu und scharrte mit den Stiefeln im Dreck. Um uns herum wimmelte es von Menschen, wie es hier am frühen Abend immer war. Und zwischen ihnen wirkte sie sofort um einiges kleiner.
Ich unterdrückte ein Seufzen, weil ich ihr kein schlechtes Gewissen machen wollte. »Wo wohnt er denn?«
Sie hob den Blick. Starrte mich einen ganzen Moment unsicher an, bevor sie sich die roten Locken hinter die Ohren schob und ihr kleines Ohrpiercing berührte. »Da hinten.« Sie nickte in Richtung eines Plattenbaus. »Dritter Stock.«
»Nachname?«, fragte ich und hatte mich bereits in Bewegung gesetzt.
»Schäfer. Aber Lio …« Chiara holte zu mir auf, ihre ganze Haltung signalisierte jetzt Unruhe. »Mit dem Typen ist echt nicht zu spaßen. Der hält die Fäuste nicht mal vor seinen engsten Freunden zurück.«
»O Mann. Warum lässt du dich immer mit solchen Leuten ein?«, fragte ich zwischen zusammengepressten Zähnen hindurch, während ich die Straße überquerte. Ich durfte gar nicht erst darüber nachdenken, dass er sie vielleicht auch angefasst haben könnte, denn dann begann mein Innerstes nur noch mehr zu kochen.
Chiara zuckte mit den Schultern und blieb am Gehweg stehen. Jetzt war da nicht nur Unsicherheit in ihrem Blick, sondern richtige Angst. Es fehlte eigentlich bloß noch, dass sie zu bibbern begann. Dass sie trotzdem hier stand, zeigte, wie ernst es ihr war. Wie wichtig.
Sofort taten mir die harschen Worte leid.
»Warte hier unten«, sagte ich deshalb mit fester Stimme und blickte an dem Plattenbau empor.
Das Gebäude, in dem Chiaras Ex wohnte, war sicher gut acht oder neun Stockwerke hoch und wirkte ehrlich ein wenig runtergekommen. Im Erdgeschoss war ein Waschsalon, dessen Fenster mehrfach notdürftig repariert aussahen, und darüber war nichts als grauer Beton und winzige Fenster, die sicher kaum Licht in die Wohnungen ließen.
»Du willst da allein hoch?« Chiara war die Erleichterung deutlich anzuhören, auch wenn sie sie offensichtlich nicht wirklich zulassen wollte. »Der Typ ist …«
»Echt gefährlich, schon klar.« Ich warf ihr über die Schulter ein Grinsen zu und drückte die kaputte Eingangstür auf. »Mach dir keinen Kopf.«
Noch durch die Scheibe konnte ich sehen, dass sie das definitiv nicht gut umsetzen konnte. Aber ich würde in ein paar Minuten zurück sein.
Leichtfüßig hüpfte ich die Treppe nach oben. Dem Aufzug vertraute ich in diesem heruntergekommenen Haus sicher nicht, und so konnte ich mir schon mal zurechtlegen, was ich sagen wollte. Auch wenn das nicht unbedingt leicht war, wenn ich den Typen noch überhaupt nicht einschätzen konnte. Vielleicht musste ich also doch improvisieren.
Im dritten Stock waren sechs Türen. Die mit der Aufschrift »Schäfer« war ganz hinten, im dunklen Bereich des Ganges. Irgendwie passend. Ohne zu zögern, drückte ich auf den Klingelknopf, machte einen Schritt von der Tür weg und steckte die Hände wieder in die Hosentaschen. Im Gegensatz zu Chiara verspürte ich eher Neugier als Angst. Neugier und ein wenig Adrenalin, das mir durch die Adern schoss. Emmi hätte mich wahrscheinlich für meinen geringen Selbsterhaltungstrieb zurechtgewiesen, aber eigentlich lag sie damit falsch. Ich fand das Leben großartig. Meines im Besonderen. Ich hatte einfach keine Angst vor Schaumschlägern.
Und dass dieser Rico Schäfer einer davon war, zeigte sich bereits in dem Moment, als er die Tür aufriss. Sein Kopf war rasiert, nur ein paar dunkle Stoppeln zeigten sich auf der Glatze. Unter dem Muskelshirt konnte ich ein paar hässliche Tattoos sehen. Tribals, natürlich. Sie zogen sich über seine ganze Brust bis über die Schultern nach hinten. Es brauchte nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, wie sein Rücken aussah.
Er musterte mich mit einem Blick, der geradezu darum bettelte, provoziert zu werden, damit er zuschlagen konnte. Ein wenig wie eine bösartige Bulldogge. Zu allem klischeehaften Überfluss hatte er auch noch ein Bier in der Hand. Willkommen in Berlin-Kreuzberg.
»Hey«, sagte ich fröhlich. »Du bist sicher Rico, oder?«
»Was willst du Knirps von mir?«
Ganz schön übertrieben für jemanden, der höchstens fünf oder sechs Jahre älter war als ich. Mitte zwanzig und schon so vom Leben verdorben. Schade drum.
Ich legte den Kopf schief und grinste, um ihm zu zeigen, dass er mich mit seinem Gehabe kein bisschen einschüchterte. »Mein Name ist Lio, ich bin ein Freund von Chiara.«
Das war offensichtlich ein Trigger. Denn nun riss Rico die Augen auf, und seine Wangen wurden wutrot. »Ist die Schlampe etwa bei dir?« Er sah sich beinahe hektisch im Treppenhaus um.
Ich ballte die Hände in den Hosentaschen zu Fäusten. Schlampe, weil sie dich verlassen hat, statt andersherum? Schlampe, weil sie genug davon hatte, von dir verprügelt zu werden?
Nichts davon sprach ich aus. Rico war ein Schaumschläger, aber es wäre dumm von mir gewesen, ihn zu provozieren. Daher sagte ich in ruhigem Ton: »Nein, ist sie nicht.« Als Rico mich wieder mit dem Bulldoggenblick ansah, schob ich hinterher: »Sie schickt mich, um den Hasen zu holen.«
Er schnaubte. »Kannst du vergessen. Sie soll ihn selbst holen, oder das Vieh bleibt hier.«
Natürlich.
»Ist das Häschen dir etwa so wichtig?«, fragte ich mit mitleidiger Stimme. Wahrscheinlich ging ihm das Tier eh schon ewig auf den Sack. Wer wusste, ob er ihn überhaupt fütterte oder seinen Dreck wegmachte. Aber Rico war jemand, der gern Besitzansprüche auf Dinge erhob. Und auf Lebewesen. Das war ihm deutlich anzusehen. Aber wenn Typen wie ihn irgendetwas aufregte, dann, wenn man an ihrer fragilen Männlichkeit kratzte.
Und es funktionierte.
Seine Augenbrauen wanderten zusammen. »Das Vieh ist mir scheißegal. Sag Chiara, dass sie ihn selbst abholen soll, oder es fliegt in den nächsten Tagen aus dem Fenster.«
In meiner Brust stieg jetzt doch etwas Wut nach oben. Gewalt gegen Menschen. Todesandrohungen gegen Tiere. Er schoss auf meiner Unbeliebtheitsliste gerade um einiges weiter nach oben.
Rico ging einen Schritt nach hinten und griff nach der Tür. »Verpiss dich.«
Bevor er sie zuschlagen konnte, machte ich einen Satz nach vorn und stellte meinen Fuß dazwischen.
Ungläubig zog der Typ sie wieder auf und starrte mich an. »Hängst du nicht an deinem Leben, Kleiner?«
Ich ignorierte seine Worte und schielte in seinen Wohnungsflur. »Hier riecht es doch nach Gras, oder?«
Das irritierte ihn offensichtlich mehr, als er zeigen wollte. »Ich verkaufe nicht an Freunde von dieser Schlampe.«
Unbeeindruckt zuckte ich mit den Schultern. »Interessiert mich wirklich kein Stück.« Ich sah zu ihm auf und zog die Mundwinkel nach oben. »Aber vielleicht interessiert es diese Typen in Blau, die hier überall rumspazieren? Was glaubst du, sind die leicht zu versorgen? Sind eine Menge Leute, aber du hast sicher ordentlich was zu Hause, wie ich so gehört habe.«
Eine ganze Weile starrte Rico mich nur an. So lange, dass ich schon befürchtete, sein wahrscheinlich mickriges Gehirn war irgendwie abgestürzt. Dann machte er einen großen Schritt auf mich zu und packte mich am Kragen meines Shirts. »Keine Ahnung, was du mit deiner Suizidmission hier bezwecken willst, aber mir mit der Polizei zu drohen, ist ganz sicher keine gute Idee.«
Er war meinem Gesicht so nah, dass ich kurz überlegte, ihm einen Kuss auf die Stirn zu drücken. Aber ich rief mir in Erinnerung, dass eine zu große Provokation wahrscheinlich eher kontraproduktiv sein würde. Ganz konnte ich mir das Schmunzeln aber nicht verkneifen. »Was glaubst du, wie viele Knochen musst du mir brechen, damit ich nicht mehr reden kann?«, fragte ich leise.
Ricos Augen wurden noch größer. Wahrscheinlich hatte lange niemand mehr so mit ihm geredet. Eine Ader an seiner Schläfe pulsierte.
Es war wohl Zeit für die Deeskalation. Also hob ich unschuldig die Hände. »Hey, ich will dir eigentlich echt keinen Ärger machen. Ernsthaft. Mir ist scheißegal, was du für Zeug aus deiner Wohnung verkaufst. Und ich weiß auch, dass dir dieser Hase scheißegal ist. Wir ersparen uns also beide eine Menge Ärger, wenn du ihn mir einfach mitgibst.«
In seinem Gesicht stritten sich augenblicklich eine Menge Gefühle. Er wollte auf keinen Fall den Kürzeren ziehen und nachgeben. Aber er wollte auch nicht, dass ein SEK

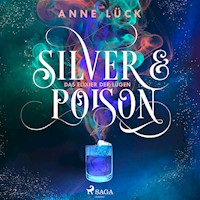
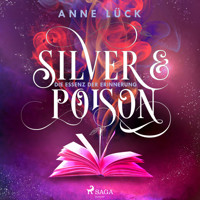
![Jewel & Blade. Die Wächter von Knightsbridge [Band 1 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/ce22490997b3e6e0e807c8b632e07b21/w200_u90.jpg)




![Jewel & Blade. Die Hüter von Camelot [Band 2 (ungekürzt)] - Anne Lück - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c7d0b6bb9c33b9a1b2b09f490d3cfe2a/w200_u90.jpg)