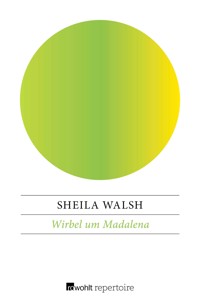9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Frauenroman, der seine Leser(innen) sofort fesseln wird. Im vornehmen London des Jahres 1810 gerät die junge Lucia, Tochter eines englischen Adligen und einer italienischen Sängerin, nach dem Tod ihrer Eltern in die Obhut eines kaltherzigen Stiefvaters. Er will sie an einen Schurken verkuppeln. Doch zuvor setzt er sie als Pfand beim Glücksspiel ein – und verliert sie an den Marquis of Mandersely. Der dem Müßiggang ergebene Marquis ist jedoch ein Gentleman und bringt das Mädchen bei seiner ehrbaren Tante unter. Obschon er mit einer schönen Gräfin befreundet ist, gerät sein Herz bald in Verwirrung. Er verliebt sich in die natürliche und reizende Lucia, obschon (oder weil?) sie sich ihm gegenüber sehr zurückhaltend, fast abweisend benimmt und ihre Gefühle vor ihm sorgsam verbirgt. Als ein Spieler die Schwester des Marquis zu einem unehrenhaften Schäferstündchen zwingen will, verteidigt Lucia mutig deren Ehre. Aufopferungsvoll kümmert sie sich auch um einen schwerkranken Vetter ihres Gebieters, und der Marquis glaubt, daß ihr Herz endgültig einem anderen gehört. Als Lucia jedoch geraubt und in ein Freudenhaus verschleppt wird, ist der entflammte Marquis endgültig entschlossen, um seine Liebe zu kämpfen. Wer Georgette Heyers unterhaltsame Epen aus der Regency-Epoche liebt, wird auch diesen romantisch verwobenen Liebes- und Gesellschaftsroman aus einer entschwundenen Zeit verschlingen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Sheila Walsh
Das Mädchen und der Marquis
Über dieses Buch
Ein Frauenroman, der seine Leser(innen) sofort fesseln wird. Im vornehmen London des Jahres 1810 gerät die junge Lucia, Tochter eines englischen Adligen und einer italienischen Sängerin, nach dem Tod ihrer Eltern in die Obhut eines kaltherzigen Stiefvaters. Er will sie an einen Schurken verkuppeln. Doch zuvor setzt er sie als Pfand beim Glücksspiel ein – und verliert sie an den Marquis of Mandersely. Der dem Müßiggang ergebene Marquis ist jedoch ein Gentleman und bringt das Mädchen bei seiner ehrbaren Tante unter. Obschon er mit einer schönen Gräfin befreundet ist, gerät sein Herz bald in Verwirrung. Er verliebt sich in die natürliche und reizende Lucia, obschon (oder weil?) sie sich ihm gegenüber sehr zurückhaltend, fast abweisend benimmt und ihre Gefühle vor ihm sorgsam verbirgt. Als ein Spieler die Schwester des Marquis zu einem unehrenhaften Schäferstündchen zwingen will, verteidigt Lucia mutig deren Ehre. Aufopferungsvoll kümmert sie sich auch um einen schwerkranken Vetter ihres Gebieters, und der Marquis glaubt, daß ihr Herz endgültig einem anderen gehört. Als Lucia jedoch geraubt und in ein Freudenhaus verschleppt wird, ist der entflammte Marquis endgültig entschlossen, um seine Liebe zu kämpfen.
Wer Georgette Heyers unterhaltsame Epen aus der Regency-Epoche liebt, wird auch diesen romantisch verwobenen Liebes- und Gesellschaftsroman aus einer entschwundenen Zeit verschlingen.
Vita
Sheila Walsh, geboren in Birmingham, veröffentlichte eine Reihe von Erzählungen. «Das Mädchen und der Marquis» war ihr erster Roman, der sogleich erfolgreich war und preisgekrönt wurde. Sheila Walsh war mit einem Juwelier verheiratet und lebte mit ihrer Familie in Southport.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 1975 unter dem Titel «The Golden Songbird» bei Hurst & Blackett, London.
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg
Copyright für diese Ausgabe © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 1977 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Golden Songbird» © Sheila F. Walsh, 1975
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN Printausgabe 978-3-499-14106-5
ISBN E-Book 978-3-688-10797-1
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
1
In dem kleinen Salon mit den schweren Vorhängen warf eine einzelne Hängelampe ihr Licht auf den mit grünem Filztuch bedeckten Tisch beim Fenster.
Falls so etwas wie eine gespannte Atmosphäre herrschte, so schien Hugo, der IV. Marquis von Mandersely, nichts davon zu bemerken. Er lehnte mit der Lässigkeit des geborenen Nobelmanns in seinem Stuhl – von seinem dunklen, modisch gelockten Tituskopf bis zu den blaßgelben engen Pantalons an seinen ausgestreckten Beinen ein Repräsentant der eleganten Welt. Der gutgeschnittene dunkelblaue Rock aus edlem Tuch war leger zurückgeschlagen und gab darunter eine halb zugeknöpfte Weste aus schmalgestreifter weißer Seide preis.
Sein Kinn ruhte in den üppigen Falten der Krawatte, und die blassen, scharfgeschnittenen Züge trugen den Ausdruck tiefster Langeweile. Seine langen schlanken Finger spielten mit einem leeren Weinglas.
Toby Blanchard kannte diesen Ausdruck von jeher. Er seufzte. Der Abend war von Anfang an ein bedauerlicher Mißerfolg gewesen, und Hugo würde ihm nachher zweifellos Vorhaltungen machen, daß sie der Einladung ihres Gastgebers Mr. Jasper Franklyn gefolgt waren. Toby hatte seine Bekanntschaft vor einigen Tagen bei dem alten Lord Brancaster gemacht, der, wenn auch nicht mehr ganz richtig im Oberstübchen, doch jedenfalls mit Leuten von Stand Umgang pflegte; wenigstens hatte Toby das angenommen. Als Mr. Franklyn hörte, daß der unvergleichliche Marquis von Mandersely Tobys Vetter war, hatte er darauf gedrängt, beide Herren sollten ihn zu einem abendlichen Kartenspiel in der Bruton Street besuchen, und Toby, ein liebenswürdiger, umgänglicher junger Mann, hatte die Einladung gern angenommen.
Als er jetzt einen Blick auf ihren Gastgeber warf, der sich mit ungesund dunkelrotem Gesicht über den Tisch flegelte, eine altmodische, zerrupfte Perücke auf dem kahl werdenden Kopf, und Hugo unverwandt anstarrte, mußte Toby sich eingestehen, daß er sich hatte hereinlegen lassen. Mr. Franklyn hatte fast von Anfang an versucht, Hugo unter den Tisch zu trinken, und seine guten Manieren waren dabei unvermeidlich auf der Strecke geblieben.
Im Kamin sank ein Holzscheit in sich zusammen und sprühte Funken auf.
Lord Mandersely hob den Kopf und stellte sein Glas auf den Tisch. «Nun, meine Herren», sagte er gedehnt, «sollten wir jetzt nicht Schluß machen?»
Mr. Franklyn blickte wütend und rachsüchtig auf das Häufchen Goldmünzen und Schuldscheine, das vor Seiner Lordschaft lag – nicht wenig von dem Geld hatte Mr. Franklyn gehört. Er war ein waghalsiger Spieler, aber ein schlechter Verlierer. Vor allem aber konnte er den Gedanken nicht ertragen, daß all das Geld in die Taschen eines Mannes wandern sollte, der schon mehr als reichlich mit weltlichen Gütern gesegnet war.
Nichts lief so, wie Mr. Franklyn es sich vorgestellt hatte. Er war ein Mann von geradezu fanatischer Zielstrebigkeit, und dank dieser Eigenschaft war es ihm gelungen, mit einer stetig wachsenden Reihe von Tuchmanufakturen in Nord-Yorkshire ein beträchtliches Vermögen zusammenzuscharren. Im Alter von fünfzig Jahren beschloß er, sich in London ein Haus zu kaufen und fortan so zu leben, wie es einem Manne seines Reichtums und Standes zukam.
Zu diesem Behuf hatte er eine schöne und vielgereiste Ausländerin geheiratet, eine Witwe, die ihm zu verstehen gab, sie könne ihm die Wege in die gute Gesellschaft ebnen. Aber sie hatte ihm eine bittere Enttäuschung bereitet; denn schon sehr bald siechte sie an. einem Fieber dahin und hinterließ ihm eine junge Stieftochter, die ihn ebensosehr verachtete, wie er sie ablehnte.
Dennoch durfte er einige Erfolge verzeichnen. Der alte Narr Brancaster hatte ihm zu dem einen oder anderen der besseren Clubs Zutritt verschafft. Er hatte sich einen Anstrich von Kultiviertheit aneignen können, und mit seinem ständig wachsenden Vermögen im Hintergrund war er überzeugt, nur noch ein bißchen Glück zu brauchen. Gerade das schien seine Begegnung mit Captain Blanchard gebracht zu haben, dessen Vetter in seinen Augen all das verkörperte, was Franklyn am meisten mit Neid erfüllte und was er anstrebte.
Aber dieser Abend hatte von Anfang an nichts als Peinlichkeiten gebracht. Schon bald hatte er gemerkt, daß Seine Lordschaft verdammt hochnäsig war, und beim Versuch, gegen ihn anzukommen, hatte er zu oft Hilfe bei der Portweinflasche gesucht, was sowohl seinem Ansehen als auch seiner Urteilsfähigkeit schadete. Sein Spiel wurde hektisch und unkontrolliert, als sich herausstellte, daß der Marquis eine phänomenale Glückssträhne hatte. Und mittlerweile war er nicht mehr in der Verfassung, klar denken zu können.
«Sie können noch nicht aufbrechen, Mylord», murrte er. «Meine Güte, es ist gerade erst kurz nach elf. Sie müssen uns die Chance geben, ein bißchen von unserem Geld zurückzugewinnen.»
Mandersely unterdrückte ein Gähnen.
Toby sah ihn beunruhigt an. Sein Vetter konnte jetzt jeden Augenblick höllisch unangenehm werden. Hastig sagte er: «Zählen Sie nicht auf mich, Franklyn. Meine Taschen sind leer.»
Der vierte Mitspieler, ein unbedeutender kleiner Mann namens Thane, gab mit schwacher, schriller Stimme kund, auch ihm sei der Einsatz zu hoch.
Voller Wut knallte Franklyn einen Würfelbecher auf den Tisch. «Also gut, Mandersely. – Alles, was hier liegt. Ich verdoppele … wir würfeln um das Ganze! Jeder hat einen Wurf – die höchste Zahl gewinnt.»
Thane schnaufte abfällig. Toby starrte ungläubig auf Franklyn.
Der Marquis zog lediglich leicht die Augenbrauen hoch. «Es ist Ihnen doch klar, mein Freund, wieviel hier liegt?» murmelte er leise.
«Und ob mir das klar ist. Schließlich ist das meiste davon mein Geld!»
«Und Sie sind tatsächlich entschlossen, die gleiche Summe zu riskieren?»
Franklyn begann zu fluchen. Toby mischte sich gezwungen jovial ein. «Machen wir für heute Schluß, lieber Freund; wir sind alle etwas angeschlagen, und Hugo hat den ganzen Abend lang ein so unverschämtes Glück gehabt, daß sich das nicht mit einem Wurf ändern läßt.»
«Halten Sie sich da raus, Blanchard! Ich brauche keinen hübschen kleinen Soldaten, der mir Händchen hält. Zwar habe ich nicht genug Geld im Hause, Mandersely, aber ich bin Ihnen den Betrag ja wohl zehnmal gut. Sie nehmen doch einen Schuldschein?»
Lord Mandersely seufzte. «Ich glaube nicht. Es sieht so aus, als hätte ich schon eine beträchtliche Anzahl von Schuldscheinen von Ihnen. Sagen wir, ein andermal?»
Die Beleidigung war so dünn kaschiert, daß Toby den Atem anhielt. Franklyn kam schwankend auf die Füße, sein Gesicht brannte vor Wut. Draußen in der Halle fiel eine Tür ins Schloß. Mit einemmal hatte Franklyns Blick etwas Verschlagenes. «Warten Sie», lallte er und torkelte zur Tür, den Stuhl, der ihm im Wege stand, mit einem Fußtritt beiseite befördernd.
«Mein lieber Toby», sagte Seine Lordschaft, füllte das Glas nach, lehnte sich zurück und betrachtete den schimmernden Wein aus zusammengekniffenen Augen, «das Militärleben ruiniert deine Urteilskraft. Wenn du dir jetzt solche Freunde wählst, werde ich mir wohl den Umgang mit dir versagen müssen.»
Mr. Thane starrte ihn stumm an, während Toby, wütend über den Seitenhieb auf das 95. Schützenregiment, sich anschickte, ihm eine Abfuhr zu erteilen, doch das diabolische Glitzern in Hugos Augen ließ ihn innehalten; nur ein ausgemachter Narr würde es riskieren, Mandersely herauszufordern, nachdem er schon die dritte Flasche Wein angebrochen hatte. So murmelte er nur: «Sei doch still, Hugo. Wenn du auf mir herumhacken willst, schieb es auf. Er wird dich hören.»
«Das wäre mir nur recht, mein Lieber. Ich wünschte wahrhaftig, ich wäre meiner ersten Eingebung gefolgt und hätte die Einladung abgelehnt. Der Mann ist ein übler Spießbürger.»
Eine schrille, zurechtweisende Stimme unterbrach ihn. «Lord Mandersely! Es gehört sich nicht, so über Ihren Gastgeber zu sprechen.»
Mylord betrachtete aus kühlen blauen Augen Mr. Edwin Thane. Er hob das Monokel und ließ den Blick sehr langsam über die Erscheinung des Gentleman wandern. Er erfaßte das flohfarbene Seidenjackett, das der fahlen Haut so schlecht stand, und ruhte dann einen Augenblick lang ungläubig auf der Krawatte. Unter dieser stummen Musterung nahm Mr. Thanes Gesicht sehr rasch die Farbe seines das Auge beleidigenden Halstuchs an. Endlich zufriedengestellt, wandte der Marquis sich wieder an Toby.
«Was, zum Teufel, heckt der Mann jetzt aus?»
Franklyn hatte die Tür aufgerissen und brüllte wie ein Stier: «Lucia – bist du das? Verdammt noch mal, komm her!»
Toby runzelte die Stirn. «Ist das nicht die Stieftochter, die wir vorhin kennengelernt haben?»
Sein Vetter lächelte flüchtig und erinnerte sich an die verschlagene Art, in der Franklyn sie ihm als «meine kleine Lucia» vorgestellt hatte.
Für ein junges Mädchen war das grell smaragdgrüne Kleid, das viel zu tief ausgeschnitten war und jede zierliche verführerische Kurve zeigte, wenig geeignet. Gewiß, sie war ungewöhnlich genug, einen zweiten Blick zu lohnen, wenn er sich auch nichts aus Blondinen machte. Sie hatte ein feines, interessantes Gesicht, in dem am meisten die leuchtend grünen Augen mit den dunklen Wimpern und den dunklen, schön geschwungenen Brauen auffielen, die in einem kleinen Bogen ausliefen und dem Gesicht einen koboldhaften Reiz verliehen. Das Haar war von einem ungewöhnlichen Blaßgold und kunstvoll hochgesteckt.
Die Funktion des Mädchens war so offenkundig, daß er sich nur mit Mühe das Lachen verbeißen konnte. Die beiden hätten wissen müssen, daß auf ihn sehr viel klügere Frauen Jagd gemacht hatten als dieses Persönchen, das sein Kinn so hoheitsvoll reckte, als er das Glas ans Auge hob, um sie genauer zu betrachten. Mit einunddreißig war er viel zu erfahren, um auf einen so augenfälligen Versuch, ihn zu ködern, noch hereinzufallen.
In der Halle war ein erbitterter Disput im Gang; durch die offene Tür drang ein leises, verzweiflungsvolles Flüstern.
«Nein, Sir, das kann ich nicht. Ich habe mich schon für die Nacht zurückgezogen. Ich bin nur heruntergekommen, um mir ein Buch aus der Bibliothek zu holen.»
Es folgte ein Wutschrei. «Keine Widerworte, mein Fräulein. Du tust, was ich dir sage!» Franklyn kam ins Zimmer zurückgestampft und zerrte das Mädchen hinter sich her. Sie trug einen Morgenrock, den sie verzweifelt fester um sich zu wickeln suchte.
Grob schob Franklyn sie zum hellbeleuchteten Tisch und ließ sich dann schwer auf seinen Stuhl fallen.
«So, Mylord. Da Ihnen meine Unterschrift mißfällt, biete ich Ihnen einen verlockenderen Einsatz: meine Stieftochter.»
Das Mädchen stieß einen Schrei aus – dann befiel sie lähmendes Entsetzen. Tobys Stuhl rutschte krachend zurück. «Das ist ungeheuerlich! Mann, das können Sie nicht tun!»
Auch Thane erhob sich und äußerte zänkisch seine Einwände.
Allein der Marquis schien ungerührt. Nur seine Augen wurden ein wenig größer, als er die Reaktionen des Mädchens beobachtete. Aus dem geröteten Gesicht war alles Blut gewichen. Mit einer instinktiven Bewegung versuchte sie, den Morgenrock enger um die schlanke Gestalt zu ziehen, und stand dann kerzengerade und bemerkenswert gefaßt vor ihm, während er sie langsam vom Kopf bis zu den nackten rosa Füßen musterte.
Das offene, schöne, glattgebürstete Haar ließ sie viel jünger und sehr verwundbar erscheinen. Die Augen waren riesige dunkle Brunnen, aber sie hielten trotzig seinem Blick stand. Nur das rasche Heben und Senken ihrer Brust verriet sie.
Respekt, du hast Haltung, dachte Hugo mit einem Anflug von Bewunderung.
Toby wandte sich an das Mädchen. «Ich bitte Sie, Miss Mannering – ziehen Sie sich zurück – ein schreckliches Mißverständnis … das hätte nicht passieren dürfen …» Er drehte sich nach seinem Vetter um. «Hugo – sag ihm, daß du mit diesem Unsinn nichts zu tun haben willst.»
Der Marquis schickte sich an zu sprechen, als das Mädchen mit leiser, klarer, kaum merkbar zitternder Stimme sagte: «Es ist sehr freundlich, Captain Blanchard, daß Sie sich so um mich bemühen, aber es ist kein Mißverständnis. Mein Stiefvater hat eine Wette vorgeschlagen. Will Seine Lordschaft sie annehmen oder nicht?»
In den Worten wie auch in dem Blick, der sie begleitete, lag eine unmißverständliche Herausforderung. Sehr wohl, mein feines Fräulein, dachte Hugo. Wenn das Ihr Wunsch ist! Mir scheint, Sie haben eine Lehre nötig.
Er zog eine schöne emaillierte Schnupftabakdose aus der Tasche. Ohne den Blick von dem Mädchen zu wenden, ließ er sie aufschnappen. Mit einer eleganten Drehung des Handgelenks entnahm er eine Prise, ließ die Dose zuschnappen und steckte sie wieder ein.
Er lächelte mit einer Spur von Boshaftigkeit. «Seine Lordschaft nimmt an. Wie könnte ein Mann einem solchen … Angebot widerstehen?» Voller Genugtuung sah er, wie ihr die Röte in die Wangen stieg. Er drehte sich zu ihrem Stiefvater um. «Wenn Sie bereit sind, Franklyn.»
Der Mann zögerte – ergriff den Becher und würfelte.
«Eine Drei. Nicht hoch genug, fürchte ich», mutmaßte Seine Lordschaft.
Er ließ sich Zeit, nahm den Würfel und tat ihn in den Becher. Die Spannung wurde unerträglich. Dann plötzlich rollte der Würfel über den Tisch und kam vor Mr. Franklyn zum Stillstand. Die Punkte tanzten vor seinen Augen – er stierte sie begriffsstutzig an.
Lord Manderselys Brauen hoben sich. «Damit, meine ich, dürfte diese kleine Charade beendet sein.» Mit einem spöttisch-triumphierenden Blick sah er zu dem Mädchen auf.
Lucia Mannering sah ihm lange unverwandt in die Augen; kleine weiße Zähne gruben sich in ihre Unterlippe, und deutlich pulste das Blut in ihren Halsschlagadern. Wortlos drehte sie sich um, richtete einen haßerfüllten Blick auf ihren Stiefvater und verließ das Zimmer.
Toby eilte ihr nach, um ihr die Tür aufzuhalten, und stammelte mitfühlende Entschuldigungen, aber sie schüttelte nur den Kopf, und der Captain kehrte zum Tisch zurück. Jasper Franklyn saß immer noch wie versteinert da, während Hugo betont gleichgültig seine Weste zuknöpfte und den Rock zurechtzog.
«Du scheinst den Verstand verloren zu haben, Hugo! Das Mädchen ist nicht wie der Stiefvater, begreifst du? Sie ist die Enkelin vom alten Colonel Mannering, auch wenn er sie nicht anerkennt. Es hat seinerzeit einen gräßlichen Skandal gegeben – sein einziger Sohn Freddie hat eine kleine italienische Opernsängerin geheiratet – und er hat ihn enterbt, einfach so …» Toby schnippte mit den Fingern und redete sofort weiter: «Was ist bloß in dich gefahren – das arme Kind einer solchen Schande auszusetzen!»
Hugo machte ein gequältes Gesicht. «Das arme Kind hat mich absichtlich herausgefordert!»
«Unsinn! Warum sollte sie so etwas Hirnverbranntes tun?»
«Woher soll ich das wissen, lieber Vetter. Ich habe es seit langer Zeit aufgegeben, die Abgründe der weiblichen Seele auszuloten.» Er spielte gedankenverloren mit dem Band, an dem sein Monokel hing. «Fest steht nur, daß du ihr jede Möglichkeit zu einem Rückzug gegeben hast – trotzdem hat sie mich bewußt herausgefordert. Wenn also ihr Stolz jetzt geknickt ist, gib nicht mir die Schuld daran.»
Toby maß seinen Vetter vorwurfsvoll. «Ist dir klar, daß du manchmal ausgesprochen widerwärtig sein kannst, Hugo? Aber gut, noch ist ja kein Unheil geschehen. Ich bin dafür, daß wir uns jetzt auf den Heimweg machen.»
Lord Mandersely erhob sich lässig. «Lieber Toby, seit über einer Stunde möchte ich nichts lieber als das.»
Er übersah den Gastgeber, der, den Kopf auf dem Tisch, in sich zusammengesunken war, blieb aber vor Mr. Thane stehen.
«Auf ein Wort, Thane», sagte er leise. «Keine Andeutung über die Vorfälle des heutigen Abends darf laut werden.»
Mr. Thane blickte ihn verachtungsvoll an. «Ihr guter Ruf wird durch mich nicht geschädigt werden, Mylord.»
Der Marquis war leicht erheitert. «Mein guter Ruf macht mir keine Sorgen, verehrter Freund.» Er nickte ihm zu und ging mit Toby aus dem Zimmer.
In der Halle stießen sie auf ein Hindernis.
In einen dunklen Umhang gehüllt, stand Miss Mannering neben der Haustür; eine dunkle Kapuze umrahmte schmeichelnd ihr blasses Gesicht. Ihr zur Seite waren mehrere Hutschachteln aufgetürmt.
«Zum Teufel!» zischte Lord Mandersely. Schnurstracks ging er auf sie zu. «Was für einen Unsinn haben Sie sich nun schon wieder ausgedacht, Ma’am?»
«Keinen Unsinn, Mylord.» Wiederum war sie so gefaßt, daß es ihn wütend machte. «Ich wollte Eure Lordschaft nicht warten lassen und habe Anweisung gegeben, daß die Kutsche vorfährt.»
«In der Tat, haben Sie das?» Er schnaubte nur noch.
Toby stammelte zusammenhanglos: «… doch nur ein Spaß, Ma’am! … keine Minute gedacht, Sie könnten es ernst nehmen …»
Sie hörte ihm geduldig zu und drehte sich dann zu Lord Mandersely um.
«Ach, gehen Sie zu Bett, Kind!» sagte dieser ärgerlich. «Das Spiel ist aus.»
Die klaren Augen wandten sich keine Sekunde von seinem Gesicht ab, dennoch waren die Worte an seinen Vetter gerichtet.
«Captain Blanchard, ich bin so unwissend. Hat mit der Wette etwas nicht gestimmt? Ging es vielleicht nicht genau nach den Regeln?»
Toby warf sich in die Brust. «Was das betrifft, Ma’am, die Wette war in Ordnung … aber das besagt doch nicht, verstehen Sie … Hugo will daraus keinen Nutzen ziehen.»
«Aber ich will das», beharrte sie.
Toby murmelte, er wolle ihren Stiefvater wach machen, und ging zurück in den Salon.
Lord Mandersely spürte, wie Lucias Halsstarrigkeit ihn von Minute zu Minute wütender machte. Am liebsten hätte er ihr die Kapuze vom Kopf gerissen und seine Finger um ihren wunderschönen weißen Hals gelegt.
«Sehr wohl, Miss Mannering», stieß er zornig hervor. «Sie haben mich bewußt herausgefordert und sich auf meine Kosten amüsiert. Aber machen wir nun ein Ende damit.»
Er drehte sich zu dem Diener um, der mit steinernem Gesicht darauf wartete, ihm in den Mantel zu helfen – einem prachtvollen Kleidungsstück mit mehreren übereinanderfallenden Kragen.
«Mylord, es ist mir bitterernst.» Zum erstenmal war ein Zittern in ihrer Stimme. «Sie haben die Wette gewonnen – Sie müssen die Verantwortung für Ihren Gewinn auf sich nehmen.»
«Ich muß!» Er fuhr herum. Seine Stimme war wie ein Peitschenhieb. «Ich muß! Niemand hat mir zu sagen, was ich muß, Madam. Niemand!»
«Verzeihen Sie mir.» Sie sprach leise, aber drängend. «Ach, bitte, Mylord! Lassen Sie mich nicht hier!»
Hugos Augen wurden schmal; er sah ihre krampfhaft zusammengepreßten Hände. «Meinen Sie damit, daß ich Sie fortbringen soll – jetzt – heute nacht?»
«Ja.»
«Mit nicht einmal einer Zofe zur Begleitung?»
«Es gibt hier niemand Geeignetes, Sir, höchstens ein junges Mädchen. Und sie schläft sicher schon längst.»
«So. Und, was zum Teufel – Vergebung –, soll ich mit Ihnen anfangen? Sie wissen, daß ich allein lebe, abgesehen von meiner Dienerschaft.» Er ließ ihr Zeit, die Bedeutung seiner Worte zu erfassen.
Zwei Flecken brannten auf den blassen Wangen, und einen Augenblick lang sah er so etwas wie Verzweiflung in ihren Augen aufflackern. Dann reckte sie sich, und ihre Stimme bebte kaum merklich, als sie beharrlich wiederholte: «Ich will keine Nacht mehr unter diesem Dach verbringen.»
Stumm starrten sie einander an und warteten darauf, daß Toby zurückkam.
«Der vermaledeite Kerl schnarcht», brummte der Captain. «Ein Mann, der nichts verträgt, sollte nicht trinken!» Er betrachtete die beiden Widersacher mit gehobenen Brauen. «Immer noch nicht einig?»
Mandersely drehte sich zu seinem Vetter um, seine Augen funkelten. «Es hat den Anschein, als müsse ich Miss Mannering mit nach Hause nehmen.»
Toby war schockiert. «Hugo, das kannst du nicht! Wenn das bekannt wird, ist der gute Ruf der jungen Dame für immer ruiniert.»
«Lieber Vetter – davon brauchst du mich nicht zu überzeugen.»
Toby machte kehrt. «Ma’am, ich flehe Sie an! Überlegen Sie sich die Sache noch einmal.»
Sie hielt aufrührerisch seinem Blick stand.
Toby zog seinen Vetter zur Seite. Der Marquis schob Tobys Hand fort und glättete die Falten seines Ärmels. Das, was Toby für ein Flüstern hielt, war in jedem Winkel der Halle zu hören.
«Ich weiß, du wirst meine Worte nicht gern hören, Hugo. Du bist sieben Jahre älter als ich …»
«Was, nur sieben Jahre?» staunte Seine Lordschaft. «Nicht zu glauben.»
«Keine Ablenkungsversuche!» Toby mußte grinsen. «Ach, schrecklich, ich kann keine Predigt halten. Und dir schon gar nicht! Jeder weiß, wie diskret du deine Privatangelegenheiten handhabst, weitab vom Grosvenor Square. Aber Gerüchte lassen sich nicht unterdrücken. Nimm nur vorigen Sommer – die kleine portugiesische Tänzerin vom Opernballett – die Rothaarige, die dir das Paar Brauner abgeschwatzt hat.» Er schüttelte den Kopf. «Wie kann man gute Pferde nur so verschwenden! Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, Buffy Harcourt hat geschworen, du hättest sie am Grosvenor Square einquartiert, sehr bequem und passend …»
«Toby!»
«Äh?» Er folgte Hugos strafendem Blick und sah Miss Mannering, die, hochrot im Gesicht, so tat, als habe sie seine Worte nicht gehört. Er stammelte eine Entschuldigung und beschwor sie, nichts auf sein Gerede zu geben. «Dennoch – es geht nicht, meine Liebe – glauben Sie mir. Haben Sie denn keine Freundin, zu der Sie gehen könnten?»
Sie schüttelte den Kopf. «Wir haben uns meistens im Ausland aufgehalten … früher, als meine Eltern noch lebten … Ich kenne niemand in London.»
«Dann bleiben Sie am besten hier. Finden Sie sich damit ab. Ich bin sicher, daß es Franklyn morgen früh sehr leid tun wird.»
«Nein! Ich will nicht hierbleiben!»
Schweigend betrachtete der Marquis die hartnäckige kleine Person. Endlich wandte er sich ab, griff nach dem hohen Hut aus Biberpelz, setzte ihn auf, nahm Handschuhe und Stock und trat einen Schritt vor, um ihr in die Augen sehen zu können. «Dann bleibt nur eine Möglichkeit, Miss Mannering …»
Toby, der sich gerade in seinen Mantel kämpfte, starrte ihn fassungslos an. «Nein, Hugo! Entschuldige, aber das dulde ich nicht.» Er verbeugte sich tief vor Miss Mannering. «Ich bitte Sie ergebenst um Verzeihung, meine verehrte junge Dame. Mein Vetter meint es nicht so … Verstehen Sie, wir sind beide ein wenig beschwipst, Sie müssen …»
«Sprich bitte nur für dich, lieber Toby», sagte Seine Lordschaft. «Mein Verstand hat nämlich nie klarer gearbeitet.»
Toby schüttelte ernst den Kopf. «Das glaubst du nur, Hugo … bei manchen Leuten wirkt sich das so aus.»
«Ich werde Miss Mannering zu Tante Aurelia bringen.»
Toby war entgeistert. «Aber … es geht auf Mitternacht zu! Die alte Dame wird sich längst zurückgezogen haben. Liebe Güte, du kannst doch nicht an ihre Tür hämmern und sie um diese Uhrzeit aufscheuchen … die Gute wird sich zu Tode erschrecken.»
«Unsinn! Tante Aurelia ist aus hartem Holz. Und im übrigen braucht sie gar nicht gestört zu werden. Saunders wird alles Notwendige in die Hand nehmen. Saunders geht nie schlafen.»
«Na gut, du mußt es wissen.» Toby war froh, die Sache damit geklärt zu haben.
Lucia Mannering allerdings blickte unsicher von einem zum anderen. «Es wäre mir peinlich, jemandem zu so später Nachtstunde Ungelegenheiten zu bereiten.»
Der Marquis wurde wieder ärgerlich. «In diesem Fall bleiben Sie am besten hier, Ma’am», sagte er schroff.
«Ach, um Himmels willen!» Sie verbarg das Gesicht in den Händen und versuchte, ihre wirren Gedanken zu ordnen. «Nein … ich komme mit.»
«Gut. Dann wollen wir sofort aufbrechen.»
Sie setzten Toby unterwegs vor seiner Wohnung ab. Nachdem er ausgestiegen war, wurde es unerträglich still in der Kutsche. Abgesehen vom Knirschen und Rattern der Räder auf dem Kopfsteinpflaster und dem Klappern der Pferdehufe schien es kein anderes Geräusch mehr zu geben.
Der Marquis sagte kein Wort. Er lehnte in seiner Ecke der Kutsche, das Kinn tief auf der Brust, und überließ sich lässig den Schaukelbewegungen des gutgefederten Fahrzeugs.
Als die Kutsche am Portland Place hielt, richtete er sich seufzend auf. Dann stieg er aus, streckte ihr die Hand entgegen und befahl: «Kommen Sie.»
Lucia gehorchte. Mit einemmal befiel sie eine überwältigende Müdigkeit, und sie stolperte.
«Müde, Miss Mannering?»
«Ja, ein bißchen, Sir.» In Wahrheit kam es ihr vor, als sei der Abend ein einziger grausiger Alptraum gewesen, aus dem sie gleich aufwachen würde.
Die Tür zu Lady Springhopes Haus wurde bei Tag und Nacht von einem Pförtner bewacht, aber da sich nur selten zu so später Stunde noch ein Besucher meldete, pflegte er es sich bequem zu machen. Dennoch dauerte es nicht lange, bis er aufgeschreckt und auf die Suche nach Saunders geschickt worden war.
Auf der Schwelle sah sich Lucia mit großen Augen um, alle Müdigkeit war vergessen. Sie hatte sich so an Mr. Franklyns bescheidene Halle gewöhnt, daß ihr das gewaltige Marmorvestibül den Atem benahm. Eine Treppe stieg in einer eleganten, geschwungenen Kurve auf; riesige Kronleuchter hingen von der Decke, und jeder freie Platz war mit Trophäen geschmückt – ausgefallene, primitive Statuen, prächtige Masken und Schilde, Kunstwerke, wohin man blickte.
Der Marquis beobachtete ihr Staunen mit Erheiterung. Er hob das Glas ans Auge und drehte sich langsam um seine eigene Achse. «Scheußlich, nicht wahr?» murmelte er. «Mein verehrter verstorbener Onkel war ein weitgereister Mann und hatte eine wahre Sammelleidenschaft. Ich bin überzeugt, daß meine Tante, als sein Geschmack immer verschrobener wurde, sich jedesmal vor seiner Rückkehr fürchtete. Ah, Saunders …» Er drehte sich um, als der Butler sich näherte, tadellos gekleidet und völlig gelassen, genau wie Seine Lordschaft prophezeit hatte.
«Dies ist Miss Mannering. Sie befindet sich in einer schwierigen Lage. Bringen Sie sie bitte in einem der Schlafzimmer meiner Tante unter.»
Saunders hörte ihn an, ohne die geringste Überraschung zu zeigen. Er kannte Master Hugo viel zu lange, um durch einen seiner plötzlichen Einfälle aus der Ruhe gebracht zu werden, denn in jungen Jahren hatte Seine Lordschaft ständig Streiche ausgeheckt – und meistens war es Saunders gewesen, der ihm aus der Patsche geholfen hatte.
So neigte er auch jetzt nur den Kopf und sagte gemessen: «Sehr wohl, Lord Hugo. Vielleicht könnten Sie die junge Dame in die Bibliothek führen, während ich das Zimmer herrichten lasse. Weiß Ihre Gnaden von dieser Angelegenheit? Sie hat mir gegenüber nichts davon erwähnt.»
«Ob sie es weiß – natürlich nicht! Ich habe bis vor einer Stunde auch nichts davon gewußt. Keine Sorge, Saunders. Ich werde es meiner Tante morgen erklären.»
Lucia Mannering wäre am liebsten in den Boden versunken. Es war leicht, sich vorzustellen, was dieses steife alte Faktotum dachte. Das Blut stieg ihr in die Wangen, und sie wollte gerade sagen, daß sie augenblicklich nach Hause zurückkehren möchte, als oben auf der Treppe ein Geräusch zu hören war.
«Großer Gott! Tante Aurelia!»
Eine seltsame Erscheinung kam langsam die Treppe herab und blieb wenige Stufen über ihnen stehen: eine winzige, runde Gestalt in einem voluminösen Hausmantel. Eine Spitzenhaube saß auf einer Fülle verblaßten roten Haars, das in einen langen, schweren Zopf geflochten war.
Der hoheitsvolle Blick, mit dem sie ihren Neffen betrachtete, war dem seinen so ähnlich, daß die Verwandtschaft unverkennbar war. Eine wahrhaft beeindruckende alte Dame.
«Nun, mein lieber Neffe», sagte sie mit vorwurfsvoller Stimme, «ich darf wohl annehmen, du hast einen guten Grund, mitten in der Nacht Staub aufzuwirbeln und den Frieden meines Hauses zu stören.»
«Ich wollte dich keineswegs stören, Tante Aurelia. Es tut mir unendlich leid. Ich hatte nur die Absicht, Miss Mannering für eine Nacht hierherzubringen, da sie gezwungen war, ihr Heim zu verlassen.»
Lady Springhope richtete sich noch gerader auf. Ihre Nasenflügel bebten. «Darf ich dich um Aufklärung bitten, Hugo. Ich bin in letzter Zeit wenig in Gesellschaft gewesen. Ist es derzeit Mode, seine chère amie bei der eigenen Familie einzuquartieren?»
Ihre Worte trieben Hugo die Röte ins Gesicht. «Das ist Ihrer unwürdig, Ma’am», stieß er zwischen den Zähnen hervor. «Nie würde ich Sie auch nur dem Hauch eines Skandals aussetzen. Ein Blick genügt, und Sie wissen, daß Miss Mannering nicht das ist, was Sie von ihr denken.»
Lucia war am Ende ihrer Kräfte. Sie war abscheulich schlecht behandelt worden, man hatte sie gedemütigt und tyrannisiert, und nun dies, diese letzte Beleidigung. Die Kehle schnürte sich ihr zu; zwischen Lachen und Weinen rang sie nach Luft. «Oh, Sir, lassen Sie uns ein Ende machen! Ich hätte nicht kommen dürfen. Ich gehe zurück!»
«Unsinn. Es gibt gar keine Schwierigkeit. Meine Tante wird sich nicht weigern, Sie aufzunehmen.»
«Kommen Sie her, Miss Mannering», befahl Lady Springhope.
Lucia sah aus, als wolle sie sich widersetzen; dann schritt sie langsam zum Fuß der Treppe.
«So, mein Kind, und jetzt nehmen Sie die Kapuze ab. Wenn Sie sich darunter verstecken, kann ich Sie nicht richtig sehen.»
Wiederum zögerte sie. Dann schob sie die Kapuze zurück und blickte trotzig zu der alten Dame auf.
Lady Springhope sah in die feindseligen grünen Augen, die weit aufgerissen waren, um die Tränen zurückzuhalten. Sie sah das silbern und golden schattierte Haar, die feinknochigen, zerbrechlichen Züge. Flüchtig trat ein Ausdruck von Wiedererkennen in ihr Gesicht, doch er verschwand sofort. «Hm! Saunders?»
Der alte Butler, der sich diskret in den Hintergrund zurückgezogen hatte, trat stumm näher.
«Saunders, lassen Sie das Rosenzimmer richten.»
«Dazu habe ich mir schon die Freiheit genommen, Mylady.»
«So, haben Sie das?» Sie warf ihm einen scharfen Blick zu und schnaubte. «Hugo hat Sie schon immer um den Finger zu wickeln verstanden.» Sie wandte sich um und sagte über die Schulter: «Ich werde Sie am Vormittag rufen lassen, Miss Mannering. Und du, Hugo, wirst mir mittags deine Aufwartung machen. Gute Nacht.»
Lucia starrte ihr nach, bis Lord Mandersely hinter ihr sagte: «Sie ist keineswegs so furchteinflößend, wie sie es Ihnen vorspielen will, Miss Mannering.» Mit einer hastigen, erschrockenen Bewegung fuhr sie herum, und er sah, wie blaß und erschöpft sie war. «Ich lasse Sie jetzt in Saunders’ guten Händen. Sie werden zum Umfallen müde sein, denke ich.» In seinen Augen blitzte der Anflug eines Lächelns auf. «Sie haben einen beklagenswerten Abend hinter sich. Ich wünsche Ihnen erfreulichere Träume.»
«Danke.»
Er verließ das Haus. Sie mußte das Verlangen unterdrücken, einfach hinter ihm her zu laufen, ihn zurückzurufen. Es kam ihr vor, als ließe sie ihr einziger Freund im Stich – ein lächerlicher Gedanke, sagte sie sich niedergeschlagen.
Saunders hustete, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. «Wenn Sie mir folgen möchten, Miss.» Sie ging hinter ihm die Treppe hinauf und durch Korridore, die sie schwindlig machten, bis Saunders endlich eine Tür öffnete. Sie nahm das Zimmer kaum in sich auf, wenn sie auch dankbar feststellte, daß im Kamin ein Feuer brannte und ihre Hutschachteln sie erwarteten.
«Haben Sie noch irgendwelche Wünsche, Miss Mannering? Ich fürchte, die Hausmädchen schlafen alle schon, doch ich könnte eine von ihnen rufen lassen.»
«Aber nein», sagte sie rasch, «das möchte ich auf gar keinen Fall. Sie sind mehr als freundlich gewesen. Glauben Sie mir, ich brauche nichts.»
Saunders zog sich mit einer Verbeugung zurück und ließ Lucia allein.
2
Lucia hatte geglaubt, sie brauchte nur den Kopf auf das Kissen zu legen, dann würde sie sofort einschlafen, aber sie wälzte sich noch stundenlang von einer Seite auf die andere. Ihre Gedanken jagten sich und kehrten mit erbarmungsloser Beharrlichkeit zu dem bedeutungsvollen Schritt zurück, den sie getan hatte. Je länger sie darüber nachdachte, desto deutlicher erkannte sie, zu welch eklatanten Fehldeutungen ihre Handlungsweise führen konnte.
In der Dunkelheit ließ das gelegentliche Aufflackern des sterbenden Feuers verzerrte Schatten über die Zimmerdecke huschen. Ihr Gesicht brannte, und sie vergrub es in dem kühlen, zart duftenden weichen Kissen.
Allmählich glitt sie in das Niemandsland zwischen Wachen und Schlafen, verfolgt von flüchtigen, wirren, angstvollen Träumen. Sie befand sich auf einer Art Phantasieauktion, bei der ein rasend gewordener Mr. Franklyn die Steigerer immer höher trieb, allen voran ein großtuerischer, rothaariger Mann, der sie mit dreisten, lüsternen Blicken verschlang. Hin und wieder beugte er sich vor, um sie zu streicheln, wobei er seine Hände lange auf ihr ruhen ließ … Die Gebote stiegen höher und höher, ebenso wie ihre Hilferufe, aber während der ganzen Zeit lag Lord Mandersely zurückgelehnt in seinem Stuhl und schüttelte lächelnd den Kopf.