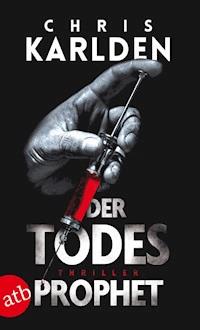4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Medikament, dessen Nebenwirkungen unvorhersehbar sind. Eine Entscheidung, die einen wahren Albtraum heraufbeschwört. Aufgrund einer seltenen Erkrankung verschwimmen für den jungen Anwalt Jan Flemming zunehmend die Grenzen zwischen Realität und falscher Wahrnehmung. Seinen Job in einer renommierten Hamburger Kanzlei musste er deshalb bereits aufgeben. Zudem droht seine Ehe unter der Last der immer schlimmer werdenden Symptome zu zerbrechen. Da er seine Frau nicht verlieren will, stellt er sich als Testpatient für ein Heilung versprechendes Medikament zur Verfügung. Kurz darauf passieren schreckliche Dinge, in die Jan verstrickt zu sein scheint. Um seine Unschuld zu beweisen, ermittelt er auf eigene Faust. Dabei stößt er auf Erkenntnisse, die ihn zutiefst schockieren und eine Wahrheit, die alles verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DAS MEDIKAMENT
PSYCHOTHRILLER
CHRIS KARLDEN
INHALT
Über den Autor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
EINE WOCHE SPÄTER
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Gebrauchsinformation
Danksagung
Die Speer & Bogner Thriller-Reihe
ÜBER DAS BUCH
Aufgrund einer seltenen Erkrankung verschwimmen für den jungen Anwalt Jan Flemming zunehmend die Grenzen zwischen Realität und falscher Wahrnehmung. Seinen Job in einer renommierten Hamburger Kanzlei musste er deshalb bereits aufgeben. Zudem droht seine Ehe unter der Last der immer schlimmer werdenden Symptome zu zerbrechen. Da er seine Frau nicht verlieren will, stellt er sich als Testpatient für ein Heilung versprechendes Medikament zur Verfügung. Kurz darauf passieren schreckliche Dinge, in die Jan verstrickt zu sein scheint. Um seine Unschuld zu beweisen, ermittelt er auf eigene Faust. Dabei stößt er auf Erkenntnisse, die ihn zutiefst schockieren und eine Wahrheit, die alles verändert.
ÜBER DEN AUTOR
Chris Karlden, Jahrgang 1971, studierte Rechtswissenschaften und arbeitet als Jurist in der Gesundheitsbranche. Sein erster Psychothriller »Monströs« wurde zum E-Book-Bestseller. Seitdem sind von ihm mehrere Thriller in verschiedenen Verlagen und im Selfpublishing erschienen. Der Autor lebt mit seiner Familie grenznah zu Frankreich und Luxemburg im Südwesten Deutschlands. Mehr Informationen zum Autor unter https://chriskarlden.de
Das Medikament
Copyright © 2018 by Chris Karlden
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
unter Verwendung von Motiven von FinePic / shutterstock
Erweitertes Korrektorat: Manuela Tiller
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Reche vorbehalten. Jedwede Verwendung des Werkes darf nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors erfolgen. Dies betrifft insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung.
Dies ist ein fiktiver Roman. Die Figuren und Ereignisse darin sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit echten Personen, lebend oder tot, wäre zufällig und nicht beabsichtigt.
ZU RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
lesen Sie die am Ende des Buches abgedruckte Gebrauchsinformation.
1
Ich habe Angst vor den Nächten mit ihren unendlich langen Stunden des Wachseins und den kurzen albtraumbehafteten Schlafperioden dazwischen. Meine daraus resultierende Müdigkeit ist schmerzhaft. Sie verursacht mir Übelkeit. Sie ist mein Goliath, gegen den ich täglich kämpfe und gegen den ich, anders als David, stets den Kürzeren ziehe. Sie ist mein Stein des Sisyphus, den ich Tag für Tag von Neuem beginne, den Berg hinaufzurollen, und sie ist meine Windmühle aus Cervantes Don Quichotte. Meine Müdigkeit hat mich verwandelt. Das bin nicht mehr ich, der da benommen durch die Tage schlingert und wankt. Das ist ein anderer. Eine schlechte Kopie von mir. Eine Fälschung. Das Leben sollte sich anders anfühlen. Ich weiß es, denn ich habe einmal gelebt.
Fünf Monate zuvor
Meine Stirn knallt dumpf krachend auf die Kante meines Schreibtischs. Der heftige Schmerz reißt mich wie eine Explosion aus dem Schlaf. Für den Bruchteil einer Sekunde weiß ich nicht, woran ich bin und was mit mir geschieht. Dann, als es mir klar wird, ist es bereits zu spät.
Der Zusammenprall meines Schädels mit der Tischkante hat wie bei einer Billardkugel, die gegen die Bande gespielt wird, meine Fallrichtung verändert. Alles geht so rasend schnell, dass es mir unmöglich ist, mich zu regen, geschweige denn, mich abzufangen. Ich kann nur registrieren, was passiert, während Blut über mein Gesicht schießt, Adrenalin mich durchflutet und Panik meinen Atem erdrückt.
Ich stürze mit Schulter und Kopf voran auf das Eichenparkett. Es ist, als würde ein Boxhandschuh aus Beton gegen meinen Schädel donnern. Ich werde ohnmächtig. Dann pulverisieren Lichtblitze die Dunkelheit und mein Bewusstsein kehrt zurück. Das Bild einer zerplatzten Wassermelone, deren rosarotes Fleisch auf dem Boden verteilt liegt, kommt mir in den Sinn. Mir wird schlagartig übel. Der Kaffee, den ich vorhin getrunken habe, drängt sich bitter meine Speiseröhre hinauf. Ich würge, schlucke schwer und verhindere knapp, dass ich mich übergeben muss. Als ich die Augen langsam öffne, erkenne ich eine Blutlache, die sich langsam unter meinem Kopf ausbreitet. Ich stöhne auf und schließe wieder die Augen. Für einen Moment bleibe ich reglos auf der Seite liegen und atme schwach vor mich hin. Ein kratzendes Rauschen wie bei der vergeblichen Suche nach einem Radiosender tritt in meine Ohren. Dadurch bemerke ich, dass ich seit meinem Aufschlag auf den Boden taub war und bis jetzt rein gar nichts mehr gehört habe. Plötzlich ist das Rauschen weg, und als hätte jemand Stöpsel aus meinen Gehörgängen gezogen, nehme ich die Umgebungsgeräusche wieder wahr.
Die eiligen Schritte zweier Personen klappern über den Holzfußboden. Businessschuhe mit harten Ledersohlen. Ich lege meine Hand auf die Stelle über der rechten Augenbraue, die so höllisch wehtut, und spüre das feuchte warme Blut an meinen Fingern. Als ich mich langsam auf den Rücken drehe und die Augen wieder öffne, sehe ich verschwommen in die Gesichter von Boris Jasper und Alexander Wellenstein, die beide in die Knie gegangen sind und sich über mich beugen.
Vor elf Jahren haben Boris und Alexander ihre Kanzlei Jasper & Wellenstein gegründet, und im Laufe der Zeit hat sich diese zu einer der angesehensten Anwaltssozietäten Hamburgs entwickelt. Mir ist instinktiv klar, dass aus meinem großen Ziel, Juniorpartner zu werden, nun nichts mehr wird. Ich verziehe die Mundwinkel zu einem gequälten Lächeln und erkenne an der in Falten gelegten Stirn von Boris und in den Blicken beider eine Mischung aus Besorgtheit und Missbilligung. Ich hätte es nicht so weit kommen lassen dürfen und meinen Platz schon vor Wochen räumen sollen. Einige peinliche Momente wären uns erspart geblieben, wie zum Beispiel der, als ich letzte Woche während einer Besprechung mit allen Anwälten der Kanzlei eingeschlafen bin, und mit dem, was nun geschehen ist, als Höhepunkt. Es geht um den Ruf der Kanzlei. Das besagen ihre Blicke, und sie haben recht. Alexander reicht mir mehrere Papiertaschentücher, die ich auf meine Wunde presse.
»Herr Flemming ist plötzlich umgekippt.«
Ich erkenne die zittrig helle Stimme meiner siebenundvierzigjährigen Mandantin. Mein Beratungstermin mit ihr war gerade beendet. Ich wollte sie zur Tür meines Büros begleiten, um mich dort von ihr zu verabschieden. Mit einem gewinnenden Lächeln erhob ich mich von meinem Drehsessel und wandte mich zur Seite, um hinter meinem Schreibtisch hervorzukommen. Dann schlief ich ein. Abrupt und aus heiterem Himmel. Vermutlich sind meine Beine weggesackt und mein Oberkörper ist mit Schwung vornübergefallen. Die teuflische Präzision, mit der meine Stirn auf der Tischkante aufschlug, ist bemerkenswert.
»Sollten Sie nicht einen Rettungswagen verständigen?«
Die Stimme meiner Mandantin, die ich nicht sehe, aber irgendwo in der Nähe der Tür stehend vermute, klingt hysterisch. Um ihre Nerven ist es momentan nicht gut bestellt. Ihr Mann hat sie betrogen, und ich durfte daraufhin die Scheidung für sie einreichen. Dass ich vor ihr zusammengebrochen bin, muss verstörend für sie gewesen sein. Ich sehe vor mir, wie die Frau hilferufend ins Foyer gerannt ist, was dann Boris und Alexander auf den Plan geholt und vermutlich alle anderen zurzeit in der Kanzlei anwesenden Mandanten in Angst und Schrecken versetzt hat.
Schmerzlicher als meine pochende Stirn empfinde ich meine Scham gegenüber meiner Mandantin. Mein unrühmlicher Kontrollverlust, mein Einschlafen und Hinfallen zeugen von Schwäche. Wie soll sie mir jemals wieder die nötige Stärke zutrauen, sie bestmöglich zu vertreten?
»Das ist nicht so wild, wie es aussieht«, beschwichtigt Boris unterdessen die Frau.
Als ich mich erhebe, greifen er und Alexander mir unter die Arme und helfen mir auf meinen Schreibtischsessel.
»Tut mir leid«, sage ich zu meiner Mandantin. »Danke, dass Sie so besorgt um mich sind, aber es ist wirklich wieder alles in Ordnung. Wäre die Tischkante nicht im Weg gewesen, man würde mir nichts ansehen.« Ich lächle schief, glaube aber nicht, dass sie mir meine gespielte Unbekümmertheit abnimmt.
»Sie haben mir einen gehörigen Schrecken eingejagt«, sagt sie schließlich und zieht missmutig die Augenbrauen hoch. Dann lächelt sie. »Aber Hauptsache, es ist nichts Schlimmeres mit Ihnen.« Sie nickt mir, Boris und Alexander zum Abschied freundlich zu, dreht sich auf ihren hohen Absätzen um und verlässt das Büro in Richtung Ausgang. Dabei stößt sie fast mit Annette, einer jungen Büroangestellten, zusammen, die mit einem Erste-Hilfe-Koffer herbeieilt. Annette bietet sich an, meine Wunde medizinisch zu versorgen. Ich danke ihr, möchte das aber lieber selbst machen. Die Vorstellung, vor den Augen meiner Chefs von einer Mitarbeiterin ein Pflaster aufgeklebt zu bekommen, empfinde ich als demütigend. Ich nehme mir aus dem Koffer, was ich brauche und gehe ins WC. Auf dem Weg durch den Flur dorthin wird mir schwindlig und meine Kopfschmerzen nehmen zu. Vor dem WC-Spiegel muss ich mich kurz auf dem Waschbeckenrand abstützen. Dann wasche ich das Blut von meinem Gesicht und nehme anschließend eine Ibuprofen Tablette, die ich mit Leitungswasser hinunterspüle. Der Bereich um den etwas mehr als zwei Zentimeter langen Riss über meiner rechten Augenbraue weist bereits eine deutliche Schwellung auf. Um die klaffende Wunde zusammenzuhalten, klebe ich zwei schmale Haftstreifen quer über den Cut und überdecke die Stelle anschließend noch mit einem großen Pflaster. Mein Schädel dröhnt und mir ist noch immer speiübel. Aber ich will nicht ins Krankenhaus oder zu einem Arzt. Ich will arbeiten. In einer halben Stunde habe ich den nächsten Termin mit einem meiner wichtigsten Mandanten. Mein weißes Hemd ist im Brustbereich von meinem Blut rot getränkt, und mein dunkler Anzug ist von Flecken überzogen, die sich deutlich abzeichnen. Aber ich habe Wechselkleidung im Garderobenschrank meines Büros deponiert. Ich lächle meinem Spiegelbild aufmunternd zu. »Du bist wieder da«, sage ich zu mir.
Das Mandantengespräch läuft hervorragend.
»Ich boxe in meiner Freizeit«, antworte ich, als der Mandant mich auf das Pflaster auf meiner Stirn anspricht.
Eine halbe Stunde nach dem Termin kommen Alexander und Boris zu mir ins Büro und legen mir mit betretenen Mienen nahe, mich unverzüglich krankzumelden und meine Tätigkeit als Anwalt ruhen zu lassen.
2
Heute
Es ist kurz nach achtzehn Uhr. Draußen ist es bereits dunkel. Doch mein Weg durch den kleinen Park, der nur zehn Gehminuten von unserem Haus entfernt in nordwestlicher Richtung auf der anderen Seite der Alster liegt, ist beleuchtet. Die Kronen der Bäume sind kahl und die ehemals grünen Blätter bedecken braun und nass den Weg. Es ist Anfang November und die Temperaturen liegen nur noch knapp über dem Gefrierpunkt. Ich fröstle, vergrabe die Hände in meinen Manteltaschen, bleibe stehen und blicke in den wolkenverhangenen Himmel. An einer Stelle blitzt ein Stern durch eine Wolkenlücke. Ich atme die frische, nasskalte Luft tief ein und halte sie an, solange ich kann. Währenddessen zähle ich die Sekunden, und als ich wieder ausatme, bilden sich weiße Wölkchen vor meinem Mund.
Ich vermisse mein früheres Leben, meine Freunde, die nach meiner Erkrankung mit der Zeit immer weniger wurden, das Tennisspielen und insbesondere an lauen Sommerabenden das gesellige Beisammensein danach. Ich vermisse es, ausgeruht und voll Energie in den Tag zu starten. Ich vermisse meine Arbeit, meine Kollegen und meine Mandanten. Ich vermisse den Blick aus dem Fenster meines im dritten Stockwerk gelegenen Büros, von wo aus ich das geschäftige Treiben von Fußgängern und Autos auf der Straße darunter beobachten konnte und von wo aus ich durch die Gebäudeflucht auf das Alsterfleet sah. Manchmal glaube ich, das edle Kirschbaumholz meines Büroschreibtischs unter meinen Fingern zu spüren, wenn ich morgens meine Hände auf den Küchentisch lege und die Augen schließe. Aber ich kann es verstehen. Eine Kanzlei von Rang und Namen kann sich keinen vor Müdigkeit gereizten und unkonzentrierten Anwalt erlauben, der mitten im Beratungsgespräch mit seinen Mandanten einschläft. Boris und Alexander wussten schon damals, dass es für mich keine Wiederkehr in ihre Kanzlei geben würde. Bereits drei Wochen später saß eine junge Anwältin mit einem halben Jahr Berufserfahrung an meinem Schreibtisch. Aber sie haben damals »ruhen lassen« gesagt, vom Aufgeben meines Jobs, von der Endgültigkeit haben die beiden kein Wort erwähnt. Das war sehr feinfühlig von ihnen. Das zeichnet gute Anwälte aus. Sie geben sich verständnisvoll wie Mitreisende auf einem sinkenden Schiff. Ich weiß, ich tue Boris und Alexander unrecht. In Wirklichkeit bin ich vermutlich nur verbittert. Ich habe fünf Jahre neben acht weiteren Anwälten unterschiedlicher Fachrichtungen am Standort Neuer Wall in unmittelbarer Nähe der Alsterarkaden, des Jungfernstiegs und des Rathauses für die beiden gearbeitet. Ich wäre wirklich gern Partner in ihrer Kanzlei geworden. »Stopp«, sage ich zu mir selbst und lasse diese mich traurig machenden Erinnerungen verschwinden. Stattdessen stelle ich mir vor, wie Barb zur Tür hereinkommt, ich ihr einen Kuss gebe, sie in die Arme schließe und sie lange festhalte. Ich lächle. Wenn sie in einer halben Stunde von der Arbeit kommt, will sie nicht mehr nach draußen in die Kälte. Sie wird müde sein, und ich will nur eins: bei ihr sein. Das Haus ist ein anderes, wenn sie darin ist. Wärmer, von Leben erfüllt. Sie wird etwas essen, es sich danach auf der Couch gemütlich machen, ein Buch zur Hand nehmen oder den Fernseher anschalten. Meine Frau Barbara ist ein Engel. Sie kümmert sich rührend um mich, versucht, die Krankheit zu akzeptieren, mich aufzubauen, mich nicht spüren zu lassen, dass ich heute nicht mehr derselbe Mann bin, den sie vor vier Jahren geheiratet hat.
Am östlichen Ende des Parks treffe ich auf ein paar Jugendliche, die auf einer Holzbank herumlungern. Sie hören Musik, rauchen, sind albern und trinken etwas. Einer von ihnen wünscht mir grinsend einen guten Abend. Ich weiß nicht, ob es ernst gemeint ist oder er sich nur über mich lustig machen will. »Danke, ebenso«, sage ich und fühle mich dabei sehr viel älter als die sechsunddreißig Jahre, die ich morgen werde.
Im Anschluss an den Park führt mich mein Spaziergang ein kurzes Stück an der Bundesstraße vorbei, dann biege ich rechts in eine Seitenstraße ab und gehe unmittelbar vor der Brücke nach links weiter. Dort führt eine schmale Straße am Ufer der Alster vorbei. Der Bürgersteig auf der linken Seite ist von in die Jahre gekommenen Häusern mit großen Grundstücken gesäumt, und an den Grünstreifen rechts neben der Straße schließt sich das Alsterufer an.
Die meisten der Wohngebäude hier haben noch die für Hamburg typischen roten Klinkerfassaden. Bei Tag kann man erkennen, dass die Fugen zwischen den Klinkern oftmals eine Erneuerung nötig hätten. Vermutlich leben in diesen Häusern noch die Menschen, die sie erbaut haben. In dem Viertel, in dem Barb und ich wohnen, ist der Generationswechsel hingegen deutlich sichtbar. Fast alle neuen Eigentümer haben ihren in den 50er-Jahren erbauten Häusern Rundumsanierungen spendiert und vielfach dabei die Klinker durch moderne Wärmeverbundsysteme mit glatten Putzfassaden ersetzt. Einige haben die roten Klinker einfach weiß gestrichen. Hinzu kommen neu angelegte Vorgärten, Zäune aus Edelstahl und herausgerissene Küchenwände, die die kleinen Räume an Größe gewinnen lassen. Barb und ich kämen nicht auf die Idee, an der Fassade unseres Hauses etwas zu ändern. Wir lieben unser leicht windschiefes Rotklinkerhaus mit seinem spitzen Satteldach, seiner einfachen weißen Haustür, die über wenige Treppenstufen erreichbar ist, und seinem Giebel, der wie bei allen übrigen Häusern im Nelkenstieg, die auch sonst ungefähr baugleich sind, zur Straße zeigt. Wir lieben den kleinen, leicht verwilderten Vorgarten, von dem ein mit einfachen grauen Betonplatten belegter Weg zur Vordertreppe führt und den eine schulterhohe Hainbuchenhecke zu einem Bürgersteig abgrenzt. Dieser ist so schmal, dass wenn sich darauf ausnahmsweise einmal zwei Personen begegnen, eine auf die ebenfalls enge Straße treten muss, um aneinander vorbeizukommen, was aber wiederum gefahrlos möglich ist, da der Nelkenstieg so wenig befahren wird, wie der Bürgersteig begangen wird. Viele unserer Nachbarn sind ungefähr so alt wie wir und stammen wie Barb und ich aus den umliegenden Stadtteilen des Bezirks Hamburg-Nord. In den letzten Jahren ziehen aber auch vermehrt Familien mit kleinen Kindern aus der Stadtmitte zu uns. Das hat die Immobilienpreise in die Höhe getrieben. Doch ein kleines Häuschen kann man sich hier noch immer um einiges besser leisten als in der Nähe der Innenstadt, die zudem nur gut zwanzig Minuten mit der Bahn oder etwa eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt liegt.
Ich gehe diesen meinen Weg seit fünf Monaten fast jeden Abend. Im Sommer später, im Herbst früher, Hauptsache es ist dunkel. Bei Tag, wenn alle Welt arbeitet, durch die Gegend zu schlendern, käme mir falsch vor, und ich würde mich beobachtet fühlen, würde die Blicke der hinter den Fenstergardinen stehenden Menschen in meinem Rücken spüren, obwohl sie gar nicht da wären. Sobald es aber dunkel ist, habe ich die Welt draußen fast für mich allein. Um diese Zeit begegnen mir meist nur noch Hundebesitzer, die mit ihren Tieren vor Einbruch der Nacht Gassi gehen. Der Rest der Menschen scheint nur noch mit dem Auto unterwegs zu sein. Bürgersteige in einem Dorf erscheinen mir daher oft wie ein überkommenes Relikt aus einer anderen Zeit. Einer Zeit, als es noch an jeder Ecke kleine Lebensmittelläden gab, zu denen man sich zu Fuß aufmachte und nur so viel kaufte, wie man an einem Tag verbrauchte und in eine Tragetasche passte.
Als ich an dem einen im Verfall begriffenen Haus ankomme, bleibe ich dort wie immer stehen und betrachte es. Das Haus fasziniert mich. Es ist das einzige in dieser Straße, das derart heruntergekommen ist, und wirkt deshalb deplatziert und unwirklich, und doch ist es da. So wie meine Krankheit. Ich frage mich, wie viele Jahre es schon leer steht und ob es in zwanzig Jahren noch da sein wird. Wenn ja, wird es bis dahin nur noch eine Ruine sein, es sei denn, jemand nimmt sich ein Herz und renoviert es. Das Haus ist umgeben von Unkraut, und eine viel zu hohe Tanne neigt sich gefährlich über das moosbesäte und mit porösen Betonziegeln bedeckte Dach. Das bleiche, einst dunkle Holz der Haustür ist verzogen, sodass sie schief in den Angeln sitzt und ein breiter Spalt zwischen Türblatt und Laibung klafft. Der Mauerputz bröckelt großflächig ab und das Garagentor ist verbeult und rostig. Doch etwas ist heute anders als sonst.
Durch die schmutzige Gardine des Fensters rechts neben der Haustür scheint ein schummriges Licht, wie von einer Kerze, aber hell genug, um zu erkennen, was im Inneren vor sich geht. Schatten, die vermutlich zu einem Mann und einer Frau gehören, zeichnen sich plötzlich übergroß auf der Zimmerwand ab. Ich schrecke zusammen und ein Schauder überläuft mich, als der Mann beide Hände um den Hals der Frau legt und es so aussieht, als würde er sie würgen und dabei zu Boden drücken.
Ich spüre, wie ich mich vor Aufregung verkrampfe, obwohl ich weiß, dass ich gelassen bleiben muss. Ich renne über den Weg zur Haustür und rüttle daran. »Aufmachen«, schreie ich. »Hören Sie sofort damit auf.« Ein Poltern dringt nach draußen. Mir stockt der Atem. Mein Herz pocht lautstark gegen meine Brust. Mein Gesicht wird taub. Ich trete nah an das Fenster heran. Doch die dichte Gardine lässt mich immer noch nur schemenhaft erkennen, was in dem Zimmer dahinter passiert. Die Frau liegt am Boden. Sie strampelt mit den Beinen, während der Mann auf ihr sitzt und ihren Hals umklammert. Ich meine, ein Röcheln zu vernehmen. Mit der linken Hand trommle ich gegen die Scheibe. »Aufhören«, schreie ich wieder und zerre mit der Rechten mein Handy aus der Manteltasche hervor. Es ist, als ob der Mann im inneren mich nicht hören würde, denn er macht ungerührt weiter. Die Beine der Frau zucken nur noch. Meine Hände zittern, als ich die Nummer des Notrufs eingebe. »Kommen Sie schnell, hier geschieht ein Verbrechen.« Es gelingt mir noch, die Adresse zu nennen. Dann fällt mir das Mobiltelefon aus der Hand. Meine Beine erlahmen. Ich sinke zu Boden, liege vor der Tür und kann mich nicht mehr bewegen. Die Haustür bleibt verschlossen. Kein Geräusch ist mehr von innen zu vernehmen. Ich weiß, dass ich atmen kann, spüre aber nicht, dass ich es wirklich tue. Todespanik überkommt mich. Der Strahl einer Taschenlampe trifft auf meine Beine und wandert hoch bis zu meinem Gesicht. Gefühlt sind höchstens zehn Minuten vergangen. Eine weitere Taschenlampe strahlt auf die Haustür und das Fenster. Über mir höre ich das Rauschen der riesigen Tanne im Wind.
»Sind Sie verletzt?« Eine junge Polizistin beugt sich zu mir herunter. Ich will mich aufrichten, meinen Kopf schütteln und ihr sagen, dass ich gleich wieder okay bin. Aber ich kann nicht sprechen und ich kann mich nicht bewegen. Es ist ein grausames Gefühl, bei vollem Bewusstsein im eigenen Körper gefangen zu sein, und das Einzige, das funktioniert, sind die von abgrundtiefer Furcht getriebenen Gedanken.
»Sieht nach einem Schock aus«, raunt der ältere Polizist, der bei ihr ist, und fordert einen Rettungswagen an.
3
Von meinem Platz am Esszimmertisch sehe ich durch die offene Tür auf die aufgeräumten Arbeitsplatten unserer modernen Küche. Barbara sitzt mir gegenüber mit Blick auf die weiß getünchte Wand, an der das Ölgemälde einer von bunten Blumen übersäten Sommerwiese hängt. Auf dem Sideboard darunter stehen große handgeschnitzte Holzbuchstaben, die das Wort WELCOME bilden. Barb stößt einen tiefen Seufzer aus. Meine Hände ruhen hilflos wie zwei an Land gespülte Seesterne auf der gläsernen Tischplatte.
Der Blick, mit dem der ältere Polizist mich durchbohrte, als er aus dem unbewohnten Haus kam, dessen Haustür er zuvor mit einem Fußtritt geöffnet hatte, will mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Darin lag eine Mischung aus Zorn und Verachtung. Seine Kiefermuskeln zuckten. Aber er machte mir keinen Vorwurf. Die Kataplexie, die mich in ihrem lähmenden Griff hatte, war wie immer von selbst verschwunden, und dass ich plötzlich ohne ärztliche Hilfe wieder reden und mich bewegen konnte, als er aus dem Haus kam, machte ihn vermutlich noch misstrauischer.
»Dadrin ist niemand«, sagte er nur und überrumpelte mich damit so sehr, dass ich ihn nur erstaunt ansehen, aber auf Anhieb kein Wort herausbringen konnte. Seine junge Kollegin kam unmittelbar hinter ihm aus dem Haus und trat neben ihn. Vorwurfsvoll starrten mich beide an. Ich zuckte verlegen mit den Schultern. »Ich kann mir das nicht erklären«, stammelte ich schließlich und startete damit einen vergeblichen Versuch, meinen Anruf bei der Polizei zu entschuldigen. Ich erzählte, dass ich an einer seltenen Autoimmunerkrankung leide, die der Grund für den Zustand sei, in dem sie mich vorgefunden haben. Bereits nach meinen ersten Worten hatte ich den Eindruck, dass sie sich gedanklich verabschieden und nicht mehr zuhören würden. Vor allem spürte ich, dass sie mir nicht glaubten, dass ich in dem Haus jemanden gesehen hatte. Sie hielten mich vermutlich für einen Spinner. Genauso gut hätte ich zu der Tanne im Garten des Hauses sprechen können. Schließlich meldete die Polizistin per Funk an die Zentrale, dass es sich um einen falschen Alarm gehandelt habe, bestellte den Rettungswagen ab, und das war´s.
Mit wässrig schimmernden Augen sieht Barb mich an und knabbert auf ihrer Unterlippe. Langsam schiebt sie ihre Hand über den Tisch und legt sie auf meine.
Wir schweigen. Wir haben in letzter Zeit gemeinsam einiges ertragen müssen. Wir geraten nicht mehr so leicht aus der Fassung.
»Du weißt, dass ich es nicht mag, wenn du abends im Dunkeln allein spazieren gehst«, sagt sie schließlich. »Du hast das immer damit abgetan, dass ja noch nie was passiert sei. Aber jetzt kannst du das nicht mehr so einfach behaupten.«
Ich senke den Blick und streife mit meinen Händen durch mein Haar. Ich weiß, dass sie recht hat, will es aber nicht zugeben. Ich komme mir vor wie ein kleines Kind, das Mist gebaut hat, und muss aufpassen, dass ich nicht wieder in stummes Selbstmitleid versinke. Ich schließe die Augen. Es fällt mir schwer. Aber ich zähle im Geiste auf, was ich alles kann, und versuche dabei auszublenden, was ich nicht mehr kann. Als Anwalt arbeiten zum Beispiel und eine Familie ernähren. Neben dem abrupten Einschlafen tagsüber gibt es noch ein paar weitere Symptome meiner Krankheit. Gelegentlich wird mein morgendliches Aufwachen von Schlaflähmungen begleitet, bei denen ich mich dann trotz vollem Bewusstsein nicht mehr rühren kann. Währenddessen sind Halluzinationen nicht selten. Schlimmer noch empfinde ich die Kataplexien. Sie können in jeder erdenklichen Situation durch starke Gefühlsregungen wie Ärger, Aufregung, Wut oder auch nur Lachen ausgelöst werden. Wie bei der Schlaflähmung führt eine Kataplexie zum Erschlaffen meiner kompletten Muskulatur und lässt mich körperlich, wo auch immer ich mich befinde und was immer ich auch tue, zusammenbrechen.
Ich schüttle den Kopf und sehe Barb fest in die Augen. Meine Unterlippe bebt. »Sie haben nichts gefunden. Keine Spur eines Kampfes, keine Kerze, und es gibt auch keinen Strom im Haus.«
Sie drückt meine Hand fester, atmet tief ein, sodass ich sehen kann, wie sich ihr Brustkorb hebt, und atmet geräuschvoll wieder aus. »Möglicherweise hast du dir den Mann und die Frau in dem Haus nur eingebildet.«
Ich ziehe meine Hand weg und lehne mich in den Schwingstuhl zurück. »Das glaube ich nicht. Es sah absolut real aus.«
Barb legt den Kopf schief. »Es könnte aber doch sein.«
Ich beiße die Zähne zusammen. Es hat keinen Sinn, weiter mit ihr darüber zu reden. Eigentlich kann es nicht sein. Ich weiß aber, dass ich halluziniert haben muss, eine andere Erklärung gibt es nicht. Dennoch will ich nicht akzeptieren, dass mein Gehirn mir eine falsche Wahrnehmung vorgegaukelt hat.
Barb steht vom Tisch auf, geht hinüber zu der breiten Fensterfront und schaut hinaus in den dunklen Garten. Ich frage mich, was wohl in ihrem Kopf vorgeht. Früher hat das Leben mehr Spaß gemacht, vielleicht ist es das, was sie denkt. Meine Krankheit wird mir von Tag zu Tag unerträglicher, und ich glaube, dass sich das auf Barbara überträgt. Wir haben beide nicht damit gerechnet, dass unser bisheriges so perfektes und glückliches gemeinsames Leben jemals aus der Bahn geworfen werden könnte. Wir waren beide auf der Überholspur, jetzt stehe ich mit einem Totalschaden am Straßenrand. Was war, wird nie wieder so sein. Das war eine andere Ära. Momente unbeschwerten Glücks scheinen so unerreichbar fern wie die Sterne am Firmament. Wie viel hält unsere Beziehung aus? Schaffen wir es, einen neuen Weg zu finden? Vielleicht denkt sie auch daran, während sie nach draußen ins Nichts der Dunkelheit blickt.
Ich gehe zu ihr ans Fenster, streiche über ihr dichtes braunes Haar und lege meinen Arm um ihre Hüfte. Gemeinsam mit ihr starre ich ins Nichts. In Barbs von der Fensterscheibe reflektiertem Spiegelbild erkenne ich, dass sich ihre Augen mit Tränen gefüllt haben, was mein Herz zusammenkrampfen lässt.
»Gleich morgen rede ich mit Dr. Merten darüber«, sage ich. Barbara nickt zustimmend. Dr. Jakob Merten ist mein Hausarzt, seit ich denken kann. Ich habe lange gewartet, bis ich mich von ihm untersuchen ließ. Aber irgendwann musste ich einsehen, dass meine Schläfrigkeit bei Tag, trotz frühem Zubettgehen, ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht hatte und ich meine Schlafstörungen ohne ärztliche Hilfe nicht in den Griff bekommen würde. Dr. Merten ließ mich einen speziellen Diagnose-Fragebogen ausfüllen. Anschließend brachten mehrere Aufenthalte in einem Schlaflabor die Gewissheit. Der Frühlingstag vor acht Monaten, an dem ich von Dr. Merten die sichere Diagnose erhielt, der Tag, an dem sich mein Leben radikal änderte, brannte sich unauslöschlich in mein Gedächtnis.
»Herr Flemming, bitte in den Untersuchungsraum eins«, dröhnte die freundliche Stimme einer Arzthelferin durch die Lautsprecheranlage an der Decke.
Ich trat ein und setzte mich auf den Stuhl neben der Untersuchungsliege. Ein paar Minuten später kam mein in die Jahre gekommener Hausarzt mit einem ernsten Gesichtsausdruck und seinem um den Hals hängenden Stethoskop in den Raum. Sein schlohweißes Haar stand wie immer in alle Richtungen ab und seine graublauen Augen flackerten nervös. Er begrüßte mich mit einem Handschütteln, nahm mein Krankenblatt, setzte sich an einen kleinen Sekretär und überflog die Eintragungen. Dann rückte er seinen Stuhl in meine Richtung, verzog die Mundwinkel zu einem kurzen schmallippigen Lächeln und sah mich mitfühlend über den oberen Rand seiner Brille hinweg an, die auf seinem pfeilgeraden Nasenrücken nach unten gerutscht war. »Also, Jan, wir haben jetzt alle nötigen Untersuchungsergebnisse, und daraus ergibt sich eine eindeutige Diagnose.«
Er machte eine Pause. Ich ahnte, was er sagen würde, und behielt recht.
»Ich habe dir ja schon erklärt, worum es sich aufgrund deiner Symptome handeln könnte, und nun haben wir leider die Bestätigung dafür bekommen.«
Mein Magen verkrampfte sich und auf meine Brust schien sich ein tonnenschweres Gewicht zu legen.
»Narkolepsie«, sagte er. Mir blieb die Luft weg, ich begann zu schwitzen und meine Hände wurden feucht. Alles, was er danach von sich gab, drang nur noch seltsam verzerrt, lang gedehnt und dumpf, als hätte ich Wattebäusche in den Ohren, zu mir durch.
Natürlich hatte ich mich, nachdem Dr. Merten den Verdacht geäußert hatte, dass es sich um die Schlaf-Wach-Krankheit handeln könnte, im Internet darüber schlaugemacht. Bis jetzt hatte ich, obwohl die beschriebenen Symptome auf mich zutrafen, allerdings irrationalerweise gehofft, nein, sogar fest geglaubt, dass mir etwas anderes fehlen müsse. Es konnte nicht sein, was nicht sein durfte. Doch an diesem Tag brach das Kartenhaus des Verdrängens und Leugnens, das ich zum Schutz meines bisherigen Lebens um mich herum errichtet hatte, auf einen Schlag mit dem Wort Narkolepsie, das aus seinem Mund kam, zusammen. Unheilbar, dachte ich nur. Unheilbar!
»Abruptes Einschlafen, egal bei welcher Tätigkeit. Albträume, fehlender Tiefschlaf, generalisierte Schlafstörungen, Übermüdung. Schlaflähmungen beim Aufwachen und Einschlafen begleitet von Halluzinationen. Wenn es ganz schlimm wird, Lähmungen der Gesichtsmuskulatur bis hin zu ganzkörperlichen Muskellähmungen aufgrund starker Emotionen wie Lachen, Wut, Ärger, Angst oder Trauer.«
»Das ist total unwirklich«, entgegne ich. »Ich kann das nicht glauben. Warum jetzt? Warum hab ich nicht früher was davon bemerkt?«
Dr. Merten nickte verständnisvoll.
»Lass es mich dir so erklären. Um Narkolepsie zu bekommen, bedarf es einer genetischen Neigung deines Autoimmunsystems. Aber hinzukommen muss zwingend ein weiterer Auslöser. Ohne den erkrankst du nicht an Narkolepsie.«
»Und was soll das für ein Auslöser sein?«
»Ich vermute, es war die Streptokokkeninfektion, die du dir Anfang des Jahres zugezogen hast.«
Ich konnte es nicht fassen. Tatsächlich begannen danach langsam zunehmend meine Schlafstörungen und meine Tagesschläfrigkeit.
»Die Infektion hat zur Narkolepsie geführt?«
Er nickte. Ich schloss die Augen, senkte den Kopf und rieb mir mit der Hand durchs Gesicht.
»Dein Autoimmunsystem hat die bakterielle Infektion erfolgreich bekämpft. Dabei ist es aber leider übers Ziel hinausgeschossen und hat den Botenstoff Orexin in deinem Gehirn ein für alle Mal mit vernichtet. Ein Kollateralschaden, wenn man so will.«
Ich erinnere mich noch, dass mir übel wurde, so plastisch und beängstigend war die Erklärung Dr. Mertens.
Anschließend erzählte er noch, dass die Wahrscheinlichkeit, an Narkolepsie zu erkranken, bei 0,05 Prozent liege und die Symptome bei den etwa zwanzigtausend Betroffenen in Deutschland unterschiedlich stark ausgeprägt seien.
In meinem Schädel dröhnte damals ein Geräusch wie das Stampfen einer Dampflok.
Wir stehen noch immer vor dem Fenster und blicken ins Dunkel des Gartens. Ich räuspere mich und schlucke den Kloß in meinem Hals hinunter. »Wie war es heute bei der Arbeit?«, frage ich Barb, um auf ein anderes Thema zu kommen.
Sie zieht die Nase hoch, wischt sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen und dreht sich nicht zu mir um. »Einer von den Tagen, die man am besten vergisst.«
»So schlimm?