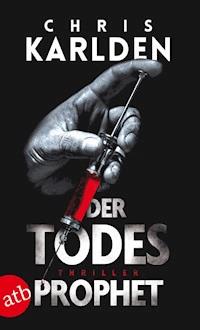
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Unter 6 Euro
- Sprache: Deutsch
Ein Mörder mit einer grausamen Botschaft. Ein Mann, der ihn aufhalten muss, um nicht alles zu verlieren.
Ein Jahr ist es her, dass der Journalist Ben Weidner in Äthiopien Grausames erlebte. Seitdem leidet er unter Panikattacken und Erinnerungslücken. Auch seine Beziehung zu Nicole, der Mutter der gemeinsamen Tochter Lisa, ist am Ende. Als Ben die Leiche einer Frau findet, deuten erste Hinweise auf ihn als Mörder. Bei dem Versuch, seine Unschuld zu beweisen, gerät Ben mehr und mehr in ein Netz aus unglücklichen Verstrickungen. Schon bald beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ihn seine Vergangenheit einholt und weit mehr auf dem Spiel steht, als nur der Verlust seiner Freiheit ...
Chris Karlden – ein neuer Star unter den deutschen Thrillerautoren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über Chris Karlden
Chris Karlden, Jahrgang 1971, arbeitet derzeit als Jurist in der Gesundheitsbranche. Sein erster Psychothriller»Monströs«, veröffentlicht als E-Book, hat sich bisher mehr als 50.000 mal verkauft.
Informationen zum Buch
Ein Mörder mit einer grausamen Botschaft.
Ein Mann, der ihn aufhalten muss, um nicht alles zu verlieren.
Ein Jahr ist es her, dass der Journalist Ben Weidner in Äthiopien Grausames erlebte. Seitdem leidet er unter Panikattacken und Erinnerungslücken. Auch seine Beziehung zu Nicole, der Mutter der gemeinsamen Tochter Lisa, ist am Ende. Als Ben die Leiche einer Frau findet, deuten erste Hinweise auf ihn als Mörder. Bei dem Versuch, seine Unschuld zu beweisen, gerät Ben mehr und mehr in ein Netz aus unglücklichen Verstrickungen. Schon bald beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ihn seine Vergangenheit einholt und weit mehr auf dem Spiel steht als nur der Verlust seiner Freiheit.
Chris Karlden – ein neuer Star unter den deutschen Thrillerautoren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Chris Karlden
Der Todesprophet
Thriller
Inhaltsübersicht
Über Chris Karlden
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Epilog
Danksagung
Impressum
Für Jana und Christiane
Prolog
Die Anspannung war so unerträglich, dass Ben glaubte, den Verstand zu verlieren. Jegliche Kraft war aus ihm gewichen, und seine Arme hingen schlaff wie Lianen an seinem Körper herab. Der Revolver lag schwer in seiner zitternden rechten Hand. Was sollte er nur tun? Immer wieder die gleiche Frage, auf die es keine richtige Antwort gab. Es war klar, was geschehen würde, auch wenn sein Verstand sich weigerte, es sich vorzustellen. Er hörte das vor Adrenalin wallende Blut in seinen Ohren rauschen. Schweißperlen rannen ihm von der Stirn über sein von feinem Sand überzogenes Gesicht. Alles in ihm rebellierte gegen das, was sie von ihm verlangten, und die über allem thronende Angst schrie ihm ein innerlich widerhallendes ›Nein‹ entgegen. Und doch blieb ihm keine andere Wahl. Er musste den vor ihm stehenden Mann erschießen, sonst würde er selbst sterben – wie Mike.
Der bleiche, tränenüberströmte Mann vor ihm trug ein weißes Poloshirt. Auf seinem Namensschild in Brusthöhe, das ihn als Kevin Marshall auswies, war der Äskulapstab mit der Schlange, dem Wahrzeichen der Ärzte, abgebildet. Darunter stand der Name der Hilfsorganisation geschrieben, für die der Arzt vermutlich ehrenamtlich tätig war. Marshall keuchte laut und hastig und biss sich in einem fort mit den Schneidezähnen auf die Unterlippe, die davon zu bluten begonnen hatte. Ben schätzte Marshall, den die Entführer wie ihn und Mike hierherverschleppt hatten, auf Anfang dreißig und fragte sich, ob der Mann, den er für einen Amerikaner hielt, ebenfalls verheiratet war und ein Kind hatte. An dem nervösen Blinzeln und dem Flackern in den Augen seines Gegenübers erkannte Ben, dass dieser ebenso verzweifelt nach einem Ausweg aus diesem Alptraum suchte wie er. Aber es gab keinen. Auch Kevin Marshall hatte einen Revolver in der Hand, und gleich würden sie aufeinander schießen müssen.
»Jetzt drehen!«, befahl der dunkelhäutige Anführer der Kidnapper in gebrochenem Englisch. Das Weiß in den glasig schimmernden Augen des Afrikaners war gelb verfärbt. In seinem ausgemergelten Gesicht zeichneten sich die Wangenknochen scharf ab. Die laufende Videokamera auf dem Stativ neben ihm war auf Ben und Kevin Marshall gerichtet. Der Mann starrte die beiden mit regungsloser Miene an. Er, wie auch die acht bewaffneten Männer in seiner Gefolgschaft, machten den Eindruck, dass sie zu viel verloren hatten, als dass ihnen ihr Leben und das anderer Menschen noch irgendetwas bedeutete. In ihren Gesichtern lag eine Mischung aus Traurigkeit und aufgestauter Wut. Mit ihren Maschinengewehren zielten sie auf Ben und Kevin, bereit, jederzeit abzudrücken. Die Afrikaner hatten damit gedroht, dass sie auf der Stelle in einem Kugelhagel sterben würden, falls sie nicht mitspielten.
Ben hob zögerlich den Revolver vor seine Brust und drehte, wie der Anführer es befohlen hatte, die Revolvertrommel, aus der zuvor alle Patronen, bis auf eine, herausgenommen worden waren. Marshall tat es ihm gleich und starrte ihn dabei aus Augen, aus denen Ben nichts außer Verzweiflung und Todesangst herauslesen konnte, an. Sie hatten ihre Instruktionen erhalten, bevor die Aufzeichnung mit der Videokamera gestartet worden war. Die Entführer verlangten, dass die beiden Gefangenen sich in kurzer Distanz gegenübertraten, aufeinander anlegten und auf ihr Signal hin zeitgleich abdrückten. Falls einer von ihnen überlebte, würden sie demjenigen die Freiheit schenken.
Ben warf einen kurzen Blick hinüber zu der Wand, vor der Mike lag. Sein Kollege und Freund war tot. Die Entführer hatten ihn als Erstes vor die Kamera gezerrt und Kevin Marshall gegenübergestellt. Mike war auf die Knie gefallen. Er hatte geweint und um sein Leben gebettelt. Nachdem er sich wiederholt geweigert hatte, den ihm hingehaltenen Revolver in die Hand zu nehmen, war der Anführer der Gruppe vorgetreten und hatte Mike mit einer Maschinengewehrsalve erschossen. Dann hatten sie Mikes Leiche an die Wand geschleift und Ben den Revolver in die Hand gedrückt. Und die nächsten Sekunden würden auch für Ben über Leben und Tod entscheiden. Sein Verstand wehrte sich, die Situation zu begreifen. Als Ressortleiter für die Rubrik Blick in die Welt musste Ben täglich darüber berichten, wie Menschen auf tragische Weise aus dem Leben schieden. Er schrieb über verhungernde Kinder, Opfer von Naturkatastrophen, in Kriegen getötete Menschen und zahlreiche andere Tode, die ihm nicht selten die Tränen in die Augen steigen ließen. Nun war er selbst Teil des Grauens, Opfer eines perfiden Spiels. Noch vor einer Stunde war alles in Ordnung gewesen. Ben hatte es sich als Journalist zur Aufgabe gemacht, auf die Not der Menschen in Krisenländern aufmerksam zu machen. Da in dem afrikanischen Staat Äthiopien sich die Hungersnot schnell ausbreitete, waren Ben und Mike, der als freier Fotograf arbeitete und seine Fotos unter anderem an die Zeitung verkaufte, für die Ben tätig war, dorthin gereist, um sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Sie waren mit einem gemieteten Jeep auf dem Weg zu einem zehn Kilometer östlich der Hauptstadt gelegenen Dorf gewesen, als kurz vor dem Ziel zwei Geländewagen aufgetaucht waren und ihnen den Weg abgeschnitten hatten. Schwerbewaffnete Einheimische waren von den Pritschen der Ladeflächen gesprungen, hatten Ben und Mike aus dem Wagen gezerrt, sie gefesselt und in ein einsam gelegenes Haus verschleppt. Dort saß Kevin Marshall bereits gefesselt in einer Ecke des Raumes. Hinter dem an einigen Stellen eingefallenen Mauerwerk lag kilometerweit nichts als eine trockene steppenartige Landschaft mit vereinzelt aufragenden dürren, knochigen Bäumen und Sträuchern.
»Fertig machen«, sagte der Anführer jetzt. Er hob den rechten Arm, bis seine geballte Faust in Richtung der aus Strohmatten bestehenden Decke wies, und läutete damit das Duell ein. Ben und Kevin hörten auf, die Revolvertrommeln zu drehen, die sich danach noch kurz wie Glücksräder weiterbewegten, bevor sie zum Stillstand kamen. Ben streckte langsam den Arm aus und zielte auf die Stirn seines Gegenübers. Kevin Marshall hatte ein rundes Gesicht und einen dicken Bauch. Überhaupt sah er aus wie ein großer sanftmütiger Teddybär. Sein Mund stand offen, sein Unterkiefer bebte. Tränen liefen ihm über die Wangen, und er schluchzte. Wie in Zeitlupe hob auch Kevin seinen Revolver, bis Ben in die Mündung blickte, die auf seinen Kopf gerichtet war.
Ben atmete hektisch ein und aus, und sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Dazu hatte sich eine bleierne Schwere auf seine Brust gelegt. Er hatte Mühe, die Waffe in seiner zitternden Hand weiterhin auf Kevins Kopf gerichtet zu lassen und fühlte sich wie in Trance. Einer von ihnen würde durch die Hand des anderen sterben.
Während die Videokamera erbarmungslos rot blinkte und damit die funktionierende Aufnahme anzeigte, blickten sie auf den erhobenen Arm des Anführers. Wenn er sich senkte, würden sie abdrücken müssen.
Ben fragte sich, ob er gleich wirklich den Abzug betätigen und sein Gegenüber damit eventuell erschießen könnte. Was dachte Kevin? Ging es ihm genauso? Für einen Moment durchfuhr ihn der Impuls, die Waffe sinken zu lassen.
Aber er war wie blockiert. Lisa war erst sieben. Sie brauchte ihren Vater. Und auch sein Überlebenstrieb befahl ihm jetzt nachdrücklich, seine einzige Chance zu nutzen und abzudrücken, wenn es so weit war. Auch wenn dies bedeutete, dass er dafür einen unschuldigen Menschen töten musste. Er dachte daran, welchen Verlauf das Duell nehmen konnte. Die Möglichkeit, dass sie beide eine leere Patronenkammer erwischten, war am wahrscheinlichsten. Dann würde das nervenzerfetzende Spiel von neuem beginnen.
Falls einer von ihnen eine geladene Kammer hatte, war es direkt vorbei. Aber es musste nicht zwangsläufig einen Überlebenden geben, denn die letzte Möglichkeit bestand darin, dass beide Schlaghähne auf eine Patrone trafen.
Bens linkes Augenlid begann zu zucken. Seine Nerven ließen ihn eigentlich nie im Stich. Doch jetzt im Angesicht seines womöglich unmittelbar bevorstehenden Todes, schienen diese vollständig zu versagen. Fliegen kreisten wie Aasgeier um seinen Kopf und erzeugten ein Brummen – wie alte Neonröhren, kurz bevor sie den Geist aufgeben. Das ihn durchströmende Adrenalin ließ ihn noch wie ferngesteuert funktionieren, doch aufgrund des Wassermangels und der Hitze war ihm schwindlig, und sein Blickfeld verengte sich zu einem immer kleiner werdenden Tunnel. Mit der freien Hand wischte er sich den brennenden Schweiß aus den Augen, um überhaupt noch etwas erkennen zu können. Seine Kehle war so trocken, dass er kaum noch schlucken konnte. In diesem Zustand würde er gewiss nicht treffen, auch wenn das Ziel, Kevin Marshalls Kopf, unmittelbar vor ihm war. Noch immer schwebte der Arm des Anführers wie ein Fallbeil in der Luft.
Die Sekunden des Wartens kamen ihm wie Stunden vor. Ben dachte an Nicole. Sie hatte ihm angedroht, dass sie ihn verlassen würde, falls er nach Äthiopien reisen und sich unnötig in Gefahr begeben würde, nur um eine möglichst authentische Reportage abliefern zu können. Sie hatte ihn gebeten, aus Rücksicht auf Lisa auf die Reise zu verzichten. Ben war sich der Gefahr zwar bewusst gewesen, hatte diese aber wie immer verdrängt, war stur geblieben und dennoch geflogen. Die Welt musste erfahren, wie sehr die Menschen in Äthiopien leiden mussten und wie viele an Unterernährung starben. Jetzt war er selbst zum Opfer geworden, und er wusste noch nicht einmal, warum. Genau wie Kevin Marshall war er nur hier, um zu helfen. Weshalb also taten diese Männer ihnen das an?
Dann war der Moment gekommen. Der Anführer ließ seinen Arm nach unten schnellen. Ben zielte, schloss die Augen und drückte ab. Nur hundertstel Sekunden voneinander getrennt hallten zwei Schüsse von den Wänden des Raumes wider.
Fünfzehn Monate später
1
Es war nicht leicht gewesen, sie zu überreden. Aber am Ende hatte sie mitgemacht. Sie brauchte das Geld. Und nun dachte sie, er würde ihr nach getaner Arbeit den versprochenen Lohn einfach so vor der Tür überreichen. Aber sein Plan war ein anderer. Er sagte ihr, er müsse sich noch davon überzeugen, dass sie ihren Auftrag auch tatsächlich erledigt hatte. Sie zögerte, überlegte, sah ihn eindringlich durch den Türspalt hinter der vorgehängten Kette an. Er merkte, dass sie sich nicht wohl dabei fühlte, ihn spät in der Nacht hereinzulassen, zu sich und dem schlafenden Kind. Er lächelte, denn er wusste, er konnte so harmlos wirken. Schließlich nickte sie zustimmend, öffnete die Wohnungstür und ließ ihn eintreten.
Als sie vor ihm her ins Wohnzimmer ging, zog er den mit Äther getränkten Lappen aus der Nylontüte in seiner Jackentasche hervor. Kurz dachte er an das schlafende Kind, an dessen Zimmer sie nun vorbeikamen. Er musste leise sein. Noch sollte der Junge nicht aufwachen.
Tu es endlich, sagte die Stimme in seinem Kopf. Worauf wartest du noch?
Schnell schlang er seinen rechten Arm von hinten um die Frau und presste das feuchte Tuch auf ihren Mund und ihre Nase. Sie zuckte erschrocken zusammen und stöhnte auf. Er drückte fester zu und hielt sie mit dem linken Arm umklammert. Panisch trat sie um sich. Ihr rechter Fuß verfehlte nur knapp einen Holzständer mit einer Buddhastatue aus Keramik. Ihre freie rechte Hand zerrte an seinem Arm. Dann erlahmten ihre Muskeln schlagartig. Ihre Glieder erschlafften, und sie sackte bewusstlos in sich zusammen. Er fing sie auf und legte sie sanft auf dem Boden ab. Während sie so friedlich vor ihm lag, sah sie ganz unschuldig aus. Doch er durfte sich nicht blenden lassen. Der Teufel trägt die schönsten Gesichter. Er wusste genau, warum sie sterben musste, und er würde ihren Tod in eine Botschaft verwandeln, vor der niemand mehr die Augen verschließen konnte.
Sie hätte sich nicht von ihrem Mann lossagen dürfen. Sie hatte es doch vor Gott geschworen: Bis dass der Tod euch scheidet. Und so würde es nun also sein. Sie hatte ihren Mann verlassen und damit das, was mit dem heiligen Bund eins geworden war, getrennt.
Er ließ sich von ihrer Schönheit in den Bann ziehen und ertappte sich dabei, wie sein Blick an ihrem makellosen Körper klebte. Es war schade um sie, dachte er. Dann hallte die engelsgleiche Stimme, die ihn seit Wochen begleitete, erneut in seinem Schädel wider und forderte ihn auf, endlich fortzufahren. »Du hast ja recht«, flüsterte er und schlich ins Kinderzimmer. Auf der weißen Tapete waren bunte Rennautos abgebildet. So eine Tapete hätte er früher auch gern gehabt.
Die langen tiefen Atemzüge des Kindes zeugten davon, dass es etwas Schönes träumte. Vermutlich das letzte Mal für eine sehr lange Zeit, dachte er. Aber auch das sollte so sein. Wieder zückte er seinen Lappen und drückte ihn dem Jungen sanft aufs Gesicht. Das Betäubungsmittel wirkte, ohne dass das Kind die Augen öffnete. Ruhe sanft.
Eine halbe Stunde verging, in der er ohne Hast die notwendigen Vorbereitungen traf. Dann kam die Mutter des Jungen wieder zu sich. Nach nur wenigen Sekunden begriff sie, wo sie sich befand, dass etwas mit ihr nicht stimmte und schließlich auch, was von Anfang an seine wahren Absichten gewesen waren. Sie würde ihr Geld nie erhalten.
Er lächelte. Sie konnte es nicht sehen. Die schwarze mittelalterliche Henkersmütze umhüllte seinen Kopf. Sie versuchte zu schreien, aber mehr als ein Ächzen und Stöhnen brachte sie mit dem Knebel in ihrem Mund nicht hervor. Als er dann den Wasserhahn der Badewanne aufdrehte, riss sie entsetzt die Augen auf. Sie starrte ihn kurz an, ihren Richter und Vollstrecker. Er hatte sie so gefesselt, dass sie sich kaum noch bewegen konnte. Dennoch bot sie all ihre Kraft auf, um sich zu befreien. Vergeblich spannte sie ihre Muskeln an. Mochte in ihrem Inneren ein Aufschrei laut widerhallen, nach außen drang nur ein dumpfes Geräusch. So leise, dass niemand außer ihm und mittlerweile auch ihrem Sohn es hören konnte.
Der Siebenjährige tobte und zerrte wie verrückt an seinen Fesseln. Es hatte länger gedauert als gedacht, bis er wieder zu sich gekommen war. Für einen kurzen Moment sah es so aus, als wäre der Kleine stark genug, den Heizkörper, an den er gebunden war, aus der Verankerung zu reißen. Er würde hautnah alles miterleben können und aus dem, was gleich geschah, lernen. Etwas, das er weitergeben konnte. Wie viel Energie und Kraft doch in einem Kind steckt, das seine Mutter vor dem Tode und sich selbst davor bewahren will, dabei zusehen zu müssen. Sein Gekreische war dank des Korkens in seinem Mund und dem Klebeband über seinen Lippen kaum zu hören.
Die Badewanne war nun fast vollgelaufen. Er stellte das Wasser ab und genoss den Moment, die Panik, die sich in ihr auszubreiten schien. Wahrscheinlich betete sie gerade, dass alles nur ein Traum war. Er spürte förmlich, wie sie sich vorwarf, zu vertrauensselig gewesen zu sein. Aber sie würde auch nicht mehr die Möglichkeit bekommen, in Zukunft misstrauischer zu sein. Zweite Chancen gab es nur in Liebesfilmen. Das hier war die Realität, aus der es kein Entkommen gab.
Ihr Kopf lugte gerade noch über die Wasseroberfläche.
Feierlich verkündete er nun das Urteil und ließ auch die Begründung nicht aus. Sie sollte erfahren, warum sie schuldig war und warum er ihren Jungen nicht davor verschonen konnte, alles ansehen zu müssen. Sie schien zu begreifen, dass sie sterben würde.
Er hatte eine Kerze angezündet, die das Szenario im sonst dunklen Raum in das passende feierliche Licht tauchte. Eigentlich hatte er noch genug Zeit, und gerne hätte er sie noch länger betrachtet. Doch die Stimme ermahnte ihn, sie nicht unnötig lange leiden zu lassen. Also befolgte er den Befehl und fuhr fort. Er vollstreckte das Urteil und tauchte ihren Kopf unter die Wasseroberfläche. Ihr Gesicht war nur wenige Zentimeter von einem rettenden Atemzug entfernt. Wieder und wieder durchfuhr ihn ein bislang ungekanntes Hochgefühl. War es die Macht, die er ausübte? Die Macht der Entscheidung über das Leben eines Menschen. Er neigte den Kopf, beobachtete sie konzentriert. Sie zuckte, und ihre Füße strampelten, mehr konnte sie in ihrem Kokon, den er um sie gewoben hatte, nicht tun. Er spürte ein letztes Aufbäumen, ihren Kopf, der fest gegen seine Handfläche drückte, mit der er sie gnadenlos unter Wasser hielt. Nach fast zwei Minuten war es dann so weit. Sie konnte den Atemreflex nicht mehr unterbinden und sog das Wasser in ihre Lunge. Er hatte zuvor über den Tod durch Ertrinken gelesen. Die Schmerzen mussten unerträglich sein. Dann wich das Leben aus ihren noch immer geöffneten Augen.
Er konnte ihre Seele davonfliegen sehen. Sie war rabenschwarz. Er hatte die Ordnung wiederhergestellt und sie bestraft. Von ihren Sünden hatte er sie damit jedoch nicht befreit. Dafür war er nicht zuständig.
Es war schon verrückt. Erst jetzt, wo sich sein eigenes Leben schon bald dem Ende zuneigte, gab dieser Auftrag seinem bislang nutzlosen Dasein doch noch einen Sinn. Sein Weg lag klar vor ihm, sein Plan war perfekt. Er stellte nichts in Frage. Er durfte dienen. Das war eine Ehre.
Anfangs würden die Leute sein Werk für die Tat eines Wahnsinnigen halten. Doch nicht er war der Verrückte. Es waren die anderen, die vielen narzisstischen Geschöpfe, die nicht mehr wussten, was echte Werte waren. Doch mit der Zeit würden viele von ihnen seine Botschaft verstehen und anerkennen, wie wichtig sein Beitrag für eine bessere Welt gewesen war. Auch der kleine Junge würde einmal begreifen, dass seine Mutter selbst die Schuld an ihrem Schicksal trug. Und sie würde nicht die Einzige bleiben, die er bestrafen würde.
2
Anfangs nahm er das Klingeln nur gedämpft wahr. Doch nach und nach grub sich das nervtötende Geräusch immer tiefer in sein Bewusstsein und holte ihn schließlich ganz aus dem Schlaf. Im ersten Augenblick wusste Ben nicht, wo er sich befand. Benommen tastete er um sich und stellte fest, dass er auf einer Matratze lag. Er öffnete einen Spalt weit die Augen. Das helle Tageslicht schmerzte auf seiner Netzhaut. Dann sah er verschwommen die Umrisse seiner kleinen Einzimmerwohnung vor sich. Währenddessen klingelte das Telefon unablässig weiter.
Das unerträgliche Pochen und die bohrenden Schmerzen unter seiner Schädeldecke, die nun unvermittelt in den Vordergrund traten, waren kaum auszuhalten. Er fühlte sich hundeelend. Mit einem Stöhnen erhob er sich aus dem Bett. Dabei fiel sein Blick auf das Display des Radioweckers auf seinem Nachttisch. Wenn er nachts, wie so oft, schweißgebadet aus einem Alptraum erwachte und panische Angst jede Faser seines Körpers beherrschte, erschienen ihm die roten Leuchtziffern der Digitalanzeige wie die Fratze des Teufels, die ihn gierig anfunkelte.
Es war halb zwölf, eine für ihn ungewöhnliche Zeit aufzuwachen. Normalerweise schlief er nie so lange. Egal um welche Uhrzeit er zu Bett ging oder wie viele schlaflose Stunden er nachts verbrachte, in der Regel erwachte er spätestens zwischen sieben und acht Uhr morgens. Während er leicht schwankend auf den Tisch, auf dem das Telefon lag, zusteuerte, fragte er sich, warum die Rollläden nicht wie gewöhnlich für die Nacht heruntergelassen waren. Dann fiel sein Blick auf die neben dem Telefon ausgebreiteten Papiere. Augenblicklich fielen ihm die Ereignisse des gestrigen Abends wieder ein. Sein Unwohlsein nahm schlagartig zu.
Nach der Arbeit hatte er einen Umschlag mit Scheidungspapieren in seinem Briefkasten gefunden. Nun war es also so weit. Entgegen ihrer Drohung hatte Nicole sich nach seiner Rückkehr aus Afrika nicht von ihm getrennt. Die Ereignisse von Äthiopien belasteten die ganze Familie und Nicole war an seiner Seite und stand ihm bei. Doch sie hatte ihn auch aufgefordert, sich in Therapie zu begeben, wie auch sein Hausarzt es ihm empfohlen hatte. Aber Ben hatte versucht, die erschütternden Erlebnisse zu verdrängen und weiterzumachen, als sei nichts geschehen. Obwohl sich seine nächtlichen Alpträume, in denen er sich immer wieder aufs Neue Kevin Marshall gegenübersah, häuften und die Schuldgefühle, diesen getötet zu haben, mit jedem Tag stärker wurden. Hinzu kam, dass er sich immer mehr vom Alltag überfordert fühlte und zu Hause und im Büro gereizt reagierte, sobald man ihn auf seinen Zustand ansprach. Seine Selbstvorwürfe steigerten sich noch, als er erfuhr, dass Lisa in der Schule gemobbt wurde, weil ihr Vater in den Augen ihrer Mitschüler ein Mörder war. Für Lisa war es schwierig, damit umzugehen, aber Ben durfte ihr und ihren Klassenkameraden keinen Vorwurf machen. Sie waren noch Kinder, und er wusste ja selbst nicht, ob er ein Mörder war oder nicht, auch wenn Nicole und sein Arzt ihm immer wieder sagten, er solle sich keine Vorwürfe machen.
Es war ein harter Schlag für Ben gewesen, als Nicole ihn dann doch drei Monate nach seiner Heimkehr bat, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich aber bereits selbst eingestehen müssen, dass er sich in einer psychischen Verfassung befand, in der er seiner Familie nicht guttat. Er stand unter ständiger Anspannung und fühlte sich gefühlsmäßig, als ob jemand eine unsichtbare Glocke über ihn gestülpt hätte, die seine emotionale Verbindung zur Außenwelt weitestgehend kappte. In seinem Kopf herrschte oftmals eine seltsame Leere, oder er war nicht bei der Sache, da seine Gedanken in eine andere Richtung abschweiften. Wenn Nicole und Lisa versuchten ihn aufzumuntern, war er oft nicht zu mehr als einem gequälten Lächeln in der Lage. Vor allem Lisa verhielt sich ihm gegenüber seit seiner Rückkehr wesentlich zurückhaltender. Früher war sie zur Begrüßung lachend auf ihn zugelaufen gekommen und ihm in die Arme gesprungen, kaum, dass er zur Haustür hereinkam. Jetzt konnte er in der gleichen Situation nur noch ein kurzes Leuchten in ihren Augen aufflackern sehen, das aber unmittelbar danach einem traurigen und enttäuschten Gesichtsausdruck wich. Ganz so, als ob sie für einen Augenblick vergessen hatte, dass ihr Vater einen anderen Menschen getötet hatte und es ihr gleich darauf wieder zu Bewusstsein gekommen war. Wenn er sie zu umarmen versuchte, ließ sie es widerwillig und mit abgewandtem Kopf kurz zu, um sich schon im nächsten Augenblick wieder von ihm wegzudrücken. Es brach ihm das Herz, dass die enge Bindung zu seiner kleinen Prinzessin plötzlich der Vergangenheit anzugehören schien. Aber er hatte auch zunehmend das Gefühl, dass das Zusammenleben in der gemeinsamen Wohnung das Verhältnis zu seiner Familie eher verschlechterte als verbesserte. Deshalb hatte er die vorübergehende räumliche Trennung, als Nicole sie vorschlug, sogar befürwortet. Als er sich aber danach weiterhin einer Therapie verweigerte, gingen Nicole und Lisa mehr und mehr auf Abstand zu ihm. Schließlich hatte Nicole dann doch die endgültige Trennung gewollt, und obwohl diese nun auch schon ein Jahr zurücklag, hatte die gestrige Zusendung des Scheidungsantrags ihn aufs Neue verletzt. Natürlich hatte er Nicole sofort angerufen. Sie versuchte ihm so schonend wie möglich zu erklären, dass es inzwischen jemand anderes in ihrem Leben gab. Wer es war, verriet sie ihm jedoch nicht. Dafür gab sie ihm am Ende des Gesprächs unmissverständlich zu verstehen, dass sie definitiv keine Chance mehr für eine gemeinsame Zukunft mit ihm sah. Er solle sich keine weiteren Hoffnungen machen. Aber Ben wollte einfach nicht akzeptieren, seine Frau und seine mittlerweile achtjährige Tochter unwiderruflich verloren zu haben.
Am Abend hatte er sich dann mit Viktor vor dem Kino am Sony-Center getroffen, wo ihnen Tamara Engel, eine Bekannte Viktors aus seinem Abiturjahrgang, über den Weg gelaufen war. Der Abend endete damit, dass Viktor, wie so oft, wegen dringender Geschäfte früher gehen musste und Ben mit Tamara in ihrer Wohnung landete. Das Letzte, woran er sich erinnerte, war, dass er es sich auf Tamaras Sofa bequem gemacht hatte und eine Tasse dampfender Kaffee vor ihm auf dem Tisch stand.
Noch in Gedanken nahm Ben das Telefon vom Tisch und beendete das Dauerklingeln, indem er das Gespräch, ohne auf das Display zu schauen, annahm.
»Das hat ja verdammt lange gedauert.« Es war Nicole, und ihre Stimme klang leicht vorwurfsvoll. Ben seufzte. Im ersten Moment hatte er befürchtet, dass Lisa etwas zugestoßen sein könnte, doch dann stellte er fest, dass Nicole ansonsten aber gelassen wirkte.
»Auf deinem Handy springt nach fünfmaligem Klingeln die Mailbox an. Ich versuche gerade zum dritten Mal, dich zu erreichen. In der Redaktion wusste auch niemand, wo du steckst. Ist alles in Ordnung mit dir?«
Noch immer brachte Ben kein Wort hervor. Er hatte sie noch nicht mal begrüßt. Dafür hatte er plötzlich das Gefühl, bei starkem Wellengang an Deck eines Schiffes hin und her zu wanken. Er musste würgen und konnte dem Drang, sich übergeben zu müssen, nur knapp widerstehen. Ben öffnete die Lippen, um etwas zu sagen, und bemerkte, dass es ihm schwerfiel, sich zu konzentrieren.
»Bei mir ist alles okay«, krächzte er und scheiterte bei dem Versuch, möglichst gutgelaunt zu klingen. Seine Kehle war rau und trocken.
»Du hörst dich aber nicht so an.«
Eine kurze Pause entstand. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Seine Kopfschmerzen steuerten auf einen neuen Höhepunkt zu, und er fragte sich, weshalb sie eigentlich anrief. Gewiss nicht nur, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Wahrscheinlich hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ihm mit dem Scheidungsantrag allen Grund gegeben hatte, sich mies zu fühlen. Aber die Tatsache, dass er sich körperlich gerade so angeschlagen fühlte, hatte damit nichts zu tun. Die Ursache dafür hätte er selbst gern gekannt. Sein Zustand erinnerte ihn an einen Kater nach einer durchzechten Nacht. Aber außer zwei Flaschen Bier im Kino hatte er keinen Alkohol getrunken. Zumindest erinnerte er sich nicht daran.
»Ben?« Nicole holte ihn aus seinen Gedanken.
»Ja?«
»Was ist los? Ist es wegen gestern?«
Sie waren seit neun Jahren verheiratet, daher brauchte sie Ben noch nicht einmal zu sehen, um per Telefondiagnose festzustellen, dass mit ihm etwas nicht stimmte.
Kennengelernt hatten sie sich im Winter vor elf Jahren bei einer Sammelaktion für Berliner Obdachlose, die von dem Radiosender, für den Nicole als Marketingassistentin arbeitete, organisiert worden war. Nicole war ihm dort nicht nur wegen ihrer guten Figur und den langen, leicht gelockten blonden Haaren aufgefallen, sondern vor allem wegen ihrer netten, offenen, aber auch naiven und gutgläubigen Art. Sie schien voller Energie, Tatendrang und Lebenslust, aber in ihrem Inneren auch sehr leicht verletzlich.
Ben holte tief Luft, bevor er zu einer Erklärung ansetzte.
»Mein Kopf dröhnt und ich weiß nicht, wie und wann ich gestern nach Hause gekommen bin.«
Eine kurze Gesprächspause trat ein. Ben hoffte inständig, dass Nicole nicht weiter nachbohren würde. Doch sie tat es. Er hätte es wissen müssen.
»Meinst du, es war wieder einer dieser Aussetzer?«
Ben entfuhr ein tiefes Seufzen.
»Die Kopfschmerzen und die Übelkeit sind neu. Ansonsten sieht es ganz danach aus.«
Seit er vor fünfzehn Monaten aus Äthiopien zurückgekehrt war, hatte er zwei weitere mit dem gestrigen Abend vergleichbare Blackouts erlebt. Nicole wusste davon. Vermutlich war das durch die Vorfälle in Äthiopien entstandene Trauma der Grund für die Aussetzer. Die bisherigen Filmrisse waren beide Male in Situationen aufgetreten, die ihn an das dort erlebte Grauen erinnert hatten. Zum ersten Mal war es vor fast sechs Monaten passiert, an Silvester, das er in diesem Jahr allein in seiner Wohnung verbracht hatte. Als um zwölf Uhr die Raketen gezündet wurden und die Knallkörper explodierten, erlitt er zuerst eine starke Panikattacke, dann wurde ihm schwarz vor Augen. Gegen zwei Uhr kam er, zusammengekauert wie ein Fötus und am ganzen Leib zitternd, auf dem Fußboden wieder zu sich, ohne dass er sich daran erinnern konnte, was in den vergangenen Stunden geschehen war. Vor zwei Monaten dann war Ben aus heiterem Himmel beim Überqueren einer belebten Straße erneut in einen schockähnlichen Zustand geraten. Er passierte gerade eine Baustelle, als ein Presslufthammer ansprang, dessen Donnern ihn an Maschinengewehrschüsse erinnerte. Er hatte am ganzen Körper gezittert, sich vor panischer Angst nicht mehr von der Stelle bewegen können und vollkommen die Orientierung verloren. Das einsetzende Hupkonzert, als die Ampel für den Straßenverkehr wieder auf grün geschaltet hatte, machte es nur noch schlimmer. Eine junge Frau erkannte schließlich seine Notlage und holte ihn von der Straße. Als er auf dem Gehweg neben einem Mülleimer kauerte und auf die von ihr gerufene ärztliche Hilfe wartete, wurde ihm erneut schwarz vor Augen. Erst im Rettungswagen, kurz bevor dieser das Krankenhaus erreichte, konnte er wieder einen klaren Gedanken fassen. Der Notarzt erklärte Ben, dass er die ganze Zeit bei Bewusstsein gewesen sei. Dennoch hatte Ben keine Erinnerung an die letzte halbe Stunde. Der Notarzt erinnerte sich noch an Bens Entführung. Die Medien hatten damals ausführlich über die Entführungsaktion und das Todesduell berichtet. Es handelte sich um eine militante Gruppierung, die den Westen für das Elend in ihrem Land verantwortlich machte. Ben, Mike und Kevin waren willkürliche Opfer gewesen und wenn sie nicht sofort hingerichtet werden wollten, gezwungen, sich in Einzelduellen gegenseitig zu erschießen. Die Entführer zeichneten die Duelle mit einer Videokamera auf und stellten sie anschließend ins Internet. Ein paar Tage zuvor war ein Flüchtlingsschiff bei dem Versuch, das Mittelmeer von der libyschen Küste aus zu überqueren gekentert, und über hundert Äthiopier waren dabei ertrunken. Darunter auch zahlreiche Kinder. Die Kidnapper machten die unterlassene Hilfe der westlichen Welt dafür verantwortlich, dass Menschen überhaupt aus Äthiopien fliehen mussten, weil sie an Hunger litten und Unzählige an Unterernährung starben. Von denen, die sich zur Flucht entschieden, kamen die meisten schon auf dem Weg an die Küsten ums Leben, und jetzt waren die wenigen, die es bis aufs Meer geschafft hatten, auch noch ertrunken. Die Tatsache, dass erst eine Woche zuvor die Finanzmittel zur Rettung von schiffbrüchigen Flüchtlingen durch die europäischen Anliegerstaaten am Mittelmeer gekürzt worden waren, hatte nur noch Öl ins Feuer gegossen.
Vor diesem Hintergrund und anhand der Symptome wie den anhaltenden Angstzuständen und den Panikattacken, Unkonzentriertheit und dauernder Gereiztheit vermutete der Arzt eine posttraumatische Belastungsstörung. »Sie brauchen dringend psychologische Hilfe«, hatte er Ben versichert. »Wenn es sogar schon zu Blackouts kommt …«, hatte er hinzugefügt.
Ben hatte nie viel auf die Meinung von Ärzten gegeben. Stattdessen vertraute er darauf, dass die meisten Krankheiten auch ohne Medikamente heilten. Sein derzeitiger Zustand machte ihm zwar schwer zu schaffen, aber er konnte sich auch nicht vorstellen, dass ein Therapeut ihm helfen konnte. Das Einzige, was er den Psychologen zutraute, war, ihn mit ruhigstellenden Medikamenten vollzupumpen, die sein Gehirn vernebelten, und ihn zu einer emotionslosen Hülle seiner selbst werden ließen. Darauf wollte er trotz seiner Angstanfälle lieber verzichten. Er konnte sich seine Sturheit rational nicht erklären, er wusste nur, dass er nicht bereit war, sich in vermutlich monatelangen Sitzungen regelmäßig das Erlebte wieder und wieder vor Augen führen zu müssen. Die Blackouts schienen ihm das kleinere Übel zu sein. Deshalb hatte er entgegen der Empfehlung des Notarztes auch keine Überweisung zu einem Therapeuten angenommen.
Die plötzlichen Panikattacken und Flashbacks hatten erst zwei Monate nach seiner Rückkehr aus Äthiopien begonnen. Immer öfter wurde er von da an, ausgelöst durch alltägliche Situationen wie das Knallen eines Sektkorkens, in das Haus zurückkatapultiert, in dem er und Kevin Marshall gezwungen worden waren, aufeinander zu schießen, bis nur noch einer übrig war. Und dieser eine war er gewesen.
In dem Film, der dann in seinem Kopf ablief, richtete Ben erneut den Revolver auf den Kopf des amerikanischen Arztes und drückte zeitgleich mit diesem auf das Zeichen des Befehlshabers der Entführer hin ab. Doch während die Kugel aus dem Revolver des Amerikaners nur Bens Schläfe streifte, traf das Projektil aus Bens Waffe mitten in die Stirn des Arztes. Gehirnmasse und Blut verteilten sich auf dem unverputzten Mauerwerk der dahinterliegenden Hauswand.
Seitdem war keine Nacht vergangen, in der er nicht von den Ereignissen träumte und dann schweißgebadet und in Todesangst erwachte. Doch leider blieb es nicht bei den Träumen. Auch tagsüber suchten ihn die Erinnerungen heim und zogen ihn wie der Wirbelsturm aus Alice im Wunderland in eine andere Welt, die ihm so real erschien. Sie zogen ihn in das verfallene Haus, in dem er wieder und wieder gezwungen war, den Abzug zu drücken.
Am gestrigen Abend allerdings war dem Blackout kein Flashback vorausgegangen. Seine Erinnerung endete mit dem Moment, in dem er bei Viktors Bekannter Tamara Engel in Schöneberg auf der Couch saß. Dann war er, geweckt durch Nicoles Anruf, in seinem Bett wieder wach geworden.
»Ich habe dir schon so oft gesagt, dass du eine Therapie machen sollst, Ben. Bitte überleg es dir doch noch mal.« Ben hörte, wie Nicole einmal tief durchatmete. »Was ist denn das Letzte, woran du dich erinnerst?«, fragte sie dann.
Ben erinnerte sich an ihre Worte, die er so oft gehört hatte: »Manchmal brauchen wir jemanden, mit dem wir über unsere Vergangenheit reden können, damit sie uns nicht einholt und verschlingt.« Aber er war der Meinung, dass es besser sei, die schlimmen Dinge, die hinter einem lagen, auszublenden und zu vergessen, anstatt sie immer wieder hervorzukramen.
»Ich war mit Viktor im Kino.«
Das war zwar nur die halbe Wahrheit, aber obwohl er und Nicole offiziell getrennt waren, fühlte er sich schlecht, bei einer anderen Frau gewesen zu sein, noch dazu bei einer Frau, die er erst wenige Stunden zuvor kennengelernt hatte. Dabei hatte er sie nur nach Hause gebracht und war noch auf einen Kaffee mit raufgekommen.
»Du musst lernen zu begreifen, dass dich keine Schuld trifft, Ben.«
Genau das war der Punkt, den Ben bezweifelte. Er hatte einen Menschen getötet, um sein Leben zu retten. Kein Tag verging, an dem er sich das nicht vorwarf.
»Ich denk über eine Therapie nach«, sagte er, um das Thema nicht weiter vertiefen zu müssen. Mit dem Telefon am Ohr ging er zum Fenster hinüber. Draußen schien die Sonne, die Blätter der Bäume am Straßenrand hatten ein sattes Grün angenommen und bewegten sich im Wind. Das helle Tageslicht schmerzte noch immer in seinen Augen. Er ließ die Rollläden so weit herunter, dass nur noch die Lamellenschlitze geöffnet waren.
»Eigentlich rufe ich an, weil wir heute in den Zoo wollen und frag mich nicht, warum auf einmal, aber Lisa hätte gern, dass du mitkommst.«
Ben musste schwer schlucken.
›Mördertochter‹, so hatten die anderen Schüler Lisa beschimpft, weil irgendein wahnsinniger Vater seinen Sohn das YouTube-Video hatte schauen lassen, auf dem Ben gezwungen war, einen Menschen zu erschießen. Für den Jungen war es ein Leichtes gewesen, das Video im Netz wiederzufinden und seinerseits auf dem Handy seinen Freunden in der Schule zu zeigen. Nicole bemühte sich inständig, Lisa davon zu überzeugen, dass ihr Vater nicht anders hatte handeln können und ihn keine Schuld traf. Doch sie fand keinen rechten Zugang zu Lisa, die sich, wenn Nicole einen erneuten Erklärungsversuch unternahm, die Ohren zuhielt oder einfach in ihr Zimmer lief. Vermutlich konnte Lisa nicht begreifen, wie ihr Vater so etwas Schreckliches tun konnte. Sicher fragte sie sich, warum es Menschen gab, die so grausam waren, dass sie andere zwangen, aufeinander zu schießen. Nachdem Lisa immer abweisender, trauriger und in sich gekehrter wurde, hatte Nicole sich um eine kinderpsychologische Therapie gekümmert, bei der sie selbst auch anwesend sein durfte. Dann kam Nicoles Trennungswunsch, da sie es satthatte, dass Ben sich einer Therapie gegenüber weiterhin verweigerte, obwohl ganz offensichtlich war, dass er mit den alltäglichen Dingen überfordert war und unter starken Stimmungsschwankungen litt. Hinzu kam, dass sie nicht mehr ansehen wollte, wie er wegen einer plötzlichen Erinnerung an die Geschehnisse in Afrika innehielt, ihm Tränen in die Augen stiegen und er die Zähne aufeinanderbiss. Das Zusammenleben zerrte an ihren Nerven. Nachdem Ben ausgezogen war, bekam er Lisa immer nur kurz zu sehen, wenn er sie und Nicole besuchte. Nach einer schnellen Begrüßung verschwand sie direkt wieder in ihrem Zimmer. Wenn er anrief, wechselte sie nur ein paar knappe Worte mit ihm, bevor sie das Telefon wieder an Nicole zurückreichte. Gemeinsame Unternehmungen hatte es seit seinem Auszug nicht mehr gegeben.
Es war klar, warum Nicole so vehement versucht hatte, ihn zu erreichen. Sie wusste, was dieser Ausflug in den Zoo für ihn bedeutete.
»Sollen wir uns um zwei Uhr bei den Seehunden treffen?«
»Danke«, flüsterte er ins Telefon.
»Wie bitte?«
»Ich meinte, danke. Das ist wirklich toll. Ich kann’s noch gar nicht richtig fassen.«
»Prima. Übrigens, ich habe diese Woche jeden Artikel von dir verschlungen. Das war echt mal ein klasse Thema.«
Nicole wollte offensichtlich das Thema wechseln, um ihn auf andere Gedanken zu bringen.
3
Ben musste an die Umarmung und den Abschiedskuss denken, den er Lisa vor seiner Abreise nach Afrika gegeben hatte. Ihr blondes Haar war damals zu zwei seitlich herabhängenden Zöpfen geflochten gewesen.
Als das Taxi anfuhr, winkte Ben seiner kleinen Familie zum Abschied zu. Nicole und Lisa hatten Tränen in den Augen. Er hatte seinen beiden Liebsten versichert, in fünf Tagen zurück zu sein. Daraus waren am Ende sieben geworden und wenige Monate nach seiner Rückkehr hatte er alles verloren: seine Familie, sich selbst und dann auch noch seinen Job als Redakteur bei einer angesehenen Berliner Tageszeitung. Fünf Monate nach Bens Heimkehr aus Äthiopien teilten die Herausgeber der Zeitung ihm mit, dass er für sie leider nicht weiter tragbar sei. Und er musste ihnen recht geben. Er war einfach nicht mehr imstande, konzentriert zu arbeiten. Stundenlang saß er nur da und tat nichts. Und wenn doch, dann kam nichts Verwendbares dabei heraus. Wenn seine Kollegen ihn etwas fragten, gab er pampige Antworten, und wenn sie seine Arbeit kritisierten oder jemand nicht das tat, was er von ihm verlangte, reagierte er in einem aggressiven Ton, wie er es vorher von sich nicht gekannt hatte. Schließlich stellten sie ihn von der Arbeit frei, wollten, dass er sich behandeln ließ und eventuell nach einer Therapie wieder zurückkam. Ben hatte daraufhin gekündigt. Fakt war, dass er für die Berichterstattung im Ressort Blick in die Welt, in dem es nur allzu oft um Unruhen, Kriege und Gewalt ging, nicht mehr zu gebrauchen war. Das erkannte er selbst. Die Beschäftigung mit solchen Themen führte unweigerlich dazu, dass er wieder in dem Haus bei dem Duell landete und über geraume Zeit den Ausgang nicht fand. Das war der Grund, warum er keine Artikel mehr schreiben konnte.
Viel schwerer noch als die Aufgabe der Arbeit wog für Ben aber die Trennung von seiner Familie.
»Wenn du dorthin fliegst, brauchst du nicht wieder zu uns zurückzukommen«, hatte Nicole ihn gewarnt. Er hatte ihre Drohung durchaus ernst genommen, und ihr versichert, dass es das letzte Mal sein würde. Aber das hatte er schon oft gesagt. Und jetzt hatte er mit den Konsequenzen zu leben.
So nah, wie in diesem Haus in Afrika, war er dem eigenen Tod noch nie gewesen. Nachdem er das Duell überlebt hatte, hielten die Entführer ihr Versprechen, den letzten Überlebenden freizulassen. Sie fesselten ihn, verbanden ihm die Augen und warfen ihn nach einer etwa einstündigen Fahrt auf dem Dorfplatz einer kleinen Siedlung von der Pritsche des Wagens. Die Dorfbewohner verständigten dann die Polizei. Nur ein paar Stunden später fanden die einheimischen Polizisten aufgrund seiner Beschreibung das Haus, in das er und Mike verschleppt worden waren, mit den darin liegenden Leichen von Mike und Kevin. Etwa zum gleichen Zeitpunkt wurde das Video von dem grausamen Duell online gestellt. Er selbst konnte Nicole zuvor noch telefonisch und unter Tränen mitteilen, was passiert war. Wenige Tage später und nach einer ausführlichen Aussage konnte Ben nach Hause zurückreisen.
»Dein Job ist dir wichtiger als deine Familie. Es ist dir doch egal, wenn wir hier vor Angst um dich fast verrückt werden«, hatte sie ihm vor seiner Abreise vorgeworfen.
Er hatte das vehement bestritten. Sich damit gerechtfertigt, dass die Welt wissen müsse, wie sehr die Menschen in Äthiopien litten. Er wollte von der Hungersnot berichten, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen.
Mit neunundzwanzig war er für zwei Jahre aus Berlin weggegangen, um bei einer großen Hamburger Tageszeitung zu arbeiten. Er war froh darüber gewesen, dort mit den Auslandsreportagen betraut zu sein. Als überzeugter Pazifist glaubte er, durch die Berichterstattung aus den Krisenländern der Welt, bei denen er insbesondere Wert darauf legte, die Nöte der dort lebenden Menschen zu beleuchten, seinen Teil dazu beitragen zu können, dass sich dort etwas zum Besseren wendete. Auch nachdem er wieder zurück in Berlin war und Nicole kennengelernt hatte, war er seinem Ressort treu geblieben. Nicole hatte es jedoch nie akzeptieren können, dass er für manche Reportagen in die Krisenregionen reisen musste und sich dadurch immer wieder aufs Neue in unvorhersehbare Gefahren begab. Sie konnte die ständige Angst, dass ihm etwas zustoßen könnte, nicht ertragen. Nach Lisas Geburt vor acht Jahren, hatte er auf Nicoles vehementes Drängen hin endlich die Auslandsreportagen aufgegeben und mit der Redaktionsleitung für den Blick in die Welt einen Chefposten übernommen, der ihn nur in ganz seltenen Fällen noch zwang, selbst zu reisen. Nicole gegenüber rechtfertigte er sich damit, dass die Kontaktleute vor Ort nur ihm vertrauten und auch nur mit ihm reden würden.
Er genoss es dann besonders, in sein altes Betätigungsfeld zurückzukehren und seinen Anzug und den Schreibtisch als Redaktionsleiter gegen Outdoorbekleidung und Marschstiefel einzutauschen. Wie Indiana Jones: Einerseits der smarte Universitätsprofessor, andererseits der neugierige und die Gefahr liebende Draufgänger. Nur bei seinem letzten Außeneinsatz war seine Rechnung nicht aufgegangen. Alles war schiefgelaufen und in einer Katastrophe geendet, deren Folgen für immer an ihm haftenbleiben würden.
Seit vier Monaten war Ben nun wieder als Reporter tätig. Er arbeitete beim Berliner Boulevardblatt, das seinem Freund Viktor von Hohenlohe gehörte – ebenso wie eine Privatbank und mehrere Fabriken –, und war dort für die Rubrik Kurioses zuständig.
Bens neueste Story behandelte die Hellseherei. Der Artikel war in eine sechsteilige Serie gegliedert, die in der heutigen Samstagsausgabe ihren Abschluss fand. Wenn er ehrlich war, war die Story nur ein Versuch, Nicole zu imponieren. Sie sollte außerdem sehen, dass er sich von den schweren Themen verabschiedet hatte und nun auf der Suche nach Geschichten war, die ihn in keiner Weise in Gefahr bringen könnten.
In den letzten Tagen hatte er zwei Frauen und einen Mann, die sich als Wahrsager betätigten, im Selbsttest über seine Zukunft befragt, ohne ihnen zu verraten, dass er Journalist war. Wie vermutet, hatten die drei ihm etwas völlig Unterschiedliches prophezeit. Die erste Frau, die er besuchte, legte Ben die Karten und sagte ihm vorher, dass ihm ein glückliches Leben bevorstehe. Die zweite Frau sah in einer Kristallkugel, dass Ben eine Menge Geld zu erwarten habe. Diese beiden Aussagen überraschten ihn nicht, zählten sie doch zum Standardrepertoire dessen, was Menschen, die Wahrsager aufsuchten, hören wollten. Als Ben an seinen letzten Testkandidaten dachte, bei dem er erst gestern Morgen gewesen war, überkam ihn ein tiefes Unbehagen. Irgendwie war ihm der Mann unheimlich gewesen. Er hieß Arnulf Schilling und wohnte in einem denkmalgeschützten alten Haus in der Spreetalallee, dessen Garten unmittelbar an den Ruhwaldpark angrenzte.
Schilling hatte lange weiße Haare, die ihm bis über die Schultern seines dunkelbraunen Anzugs fielen, und einen weißen Vollbart, der ihm bis zur Brust reichte. Ben schätzte, dass der Wahrsager, der ihn an den dunklen Zauberer Saruman aus den Herr der Ringe-Filmen erinnerte, um die siebzig Jahre alt sein musste. Sein stechender Blick aus den tiefliegenden Augen schien Ben zu durchbohren. Nicole hätte gesagt, Ben habe die negative Aura dieses Menschen gespürt.
Arnulf Schilling bot Ben im Wohnzimmer einen Platz auf einem alten Polstersessel an. Nachdem Ben sich gesetzt hatte, stellte Schilling einen Stuhl unmittelbar vor den Sessel und setzte sich Ben gegenüber, so dass sich ihre Knie fast berührten.
Ben tischte dem Mann die gleiche Geschichte auf, die er auch schon den beiden Wahrsagerinnen erzählt hatte: Er sei unzufrieden mit seiner beruflichen und privaten Situation und sehe keinen Anhaltspunkt, dass sich an seinem Leben und seiner Unzufriedenheit bald etwas ändern könnte. Ben hatte bewusst so wenige Informationen wie möglich von sich preisgegeben. Während die davor getesteten Wahrsagerinnen versuchten, mit gezielten Fragen etwas aus ihm herauszubekommen, das sie dann benutzen konnten, um daraus eine fadenscheinig passende Zukunftsvision zu konstruieren, verlor der Langhaarige kein unnötiges Wort, sondern fixierte Ben mit tiefem Blick. Dann lächelte Schilling, räusperte sich, fasste Ben an beiden Händen und schloss die Augen. Nach etwa einer Minute zuckte der Mann heftig. Als hätte er einen elektrischen Schlag erhalten, ließ er schlagartig Bens Hände los und schnellte nach hinten. Dann sah er Ben mit bedauerndem Blick an. Ein sorgenvoller Ausdruck lag jetzt auf seinem Gesicht. Tolle Showeinlage, dachte Ben.
Schilling räusperte sich, als müsste er nach den richtigen Worten suchen. »Ihnen steht ein großes Unheil bevor«, sagte er dann.
Bens Lächeln war mit einem Mal wie eingefroren. »Was denn für ein Unheil?«
Schilling sah Ben ernst an und legte die Stirn in Falten. Er schien zu überlegen, wie viel er seinem Klienten verraten dürfte. »In Ihrer Umgebung wird es Tote geben«, sagte er schließlich.
Bens Miene verfinsterte sich. Obwohl er an diesen Humbug nicht glaubte, verunsicherte ihn die Aussage des Alten. Die beiden vorhergehenden Testkandidatinnen hatten ihm mit überaus positiven Aussichten das Leben versüßen wollen. Dieser Mann hier wollte ohne Zweifel das Gegenteil. »Wie meinen Sie das?«
»Ich habe schreckliche Dinge durch Ihre Augen gesehen. Dinge, die Sie bald erleben werden.«
Der Mann war ein Scharlatan, seine Vorhersage viel zu ungenau. Irgendeine Unpässlichkeit stieß doch jedem irgendwann einmal zu, und dann würde er sich an diesen Mann erinnern und sich sagen: Er hat es vorhergesehen.
»Was haben Sie denn gesehen?« Ben war sich sicher, Schilling würde ausweichen. Und in gewisser Weise tat er das auch.
»In Fällen wie dem Ihren halte ich mich mit konkreten Äußerungen sicherheitshalber zurück. Schließlich könnte ich mich auch irren, und dann wäre es nicht richtig, Sie damit zu belasten.«
Im Gegensatz zu Ben glaubte Nicole fest an die Hellseherei. Es gab kaum einen Kartenleger, bei dem sie noch nicht gewesen war. Diese drei Hellseher hatte er gezielt deshalb ausgesucht, weil er wusste, dass sie auf Nicoles Liste noch fehlten und sie sich deshalb ganz besonders für seine über die Tage der letzten Woche verteilten Artikel zum Thema Wahrsagerei und den abschließenden Hellsehertest in der Samstagsausgabe interessieren würde.
Aber Ben wollte nicht lockerlassen. Er wollte, dass Schilling sich zu einer konkreten Aussage verleiten ließ, die sich dann selbstverständlich als unwahr erweisen würde.
»Wenn ich nun aber wüsste, was auf mich zukommt, könnte ich es vielleicht verhindern. Können Sie mir nicht etwas Greifbareres an die Hand geben? Etwas, wodurch ich das Unheil, von dem sie sprachen, erkennen kann?«
Schilling schüttelte langsam den Kopf. »Glauben Sie mir, es ist besser, wenn Sie nichts wissen. Ändern werden Sie daran ohnehin nichts können.«
Langsam wurde Ben ungehalten. Der Kerl war aalglatt.
»Aber Sie erwarten doch nicht ernsthaft, dass ich Sie für diese Auskunft bezahle?«
Jetzt sah der Bärtige überrascht auf. Für einen Moment schien der Blick seiner eisblauen Augen Ben zu durchbohren. »Sie glauben gar nicht an Hellseherei, nicht wahr? Sie denken, alles, was die Wissenschaft nicht beweisen kann, existiert auch nicht. Vermutlich glauben Sie auch nicht an Gott.«
Der Mann wartete Bens Antwort gar nicht erst ab.
»Also gut. Ganz, wie Sie wollen. Ich gebe Ihnen einen Beweis dafür, dass ich recht habe und weiß, was die Zukunft für Sie bereithält.«
Wieder schmunzelte der Mann und rieb sich seinen Bart.
»Ich sage Ihnen, was ich durch Ihre Augen in der Zukunft gesehen habe. Wenn Sie es dann selbst sehen, werden Sie wissen, dass das Unheil bereits seinen Anfang genommen hat.«
Wieder hatte Schilling in Rätseln gesprochen. Und dann hatte er etwas gesagt, das punktgenau war und dennoch wieder nichts erahnen ließ. Es waren ein Datum und eine Uhrzeit: 24. Juni, 2 Uhr 41. Danach war der Hellseher aufgestanden und hatte Ben zur Tür begleitet.
4
Nach einer Dusche und zwei Tassen Kaffee fühlte Ben sich besser. Er freute sich darüber, dass Lisa von sich aus wieder seine Nähe suchte, und hoffte, dass seine Tochter bald wieder den sanftmütigen Vater und nicht mehr einen Mörder in ihm sehen würde. Er wünschte ihr, dass sie die Szenen aus dem Video verdrängen könnte. Wenn sie es später zuließ, würde er sie einfach nur in den Arm nehmen und an sich drücken. Er überlegte sich, dass er ihr gern ein Geschenk mitbringen würde. Am besten ein schönes Kleidungsstück, zum Beispiel ein T-Shirt, aber er war sich nicht sicher, ob er ihren Geschmack noch treffen würde.
Er musste daran denken, wie sehr Lisa es mochte, vor dem großen Wandspiegel im Eingangsbereich der Wohnung zu posieren und dort ihre eigene Modenschau zu veranstalten. Wenn ihr aufgefallen war, dass er sie dabei beobachtete, war es ihr peinlich gewesen, und sie hatte gleich damit aufgehört. Ihm fielen auch die schönen Familienurlaube ein. Besonders eine vierwöchige Reise mit dem Wohnmobil war ihm in Erinnerung geblieben. Nicole hatte im Anschluss daran ein dickes Fotoalbum erstellt, das sie sich schon unzählige Male gemeinsam auf der Couch, mit Lisa in der Mitte, angesehen hatten. Sie waren in mehreren Etappen bis nach Andalusien gefahren und hatten alle paar Tage an einem anderen Ort übernachtet. Sie waren in kleinen Buchten mit glasklarem Wasser tauchen gewesen, und er hatte Stunden damit verbracht, Lisa dabei zu helfen, mit einem Eimer und einem Netz in Ufernähe kleine Fische zu fangen oder riesige Sandburgen zu bauen. Als er sich mit einem Blick auf die Uhr von dem schönen Film, der vor seinem inneren Auge ablief, losriss, bemerkte Ben, dass sich seine Lippen zu einem Lächeln verzogen hatten. Er hätte alles dafür gegeben, dass es wieder so wurde wie damals. Bisher hatte er diesbezüglich wenig Hoffnung gehabt, und nachdem Nicole die Scheidung eingereicht hatte, sanken die Chancen dafür weiter. Dennoch gab ihm der anstehende Zoobesuch mit seiner Familie Auftrieb. Er hatte das Gefühl, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren war.
Während er den Gedanken an glücklichere Tage nachhing, durchsuchte er die Kleidungsstücke, die er am vorigen Abend getragen hatte, nach seinen Wertgegenständen. Seinen Schlüsselbund fand Ben wie gewohnt in der Vordertasche seiner unordentlich neben dem Bett liegenden Jeans, in deren Gesäßtasche auch sein Geldbeutel steckte. Die Suche nach seinem Mobiltelefon verlief jedoch ergebnislos. Es lag weder auf dem Sideboard noch auf dem Tisch. Und in einer der Taschen seiner Lederjacke, die er gestern getragen hatte, befand es sich ebenfalls nicht. Auch der Anruf mit dem Festnetztelefon auf dem Handy verriet ihm nicht, wo es sich befand. Obwohl er es nie lautlos stellte, hörte er es nicht klingeln. Er kam zu dem Schluss, dass er sein Telefon in Tamara Engels Wohnung liegengelassen haben musste. Es war erst kurz vor zwölf. Genug Zeit also, um das Handy zu holen und bei der Gelegenheit Tamara zu fragen, wie er nach Hause gekommen war.
Als Ben aus dem Hauseingang auf den Bürgersteig trat, fragte er sich, ob es überhaupt eine gute Idee war, plötzlich bei Tamara aufzutauchen. Schließlich konnte er sich nicht mehr an die Geschehnisse des gestrigen Abends erinnern. Vielleicht hatte er sich danebenbenommen, und sie hatte ihn rausgeworfen. Oder – was er nicht hoffte – sie waren zusammen im Bett gelandet. Auf dem Weg zur U-Bahn-Station, die nur etwa zweihundert Meter von dem Mietshaus mit Bens Wohnung entfernt war, rief er sich noch einmal ins Gedächtnis, was gestern Abend nach dem Telefonat mit Nicole genau geschehen war – zumindest das, woran er sich erinnern konnte.
Viktor und Ben hatten Tamara im Kassenbereich des Kinos getroffen. Das letzte Mal hatten Viktor und sie sich vor drei Jahren bei einem Klassentreffen wiedergesehen und damals eigentlich vorgehabt, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Wie so oft war es bei den guten Vorsätzen geblieben. Tamara war alleinerziehend, ihr Sohn Tim sieben Jahre alt. Einmal im Monat gönnte sie sich einen Kinoabend, und ihre Schwiegermutter passte so lange auf Tim auf. Eigentlich war sie mit einer Freundin verabredet gewesen, doch diese hatte kurzfristig abgesagt. Tamara hatte sich den Film, auf den sie sich schon so lange gefreut hatte, nicht verderben lassen wollen und war kurzerhand allein zum Kino gefahren. Sie waren dann zu dritt in denselben Film gegangen, auf den sich Ben jedoch nicht hatte konzentrieren können. Immer wieder ging Ben durch den Kopf, dass Nicole sich scheiden lassen wollte. Eine halbe Stunde nach Filmbeginn erhielt Viktor eine SMS, deren Inhalt so wichtig war, dass er das Kino augenblicklich verlassen musste. Viktor von Hohenlohe war der Stammhalter einer Adelsfamilie, dem es, wie schon seinen Vorfahren, gelungen war, den geerbten Reichtum noch weiter zu steigern. Die alleinige Leitung des Unternehmensimperiums verlangte es Viktor ab, zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar zu sein. Es verging kaum ein Abend, an dem nicht das Telefon klingelte und Viktors Entscheidung gefragt war. Viktor hatte Tamara und Ben noch einen schönen Abend gewünscht und war dann aus dem Kino gestürzt.
Viktors Frau Veronika hatte ihn vor dreizehn Jahren mit dem gemeinsamen Sohn Johannes verlassen. Seither hatte Ben seinen Freund nur in Begleitung von teuren Hostessen gesehen, die Viktor immer dann anheuerte, wenn es der Anlass gebot, mit einer Partnerin aufzutauchen. Aber eine Frau, die ihm wirklich nahegestanden hätte, hatte es nie wieder gegeben.
Nach dem Kino war Ben mit Tamara ins amerikanische Diner um die Ecke gegangen, wo sie ofenwarmen Pfirsichkuchen gegessen hatten. Tamara merkte ihm an, dass er mit seinen Gedanken ganz woanders war. Irgendwann erzählte er ihr von Nicoles Vorhaben, sich scheiden zu lassen. Daraufhin gab auch Tamara etwas von sich preis. Ihr Exmann war spielsüchtig und hatte das kleine Vermögen, das sie von ihren früh verstorbenen Eltern geerbt hatte, komplett verspielt. Außerdem sei er ein krankhaft eifersüchtiger und gewalttätiger Choleriker. Er habe sie mehrmals zusammengeschlagen, auch vor Tim. Es war nur so aus ihr herausgesprudelt. Offensichtlich hatte ihr schon lange niemand mehr einfach nur zugehört. Nach der Trennung von ihrem Mann hatte sie sich als Designerin selbständig gemacht. Aber in einer kreativen Stadt wie Berlin täten das viele, so dass sie und Tim mehr schlecht als recht davon leben könnten.
Nach Verlassen des Diners hatte Tamara ihn gefragt, ob er so nett sein könnte, sie bis zu ihrer Wohnung zu begleiten. Sie sei sehr selten noch um diese Uhrzeit unterwegs und habe auch noch immer Angst vor ihrem Exmann, den sie schon mehrfach vor dem Mietshaus, in dem sie zurzeit wohnte, gesehen hatte.
Als das Taxi vor dem Haus hielt, war es kurz nach Mitternacht. Tamara bat Ben, vor dem Haus zu warten, bis sie ihre Schwiegermutter verabschiedet hätte, da diese nicht begeistert wäre, wenn sie mitten in der Nacht in Begleitung eines fremden Mannes auftauchen würde. Zehn Minuten später saß Ben dann auf einer bequemen Couch mit braunem Alcantarabezug in Tamaras Wohnzimmer. Von da an wusste er nichts mehr. Die Zeit bis zu seinem Erwachen vor gut einer Stunde schien aus seinem Gedächtnis gelöscht zu sein.
5
Als auch nach dem dritten Klingeln an der Eingangstür des sechsstöckigen Mietshauses niemand öffnete, kramte Ben seinen Notizblock aus seiner Jacke hervor und schrieb mit der Bitte, dass Tamara ihn anrufen solle, seine Festnetznummer darauf. Gerade, als er den Zettel in ihren Briefkasten werfen wollte, kam ein älterer Herr aus dem Haus. Freundlich lächelnd hielt dieser ihm die Tür auf. Ben betrat das Treppenhaus und lief in den dritten Stock, in dem Tamaras Wohnung lag. Kurz überlegte er. Wenn er ihr den Zettel unter der Wohnungstür durchschieben würde, wäre sichergestellt, dass sie die Nachricht heute noch finden würde. Im Briefkasten hingegen könnte sie den kleinen Zettel übersehen, oder vielleicht würde sie ihn sogar erst am Montag wieder leeren.
Als er in die Hocke gehen wollte, um den Zettel unter der Tür hindurchzuschieben, bemerkte er, dass diese nur angelehnt war. Tamara würde wohl kaum das Haus verlassen haben, ohne zuzuziehen. Er drückte gegen die Tür, die daraufhin lautlos ein Stück aufschwang.
»Tamara, bist du da? Hier ist Ben«, rief er ins Innere der Wohnung. Er war schon im Begriff, den Zettel auf die Kommode, die links an der Wand im Flur stand, zu legen, da fiel ihm etwas Merkwürdiges auf. Es war dunkel im Flur. Die Tür zum Wohnzimmer stand offen, und die Rollläden waren noch heruntergelassen. Mittlerweile war es schon kurz vor ein Uhr mittags. Ben spürte, dass hier etwas nicht stimmte. Er dachte an Tamaras gewalttätigen Exmann. Was, wenn dieser sie beobachtet hatte, als sie mitten in der Nacht einen anderen Mann in die Wohnung mitgenommen hatte?
Ein Schauder überlief Bens Rücken. Er griff von der Türschwelle aus um die Ecke, schaltete das Licht an und suchte nach Spuren, die ihm verrieten, was los war. Aber was ging ihn das eigentlich an? Wenn er einfach hineingehen und nachsehen würde, ob alles in Ordnung war, käme Tamara wahrscheinlich gerade in diesem Moment von einer Nachbarin aus der Wohnung nebenan, wo sie sich nur kurz ein paar Eier geliehen hatte, zurück und würde ihn dabei ertappen, wie er in ihrer Wohnung herumschnüffelte.
Nein, seine Neugier, die für ihn als Journalist zwingend notwendig war, hatte ihn oft genug in brenzlige Situationen gebracht und war hier völlig unpassend. Sicher gab es eine logische Erklärung. Als er das Licht wieder ausschalten und gehen wollte, glaubte er einen erstickten Laut aus dem Raum zu seiner Linken zu hören. Er spürte, wie sich die Härchen auf seinen Unterarmen aufstellten und er eine Gänsehaut bekam. Es hörte sich an wie ein dumpfer Schrei.
Wie in Trance ging Ben auf die Tür zu. Sein Herz pochte, und seine Atmung ging flach und schnell. Als seine Hand die Türklinke umfasste, flackerten die ersten Szenen aus dem verfallenen Haus in Äthiopien vor ihm auf. Es war seine in ihm aufkommende Angst, die sie hervorrief. Er biss sich auf die Unterlippe. Scheiß auf das Handy! Kurz überlegte er, einfach umzudrehen und zu gehen. Er hatte genug eigene Probleme, und am wichtigsten war jetzt, dass er pünktlich zu dem Treffen mit seiner Tochter im Zoo erschien. »Um zwei Uhr bei den Seehunden«, sagte er leise zu sich. Irgendwie beruhigte ihn das.
Aber jemand versuchte auf sich aufmerksam zu machen. Er konnte nicht einfach verschwinden und so tun, als wäre alles in Ordnung. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen, drückte die Klinke herunter und stieß die Tür auf. Das Türblatt schwang auf, prallte gegen ein Hindernis und blieb in halb geöffneter Position stehen. Das Licht aus dem Flur fiel matt in das sandsteinfarben geflieste Badezimmer. Der Raum wirkte friedlich, kein Mucks war mehr zu hören. Kein Anzeichen, dass hier jemand in Not war. Hatte er sich getäuscht? Aber warum ließ sich die Tür nicht weiter öffnen? Ben drückte auf den Lichtschalter links an der Wand. Mehrere Deckenstrahler flammten auf und das leise Surren einer Lüftungsanlage setzte ein. Noch einmal atmete Ben durch, sagte sich, dass er sich geirrt haben musste. Dann schaute er hinter die Tür. Im gleichen Moment fuhr ihm der Schreck in jede Faser seines Körpers.
Er blickte in die rotgeäderten und verweinten Augen eines kleinen Kindes. In Augen, die vor Entsetzen und Angst wie paralysiert zu ihm aufschauten. Das Kind war mit Handschellen und den Armen auf dem Rücken an die unterste Sprosse eines Handtuchheizkörpers gefesselt. Ein breites Klebeband verdeckte seinen Mund und die Hälfte seines Gesichts. Ben kniete sich zu dem Jungen und zog an seinen Fesseln, konnte sie aber nicht von dem Heizkörper losreißen.





























