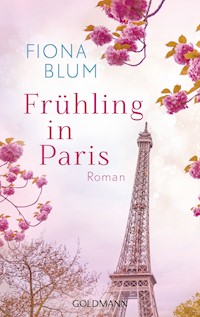9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Lucy S. Harper ist Lehrerin für Mathematik in Manchester. Sie lebt allein, liebt die Welt der Zahlen und verabscheut Überraschungen. Wie den Anruf, den sie eines Tages erhält: Eine ihr unbekannte Frau namens Maureen teilt ihr mit, dass ihr Vater im Sterben liegt und sie noch einmal sehen möchte. Zuerst glaubt Lucy an einen Irrtum, denn ihr Vater Peter ist wohlauf – von jenem George, der in Irland angeblich auf sie wartet, hat sie noch nie gehört. Doch als ihre Eltern äußerst seltsam reagieren, wird Lucy misstrauisch. Spontan beschließt sie, nach Irland aufzubrechen und der Sache auf den Grund zu gehen. Und damit beginnt das erste Abenteuer ihres Lebens ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Ähnliche
Buch
Lucy S. Harper ist Lehrerin für Mathematik in Manchester. Sie lebt allein, liebt die Welt der Zahlen und verabscheut Überraschungen. Wie den Anruf, den sie eines Tages erhält: Eine ihr unbekannte Frau namens Maureen teilt ihr mit, dass ihr Vater im Sterben liege und sie noch einmal sehen möchte. Zuerst glaubt Lucy an einen Irrtum, denn ihr Vater Peter ist wohlauf – von jenem George, der in Irland angeblich auf sie wartet, hat sie noch nie gehört. Doch als ihre Eltern äußerst seltsam reagieren, wird Lucy misstrauisch. Spontan beschließt sie, aufzubrechen und der Sache auf den Grund zu gehen. Und damit beginnt das erste Abenteuer ihres Lebens …
Autorin
Fiona Blum ist das Pseudonym der Schriftstellerin und Juristin Veronika Rusch. Sie hat Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom studiert und mehrere Jahre als Anwältin gearbeitet. Heute lebt sie als Schriftstellerin mit ihrer Familie in einem alten Bauernhaus in Oberbayern. Für ihren Roman »Liebe auf drei Pfoten« erhielt sie den begehrten DELIA-Literaturpreis.
Weitere Informationen unter www.fiona-blum.de und @fionablum
Fiona Blum
Das Meer so nah
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe April 2018
Copyright © 2018 by Fiona Blum
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Umschlagmotive: Haus: Stephen Barnes/Homes and Interiors / Alamy Stock Foto, Mauer: Stuart Black / Alamy Stock Foto, Himmel: FinePic®, München Landschaft: plainpicture/Cultura/Gu
FinePic®, München
Redaktion: Ilse Wagner
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-22071-6V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
»Als ich fünf Jahre alt war, sagte mir meine Mutter, dass Glücklichsein das Wichtigste im Leben sei. Als ich zur Schule ging, fragte man mich, was ich werden wollte, wenn ich erwachsen sei, und ich schrieb: »glücklich«. Sie sagten mir, dass ich die Aufgabe nicht verstanden hätte. Ich sagte ihnen, dass sie das Leben nicht verstanden hatten.«
John Lennon
»… denn man kann nichts zähmen, was so frei und wild und glücklich ist.«
Emily Hughes, Wild
Dramatis Personae
TOTTINGTON/MANCHESTER
Lucy Skye Harper, Mathematiklehrerin mit rätselhaftem Zweitnamen und einer unbestimmten Sehnsucht
Chloé Harper, Lucys Tochter
Lilly und Peter Harper, Lucys überraschend schweigsame Eltern
Pippa Carlisle, Lucys jüngere Schwester, die ihr Herz an einen schottischen Gärtner verloren hat
Rob Carlisle, Pippas Mann, der schottische Gärtner
Joy, Jacky, Jenna, Jamie, Pippas Kinder
Jasper, Joseph, Pippas Hunde
KNOCKNABARRA
George Miller (Geordie), der Mann, der auszog, dem Regen die Stirn zu bieten
Maureen Mulligan, Friseurin, Taxifahrerin, Gästehausbesitzerin mit einem großen Herzen
Séamus (sprich: schaimes) Owen, Schaffarmer mit einem Glasauge und einer Weide, auf der man traurige Feste feiern kann
Flynn, junger Mann aus Dublin, der seine Kindheit um Haaresbreite überlebt hat und keine Briefe schreiben will
Erin, Streunerin unklarer Herkunft, rothaarig, ein Streichholz, das darauf wartet, angezündet zu werden
Gracie O’Malley, ältere Dame mit Vorliebe für Wäscheständer und irische Poeten, Nachfahrin der berühmtesten Piratin Irlands
Roísín (sprich: Rosh-een) MacNamarra, die mit den Feen spricht. Pubbesitzerin mit bewegter Vergangenheit, die zu oft friert
James Murphy, fiedelndes Original mit Hang zum Ale, dessen Zukunft 1972 in Derry endete
Raymond Campbell, Musikproduzent aus Dublin, der weiße Anzüge und spitze Schuhe liebt und von Zeiten träumt, die es niemals gegeben hat
ACHADH CAIRN
Liam Cullen, Schaffarmer und Möbelschreiner, der an Feen glaubt, schon einmal am Abgrund stand und deswegen vorsichtig ist
Ryan O’Toole, Liams Freund und Pubbesitzer, der froh ist, dass seine Frau ihn liebt und seine Schwiegermutter tot ist
GALWAY
Michael Byrne, Anwalt, der von etwas träumt, seit er ein kleiner dürrer Junge mit abstehenden Ohren war, aber es lange nicht weiß
Arthur Cox senior, Anwalt, der Sean Connery von Galway
Arthur, »Art« Cox junior, sein Sohn, der sich redlich bemüht, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, auch wenn er nicht wie Sean Connery aussieht
Saoirse (sprich: Sörscha), Tanzlehrerin, deren Gesang für Gänsehaut sorgt
Fintan O’Shea, Bodhránspieler und ehemaliger Weiberheld, der jeden Tag baden geht und eine Menge weiß
Katie McMahon, Fintan O’SheasTochter, die vortrefflichen Irish Cheese Cake backen kann und auch sonst eine wunderbare Gastgeberin ist
Siobhan (sprich: Schewon), Fintan O’Sheas Enkelin, die schon entschieden hat, wen sie heiraten will
Schafe. Viele Schafe. Und ein Hund
Prolog
Als ich ein Kind war, vielleicht fünf, sechs Jahre alt, gab es eine Zeit, in der ich Angst vor Regen hatte. Es fing mit der Angst vor Gewittern an. Doch nach einer Weile wurde es schlimmer. Sobald sich auch nur ein winziges Wölkchen am Himmel zeigte, hatte ich das dringende Bedürfnis, auf der Stelle Schutz zu suchen. Irgendwann – waren es Wochen, Monate oder Jahre später – verflüchtigte sich diese Angst wieder, sie verdampfte wie eine Pfütze in der Sonne, und ich vergaß, dass sie einmal da gewesen war.
An jenem stürmischen Tag im Dezember 1974, als ich – fast ein Vierteljahrhundert später – auf der Fähre Richtung Irland an der Reling stand und mit rebellierendem Magen auf die wütende irische See blickte, fiel mir diese alte Angst wieder ein, und ich fragte mich, warum ich mir für meine Flucht ausgerechnet einen Ort hatte aussuchen müssen, an dem es noch mehr regnete als in England?
Heute weiß ich die Antwort:
Gerade deswegen.
Um zu lernen, dass man nur frei sein kann, wenn man nicht bei der ersten Wolke am Himmel nach Schutz sucht.
1
»Wir müssen es tun«, sagte Séamus und trank einen Schluck von seinem Pint. »Wir sind es ihm schuldig.«
»Aber es wird ihr Leben völlig durcheinanderbringen«, warf Maureen zweifelnd ein. »Können wir das verantworten?«
»Darum geht es nicht«, widersprach Roísín von der Theke her. Sie war die Wirtin des Pubs, in dem die beiden saßen und seit einer Stunde dieses Problem besprachen. »Es hätte schon längst geregelt werden müssen.« Sie ging zum Kamin und warf ein weiteres Stück Torf ins Feuer. Sofort breitete sich der durchdringende, säuerliche Geruch nach Moorerde im Raum aus. Roísín war eine der wenigen, die ihr Pub noch immer mit Torf heizte. Die meisten anderen Kneipenbesitzer waren längst auf Öl oder Gas umgestiegen, hatten künstliche Kaminfeuer installiert und waren froh, dass die Zeiten, in denen man auf die flachen braunen Briketts angewiesen gewesen war, endgültig vorüber waren. Torf roch nach Armut und Elend, fanden sie. Roísín widersprach ihnen, sie widersprach überhaupt gern und oft, und auch in diesem Fall hatte sie eine andere Meinung: Torf roch nach Heimat, nach Dingen, die man nicht vergessen durfte, er roch nach den Mooren, aus denen er kam, nach Pflanzen, die dort gelebt hatten, er roch nach Irland. Sein Rauch hatte die Farbe der Insel, deren Grün längst nicht so hell und leuchtend war, wie die Werbeprospekte die ganze Welt inzwischen glauben machen wollten. Die Farbe des Torfrauchs ging tiefer, erfasste alle Schattierungen der Insel, vom hellen Grün der Wiesen bis zum erdigen Braun der Moore.
Flynn hatte sich halb totgelacht, als sie darüber einmal gesprochen hatte. »Was für eine beschissene Farbe soll dein Torfrauch haben? Ich sag dir, er ist immer schwarz und stinkt nach Scheiße, egal, ob du deine Schwiegermutter oder deinen Slip verbrennst.«
Roísín hatte keine Antwort gegeben. Es lohnte nicht, mit Flynn über solche Dinge zu streiten. Er stammte aus Dublin, war groß geworden in einem der berüchtigten Ballymun Flats, deren elende Wohnungen bis zu ihrem Abriss Anfang dieses Jahrtausends denjenigen vorbehalten gewesen waren, denen überhaupt keine andere Wahl mehr blieb. Und ob das nicht schon genug gewesen wäre, hatte er auch noch seine Kindheit nur um Haaresbreite überlebt. In Flynns Kopf herrschte fortwährend Krieg, es gab nirgends eine Stelle, die friedlich genug war, um über Farbschattierungen des Torfrauchs nachdenken zu können. Roísín konnte das verstehen. Sie konnte überhaupt vieles verstehen, sogar Dinge, die sie gar nicht verstehen wollte. Jetzt kam Flynn zur Tür des Pubs herein, die Stirn wie immer zornig in Falten gelegt, gefolgt von dem alten James Murphy, der noch schlimmer humpelte als sonst. Die beiden setzten sich zu Maureen und Séamus, die ihnen besorgte Blicke zuwarfen. Schichtwechsel an Georges Sterbebett.
»Keine Zeit mehr«, nuschelte Murphy in seinen Bart. Er war kein Freund großer Worte. Dann schüttelte er den Kopf und versank in brütendes Schweigen.
»Erin meint, sie würde es wissen wollen.« Dieser überraschende Beitrag kam von Flynn. Alle vier wandten sich dem jungen Mann zu, der jetzt einen tiefen Schluck von dem Lager nahm, das Roísín ihm hingestellt hatte. Er zuckte mit den Schultern. »Was schaut ihr so? Is nich meine Meinung. Ich denke, Geordie könnte auf so ’ne englische Tussi glatt verzichten. Aber er denkt nicht so, oder? Hat immer von ihr gesprochen. Und Erin meint, sie wär stinkwütend, wenn’s ihr niemand sagen würde.«
Verblüfftes Schweigen antwortete ihm. Dass Maureen, Séamus, Roísín und Murphy gleichermaßen erstaunt waren, lag zum einen daran, dass Flynn sich noch nie für irgendjemanden oder irgendeine Sache eingesetzt hatte, und zum anderen, und das war noch verblüffender, dass Erin ebenfalls eine Meinung dazu zu haben schien. Erin machte immer den Eindruck, als sei sie gar nicht wirklich anwesend, schwebe nur zufällig vorbei, um im nächsten Augenblick wieder in anderen Sphären zu verschwinden. Sie sahen sich an, und nach einer Weile nickte Maureen. »Wir rufen sie an.«
Am Morgen des vierundzwanzigsten August regnete es in Tottington, Greater Manchester, wie es nahezu den ganzen August geregnet hatte. Und jetzt, als der Monat in den letzten Zügen lag, würde es auch nicht mehr besser werden. Der Wind schob den Regen in Böen über die wie ausgestorben wirkende Straße, klatschte Blätter, die um diese Zeit noch gar nicht von den Bäumen hätten fallen dürfen, gegen die Windschutzscheiben der Autos und ließ Dachrinnen und Gullys überlaufen. Lucy S. Harper stand vor dem Haus ihrer Eltern in der Booth Street 11, schloss für einen Moment die Augen, atmete tief ein und mit einem Seufzer wieder aus und drückte dann energisch auf den Klingelknopf. Es muss ausdrücklich erwähnt werden, dass sie klingelte, denn normalerweise tat sie das nicht. Sie besaß einen Schlüssel für das Reihenhaus mit dem weiß gestrichenen Erker und dem spitzen Giebel über dem Eingang, das sich nur durch eine dottergelbe Haustür von den übrigen Reihenhäusern der Straße unterschied. Ihre Mutter bestand darauf, dass sie ihn auch benutzte, »du bist doch hier zu Hause, Liebes«, was Lucy allerdings nur ungern tat. Sie sperrte zwar gehorsam auf, blieb dann jedoch an der Schwelle stehen und rief durch die offene Tür nach ihren Eltern, um sie nicht womöglich bei irgendetwas zu ertappen, was Töchter nichts anging. Allerdings erschien sogar ihr selbst dieser Gedanke im Grunde abwegig, ja, fast lächerlich, denn jedes Mal, wenn sie sich bemerkbar machte, kam ihre Mutter aus der Küche, oder ihr Vater rief aus dem Wohnzimmer aus den Tiefen seines Sessels: »Mum ist im Garten.« Nie waren die beiden irgendwo anders anzutreffen als in Wohnzimmer und Küche und bei schönem Wetter im Garten. Dennoch. Lucy war Privatsphäre wichtig, und sie respektierte sie auch bei anderen. Selbst wenn diese es nicht wollten. Ihrer Schwester Pippa hingegen war solche Rücksicht fremd. Wenn sie ihre Eltern besuchte, marschierte sie, ohne zu klingeln oder zu rufen, einfach durch den Flur schnurstracks in die Küche, genau wie damals, als sie noch Kinder gewesen waren, jetzt allerdings meist gefolgt von ihrer vierköpfigen Kinderschar, den beiden Hunden und ihrem Mann Rob. Sie brachte Erdkrümel an ihren Schuhen, Blumensträuße aus ihrer Gärtnerei, selbst gebackenen Apfelkuchen und den Geruch nach frischer Luft mit und schaffte es sogar, dass ihr Vater sich aus seinem Lehnstuhl im Wohnzimmer erhob, sie nacheinander umarmte und Jamie, den jüngsten seiner fünf Enkel, in die Luft warf, bis er vor Vergnügen kreischte.
Lucys jüngere Schwester war ein Mensch, der überall, wo er auftauchte, die Leute zum Strahlen brachte. Das war immer schon so gewesen. Es störte Lucy nicht, dass sie anders war. Sie war nicht eifersüchtig deswegen, im Gegenteil. Die beiden Schwestern verstanden sich, und sie besuchte Pippa und ihre Familie gern. Sie hatten eine Gärtnerei am Stadtrand von Tottington, zu der ein altes Haus gehörte, das Rob renovierte, seit sie dort vor zehn Jahren eingezogen waren. Pippa war eigentlich gelernte Zahntechnikerin, doch als sie Rob Carlisle kennenlernte, der damals bei ihrem Freund die Hecke schnitt, veränderte sich ihr Leben von Grund auf. Sie verließ ebenjenen Freund, einen gut situierten, aber ihren Angaben zufolge sterbenslangweiligen Versicherungsmakler, wurde sofort darauf schwanger, bekam Töchterchen Joy und heiratete Rob Carlisle in der St. Anne’s Church in Tottington in einem weißen, bauschigen Prinzessinnenkleid, den kleinen rothaarigen Säugling im Arm. Fünf Jahre und eine weitere Tochter, Jacky, später, übernahmen sie zusammen die Gärtnerei von zwei alten Schwestern, die beide schon über achtzig Jahre waren, zogen in das alte Haus und bekamen noch zwei Kinder, die jetzt achtjährige Jenna und das Nesthäkchen der Familie, den vierjährigen Jamie. Bis auf den Tick, dass Pippa und Rob allen ihren Kindern und sogar den beiden Hunden, Jasper und Joseph, Namen gegeben hatten, die mit J anfingen, schien das Leben von Lucys Schwester keinerlei Regeln zu folgen und war immer für eine Überraschung gut. Vielleicht musste das so sein, wenn man vier Kinder und zwei Hunde hatte, einen Kredit, den man in hundert Jahren nicht würde zurückzahlen können, mit einem impulsiven schottischen Gärtner verheiratet war und in einem Haus ohne funktionierende Heizung lebte. Für Lucy jedoch schien Pippas Alltag eher dem Überleben auf einem fremden Planeten zu ähneln. Im Gegensatz zu ihrer Schwester brauchte sie Regeln. Sie waren ihr fast so wichtig wie das Atmen. War atmen nicht auch eine Regel? Ein. Aus. Ein. Aus. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Ohne Regeln gab es keine Sicherheit. Deshalb war sie auch Mathematikerin geworden. Denn die Welt der Zahlen war logisch, berechenbar, man konnte sich auf sie verlassen, und es gab keine Überraschungen. Wenn man alles richtig machte, kam man zum richtigen Ergebnis. Keine Diskussion. Wenn es tatsächlich einen Planeten gäbe, auf dem nur Mathematiker wohnten, Lucy hätte sich längst dort ein Haus gekauft.
Doch wir wollen nicht abschweifen. Die Frage, die sich am Beginn dieser Geschichte stellte, war eine andere, nämlich, warum Lucy an diesem regnerischen Morgen am Ende eines komplett verregneten Sommers gegen jede Regel auf die Klingel ihres Elternhauses drückte. Auch diese Frage hing mit Mathematik zusammen, irgendwie, jedenfalls aus Lucys Perspektive. Für sie waren ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Eltern zwei Mengen, die sich zwar überschnitten, aber nur zum Teil. Und in dieser Schnittmenge, in der sich auch ein Teil von Pippas Leben befand, fanden Sonntagmittagessen statt, Weihnachten und Geburtstage, Telefonate und Besuche. Und auch der Schlüssel zu dem Reihenhaus befand sich in eben jener Schnittmenge, die der Größe nach durchaus variieren konnte. Fuhren ihre Eltern beispielsweise den Winter über, gleich nach Weihnachten, an die Costa Brava, wo sie seit einigen Jahren mit gleichgesinnten Paaren in einem kleinen Hotel am Meer zu überwintern pflegten, wurde ihre Schnittmenge kleiner, im Frühjahr jedoch, wenn sie zurückkamen und Lucy spürte, dass sie sie vermisst hatte, dehnte sie sich wieder aus.
Nun hatte Lucy heute Morgen einen Anruf erhalten, der weder in die Schnittmenge noch in die Menge ihres eigenen Lebens passen wollte. Der Anruf war quasi ein unbekanntes Element, wenn man so wollte. Mehr noch, er war geeignet, das gesamte Gleichgewicht von Mengen und Schnittmengen auseinanderzureißen, ja, zu zerstören. Ein Faktor, der nicht ins Schema passte und daher Unheil brachte. Unsicherheit, Verwirrung. Und aus diesem Grund hatte Lucy heute an der Tür ihrer Eltern geklingelt. Weil sie sich nicht sicher war, wie es um ihre gemeinsame Schnittmenge noch stand.
Ihre Mutter öffnete und rief erstaunt. »Lucy! Aber warum klingelst du?«
Lucy schaffte es nicht, sich mit Begrüßungsfloskeln oder irgendwelchen Erklärungen aufzuhalten. Sie zitterte vor Anspannung. »Ist Dad da?«
»Ja … natürlich, er sitzt im Wohnzimmer. Aber was ist denn …«
Lucy drängte sich an ihrer Mutter vorbei, vergaß, ihre nassen Schuhe auszuziehen, und die Jacke, die sie im Vorübergehen auszog, fiel zu Boden, da sie den Haken nicht getroffen hatte.
Ihre Mutter hob sie auf.
»Ich muss mit euch beiden reden«, sagte Lucy und hörte, wie ihre Stimme zitterte.
»Ist etwas passiert? Mit Chloé?« Auch die Stimme ihrer Mutter hatte jetzt einen alarmierten Ton angenommen.
»Nein. Mit Chloé ist alles in Ordnung.«
Chloé war Lucys Tochter. Sie stammte aus einer spektakulär und irgendwie auch vorhersehbar gescheiterten Ehe mit einem ehemaligen Studienkollegen, David, inzwischen Lehrer für Englische Literatur und Sport im fernen London, mit dem Lucy schon während ihrer nicht einmal zwei Jahre währenden Ehe im Grunde keinerlei gemeinsame Schnittmenge gehabt hatte. Zwei Geraden, die sich ein Mal gekreuzt hatten. Nichts weiter. Nichtsdestotrotz hatte es sich gelohnt, denn Chloé war das Ergebnis dieser Begegnung gewesen, und sie war Lucys ganzer Stolz. Im letzten Jahr hatte sie die Schule beendet und war nach Manchester in eine WG gezogen, um zu studieren. Sehr zum Leidwesen ihrer Großmutter, die Chloé mit ihren achtzehn Jahren noch für viel zu jung hielt, um auszuziehen. Und, wenn man ehrlich war, auch zum Leidwesen von Lucy, die das aber nie zugegeben hätte. Junge Menschen brauchen ihre Freiheit. Ihnen müssen Flügel wachsen. Das war ihre feste Überzeugung, und so hatte sie Chloé tatkräftig geholfen, war mit ihr in einem von Rob und Pippa geliehenen Lieferwagen nach Manchester gefahren, hatte Kisten in den dritten Stock einer ziemlichen Bruchbude in der Nähe der Universität geschleppt und in dem abgewohnten Zimmer die Wände fliederfarben gestrichen, einen Schrank und ein Bett aufgebaut, Vorhänge aufgehängt und Nägel in die Wand geschlagen. Vor allem aber hatte sie Chloés Begeisterung geteilt. Über alles. So war Chloé. Es gab wenig, über das sie sich nicht freuen konnte. Und Lucy freute sich mit. Doch als sie nach einem gemeinsamen Essen in einem Pub in der Nähe der neuen Wohnung allein nach Hause gefahren war, hatte sie zweimal anhalten müssen, weil sie durch den Tränenschleier die Straße nicht mehr erkennen konnte.
Doch um Chloé ging es jetzt nicht.
Auch ihr Vater machte ein überraschtes Gesicht, als Lucy, mit vom Regen feuchten Haaren und nassen Schuhen, ins Wohnzimmer kam, gefolgt von ihrer Mutter.
»Sie muss mit uns reden«, sagte Lilly Harper, an ihren Mann gewandt, und sie klang dabei wie jemand, der die Worte aus einer fremden Sprache übersetzt. Peter Harper faltete seine Zeitung zusammen. »Reden? Worüber denn?«
Lucy setzte sich auf einen der Stühle am Esstisch und wartete, bis sich ihre Mutter ebenfalls gesetzt hatte. Die beiden saßen ihr erwartungsvoll und ein wenig beunruhigt gegenüber, ihr Vater im Lehnsessel, ihre Mutter auf dem Sofa, beide über siebzig Jahre alt, mit mehr oder weniger grauen Haaren. Ihr Vater hatte schon seit Langem eine Glatze und war ein wenig in die Breite gegangen, »stattlich« nannte er das; ihre Mutter war schlank geblieben und noch immer so gut aussehend wie eh und je, mit ihrem schön geschnittenen Gesicht und den dunklen Augen, eingerahmt von kurzen, dunklen, mittlerweile silbern gesträhnten Haaren, die ihr Gesicht noch zarter erscheinen ließen. Sie waren ihr so vertraut. Lucy räusperte sich mehrmals, bevor sie sagte: »Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Aus Irland. Von einer Frau namens Maureen. Kennt ihr sie?«
»Irland? Maureen?« Ihr Vater runzelte die Stirn. »Wer soll das sein?«
»Keine Ahnung. Aber sie hat gesagt, ich solle sofort kommen. Mein Vater läge im Sterben.«
Es gibt Momente im Leben, die einem im Gedächtnis bleiben, ob man will oder nicht. Der erste Schultag mag so ein Moment sein, die Geburt des eigenen Kindes, eine Hochzeit, ein Scheidungstermin und all die peinlichen Situationen, bei denen man sich danebenbenommen hat. In jedem Fall aber vergisst man nie mehr den Augenblick, an dem man begreift, dass sich das eigene Leben von Grund auf ändern wird. Unwiederbringlich. Durch einen einzigen Satz. Einmal ausgesprochen kann er nicht mehr zurückgenommen werden.
Lucy spürte, dass sich mit diesen fünf Wörtern die Koordinaten ihres Lebens verschoben. Die Vorzeichen änderten sich, was das ganze Gefüge ins Wanken brachte, auch wenn zunächst keine Reaktion erfolgte. Ihre Eltern starrten sie ausdruckslos an, schienen nicht zu verstehen, was sie gerade gesagt hatte. Dann begann ihre Mutter zu lachen. »Was ist das denn für ein Blödsinn?«
»Das ist nicht lustig«, sagte Lucy leise.
»Liebes, da nimmt dich offenbar jemand auf den Arm!« Lilly Harper beugte sich vor und tätschelte ihrem Mann lächelnd das Knie. »Schau doch her. Hier ist dein Vater. Putzmunter wie eh und je …«
»Aber die Frau …«
»Wir kennen keine Maureen«, schnitt ihr Vater ihr das Wort ab und nahm die Zeitung wieder zur Hand, die er auf dem Beistelltisch abgelegt hatte. »Wir kennen überhaupt niemanden in Irland. Das ist ein Irrtum, irgendeine Verwechslung oder aber ein Trick. Ja, das wird’s sein. Ein Versuch, dir Geld aus der Tasche zu ziehen. Man kennt das doch, Telefonbetrüger …«
»Wie soll das gehen, sie wollte doch kein Geld …«
»Sie werden sich schon noch was einfallen lassen. Erst erschleichen sie sich dein Vertrauen, machen dich mit irgendwelchem Quatsch verrückt, und dann bitten sie dich, ihnen Geld zu überweisen.«
»Für wie blöd hältst du mich?«, fragte Lucy empört.
»Na, jedenfalls für naiv genug, um auf so etwas reinzufallen«, gab ihr Vater ungerührt zurück. Dann entfaltete er seine Zeitung und begann wieder zu lesen.
Lucys Mutter stand auf. »Du bist vielleicht ein wenig verunsichert durch die schlimme Sache mit deinem Job.«
»Nein! Das hat doch damit nichts zu tun.«
»Möchtest du einen Tee? Ich habe Shortbread gebacken.«
Lucy sah ihre Eltern wortlos an. Ihre Mutter erwiderte den Blick mit leichter Besorgnis, ihr Vater hatte sich bereits hinter der Zeitung verschanzt. Wäre der Name nicht gewesen, mit dem die fremde Frau sie am Telefon angesprochen hatte, sie hätte in diesem Moment zu zweifeln begonnen. Hätte womöglich der Vermutung ihres Vaters, sie sei einem bösen Scherz aufgesessen, Glauben geschenkt und mit ihrer Mutter Tee getrunken und Shortbread gegessen. Doch da war dieser Name, mit dem die Frau, Maureen, sie angesprochen hatte, als sei dies eine Selbstverständlichkeit.
Skye.
»Skye, du musst kommen«, hatte sie gesagt. Und Lucy hatte sich augenblicklich angesprochen gefühlt. Gerufen, so als hätte sie seit Jahren, ja, Jahrzehnten auf diesen Anruf gewartet.
Immer schon hatte sich Lucy gefragt, weshalb ihre grundsoliden, fast ein wenig spießigen Eltern ihr so einen ungewöhnlichen zweiten Vornamen gegeben hatten. Einen Namen, der nach Hippies, Flower-Power und Tanzen unter freiem Himmel klang und so gar nicht zu einem Reihenhaus in Tottington, Greater Manchester, passte.
»Eine Idee deiner Mutter«, hatte ihr Vater einmal knapp geantwortet, als sie danach gefragt hatte. Ungewöhnlich war der Name auch deshalb, weil niemand in ihrer Familie einen Zweitnamen hatte. Es gab Lilly und Peter, Pippa und Rob. Auch deren Kinder hatten lediglich einen Vornamen. Nur Lucy nicht.
Sie hatte auch ihre Mutter nach dem Grund dieses zweiten Namens gefragt, und diese hatte nur erklärt, »weil er so schön ist«.
Er war schön, das stimmte. Und es gab diese Tage, an denen der oft verhangene Himmel über Manchester so nordisch blau war, so schimmernd und leuchtend, dass man sich einbilden konnte, es habe noch nie Regen gegeben, keinen Sturm und keine endlos grauen Tage, an denen es schien, als sei die Stadt in einem Meer aus Wolken versunken und würde nie wieder herausfinden. Wenn Lucy an solchen Tagen den Kopf hob und in den Himmel blickte, glaubte sie zu wissen, warum ihre Mutter sie so genannt hatte. Sie hätte es nicht erklären können, nicht in Worten, doch sie ahnte, dass dieser Name ein Versprechen war. Sie wusste nicht, wofür, aber sie glaubte fest daran, dass dieses Versprechen irgendwann eingelöst werden würde. Und wenn es so weit war, würde sie es schon merken. Diese vier Buchstaben sollten sie an den blauen Himmel erinnern, an endlose Weite und an eine Leichtigkeit, die sie noch nie erlebt hatte. Sie hatte das S. daher demonstrativ in ihren Namen mit aufgenommen. Und gewartet. Auf irgendetwas. Doch es war nie etwas passiert. All die Jahre nicht. Sie überschritt die dreißig, die vierzig, und nichts geschah. Auch wurde sie niemals von jemandem so genannt, nicht von ihren Eltern, nicht von ihrer Schwester, von niemandem. Außer von dieser Frau aus Irland, die ihr damit so etwas wie einen elektrischen Schlag versetzt hatte.
Als sie bereits auf der Straße stand, rief ihre Mutter ihr noch nach: »Warum willst du denn schon weg, Liebes? Bleib doch noch zum Tee …«
Lucy drehte sich noch einmal zu ihrer Mutter um. »Ich habe keine Zeit. Ich muss nach Irland.« Es war eigentlich nur so dahingesagt. Aus Ärger darüber, dass ihre Eltern ihre Aufregung über den Anruf nicht ernst genommen hatten. Bis zu diesem Moment hatte sie nicht wirklich in Erwägung gezogen, nur wegen des Anrufes einer Wildfremden, wie auch immer sie sie genannt haben mochte, tatsächlich alles stehen und liegen zu lassen und nach Irland zu fliegen. Die Frau mit dem weichen irischen Klang in ihrer Stimme hatte zwar gemeint, sie solle sich nicht zu viel Zeit lassen, um darüber nachzudenken, und ihr ihre Telefonnummer gegeben, doch Lucy hatte geglaubt, ein Gespräch mit ihren Eltern würde alles schnell aufklären, und damit wäre die Sache erledigt. Doch da hatte sie sich getäuscht. Und als sie nach diesen letzten, ärgerlich hingeworfenen Worten den Gesichtsausdruck ihrer Mutter sah, wusste sie plötzlich mit Sicherheit, dass ihr diese unbekannte Frau keinen Bären aufgebunden hatte. Irgendetwas war an der Sache dran, wenn sie auch nicht sagen konnte, was es war. Gleichzeitig begriff sie, dass es von Lilly und Peter Harper keine Erklärung geben würde. Diese Geschichte, was auch immer sie beinhalten mochte, war nie dazu vorgesehen gewesen, Teil ihrer gemeinsamen Schnittmenge zu sein.
Wieder zu Hause, schaltete sie den Computer ein, suchte nach Flügen und wählte dann die Handynummer, die die Frau ihr gegeben hatte. Maureen war sofort am Apparat.
»Ich komme«, sagte Lucy nur, und sie spürte, wie ihr bei diesen Worten die Knie weich wurden. »Die Maschine landet um achtzehn Uhr fünfundzwanzig am Flughafen Shannon.«
»Skye, das ist wunderbar. Ich hol dich vom Flughafen ab. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät.«
Und damit änderten sich abrupt und völlig unvorhersehbar die Vorzeichen in Lucy S. Harpers Leben. Man konnte noch nicht sagen, in welche Richtung dies führte, dazu fehlte zu diesem Zeitpunkt der Überblick, wie fast immer der Überblick für das große Ganze fehlt, wenn man mitten in einer Gleichung steckt und zwischen eckigen und runden Klammern, Wurzeln und Logarithmen zu versanden droht. Lucy hatte dies immer ihren Schülern gepredigt: »In der Mathematik gibt es keine Überraschungen. Lasst euch also nicht beirren, macht das, was ihr gelernt habt, löst eine Klammer nach der anderen auf, am Ende werdet ihr das Ergebnis dann ganz klar vor euch sehen.« Leider klappte das mit der klaren Erkenntnis am Ende bei ihren Schülern nur selten. Sie war immer wieder fassungslos, zu welch krummen, absolut unlogischen, ja geradezu haarsträubenden Ergebnissen ihre Schüler kamen und, was fast noch schlimmer war, deren Absurdität dabei überhaupt nicht zu bemerken schienen.
Als Lucy im Flugzeug saß, hoch über der bleiernen irischen See, vor dem Fenster nichts als Nebelgrau, und über sichere Rechenwege nachdachte, überkam sie eine vage Ahnung, dass ihr mathematisches Credo nicht so ohne Weiteres auf das Leben zu übertragen war, wie sie immer geglaubt hatte. Mit einem tiefen Seufzer bestellte sie sich bei der hübschen irischen Flugbegleiterin einen doppelten Jameson, was der ungewohnten Situation, in der sie sich befand, durchaus entsprach, und hoffte, dass die Gleichung, in der sie gerade steckte, trotz der zahlreichen Unbekannten und unerwarteten Nullstellen am Ende nicht zu ähnlich haarsträubenden Ergebnissen führen würde wie die Lösungen ihrer Schüler.
2
Maureen Mulligan entpuppte sich als eine rundliche Frau Ende fünfzig mit feuerrot gefärbten, krausen Haaren. Trotz des eher kühlen Wetters trug sie ein lila geblümtes Sommerkleid, dazu einen Regenmantel und grüne Gummistiefel. Als Lucy, noch etwas benommen vom Whiskey, mit ihrem Köfferchen in die Ankunftshalle trat und sich umsah, kam Maureen auf sie zugelaufen. »Skye?«
Lucy nickte zögernd. Der Name hatte noch immer diesen fremden, verheißungsvollen Klang, auch wenn er von einer Frau ausgesprochen wurde, die grüne Gummistiefel zum Kleid trug. Maureen musterte Lucy einen Moment lang von oben bis unten wie eine seltene Pflanze, dann wurde ihr Lächeln breiter, und sie drückte sie an ihre ausladende Brust. »Willkommen in Irland!«
Maureen war warm und ihre Umarmung kräftig. Lucy roch frische Luft und Holzrauch, vermischt mit etwas Süßlichem wie Vanille. Ihre Haare kitzelten Lucy im Gesicht. Sie spürte, wie Maureens Herz klopfte. Oder vielleicht war es auch das ihre. So genau ließ sich das nicht sagen. Als Maureen sie schließlich losließ, sahen sie sich ein wenig verlegen an. Maureen strich sich eine Locke aus dem geröteten Gesicht. »Entschuldige, aber das musste sein. Ich kann gar nicht glauben, dass du wirklich gekommen bist. Er hat oft von dir gesprochen, weißt du.«
»Von mir …?«, fragte Lucy irritiert nach. «Aber wer … woher …«
Doch Maureen ging nicht darauf ein. Sie hatte schon nach Lucys Koffer gegriffen und war losgelaufen. »Es ist so furchtbar, dass er dich jetzt doch nicht mehr sehen konnte. Aber wenigstens konnten wir ihm noch sagen, dass du kommst.« Sie drehte sich um und lächelte Lucy zu. »Er war so glücklich darüber.«
Lucy lief neben ihr her. »Sie sprechen von …«
»Von George. Deinem Vater. Er ist vor ein paar Stunden gestorben. Und er hat dabei gelächelt. Hat sich auf dich gefreut.«
Lucy blieb stehen. »Das tut mir leid«, sagte sie. Und obwohl sie den Mann nicht gekannt hatte, spürte sie, dass es die Wahrheit war. Es tat ihr leid. Aber nicht, weil sie seinetwegen trauerte, das wäre wohl auch zu viel verlangt gewesen, immerhin hatte sie an diesem Tag zum ersten Mal von diesem Menschen gehört. Nein, sie ärgerte sich. Sie spürte, wie die Wut über diese ganze sinnlose Aktion, über die absurde Vergeblichkeit dieser aberwitzigen Reise in ihr aufstieg. Sie stand hier, an diesem kleinen Flughafen am westlichsten Zipfel Europas, um einen Mann zu treffen, der behauptet hatte, ihr Vater zu sein, und bevor sie mit ihm sprechen konnte, war er einfach gestorben. Das war doch Slapstick. Nicht das richtige Leben.
Maureen deutete ihren Gefühlsaufruhr völlig falsch. Tränen in den Augen, tätschelte sie Lucy den Arm. »Ja, es ist so furchtbar traurig. Wir alle dachten, er würde noch ein paar Tage durchhalten. Geordie war ja ein zäher Knochen. Aber wenigstens kannst du ihm noch die letzte Ehre erweisen.«
Sie wollte nicht. Wollte nicht mit Maureen Mulligan mitgehen, die so lächerlich und seltsam aussah, und sie wollte niemandem die letzte Ehre erweisen, den sie nicht gekannt hatte. Dennoch setzte sie sich gehorsam in Bewegung und folgte der geschäftig vorangehenden Frau, die trotz ihres nicht unerheblichen Körperumfangs und der unförmigen Gummistiefel recht schnell auf den Beinen war. Sie verließen den Flughafen und gingen zu einem dreckverspritzten Van, der schon bessere Zeiten gesehen hatte. Maureen’s Cab & Haircutter stand in verschnörkelter, von Blumen umrankter Schrift auf den Türen, und auf dem Dach prangte eine schwarz-gelbe Taxibarke. Maureen packte Lucys Koffer in den Kofferraum und ließ sie einsteigen, und Lucy identifizierte sofort den Vanillegeruch, der Maureen umgab: Er stammte von einem gelben Duftbäumchen, das am Innenspiegel baumelte und das ganze Auto in eine künstlich-süße Duftwolke hüllte.
»Es dauert etwa eine Stunde bis Knocknabarra«, sagte Maureen und startete das Auto. Lucy gab keine Antwort. Sie überlegte, wann sie wohl morgen einen Flug zurück nach Manchester bekommen könnte und ob es in Knocknabarra noch andere Taxis als Maureen’s Cab & Haircutter gab. Sie kamen an einer vom Wind zerrupften Wiese vorbei, auf der in großen weißen Buchstaben der gälische Willkommensgruß Fáilte Ireland stand, passierten eine abweisend wirkende Burg namens Bunratty Castle, wie Maureen ihr, ganz eifrige Reiseführerin, erklärte, und dazu auch noch so einige Geschichten über Schlösser und Schlossherren, Gespenster, weiße Frauen und unglückliche Liebschaften parat hatte, fuhren an weiten Feldern entlang und ließen Limerick im Nieselregen links liegen. Schließlich wurde die Landstraße leerer und die Landschaft hügeliger. In der Ferne erhob sich ein kahler Gebirgszug. Ab und zu drangen ein paar letzte Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke und brachten die grünen Wiesen und Felder entlang der Straße zum Leuchten. Knocknabarra befand sich zehn Kilometer südlich von Tipperary und entpuppte sich als eine Straßenkreuzung, an der ein unspektakuläres Pub mit dem Namen The Witch Way stand sowie ein paar Häuser entlang der Hauptstraße. Maureen hielt vor einem schmalen Laden unweit des Pubs, dessen Fassade eine ähnliche Farbe hatte wie ihr Sommerkleid. Maureen’s Hair Studio stand auf einem Schild darüber. Die Auslage war vollgestopft mit allerlei Kram – Seidenblumensträuße, Häkeldeckchen, Bücher, Schreibwaren und Zeitschriften −, und über allem prangte ein Friseurkopf mit riesigen Glubschaugen und einer wasserstoffblonden Lockenperücke. Ziemlich retro, würde Chloé sagen, dachte Lucy, als sie ausstieg. Maureen sperrte die Tür auf, führte sie durch den Laden in einen Flur und dann eine enge Stiege hinauf in ein Zimmer unter dem Dach, das aus nichts anderem als aus Blumen zu bestehen schien. Die Tapete hatte ein Blumenmuster, der Quilt über dem Bett ebenso, die Kissen waren anders geblümt als der Sesselbezug. Sogar die Teetasse, die neben einem Wasserkocher auf einem kleinen Tisch bereitstand, war geblümt. Es wirkte leicht psychedelisch. Lucy blinzelte. »Oh. Das ist … schön«, sagte sie höflich.
»Ja, nicht wahr?« Maureen lächelte stolz. »Das ist eines der alten Kinderzimmer. Als Patrick, mein Jüngster, ausgezogen ist, habe ich die Zimmer zu Gästezimmern umgestaltet. Sie sind ja nach und nach alle drei ausgezogen. Aidan ist in die USA gegangen und Caitlin nach London. Keiner ist mehr da. Ich biete deshalb auch Bed & Breakfast an. Allerdings, wer verirrt sich schon nach Knocknabarra? Du bist in den ganzen Jahren erst mein zweiter Gast.« Sie lächelte schief. »Und den ersten Gast konnte man eigentlich nicht so nennen. Es war eine junge Frau aus Ballycrusha, das ist das Nachbardorf, die ihrem Mann davongelaufen ist. Ich kannte sie, weil ich ihr immer die Haare geschnitten habe. Armes Ding. Grün und blau hatte er sie geschlagen.«
»Oje. Und dann?«
Maureen zuckte mit den Schultern. »Nach drei Tagen stand er vor der Tür, mit Blumen, hat sie vollgesäuselt, und sie ist ihm um den Hals gefallen und wieder zurückgegangen. Dummes Luder.«
»Weiß man, was mit den beiden passiert ist?«
»Es hat keine vier Wochen gedauert, und sie ist ihm ein zweites Mal davongelaufen. Und nie wieder aufgetaucht. Er hat jetzt eine neue Frau und einen Stall Kinder.«
»Wie lange ist das denn her?«
Maureen überlegte. »Ach, an die zehn Jahre werden’s schon sein. Patrick war gerade ausgezogen. Ist nach Dublin gegangen.« Sie sah auf die Uhr. »Treffen wir uns unten in einer halben Stunde? Hast du was Warmes zum Anziehen dabei? Wenn nicht, ganz oben im Schrank sind noch ein paar alte Pullover von Patrick. Nimm dir einen raus. Es wird recht frisch werden.« Und mit dieser etwas rätselhaften Ankündigung ließ sie Lucy allein in dem Gästezimmer, in dem nur alle zehn Jahre ein Gast logierte.
Lucy warf einen Blick aus dem Fenster. Es ging nach hinten hinaus. Eine kleine Kirche stand dort, eingerahmt von Bäumen und einem halb verfallenen Friedhof mit windschiefen keltischen Kreuzen. Sie seufzte. Maureen hatte ihr nicht gesagt, wohin sie gehen würden, und sie hatte vergessen zu fragen. Die vielen Blumen, Maureens Geschichten und der Vanilleduft des Wunderbäumchens hatten ihr das Hirn vernebelt. Wahrscheinlich gingen sie in die Kirche, und es würde eine Andacht für den Verstorbenen geben. Sie konnte sich gut vorstellen, dass es in dem alten Gemäuer eiskalt war. Und weil sie nur einen dünnen Pullover eingepackt hatte, öffnete sie den Schrank und zog einen von Patricks zurückgelassenen Pullovern heraus. Er war dick, weiß und aus Schafwolle, offenbar selbst gestrickt, mit kompliziertem Muster und so groß, dass sie fast zweimal hineinpasste. Allem Anschein nach war Maureens Sohn ein recht stattlicher Kerl. Der Pulli war weich und warm, und weil sie zusätzlich zu der ganzen deprimierenden, sinnlosen Geschichte, in die sie da geraten war, nicht auch noch frieren wollte, behielt sie ihn an.
Sie gingen nicht in die Kirche. Maureen erwartete sie in unförmigen Jeans, deren Hosenbeine sie in die Gummistiefel gestopft hatte. Unter einem schlammfarbenen knielangen Parka trug sie einen ähnlichen Pullover wie jetzt auch Lucy. Eine lila Strickmütze, tief über die Ohren gezogen, vervollständigte das Ensemble. Sie reichte Lucy eine Plastiktüte. »Ich hab Gummistiefel und einen Hut für dich. Passt dir Größe neununddreißig?«
»Ich brauche keine Gummistiefel«, wehrte Lucy ab. »Meine Schuhe sind ganz in Ordnung.«
Maureen warf einen skeptischen Blick auf die weißen Sneakers, die Lucy trug. »Jetzt schon noch. Danach kannst du sie wegwerfen«, prophezeite sie.
»Danach?«, fragte Lucy. »Wohin gehen wir denn?«
»Na, zur Totenwache. Was sonst?« Maureen sah sie überrascht an. »Sagte ich das nicht?«
»Äh, ich weiß nicht …« Lucy kam ein wenig ins Stottern. Die Frau hatte etwas von letzter Ehre gesagt, das schon, aber eine Totenwache? Was sollte das sein? Und seit wann brauchte man dazu Gummistiefel?
Maureen lächelte und griff nach einer großen Sturmlampe, die an einem Haken der Garderobe hing. »Lass uns erst mal hingehen. Die anderen warten schon. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du die Stiefel anziehen willst oder nicht.«
Sie liefen die Straße entlang, bogen in den Weg zur Kirche ein, gingen am Friedhof vorbei und durch ein kleines Wäldchen. Auch wenn es erst dämmerte, herrschte im Wald bereits tiefe Dunkelheit, und Maureen schaltete die Sturmlampe ein. Ihr starker Lichtschein hüpfte auf dem moosbedeckten, von Wurzeln und Gestrüpp fast zugewachsenen Weg vor ihnen her. »Das ist eine Abkürzung zu Séamus’ Wiese«, verkündete sie in einem Ton, als müsste jeder Mensch auf dieser Welt Séamus’ Wiese kennen. »Die Leute gehen hier nicht gern. Das ist nämlich ein Feenwald.«
»Und was heißt das?«, fragte Lucy, während sie vorsichtig über eine besonders dicke, moosbewachsene Wurzel stieg.
Maureen blieb stehen und leuchtete mit der Lampe in den Wald hinein. »Dort hinten ist ein síd. Eine Wohnstätte der Feen. Sie werden nicht gern gestört. Kann man ja verstehen, ich mag es auch nicht, wenn Hinz und Kunz in mein Wohnzimmer stolpern.« Lucys Blick folgte dem Schein der Lampe. Der Waldboden wie auch die knorrigen, ausladenden Bäume waren über und über mit Moos bedeckt und schienen im gelblichen Licht zu leuchten. Etwas weiter hinten, im Dunkel, dort, wo der Schein der Lampe nicht mehr ganz hinreichte, ragte ein hoher Felsen zwischen den Bäumen auf. Danach verlor sich das Licht im undurchdringlichen Schwarz. Es war still, so still, dass man glauben konnte, kein atmendes Wesen außer ihnen befände sich hier. Lucy fröstelte unwillkürlich trotz ihres dicken Pullovers.
Maureens Stimme unterbrach die Stille. »Roísín sagt, der Weg wäre sicher. Es ist also kein Problem, darauf zu gehen, im Gegenteil, die Feen freuen sich über ein bisschen Abwechslung, solange man ihnen nicht zu nahe kommt. Und sie haben dich ja sicher auch erwartet und sind neugierig, wie du aussiehst.« Sie tätschelte Lucy beruhigend den Arm und ging dann weiter: »Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, Skye, dass du verschwindest und erst in hundert Jahren wieder auftauchst.«
»Oh. Da bin ich aber erleichtert«, meinte Lucy säuerlich und marschierte hinter Maureen drein. Die Gefahr, von Feen geraubt zu werden, schien ihr in Anbetracht der Situation, in der sie sich befand, ihre kleinste Sorge zu sein. Stattdessen kam ihr jedoch der Gedanke, dass es vielleicht nicht ganz ungefährlich war, mit einer Verrückten in der Nacht durch einen dunklen Wald zu stolpern, ohne dass jemand wusste, wo sie sich befand. Maureen drehte sich mit einem schuldbewussten Blick zu ihr um. »Ich wollte dich nicht erschrecken, Liebes. Das ist natürlich alles ein bisschen viel für dich. Immerhin ist gerade dein Vater gestorben.«
Lucy gab keine Antwort. Sie hatte das Bedürfnis, laut zu schreien, Patrick Mulligans riesigen Schafwollpullover auszuziehen, ihn dieser Frau vor die Füße zu werfen und sich dann schnurstracks auf den Weg nach Hause zu machen. Wenn nötig zu Fuß. Doch so ein respektloses Verhalten wäre sicher ein Frevel in den Augen von Maureens Feen, und sie würde am Ende doch noch geraubt werden und erst in hundert Jahren wieder auftauchen. It’s a long way to Tipperary, it’s a long way to go … dieses alte Lied kam ihr plötzlich in den Sinn, und sie schüttelte unwillig den Kopf, um die seltsamen Gedanken zu vertreiben. War sie auch schon dabei, verrückt zu werden?
Mochte sein, dass die Atmosphäre dieses verwunschenen Waldes dazu beitrug, dass Lucy der Meinung war, plötzlich verrückt zu werden. Mochte sein, dass das dicke, grüne, irische Moos, das jeden Schritt und jedes Geräusch dämpfte, auch in der Lage war, den gesunden Menschenverstand zu dämpfen und sie mit dem beunruhigenden Gefühl zurückzulassen, sich ohne Fallschirm und Netz im freien Fall zu befinden. In der Tat fühlte sich Lucy ein wenig wie Alice im Wunderland, nachdem diese in das Kaninchenloch gekrochen war. Sie war unversehens in einer anderen Welt gelandet, ja, wie es aussah, in einem anderen Leben. In dem sie nicht Lucy S. Harper, Mathematiklehrerin aus Tottington, war, sondern Skye. Nur Skye. Und es würde noch einige Zeit dauern, bis sie in der Lage wäre zu begreifen, was das tatsächlich bedeutete. Sie verspürte zwar eine gewisse Unruhe, ein Flattern im Gebälk ihres Bewusstseins, doch es war ein Leichtes, es auf den Ärger über diese wahnwitzige Reise zu schieben und auf die zunehmende Sorge, einer Verrückten in die Hände gefallen zu sein.