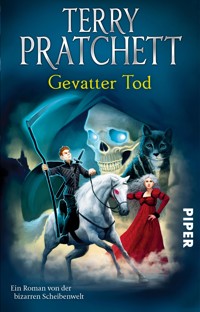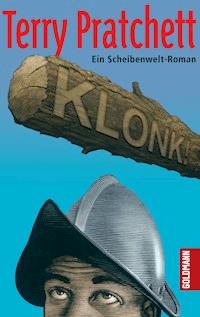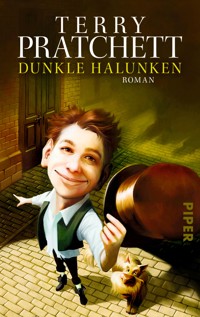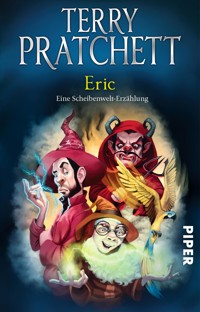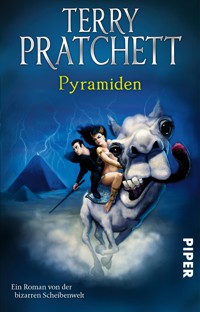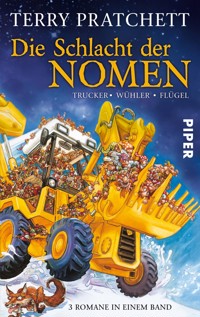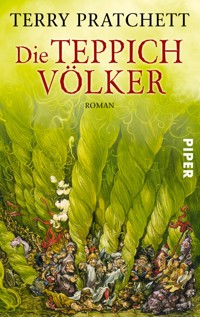8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: MÄRCHEN VON DER SCHEIBENWELT
- Sprache: Deutsch
Ein neues Märchen von der SCHEIBENWELT voller Spannung, Witz und Magie
Tiffany Weh, vielversprechende Junghexe im Teenageralter, hat es nicht leicht. Denn die alltägliche Hexerei erweist sich als ziemlich anstrengend, und ganz bestimmt ist es nicht damit getan, den lieben langen Tag fröhlich auf einem Besen herumzusausen. Dennoch gibt Tiffany ihr Bestes – bis etwas uraltes Böses aus einem tiefen Schlaf erwacht und mit ihm allerlei alte Schauergeschichten über böse Hexen. Bald kann man sich kaum noch mit einem spitzen Hut auf die Straße wagen. Und als wäre das nicht schon genug Ärger, fängt dieses uralte böse Wesen bald an, gezielt Jagd auf eine ganz spezielle vielversprechende Junghexe zu machen …
Klappenbroschur mit gestalteten Innenseiten und abtrennbarem Lesezeichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Tiffany Weh, vielversprechende Junghexe im Teenageralter, hat es nicht leicht. Denn die alltägliche Hexerei erweist sich als ziemlich anstrengend, und ganz bestimmt ist es nicht damit getan, den lieben langen Tag fröhlich auf einem Besen herumzusausen. Dennoch gibt Tiffany ihr Bestes – bis etwas uraltes Böses aus einem tiefen Schlaf erwacht und mit ihm allerlei alte Schauergeschichten über böse Hexen. Bald kann man sich kaum noch mit einem spitzen Hut auf die Straße wagen. Und dann fängt dieses uralte Böse auch noch damit an, gezielt Jagd auf eine ganz spezielle Junghexe zu machen …
Autor
Terry Pratchett, geboren 1948, gilt als einer der erfolgreichsten Autoren der Gegenwart. Von seinen mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Romanen wurden weltweit bisher über 80 Millionen Exemplare verkauft, seine Werke sind in 38 Sprachen übersetzt. Für seine Verdienste um die englische Literatur wurde ihm sogar die Ritterwürde verliehen. Terry Pratchett starb im März 2015.
Terry Pratchetts Fanclub in Deutschland: www.pratchett-fanclub.de
Mehr Informationen zum Autor und seinen Büchern sowie eine Gesamtübersicht über seine bei Goldmann und Manhattan lieferbaren Titel erhalten Sie unter www.pratchett-buecher.de
Inhaltsverzeichnis
1
Ein toller Hecht
Was fanden die Menschen bloß an Lärm so toll? Tiffany Weh verstand es nicht. Wieso war Lärm so wichtig?
Dicht neben ihr ertönte ein Brüllen wie von einer Kuh in den Geburtswehen. Es quoll aus einem alten Leierkasten, der von einem zerlumpten Mann mit verbeultem Zylinder malträtiert wurde. Tiffany suchte möglichst unauffällig das Weite. Aber das Gedudel hatte etwas derart Klebriges an sich, dass man Angst haben musste, es würde einem bis nach Hause hinterherkriechen, wenn man nicht aufpasste.
Doch in diesem lärmenden Hexenkessel war das Gebrüll nur ein Geräusch von vielen – samt und sonders von Menschen gemacht, die alles daransetzten, sich beim Krachmachen auch ja nicht übertrumpfen zu lassen. Sie krakeelten an den Bretterbuden, sie tauchten nach Äpfeln oder Fröschen1, sie bejubelten die Preisboxer und die Seiltänzerin in ihrem Glitzerkostüm, sie priesen lauthals Zuckerwatte an, und sie sprachen – ohne etwas beschönigen zu wollen – in nicht unerheblichem Maße dem Alkohol zu.
Das ganze grüne Hügelland lag unter einer Decke aus Lärm, als hätten sich die Einwohner von zwei, drei Kleinstädten dort eingefunden. Wo sonst höchstens der Schrei eines Bussards zu vernehmen war, johlte und grölte es nun in einer Tour. So etwas nannte man dann »sich vergnügen«. Lediglich die Taschen- und sonstigen Diebe gingen ihren Geschäften in löblicher Stille nach, wobei sie um Tiffany vorsichtshalber einen großen Bogen machten. Wer wollte schon einer Hexe in die Tasche fassen? Es stand zu befürchten, dass man seine Finger nicht vollzählig wieder zurückbekam. Und eine kluge Hexe bestärkte sie natürlich nach Kräften in dieser Furcht.
Ist man eine Hexe, ist man alle Hexen, dachte Tiffany Weh, während sie sich einen Weg durch die Menge bahnte, ihren Besen an einer Schnur hinter sich herziehend. Er schwebte einige Fuß hoch über der Erde. Das funktionierte zwar einigermaßen, störte sie aber auch ein bisschen. Da überall auf dem Jahrmarkt kleine Kinder mit Luftballons herumliefen, konnte sie sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie eine ziemlich lächerliche Figur abgab. Und wer eine Hexe blamierte, blamierte alle Hexen.
Doch wenn sie den Besen einfach an einer Hecke angebunden hätte, wäre mit Sicherheit irgendein frecher Junge auf die Idee gekommen, ihn loszumachen und sich als Mutprobe daraufzuschwingen, woraufhin er wahrscheinlich prompt bis in die obersten Schichten der Atmosphäre hinaufgeschossen wäre, wo die Luft gefror. Natürlich war Tiffany theoretisch in der Lage, den Besen wieder zurückzurufen, aber Mütter konnten nun einmal ziemlich verschnupft reagieren, wenn sie an einem warmen Spätsommertag ihr Kind auftauen mussten. So etwas käme gar nicht gut an. Man würde über sie tuscheln. Über Hexen wurde immer getuschelt.
Also blieb Tiffany nichts anderes übrig, als den Besen weiter hinter sich herzuziehen. Mit ein bisschen Glück würden es die Leute ja vielleicht für ihren scherzhaften Beitrag zu der ausgelassenen Festtagsstimmung halten.
Die Etikette musste gewahrt bleiben, selbst auf einer scheinbar so ungezwungenen Veranstaltung wie einem Jahrmarkt. Sie war die Hexe. Sie konnte es sich nicht leisten, einen Namen zu vergessen oder – noch schlimmer – zwei Namen zu verwechseln. Nicht auszudenken, wenn sie Cliquen und Klüngel durcheinanderbrachte, wenn sie vergaß, wer mit wem zerstritten war oder wer mit welchem Nachbarn nicht mehr redete und so weiter und so weiter und so fort. Tiffany kannte das Wort »Minenfeld« nicht, aber der Sachverhalt war ihr durchaus geläufig.
Sie war die Hexe. Und zwar die Hexe für das gesamte Kreideland – nicht mehr nur für ihr eigenes Dorf, sondern für alle Dörfer bis hinüber nach Ham-am-Egg, das einen relativ strammen Tagesmarsch entfernt lag. Ein Gebiet, für das sich eine Hexe verantwortlich fühlte und für deren Bewohner sie tat, was getan werden musste, galt als ihr Revier, und Tiffanys Revier war nicht das schlechteste. Es gab nicht viele Hexen, die gleich für eine ganze geologische Formation zuständig waren, auch wenn diese zum größten Teil mit Gras und das Gras zum größten Teil mit Schafen bedeckt war. An diesem Tag mussten die Schafe, um deren Wohl und Wehe und Wolle sich in den Hügeln normalerweise alles drehte, auf sich selbst aufpassen. Sie durften tun und lassen, was sie wollten, also vermutlich genau das Gleiche, wonach ihnen auch sonst der Sinn stand. Denn heute interessierte sich keiner für sie. Heute drehte sich alles um die wunderbarste Attraktion der Welt.
Wobei gesagt werden muss, dass der Jäte-Jahrmarkt für die Kreidelandbewohner nur deshalb eine Weltattraktion darstellte, weil die meisten noch nie weiter als vier Meilen aus ihrem Heimatdorf herausgekommen waren. Wenn man im Kreideland zu Hause war, begegnete man auf dem Jahrmarkt jedem, den man kannte2. Außerdem konnte man hier wunderbar auf Brautschau gehen. Die Mädchen zogen ihre schönsten Kleider an, während die Jungen ihre hoffnungsvollsten Mienen aufsetzten und sich die Haare mit billiger Pomade oder – im Normalfall – mit Spucke an den Kopf klatschten. Wer sich für Spucke entschied, war meistens sehr viel besser dran. Die Pomade war nämlich so billig, dass sie bei warmem Wetter zerlief und die sehnlichst herbeigewünschte Wirkung auf das weibliche Geschlecht prompt zunichtemachte. Umso unwiderstehlicher war ihre Anziehungskraft auf Fliegen, die sich an den fettigen Haaren gütlich taten.
Da man dieses Ereignis aber kaum den »Jahrmarkt, auf den man geht, um einen Kuss zu erhaschen oder mit ein bisschen Glück sogar das Versprechen auf einen zweiten« nennen konnte, hieß er der Einfachheit halber nur der Jäte-Jahrmarkt.
Das Große Jäten fand im Spätsommer statt und dauerte drei Tage, eine Zeit, in der fast überall im Kreideland die Arbeit ruhte. Heute war der dritte und letzte Tag, und eine alte Volksweisheit besagte, dass für jeden, der bis dahin noch keinen Kuss abbekommen hatte, der Ofen aus war. Tiffany war ungeküsst geblieben, aber sie war ja auch die Hexe. Wer wollte schon das Risiko eingehen, in weiß der Himmel was verwandelt zu werden?
Bei mildem Wetter schliefen die Menschen oft und gerne draußen, unter den Sternen oder auch unter den Büschen. Wer also in der Nacht einen Spaziergang machen wollte, musste gut aufpassen, dass er nicht über irgendwelche fremden Füße stolperte. Deutlicher ausgedrückt: Es herrschte die Art von munterem Treiben, die Nanny Ogg – eine Hexe, die bereits drei Ehemänner verschlissen hatte – als »Alleinunterhaltung zu zweit« bezeichnete. Zu schade, dass Nanny oben in den Bergen wohnte. Der Jäte-Jahrmarkt wäre ganz nach ihrem Geschmack gewesen, und Tiffany hätte zu gern ihr Gesicht beim Anblick des Riesen gesehen.3
Er – denn dass er ein Er war, stand unzweifelhaft fest – war vor Tausenden von Jahren aus der Grasnarbe geschnitten worden. Die weiße Silhouette im grünen Gras stammte aus einer Zeit, als die Menschen in einer gefährlicheren Welt um ihr Überleben kämpfen und … fruchtbar sein mussten.
Hosen schienen in jenen Tagen jedoch noch nicht erfunden worden zu sein. Dabei griff die Bezeichnung »hosenloser Riese« bei weitem zu kurz. Seine Hosenlosigkeit war eine Welt für sich. Es war unmöglich, auf der kleinen Straße am Fuß der Hügel entlangzugehen, ohne dass einem seine bodenlose Hosenlosigkeit förmlich entgegenprallte. Es handelte sich eindeutig um die Figur eines Mannes und definitiv nicht um die einer Frau.
Alle, die zum Großen Jäten kamen, brachten eine kleine Schaufel oder auch nur ein Messer mit, um das Unkraut zu jäten, das die Umrisslinien im Laufe des Jahres überwuchert hatte. Stück um Stück arbeiteten sie sich die Hügelflanke hinunter, bis der Kalkstein wieder leuchtend weiß zum Vorschein kam und der Riese in seiner ganzen Manneskraft hervortrat.
Wenn die jungen Mädchen an dem Riesen rupften und zupften, ging es nie ohne Gekicher ab.
Wegen des Gekichers und der Umstände dieses Gekichers musste Tiffany unwillkürlich an Nanny Ogg denken, die – ein breites Grinsen im Gesicht – meistens dicht hinter Oma Wetterwachs zu finden war. Die alte Frau galt allgemein als kreuzfidel und puppenlustig, doch es steckte weit mehr in ihr. Und obwohl Nanny offiziell nie ihre Lehrerin gewesen war, hatte Tiffany sich so einiges von ihr abgeschaut. Bei diesem Gedanken schmunzelte sie leise. Nanny Ogg kannte die alte, dunkle Magie – eine Magie, die gänzlich ohne Hexen auskam, die den Menschen und der Landschaft von Natur aus innewohnte. Bei der es um Angelegenheiten wie Tod, Ehe und Verlobung ging. Und um Versprechen, die Versprechen blieben, auch wenn niemand sie hörte. Und um all die Dinge, die dazu führten, dass die Leute auf Holz klopften und nie, niemals unter einer schwarzen Katze hindurchgingen.
Um das zu verstehen, brauchte man keine Hexe zu sein. Es waren besondere Augenblicke, in denen die Welt um einen herum irgendwie realer und fließender wurde. Oder, wie Nanny Ogg den Zustand nennen würde: numinos, ein ungewohnt feierliches Wort aus dem Mund einer Frau, von der man üblicherweise eher Sätze zu hören bekam wie: »Ein Schnäpschen bitte, und am liebsten gleich ein doppeltes. « Sie hatte Tiffany von den Zeiten erzählt, in denen man als Hexe offenbar noch ein bisschen mehr Spaß haben konnte. Zum Beispiel davon, wie man den Wechsel der Jahreszeiten beging; von den vielen Bräuchen, die nur noch in der Erinnerung der Menschen weiterlebten. Einer Erinnerung, die – wie Nanny Ogg sagte – tief und dunkel war, die atmete und nie verlosch. Von lauter kleinen Ritualen.
Das Feuerritual hatte es Tiffany besonders angetan. Sie mochte Feuer. Es war ihr Lieblingselement. Da man früher glaubte, dass es sogar die Mächte der Finsternis in Schach halten konnte, heirateten die Menschen, indem sie zusammen über ein Feuer sprangen.4 Anscheinend half es, dabei gleichzeitig einen kleinen Spruch aufzusagen, so berichtete es zumindest Nanny Ogg, die Tiffany diesen Spruch auch prompt verraten hatte. Seitdem ging er ihr nicht mehr aus dem Kopf. So war es oft, wenn Nanny Ogg etwas erzählte: Es blieb irgendwie kleben.
Doch diese Zeiten waren schon lange vorbei. Heutzutage ging alles viel gesitteter zu – außer bei Nanny Ogg und dem Riesen.
Es gab noch andere Scharrbilder im Kreideland. Darunter auch das Weiße Pferd, das, wie Tiffany sich zu erinnern glaubte, einmal sogar aus dem Boden hervorgebrochen und im Galopp angeprescht gekommen war, um sie zu retten. Sie konnte nur hoffen, dass der Riese nicht auf dieselbe Idee verfallen würde. In aller Eile eine sechzig Fuß lange Hose aufzutreiben wäre wahrhaftig kein Kinderspiel, obwohl gerade Eile das Gebot der Stunde gewesen wäre.
Tiffany selbst hatte nur ein einziges Mal über den Riesen gekichert, und das war schon sehr lange her. Eigentlich gab es nur vier Sorten Menschen auf der Welt: Männer, Frauen, Zauberer und Hexen. Die Zauberer lebten überwiegend in den Universitäten der großen Städte und durften nicht heiraten. Die Gründe dafür waren Tiffany vollkommen schleierhaft. Aber ins Kreideland verirrte sich sowieso kaum je einer von ihnen.
Hexen waren eindeutig Frauen, doch die meisten der älteren, die Tiffany kannte, hatten auch nie geheiratet. Was zum einen daran lag, dass Nanny Ogg fast alle in Frage kommenden Männer aufgebraucht hatte, und zum anderen wohl auch daran, dass sie für so etwas viel zu beschäftigt waren. Natürlich kam es hin und wieder vor, dass eine Hexe einen Ehemann an Land zog, der etwas hermachte, wie zum Beispiel Magrat Knoblauch aus Lancre, die allerdings, nach allem, was man so hörte, in jüngster Zeit nur noch Kräuterkunde betrieb. Aber die einzige junge Hexe, von der Tiffany wusste, dass sie überhaupt Zeit für einen Verehrer hatte, war ihre beste Freundin aus den Bergen. Petulia, die sich auf Schweinemagie spezialisiert hatte, war mit einem netten jungen Mann verlobt, der eines Tages die Schweinefarm5 seines Vaters erben würde, also praktisch ein Adliger war.
Doch Hexen sind nicht nur viel beschäftigte Leute, sie sind auch anders. Das hatte Tiffany schon in sehr jungen Jahren erfahren müssen. Man lebte unter den Menschen, aber man gehörte nicht dazu. Es gab immer eine Kluft, eine gewisse Distanz, auch wenn man selbst gar nichts dazu beitrug. Es war einfach so. Die Mädchen, mit denen Tiffany schon als Hemdenmatz gespielt hatte, machten heutzutage einen kleinen Knicks, wenn sie ihr begegneten, und sogar alte Männer lüfteten vor ihr den Hut – falls sie einen besaßen.
Das taten sie allerdings nicht nur aus Respekt, sondern auch aus Angst. Hexen hatten Geheimnisse. Sie waren jederzeit zur Stelle und halfen, wenn ein Kind auf die Welt kam. Man wusste sie gern um sich, wenn man heiratete (damit sie einem Glück brachten oder wenigstens kein Unglück). Und beim Sterben hatte man ebenfalls eine Hexe an seiner Seite, die einem den Weg wies. Hexen hatten Geheimnisse, die sie niemandem preisgaben … höchstens anderen Hexen. Denn wenn sie unter sich waren, wenn sie sich auf einem Berg versammelten, um sich ein Gläschen oder zwei zu genehmigen (beziehungsweise ein Gläschen oder neun wie im Fall von Frau Ogg), schnatterten sie wie die Gänse.
Nur nicht über die wahren Geheimnisse. Was man getan, gehört und gesehen hatte, behielt man für sich. So viele Geheimnisse, dass man Angst haben musste, sie würden aus einem heraussickern. Verglichen mit dem, was eine Hexe sonst oft zu Gesicht bekam, war ein hosenloser Riese nun wirklich nicht der Rede wert.
Nein, Tiffany beneidete Petulia nicht um ihre Romanze, die sich vermutlich größtenteils in schweren Stiefeln, unvorteilhaften Gummischürzen und im Regen abspielte – ganz zu schweigen von dem ständigen Gegrunze und Gequieke.
Nein, sie beneidete sie um ihre Vernunft. Petulia hatte ihr Leben im Griff. Sie wusste genau, wie sie sich ihre Zukunft vorstellte. Sie krempelte die Ärmel hoch und sorgte selbst dafür, dass ihre Wünsche wahr wurden. Wenn es sein musste, auch bis zu den Knien in Schweinen watend.
Alle Familien, selbst diejenigen, die oben in den Bergen wohnten, hielten sich mindestens ein Schwein, das im Sommer als Mülltonne fungierte und den Rest des Jahres über als Braten, Speck, Schinken und Wurstkette Verwendung fand. Das Schwein war wichtig. Eine kranke Großmutter wurde unter Umständen einfach mit Terpentin behandelt, aber wenn das Schwein unpässlich war, ließ man sofort eine Schweinehexe kommen und entlohnte sie sogar für ihre Dienste. Und nicht zu knapp. Und meistens mit Würsten.
Als wäre das alles des Guten noch nicht genug, verstand sich Petulia auch noch wie kein anderer auf die edle Kunst des Schweinlullens. In diesem Jahr hatte sie sogar die Meisterschaft gewonnen. Tiffany fand, dass man sich für das, was ihre Freundin mit den Schweinen anstellte, kein treffenderes Wort hätte ausdenken können. Petulia setzte sich zu einem Schwein und erzählte ihm mit sanfter, ruhiger Stimme so lange extrem langatmige und langweilige Geschichten, bis irgendwann ein seltsamer Schweinemechanismus einsetzte: Mit einem letzten wohligen Gähnen streckte das Tier alle viere von sich und verwandelte sich vom lebenden Borstentier in eine wichtige Bereicherung des familiären Speisezettels. Für das Schwein war dieses Ende vielleicht kein glückliches, aber immerhin doch ein wesentlich appetitlicheres und friedlicheres als das, welches ihm vor der Erfindung des Schweinlullens geblüht hätte. So waren im Großen und Ganzen alle Beteiligten recht gut bedient.
Tiffany, allein inmitten der Menschenmenge, seufzte. Man hatte es eben nicht leicht, wenn man den schwarzen spitzen Hut trug. Denn ob man es wahrhaben wollte oder nicht: Die Hexe war nun mal der Hut, und der Hut war die Hexe. Und vor diesem Hut waren die Menschen stets auf der Hut. Er flößte ihnen Achtung, aber auch ein gewisses Maß an Furcht ein, als könne man ihnen in den Kopf gucken. Womit sie vermutlich gar nicht mal so schieflagen. Wozu hatte man schließlich seine Hexenmethoden, wie den Ersten Blick und die Zweiten Gedanken?6 Doch das war eigentlich keine Magie. Diese Methoden konnte jeder lernen, der auch nur ein Quäntchen gesunden Menschenverstand besaß – manchmal war jedoch selbst dieses kleine Quäntchen schon zu viel verlangt. Oft kamen die Menschen vor lauter Leben gar nicht dazu, sich nach dem Sinn zu fragen. Dafür waren dann die Hexen da, und deshalb wurden sie gebraucht, und zwar dauernd, oh ja. Das hieß allerdings noch lange nicht, dass sie auch erwünscht waren. Was man sie auf eine betont höfliche und deutlich unausgesprochene Art und Weise immer wieder spüren ließ.
Hier war es anders als in den Bergen, wo die Menschen an Hexen gewöhnt waren. Die Bewohner des Kreidelands konnten zwar freundlich sein, aber sie waren keine Freunde, keine echten Freunde. Die Hexe war anders. Die Hexe wusste Dinge, die sonst niemand wusste. Die Hexe war eine andere Sorte Mensch. Die Hexe war jemand, mit dem man sich lieber nicht anlegen sollte. Die Hexe war keine von ihnen.
Tiffany Weh war die Hexe. Sie war Hexe geworden, weil die Menschen eine Hexe brauchten. Jeder braucht eine Hexe, auch wenn das nicht jeder weiß.
Und es funktionierte ganz gut. Wann immer Tiffany einer jungen Mutter bei der Geburt des ersten Kindes beistand oder einem Greis den Weg ins Grab ebnete, verblassten in den Köpfen der Menschen die Märchenbuchvorstellungen vom sabbernden, hässlichen alten Weib mit jedem Mal ein bisschen mehr. Trotzdem hatten die alten Geschichten, die alten Gerüchte, die alten Bilder immer noch Macht über das Gedächtnis der Welt.
Was es für Tiffany schwierig machte, war die Tatsache, dass es im Kreideland traditionell keine Hexen gab. So lange Oma Weh noch gelebt hatte, wäre auch keine auf die Idee gekommen, sich dort niederzulassen. Oma Weh war, wie jeder wusste, eine weise Frau gewesen. So weise sogar, dass sie keine Hexe geworden war. Ohne ihre Zustimmung lief im Kreideland überhaupt nichts — jedenfalls nicht länger als zehn Minuten.
Deshalb war Tiffany als Hexe vollkommen auf sich allein gestellt.
Abgesehen davon, dass sich die Bewohner der Kreide nicht mit Hexen auskannten, konnte sie nun auch nicht mehr auf die Unterstützung der Berghexen wie Nanny Ogg, Oma Wetterwachs und Frau Grad zählen. Dabei wären sie ihr mit Sicherheit zu Hilfe gekommen, wenn Tiffany sie darum gebeten hätte, ganz bestimmt. Und sie hätten auch nichts gesagt, sondern sich bloß ihren Teil gedacht, nämlich, dass Tiffany mit der Verantwortung nicht fertig wurde, dass sie der Aufgabe wohl nicht gewachsen war, dass sie überfordert oder schlicht und ergreifend nicht gut genug war.
»Sie, Fräulein?« Ein nervöses Kichern. Tiffany drehte sich um. Vor ihr standen zwei kleine Mädchen in ihren neuen Sonntagskleidern und Strohhüten. Sie schienen etwas auf dem Herzen zu haben, auch wenn ihnen ein wenig der Schalk aus den Augen blitzte. Tiffany musste nur kurz überlegen, dann lächelte sie.
»Ach, Becky Pardon und Nancy Aufrecht, richtig? Na, ihr zwei beiden? Was kann ich für euch tun?«
Becky Pardon zog verlegen ein Blumensträußchen hinter ihrem Rücken hervor und hielt es ihr hin. Tiffany wusste natürlich sofort, was es damit auf sich hatte. In ihrem Alter hatte sie für die älteren Mädchen auch welche gebunden, weil das eben zum Jäte-Jahrmarkt dazugehörte: ein kleiner Strauß selbstgepflückter Wiesenblumen, zusammengehalten von – und das war das Entscheidende, das Magische – einigen frisch aus dem weißen Kalkstein gerupften Grashalmen.
»Wenn Sie das heute Nacht unter Ihr Kopfkissen legen, träumen Sie von Ihrem Liebsten«, sagte Becky Pardon mit ernster Miene.
Tiffany nahm den schon etwas welken Strauß behutsam entgegen. »Mal sehen, was wir hier haben«, sagte sie. »Honigraspeln, Damendaunen, siebenblättriger Klee – der bringt sehr viel Glück –, ein Zweiglein Greisenhöschen, Liebesschlüsselchen, ach, und ein paar Stängel Herzschmerzlose und …« Sie starrte auf die kleinen rot-weißen Blüten.
Die Mädchen fragten: »Haben Sie was, Fräulein?«
»Ein Vergiss-mein-G′sicht7!«, sagte Tiffany etwas schärfer als beabsichtigt. Um sich ihre Irritation nicht anmerken zu lassen, fuhr sie rasch im munteren Plauderton fort: »Die kommen in unserer Gegend nicht oft vor. Müssen wohl aus irgendeinem Garten hierher eingeschleppt worden sein. Und ihr wisst doch sicher auch, womit ihr den Strauß zusammengebunden habt, oder? Das sind Binsen, aus denen man früher Binsendochtkerzen gemacht hat. Was für eine nette Überraschung. Ich danke euch sehr. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf dem Jahrmarkt …«
Becky hob die Hand. »Sie? Fräulein?«
»Gibt es noch etwas, Becky?«
Die Kleine bekam einen roten Kopf und beriet sich rasch mit ihrer Freundin. Noch eine Spur röter, aber wild entschlossen, drehte sie sich wieder zu Tiffany um.
»Fragen ist doch nicht verboten, oder? Man kriegt doch keinen Ärger, bloß weil man was fragt?«
Jetzt kommt‘s, dachte Tiffany: Wie werde ich Hexe, wenn ich groß bin? Das wollten die kleinen Mädchen immer von ihr wissen. Sie glaubten, der Hexenberuf sei ein ständiges Besenreiten. Laut sagte sie: »Von mir hast du jedenfalls nichts zu befürchten. Frag ruhig.«
Becky Pardon blickte auf ihre Stiefel. »Haben Sie eigentlich auch süße Triebe?«
Ein weiteres Talent, das man als Hexe benötigt, ist die Fähigkeit, sich seine Gedanken nicht ansehen zu lassen. Vor allem durfte man es unter gar keinen Umständen dazu kommen lassen, dass einem die Gesichtszüge entgleisten. Ohne das leiseste Schwanken in der Stimme und ohne den geringsten Hauch eines verlegenen Lächelns antwortete Tiffany: »Das ist eine sehr interessante Frage, Becky. Verrätst du mir, warum du das wissen möchtest?«
Nachdem sie die Frage nun gewissermaßen in den öffentlichen Raum gestellt hatte, wirkte die Kleine richtig erleichtert.
»Na ja, ich hab meine Oma gefragt, ob ich Hexe werden kann, wenn ich groß bin, und da hat sie gesagt, dass ich das bestimmt nicht wollen würde, weil Hexen keine süßen Triebe haben.«
Zwei Paar ernste Eulenaugen blickten Tiffany erwartungsvoll an. Ihr blieb nicht viel Zeit zum Überlegen: Es sind Mädchen vom Land, die mit Sicherheit schon einmal gesehen haben, wie Katzen und Hunde ihre Junge bekommen, dachte sie. Bestimmt haben sie auch schon die Geburt eines Lämmchens miterlebt oder die eines Kälbchens — eine laute Angelegenheit, die man nicht so leicht überhören kann. Sie wissen also ganz genau, was ihre Frage bedeutet.
Nun schaltete sich Nancy ein. »Wenn das nämlich stimmt, Fräulein, hätten wir gerne unsere Blumen zurück. Wir wollen sie ja nicht verschwenden. Nicht böse sein.« Rasch trat sie einen Schritt zurück.
Tiffany war selbst überrascht, dass sie lachen musste. Das hatte es bei ihr schon ewig nicht mehr gegeben. Während sich die Dorfbewohner erstaunt nach ihr umdrehten, erwischte sie die Mädchen in letzter Sekunde, bevor sie davonlaufen konnten, und zog sie zu sich herum.
»Gut gemacht, ihr zwei«, sagte sie. »Ich freue mich immer, wenn zur Abwechslung mal jemand seinen Verstand benutzt. Ihr dürft nie aufhören, Fragen zu stellen. Und nun zu meiner Antwort: Was die süßen Triebe angeht, sind Hexen genau wie alle anderen Menschen auch, bloß haben sie meistens so viel zu tun, dass sie gar nicht dazu kommen, über sie nachzudenken.«
Die Mädchen schienen froh, dass sie sich die Mühe mit den Blumen doch nicht ganz umsonst gemacht hatten, und Tiffany wappnete sich für die nächste Frage, die wiederum von Becky kam. »Haben Sie denn einen Liebsten, Fräulein?«
»Zurzeit nicht«, antwortete Tiffany, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie hob das Sträußlein hoch. »Aber wer weiß? Wenn ihr die Blumen richtig gebunden habt, finde ich vielleicht wieder einen. Dann seid ihr bessere Hexen als ich. So viel steht fest.« Die beiden Mädchen ließen sich diese dreiste Schmeichelei strahlend gefallen, und die Fragerei hatte ein Ende.
»So«, sagte Tiffany. »Gleich fängt das Käserollen an. Das wollt ihr doch bestimmt nicht verpassen.«
»Nein, Fräulein«, antworteten sie im Chor. Ehe sie sich trollten, vor Erleichterung und Selbstherrlichkeit fast platzend, tätschelte Becky tröstend Tiffanys Hand. »Verehrer können ganz schön anstrengend sein«, sagte sie mit der ganzen Abgeklärtheit ihrer acht Lebensjahre.
»Danke«, erwiderte Tiffany. »Das werde ich mir merken.«
Mit den anderen Jahrmarktsattraktionen, wie zum Beispiel dem Fratzenschneiden durch ein Pferdekummet, der Kissenschlacht auf einem gefetteten Balken oder sogar dem Froschtauchen, hätte man sie, wenn überhaupt, nur mit Mühe hinter dem Ofen hervorlocken können. Denn das Schönste war für Tiffany schon immer das Käserollen gewesen. Sie konnte sich gar nicht daran sattsehen, wenn ein guter Laib Käse den ganzen Hügel hinunterrollte – allerdings nicht über den Riesen. Davon wäre wohl jedem der Appetit vergangen.
An den Start gingen ausschließlich Hartkäsesorten, die zum Teil speziell für die Käserollsaison gemacht wurden. Der Hersteller des Siegerlaibes, der unversehrt am Fuß des Hügels ankam, gewann einen Gürtel mit Silberschnalle und die Bewunderung des ganzen Dorfes.
Obwohl Tiffany eine hervorragende Käserin war, hatte sie noch nie an diesem Wettbewerb teilgenommen. Für Hexen waren solche Turniere tabu. Denn wenn man gewann (und sie wusste, dass sie schon ein, zwei Championkäse hergestellt hatte), hieß es – natürlich hinter vorgehaltener Hand –, das wäre unfair, weil man ja schließlich eine Hexe sei. Und wenn man nicht gewann, wurde ebenfalls getuschelt: »Was soll denn das für eine Hexe sein, die noch nicht mal einen Käse hinkriegt, der die einfachen Käse von uns einfachen Leuten besiegen kann?«
Kurz vor Beginn des Käserollens setzte sich die Menge allmählich in Bewegung. Nur um die Bude, an der man nach Fröschen tauchen konnte, drängte sich noch das Publikum. Es war eine sehr beliebte und lustige Attraktion – vor allem für die nicht tauchenden Zuschauer. Leider fehlte in diesem Jahr der Mann, der sich Wiesel in die Hose steckte. Sein Rekord stand angeblich bei neun Wieseln in einer einzigen Hose. Seine Anhänger rätselten, ob ihm die ganze Sache vielleicht doch zu kitzelig geworden war. Aber früher oder später versammelten sich alle an der Startlinie für das Käserollen. So wollte es die Tradition.
Da der Hang an dieser Stelle steil und die Rivalität zwischen den Käsebesitzern groß war, kam es zu einem ungestümen Gerangel, das jedes Mal in Knüffe, Püffe und Tritte überging und gelegentlich auch mit einem Arm- oder Beinbruch enden konnte. Während sich die wartenden Männer mit ihren Laiben in einer Reihe aufstellten, bemerkte Tiffany – offenbar als Einzige – einen ominösen Käse, der aus eigener Kraft an den Start rollte. Ein schwarzer Käse mit einer dicken Staubschicht, der ein schmutziges blau-weißes Tuch umgebunden hatte.
»Oh nein«, seufzte sie. »Horace! Und wo du bist, ist der Ärger nicht weit.« Sie blickte sich forschend um. »Jetzt hört mal gut zu«, sagte sie leise. »Ich weiß, dass mindestens einer von euch in der Nähe sein muss. Dieser Wettkampf ist nicht für euch, sondern für die Menschen. Verstanden?«
Aber es war schon zu spät. Der Rennleiter, der einen großen Schlapphut mit spitzenbesetzter Krempe trug, erhob die Stimme und verkündete: »Lasset die Laibe rollen!« Eine etwas hochtrabende Ausdrucksweise für »Auf die Plätze, fertig, los«, aber ein Mann mit Spitzenborte am Hut würde niemals etwas platt ausdrücken, wenn es auch geschwollen ging.
Tiffany traute sich kaum hinzusehen. Die Läufer kugelten und schlitterten mehr den Hügel hinunter, als dass sie rannten. Schon erhob sich lautes Geschrei. Der schwarze Käse, der sich blitzschnell an die Spitze des Feldes gesetzt hatte, machte immer wieder unvermittelt kehrt, um einen seiner unschuldigen Käsekollegen von der Strecke zu drängen. Während er den Hügel hinaufschoss, gab er ein leises Grollen von sich.
Schimpfend versuchten die Käseläufer, ihn festzuhalten, doch obwohl sie mit Stöcken nach ihm schlugen, setzte der Schurkenkäse seinen Weg der Zerstörung unbeirrt bis ins Ziel fort, wo das Rennen in einer schrecklichen Massenkarambolage aus Leibern und Laiben seinen Höhepunkt fand. Anschließend rollte er gemächlich wieder nach oben und blieb, sanft vibrierend, auf der Startlinie hocken.
Am Fuß des Hügels brach derweil unter den kampffähig gebliebenen Käse-Jockeys eine Schlägerei aus. Und da das Publikum nur noch Augen für dieses wilde Getümmel hatte, nutzte Tiffany die Gunst des Augenblicks, Horace an sich zu nehmen und ihn in ihrer Tasche zu verstauen. Schließlich gehörte er ihr. Zumindest hatte sie ihn gemacht. Allerdings musste ihr dabei irgendetwas Seltsames in die Milch geraten sein, denn Horace war der einzige Käse, der nicht nur Mäuse fraß, sondern, wenn man ihn nicht festnagelte, sogar andere Käse. Es war deshalb auch kein Wunder, dass er sich so prächtig mit den Wir-sind-die-Größten8 verstand, die ihn zum Ehrenmitglied ihres Clans ernannt hatten. Er war eben ein Käse ganz nach ihrem Geschmack.
Möglichst unauffällig hob Tiffany sich die Tasche an den Mund und zischte: »So etwas gehört sich nicht! Schäm dich!« Die Tasche wackelte ein bisschen. Leider kam das Wort »schämen« in Horaces Wortschatz nicht vor – was auch für alle anderen Wörter galt. Sie ließ die Tasche wieder sinken, entfernte sich ein paar Schritte von der Menge und sagte: »Ich weiß, dass du da bist, Rob Irgendwer.«
Schon saß er auf ihrer Schulter. Sie konnte ihn riechen. Da die Größten, wenn es nicht gerade regnete, kaum mit Wasser in Berührung kamen, rochen sie immer wie leicht beschwipste Kartoffeln. »Die Kelda9 wollte wissen, wie’s dir so geht«, sagte der Große Mann des Clans. »Du has‘ dich schon zwei Monate nich mehr bei ihr inner Höhle blicken lassen. Ich glaub, sie macht sich Sorgen um dich, wo du doch immer so schwer schuften muss‘.«
Tiffany stöhnte, aber nur innerlich. »Das ist sehr nett von ihr. Die Kelda kann sich bestimmt denken, dass ich sehr beschäftigt bin. Die Arbeit hört eben nie auf. Ich werde immer irgendwo gebraucht. Aber sie muss sich keine Sorgen machen. Es geht mir gut. Und lass bitte Horace nicht mehr frei herumrollen – du weißt doch, wie leicht er über die Stränge schlägt.«
»Ja, aber da oben aufm Spruchband steht doch, dass der Jahrmarkt ‘n Fest fürs Volk der Hügel is. Und wir sind noch viel mehr als Volk. Wir sind Folklore! Daran is nich zu rütteln. Außerdem halt ich große Stücke auf den großen kleinen Hosenlosen. Er is’n toller Hecht, das steht mal fest.« Rob hielt kurz inne. »Dann kann ich ihr also bestelln, dass bei dir so weit alles in Butter is?« Er klang ein wenig nervös, als ob er gern mehr gesagt hätte, sich aber nicht so recht traute.
»Mach das, Rob Irgendwer. Ich wäre dir sehr dankbar«, antwortete Tiffany. »Wenn ich das richtig sehe, muss ich jetzt erst mal los, ein paar Leute verbinden.«
Heldenhaft ratterte Rob Irgendwer – ein Mann auf undankbarer Mission – nun doch noch den Satz herunter, den ihm seine Frau für Tiffany mitgegeben hatte: »Die Kelda sagt, andre Väter haben auch schöne Söhne!«
Tiffany stand da wie erstarrt. Ohne ihn anzusehen sagte sie leise: »Ich danke der Kelda für ihren Rat. Aber die Arbeit wartet, Rob. Und vergiss nicht, der Kelda meinen Dank auszurichten!«
Die meisten Zuschauer hatten sich inzwischen im Zielraum eingefunden, die einen, um zu gaffen, die anderen, um den laut jammernden Käseläufern mit laienhaften Mitteln Erste Hilfe zu leisten. Aber für alle war es ein spannender Zeitvertreib. So einen eindrucksvollen Haufen aus Männern und Käsen bekam man schließlich nicht alle Tage zu sehen. Und womöglich waren da ja auch noch ein paar wirklich interessante Verletzungen zu bestaunen.
Tiffany, die froh war, helfen zu können, brauchte sich nicht erst lange zu den Opfern durchzukämpfen. Vor dem spitzen schwarzen Hut teilte sich die Menge schneller als die Fluten eines seichten Meeres vor einem heiligen Mann. Zuerst verscheuchte sie die Schaulustigen, wobei sie den Begriffsstutzigeren unter ihnen mit ein paar Rippenstößen nachhelfen musste. Zum Glück war das Gemetzel in diesem Jahr nicht allzu blutig ausgefallen: nur ein gebrochener Arm, ein gebrochenes Handgelenk, ein gebrochenes Bein und jede Menge Schrammen, Beulen und Schürfwunden, die bei der Schlitterpartie am Hang entstanden waren – Gras ist nicht unbedingt jedem Menschen grün. Mehreren jungen Männern, die offenbar große Schmerzen litten, aber nicht willens waren, ihre Verletzungen mit einem weiblichen Wesen zu erörtern, gab Tiffany den Rat, die betroffenen Stellen zu Hause mit kalten Umschlägen zu behandeln, und sah ihnen nach, wie sie krummbeinig davonwackelten.
Tiffany konnte mit sich zufrieden sein. Unter den neugierigen Blicken der Menge hatte sie ihr Können unter Beweis gestellt und sich – nach allen Bemerkungen, die sie ringsum aufschnappte – durchaus achtbar geschlagen. Vielleicht war es nur Einbildung, dass ein, zwei Leute ein verlegenes Gesicht machten, als ein alter Mann, dem der Rauschebart bis zur Hüfte hing, mit einem Grinsen zu ihr sagte: »Ein Mädel, das Knochenbrüche richten kann, kriegt bestimmt noch einen Kerl ab«, aber das ging vorbei. Als es nichts mehr zu gaffen gab, stiegen die Menschen den Hügel langsam wieder hinauf … Doch dann fuhr die Kutsche vorbei und – was noch viel schlimmer war – hielt an.
An der Tür prangte das Wappen der Familie Souvenir. Ein junger Mann stieg aus, auf seine Art nicht unansehnlich, aber so steif, dass man auf ihm Hemden hätte bügeln können. Das war Roland. Er war erst einen Schritt weit gekommen, als eine scharfe Stimme aus dem Inneren der Kutsche hinter ihm herschnarrte, was ihm denn einfalle, den Wagenschlag selbst zu öffnen. Für so etwas habe man schließlich Lakaien. Außerdem solle er sich gefälligst sputen, man habe ja nicht den ganzen Tag Zeit.
Der junge Mann hastete auf die Dorfbewohner zu, die sich eilig den Staub von der Kleidung klopften. Immerhin war er der Sohn des Barons, dem der größte Teil des Kreidelands und darin fast jedes Haus gehörte. Obwohl der Baron ein durchaus väterlicher Landesvater war, konnte es sicher nicht schaden, seiner Familie etwas Höflichkeit entgegenzubringen …
»Ist etwas passiert? Hat sich jemand verletzt?«, fragte Roland.
Im Kreideland war das Verhältnis zwischen Herrn und Untertanen in aller Regel von gegenseitigem Respekt geprägt. Trotzdem wusste das Bauernvolk aus Erfahrung, dass es gegenüber der Obrigkeit klüger war, mit seinen Worten sparsam umzugehen, weil manchmal jedes Wort schon ein Wort zu viel sein konnte. Schließlich gab es immer noch eine Folterkammer auf der Burg, auch wenn sie seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt worden war. Deshalb hielt man sich vorsichtshalber zurück und überließ das Reden lieber der Hexe. Die konnte immerhin wegfliegen, wenn es brenzlig wurde.
»Nur ein kleiner Unfall, der sich leider nicht verhindern ließ«, antwortete Tiffany, und sie war sich durchaus bewusst, dass sie als Einzige der Frauen keinen Knicks gemacht hatte. »Einige gebrochene Knochen, die bald wieder zusammenwachsen werden, und ein paar rote Köpfe. Danke der Nachfrage, wir kommen schon klar.«
»Verstehe, verstehe. Gut gemacht, junge Dame.«
Einen Augenblick lang glaubte Tiffany, ihre Zähne schmecken zu können. Junge Dame? So musste sie sich von ihm anreden lassen? Mit ein bisschen bösem Willen hätte man es auch als Beleidigung auffassen können. Doch offenbar störte sich außer ihr niemand daran. So redeten die hohen Herrschaften nun mal, wenn sie versuchten, sich umgänglich und leutselig zu geben. Anscheinend will er seinem Vater nacheifern, dachte sie. Aber der alte Baron hatte ein Gespür dafür. Er redete auf Augenhöhe mit den Leuten. Nicht von oben herab, wie von einem Podium. Sie antwortete: »Danke sehr, der Herr.«
So weit, so gut. Doch jetzt öffnete sich die Tür der Kutsche ein zweites Mal, und ein weißes Füßlein senkte sich hinunter auf den Feuerstein. Das war sie: Lappalia – oder Larifaria? Tiffany wusste natürlich ganz genau, dass sie Lätitia hieß, aber eine klitzekleine, noch dazu unausgesprochene Bosheit musste ihr doch wohl erlaubt sein. Lätitia! Was für ein Name. Läppisch, lästig, lächerlich. Und wie kam diese Lätitia überhaupt dazu, Roland vom Jäte-Jahrmarkt fernzuhalten? Er gehörte dorthin! Sein Vater hätte sich den Besuch sicher nicht nehmen lassen, wenn er dazu imstande gewesen wäre! Und dann noch diese Schuhe, beziehungsweise Schühchen! So weiß und zierlich! Wie lange würden die wohl halten, wenn ihre Trägerin einer geregelten Arbeit nachgehen müsste? Tiffany zügelte sich: Eine kleine Bosheit musste reichen.
Lätitia warf einen furchtsamen Blick auf Tiffany und die Menge und sagte zu Roland: »Lass uns fahren, ja? Mutter wird schon ungeduldig.«
Die Kutsche rollte weiter, der Leierkastenmann zog ab, die Sonne ging unter. Einige Menschen verweilten noch ein wenig in den warmen Schatten der Abenddämmerung, aber Tiffany flog allein nach Haus – so hoch, dass nur die Fledermäuse und Eulen ihr Gesicht sehen konnten.
2
Katzenmusik
Sie bekam nur eine Stunde Schlaf, bevor der Alptraum begann.
Was ihr von dieser Nacht am besten in Erinnerung bleiben sollte, war das dumpfe Poltern, mit dem Herrn Mickers Kopf gegen Wand und Geländer schlug, als sie ihn gewaltsam aus dem Bett zerrte und an seinem speckigen Nachthemd die Treppe hinunterschleifte. Er war ein massiger Mann und schlief noch halb. Seine andere Hälfte war stockbetrunken.
Sie musste unbedingt dafür sorgen, dass er keine Sekunde zum Nachdenken kam, während sie ihn wie einen Sack hinter sich herzog. Er war zwar drei Mal so schwer wie sie, aber sie kannte das Hebelgesetz. Als Hexe musste man schwer heben können. Sonst könnte man einem Kranken ja nie das Bett frisch beziehen. Nachdem Tiffany ihn über die letzten Stufen in die winzige Küche der Kate hatte rutschen lassen, übergab er sich auf den Fußboden.
Das geschah ihm ganz recht – in einer stinkenden Pfütze aus Erbrochenem zu liegen war noch das Mindeste, was dieser Kerl verdient hatte. Doch jetzt hieß es schnell handeln, bevor er wieder zu sich kam.
Als Frau Micker, eine kleine graue Maus, laut schreiend vor Entsetzen ins Wirtshaus gestürzt war und von den brutalen Schlägen ihres Mannes berichtete, hatte Tiffanys Vater sofort seine Tochter aus dem Bett holen lassen. Herr Weh war ein sehr vorausschauender Mann, der gewusst haben musste, dass die bierselige Stimmung am Ende eines Jahrmarkttages blitzschnell und auf verhängnisvolle Weise ins Gegenteil umschlagen konnte. Noch während Tiffany auf ihrem Besen zu den Mickers eilte, hörte sie bereits die ersten Klänge der Katzenmusik.
Sie gab dem Mann eine Ohrfeige. »Hören Sie das?«, fuhr sie ihn an und zeigte auf das dunkle Fenster. »Hören Sie? Die wollen Ihnen eine Katzenmusik bringen. Die kommen, um Ihnen den Marsch zu blasen, Herr Micker. Sie haben Stöcke! Und Steine! Und Fäuste! Sie haben sich mit allem bewaffnet, was nicht niet- und nagelfest ist, aber vor allem haben sie ihre Fäuste. Das Kind ist tot, Herr Micker. Sie haben Ihre Tochter so schwer verprügelt, dass sie ihr Kind verloren hat. Ihre Frau sitzt bei den Dorffrauen und weint sich aus, und alle wissen, dass Sie es getan haben. Alle.«
Sie starrte in seine blutunterlaufenen Augen. Er hatte automatisch die Hände geballt, weil er ein Mann war, der mit seinen Fäusten dachte. Bald würde er versuchen, sie zu gebrauchen – zuschlagen war leichter als nachdenken. Herr Micker hatte sich schon immer mit den Fäusten durchs Leben geprügelt.
Die Katzenmusik kam nur langsam näher. Es ist eben schwierig, in finsterer Nacht quer über die Felder zu laufen, wenn man zu tief ins Glas geschaut hat. Da kann die rechtschaffene Empörung, die einen antreibt, noch so groß sein. Hoffentlich gingen die Männer nicht in die Scheune. Dann würden sie nicht lange fackeln und Herrn Micker an Ort und Stelle aufknüpfen – wenn er Glück hatte und sie ihm sonst nichts antaten. Ein Blick in die Scheune hatte Tiffany genügt, und sie wusste, dass eine Bluttat geschehen war und sie eine zweite verhindern musste. Sie hatte dem Mädchen mit einem Zauber die Schmerzen genommen, die sie jetzt dicht über ihrer Schulter im Gleichgewicht hielt. Natürlich waren sie unsichtbar, aber vor Tiffanys innerem Auge brannten sie in feurigen Farben.
»Da ist bloß dieser Schuft dran schuld«, murmelte Herr Micker, dem das Erbrochene über die Brust lief. »Steigt ihr nach und verdreht ihr den Kopf, bis sie sich von ihrer Mutter und mir nichts mehr sagen lässt. Dabei ist sie doch erst dreizehn. Es ist eine Schande.«
»William ist auch erst dreizehn«, sagte Tiffany. Es gelang ihr nur mit Mühe, ihren Zorn im Zaum zu halten. »Und was soll das überhaupt heißen? Dass sie zu jung war, um sich zu verlieben, aber nicht zu jung, um dermaßen verprügelt zu werden, bis sie an Stellen geblutet hat, wo kein Mensch je bluten sollte?«
Sie war sich nicht sicher, ob sie tatsächlich zu ihm durchdrang. Selbst nüchtern war er von so beschränktem Verstand, dass man sich fragte, ob er überhaupt etwas anderes als Stroh im Kopf hatte.
»Was die zwei getrieben haben, gehört sich nicht«, sagte er. »Und ein Mann muss ja wohl dafür sorgen, dass wenigstens unter seinem eigenen Dach Zucht und Ordnung herrschen. «
Tiffany konnte sich lebhaft vorstellen, was für hitzige Reden im Wirtshaus geschwungen worden waren – als Ouvertüre zur Katzenmusik. Es gab zwar nicht viele Waffen im Kreideland, aber dafür hatten die Leute Sicheln, Sensen, Messer und große, schwere Hämmer – die nur so lange keine Waffen waren, bis jemand damit angegriffen wurde. Und das ganze Dorf wusste, wie jähzornig der alte Micker war und wie oft seine Frau – wenn sie mal wieder ein blaues Auge hatte – ihren Nachbarn weismachen wollte, sie wäre gegen eine Tür gelaufen.
Oh ja, sie konnte sich vorstellen, wie sich die Stimmung im Wirtshaus, angefacht vom Bierdunst, immer weiter aufheizte, bis den Leuten irgendwann die Sachen in den Sinn kamen, die bei ihnen zu Hause im Schuppen hingen und die – noch – keine Waffen waren. In seinem eigenen kleinen Reich war jeder Mann der Herrscher. (Das glaubten zumindest die Männer.) Und deshalb steckte man seine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten. Aber wenn es im Reich des Nachbarn zu gären begann, musste man etwas unternehmen, damit sich die Fäulnis nicht weiter ausbreiten konnte. Herr Micker war das schmutzige kleine Geheimnis der Dorfgemeinschaft — aber eines, das sich nach den Vorfällen dieses Abends nicht mehr unter der Decke halten ließ.
»Ich bin Ihre einzige Chance, Herr Micker«, sagte Tiffany. »Sie müssen fliehen, und zwar sofort. Packen Sie ein paar Sachen zusammen, und dann nichts wie weg. Laufen Sie so weit, bis Sie keiner mehr kennt, und dann sicherheitshalber noch ein paar Meilen weiter. Ich kann die Leute nämlich nicht aufhalten. Verstehen Sie? Mir persönlich ist es herzlich egal, was sie mit Ihnen machen, aber ich will nicht, dass gute Menschen durch einen Mord zu bösen Menschen werden. Also, nehmen Sie endlich Ihre Beine in die Hand! Wenn man mich fragt, wohin Sie verschwunden sind, weiß ich von nichts.«
Dumpf kratzte er seinen letzten Trotz zusammen. »Ich lass mich doch nicht aus meinem eigenen Haus schmeißen«, nuschelte er.
»Ihr Haus, Ihre Frau und Ihre Tochter haben Sie längst verloren. Und Ihren Enkel, Herr Micker. Hier werden Sie heute Nacht keine Freunde finden. Ich biete Ihnen Ihr Leben. «
»Schuld war nur der Suff!«, brach es aus Micker heraus. »Ohne den Schnaps wär das nie passiert!«
»Aber wer hat den Schnaps denn getrunken? Und noch einen und noch einen?«, fragte sie. »Sie haben sich den ganzen Tag auf dem Jahrmarkt volllaufen lassen, bis Sie der Suff in den Klauen hatte.« Tiffany war es eiskalt ums Herz.
»Es tut mir leid.«
»Das reicht nicht, Herr Micker. Das reicht hinten und vorne nicht. Verschwinden Sie, und gehen Sie in sich, und wenn Sie als besserer Mensch wieder zurückkommen, haben Sie vielleicht das Glück, dass die Leute Sie mit einem Hallo oder wenigstens mit einem Kopfnicken begrüßen.«
Tiffany ließ ihn nicht aus den Augen, schließlich kannte sie ihren Pappenheimer. In ihm kochte es. Er schämte sich, er wusste weder ein noch aus, er war aufgebracht – lauter Umstände, unter denen die Mickers dieser Welt gern einmal die Fäuste fliegen lassen.
»Ich rate Ihnen dringend davon ab, Herr Micker«, sagte sie warnend. »Haben Sie eine Ahnung, was passiert, wenn Sie eine Hexe schlagen?«
Diese Hexe hier würde wahrscheinlich tot umfallen, wenn sie sich von dir einen Hieb einfängt, dachte sie. Deshalb muss ich dafür sorgen, dass du vor lauter Angst gar nicht erst dazu kommst.
»Haben Sie mir die Katzenmusik auf den Hals gehetzt?«
Sie seufzte. »Diese Musik kann man nicht lenken, Herr Micker, und das wissen Sie genau. Sie entsteht von selber, wenn den Leuten der Kragen platzt. Niemand weiß, wann sie einsetzt. Es beginnt mit einem Blick, einem ersten stummen Nicken. Es zieht immer weitere Kreise, bis irgendwann der Erste einen Löffel in die Hand nimmt und auf einen Teller trommelt, bis jemand seinen Bierkrug auf den Tisch knallt, bis nach und nach alle mit ihren Stiefeln auf den Boden stampfen, lauter und immer lauter. Katzenmusik ist Lärm gewordener Zorn. So hört es sich an, wenn das Fass überläuft. Wollen Sie ernsthaft hier sitzen bleiben, bis sie kommen und dafür sorgen, dass Ihnen Hören und Sehen vergeht?«
»Sie halten sich wohl für besonders schlau, was?«, knurrte Micker. »Glauben, Sie können die Leute einfach so rumkommandieren, mit Ihrem Besen und Ihrer Schwarzen Magie.«
Sie konnte sich einer gewissen Bewunderung nicht erwehren. Er hatte keinen einzigen Freund mehr auf der Welt, war über und über mit seinem eigenen Erbrochenen bekleckert und – sie schnupperte – ja, von seinem Nachthemd tropfte Urin. Und trotzdem wagte er es, Widerworte zu geben. »Ich bin bloß schlauer als Sie, Herr Micker. Und das ist kein großes Kunststück.«
»Ach nein? Die Schlauheit wird Ihnen schon noch vergehen. Halbgares Frauenzimmer, das sich überall einmischt … Warten Sie ab, bis sie Ihnen eine Katzenmusik bringen. Was machen Sie dann?«
»Weglaufen, Herr Micker. Mich aus dem Staub machen. Und für Sie wird es jetzt auch höchste Zeit.« Sie konnte bereits einzelne Stimmen heraushören.
»Würden Ihre Majestät vielleicht erlauben, dass man sich vorher noch die Stiefel anzieht?«, fragte er höhnisch und bückte sich schon danach. Aber man konnte in Herrn Micker lesen wie in einem nicht besonders dicken offenen Buch. Einem Büchlein voller fettiger Fingerabdrücke und einer Scheibe Speck als Lesezeichen.
Mit schwingenden Fäusten richtete er sich auf.
Sie wich einen Schritt zurück, fasste ihn beim Handgelenk und ließ die Schmerzen auf ihn los. Tiffany spürte, wie sie kribbelnd ihren Arm hinunter und in den Mann hineinliefen: die gesamten Schmerzen seiner Tochter in nur einer Sekunde. Er wurde quer durch die Küche geschleudert, alle Gefühlsregungen aus ihm herausgebrannt, bis auf eine animalische Angst. Wie ein Stier warf er sich gegen die morsche Hintertür, brach hindurch und verschwand in der Dunkelheit.
Tiffany schleppte sich zurück in die Scheune, die von einer Lampe erleuchtet war. Laut Oma Wetterwachs fühlte man die Schmerzen nicht, die man einem anderen abgenommen hatte. Aber das war eine Lüge. Eine notwendige Lüge. Man fühlte sie sehr wohl, doch man konnte sie aushalten, weil es nicht die eigenen waren. Aber nachdem man sich von ihnen befreit hatte, konnte man sich vor Schwäche kaum noch auf den Beinen halten.
Als die tobende, lärmende Meute eintraf, saß Tiffany still neben dem schlafenden Mädchen in der Scheune. Die Katzenmusik zog einmal um die Kate herum, aber sie überschritt nicht die Schwelle. So lautete eines ihrer ungeschriebenen Gesetze. Und die wurden eingehalten, auch wenn man es kaum glauben mag. Manchmal wütete sie drei Nächte, manchmal genügte auch schon eine. Doch so lange sie in der Luft lag, traute sich niemand aus dem Haus heraus und auch niemand wieder hinein. Es sei denn, er wollte um Vergebung oder um Verständnis bitten – oder um zehn Minuten zum Packen und Abhauen. Die Katzenmusik hatte keinen Dirigenten. Alle wurden von der Raserei gleichzeitig befallen. Sie spielte immer dann auf, wenn in einem Dorf das Gefühl überhand nahm, dass ein Mann seine Frau zu oft oder seinen Hund zu brutal geschlagen hatte. Wenn ein verheirateter Mann und eine verheiratete Frau vergaßen, dass sie mit jemand anderem verheiratet waren. Es gab auch noch andere, dunklere Taten, die mit der Katzenmusik gesühnt wurden, doch über die redete man nur hinter vorgehaltener Hand. Dem einen oder anderen gelang es, die Musik wieder zum Verstummen zu bringen, indem er ein besserer Mensch wurde; aber die meisten packten ihre Siebensachen und machten sich noch vor der dritten Nacht aus dem Staub.
Von selbst hätte Micker die Warnung bestimmt nicht verstanden. Er wäre mit fliegenden Fäusten aus dem Haus gestürmt. Es wäre zum Kampf gekommen, und irgendjemand hätte eine noch größere Dummheit begangen als Micker mit seiner Attacke. Dann würde der Baron davon erfahren haben, und die Menschen hätten Heim und Hof verloren. Sie hätten das Kreideland verlassen und in der Ferne, also mindestens zehn Meilen entfernt, unter Fremden ein neues Leben anfangen müssen.
Als die Katzenmusik allmählich verklang, ging langsam das Scheunentor auf, und Tiffanys Vater schob sich verlegen herein. Er war ein Mann von feinem Instinkt, der im Dorf hohes Ansehen genoss. Doch nun war plötzlich seine Tochter wichtiger als er, eine Hexe, die sich von niemandem dreinreden ließ. Tiffany wusste, dass er von den anderen Männern deswegen aufgezogen wurde.
Sie lächelte ihn an, und er setzte sich neben sie ins Heu. Die Musik zog wieder ab – hier würde sie niemanden mehr zum Verprügeln, Steinigen oder Aufknüpfen finden. Herr Weh, der von Natur aus ein Mann weniger Worte war, schaute sich schweigend um. Sein Blick fiel auf das in Stroh und Sackleinen gewickelte kleine Bündel, das Tiffany an einer Stelle abgelegt hatte, wo das Mädchen es nicht sehen konnte. »Dann stimmt es also? Sie war in anderen Umständen? «
»Ja, Papa.«
Er blickte ins Leere. »Besser, wenn sie ihn nicht finden«, sagte er nach einer gebührenden Pause.
»Ja«, antwortete Tiffany.
»Ein paar von den jüngeren Burschen haben gedroht, ihn aufzuhängen. Wir hätten das natürlich verhindert, aber es wäre eine unschöne Sache gewesen. Man hätte für die eine oder andere Seite Partei ergreifen müssen. So was kann ein ganzes Dorf vergiften.«
»Ja.«
Sie schwiegen. Nach einer Weile blickte ihr Vater hinunter auf das schlafende Mädchen. »Konntest du ihr helfen?«
»Ich habe getan, was ich kann«, antwortete Tiffany.
»Hast du ihr die Schmerzen genommen?«
Sie seufzte. »Ja, aber ich muss ihr auch noch etwas anderes nehmen. Leihst du mir eine Schaufel, Papa? Ich begrabe das arme Würmchen im Wald, wo es keiner mitbekommt.«
Er wandte den Blick ab. »Musst du dir das auch noch aufhalsen, Tiff? Und das in deinem Alter. Noch keine Sechzehn, aber ständig auf Trab, um Kranke zu pflegen, Verbände zu wechseln und was weiß ich noch. Du solltest das nicht alles alleine machen müssen.«
»Ja, ich weiß«, sagte Tiffany.
»Warum tust du es dann?«, fragte er.
»Weil es sonst keiner tut. Weil es keiner tun will oder tun kann. Darum.«
»Aber eigentlich kann man das nicht von dir verlangen.«
»Ich verlange es von mir. Ich bin eine Hexe. Das gehört nun mal dazu. Das, wofür sich niemand verantwortlich fühlt, ist meine Aufgabe«, sagte Tiffany rasch.
»Ja, aber wir dachten doch alle, eine Hexe zu sein bedeutet, dass man auf seinem Besen durch die Gegend saust, und nicht, dass man alten Frauen die Zehennägel schneidet. «
»Die Leute sehen einfach nicht, wo welche Hilfe nötig ist«, erklärte Tiffany. »Sie sind keine schlechten Menschen, sie denken bloß nicht mit. Nehmen wir nur mal die alte Frau Strumpf, die auf der Welt nichts besitzt außer ihrer Katze und ihrer Arthritis. Die Nachbarn haben ihr regelmäßig etwas zu essen gebracht, das stimmt, aber meinst du, einer von ihnen hätte gemerkt, dass sie sich ein Jahr lang die Stiefel nicht mehr ausziehen konnte, weil ihre Zehennägel zu lang geworden waren? Die Leute bringen gern einen Eintopf vorbei oder ab und zu einen Blumenstrauß, aber sobald die Sache ein bisschen unappetitlich wird, ist keiner mehr da. Hexen erkennen sofort, wo etwas nicht stimmt. Klar, wir sausen auch schon mal mit dem Besen durch die Gegend, aber meistens nur, weil wir möglichst schnell irgendwohin wollen, wo Hilfe gebraucht wird.«
Herr Weh schüttelte den Kopf. »Und das macht dir Freude?«
»Ja.«
»Warum?«
Während Tiffany darüber nachdachte, ließ ihr Vater sie nicht aus den Augen. »Weißt du noch, was Oma Weh immer gesagt hat?«, antwortete sie schließlich. »›Gib den Hungrigen zu essen, den Nackten was zum Anziehen, und sprich für die, die keine Stimme haben.‹ Meinst du nicht auch, dass in dieser Reihe noch Platz ist für: ›Bück dich für die, die den Rücken nicht mehr krumm machen können, reck dich für die, die sich nicht mehr strecken können, und wisch denen den Hintern ab, die sich nicht mehr umdrehen können.‹ Und manchmal erwischt man einen richtig guten Tag, der einen für die schlimmen Tage entschädigt, und dann kann man einen Augenblick lang hören, wie die Welt sich dreht. Anders kann ich es nicht erklären.«
Ihr Vater musterte sie mit einem Ausdruck von Stolz, gepaart mit Verständnislosigkeit. »Und dafür lohnt sich die ganze Plackerei?«
»Ja, Papa!«
»Alle Achtung, Jiggit. Was du da leistest, ist richtige Männerarbeit. «
Weil er sie bei dem Kosenamen genannt hatte, den nur ihre Familie kannte – gab sie ihm ein Küsschen. Dass man wohl lange hätte suchen müssen, um einen Mann zu finden, der sich für die Arbeit, die sie machte, nicht zu schade war, behielt sie taktvoll für sich.
»Wie soll es mit den Mickers jetzt weitergehen?«, fragte sie.
»Frau Micker und ihre Tochter können erst mal bei uns unterkommen, und …« Herr Weh hielt inne und warf ihr einen fast furchtsamen Blick zu. »Die Dinge sind nie so einfach, wie man denkt, mein Kind. Seth Micker war kein übler Kerl, als wir noch junge Burschen waren. Nicht gerade die hellste Leuchte, aber auf seine Art ganz in Ordnung. Sein Vater dagegen, der war wirklich nicht ganz richtig im Kopf. Natürlich war man damals nicht so zimperlich wie heute, und wer nicht gehorchte, konnte sich leicht eine Ohrfeige einfangen. Aber Seths Vater hatte einen schweren Ledergürtel mit zwei großen Schnallen. Damit hat er ihn schon verdroschen, wenn Seth ihn nur komisch angeguckt hat. Ungelogen. Er wollte ihm eine Lektion erteilen.«
»Was ihm ja anscheinend auch bestens gelungen ist«, sagte Tiffany, doch ihr Vater hob die Hand und fuhr fort.
»Und dann kam Molly. Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass Molly und Seth wie füreinander geschaffen waren. Eigentlich waren sie für niemanden so richtig geschaffen. Aber sie schienen halbwegs glücklich miteinander. Damals war Seth Schaftreiber, und manchmal musste er die Herden auch ganz bis in die große Stadt bringen. Das ist ein Beruf, für den man nicht besonders viel zwischen den Ohren zu haben braucht, und es ist durchaus möglich, dass das eine oder andere Schaf klüger war als er, aber es war eine Arbeit, die irgendeiner machen musste. Immerhin hat er sein Geld damit verdient, und keiner hat ihn deswegen scheel angeguckt. Das Dumme war bloß, dass er Molly oft wochenlang allein lassen musste, und …« Er sah sie verlegen an.
»Den Rest kann ich mir schon denken«, sprang Tiffany ihm bei, doch er überhörte sie geflissentlich.
»Nicht, dass sie ein liederliches Frauenzimmer gewesen wäre«, sagte er. »Sie wusste nur nicht, wo‘s langgeht, und es hat ihr auch keiner erklärt. Jedenfalls kamen damals alle naselang irgendwelche Fremden durchs Dorf. Fahrendes Volk und so. Richtig schneidige Burschen zum Teil.«
Es tat Tiffany in der Seele weh, mit anzusehen, wie er sich quälte, weil er seiner Tochter Dinge erzählen musste, über die sein kleines Mädchen doch eigentlich noch gar nicht Bescheid wissen sollte.
Sie drückte ihm noch einen Kuss auf die Wange. »Ich weiß, Papa, ich weiß es wirklich. Amber ist in Wahrheit gar nicht seine Tochter, richtig?«
»Das habe ich nicht gesagt. Aber möglich ist alles«, antwortete er gepresst.
Womöglich war genau das der springende Punkt, dachte Tiffany. Wenn Seth Micker Gewissheit gehabt hätte, so oder so, hätte er vielleicht besser damit umgehen können. Vielleicht. Ganz auszuschließen war es jedenfalls nicht.
Doch er hatte immer mit seinen Zweifeln leben müssen – an manchen Tagen von seiner Vaterschaft überzeugt, an anderen von den schlimmsten Verdächtigungen gepeinigt. Bei einem Mann wie Micker, für den »denken« ein Fremdwort war, konnte es nicht ausbleiben, dass sich die finsteren Gedanken in seinem Kopf verhedderten, bis sein Verstand völlig lahmgelegt war. Und wenn das Hirn nicht mehr weiterweiß, tritt die Faust in Aktion.
Ihr Vater betrachtete sie forschend. »Du weißt wirklich, wovon ich rede?«, fragte er.
»Das kenne ich von meinen Hausbesuchen. So heißt das, was wir Hexen machen. Bitte begreif doch, Papa. Ich sehe die schrecklichsten Dinge, und die allerschrecklichsten sind die, die am normalsten sind. Die kleinen Geheimnisse hinter verschlossenen Türen, Papa. Gutes und Schlechtes, wovon ich dir lieber nichts erzähle. Aber das gehört eben zum Hexenberuf dazu! Man bekommt ein Gespür dafür.«
»Na, für unsereins ist das Leben nun auch nicht gerade ein Zuckerschlecken …«, sagte ihr Vater. »Früher zum Beispiel – «
»Da war diese alte Frau. Sie wohnte in der Nähe von Schnitte«, fiel Tiffany ihm ins Wort. »Sie ist gestorben, ganz friedlich eingeschlafen. An sich keine besonders schlimme Sache. Ihr Lebenslicht ist einfach erloschen. Aber sie lag zwei Monate in ihrem Bett, bevor irgendjemand etwas gemerkt hat. Die Leute aus Schnitte sind ein bisschen sonderbar. Das Schlimmste allerdings war, dass ihre Katzen nicht aus dem Haus konnten und angefangen haben, sie aufzufressen. Was der alten Frau vermutlich nicht einmal etwas ausgemacht hätte, so wie sie in ihre Katzen vernarrt war. Aber eine von ihnen hat dort Junge bekommen. Im Bett. Es war gar nicht leicht, ein neues Heim für sie zu finden. Dabei waren es reizende Kätzchen mit wunderschönen blauen Augen.«
»Äh«, krächzte ihr Vater. »Wenn du sagst ›im Bett‹, heißt das …?«
»In demselben Bett, in dem die alte Frau lag? Ja. Ich hatte schon öfter mit Toten zu tun. Beim ersten Mal wird einem noch übel, aber dann erkennt man, dass der Tod nur, na ja, Teil des Lebens ist. Wenn man ihn als einen Punkt auf einer langen Liste von Aufgaben sieht, die Schritt für Schritt abgearbeitet werden müssen, wird man leichter damit fertig. Manchmal kommen einem auch die Tränen, aber die gehören eben mit dazu.«
»Hat dir denn keiner geholfen?«
»Doch, doch. Ich habe ein paar Nachbarinnen zusammengetrommelt, die mir zur Hand gegangen sind, aber im Grunde hatte keiner etwas mit der alten Frau zu tun. So etwas kommt vor, dass jemand durch das Netz fällt.« Sie hielt inne. »Sag mal, Papa. Unsere alte Scheune steht doch immer noch leer, oder? Wäre es möglich, dass du sie für mich ausräumen und auf Vordermann bringen lässt?«
»Sicher«, antwortete ihr Vater. »Aber dürfte ich vielleicht fragen, wozu du sie brauchst?«
Wie höflich er sprach. Jetzt redete er mit der Hexe. »Mir schwebt da etwas vor«, sagte sie. »Und ich habe das Gefühl, dass ich die Scheune dafür gut gebrauchen kann. Bis jetzt ist es nur so eine vage Idee, aber es schadet ja trotzdem nicht, da drinnen mal auszumisten.«
»Gut, gut. Auf jeden Fall bin ich mächtig stolz auf dich, wenn ich sehe, wie du auf deinem Besen durch die Gegend zischst. So was nenne ich richtige Magie.«