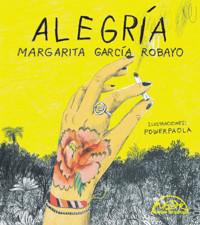19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Mutter wird per Post geliefert Fern ihrer Heimat versucht eine junge Kolumbianerin, Klarheit in ihr Leben zu bringen, in dem ein unzuverlässiger Geliebter, ein launischer Arbeitgeber, eine überforderte Freundin, misstrauische Nachbarn und eine diebische Katze kommen und gehen. Sie schreibt Texte für eine Werbeagentur und hofft auf ein Stipendium. Doch nichts ist sicher. Da fehlte gerade noch, dass ihre Mutter aus einem Paket springt und andauernd gute Ratschläge gibt. Ein hintergründiges Spiel beginnt: Ist die Mutter wirklich da oder ist sie nur eine Halluzination? In einer minutiösen eleganten Prosa, klar und genau, führt uns die Autorin durch das Labyrinth einer im Prekariat lebenden Generation. Beunruhigend und humorvoll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Eine junge Kolumbianerin schreibt Texte für eine Werbeagentur, zum Beispiel über das Glück von Kühen. Insgeheim hofft sie auf ein Literaturstipendium, das sie nach Europa führen soll. Doch nichts ist sicher. Da fehlte gerade noch, dass ihre Mutter aus einem Paket springt und gute Ratschläge gibt. Ein hintergründiges Spiel beginnt: Ist die Mutter wirklich da oder ist sie nur eine Halluzination?
In einer eleganten Prosa und mit subtilem Witz führt uns die Autorin durch das Labyrinth einer im Prekariat lebenden Generation. Die Mutter wünscht sich für ihre Tochter ein Aufstieg versprechendes, sicheres Leben, das es so nicht mehr gibt. Die Tochter lernt, sich in einem ständig wechselnden Raum zu bewegen und fragt sich, wie man in diesem Raum jemals selbst Mutter werden kann. Beunruhigend und humorvoll.
Margarita Carcía Robayo
Das Paket
Roman
Aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz Robayo,
Erst war es wie das Eindringen einer Fliege im Winter.
So seltsam. Die Augen folgen der Flugbahn.
Das Ohr will das Summen vernehmen.
Die Fliege setzt sich auf den Tisch
auf die Glühbirne. Verwirrend.
ESTELA FIGUEROA, Die Fliege
Diese Geschichte
ist ein wenig besonders
aber so ist sie eben.
Es ist unsere Geschichte.
Und wenn ich sie dir erzählt habe
ist es auch deine
für immer.
GERMANO ZULLO und ALBERTINE, Mein Kleiner
1
Meine Schwester schickt mir gern Pakete. Das ist albern, denn wir leben so weit auseinander, dass die meisten Sachen auf dem Weg Schaden nehmen. Weit ist ein zu kurzes Wort, wenn man es ins Geographische übersetzt: Fünftausenddreihundert Kilometer trennen mich von meiner Familie. Meine Familie, das ist sie. Und meine Mutter, aber zu der habe ich keinerlei Kontakt. Meine Schwester anscheinend auch nicht. Sie erwähnt sie seit Jahren kaum noch, obwohl ich annehme, dass sie sich weiterhin um ihre Angelegenheiten kümmert. Manchmal wüsste ich gern, was aus dem Haus geworden ist, in dem wir als Kinder gelebt haben, aber ich frage nicht nach, weil die Antwort mir Informationen liefern könnte, auf die ich lieber verzichte.
Das Haus lag in einem Fischerdorf abseits der Stadt, ein Sandkeil, der wie ein Fangzahn ins Meer drang. Das Grundstück war groß und das Haus klein, es stand oben auf einem Hang, abfallend zu einem oft wilden Meer, das Rochen ausspuckte und Muränen gegen die Felsbrocken am Ufer warf. Meine nachhaltigste Erinnerung an dieses Haus ist die an einen Abend, an dem meine Mutter weggegangen und sehr lange nicht zurückgekommen war. Ich muss damals fünf Jahre alt gewesen sein und meine Schwester zehn. Eusebio, der Hausmeister, brachte sie im Morgengrauen zurück. Er sagte, sie sei auf der Landstraße unterwegs gewesen. Die Entschuldigung meiner Mutter war, sie sei hinausgegangen, um Luft zu schöpfen, und dabei hätte sie die Zeit vergessen. Solange ich mich erinnern kann, hat meine Mutter Luft gebraucht: Ich sehe sie, wie sie im Haus Fenster und Türen aufreißt und sich mit energischen, unkontrollierten Bewegungen Luft zuwedelt. Ich hatte immer die Vorstellung, dass ihr Körper einen Schwarm Vögel beherbergte, die flügelschlagend nach draußen drängten und dabei ihr Inneres zerkratzten. Und deshalb weinte sie. Und wenn man zu ihr ging, um sie zu trösten, was genau genommen darin bestand, sich mit furchtsamem Blick langsam anzuschleichen, dann entwischte sie wie eine Eidechse und sperrte sich im Bad ein.
Mit meiner Schwester telefoniere ich alle zwei Wochen. Und an den Geburtstagen. Sie ist so feinfühlig, mich anzurufen, wenn ein Orkan in der Karibik wütet – was ich nur selten mitbekomme –, um mir Bescheid zu geben, dass nicht einmal ein Hauch davon sie erreicht hat. Wir führen wohlmeinende, kurze Gespräche. Zum Schluss kündigt sie immer an, dass sie gerade ein Paket für mich zusammenstellt, zählt genau den Inhalt auf und zeigt mir die Zeichnungen, die meine Neffen beilegen werden, darauf immer ich mit enormen Lippen, geblümten Kleidern, goldenen Capes, Kronen und auffälligen Texas-Boots, die ich nie gehabt habe, auch nicht tragen würde. Manchmal sagt sie, diesmal käme »eine kleine Überraschung«, und dann legt sie eins der vielen Fotos aus unserer Kindheit dazu, die sie aus ihren nach Jahren geordneten Alben nimmt. Es betrübt mich, dass weder die Fotos noch die Zeichnungen heil ankommen, weil sie alles in denselben Karton steckt, die Früchte auf der Reise durch die Tüten suppen und das Papier nass wird. Je nach Papiersorte halten sich einige Fotos besser und lösen sich nicht ganz auf, dennoch lässt der Saft unsere Gesichter verschwimmen und gibt uns etwas Gespensterhaftes.
Daher erhalte ich gewöhnlich Pakete, die, von außen perfekt verpackt, mit verdorbenen Lebensmitteln vollgestopft sind.
Ich erlaube meiner Schwester, mir Pakete zu schicken, weil diese abzulehnen eine Erklärung erfordert, die sie mir übel nähme und die ihr bestätigen würde, dass mich die Ferne zu einer missmutigen Person gemacht hat. Nach Jahren der Abwesenheit besteht die sicherste Strategie zur Erhaltung der Harmonie in unserer wechselhaften Beziehung darin, so zu tun, als gäbe es zwischen ihr und mir keine größeren Unterschiede. Es geht darum, uns zu neutralisieren. Das setzt auf beiden Seiten eine beachtliche Anstrengung voraus. Ich weiß, wie schwer es ihr fällt vorzutäuschen, mein Leben als Emigrantin sei für sie etwas ganz Normales und nicht eine Extravaganz, ein Exzess an Exzentrik. Und ich muss unaufgeregt damit zurechtkommen, dass Vakuumverpackungen für verderbliche Waren nicht der Weisheit letzter Schluss sind.
»Damit kannst du rechnen«, sagt sie jetzt vom Computerbildschirm aus.
Heute stand kein Gespräch an, aber ich habe sie angerufen, ich brauche ihre Hilfe, um ein Dokument für ein Stipendium zu beantragen. »Noch ein Stipendium?«, war ihre erste, eher laue Regung. »Aber in Holland«, erklärte ich: »in der Ersten Welt.« »Ich gratuliere!« Das war die erwartbare Reaktion, die ich jetzt herunterdimmen musste: »Aber ich habe es noch nicht bekommen.« Sie darauf: »Doch du wirst es bekommen.«
Noch habe ich nicht erklärt, was genau sie beantragen muss, schon kommt ihre Antwort, ja sicher, ganz selbstverständlich, sie werde sich sofort darum kümmern. So wie andere Male auch zeigt sie sich entschlossen, mir einen Gefallen zu erweisen, den sie dann später vergisst. Ein Teil ihrer Rolle der großen Schwester besteht darin, mir diese enthusiastische, aber luftige Sicherheit zu vermitteln.
Jedes Mal, wenn wir miteinander reden, verfestigen sich meine Vorstellungen darüber, zu welchen Trugschlüssen Verwandtschaft verleitet. Mit jedem Anruf gewinnt meine Theorie an Umfang, dieweil sie an Klarheit verliert. Mein Kopf – so male ich mir das aus – beherbergt lange Würmer, die gegen die Schädelwände stoßen; die langsam und unmäßig wachsen; die sich einrollen, um immer mehr Platz zu beanspruchen. Ich habe sie über Jahre dort geduldet, mir dabei gewünscht, die Zeit möge über sie hinwegwalzen und sie zerquetschen. Doch die Zeit war nichts anderes als ein Ferment. Eines Tages werden sich die Würmer wie bei der Medusa aus meiner Kopfhaut schlängeln.
»… und ein paar von den Kokoskugeln, die du so gern magst«, sagt meine Schwester und beendet damit eine Aufzählung, der ich nicht aufmerksam gefolgt bin. Es ist das Inventar des letzten Pakets, das sie für mich zusammengestellt hat und das bald ankommen muss. Seit dem vorherigen ist noch kein Monat vergangen, was ungewöhnlich ist, aber ich möchte sie nicht mit der Frage, warum so eilig, unterbrechen, weil das Gespräch sonst zu lang würde.
Meine Theorie besagt, dass allein schon das Wissen um die Verwandtschaftsbande die Menschen davon überzeugt, dass Verwandtschaft ein unerschöpfliches Hilfsmittel ist, das für alles taugt: gegnerische Schicksale zu versöhnen, den Willen zu beugen, Rebellionswünsche zu bekämpfen, Lügen in Erinnerungen zu verwandeln und umgekehrt; oder aber dazu, ein belangloses Gespräch zu führen. Aber Verwandtschaft reicht nicht aus, im Gegenteil. Sie ist ein unsichtbares Band, man muss es sich ständig vergegenwärtigen, um nicht zu vergessen, dass es da ist. Die letzten Male, als ich meine Schwester sah, wiederholte ich im Stillen: »Wir sind Schwestern, wir sind Schwestern«, wie jemand, der sich ein mysteriöses Geschehen nur mit Hilfe des Glaubens erklären kann. Was anderes ist, mit den Verwandten zusammenzuleben – denke ich jedes Mal, wenn ich sie mit ihrer Familie sehe –, sich jeden Tag in den Gesichtern und Gesten anderer Menschen zu entdecken, die mit dir altern und wie Sporen deine genetische Information reproduzieren. Wenn meine Schwester ihren ältesten Sohn ansieht – er gleicht ihr wie ein Ei dem anderen –, kann ich die Genugtuung und Erleichterung in ihren Augen sehen: In deinem Gesicht werde ich auf immer leben. Vielleicht ist das gegenseitige Verstehen auch bei diesen beiden nicht so einfach oder selbstverständlich, aber es kommt viel schneller zu einem Einvernehmen.
Jetzt runzelt meine Schwester die Stirn, und ihr Blick schweift ab, ein Hinweis, dass sie überlegt, wie sie das Schlagloch, in dem das Gespräch hängengeblieben ist, auffüllen soll. Das ist ein Bemühen, das mich mit Schrecken erfüllt. Danach folgt der Schwindel, der Absturz ins banale Schwätzchen. Und darin bin ich nicht gut. Ich bin sogar schlecht darin, nicht weil es mir an Geschick fehlte – mit anderen kann ich stundenlang banale Gespräche führen –, sondern ich meine schlecht im Sinne von boshaft. Bei Banalität kenne ich nur ein Gegengift, die Boshaftigkeit. Ich habe nie gelernt, barmherzig mit meiner Familie zu sein.
Zuweilen fühlt es sich so an, als ob zwei Personen in mir lebten, eine davon (die Gute) hält die andere unter Kontrolle, manchmal aber wird sie müde, ihre Wachsamkeit lässt nach, und dann schleicht sich die andere (die Bösartige) ein, die ganz scharf darauf ist, ihr Gegenüber zu verletzen.
Vor einigen Jahren bin ich für die Passerneuerung ein paar Tage in meine Heimat zurückgekehrt. Meine Schwester hatte mich eingeladen, bei ihr und ihrer Familie zu wohnen. Da sie und ihr Mann arbeiteten und das Kind – damals war es nur eines – im Kindergarten war, blieb ich ziemlich allein in ihrer Wohnung zurück. Sie hatten mir das Kinderzimmer überlassen, ich schlief in einem niedrigen kleinen Bett mit Laken der Power Rangers. Wollte ich mich im Schrankspiegel sehen, musste ich mich bücken. Ich ging dann ins Esszimmer, goss mir einen Tee auf und setzte mich zum Schreiben hin. Manchmal machte ich eine Pause, um herumzuschnüffeln. Es gab nichts Auffallendes, meine Schwester war ein offensichtlicher Mensch. Ihr einziges Geheimnis war ein in ihrem Schrank verstecktes Foto meines Vaters. Ich kannte das Foto. Als ich das Land wechselte, hatte sie gesagt, wenn ich wolle, könne ich es mitnehmen. »Nein, danke, bei dir ist es besser aufgehoben«, sagte ich. Aber warum war das ein Geheimnis? Weil ihr Sohn eine Version der Familiengeschichte kannte, die keinen Großvater mütterlicherseits vorsah. Weder tot noch lebendig noch sonst was. Als ich sie fragte, warum sie das mache – ihre Genealogie auf so willkürliche Weise aufzustellen –, sagte sie: »Es ist kompliziert.«
In dem Wandschrank hingen auch ihre kompletten Garnituren auf Massivholzbügeln. Sie sollten das Gewicht des jeweiligen Arrangements aushalten, zu dem auch die Schuhe gehörten, die in einem Stoffbeutel mit Henkeln am Haken des Bügels hingen. Ich fragte mich, wann sie sich für eine der Garnituren entschied, ob sie die einzelnen zuweilen mischte oder ob diese unabänderlich waren. Auf ihrem Nachttisch lagen Zeitschriften, bei denen sie einzelne Seiten markiert hatte, die sie wahrscheinlich lesen oder wieder lesen wollte. Meistens ging es um Tipps, wie Vorzüge des Körpers betont und kleine Mängel überspielt werden konnten. Also mehr oder weniger um das, was sie schon seit der Pubertät interessierte. Dies und die Tatsache, dass sie in eben dem Viertel, in dem wir aufgewachsen waren, wohnte, machte ihre Wohnung für mich zur Tür in die Vergangenheit.
Wenn sie heimkamen, begab sich ihr Mann – der sich damit brüstete, ein guter Koch zu sein – in die Küche, und sie badete das Kind. Ich wollte helfen, wusste aber nicht, wie ich mich in eine abgestimmte Familie und ihre Routinen einfügen sollte. Also verlegte ich mich auf Einfaches, deckte den Tisch und erzählte meinem Neffen Geschichten, bis einer von uns beiden zu gähnen begann – meistens ich. Später setzte ich mich zu meiner Schwester, wir tranken einen Kräutertee, und ich hörte zu, wenn sie irritierend detailreich von ihrem Arbeitstag erzählte. Zu dem Zeitpunkt war meine Tante Vicky schon fast ein Jahr tot, aber meine Schwester war immer noch böse, nicht auf den Tod, das Leben oder auf Gott – »der sie so früh geholt hat« –, sondern auf die globale Erwärmung, auf die giftigen Abfälle, auf die Labore, die Viren fabrizierten, die Strahlung der Antennen im öffentlichen Raum und auf alles, was sonst noch unsere Zellen schädigen könnte. Unser gemeinsamer Alltag war eine Fiktion, aber in den ersten Tagen funktionierte er, fühlte sich momentweise sogar angenehm an. Ich machte es mir zur Gewohnheit, Mini-Jet-Schokolädchen zu kaufen, die ich dann an Orten versteckte, von denen ich wusste, dass die Familie sie leicht finden konnte. Jedes Mal gaben sie sich überrascht, wir alle taten so, als wüssten wir nicht, woher sie kamen, und mein Neffe brach in ein nervöses Lachen aus, ein panisches Gegacker, das kaum zu kontrollieren war. Nicht einmal dann verrieten wir uns, wir ließen ihn glauben, ein Heinzelmännchen käme ins Haus und brächte uns Süßigkeiten. Nach etwa zehn Tagen Aufenthalt tauchte jedoch die andere, die Bösartige, auf. Ich gab mich vornehm, sagte Albernheiten, die Nase hoch, wie jemand, der einen feineren Geruchssinn hat: »Wo kommt nur diese ordinäre Angewohnheit her, Käse auf den Fisch zu geben?«, schleuderte ich eines Abends heraus und verdrehte angeekelt die Augen. Mein Neffe begriff genug, um den Teller mit dem in Cheddar ertrunkenen Snook-Filet, das ihm sein Papa aufgetan hatte, unberührt stehen zu lassen. Ich tarnte meine Grobheiten mit Alkohol, sodass bei einer späteren Betrachtung jemand hätte sagen können: »Die Arme, sie verträgt einfach nichts.« Ein wenig davon stimmte. Je mehr ich trank, desto stärker verlor der Abend an Glanz, und mein Bedürfnis nahm zu, auf die uns einhüllende Trübseligkeit hinzuweisen. Am Abschiedsabend erhöhte ich nochmal den Einsatz: »Sahnige Gerichte sind ein Ausweis von Unfähigkeit«, sagte ich, kaum hatte ich die zweite Dose Bier geöffnet, »ein guter Koch pisst lieber auf sein Gericht, als es in Sahne zu baden.« Worauf meine Schwester zum Mülleimer stürzte und die Biskuitrolle mit Huhn und Bechamelsauce hineinwarf, mit der sie mich hatte überraschen wollen. Als Nächstes hob sie den Telefonhörer und bestellte eine Pizza.
Wusste ich, dass meine Schwester den Nachmittag damit verbracht hatte, Eier zu schlagen, Paprika einzulegen, Knoblauchzehen zu bräunen und weitere spezielle, allein mir gewidmete Tätigkeiten auszuführen? Klar wusste ich das. Wusste ich, dass wahre Vornehmheit eine Mischung aus Bescheidenheit und Feingefühl ist? Das wusste ich nicht. Und die Tatsache, dass meine Schwester nichts erwidert hatte, wies darauf hin, dass sie es wusste. Ihre innere Größe erdrückte mich. Morgens dann, das Taxi vor der Tür, der Koffer in der Hand, die Füße in einen in der Straße wabernden, höchst seltsamen Nebel getaucht, bat ich um Verzeihung. Aber ich sagte es ganz leise, an niemanden gerichtet – die Worte verflüchtigten sich. Ich beugte mich zur Heckscheibe und sah sie, während ich mich entfernte: ein großes kleines Mädchen, das darauf wartete, dass die Eltern sie abholen. Ein Bild der Verlassenheit. Und ich eine Flüchtende. Ich weinte die restliche Taxifahrt über, und ich weinte im Flugzeug, bis eine Stewardess mir einen Whiskey brachte, mit dem ich ein Schlafmittel runterspülte.
Nun höre ich ihr eben still zu und gebe ihr in Gedanken Antworten, die meinen Verdruss anheizen, statt ihn zu besänftigen. Nun höre ich ihr zu und pflichte ihr fügsam bei, während ich das verärgerte Geschöpf in mir, das sich mit den Zähnen die blutigen Nagelhäute abreißt, zu zügeln suche.
Jede halbwegs vernünftige Person würde es verdächtig finden, dass mich weiterhin so unbedeutende Dinge irritieren wie ihr übermäßiges Gestikulieren oder dieses kleine, aber stetige Hüsteln, weswegen sie Sätze unterbricht, um sich mit einer Art Knurren freizuräuspern. Einmal habe ich versucht, das alles meiner Freundin Marah zu erzählen, die nachdenklich wurde und dann meinte:
»Vielleicht bedeutet Erwachsenwerden, eine solche Irritation in Zärtlichkeit umzuwandeln.«
»Aha.«
»Das kennst du doch, wenn man rührend« sagt, aber nicht sarkastisch, sondern in einem ergebenen Tonfall.«
»Ja?«
»Ok, das ist ein Zeichen, dass man gewachsen ist.«
Für Marah war ich also nicht gewachsen. Ich litt an emotionalem Zwergwuchs.
»Vielleicht auch nicht«, erwiderte ich. »Vielleicht gründet die Irritation noch auf etwas anderem, das ich aus Trägheit lieber übergehe.«
»Aus Trägheit?«
»Ja, ich bin zu träge, um das auseinanderzufieseln.«
»Warum denn?«
»Weil es zu lange dauert, ewig dauert, und im Allgemeinen nicht viel dabei herauskommt.«
»Und was wäre dann deine Lösung?«, fragte Marah.
»Mich entziehen«. Das klang nicht spontan, vielmehr so, als hätte ich an dieser Antwort herumgekaut wie an meinen Nägeln: »Die Last abwerfen und mich befreien.«
Eben das tu ich jetzt. Ich lass mich durch die Glastür gehen, die auf die Terrasse führt und von diesem Winkel den Blick freigibt auf eine mehrere Häuserblocks entfernte Baustelle, deren karierte, hohle Konstruktion Himmelsstückchen birgt. Aus dieser Entfernung sieht sie wie ein Bild aus. Der Bau steht seit Monaten still. Das Betonskelett ist errichtet, Böden und Decken sind fertiggestellt, aber bis zu den Fensteröffnungen hat es nicht gereicht. Es sollte ein Bürogebäude werden, fünfzig Stockwerke aus Glas und Beton mit einem dieser Panorama-Aufzüge, aus denen immer mal wieder jemand mit Schwindelanfällen herausgeholt werden muss. Oder mit Panikattacken. Oder jemand, der sich vollgekotzt hat.
Die Falte auf der Stirn meiner Schwester schwindet.
»Ist es sehr heiß bei euch?« fragt sie.
»Nein, wir haben jetzt Herbst.«
»Wie schön, wie in den Filmen.«
Welchen Filmen?
»Aber die Sonne ist brutal«, sage ich.
Das stimmt. Durch die Fensterhöhlen des grauen Gebäudes brennt brüllend brutal die Sonne.
»Hier auch, du weißt ja, der ewige Sommer«, lacht sie lustlos.
Sommer. Schwierig, ihn ohne sein Gegenteil zu denken. Das ganze Jahr übermäßige Hitze bedeutet nicht Sommer.
»Nun ja, Sommer ist auch schön, oder etwa nicht?«, sagt sie.
Sommer bedeutet erneutes Keimen von etwas, das abgestorben war. Ohne Tod kein Leben, möchte ich ihr sagen. Die kranken Blätter sterben zuerst, und das ist gut für sie, denn dann schlagen sie früher wieder aus, bevor die große Hitze beginnt. Die gesündesten halten durch, überstehen die Jahreszeit, bleiben lebendig in einem Klima, das sie verletzt. Mehr Leben, mehr Leiden. Sie sind Märtyrer.
»Ich weiß nicht, ob ich den Sommer mag«. Ich nehme an, dass sie so etwas von mir erwartet, um mir eine beruhigende Antwort geben zu können.
»Ein Glück. Denn hier hättest du keine Wahl.«
Nicht immer füllt meine Schwester Gesprächslücken auf die gleiche Weise. Ich muss zugeben, dass ihr da mehr einfällt als mir. Manchmal, wenn sie merkt, dass wir schon eine Weile schweigen und in die Ferne schauen, wendet sie eine, wie mir scheint, weise Strategie an. Sie erzählt mir Geschichten von Menschen, die ich nicht persönlich, aber aus ihren sich wiederholenden Erzählungen kenne, weshalb es mir leichtfällt, sie einzuordnen und auf willkürliche Fragen vernünftige Antworten zu geben.
Rat mal, was Maria Elvira sich geleistet hat?/Sie hat sich bei dir Geld geliehen und es nicht zurückgegeben./Du bist eine Hexe, weißt du das?
Du ahnst nicht, was Lucho passiert ist?/Lucho? Welcher Lucho?/Onkel Lucho./Er hat sich betrunken und ist ausgeraubt worden./Ganz genau!
Kannst du dich an den Sohn von Patricia Piñeres erinnern?/Glaub schon./Nun …/Er ist schwul./Eben das.
Meine Schwägerin Melissa hat ihren Job aufgegeben./Warum denn das? Ist sie wieder schwanger?/Heilige Jungfrau! Wie errätst du das?
Aber heute erzählt meine Schwester nichts von niemandem. Wenn sie mein Schweigen bemerkt, schweigt auch sie und seufzt. Ich nehme an, sie ist ebenfalls die Last der Verständnislosigkeit leid; vermutlich bin ich für sie nicht nur eine unnahbare, unglückliche und unzufriedene Schwester, sondern eine hochmütige Frau. Auch ihr ist die Verwandtschaft allein nicht genug, natürlich nicht. In einem Fall wie dem unseren ist Sich-gut-Verstehen nicht eine Frage der Magie, der Chemie oder der Wesensverwandtschaft, sondern eine der Zähigkeit, der Sturheit und der mühseligen Arbeit.
Mich zu entziehen besteht manchmal darin, mir ein schwarzes Loch im Denken vorzustellen, durch das ich knifflige Aufzählungen oder Worte, die sich in Form und Bedeutung ähneln, wirbele. Wie auch immer, Flucht ist ein dummes Spiel, das mir aber hilft, den Fokus der Aufmerksamkeit zu verschieben.
»Also, das Paket wird demnächst bei dir ankommen«, sagt sie als Einleitung zum Abschluss.
Jetzt schaue ich auf ihre Kleidung: förmlicher als an anderen Tagen, alles in Beigetönen, als habe sie sich für eine Taufe zurechtgemacht. Ihr Haar ist geglättet, heller im Ton als das letzte Mal, ohne sichtbare Haarwurzeln. Es ist ein Wunder, dass sie immer noch Haare auf dem Kopf hat, nachdem sie so viele Jahre diese Glättungstinktur benutzt hatte, und zwar so konstant, dass meine Tante Vicky ihr, Aloe-Kompressen auflegen musste, um die gereizte Kopfhaut zu kurieren. Meine Schwester ist so weiß wie eine Eiweiß-Meringe, aber ihr Haar ist hart und dicht gekräuselt, was, wie meine Großmutter zu sagen pflegte, das einzige wahre Bestimmungsmerkmal für afrikanische Wurzeln sei. Einen Großteil ihrer Jugend hat sie damit verbracht, dieses Merkmal auszumerzen, selbst um den Preis, ihren Kopf zu martern.
»Gehst du irgendwohin?«, frage ich.
Kein Lärm um sie herum, also vermute ich, dass weder die Kinder noch ihr Mann noch dieser lästige Köter, der bei jedem Schritt Haare verliert, im Haus sind. Es ist Samstag, und meistens wuseln da alle rum, kreischen wie Zikaden aus den Winkeln.
»Aufs Schiff.«
»Wohin?«
»Ich hab dir davon erzählt, wir machen eine Kreuzfahrt.« Und dass sie sich so freuen, weil es für die Kinder jede Menge Programm gibt, sagt sie; ein Kino mit einem monster screen; ein Wellenbad und normale Pools; Küchenchefs aus aller Welt; Yoga-Kurse; einen Hammer-Spa; Marken-Boutiquen; zwei Galaveranstaltungen …
»Und der Hund?«
»Der bleibt bei den Nachbarn, wird gerade hingebracht.«
»Ihr brecht schon auf?«
»Das Schiff legt in zwei Stunden ab, aber wir müssen ja noch zum Hafen.«
»Aha.«
»Dann pass gut auf dich auf.« Sie nähert sich dem Bildschirm und schickt einen geräuschvollen Kuss.
»Gute Reise«, sage ich, aber ihr Gesicht ist verschwunden. Ich sehe nur noch meines, das sich auf dem Bildschirm spiegelt, diese unzufriedene Miene, immer wenn ich fühle, dass mir etwas entgangen ist.
Wohin geht die Kreuzfahrt? Wann hat sie die geplant? War es ein plötzlicher Entschluss? Der Preis von einem Gewinnspiel?
Ich denke an das Dokument, an die Eingabe, die Dringlichkeit meines Anrufs.
Marah hätte mir gesagt, dass es vielleicht nicht ganz so dringlich sei.
Warum das?
Wollte ich wirklich nach Holland?
Ja, ich wollte.
Wozu?
Zum Schreiben.
Und was machte ich hier?
Dasselbe, aber unter Qualen.
Und dieser Typ, mit dem ich seit, seit wann?, seit zwei oder drei Monaten? zusammen war, komme ich da nicht ein wenig ins Zweifeln?
Nein.
Kein bisschen?
Nein.
Nein?
2
Ich wohne im siebten Stock, die Aussicht wird zum Teil von Baumkronen und ein paar modernen Hochhäusern verstellt, die unlängst in der Nachbarschaft gebaut wurden. Schräg gegenüber steht ein Gebäude mit Lofts in doppelter Raumhöhe, die Außenfassaden aus Stahl und Glas. Die Lofts sind teuer, prätentiös und winzig. Von meiner Wohnung aus kann ich alles sehen, was in der einzigen zur Seite hin gelegenen Einheit passiert, der von dem Pärchen mit Baby. Heute sind sie nicht zu Hause. Gestern Abend haben sie sich mit ein paar Stofftaschen und dem zusammengeklappten Kinderwagen aufgemacht und wie gewöhnlich eine Lampe brennen lassen, um wer weiß wen hinters Licht zu führen. »Vielleicht tun sie das, um bei der Rückkehr nicht ins Stolpern zu geraten«, hatte Axel gesagt, während wir sie von unserer Terrasse aus verschwinden sahen. Wir saßen auf zwei Plastikstühlen, fern von der Brüstung, weil er Höhenangst hat. Gestern Abend war Axel zum dritten Mal bei mir. Meistens gehen wir in seine Wohnung, die besser ausgestattet ist und keinen Balkon hat.
Ich mag es nicht, wenn die Nachbarn weggehen. Das zwingt mich dazu, in andere Fenster zu gucken, in denen nur Verschwommenes zu sehen ist. Auch sie gehen, glaube ich, nicht gerne weg, bei der Rückkehr wirken sie meist übellaunig. Das Baby wandert von den Armen des einen in die der anderen, und es weint, weil es die Unruhe der Eltern spürt. Die wiederum sind verstört von seinem Weinen: Hastig wiegen sie es, wirken sehr bleich, man könnte denken, sie fallen gleich um, bis sich das Baby dann beruhigt hat und sie wieder Sauerstoff bekommen. Ich weiß nicht, wie sie das innere Gleichgewicht wiedererlangen, das ihnen bei jeder dieser Episoden abhanden zu kommen scheint. Als würden sie von einer Wolke Stechmücken angefallen.
Jetzt stütze ich mich auf die Balkonbrüstung. Mir wird nicht schwindlig, im Gegenteil, in die Tiefe zu sehen macht mich ruhig. Unten fegt der Portier vor dem Eingang des Gebäudes. Er hat einen braunen Strickpulli an, mit dem er von oben wie eins dieser runden, übelriechenden Dinger aussieht. Blattwanzen, so nennt man sie. Er schaut nach oben, kneift die Augen wegen des hell strahlenden Himmels zusammen und entdeckt mich, die ihm zuschaut. Ich grüße, er stützt sich auf den Besen und grüßt zurück. Langsam, aber stetig fällt ein Regen vergilbter Blätter. Ich warte darauf, dass er sich umdreht und wieder an seine Arbeit geht. Máximo, so heißt der Portier, kann den ganzen Tag fegend verbringen. Und bei dieser Tätigkeit staut sich in seinem Magen die Bitternis. Eine Art von Verbitterung, die dich auf die Dauer dazu bringt, einen Stock zu packen und deine Wut an einem Hund oder einem alten Mann auszulassen.
Die Sonne dringt durch das Laub, und ich verlasse die Terrasse.
Der Wetterbericht kündigt für das ganze Wochenende Regen an, dabei deutet bislang nichts darauf hin. Mich zieht es nicht raus. Ich werde mit einer Dose Thunfisch und einem Apfel auskommen und den ganzen Nachmittag an dem Projekt für das Stipendium schreiben. In zehn Tagen muss es abgeschickt sein.
Ich drehe ein paar träge Runden durch die Wohnung: Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Wenn meine Schritte Spuren auf dem Boden hinterließen, wäre die Zeichnung meines Laufs ein U mit enger Öffnung. Auch meine Wohnung ist winzig, aber auf eine proletarischere Weise als die gegenüber. Ich bemühe mich, sie frei von jeglichem dekorativen Schnickschnack zu halten, denn wenn ich mich da gehen lasse, befürchte ich, einen provinziellen Geschmack zu offenbaren, den ich rundum ablehne, obwohl ich im Grunde weiß, dass ich ihn habe und ich sehr schnell hineinfallen kann. Darum versuche ich, die Wohnung sauber und gepflegt zu halten, und bevorzuge Funktionales, das mehrheitlich in der Küche anzutreffen ist. Meine Ignoranz verkleide ich als Minimalismus.
Dem Hang zum Kargen entgeht in diesem Umkreis allein der das Wohn-Esszimmer beherrschende Chesterfield-Diwan. Der Chesterfield dient mir als Sofa für die Besucher, als Chaiselongue für die Siesta, als Schreibtisch und Esstisch. Ich habe ihn auf einem Hausflohmarkt im Anwesen einer verstorbenen reichen alten Frau gekauft. Der Flohmarkt war in einem von mir abonnierten Newsletter angekündigt; dann und wann bekam ich Benachrichtigungen über Verkaufstage, zu denen ich nie ging. Immer war das, was mir gefiel, zu teuer und das, was ich mir leisten konnte, schmerzhaft, führte es mir doch meine prekäre Lage vor Augen. Diesen Flohmarkt suchte ich auf, weil die verstorbene Greisin so hieß wie ich, ein Zufall, der mich überzeugt hatte, auch wenn er nicht ganz so zufällig war, denn mein Name ist, zumindest in dieser Stadt, ein altmodischer Name. Als ich ankam, war der Diwan bereits verkauft, wie mir die Organisatorin beschied, sie schüttelte entschieden ihre roten Locken und wollte mich sogleich mit einem schwarz angelaufenen Silberbesteck trösten. Dann tauchte der Sohn der Verstorbenen auf, der leicht retardiert war, weshalb niemand auf ihn achtete, wenn er den Ramsch anpries, der auf dem Gartentisch ausgelegt war – auf diesen Bereich hatte ihn die grausame Frau mit den roten Haaren verbannt. Es war jedenfalls so, dass dieser Mensch die Enttäuschung, die mir ins Gesicht geschrieben stand, nicht ertragen konnte, mich daher nach draußen führte,