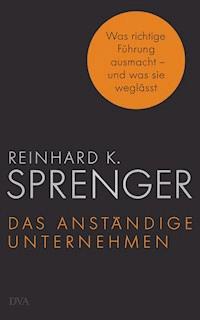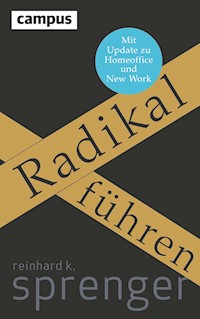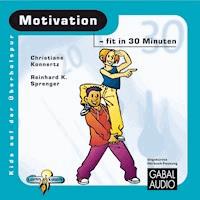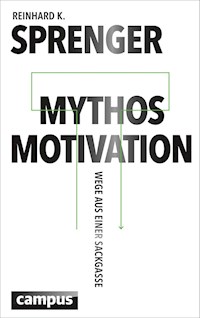Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eigeninitiative ist gefragt – das gilt nicht nur für das Privatleben, sondern auch für den Job. Deutschlands meistgelesener Managementautor Reinhard K. Sprenger zeigt, was Manager tun können, damit ihre Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, initiativ werden und Kreativität und Leistungsfreude entfalten. Anhand vieler Beispiele beschreibt Sprenger, was Selbstverantwortung ist und wie Führungskräfte sie fördern können: indem sie ihre Überzuständigkeit angemessen reduzieren und Mitarbeiter in der Verantwortung lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reinhard K. Sprenger
Das Prinzip Selbstverantwortung
Wege zur Motivation
Mit Karikaturen von Thomas Plaßmann
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Eigeninitiative ist gefragt – das gilt nicht nur für das Privatleben, sondern auch für den Job. In dieser aktualisierten Neuausgabe zeigt Reinhard K. Sprenger, was Sie als Führungskraft tun können, damit Ihre Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und initiativ werden.
Anhand zahlreicher Beispiele beschreibt Sprenger, was Selbstverantwortung ist und wie Sie Ihre Mitarbeiter aus der Defensive holen: indem Sie Überzuständigkeit überlegt und angemessen reduzieren und Mitarbeiter in der Verantwortung lassen.
»Deutschlands einziger Management-Guru, der diesen Titel wirklich verdient.« – Financial Times Deutschland
»Deutschlands Management-Autor Nr. 1« – Handelsblatt
Über den Autor
Dr. Reinhard K. Sprenger, promovierter Philosoph, gilt als der profilierteste Managementberater und Führungsexperte Deutschlands. Darüber hinaus ist er als kritischer Denker bekannt, der nachdrücklich zu neuem Denken und Handeln auffordert. Mit seinen mittlerweile zu Klassikern avancierten Büchern Mythos Motivation, Das Prinzip Selbstverantwortung, Vertrauen führt und Radikal führen veränderte er die Managementwelt.
Man gibt immer den Verhältnissen die Schuld für das,
was man ist. Ich glaube nicht an die Verhältnisse.
Diejenigen, die in der Welt vorankommen,
gehen hin und suchen sich die Verhältnisse,
die sie wollen, und wenn sie sie nicht finden können,
schaffen sie sie selbst.
George Bernard Shaw
Inhalt
Einleitung
Organisierte Unverantwortlichkeit
Philosophisches Hauptstück
Wählen
Wollen
Antworten
Pragmatisches Hauptstück
Abschied vom Leithammel
Vorgesetzte, Führungskräfte
Führen zur Selbstverantwortung
Freundliche Feler
Wie verändern?
Commitment für Vereinbarungen
Die Krise der Glaubwürdigkeit
Epilog
Danksagung
Literatur
Einleitung
Ein Rechen-Exempel
»Ich ging eines Tages über den Kundenparkplatz eines unserer Kaufhäuser und sah einen Gartenarbeiter damit beschäftigt, Laub zusammenzufegen. Er benutzte dazu einen Rechen, der noch etwa 15 Zähne hatte – normalerweise hat ein solcher Rechen etwa 30 Zähne. Ich fragte ihn: ›Warum benutzen Sie diesen alten Rechen? Sie kommen damit doch kaum vorwärts!‹ – ›Man hat mir diesen Rechen gegeben‹, antwortete der Gartenarbeiter in aller Ruhe. ›Warum haben Sie sich denn nicht einen besseren Rechen genommen?‹ beharrte ich. ›Das ist nicht meine Aufgabe‹, antwortete er. Ich dachte: ›Wie kann man einem Mitarbeiter nur solch ein schlechtes Werkzeug geben? Ich werde seinen Gruppenleiter ausfindig machen und mit ihm sprechen. Sein Job ist es sicherzustellen, dass seine Leute das richtige Werkzeug haben.‹«
James Belasco hat diese Geschichte erzählt, die einiges von dem aufzeigt, wogegen ich in diesem Buch anschreibe: den Pontius-Pilatus-Tonfall des »Ich bin nicht verantwortlich« vor allem, sowie einen völlig überzogenen Führungsbegriff. Fragen ergeben sich daraus: Wofür ist der Mitarbeiter verantwortlich? Lösen Sie das Problem, wenn Sie die Führungskraft verantwortlich machen? Was ist zu tun, um diese Situation grundsätzlich zu verbessern? Muss nicht jeder Mitarbeiter für seine Leistung selbst Verantwortung übernehmen? Was aber ist dann die Aufgabe der Führung? Und was heißt ›Verantwortung delegieren‹?
Nachdem ich »Mythos Motivation« veröffentlicht hatte, bin ich – öfter, als anzunehmen war – darauf angesprochen worden, ob ich dieser Arbeit eine weitere folgen lassen wollte. Insbesondere wünschten sich viele Leser ein konkreteres »Wie denn besser?«. Nun, dieses Buch ist ein Folgeband zu »Mythos« – aber es ist eigentlich der vorausgehende. Wohl führt es einige der dort vorgelegten Gedanken fort, namentlich vertieft es die (vor allem auf den letzten Seiten) angedeuteten Thesen zur Selbstmotivierung. Jedoch tut es das auf eigenständige Weise. Die vermeintlichen Demarkationslinien zwischen Berufs- und Privatleben – ohnehin eine irreführende Grenzziehung – zerfließen vollständig. Ich hoffe jedenfalls, dass viele von Ihnen Ihr eigenes Leben, Ihre eigenen Fragen mit diesem Buch durchspielen können.
Die zentrale Frage
Bücher, die mit »Alles wird komplexer, schneller, chaotischer« beginnen, lese ich nicht mehr. Beim Salto mortale in der Operettenwelt der Managementmethoden gibt es kaum nennenswerten Geländegewinn. Natürlich ist der Wind rauer geworden. Natürlich haben High-Tech im Fernen und Low-Pay im Nahen Osten den Wettbewerb verschärft. Aber die grundlegenden Probleme in unseren Organisationen sind immer noch die alten. So formulierte der Nationalökonom Werner Sombart die zentrale Frage dieses Buches bereits 1913:
»Wie ist dieses möglich: dass gesunde und meist vortreffliche, überdurchschnittlich begabte Menschen so etwas wie wirtschaftliche Tätigkeit wollen können, nicht nur als eine Pflicht, nicht nur als ein notwendiges Übel, sondern weil sie sie lieben, weil sie sich ihr mit Herz und Geist, mit Körper und Seele ergeben haben?«
Führungskräfte fragen heute ähnlich:
Was kann ich tun, damit Mitarbeiter Verantwortung übernehmen?
Wie setze ich das Potenzial meiner Mitarbeiter frei?
Wie schaffe ich ein Unternehmen, in das die Mitarbeiter morgens gerne kommen?
Auf diese Fragen möchte ich antworten.
Einstellungssachen
Die Mobilisierung des Mitarbeiterpotenzials als entscheidender Erfolgsfaktor ist längst kein Geheimtipp mehr. Wir sind kein rohstoffreiches Land. Unser wichtigster Rohstoff ist die Bereitschaft zum Mitmachen. Der Arbeitsplatz bleibt aber leider oft ein initiativefreier Raum. Wir lasten zwar Maschinen aus, aber wir lasten die Menschen nicht aus. Es sind deshalb nicht nur Lohnkosten und Strukturprobleme, die unserem »Standortdeutschland« zusetzen. Wir unterfordern die Menschen.
Vor allem fordern wir nicht konsequent die Selbstverantwortung der Mitarbeiter. Viele Mitarbeiter sind abgetaucht, haben durch jahrzehntelange Entmündigung verlernt, Verantwortung für sich, ihre Motivation und ihre Leistung zu übernehmen. Genau betrachtet befinden sich weite Teile der Mitarbeiterschaft in einer Art psychologischem Streik gegen die Zumutung permanenter Unterforderung. Ihre Arbeitslosigkeit ist innerlich. Auch im Gehirn: Dienst nach Vorschrift.
Die Krise der Arbeit wird vielfach noch mit den alten Rezepten bekämpft, die allenfalls eine spezifische Reparaturintelligenz artikulieren, sich aber nicht von den alten Denkmustern lösen. Die einen greifen in das geldlogische Zeughaus der Motivierung, so wenn sie z. B. der Kreativitätsreserve mit der Wiederbelebung des betrieblichen Vorschlagswesens zu Leibe rücken. Unlösbar ein Problem, das nicht mit dem Griff zur Brieftasche zu lösen ist! Die Knüppel, die sie dabei anderen zwischen die Beine werfen, stammen von dem Holzweg, auf dem sie sich befinden.
Die anderen denken über die Veränderung der Organisationsstrukturen nach. Das Management-Mantra heißt hier: Freiräume, flache Hierarchien, Entbürokratisierung, Dezentralisierung. Dieser zweite Weg scheint mir nötig und erfolgversprechend; da gibt es viele bedenkenswerte Vorschläge und ermutigende Beispiele.
Jedoch: Lean Management, teilautonome Arbeitsgruppen, Kaizen, Reengineering – alle diese Managementkonzepte können nur greifen, wenn sich die Einstellungen der Menschen ändern. Der Forschungsmanager Sigmar Klose von Boehringer Mannheim: »Mit der optimalen Struktur erreiche ich 20 Prozent. Der Rest ist innere Einstellung, Siegeswille, das ›Wir machen es!‹.« Die Strukturoptimierer sitzen jenem Irrtum auf, den jeder schon einmal erlebte, der hoffte, die Reise in ein fernes Land mache ihn glücklicher: Man nimmt sich halt immer mit.
»Spiele werden im Kopf gewonnen.« Je enger die Leistungsdichte, je schärfer der Wettbewerb, desto wichtiger ist die innere Einstellung, mit der der Mitarbeiter mitarbeitet, die Führungskraft führt, der Verkäufer zum Kunden geht. Insbesondere, was die Einstellung zu Veränderungen angeht. So ist es auch eine Frage der Einstellung, ob man – vergeblich – im Wandel stabil bleiben oder Stabilität im Wandel suchen will. Eindrucksvoll zu sehen, wie schwer sich viele Mitarbeiter tun, dem Wandel etwas Positives abzugewinnen: »Das geht nicht!« (statt »Das geht so nicht«). »Das kann ich nicht!« (statt »Das kann ich noch nicht«). Offenbar ist das einzige Wesen, das den Wandel liebt, ein nasses Baby.
In diesem Buch geht es mir daher vor allem um das Bewusstsein, mit dem Menschen ihre Arbeit tun. Um eine bestimmte Art, das Leben im Unternehmen zu betrachten. Es geht mir um Engagement, Initiative und das Gefühl, mit dem eigenen beruflichen Lebenszug am richtigen Bahnhof zu stehen. Mein Fokus ist der Einzelne.
Die Hauptstücke
Es gibt keine wichtigere betriebswirtschaftliche Gestaltungsaufgabe als die Wiedereinführung der Selbstverantwortung in die Unternehmen. Dies um so mehr, als es tendenziell immer weniger Führungskräfte und immer größere Führungsspannen geben wird.
Als Negativfolie beschreibe ich dazu im ersten Teil dieses Buches das innerbetriebliche Gerangel um Verantwortung, Schuldzuweisung und Rechtfertigung. Das Ergebnis lautet: Organisierte Unverantwortlichkeit. Gegen Ende dieses Teils unterscheide ich die Begriffe Verantwortung, Selbst-Verantwortung und Commitment.
Das Philosophische Hauptstück legt die geistige Grundlage für Selbstverantwortung, Selbstmotivation und Selbstverpflichtung. Hier richte ich mich nicht an die Führungskraft »als Führungskraft«, sondern an jeden Einzelnen, unabhängig von seinem hierarchischen Rang. Sie werden diesen Teil nur dann mit Gewinn lesen, wenn Sie bereit sind, ihn auf sich selbst zu beziehen, wenn Sie ihn als selbstkritischen Impuls nutzen. Die drei Säulen der Selbstverantwortung: Wählen (Autonomie) – Wollen (Initiative) – Antworten (Kreativität) werden entfaltet.
Obwohl die Überschrift dieses Teils arg mit tiefgekühltem Höhenkamm-Denken droht, sind manche der dort vorgetragenen Sichtweisen von erschlagender Einfachheit. Dass sie neu konstatiert werden müssen, ist der präzise Gradmesser unserer gegenwärtigen Situation in den Unternehmen. Wenn ich gegen die Missachtung von Disziplin, Wille und Verpflichtung zu Felde ziehe, setze ich mich allerdings der Gefahr aus, dass hier viele ihre eigene Mutlosigkeit hinter dem Vorwurf der Realitätsferne verbergen. Utopisch! Theorie! Oder das schlimmste aller Schimpfworte: Philosophie!
Ich warne Sie also: Einige Passagen dieses ersten Hauptstücks werden Ihnen voraussichtlich ausgesprochen unsympathisch sein. Ich hätte sie unterschlagen, wenn sie für die Gesamtargumentation verzichtbar gewesen wären. Sie sind es nicht. Im Gegenteil: Gerade diese Teile bilden die größte Herausforderung an den Leser. Sie erfordern den »ganzen« Leser, der bereit ist, sich selbst und seine eingeschliffenen Denkmodelle in Frage zu stellen. So kann ich nur an Sie appellieren, das Buch nicht vorschnell zur Seite zu legen. Vieles klärt und erklärt sich im Fortgang des Textes – wie ich hoffe – auf ermutigende und befreiende Weise.
Das Pragmatische Hauptstück bildet die drei Grundprinzipien auf führungspraktische Alltagssituationen ab. Die erkenntnisleitende Frage lautet: Was kann Führung tun, um Selbstverantwortung zu fördern? Der überall geforderten Vorbildlichkeit der Führung setze ich einen Wechsel des Denkrahmens entgegen. Im Dickicht der falschen Alternativen: Vision, Vorbild, Vorgesetzter, werden die Umrisse einer perspektivischen Führungskultur erkennbar.
Perspektivisch ist dieser Entwurf insofern, als ich die Sichtweise des subjektiven Konstruktivismus für Führungsfragen praktisch mache: Wie kommen Urteile über Mitarbeiter zustande? Wie kann ich unbefriedigende Zustände verändern, ohne zu demotivieren? Darüber hinaus diskutiere ich an alltäglichen Situationen die Möglichkeit, dass Mitarbeiter in die Verantwortung gehen – führe aber gleichzeitig den Beweis, dass es unmöglich ist, Verantwortung zu »übertragen«, Mitarbeiter zu »ermächtigen«. Ich entfalte die These, dass Kritik nicht funktioniert, und biete ein alternatives Vorgehen an. Die Commitment-Mechanik für Zielvereinbarungen wird beschrieben. Den Schluss bildet ein Essay über die Fallstricke der Glaubwürdigkeit.
Der Unterschied zwischen den beiden Hauptstücken ist auch ein Unterschied der logischen Ebenen. Das lässt sich leicht an der Kernfrage des Pragmatischen Hauptstücks verdeutlichen:
Wie können wir ein Unternehmen schaffen, in dem Verantwortung nicht länger als Last, sondern als Lust empfunden wird?
»Völlig falsche Fragestellung«, tönt es von engagierter Seite. »Die Leute wollen doch Verantwortung tragen; nur wird ihnen die Übernahme dieser Verantwortung von misstrauischen und kontrollwütigen Chefs erschwert.« Einverstanden. Also müssen wir den Blick öffnen für eine erweiterte Fragestellung: »Wie muss Führung aussehen, damit die Mitarbeiter in die Verantwortung gehen?« – »Moment mal!« ruft es nun von anderer Seite. »Die wirklich interessante Frage ist doch wohl: Warum geben Mitarbeiter die Verantwortung aus der Hand? Wieso lassen sie sich entmündigen?«
Ich will also in diesem Buch beschreiben, was Selbstverantwortung im Unternehmen ist und wie Führungskräfte sie fördern können. Die Gegner, auf die ich mit dem Finger zeige wie Grünewalds Täufer, sind die Ethik der sauberen Hände durch Nichtstun sowie ein völlig überspannter Führungsbegriff. Im letzteren Fall möchte ich weder einem altklugen Moralismus das Wort reden noch Manager ungerechtfertigt anklagen, wie das heute allenthalben schick geworden ist. Aber vielleicht tun einige Führungskräfte doch das, wozu sie vor lauter Überlegenheit häufig nicht mehr kommen: überlegen.
Praxis
Ich bin Praktiker. Mich interessiert zwar, ob ein Gedanke stimmig ist, mehr aber noch, ob er funktioniert. Für die folgenden Überlegungen führe ich daher ein Kriterium ein, das ich »praktisch« nenne. Ich frage: »Ist es praktisch, so zu denken?« Ich frage nicht, ob die von mir vorgetragenen Argumente und Denkfiguren »richtig« sind, sondern nur ob es »nützlich« ist, einen solchen Gedanken in sich aufzunehmen.
Das Prüfkriterium ist damit freilich nur funktional bestimmt. Inhaltlich wird es, wenn ich ergänzend frage: »Stärkt ein Gedanke meine Selbstverantwortung? Oder schwächt er sie?« Argumente, die meine Selbstverantwortung stärken, sind für mich insofern »wahr«. Gedanken, die das Handeln verhindern, Nicht-Handeln rechtfertigen oder Unzuständigkeit aufrechterhalten, sind für mich insofern »falsch«. Mein Ansatz ist mithin einer pragmatischen Legitimation verpflichtet, die die Selbstverantwortung des einzelnen zum Moralkern hat.
Ich sage also hier nicht die Wahrheit. Wenn jemand die Wahrheit sagen könnte, hätte sie schon jemand gesagt, und wir bräuchten nicht weiter darüber zu sprechen. Ich möchte Standpunkte entwickeln, die im Sinne der Selbstverantwortung des einzelnen und einer verantwortlichen Unternehmenskultur praktisch sind. Wie alle perspektivischen Ideen setzen auch die hier vorgeschlagenen Denkfiguren den selbstverantwortlichen Einzelnen voraus, der für sich selbst entscheiden muss, was er für wahr hält.
Wer sich allerdings nach der Lektüre bestätigt fühlt – und die meisten Menschen wollen durch Bücher bestätigt werden –, der hat wenig gewonnen. Derjenige, der überhaupt nicht meiner Meinung ist, hat die Chance zu größerem Gewinn. Mit Max Frisch erhoffe ich mir, »dass der Leser vor allem den Reichtum seiner eigenen Gedanken entdeckt«.
Ja, es gibt noch etwas zu sagen – für jene, die sich einer optimistischen Praxis verschrieben haben. Karl Popper sagte: »Nichts aber ist verantwortungsloser als Pessimismus.«
Macht hat, wer macht
Es ist einfach praktisch, so zu denken.
Organisierte Unverantwortlichkeit
Im Unternehmen ist der Kelch der Verantwortung ein Wanderpokal.
Ralph Stayer, Gründer und Chairman von Johnsonville Foods, hat schlechte Erfahrungen gemacht: »Wir waren der Alleinlieferant eines großen Kunden. Dieser drohte ständig mit einem zweiten Lieferanten, weil er um unsere Lieferfähigkeit fürchtete. ›Seien Sie unbesorgt‹, versicherte ich immer wieder, ›wir werden stets pünktlich liefern.‹ Eines Tages erhielten wir den dringenden Auftrag, die Standardversion eines Produktes kurzfristig zu modifizieren und unbedingt am nächsten Tag zu liefern. Unsere Leute mobilisierten alle verfügbaren Ressourcen und schafften es tatsächlich. Sie verpackten das Produkt und beauftragten wie üblich das Transportunternehmen mit der Auslieferung. Aufgrund technischer Probleme kam der LKW-Fahrer jedoch nicht. Er erschien erst am nächsten Tag, und entsprechend verspätete sich die Auslieferung. Seitdem sind wir nicht mehr Alleinlieferant. Die Entschuldigung unserer Mitarbeiter: ›Wir können den Transportfahrer nicht kontrollieren. Er arbeitet nicht bei uns. Wir haben unseren Job gemacht. Mehr konnten wir nicht tun.‹«
Aufbruch in Fluchtrichtung
In den Unternehmen grassiert das Opferbewusstsein. Kaum jemand übernimmt die volle Verantwortung für seine Leistung. Der ständige Klageton des Ausweichlers artikuliert den hartnäckigen Willen zur Ohnmacht: Was kann ich schon tun? Die Sprache spricht: »Sie lassen es nicht zu.« – »Die anderen sind das Problem.« – »Wenn die sich nicht so dumm anstellen würden, würde alles prima klappen.« – »Der Vorstand macht keine klaren Vorgaben!« Entspricht der Vorstand dann den drängenden Erwartungen, wird über die Vorgaben lamentiert. Wenn der Wettbewerber den Auftrag erhalten hat: »Der Kunde hat nicht verstanden, was unser Produkt alles kann.« Wenn der Mitarbeiter nicht das tut, was andere von ihm erwarten (und dazu auch noch begeistert ist): »Unmotivierter Schwachleister!« – »Ich will das ja nicht, der Chef will das!« – »Oben« ist verantwortlich! »Unten« ist verantwortlich! Der Gruppenleiter ist dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter am Bankschalter freundlich und effizient sind! Der Qualitätsmanager ist verantwortlich für Qualität (wofür sonst?)! Der Personaler für das Personal! Das Bezahlungssystem ist schuld! »Wir« wären sehr erfolgreich, wenn »die« sich nicht querlegen würden. »Aber wir sind ein zu großes Unternehmen!« – »Aber wir sind ein zu kleines Unternehmen!« Und heute ist Föhn und außerdem Dienstag.
Es gibt Unternehmen, die sind reine Opferclubs. Da wird von morgens bis abends gejammert. Über die Eisheiligen auf der Vorstandsetage, über die unkooperative Nachbarabteilung, über die initiativelosen Mitarbeiter, über die Schönschwätzer im Krawattenbunker, über die Ignoranten an den Maschinen, über die rückstandslosen Geldvernichter in den Stabsabteilungen, über die Kunden, die sowieso nur stören. In einem Berliner Warenhaus wird der Übergang zwischen zwei Verwaltungstrakten »Seufzerbrücke« genannt. Und der Sage nach haben die beiden Firmengründer Hewlett und Packard die für das Unternehmen so charakteristischen Großraumbüros nur deshalb eingeführt, weil sie wussten, dass für manche ihrer Mitarbeiter jede Bürowand eine Klagemauer ist.
Dürfte man vom Zustand der Unternehmen auf die Natur der Mitarbeiter schließen, so müsste man den Menschen als Wesen definieren, das, solange es irgendwie geht, vor der Verantwortung ausweicht. Dr. Kimble ist überall. In Deutschland hat die Gewitterfront der Larmoyanz ein zusätzliches Epizentrum im Osten herbeikolonisiert: »Jetzt soll ich den ganzen Tag Initiative zeigen, wo man mir 40 Jahre lang gesagt hat: Wenn Du Dich bei uns aus dem Fenster lehnst, kriegst Du Ärger.« Einige verklären hier eine Vergangenheit, ohne fürchten zu müssen, dass sie wiederkehrt.
Wanderpokal Verantwortung
Grundsätzlich besteht über das, was Verantwortung im Unternehmen heißt, weithin Unklarheit. Entsprechend kreist und pendelt die Verantwortung: Mal hat sie der Mitarbeiter, mal der Chef, mal die da oben, mal die anderen, mal haben sie alle.
Diese Unsicherheit zeigt sich im Verhalten aller Beteiligten: Man schwankt zwischen Vorwurf und Mitleid, zwischen Besorgnis und ärgerlicher Forderung, zwischen Empörung und schlechtem Gewissen. Es verwirren sich die Zuständigkeiten, es ist unklar, wer wofür eigentlich verantwortlich ist, alle reden bei allem mit, das Management nimmt seinen Störungsauftrag bitter ernst, kaum ein Brunnen, in den nicht gespuckt wird, Ein- und Ausmischungen, wohin man schaut – berechtigt? Unberechtigt?
Sinnfällig wird diese Wirrnis an Themen, mit denen sich Vorstände beschäftigen. Das Verhängnis von Topmanagern ist nicht, dass sie sich zu weit vom Volk entfernen, sondern dass sie sich nicht weit genug von ihm entfernen. Es ist kaum zu glauben, wie viele Vorstände sich oft höchstpersönlich noch um die nebensächlichsten Details kümmern: etwa nach Dienstschluss mit dem dicken Schlüsselbund durch die Räume gehen und überall das Licht ausmachen; schauen, ob die Zahl der Topfpflanzen in den Büros der Abteilungsdirektoren auch den Richtlinien entspricht; diskutieren, ob das Seminar nun im Hotel X oder Y durchgeführt werden soll. Dazu noch: »Ich werde das Gefühl nicht los, außer mir arbeitet hier niemand.« Ich habe von einem Vorstand gehört, der eine Stunde lang über die Spülfrequenz der Urinale im Werk diskutierte. Beispielhafte Auftritte für Liza Minellis These, dass Leben ein Kabarett sei.
Nicht mehr zum Totlachen ist die Tatsache, dass für langfristige Konsequenzen immer weniger Verantwortung übernommen wird. Die von den Kapitalmärkten ferngesteuerte Gewaltherrschaft der kurzen Fristen führt in den Unternehmen zu einer aufreibenden Hü-und-Hott-Politik, die blind ist für die Spät- und Nebenfolgen. Nach uns die Sintflut! Der kultivierte Zynismus der Shareholder-Value-Fetischisten untergräbt jede stabile Beziehung, jede Idee eines zur langfristigen Verantwortung fähigen Unternehmens. Wer denkt noch an Walther Rathenau, Vorstand der AEG und später Reichsaußenminister, der ein von der Gewinnmaximierung und den Zielen der Anteilseigner emanzipiertes »Prinzip der inneren Verantwortung« für die Unternehmen entwickelte und in das Körperschaftsteuergesetz einfließen ließ?
Hinzu kommt, dass kaum ein Manager in unseren Unternehmen genug Spielraum und Zeit hat, allein für seine Ära verantwortlich zu sein. Und weil Manager wegen häufiger Versetzung nicht einmal so lange in ihren Zuständigkeiten bleiben, bis ihre Entscheidungen Folgen zeigen, gibt es oft keine direkte Verantwortung für Resultate. Seit Jahren sinkt die Verweildauer von Führungskräften, auch in Folge fortwährender Restrukturierung auf der Dauerbaustelle Unternehmen. Manager, die eine kurze Amtsdauer erwarten, sind kaum an langfristigen Problemlösungen interessiert. Sie übernehmen für ihre Aufgabe und ihre Mitarbeiter keine dauerhafte Verpflichtung. Und weil die Mitarbeiter dies wissen, verpflichten sie sich ebenfalls nicht: »Den überleben wir auch noch.«
Diese Situation in unseren Unternehmen wird wohl am besten umschrieben durch ein Wort, das Ulrich Beck für einen anderen Zusammenhang prägte: Organisierte Unverantwortlichkeit. In Abteilungen, die sich abteilen, knechten Untergebene, die unten geben, sitzen Sachbearbeiter, die Sachen bearbeiten, unter Vorgesetzten, die vorgesetzt werden und vorsitzen.
Betrachten wir einige dieser Strukturen näher.
Nicht zuständig!
Thomas Schalberger, PR-Manager aus Düsseldorf, hat es diesmal besonders eilig. Zehn vor zwölf zeigt die Uhr in der Wandelhalle des Kölner Hauptbahnhofs, der nächste Termin drängt. »Ein Ticket zweiter Klasse nach Düsseldorf« erbittet er von der Dame am Bahnschalter. »ICE oder IC?« lautet die Antwort. »Weiß ich nicht, den nächsten Zug eben«, sagt Schalberger, »das können Sie doch nachschauen.« – »Das ist der Ticketschalter, nicht der Service-Point«, entgegnet die Bahnfrau knapp, Auskunft zu Zügen gebe es aber grundsätzlich nur am Service Point. Ein kurzes Wortgefecht bleibt erfolglos, Schalberger muss sich in die Warteschlange am Service-Point einreihen – und verpasst seinen Zug.
Diese Szene beschreibt komprimiert die Haltung des »Nicht zuständig!«. Das ist die Mentalität der klar definierten Posten, Planstellen und Positionen. Sie fragt: »Wer ist zuständig?« (Statt: »Wer macht es am besten?«) Ihr Wesen ist das Statische, eine Identität aus negativer Abgrenzung. Sie hat ihren logischen Ort am »Arbeitsplatz«, einem Platz, den jemand »einnimmt«, indem er sich auf ihn »setzt« und einen fest umrissenen Zirkel von Tätigkeiten exekutiert. Wie es schon der Vorgänger tat und der Nachfolger tun wird. Orientiert an fragmentierten Einzelaufgaben. Dafür gibt es Stellenbeschreibungen. Aus Schutzgründen gegen unfriendly takeovers. Sie beschreiben ein Revier, das zu verteidigen ist, das aber auch nicht aus eigenem Antrieb überschritten wird. Ein Abteilungsleiter, der als Quereinsteiger bei der Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft MVV eine eingeschworene »Mannschaft« übernahm, erinnert sich: »Die ersten Worte, die ich lernte, waren ›Besitzstand‹, ›Historie‹ und ›Das steht nicht in der Stellenbeschreibung‹.«
Dem Konzept des »Arbeitsplatzes« entspricht auf der Handlungsebene die »Akte«. Und die Aktenmäßigkeit des Verwaltungshandelns wiederum betoniert die Herrschaft des Büros. Fachwissen wird zu Dienstwissen und Dienstwissen zu Dienstwegwissen (Dirk Baecker). Bei einer deutschen Landesbank erhält jeder neue Mitarbeiter eine Liste von Leuten, die er nicht anrufen darf.
Es ist leicht einzusehen, dass die Arbeitsteilung und die organisatorische Fragmentierung von Arbeit für diese Situation eine wichtige Rolle spielen. Sie haben Unternehmen zu vertikal-hierarchischen Organisationen gemacht, in deren Funktions-Silos vor allem das Ressort- und Abgrenzungsdenken wuchert. Die Zerlegung der Arbeitsgänge in kleinste Schritte, die Trennung von vor- und nachgelagerten Tätigkeiten (Entwicklung, Arbeitsvorbereitung, Produktion, Endkontrolle etc.), welche von den Arbeitern die Angestellten absonderte, das Zerteilen von Denken und Tun, die Höherbewertung von Führen gegenüber Ausführen – all das, was unter dem Stichwort Taylorismus für die ungelernten Arbeitskräfte der amerikanischen Hochindustrialisierung erfunden wurde, all das hat den Menschen zum Anhängsel der Maschinen-Taktzeiten reduziert. Es entband den Mitarbeiter von der Verantwortung für seine Arbeit und deren Qualität. Die innere Bindung an ein »Werk« wurde durch eine äußere Geld-»Kompensation« ersetzt. Und die arbeitenden Menschen handelten, wie sie behandelt wurden: entlassen aus der Verantwortung für Produktion und Produkt.
Dieses Management-Paradigma hat sich bis heute kaum verändert. Die Unternehmensberatung Roland Berger untersuchte bei der Telekom den Antragsweg für ein neues Telefon. Das Formular wanderte durch die Ein- und Ausgangskörbe von insgesamt vier Abteilungen. Bis zu 15 Mitarbeiter waren mit einem Auftrag beschäftigt – zersägt in viele kleine Arbeitsgänge, an denen Spezialisten ihr Spezialistenwissen exekutieren. Viele sind involviert, aber wer ist wirklich zuständig?
Wenn zuständig, dann höchstens ständig zu: Bei einem mir bekannten Zeitschriftenverlag sind sieben Abteilungen beteiligt, wenn Einzelhändler unverkaufte Produkte zur Gutschrift zurücksenden. Alle ächzen unter der Arbeitslast. Aber im engeren Sinne verantwortlich für die Retouren ist keine einzige Abteilung.
Die raumgreifende Internationalisierung in den Unternehmen tut ein übriges: Mitunter führt die Mehrfachzuständigkeit sich überlagernder regionaler, europäischer, globaler und funktionaler Netze zu einer tief greifenden Orientierungslosigkeit unter den Mitarbeitern: »Ich weiß schon seit Monaten nicht einmal, wer mein Chef ist.«
Café Größenwahn
Auf die Frage des Gastes, wie viel Uhr es sei, antwortet der Restaurantkellner: »Tut mir leid, an diesem Tisch bediene ich nicht!« – Die Beziehung zum Ganzen: sie fehlt oft in unseren Unternehmen vollständig. Viele Abteilungen organisieren die Arbeitsabläufe ausschließlich nach ihren eigenen Bedürfnissen, ohne dabei die Erfordernisse des Gesamtablaufs zur Richtschnur zu machen. Von einem Abteilungsleiter erwartet man schließlich vor allem Fachwissen und Erfahrung! Nach den Forschungen von Taubert, Henkel und Fechtner verfolgen Manager zu großen Teilen ihrer täglichen Arbeitszeit private und partikulare Abteilungsinteressen. Häufig scheint gar keine Neigung zu bestehen, unter dem Dach und zum Wohle des ganzen Unternehmens gemeinsam zusammenzuwirken.
Das lässt sich u. a. dadurch erklären, dass die Belohnungs- und Bestrafungssysteme massiv individualisiert sind. Oft hängt es aber auch mit der schieren Größe der Unternehmen zusammen, die im Extremfall jede Überschaubarkeit und damit jedes menschengemäße Maß missen lassen. Gerade in Deutschland haben wir den Jurassic Park der Uralt-Konzerne, die Großväter-Gründungen mit ihren vom Gigantismus zementierten Traditionsbeständen. Aber wie sollen Verantwortung und Großorganisation zusammengehen? Ich behaupte: Gar nicht. Menschen arbeiten nicht in Unternehmen, sondern in Nachbarschaften. Diese Nachbarschaften werden individuell »überschaubar« definiert. Sie sind über eine gewisse Anzahl an Kollegen, symbolischen Abgrenzungen, lokalen Grenzziehungen wie Kaffee-Ecken, Flure, Mittags-Stammtische etc. sowie rituelle Abläufen abgesteckt. Aus solchen überschaubaren Einheiten erwachsen Gemeinsinn und Verantwortung. Hier definiert man sich für das Unternehmen und grenzt sich allenfalls gegen den äußeren Wettbewerber ab.
Je größer die Organisationen werden, je unüberschaubarer die Strukturen und Abläufe, desto weniger bezieht man sich auf das Ganze. Anonymität, Beziehungsverluste, Hierarchisierung zählen zu den Komplexitätskosten des think big. Um trotzdem so etwas wie Wir-Gefühl zu erzeugen, verlagert man die Grenzziehung nach innen: Die Wälle und Gräben werden nun zwischen den Abteilungen ausgehoben – was man alsbald mühsam über »Alle-in-einem-Boot«-Sprüche zusammenzuschweißen versucht.
Großorganisationen sind Status-quo-Organisationen. Sie brechen nur rhetorisch zu neuen Ufern auf. Und selbst wenn man das Großgebilde zerlegt und in kleine, übersichtliche Unternehmenseinheiten gliedert, werden die neuen Schnellboote rasch wieder ins Geschwader einer Holding übernommen, was unter der Hand wieder mindestens eine Hierarchieebene und zwei rivalisierende Kompetenzschnittstellen zusätzlich abwirft. Da steppt der Li-La-Laune-Bär.
In der Pyramide begraben
Wenn jemand die anstrengende Eitelkeit einer Karriere auf sich nimmt, dann sagt er in der Regel nicht, dass er mehr Macht, Status oder Geld will, sondern dann will er »mehr Verantwortung übernehmen«. Woher nimmt er die? Wenn man die Lage in unseren Organisationen nüchtern betrachtet, dann steht zu befürchten: er nimmt sie seinen Mitarbeitern weg. Auf der nächsten Führungskräfte-Tagung stellt man sodann geschlossen fest, dass die Selbstverantwortung der Mitarbeiter dramatisch zurückgegangen ist. – Aber heißt es denn nicht immer, dass die Führungskräfte »mehr Verantwortung abgeben« sollen?
Eines vorweg, um Missverständnissen vorzubeugen: Ich glaube an die Hierarchie. Dort, wo Menschen zusammenkommen, bildet sich meiner Erfahrung nach relativ schnell und reflexhaft eine (informelle) hierarchische Struktur. Arbeitet man in Organisationen zusammen, scheint es mir mithin sowohl fair als auch praktisch (weil komplexitätsreduzierend), die Hierarchie offenzulegen. Offen gelegte Hierarchie ist wenigstens rechenschaftspflichtig. Ob sie dabei so funktional interpretiert, so tief gestaffelt und mit soviel infantilen Kinkerlitzchen ausbuchstabiert sein muss, wie das gegenwärtig noch allzu oft der Fall ist, ist eine andere Frage.
Oben die Würdenträger, in der Mitte die Bedenkenträger, unten die Wertschöpfungsträger: Die gegenwärtige Auslegung des hierarchischen Paradigmas ist allerdings auf manchmal geradezu lächerliche Weise unzeitgemäß. Sie geht von der Annahme aus, dass die Mitarbeiter weder willens noch fähig sind, ihre eigene Arbeit selbst zu organisieren und zu kontrollieren. Dass sie weder entscheiden wollen noch können. Die heimliche Botschaft an Führungskräfte: »Misstraue der Eigensteuerung Deiner Mitarbeiter, denn Du trägst ja die Verantwortung.« Selbstverantwortung des Mitarbeiters? In der Pyramide begraben.
So halten sich vielfach archaische Führungsstrukturen aus dem kapitalistischen Neolithikum, die ehedem ungebildete Leute in einer nur langsam sich wandelnden Umgebung anweisen, motivieren und kontrollieren. Wie Fossile ragen die hierarchischformalen Gehäuse der Arbeitsorganisation aus fernen erdgeschichtlichen Formationen in eine andere Gegenwart: Vier, fünf und mehr Leitungsebenen zwischen Arbeitern und Topmanagement nehmen konkurrierende Aufgaben bei oft geringen Handlungsspielräumen wahr. Je mehr Leitungsebenen aber, desto mehr Kontrollenergie – Kontrollenergie, die praktisch nichts zur Wertschöpfung beiträgt. Im Gegenteil: Erfolgserlebnisse zerfasern.
Unternehmen sind nahezu die letzten feudalistischen Enklaven der Gegenwart. Man lausche nur einigen Worten: Weisungsrecht – Zielvorgabe – Vorgesetzter – Belehrung – Kontrollspanne – Unterweisung – Dienstaufsicht – Untergebener. Der ehemalige deutsche McKinsey-Chef Herbert Henzler: »Es läuft noch immer nach der Methode Clausewitz: Einer sagt, wo es langgeht – und alle marschieren hinterher.« Die Denkfigur des Oben und Unten, die Kontroll-Metapher dominiert: »Als Chef überlege ich mir, was zu tun ist, treffe Entscheidungen, und dann motiviere ich die Mitarbeiter, damit sie das ausführen. Anschließend kontrolliere ich die Ergebnisse und belohne bzw. bestrafe entsprechend.« Die Attitüde: »Ich bin hier der Boss, also tu, was ich Dir sage.« Ergo warten die Mitarbeiter auf den Chef, bis er ihnen was sagt. »Aber ich habe die Anstrengungen einer Karriere über all die Jahre doch nur auf mich genommen, damit ich etwas verändern kann, damit die Dinge so gemacht werden, wie ich es will.« Klar – und es hat Konsequenzen. Mitarbeiter versuchen, den Boss zufriedenzustellen, statt Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Oder sich zumindest so zu verhalten, dass sie keinen Ärger bekommen. In Gremien wird viel Zeit darauf verwendet, zu überlegen, was der Chef wohl wollen könnte. Aus Angst um ihre Karriere sagen Mitarbeiter nur das, was ankommt, und nicht, worauf es ankommt.
Das hat viel zu tun mit der Frage: Wer macht im Unternehmen Karriere? Überschaut man die Forschung, dann verbringen Manager zwischen 60 und 80 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Fachtätigkeiten. Ihrer inneren Einstellung zufolge sind die allermeisten so genannten Führungskräfte aufgestiegene Sachbearbeiter. Und wollen es eigentlich auch bleiben. Führung? Das ist doch keine Arbeit! Das macht man doch so nebenbei! Die Folge davon ist, dass Entscheidungen tendenziell ein bis zwei Hierarchieebenen höher getroffen werden, als es aus sachlichen Gründen geboten wäre. Auf der Strecke bleibt die Selbstverantwortung. Deshalb wird am meisten der fähige Sachbearbeiter gefürchtet: »Was bleibt von mir, wenn der so gut ist, dass er ohne Korrektur und Kontrolle auskommt?«
Entsprechend inszenieren nicht wenige Führungskräfte ihre Unersetzlichkeit als letztes Bollwerk ihrer Würde. Für mich ist es immer wieder erstaunlich zu sehen, dass Führungskräfte keinen Tag im Seminar verbringen können, ohne ständig telefonieren zu müssen, Faxe zu erhalten und abzusenden, noch kurz mal eben … Zweimal täglich rufen sie aus dem Urlaub an und fallen in eine milde Depression, wenn sie hören, alles laufe auch ohne sie bestens. Wenn aber Führungskräfte unersetzlich sind, dann haben sie versagt. Dann sind sie allenfalls gute Fachkräfte – denn nur die werden kurzfristig »gebraucht«.
Wie wichtig die Enthierarchisierung in diesem Sinne ist, möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen: Bei den Vereinigten Papierwerken Schickedanz hatte man sich sehr früh um die Einrichtung teilautonomer Arbeitsgruppen bemüht. Mit unterschiedlichem Erfolg. Nicht wenige Mitarbeiter hatten nach Jahrzehnten der Unmündigkeit verlernt, Verantwortung zu übernehmen. Nur eine Mitarbeitergruppe hatte keinerlei Schwierigkeiten: die Nachtschicht. Die Mitarbeiter der Nachtschicht arbeiteten schon seit Jahren nahezu hierarchiefrei als Team zusammen. Der Betriebsleiter schlief; man musste sich selbst helfen, wenn etwas fehlte. Ein Nachtschichtler erzählt: »Als ich einmal merkte, dass der Leim für ein Tissue-Produkt zur Neige ging, bin ich um 3 Uhr morgens mit meinem Privat-Pkw los, um in einem Nachbarwerk den Kleber zu besorgen. 650 Liter. Meine alte Kiste brach fast zusammen. Aber ich hatte das Zeug. Tagsüber hätte ich erst einmal vier Formulare schreiben, drei Leute fragen und dann noch die Spedition beauftragen müssen.«
Sein Letzter Wille war sein erster
Erinnern Sie sich noch an das Geiseldrama in Gladbeck? Ich hatte kurz danach Gelegenheit, die Polizei-Leiter S und K in Nordrhein-Westfalen zu den Konsequenzen für das Thema Mitarbeiterführung zu beraten. Die Sachlage war klar: Die Polizisten vor Ort wollten sich absichern und ohne ein O. K. von oben keine Entscheidung treffen. Man fragte also bei der nächsthöheren Dienststelle nach, was zu tun sei. Diese wollte auch keine Entscheidung treffen und fragte wiederum eine Dienststelle höher nach. So sickerte die Verantwortung immer weiter nach oben bis zum Innenminister NRW, der nun überhaupt keine Kenntnis mehr vom aktuellen Sachstand vor Ort hatte. Währenddessen konnten die Gangster ihre makabre Medienshow vor einem Millionenpublikum abziehen. Einerseits wollten die Diensthabenden vor Ort Verantwortung vermeiden. Andererseits wurde offenbar, dass die Polizeiführung in der Vergangenheit viel dazu getan hatte, damit die Diensthabenden nicht in die Verantwortung gingen.
Verantwortung übernehmen? Da fährt kein befreiter Atem in die Lungen, sondern der Schrecken in die Glieder: »Bloß nicht – ich war doch schon mal 1988 selbst verantwortlich!« Diese Ambivalenz gegenüber der Übernahme von Verantwortung ist verständlich, weil damit oft Schuld und Anklage einhergehen. Denn wer offiziell Verantwortung übernimmt, läuft unter den obwaltenden Bedingungen Gefahr, Schuld zugewiesen zu bekommen.
Viele kennen den großen Verantwortungs-Staubsauger, der immer dann angeschaltet wird, wenn man irgendwo eine Fehlentwicklung zu erblicken meint. Hierarchie fragt nicht: »Wie lösen wir das Problem?«, sondern: »Wer ist schuld?« Ursachenanalyse dient nicht der Ursachenklärung, sondern der kollektiven Ent-Lastung durch individuelle Be-Lastung. Denn kollektive Verantwortung ist juristisch schwer zurechenbar, daher wird Verantwortung wegen der Schuldfähigkeit in der Regel individuell zugespitzt. Ein Beispiel dafür ist der Rücktritt dessen, der die »politische Verantwortung« übernimmt.
Darüber entbrennen Zurechnungskonflikte: Wer hat hier die Schuld? Der andere! Einer von uns muss sich ändern, und bei dir fangen wir an! Die gegenwärtige Outsourcing-Welle ist insofern nützlich, als sie die Palette der »anderen« erweitert.
Gesamtschuldner »Oben«
Die Reaktion? Man manövriert sich in die Unschuldsecke, redet sich auf besondere Umstände, auf »Sachzwänge« hinaus und will dafür Rabatt. »Wieso ich?« Man delegiert schon mal prophylaktisch das Problem nach oben und geht auf Tauchstation. Man erwartet »starke« Führung (was immer das sei), »klare« Entscheidungen, Erlaubnis: »Ist das denn oben gewünscht?« Dort oben wächst dann zwangsläufig der Entscheidungsdruck, man befasst sich mit allem und jedem und ringt sich eine dieser so genannten »Entscheidungen« ab. An der Unternehmensspitze hypertrophiert eine Verantwortungszumutung, die übernehmen soll, was sich die anderen ersparen.
Der Verantwortungsverweigerung zu vieler entspricht komplementär ein Über-Verantwortungsgefühl zu weniger, die meinen, »alles im Griff« haben zu müssen, obwohl sie sich dabei überfordern. »Unten« klagt man dann wieder über zu enge Vorgaben. Denn wer nicht entscheidet, hat meistens gut reden. Von der Tribüne lässt sich bequem urteilen. Die resignativ-kalkulierte Ethik der sauberen Hände durch Passivität verbindet sich mit dem Fingerzeigen auf die, die etwas tun und häufig versagen.
Gesamtschuldner »Oben«: Wenn ich Manager – gleich welcher Ebene – im Seminar mit alternativen Verhaltenweisen konfrontiere, schauen sie häufig in ihrem inneren Monolog nach »hierarchisch oben«, denken an ihren Chef, erleben sich selbst als Mitarbeiter, wünschen sich, dass man sich ihnen gegenüber so verhielte. Sie tauchen gleichsam unter ihrer Führungsverantwortung durch. Einige trauen sich: »Ich bin ja eigentlich ganz falsch hier. Mein Chef müsste hier sitzen.« Habe ich zu einem späteren Zeitpunkt diesen angesprochenen Chef im Seminar, heißt es nach einiger Zeit plötzlich: »Ich bin ja eigentlich ganz falsch hier. Mein Chef müsste eigentlich …« Die Verschiebung der Probleme auf »die da oben« offenbart die Langzeitschädigung durch eine verinnerlichte autoritäre Struktur.
Es ist schwer, das Lied der Selbstverantwortung auf der Leier der Hierarchie zu spielen: denn Hierarchie ent-antwortlicht. »Der Vorstand hat beschlossen, … Ich bin damit auch nicht einverstanden, aber was soll ich machen?« – Das sagt einer, der stiehlt. Sich. Aus der Verantwortung. Er verweist nach oben und verschweigt, dass er »Ja« gesagt hat. Der Mitarbeiter soll die Suppe auslöffeln. Aber wenn die Mitarbeiter das ausführen sollen, dann ist der Chef damit einverstanden. Bei einem großen Nahrungsmittelkonzern kann man sich mit einem einzigen stereotypen Satz aus der Verantwortung flüchten: »Amerika will das.«
Cover your ass
Schuldzuweisungen, Reinwaschungen, Verdrängungen: Die hierarchiegebundene Verfolgermentalität programmiert die Mitarbeiter auf die bürokratische Verschiebung von Verantwortung. Äußerlich sieht es nach detaillierten Prozessen zur Absicherung der Entscheidungsqualität aus. Aber die Hypertrophie der Sicherungsinstitutionen, der Kommissionen, die vielen Unterschriften unter Briefen, die Kolonnen auf Verteilern, um viele hineinzuziehen: es sind Entantwortungs-Verteiler statt Entscheidungs-Verteiler. All das will sich absichern: »Ihr habt es doch gewusst!« Das verantwortungslose Passiv regiert den betriebsinternen Schriftverkehr: »Aus gegebenem Anlass wurde beschlossen …« Adressat: alle. Verfasser: unbekannt verzogen.
Bei Schwierigkeiten holt man dann gerne Berater ins Haus. Um für den Kahlschlag nicht verantwortlich zu sein. »Wie bitte darf das Problem lauten, damit ich bei meiner Lösung bleiben kann?« Nicht selten kauft man sich Rechtfertigungsstudien, die den zuvor gefällten Entscheidungen die externen Weihen verleihen. Die fliegenden Händler gefälliger Unternehmenszukünfte realisieren zunächst recht schnell die angestrebten Produktivitätsgewinne. Mögliche kontraproduktive Folgen treten erst mit Verzögerung ein. Die baden dann andere aus. Die Mitarbeiter-Reaktion: »Wir haben zweimal McKinsey überlebt; wir werden auch noch Boston Consulting überleben.«
Cover your ass. Dabei gilt vor allem die Taktik: »Sorge für die rasche Behebung des Symptoms, nicht des Problems, denn nichts lenkt besser ab als eine rasche Aktion an der falschen Stelle.« Und für grundsätzliche Überlegungen ist es stets der falsche Zeitpunkt. Man muss erst noch die Voraussetzung für die Voraussetzung für die Voraussetzung schaffen. Am besten, man führt rasche Entschlüsse herbei und sorgt dafür, dass sie für Veränderungen gehalten werden. Wichtig dabei ist das Ritual des »Verabschiedens«: Richtlinien und Vorschriften eignen sich dafür besonders gut.
Entlastungsversuche I: Richtlinien
Entsprechend lautet eine heimliche Eintragung ins Lebensdrehbuch vieler Unternehmen: »Verregele soviel wie möglich!«, als gäbe es ein unausrottbares Bedürfnis der Menschen, am Leitseil zu gehen. Dabei wären viele Unternehmen längst zusammengebrochen, wenn die Mitarbeiter nicht oft genug selbst detaillierte Anweisungen in loyaler Weise uminterpretiert, umgeformt oder schlicht ignoriert hätten: »Die da oben haben doch keine Ahnung, was hier unten los ist.«
Alle Richtlinien sind unter bestimmten Umständen geschrieben worden, meistens um alle von etwas abzuhalten, was nur einige wenige tun oder tun würden – und die tun es auf Umwegen ohnehin. Selten helfen oder ermutigen sie Menschen, etwas zu tun. Noch seltener unterstützen sie dabei, Verantwortung zu übernehmen.
Eine Richtlinie ist mithin nicht nur ein Anschlag auf die Kreativität, sondern auch auf die Selbstverantwortung der Mitarbeiter. Die gleitende Arbeitszeit zum Beispiel, oft noch als Sieg der Phantasie über starre Organisationsformen gefeiert, wird damit begründet, dass Mitarbeiter sich mit dem Verweis auf ihr Arbeitszeitkonto der ausbeuterischen Ansprüche ihrer blutsaugenden Vorgesetzten erwehren können. Heißa! Hoch lebe die Selbstverantwortung!
Betriebsinterne Normierungsversuche: Wenn der ISO-Standard erfüllt ist, heißt das noch lange nicht, dass man auch Qualität produziert. Hier werden Kontrollprozesse idealtypisch beschrieben, hier werden Normen erfüllt, hier feiert die Abschlussorientierung dröhnend ihren Sieg über die Fähigkeitsorientierung. Die Absicherungsmentalität schaltet die Rückmeldung vom Markt aus und definiert Qualität »innen«. Bezeichnenderweise kommt das Wort »Kunde« in keiner einzigen Norm vor. Was da zertifiziert wird, ist das Qualitätsmanagement. Das Ganze schön hierarchisch aufgebaut von der Geschäftsleitung über den Qualitätssicherungsbeauftragten bis zum Qualitätsleiter. Bei der Flucht ins Handbuch fließen wieder die Energien nach innen: Weiß die Belegschaft, welche Vorschriften wo für sie festgehalten werden? Denn das sind die drei Prinzipien, die ISO 9000 ff. prägen: Dokumentation, Dokumentation und Dokumentation.
Es gibt Unternehmen, in denen die Zielvereinbarungskultur derart überzogen wird, dass der ganze Job mit bis zu 30 Zielvereinbarungen pro Jahr verregelt ist. Sicherheitsbedürfnis auf der einen Seite und Kontrollbedürfnis auf der anderen Seite bauen die Wände für den Arbeitsplatz als betriebsinterne Todeszelle.
Auch die Langsamkeit vieler Entscheidungsprozesse hat damit zu tun, dass jedes Steuerungsproblem sofort verregelt wird. Wenn BMW für eine Baugenehmigung in Deutschland acht Monate braucht, in Japan eine vergleichbare Baugenehmigung in einem erdbebenbedrohten Gebiet sechs Wochen dauert, dann verweist das auf den notorischen Richtlinien-Wildwuchs. Der macht auch die Verantwortungsträger träger. Im Schleppnetz aus Anordnungen, Richtlinien und Dienstvorschriften verfängt sich jede Selbstverantwortung. Zunächst noch wütend zappelnd, dann immer ruhiger werdend, der frühen Selbstpensionierung entgegendümpelnd. Der Rest an Begeisterung bleibt in den engmaschigen »Das-geht-nicht«-Stahlnetzen juristischer Regelungsmechaniker hängen.
Internes Unternehmertum wird so immer mehr zum internen Kampf gegen Vorschriften und Policies. In Search of Excellence? In Search of Mittelmäßigkeit! Kurzum, ich kann sie nicht mehr hören: die Winselei über den Mangel an Unternehmertypen, wenn doch jedes Steuerungsproblem umgehend mit einer Richtlinie erschlagen wird. Zurück bleibt ein Friedhof der Enthusiasmen. Muss es nicht nachdenklich machen, wie viele junge Menschen, die frisch und engagiert eine Aufgabe im Unternehmen übernommen haben, oft schon nach zwei Jahren innerlich emigriert sind? Viele von ihnen haben gleichsam eine Pappnase auf, spielen das Spiel nur noch zum Schein mit, sind aber innerlich weit davon entfernt, es als »ihr Spiel« anzuerkennen. Wer aber nur mangels besserer Alternativen dabei ist, ist nicht mehr dabei.
Entlastungsversuche II: Gremien
Wenn man im Unternehmen Schlüsselprozesse identifiziert, analysiert und nach Verantwortlichen für diese Prozesse fahndet, sucht man lange. Wo der Urheber erodiert, in einer Magellanschen Wolke unklarer Zuständigkeiten diffundiert oder gänzlich abgeschafft ist, kann es keine Urheberschaft im stabilen Sinne geben. Wo lässt sich Verantwortlichkeit, wo lässt sich Zuständigkeit festmachen? Die tiefgestaffelte Hierarchie und die breite Zuständigkeitsstreuung führen dazu, dass niemand mehr Verantwortung hat.
Im Fall des Immobilienspekulanten Schneider konnte man kaum einen konkret Verantwortlichen für die Risiken bei der Kreditvergabe identifizieren. Bei der Deutschen Bank gab es – nicht zuletzt bedingt durch jahrzehntelang gelernte Sorglosigkeit – ein Höchstmaß an struktureller Verantwortungsdiffusion. Das übergeordnete Harmoniepostulat im Vorstand verteilte zudem die Verantwortung im Schadensfall auf alle Entscheidungsträger zu gleichen Teilen.
Innerhalb der Unternehmen fühlen sich viele behindert und ausgeliefert an kaum noch personalisierbare Institutionen und Gremien. Unschuldig beginnt es zumeist: Will man ein bestimmtes Thema im Unternehmen befördern, schafft man zunächst eine Stabsstelle. Meist schwirrt irgendwo im Unternehmen ein ranghoher Manager herum, für den man so recht keine Aufgabe hat, und der wird dann Beauftragter für Total Quality Management, High Performance Organisation, Lean Management, Human Resources Development, Corporate Communications, Business Reengineering … eben für das, was sich gerade auf dem aufsteigenden Ast der Worthülsenkonjunktur befindet. Der entwickelt dann eine ungeheure operative Hektik, brennt Strohfeuer-Kampagnen ab, die sichtbar auf die Wichtigkeit des Themas (und der eigenen Aktivität) aufmerksam machen, regiert den Linienmanagern von der Seite hinein, wird als lästig, Besserwisser und Störenfried empfunden. Die Unternehmensleitung fühlt sich entlastet: »Wir haben da jetzt so einen für Qualitätsmanagement.« Man weiß sich auf der Höhe der Zeit. Die Stabsmanager okkupieren bestimmte Verantwortlichkeiten, um ihre Existenzberechtigung zu sichern – und klagen gleichzeitig darüber, dass die Linienmanager für dieses bestimmte Thema keine Verantwortung übernehmen. Da die Managementmoden ständig wechseln, kann man sich vorstellen, wohin das führt. An Impulsen und externen Anregungen fehlt es wahrlich nicht. Wohl aber an verantwortlicher Umsetzung. Bevor eine Welle »greift«, kommt schon die nächste, die ebenfalls lauwarm abgefedert wird.
Die nächste Stufe ist die Projektgruppe. Ein Komitee oder ein Ausschuss wird gegründet (was im letzteren Fall oft gar nicht so abwertend gemeint ist). Viele dieser »Da-muss-etwas-geschehen«-Projekte aber täuschen Handeln nur vor; wer-grad-mal-Zeit-hat wird Projektteilnehmer. Oft gibt es nicht einmal einen Gesamtverantwortlichen, der die Projektgruppe nach außen vertritt und abschirmt; die betroffenen Linienvorgesetzten reden nach Belieben rein; Projektziel unklar; welches Problem soll überhaupt gelöst werden? Der Vorstand wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Kommt dann ein anderes als das vom Vorstand erwartete Ergebnis, soll es gar unangenehme Konsequenzen geben, dann gibt es Konsequenzen: die Projektgruppe wird aufgelöst. Bei echten Veränderungsprozessen bleibt die Unternehmensspitze sowieso meistens außen vor. Das Topmanagement wartet darauf, dass sich »unten« etwas bewegt. Und »Unten« wartet darauf, dass von »oben« Erlauber-Signale kommen. Und so warten denn beide. Viel muss sich ändern, damit alles beim alten bleibt. Fangt schon mal an!
David Ogilvy formulierte vor über 30 Jahren: »Gehen Sie mal durch die Parkanlagen in Ihrer Stadt, und gucken Sie sich die Statuen an. Sie werden immer nur Herrn Nelson oder Herrn Bismarck finden und niemals ein Komitee zur Erreichung von diesem oder jenem.« Zweifellos gehört den integrierten, d. h. funktionsübergreifenden Business-Teams die Zukunft. Das darf aber nicht heißen, dass die Verantwortung diffundiert. Nestlé-Chairman Helmut Maucher ist zuzustimmen: »Teams mit Spitze« statt »Teams als Spitze« – was nicht mit monologischen Bombenwurfentscheidungen vom Feldherrnhügel zu verwechseln ist.