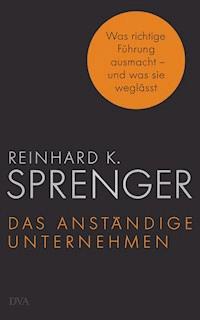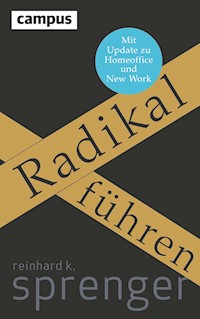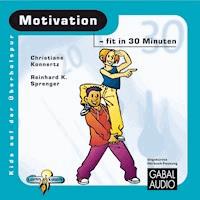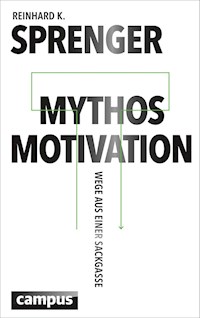17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Buch für alle Eltern, die sich im Familienalltag selbst nicht aufgeben wollen.
»Jedes Kind hat ein Recht auf glückliche Eltern!« Das hält der Bestseller-Autor und vierfache Vater Reinhard K. Sprenger allen Erwartungen entgegen, die heute auf Eltern lasten: Kinder sollen so früh wie möglich gefördert werden, Väter und Mütter sollen sowohl perfekte Eltern sein, zudem beste Freunde ihrer Kinder, Familienmanager und erfolgreich im Beruf. Doch wer sich im Suchen nach der vermeintlich »richtigen« Erziehung verliert, der läuft nicht nur Gefahr, das eigene Wohlergehen zu vernachlässigen, sondern auch das Wohl der Kinder. In »Elternjahre« richtet Sprenger daher den Fokus auf die Eltern und plädiert dafür, als Mutter oder Vater die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Denn nur, wenn wir uns um uns selbst sorgen, können wir auch gut für unsere Kinder sorgen. Sein Buch stellt die wichtigsten Fragen, die das Leben mit Kindern aufwirft und hilft dabei, Antworten zu finden, mit denen wir uns und unseren Kindern das Familienleben leichter machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch für alle Eltern, die sich im Familienalltag selbst nicht aufgeben wollen
»Jedes Kind hat ein Recht auf glückliche Eltern!« Das hält der Bestseller-Autor und vierfache Vater Reinhard K. Sprenger allen Erwartungen entgegen, die heute auf Eltern lasten: Kinder sollen so früh wie möglich gefördert werden, Väter und Mütter sollen perfekte Eltern sein, zudem beste Freunde ihrer Kinder, Familienmanager und erfolgreich im Beruf. Doch wer sich im Suchen nach der vermeintlich »richtigen« Erziehung verliert, der läuft nicht nur Gefahr, das eigene Wohlergehen zu vernachlässigen, sondern auch das Wohl der Kinder. In »Elternjahre« richtet Sprenger daher den Fokus auf die Eltern und plädiert dafür, als Mutter oder Vater die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Denn nur, wenn wir uns um uns selbst sorgen, können wir auch gut für unsere Kinder sorgen. Sein Buch stellt die wichtigsten Fragen, die das Leben mit Kindern aufwirft, und hilft dabei, Antworten zu finden, mit denen wir uns und unseren Kindern das Familienleben leichter machen.
Reinhard K. Sprenger, geboren 1953 in Essen, hat in Bochum Geschichte, Philosophie, Psychologie, Betriebswirtschaft und Sport studiert. Als Deutschlands profiliertester Managementberater und einer der bedeutendsten Vordenker der Wirtschaft berät Reinhard K. Sprenger alle wichtigen Dax-100-Unternehmen. Seine Bücher wurden allesamt zu Bestsellern, sind in viele Sprachen übersetzt und haben die Wirklichkeit in den Unternehmen in 30 Jahren von Grund auf verändert. Mit »Die Entscheidung liegt bei dir!« hat Reinhard K. Sprenger einen Best- und Longseller der Lebenshilfe vorgelegt, der in das Leben von Zigtausenden von Menschen Klarheit und positiven Einfluss gebracht hat. Als vierfacher Vater weiß er, was Eltern umtreibt, und kennt die Herausforderungen des Familienalltags. Zuletzt sind von ihm bei DVA erschienen »Das anständige Unternehmen« (2015), »Radikal digital« (2018) und »Magie des Konflikts« (2020).
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
Reinhard K. Sprenger
ELTERNJAHRE
Wie wir mit Kindern leben, ohne uns selbst
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
unter Verwendung eines Fotos von Robin Sprenger
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-29166-2V003
www.dva.de
Für meine Kinder
Inhalt
Einleitung
Was sind unsere Elternjahre?
Elternsorgen
Nur-noch-Eltern
Elternwohl
1 Warum werden wir Eltern?
Am Anfang ist der Sex
Liebe erfüllt Zwecke
Das Kind als Zweck in Beziehungen
Die Aufgabe der Eltern
Wer sind die Eltern?
Das verflixte siebte Jahr
Was wollen wir für uns Eltern erreichen?
Warum wollen wir ein Kind?
Versorgt werden
Das Kind als Ego-Prothese
2 Wer erzieht unser Kind?
Teile des Erziehungsgeflechts
Die Eltern
Die Straße
Die Gene
Der Zufall
Das Glück
Wirkungen des Erziehungsgeflechts
Wechselwirkungen
Gesellschaftliche Passung – die Schule
Familiäre Wechselwirkungen
3 Wie erziehen wir souverän und gelassen?
Erziehung »Als ob«
Müssen Eltern Vorbilder sein?
Übliche Missverständnisse
Wertevermittlung – Abschied vom Moralathleten
Alleinerziehend
Großeltern als Weiterführer
Der Schatten der eigenen Eltern
Genauso wie die Eltern
Nicht so wie die Eltern
Persönlichkeitswettbewerb gewinnen?
Erziehungsstile
Was ist gute Erziehung?
Gut genug ist perfekt
Gut-genug-Eltern
Erziehungsstile als Lebensmodelle
Die Mehrdeutigkeit des Elternseins
Woran orientieren?
Gemeinsamer Erziehungsstil?
Erziehung ist asymmetrisch
Eltern sind keine Freunde
Authentisch – von der Rolle
Schädigungsverbot
Fördern
Nicht fragen. Sagen.
Lügen und das Warum-Spiel
Klare Botschaften
Geben und Nehmen
Konflikte aushalten
Erziehung erzeugt Widerstand
Konflikte sind produktiv
Eigene Bedürfnisse artikulieren
Konflikte zwischen Geschwistern
Erziehung entscheidet sich im Konflikt
Erziehung statt Erdrückung
Gelassen bleiben
Wann lohnt der Streit? Wann nicht?
Besser streiten
Zeit ist wichtig – für wen?
Grenzen setzen
Freiräume sind Räume
Der Mut zum Nein
Vereinbarungen und Commitment
Regeln geben dem Leben eine Form
Regeln und Ausnahmen
»Sinnlose« Regeln?
Rebellion ist nötig
Strafen
Handelnd reagieren
Logisch-natürliche Konsequenzen – Was tun bei Regelbruch?
Gewalt
Der eigene Erziehungsweg
4 Wohin erziehen wir unsere Kinder?
Was ist Erziehung?
Das Konzept »Kindheit«
Erziehungsziele
Glücklich werden
Zukunftsfähig werden
Arbeiten können
Kompetenzen der Zukunft
Werden, was man ist
Werden, was man werden kann
Werden wie die Kinder
Kind sein
Bürger werden
Erziehungsziel Selbstverantwortung
Wahlmöglichkeiten erhöhen
Selbstständige Suchprozesse anregen
Nicht durch Belohnung bestrafen
Tadel des Lobens
Resilienz entwickeln
Gefahr von Risiko unterscheiden
Auf eigene Faust und draußen
Misserfolgsarmut verhindern
Frustrationstoleranz lernen
Selbstwirksamkeit erfahren
Üben
Erziehen zur Selbstverantwortung – ein verträgliches Dilemma
5 Wie erhalten wir das Elternwohl?
Die Veränderlichkeit des Liebens im Lauf der Zeiten
Trennung
Selbstachtung erhalten
Nicht die Souveränität verlieren
Nicht dem Kind gefallen wollen
Nicht anderen Eltern gefallen wollen
Elternwohl vor Kindeswohl
Übergang von zwei auf drei
Übergang von drei auf zwei
Was ist das Elternwohl?
Der Vorrang des Elternwohls
Die Praxis des Elternwohls
Ichwohl für Mütter und Väter
Happy Parentaholics
Ein paar Regeln für die Elternjahre
Nachwort und Dank
Literaturverzeichnis
»Weh dir, Land, dessen König ein Kind ist.«
(Prediger 10,16)
Einleitung
Was sind unsere Elternjahre?
Elternsorgen
Eltern erziehen heute sehr bewusst. Mütter stillen ihren Nachwuchs bis ins Kleinkindalter. Väter verzichten auf Gehalt und Karriere, um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Gemeinsam bauen sie ein drei Meter breites Familienbett und bringen die Kinder morgens nicht nur ans Schultor, sondern bis ins Klassenzimmer. Frühkindliche Förderung ist inzwischen die Regel, nicht mehr die Ausnahme. Und auf Elternabenden müssen immer mehr Stühle herangeschafft werden, so groß ist der Andrang.
Diese Elternpräsenz wird überwiegend begrüßt. Aber sie hat eine Schattenseite, und die wird täglich größer. So groß, dass sie die Präsenzgewinne überlagert. Dieser Schatten heißt Sorge.
Da ist zunächst die Sorge, dem Kind könnte etwas passieren. Ein Kind haben heißt Angst haben. Angst vor Unfall, Krankheit oder schiefer Bahn. Man sieht in einem Kind ein fragiles Wesen, das von Erwachsenen immerzu überwacht und vor allen Gefahren geschützt werden muss.
Sodann ist da die Sorge, das Kind könnte etwas verpassen – eine Sorge, die aus der Flut von Informationen erwächst, die uns die Medienwelt entgegenspült. Nimmt das Kind eine normale Entwicklung? Was darf es essen? Mit wem soll es spielen? Wie unterstützen wir Eltern es optimal?
Später die Sorge, das Kind könne nicht in die künftige Arbeitswelt passen. Welche Fähigkeiten werden gebraucht? Welche Berufe haben Chancen? Man hält es für unwahrscheinlich, dass zukünftig das gewöhnliche Menschsein genügt.
Und dann ist da letztlich das Bedürfnis der Eltern, sich ihrem sozialen Umfeld anzupassen – sie möchten durch die Leistungen ihres Kindes gut dastehen. Der Erfolg des Kindes wird auf die Eltern zurückgebogen. Die Sorge wird zum »Selbst«-Zweck.
Nun ist Sorge generell weder falsch noch völlig unbegründet. Als Vor-Sorge ist sie ein uraltes Prinzip menschlichen Selbsterhalts, die Für-Sorge ist aufgehoben in der Liebe. Aber manche Eltern sorgen sich so sehr, dass sie selbst vor lauter Sorge krank werden: Stress, niedergedrückte Stimmung, Schlaflosigkeit sind noch die harmloseren Folgen. Partnerschaftliche Probleme die weniger harmlosen. Unser Umgang mit dem Kind ist dann nicht mehr getragen von Gegenwart, Leichtigkeit und Humor, sondern von Zukunftsschwere. Mit traurigen Nebeneffekten: Wir bringen das Kind um seine Kindheit. Und uns selbst um wunderbare Elternjahre. Das wären Gründe, sich Sorgen zu machen. Wir werden sehen, was sich stattdessen eignet, unsere Elternjahre gelingen zu lassen. Wie wir es schaffen, die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen, ohne uns selbst dabei aufzugeben.
Nur-noch-Eltern
Früher wurde ein Kind eher nebenbei und unabsichtlich selbstständig; man kümmerte sich nicht groß darum. Entsprechend neu ist die Erziehung selbst. Es gibt sie erst seit etwa 200 Jahren – ein Klacks in der Weltgeschichte. Heute haben viele Eltern kein wichtigeres Thema. Das Kind ist nicht mehr nur »Nachwuchs«, es ist zum Projekt geworden. Und als Projekt wird es sorgfältig geplant, aktiv gestaltet und am Ende hoffentlich erfolgreich. Das Kind wird identitätsstiftend für die Familie.
Dabei wird das Erziehungs–»Projekt« zunehmend moralisiert. Noch bis in die 1960er Jahre hinein standen sich homogene Kollektive gegenüber – auf der einen Seite die Erwachsenen, auf der anderen die Kinder. Es war klar, was man von der jeweiligen Gruppe erwartete. Eltern verfolgten die gleichen Werte und Ziele: Sie sorgten dafür, dass die Kinder satt waren, saubere Kleidung trugen, vernünftig durch die Schule kamen und schließlich einen sicheren Beruf fanden. Und Kinder sollten vor allem gehorchen, freundlich grüßen und keine Widerworte geben. Dieser gesellschaftliche Konsens über Erziehung ist verloren gegangen. Heute stehen Erwachsene nicht mehr für Erwachsene ein, sondern vorrangig für ihr eigenes Kind. Zudem kommt es vermehrt zu ideologischen Flügelkämpfen zwischen »richtiger« und »falscher« Erziehung. Der Hype um das Kind kippt dabei oft in rigide Gewissheit, die nicht selten langjährige Freundschaften zerbricht. Wo man hinschaut: missionarischer Eifer, egal, ob es sich ums Impfen, Aufessen oder den Schnuller dreht. Kopfschüttelnd schaut man auf andere Eltern herab, die offenbar noch nicht begriffen haben, was zu tun und was zu lassen ist.
Nur in einem Punkt sind sich alle einig: Das Kind ist das neue Heiligtum. Dies umso mehr, als ein Kind heute »wertvoller« ist als früher: Die Zahl der Kinder pro Haushalt sank in Deutschland bis 2021 beständig. Zudem bekommen Menschen in unseren Breitengraden immer später ein Kind. Und ältere Eltern sind ängstlicher. Infolge der Verherrlichung durch die Eltern entwickeln die kleinen Prinzen und Prinzessinnen nicht selten ein Anspruchsdenken, das despotische Züge trägt. Die natürliche Ordnung von Eltern und Kind hat sich um 180 Grad gedreht: Heute stehen die Eltern unten und blicken hinauf zu ihrem Hausgott – zum Kind. Der französische Ideenhistoriker Alain Finkielkraut erzählt von einem Studenten, der auf einem Fragebogen als Vornamen »Majestät« angab.
Nehmen wir diese Phänomene zusammen, können wir geradezu von einer Sakralisierung des Kindes sprechen. Alles wird problematisiert, nichts bleibt unhinterfragt, und die Experten von Papa/Mama-Google haben zu allem eine Meinung, die auf Optimierung zielt. Die Familie mutiert zum Trainingslager für kindlichen Steigerungsstress. Denn Eltern wollen es »gut« machen, wollen möglichst perfekte Eltern sein. Entsprechend ist Erziehung heute: gehemmte Forderung und enthemmte Förderung. Eine solche Erziehung, so viel sei vorweggenommen, erstrebt Ziele, die nicht erreichbar sind. Sie geht von Voraussetzungen aus, die illusionär sind. Sie wählt Methoden, die kontraproduktiv sind. Und sie hat Spät- und Nebenwirkungen, die wir als Eltern unmöglich wollen können.
Das ist keine Früher-war-alles-besser-Onkelei. Ich frage vielmehr danach, was den Vorrang des Kindes gegenüber den Eltern begründet. Ob es eine Erziehung gibt, die das Prädikat »gut« verdient. Ob wir Eltern es eindeutig »richtig« machen können. Ich bin überzeugt, dass es sich bei »guter und richtiger Erziehung« um Mythen handelt. Mit fatalen Folgen für das Kind.
Und uns Eltern.
Was nämlich bei dem familiären Anstrengungsprogramm völlig unter den Tisch fällt, ist die Selbst-Fürsorge der Eltern. Die Erwachsenen sind oft Nur-noch-Eltern, vergessen sich sowohl als Paar wie als Einzelpersonen. Die Hausherren sind gleichsam von den Gästen verdrängt; die Eltern dürfen sich glücklich schätzen, wenn ihnen ein kleiner Winkel zum Rückzug bleibt. Das muss so nicht sein, wenn Eltern einen ganz zentralen Gedanken zulassen und entsprechend handeln: Elternjahre sind nur ein Abschnitt im Leben eines Erwachsenen. Kinder kommen, Kinder gehen, Eltern bleiben.
Elternwohl
Irrtümer und Übertreibungen der Erziehungsratgeberliteratur verleiten Eltern, überzogen optimistische Erwartungen zu hegen und dadurch die Elternjahre in eine Zeit des Ungenügens zu verwandeln. Von Genießen keine Spur. Im Kontrast dazu gehe ich von folgender Erfahrung aus: Wir machen als Eltern nur dann viel falsch, wenn wir zu viel richtig machen wollen. Deshalb ist eine Erziehung vorzuziehen, die sich auf wenige Aufgaben beschränkt und dabei das Schädliche vermeidet. Sie will nicht »Gutes« erreichen, sondern nimmt Abstand von der heute vorherrschenden Steigerungsmentalität. Weil ein Kind später umso erfolgreicher wird, je nebensächlicher es aufwächst. Und weil so die Chance besteht, dass Eltern die Elternjahre auch als Paar überstehen. Ich will daher offen aussprechen, worauf diese Überlegungen zielen: Eltern zu entlasten, die Sorge zu entsorgen – jedenfalls ihren überschießenden Teil. Ich werbe dafür, dass wir uns entspannen, weil eine zurückhaltende Erziehung das Richtige ist. Für das Kind. Vor allem aber für uns Eltern.
Dieser letzte Punkt wiegt schwer. Denn das öffentliche Gespräch über Erziehungsfragen diskutiert Eltern nur in ihrer funktionellen Bedeutung für das Kind, nicht aber in den existenziellen Anliegen für die Eltern. Deshalb blicken die meisten Erziehungsratgeber starr auf das Kind. Die Eltern fallen gleichsam aus der Optik. Vor lauter Kindeswohl wird vergessen, dass es auch ein Elternwohl gibt. Das scheint mir ein Grund dafür zu sein, dass die Konzepte oft zu kurz greifen.
Dieses Buch schaut daher auf die Eltern. Und dadurch auf das Kind. Ich stelle hier eine Haltung vor, die die Selbstachtung der Eltern priorisiert. Diese Haltung werden viele nicht widerspruchslos akzeptieren. Gut so. Wir sollten nicht lesen, um zu erfahren, was wir ohnehin schon denken.
Erziehung von Kindern kann man meiner Erfahrung nach mit einem Fußballtraining vergleichen: individuell üben lassen, taktisch einstellen, durchhalten lernen – und dann als Trainer von der Seitenlinie dem Spiel zuschauen; die Halbzeitpause zum Trösten und Wiederaufrichten nutzen. Mir gefällt dieses Bild. Menschen brauchen bisweilen Trost. Das gilt besonders für ein Kind. Immer wieder ist es auf tröstende Eltern angewiesen. Wer aber tröstet die Eltern? Wer beruhigt Eltern, die von Zweifeln geplagt sind, ob sie es »richtig« machen mit der Erziehung ihres Kindes? Vielleicht kann dieses Buch das leisten: Sorgen mindern, Zweifel zerstreuen und ein wenig Trost spenden in dieser angespannten, einzigartigen, wunderbaren Zeit der Elternjahre. Denn ein Kind braucht Eltern – keine Erziehungsexperten. Es braucht Eltern, die sich als Paar nicht verlieren. Die für das Kind das Beste tun, indem sie fürsich das Beste tun. Jedes Kind hat ein Recht auf glückliche Eltern!
1
Warum werden wir Eltern?
Es gibt Menschen, die Eltern werden. Und es gibt Menschen, die keine Eltern werden – weil sie kein Kind bekommen wollen oder können. Blenden wir das Nichtkönnen einmal aus und anerkennen wir, dass es heute sehr weitgehend unsere Entscheidung ist, ob wir Eltern werden. Dann sagt diese Entscheidung viel über unseren Lebensentwurf aus. Wir können unsere Lebenszeit ja wahrlich mit anderem füllen als mit »Kinderkram«. Legen wir also los mit dem Fundamentalen – mit Natur, Sex, Beziehungen und der Aufgabe der Eltern.
Am Anfang ist der Sex
Das Leben will weitermachen. Darf man so salopp formulieren? Kann das Leben überhaupt etwas wollen? Und wären nicht »Natur«, »Gott« oder »Mensch« geeignetere Kandidaten, die wir verantwortlich machen können? Für unsere Zwecke reicht das Weitermachen. Das Leben soll nicht zu Ende sein, es strebt nach Selbsterhalt, es will Zukunft haben.
Dafür hat es sich eine Menge Tricks ausgedacht. Einer davon ist die Polarität Mann/Frau. Daran ändert auch keine unvollständige Geschlechtsidentität etwas, auch nicht die Ablehnung einer binären Zuordnung, auch nicht die moderne Fortpflanzungsmedizin. Und obwohl wir rein wissenschaftlich anerkennen müssen, dass die Bandbreite des Geschlechtlichen größer ist als das duale weiblich/männlich, ist es nicht zu bestreiten, dass Männer Kinder zeugen und Frauen Kinder gebären. Das ist Fakt.
Damit aber Mann und Frau beim Weitermachen auch mitspielen, hat das Leben den Sex erfunden. Sex macht die Zeugung neuen Lebens freudvoll. Meistens jedenfalls.
»Sex« – schon allein das Wort klingt für mache Ohren provokativ. »Liebe« würden wahrscheinlich einige bevorzugen. Aber Sex steht hier für Fortpflanzung, für das Weitergeben des Lebens. Und das ist grundsätzlich bedroht. Der Mensch muss ständig dafür sorgen, dass er als Gattungswesen in einer feindlichen Umwelt überlebt. Sein Gegner in diesem Spiel ist der Tod. Und der wartet an jeder Ecke. Grundsätzlich immer schon, früher wartete er früher. Deshalb müssen wir uns fortpflanzen, was das Zeug hält. Zusammengefasst kann man das an Häuserwänden und auf T-Shirts lesen: »Leben ist eine Krankheit, die sexuell übertragen wird und mit dem Tod endet.«
Diese Erkenntnis reicht weit über die Elternjahre hinaus: Alles, was angesichts des Todes passiert, ist wichtig. Alles, was nicht angesichts des Todes passiert, ist unwichtig. Oder, um es milder zu formulieren: Es ist weniger wichtig. Denn nur das Ende unseres eigenen Lebens nötigt uns zu Entscheidungen. Und im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen können wir als Menschen gedanklich »vorlaufen« zu unserem Ende – wir wissen, dass es uns erwartet. Von da aus, gleichsam rückblickend, wählen wir unsere Lebenswege. Dann kommen auch nichtbiologische Aspekte ins Spiel: Qualitäten, Gefühle, Bezauberungen. Wenn wir schwärmerisch veranlagt sind, können wir also beruhigt sein: Raum für Romantisches ist immer noch da. Aber wir konzentrieren hier unseren Blick auf das Wesentliche. Nur das Ende schärft den Blick für die Essenz.
Nun, was ist die Essenz in Beziehungen?
Liebe erfüllt Zwecke
Menschen suchen Beziehungen. Wir sind soziale Wesen, brauchen einander, mögen nicht allein sein – oder jedenfalls nicht immer. Dafür haben wir unterschiedliche Gründe; wir wollen in und durch Beziehungen unterschiedliche Zwecke erfüllen. Auch Beziehungen zwischen Mann und Frau haben einen Zweck. Das mag poesielos klingen, ist aber unbestreitbar. Der Zweck kann vielerlei sein: Manche wollen schlicht der Tradition genügen – also das tun, was (fast) alle tun. Manche wollen im Freundeskreis gut dastehen, gefallen sich in der Gegenwart des anderen, suchen sich also einen Trophäen-Partner. Manche haben ein gemeinsames Interesse, ein Ziel, ein Projekt, eine Leidenschaft, unterstützen sich wechselseitig. Wieder andere suchen Sicherheit. Und da wären ja auch noch finanzielle Vorteile, sexuelle Erfüllung oder eben: eine Familie. Die meisten Menschen haben vielerlei Bedürfnisse gleichzeitig. Aber in der Regel dominiert ein Hauptzweck.
Dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan zufolge entsteht alles aus einem Mangel. Etwas fehlt – und das ist der Zweck, der uns weitermachen lässt. Das Fehlende ist der tiefere Grund unseres Handelns, das Begehren, der Motor, der uns vorantreibt. Wenn wir also einen anderen Menschen sehen, dann sehen wir ihn nicht in seiner Fülle, nicht für sich stehend als Individuum, sondern primär in seiner Funktion als Zweckerfüllung. Kann er/sie unsere Lücke schließen? Der Beleg dafür findet sich stets – er konkretisiert sich an der mangelnden Bereitschaft zum Kompromiss. Keine halben Sachen! Alles oder nichts!
Für denjenigen, der vorrangig eine Familie will, ist der Partner Mittel zum Zweck des Kinderwunsches. Und wenn wir in einen ernsthaften Konflikt mit unserem Partner geraten, dann vor allem deshalb, weil wir unseren Zweck bedroht sehen, den wir in Beziehungen suchen. Und wenn langfristig unser Partner den Zweck nicht erfüllt, dann verlassen wir ihn. Entweder offen oder heimlich. Offen, indem wir weggehen. Heimlich, indem wir körperlich anwesend bleiben, aber seelisch getrennt sind. Das ist so, weil der Zweck sich immer durchsetzt. Er ist wichtiger als jeder konkrete Partner; das wird im Rückblick auf Trennungen oft überdeutlich. Wenn aber unser Partner den Zweck erfüllt, bleiben wir zusammen. So banal es klingt: Wir bleiben zusammen, weil der Zweck uns nicht trennt. Eine Beziehung dauert daher so lange, wie sich die Partner wechselseitig ihren Zweck erfüllen. Das kann man Liebe nennen.
Manche nehmen den Kinderwunsch bzw. den Nichtwunsch des Partners in Kauf, um die Beziehung zu retten. Das ist ein hoher Preis. Und er wird letztlich vergeblich gezahlt. Der Groll darüber wird sich nicht legen. Im Gegenteil wird er als alter Ärger noch Jahrzehnte später präsentiert. Auch wenn wir kein Recht dazu haben, werden wir ihn ausspielen wie ein lange gehütetes Trumpf-Ass. Solche Beziehungen sind unrettbar.
Das Kind als Zweck in Beziehungen
Es gibt viele Gründe, warum Mann und Frau Beziehungen eingehen. Keiner davon ist höher oder niedriger zu bewerten. Wenn wir aber nüchtern der Stimme der Biologie lauschen, dann haben Mann und Frau nur den einen Zweck: ein Kind zu zeugen. Das ist ihr »Grund«. So lautet jedenfalls die Botschaft des Lebens. Ein Kind verkörpert das Leben auf neue und frische Weise. Und die Natur braucht Mann und Frau nur für das Kind. Alle anderen Zwecke kann man auch in anderen Beziehungen erfüllen. Wen das nicht überzeugt, dem sei Alfonso Cuaróns Film Children of Men oder Margaret Atwoods Roman Der Report der Magd empfohlen: Keine Kinder, keine Zukunft, keine Hoffnung.
Damit das Leben weitermacht, dafür braucht es also Mann und Frau. Das sind aber nicht notwendigerweise »Eltern« – also Erwachsene, die nach der Geburt das neue Leben behüten und erziehen. Wer genau sich um den Zweck des Erziehens versammelt, ist von dieser Warte aus unerheblich. Wenn eine Familie aus Liebe gegründet wird, ist es egal, mit wem. Es muss auch nicht die Liebe von Eltern zueinander sein. Die ausschließliche Liebe zum Kind reicht – siehe Co-Parenting und Alleinerziehende. Immer mehr Menschen können sich vorstellen, ohne feste Paarbeziehung zu leben, keinesfalls aber ohne ein Kind.
Der Kinderwunsch ist daher die Grundlage vielfältiger Lebensmodelle. Das Modell »Vater-Mutter-Kind« ist aus historischer Perspektive ohnehin nur eine Modeerscheinung (wir vertiefen das später). Sein Vorrang vor anderen Modellen ist jedenfalls kaum zu rechtfertigen; das Leben geht auch in anderen Konstellationen weiter. Gegenwärtig löst sich dieses Modell zwar nicht auf, wird aber ergänzt durch eine Fülle von Alternativen. Zu beobachten ist eine Rückkehr zu vormodernen, vielfältigen Formen der Erziehung. Mehr noch: Die nichtleibliche Pflegeelternschaft hat nicht nur eine lange Tradition, sie hat überdies den Vorteil, das Kind nicht übermäßig in den Mittelpunkt zu stellen.
Wie schon eingangs hervorgehoben: Elternjahre sind tatsächlich nur ein Abschnitt im Leben eines Erwachsenen, für den man den Lebensabschnittspartner braucht – den zu Unrecht viel geschmähten. Schauen wir uns nun an, wie lange wir ihn wirklich brauchen.
Die Aufgabe der Eltern
Wie heißt das Problem, für das Eltern die Lösung sind? Einfacher formuliert: Was ist der Job von Eltern? Die Moderne hat dazu etliche Antworten parat. Einige davon klingen sympathisch, einige moralisierend, einige so kompliziert, dass man zweifelt, ob Elternsein auch ohne Eltern-Führerschein funktioniert. Wie war es eigentlich vor tausend Jahren möglich, Vater und Mutter zu sein ohne entsprechende Tutorien?
Fragen wir die Anthropologie. Diese Wissenschaft vereint biologische Tatsachen und soziologische Befunde zu einer nüchternen Sicht auf den Menschen. Sie schert sich nicht darum, was gerade chic ist. Vielmehr sagt sie uns, welche Botschaft uns einige Millionen Jahre Menschheitsgeschichte senden. Was der Kern des Elternseins ist. Diese Botschaft lautet: Aufgabe der Eltern ist es, das Überleben des Kindes zu sichern.
Das klingt sehr prinzipiell, sehr sachlich und frei von Emotionen – und das ist es auch. Es ist der Natur abgeschaut. Sie vermeidet kulturelle Überformungen. Und sie besagt nichts über »gute« Erziehung, nichts über Wünschbares, nichts über modische Aufgeregtheiten. Aber sie kommt nicht ohne eine wichtige Ergänzung aus: … bis zu einem Zeitpunkt, an dem das Kind selbst überleben kann. Diese Begrenzung hat Immanuel Kant später prominent aufgegriffen. Elternjahre enden nach Kant früh, nämlich dann, wenn das Kind in der Lage ist, »sich selbst zu erhalten«.
Mehr nicht? Man meint schon den Chor jener zu hören, denen das zu bescheiden ist und auch zu roh. Sie wollen mehr: eine positive, attraktive Vision für die Zukunft ihres Kindes. Diese Einwände sind ernst zu nehmen. Aber sie verdanken sich dem Zeitgeist, dem »eiligen Meinen«, wie der Philosoph Martin Heidegger sagen würde. Und deshalb gehen sie am Kern dessen vorbei, worum es hier geht.
Denn das Wesentliche ist: Die primäre Aufgabe von Eltern ist die Gefahrenabwehr. Das begründet ihre Autorität. Es geht darum, das Kind »durchzubringen«. Deshalb sind wir Eltern Agenten der Evolution. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen als Gattungswesen weiter im Spiel zu halten. Mit einem Kind sind wir also auf Unendliches bezogen.
Wem das zu archaisch klingt, den bitte ich um einen Augenblick Geduld. Zu den ambitionierteren Erziehungszielen kommen wir später. Aber die Konzentration auf das Wesentliche kann uns helfen, einigen Schnickschnack beiseitezuräumen. Lassen wir uns also einen Moment auf dieses Grundsätzliche ein, selbst wenn es etwas gefühllos scheint.
Als Teilelement der Elternaufgabe ist da zunächst: »Das Überleben sichern«. Was ist das Überleben? Das ist schlicht der Nicht-Tod. Aufgabe von Eltern ist es, den Tod des Kindes zu verhindern. Und das ist im Falle eines Menschenkindes besonders prekär. Denn ein Menschenkind wird vollkommen hilflos geboren. Die meisten Primatenarten können schon sehr früh aus eigener Kraft überleben. Ein neugeborener Mensch bleibt hingegen derart lange schutzbedürftig, dass Biologen diese Tatsache für die biologische Sonderstellung des Menschen überhaupt halten. Die Bedürftigkeit ist wiederum eine Folge unserer Intelligenz. Diese hat ein größeres Gehirn hervorgebracht, das einen größeren Schädel braucht. Der Geburtskanal aber begrenzt das Größenwachstum. Zu große Köpfe bedrohen die Überlebenschance des Kindes (und der Mutter) während der Geburt. Die evolutionäre Lösung lautet: früher gebären, dann ist der Kopf noch klein. Je früher freilich das Kind zu Welt kommt, umso hilfloser ist es. Desto mehr Pflege braucht es.
Das gilt für den Säugling, aber auch für das Kleinkind. Gefahrenabwehr heißt dann konkret Verkehrserziehung, schwimmen lernen, Furcht vor dem Abgrund, Vorsicht bei Feuer und Eis. Fundamentale Dinge also. Wir können uns vor Augen führen, wie viele Kleinkinder in früheren Jahrhunderten keine Chance hatten, das Erwachsenenalter zu erreichen, dahingerafft von Hunger, Krankheit, Krieg. Und nach wie vor ist es in vielen Teilen der Welt eine herkulische Aufgabe von Eltern, das Überleben des Kindes zu verteidigen. Dabei ist dieses biologische Soll mitunter nicht einmal kulturell anerkannt. Wenn indische Eltern ihre weiblichen Föten abtreiben, neugeborene Mädchen töten oder so schlecht versorgen, dass sie sterben, weil für sie Mädchen minderwertig und materiell belastend sind, dann siegt die Kultur über die Natur. Dann schweigt offenbar die Stimme der Elternliebe. Das mag die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens sprengen, findet aber jährlich noch immer erschreckende zwei Millionen Mal statt.
Meine hier zugespitzte Orientierung an biologischen Grundtatsachen basiert auf dem Preis, den eine Vergötterung des Kindes und ein wohlmeinend ersticktes Leben für Kind und Eltern fordert. Beides ist nicht gleichbedeutend mit dem Appell, eine verantwortungsvolle Erziehung dem bloßen Überleben des Kindes zu opfern. Aber das Überleben ist das Notwendige; alles Weitere ist das Mögliche. Ersteres ist Pflicht, das Zweite ist Kür – etwa Persönlichkeitsentwicklung oder Talententfaltung. Was ich zeigen will: Die heutige Verabsolutierung des Möglichen sollten wir relativieren durch die Wiederbewusstmachung des Notwendigen. Wir sollten das Augenmerk auf das Wesentliche richten, indem wir die Herrschaft des Optimierens lockern. Denn nur wenig prägt das Erziehungshandeln der Gegenwart mehr als das Geringschätzen des Horizontalen und dessen Ablösen vom Vertikalen. Man will nicht mehr »Strecke machen«, sondern »Höhe gewinnen«. Das Maßvolle und Nuancenreiche des Flachlandes wird von der Gipfelstürmerei verdrängt, die unbeleuchtete Üblichkeit wird von der grellen Sonderleistung überstrahlt.
Das alles sagt aber zunächst noch nichts aus über den Unterschied zwischen Kinder haben und Kinder erziehen. Ob jemand auch Ja zur Rolle des »Erziehers« sagt, ist keine Automatik, sondern eine Entscheidung. Aus dieser Perspektive kann dann die nächste Frage nicht überraschen: Wer sind die Eltern?
Wer sind die Eltern?
Die landläufige Meinung ist: Eltern sind jene Personen, die ein Kind gezeugt beziehungsweise ausgetragen haben. Wir sollten skeptisch sein. Das war in früheren Zeiten schon nicht immer eindeutig. Und das ist es heute noch viel weniger.
In matrilinearen Gesellschaften war nur die Mutterschaft unbestritten. Die Vaterschaft wurde von Müttern verschwiegen, um sich den Schutz aller Männer der Gruppe zu sichern. Jeder Mann konnte eben der Vater eines Kindes sein. Das war der Fall in kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern. Aus demselben Grund verbannte Platon später die Monogamie aus seinem idealen Staat. Diese Praxis änderte erst die Erfindung des Ackerbaus in der Jungsteinzeit, die daraus resultierende Sesshaftigkeit und das Patriarchat als Kontrollinstanz der weiblichen Sexualität. Erst nach der neolithischen Revolution setzte sich die erbrechtlich wichtige Frage nach der Vaterschaft durch. So konnte man gewiss sein, dass das Erbe von den Vätern auf die Söhne übertragen wurde. Väter wollten ihrer Vaterschaft sicher sein – und das konnten sie nur, wenn sie die Frauen zur Monogamie verpflichteten. Und wenn die Staatsgewalt dies durchsetzte.
Falls es durchzusetzen war. Wie viele Bäuerinnen haben sich mit dem Stallburschen eingelassen, um den Druck von ihrer kinderlosen Ehe zu nehmen? Eine historische Wellenbewegung: Heute scheint die eheliche Vaterschaftsvermutung kaum noch zeitgemäß, da die Zahl der Kinder wieder steigt, die außerhalb der Ehe oder einer festen Partnerschaft geboren werden. Es gibt Spenderkinder, Mit-Väter bei gleichgeschlechtlichen Paaren, Mit-Mütter, sogar zivilisationsbrechende Miet-Mütter bei im Ausland geborenen Kindern. Da fällt die Zuordnung schwer, von »Abstammung« will schon niemand mehr reden.
Aber das sind rechtliche Erwägungen. Den Lebensweg bestimmen andere Mechanismen. Die Frage nach der Mutter beantwortet sich in der obigen Logik so: Eine Mutter ist jene Frau, die unser Überleben gesichert hat. Das ist nicht unbedingt die Frau, die uns geboren hat. Das kann unsere leibliche Mutter sein, das muss sie nicht sein. Es können wildfremde Frauen sein – manches Buch und mancher Film haben sich dieser Tatsache gewidmet. Schon Bertolt Brecht hat uns in seinem Kaukasischen Kreidekreis gelehrt, dass ein Kind nicht unter allen Bedingungen zur Gebärerin gehört. Sondern zur mütterlichen Frau. Ein Vater ist entsprechend nicht zwingend der Mann, der uns gezeugt hat. Ein Vater ist jener Mann, der unser Überleben gesichert hat.
Diese beiden Überlebenssicherer sind also die Eltern eines Kindes. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem es das selbst tun kann. Wann ist dieser Zeitpunkt gekommen?
Das verflixte siebte Jahr
Der Mensch ist immer Der-zu-früh-Geborene. Aber wann kann ein Kind aus eigener Kraft überleben? Wir wissen es nicht genau. Die Natur gibt uns mindestens einen Hinweis: das Hormon Oxytocin.
Dass heute alles Biologische in den Giftschrank wandert, weil es zu sehr nach Determinismus riecht, können wir hier souverän zur Seite schieben. Denn Hormone spielen eine unbestreitbare Rolle für das Verhalten von Menschen, zumal für unser Bindungsverhalten. So haben Evolutionsbiologen seit Langem die bedeutende Wirkung von Oxytocin beobachtet. Dieses »Kuschelhormon« hat ausgesprochen positive Wirkungen auf das soziale Miteinander. Es macht freundlich und angstfrei, es schafft Vertrauen. Vor allem aber stärkt es die Zweierbindung und – zumindest kurzzeitig – monogames Verhalten; andere Partner scheinen dadurch weniger attraktiv. Gerade zu Beginn einer Partnerschaft lassen sich hohe Oxytocin-Ausschüttungen messen.
Nun müssen wir uns zurückversetzen in eine Zeit, in der Sex zwischen Partnern unmittelbar mit der Zeugung eines Kindes verbunden war. Schwangerschaftsverhütung gab es nicht. Und weil in der Natur nichts ohne Grund ist, liegt es nahe, die Ursache der Hormonausschüttung in der Bindung der Partner aneinander zu sehen. Die Eltern blieben auch nach der Zeugung eine Zeit lang zusammen und sorgten dafür, dass das Kind die gefährlichen ersten Jahre überlebt.
Wie lange sorgt das Hormon für diese Paarbindung? Interessant ist die wissenschaftlich gut gestützte Beobachtung, dass die Oxytocin-Ausschüttung im Laufe einer Partnerschaft nachlässt. Viele Jahre galt als Forschungsstand, dass ein erhöhter Hormonpegel nach dem siebten Jahr der Partnerschaft nicht mehr nachweisbar ist. Offenbar sieht die Natur keinen Grund, das Paar über diese Zeit hinaus aneinander zu binden – weshalb man ja auch heute noch sprichwörtlich vom »verflixten siebten Jahr« spricht. Und in der Tat zeigen die statistischen Bundesämter: Die meisten Ehescheidungen fallen in Deutschland in das sechste und siebte Jahr, in der Schweiz in das siebte und achte. Diese Daten stehen in einer gewissen Spannung zu Studien, die das Oxytocin schon nach dem vierten Jahr nicht mehr nachweisen können. Die Forschung nach den Gründen steckt noch in den Kinderschuhen.
Das Verschwinden des Bindungshormons ist »naturgemäß« nicht zufällig. Es ist funktional, eine Botschaft der Biologie; es konserviert die menschliche Anpassung an Umweltbedingungen. Nimmt man diesen Hinweis ernst, dann geht die Natur offenbar davon aus, dass ein Kind etwa ab dem siebten Lebensjahr aus eigener Kraft überleben kann. Was die Experimentalökonomie bestätigt: Kinder dieses Alters können strategisch denken und handeln. Sie können sogar ihr Gegenüber bewusst täuschen.
Steuern wir dem Expertenwissen ein wenig Erfahrungswissen bei und lauschen Esther Wojcicki, die als Lehrerin die Tech-Stars des Silicon Valley großzog und in deren Garage Google gegründet wurde: »Bis zum siebten Lebensjahr muss jemand da sein, der ein Kind vor Verletzungen schützt. Aber danach können Kinder viele Dinge allein tun.«
Kaum eine Mutter oder ein Vater wird die Überlebenssicherung des Kindes zu diesem Zeitpunkt einstellen. Dennoch gilt ab dem siebten Lebensjahr: Der Job ist gemacht! Kann es sein, dass viele Eltern übersehen, dass ihr Kind älter wird? Dass sie ihre Zuständigkeit zeitlich überdehnen? Dass sie im Übermaß behüten und beschützen – altersunangemessen und über das Notwendige hinaus?
Schon an dieser Stelle lässt sich festhalten: Zum Wachsen der Kinder gehört das Schrumpfen der Eltern. Der Erfolg von Eltern lässt sich daran ablesen, wann sie in ihrer Funktion als Eltern überflüssig werden.
Was wollen wir für uns Eltern erreichen?
Warum wollen wir ein Kind?
Warum die Natur Kinder will, haben wir gesagt – das Leben soll weitergehen. Aber Menschen – warum wollen die ein Kind? Die Frage mag kurios anmuten, denn früher war die Antwort darauf ganz klar: Die Natur hatte es so vorgesehen. Heute, da wir mehr oder weniger problemlos eine Schwangerschaft verhüten können, wird die Frage entschieden. Oft geschieht das im Wettlauf mit der Zeit: Das Thema drückt Männer weniger als Frauen, deren biologische Uhr schneller abläuft. Und es ist nicht irgendeine Frage im Leben, die da zu beantworten ist. Kind ja oder nein – diese Entscheidung ist heute zentral geworden für Erwachsene.
Der Hauptgrund dafür: In der Moderne steht Elternwerden im Wettbewerb mit anderen Lebensformen. Gibt es nicht lohnendere Projekte? Sollte man sich nicht interessanteren Aufgaben widmen als ausgerechnet der Bändigung wonneproppiger Nervensägen? Wollen wir nicht doch lieber freier leben? Häufiger ins Konzert gehen? Abenteuerlich reisen? Uns der Karriere widmen? Grundsätzlicher noch fragen klimabewegte Antinatalisten, die sich in der Birthstrike-Bewegung organisieren: Es gibt doch schon so viele Menschen auf der Welt – brauchen wir da noch mehr? Tatsache ist, dass ein Kind mit Abstand die größte Umweltbelastung ist, die ein Mensch auslösen kann.
Diese Erkenntnis wird nur wenige Eltern daran hindern, ein Kind zu zeugen (auch Ökosensible nicht). Eine gute Freundin sagte einmal zu mir: »Kinder sind kein Rechenergebnis. Wenn man rechnet, bekommt man nie welche.« Denn wenn es etwas gibt, auf das sich alle erfahrenen Eltern einigen können, dann dieses: Niemand weiß vorher, wie es ist, ein Kind zu haben. Mutter oder Vater sein – es ist einfach unmöglich, sich prognostisch in diese Rolle hineinzuversetzen. Und kein Mensch kann hellsehen, ob er nach der Geburt eines Kindes noch derselbe ist. Vielleicht ist er ein ganz anderer, der beispielsweise nach ursprünglicher Skepsis plötzlich seine Liebe zum Kind entdeckt. Oder aber, trotz Vorfreude, mit einem Kind überhaupt nichts anfangen kann. Und wer weiß schon vorausahnend, ob er jahrelangem Schlafentzug gewachsen ist? Ob die Nerven stark genug sind? Auch im Rückblick: Niemand kann wissen, wie das Leben ohne Kind verlaufen wäre – besser? schlechter? –, es gibt keine Simulation, in der wir es ausprobieren könnten. Wir wissen also nicht, was wir wählen – wir können nur entscheiden. Und dann das Beste hoffen.
Trotz dieser Unvorhersehbarkeit: Im Gegensatz zu früher suchen heute Männer und Frauen um die 30 nach »guten Gründen« für diese Entscheidung. Und auch wenn manchem eine Nutzen-Kosten-Analyse zu nüchtern erscheinen mag – insgeheim macht sie jeder. Was habe ich davon, ein Kind zu haben? Warum tue ich mir das eigentlich an?
Spielen wir einige Antworten durch. Etwa: Weil man die eigene Fruchtbarkeit erleben will. Weil man sich als Frau das größte Mysterium des Lebens nicht entgehen lassen will. Weil man im Alter nicht allein sein will. Weil man durch ein Kind etwas nachholen will, was man vielleicht selbst nicht erreicht hat. Weil ein Kind dem Leben klare Prioritäten setzt. Weil es eine stockende Berufskarriere relativiert. Weil Eltern im Kind ein romantisches Herzenszeichen sehen – »sichtbar gewordene Liebe«, wie Novalis schrieb. Wieder andere wollen ein Symbol des Erwachsenseins aufrichten, sich selbst in der Rolle als Vater und Mutter erleben – wohl auch gegen die eigenen Eltern, die einen oft für immer auf die Kinderrolle festlegen. Fromme Menschen wünschen sich vielleicht ein Kind aus Ehrfurcht vor dem gottesebenbildlichen Schöpfungsakt. Nicht wenige wollen mit einem Kind ihre Beziehung flicken, die, leergelaufen oder krisengeschüttelt, einen neuen Anfang braucht; das Kind soll neuen Schwung und neuen Lebenssinn spenden. Letztlich gibt es auch solche, die nicht nur eine Krise mit dem Partner durchleben, sondern eine Krise mit sich selbst: mit Sinnlosigkeit, Langeweile, Perspektivlosigkeit. Davor wollen sie fliehen – und projizieren Sinn und Perspektive in das Kind hinein. Sie haben dann ein Ziel gefunden, das sie rational begründen können und das klingt, als bewegten sie sich auf etwas zu – anstatt von sich weg. Der große Menschenkenner Friedrich Nietzsche (»Jeder flüchtet vor irgendetwas.«) in seinem Gesang »Von Kind und Ehe« (Also sprach Zarathustra, 1883): »Redet aus deinem Wunsch das Thier oder die Not …? Oder Vereinsamung? Oder Unfriede mit dir?«
Und noch ein Gedanke sei an dieser Stelle zulässig. Als Forscher 2013 im Auftrag des Familienministeriums ungewollt Kinderlose befragten, ob Kinderlosigkeit ein Makel sei, bejahten das 20 Prozent; sieben Jahre später hatte sich diese Zahl verdoppelt! Zeigt sich im intensivierten Kinderwunsch ein Bedürfnis nach Sicherheit in unsicherer Zeit? In einer Moderne, in der der Beruf zum Job geworden ist, es immer seltener stabile Lebensverhältnisse gibt, die Gesellschaft in vereinzelnde Identitäten zerbröselt? Der Soziologe Heinz Bude schreibt: »Die einzig unkündbaren Beziehungen, die es heute noch gibt, sind die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern.«
Höher noch zielen jene Menschen, für die die eigene Existenz zu wenig hergibt. Sie ist ihnen zu krümelhaft, die eigene Lebenszeit zu winzig angesichts der unermesslichen Weltzeit. Sie wollen sich ausdehnen, durch ihr Kind zeitlich überdauern. Sie wollen, dass jemand nach ihrem Tode an sie denkt. Für die Zeit davor hat Harald Martenstein das Wesentliche gesagt: »Der Sinn des Kinderkriegens besteht heute darin, dass am Heiligen Abend jemand anruft.«
Damit kommen wir dem Kern näher. Kinder lenken uns ab, hindern uns daran, permanent um uns selbst zu kreisen. Die Beschäftigung mit uns selbst macht uns ja nicht glücklich, sondern oft eher unglücklich. Wer viel Zeit hat, sich zu fragen »Bin ich glücklich?«, der wird früher oder später unglücklich. Mit Kindern hingegen kommen wir vor lauter Hinbringen, Abholen, Kümmern, Kochen, Sorgen und Gutenachtgeschichtevorlesen gar nicht auf die Idee, um uns selbst zu kreisen. Wir fragen nicht: »Was ist der Sinn des Lebens?«, denn der Sinn des Lebens steht direkt vor unserer Nase, er beschäftigt uns von morgens bis abends, auch nachts, wenn getröstet werden muss oder uns der Krupphusten aus der Wärme unseres Bettes holt.
Wenn wir also den Strauß der moralisch mehr oder weniger hochstehenden Erklärungen für den Kinderwunsch bündeln, dann bekommen wir ein Kind nur aus einem Grund: weil ein Kind uns unterhält! Ein Kind bringt Abwechslung in den Alltag, macht ihn farbig, bereichert das Leben mit action. Das können wir sogar noch niedriger hängen: Letztlich wollen wir ein Kind, weil wir uns das Leben ohne Kind langweiliger vorstellen. Für »langweilig« können wir auch andere Worte wählen, etwa unvollständig, bedeutungslos, einförmig, belanglos, gleichförmig, oberflächlich, unbelebt, freudlos. Letzten Endes läuft es alles auf dasselbe hinaus: Es zählt der Unterhaltungswert.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Der Unterhaltungswert von Kindern ist hoch. Sehr hoch sogar. Aber nicht immer nur als Grund zur Freude. Sondern, oft ganz im Gegenteil, unterhaltend im Sinne von stressig und nervig. In der ersten Zeit, ja, da sind sie niedlich – aber mit etwa anderthalb Jahren ist das meistens vorbei. Dann haben Kinder auf einmal ihren eigenen Willen. Sie werfen sich auf den Boden, brüllen herum, wollen alles, jetzt, hier, sofort. Dann ist Elternschaft das, was Eltern schafft. Man tauscht also die Langeweile der Kinderlosigkeit gegen die Unruhe des Kinderhabens. In dem kleinen spanischen Indie-Film Lullaby von 2020 wird das ungeschönt vor Augen geführt: die Schmerzen beim Anlegen des Neugeborenen, weil die Brustwarzen zu empfindlich sind; die Erschöpfung, wenn das Kind nächtelang durch die Wohnung getragen wird, weil es sonst schreit und schreit und schreit; die Dünnhäutigkeit durch Schlafentzug; die nie gekannte Panik, wenn man einen Augenblick nicht aufgepasst hat und das Kind vom Sofa rollt. Mit dieser Unruhe wird kaum ehrlich umgegangen. Schon gar nicht in den sozialen Medien, die perfekte Mamis mit perfekten Kindern zur Schau stellen.
Und selbst Wunschkinder kann man sich zwar wünschen, aber dann doch nicht aussuchen. Es ist zudem ein Unterschied, ob man sich ein Kind wünscht und dann dieses Kind bekommt. Es ist weiterhin ein Unterschied, ob man ein Kind will, dann aber ein Kind hat. Oft entwickelt es sich ja auch alles andere als wunschkindhaft. Das geht bis zur Reue. Regretting parenthood heißt das im Jargon. Dieses Gefühl des Bedauerns ist einer mir bekannten Mutter nicht fremd: »Wenn ich noch mal entscheiden könnte, hätte ich keine Kinder gekriegt.«
Ich fasse diesen Motivstrauß zusammen und möchte ihm noch einen gesellschaftspolitischen Gedanken hinzufügen. Paare bekommen Kinder, weil sie erwarten, dass sich dadurch ihr Leben bereichert. Manche hoffen sogar auf Lebenssinn, zumindest aber auf Erfahrungen, die sie ohne Kinder vermissen würden: Kinder geben einem Leben Richtung – jedenfalls die Gelegenheit, sich noch einmal emotional an das Ganze der Welt zu binden. Deshalb eine Botschaft an das Familienministerium: Kein Mensch kommt auf die Idee, Kinder zu bekommen, um der Gesellschaft etwas Gutes zu tun. Beispielsweise die Rentenkassen zu füllen oder das Vaterland zu verteidigen. Aus solchen Begründungen schlagen nur Politiker ihren Schaum. Insofern ist es fraglich, inwieweit wir zur Erfüllung unseres persönlichen Unterhaltungswunsches die finanzielle Unterstützung der Allgemeinheit beanspruchen dürfen. Mein Kind – deine Steuern? Wir können ja Eltern nicht steuerlich entlasten ohne dadurch jene zu belasten, die keine Kinder haben – wollen oder können. Wenn wir uns also die Eingangsfrage »Warum wollen wir ein Kind?« noch einmal stellen, dann sollten wir uns die Antwort nicht von wohlfahrtsstaatlichen Wucherungen vernebeln lassen. Und die lautet: weil wir uns selbst damit einen Gefallen tun. Der Staat mag ein Interesse daran haben, dass aus wilden Hosenmätzen brave Bürger werden. Aber unser Interesse als Eltern ist der Unterhaltungswert des Kindes. Das ist und bleibt Selbstverantwortung.
Versorgt werden
Früher bekam man Kinder, um im Alter versorgt zu werden. Heute ist es oft umgekehrt: Eltern versorgen Kinder noch bis ins Erwachsenenalter. Aus durchaus egoistischen Gründen: Viele Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder flügge werden; sie wollen, dass sie zu Hause gebunden bleiben. Aber auch der archaische Wunsch nach Altersversorgung hat sich im Kern bis heute erhalten. Nur dass es weniger um eine materielle Versorgung geht, sondern um eine soziale und emotionale. Die meisten Eltern wollen später besucht werden, also in gewissem Sinne weiterhin »unterhalten« werden. Der berühmte Familientherapeut Jesper Juul schrieb dazu: »Die Frage, die sich alle Mütter und Väter stellen sollten, lautet: Möchte ich, dass mich mein Kind in 30 Jahren deshalb besucht, weil es … meint, sich um mich kümmern zu müssen? Oder soll es kommen, weil es sich gut mit mir fühlt?« Das klingt überzeugend und verweist auf den klassischen Konflikt zwischen Pflicht und Neigung. Bei genauerem Hinsehen handelt es sich um eine Schein-Alternative, die Fundamentales verdeckt. Und das Fundamentale ist: Wir dürfen gar nicht damit rechnen, dass das Kind im Alter zu uns kommt! Nicht, dass wir es uns nicht wünschen dürften. Aber es darf nicht handlungsleitend sein. Der Wunsch »für morgen« darf sich nicht schon in den Elternjahren wie ein Filter vor unser Handeln schieben. Etwa nach dem Motto: Tue nichts, wofür dich dein Kind später mit Abwesenheit strafen könnte. Das wäre eine Haltung, die jede Klarheit opfert zugunsten der Belohnungshoffnung.
Konkretes Beispiel: Wenn wir uns gegenüber dem Kind das Anmelden eigener Bedürfnisse verkneifen, dann buchen wir diese Unterlassung auf ein imaginäres Beziehungskonto. Wir »sparen« dort an und haben das Gefühl, das Kind schulde uns etwas. Wie ein alternder Fußballstar, der in Erinnerung früherer Leistungen noch immer eine Stammplatzgarantie in der Mannschaft erwartet. Aber ein Kind schuldet seinen Eltern nichts. Es gibt keine Kindespflicht zur Versorgung der Eltern. Weder ist die Tochter verpflichtet, den Vater zu besuchen, noch ist der Sohn verpflichtet, sich um die Mutter zu kümmern. Sie können es tun, aber sie müssen es nicht. Auch wenn man es bedauern mag: Wir leben nicht mehr in Zeiten, wo die Familie zwangsläufig eine Gemeinschaft zur wechselseitigen Unterstützung war. Für uns Eltern geht es vielmehr darum, auch gegenüber dem Kind unsere Bedürfnisse zu artikulieren. Ja sagen, wenn wir Ja meinen. Und Nein sagen, wenn wir Nein meinen.
In unserem Erziehungshandeln dürfen wir also nicht die Spätfolgen für uns kalkulieren. Erziehen ist à fonds perdu. Wir dürfen nicht auf Gegenleistung hoffen, keine Rückerstattung des Aufwands erwarten, nicht einmal einen heimlichen Vertrag auf ein Weiterleben in den Kindern anstreben. Die einzigen Spätfolgen, die wir abschätzen sollten (wenn dies überhaupt möglich ist), sind jene für die Kinder. Für uns bleibt nur die hoffentlich schöne Erinnerung an intensiv gelebte Elternjahre. Dass wir mit mehrheitlich guten Gefühlen auf sie zurückblicken, auf eine Zeit well wasted – als wir das Geben von Unterstützung gegen das Nehmen von Unterhaltung tauschten. Danach sind wir quitt.
Das Kind als Ego-Prothese
Alles, was wir als Menschen tun, tun wir eigennützlich. Auch erziehen. Ein Kind oder die Gesellschaft mögen einen Vorteil davon haben. Aber es ist unsere Entscheidung, die wir so oder anders treffen können. Unsere Entscheidung ist also nicht selbstlos: Wir haben ein Kind, weil uns dies für unser Leben sinnvoll erscheint – weil wir Vorteile davon haben.
Aus einem Kind Vorteile zu ziehen, ist traditionelles Kalkül. Bis heute gibt es die Mithilfe der Kinder in Haus und Hof. Andere Formen sind hierzulande verschwunden, etwa Sicherung des materiellen Lebensabends bis hin zu Kinderarbeit in Bergwerk und Fabrik. Aber es gibt auch immaterielle Gewinne, die wir mit »Unterhaltung« während und nach den Elternjahren umschrieben haben. Diesen Gewinnen möchte ich einen weiteren hinzufügen: Das Kind dient oft der elterlichen Selbstdarstellung. Es dient dem sozialen Status.
Fragen wir uns selbst: Wollen wir als Eltern in unserem sozialen Umfeld glänzen? Können wir nur schamvoll zugeben, dass unsere Tochter in der Schule nicht mithalten kann? Tun wir uns schwer, im Freundeskreis zu sagen, dass unser Sohn eine Lehre als Ofensetzer macht – wo doch die Kinder unserer Freunde alle studieren –, oder wie soll man es sonst verstehen, wenn Eltern ihr Kind auf Teufel-komm-raus ins Gymnasium zwingen? Für wen inszenieren wir das Theater um das Kind? Für das Kind? Oder vor allem für uns selbst?
Ein Kind, wohlerzogen und schulisch brillant, ist für viele Eltern eine Trophäe auf der gesellschaftlichen Jagd nach Besonderem – ähnlich anderer individualisierter Produkte, mit denen man sich von »der Masse« abheben will. Abheben vor allem von Kollegen, Nachbarn und Freunden. Nur mühsam verbrämt prahlt man mit den Erfolgen des Kindes, aber legt doch Wert auf sichtbare Groß- und Kleintriumphe. Oder lässt durchblicken, das Kind wachse ohne »Teufelszeug« auf wie etwa Minecraft, Plastikspielzeug oder Kuhmilch. Das geht bis hin zum offenen Angebertum, das in einer auf Selbstdarstellung fixierten Welt an Sandkästen, bei Elternabenden und auf Partys ganz unverhohlen protzt: »Wir sind so was von toll!« So wertet das Kind den eigenen Genpool auf, wird zu einem Unterscheidungsmerkmal, zur Ego-Prothese.
Dürfen wir womöglich sagen, dass Eltern ihr Kind ausbeuten? Die aber behaupten, sie täten das Beste für das Kind? Auch wenn wir kühler analysieren: Was »das Beste« ist, bestimmt das Ego der Eltern. Wie gesagt, wir handeln als Eltern immer eigennützlich. Es ist jedoch ein Unterschied, ob Eltern egoistisch handeln. Egoistisch im Sinne von selbstsüchtig und rücksichtslos. Egoistisch auch in der Anmaßung, die »wahren« Interessen des Kindes zu vertreten. Wir gehen nicht zu weit, wenn wir sagen: Diese Eltern lieben das Kind nicht, sie brauchen es. Von dort ist es nicht weit zum Gebrauchen. Von dort nicht weit zum Verbrauchen.
Die meisten Eltern werden das zurückweisen. Und je empörter sie das tun, umso mehr ist ein Nerv getroffen. Dieser Nerv wird fortwährend sensibilisiert durch das omnipräsente Vergleichen. Es reicht nicht mehr, »nur« eine Karriere zu machen oder eine glückliche Familie zu haben – nein, man muss eine kaum unterbrochene Folge von demonstrierbaren Lebenssiegen einfahren, vor allem aber beim Vergleich mit anderen besser abschneiden.
Deshalb kalkuliert man bei den Aktivitäten die Präsentationsleistung des Kindes. Manchen Eltern ist es überhaupt nicht peinlich, fortwährend Bilder ihrer Kleinen auf Facebook oder Instagram zu posten. Subtext: »Sind sie nicht süß?« Sind sie. Meistens jedenfalls. Falls nicht, würden wir uns ohnehin eine Antwort verkneifen. Ein Bild wäre ja auch noch ok. Aber vier, fünf Bilder, ganze Galerien? Die Wahl des Objekts verweist auf das Subjekt zurück. Das will es offenbaren: Das Kind ist das Zentrum unserer Welt! Was wir sind, das sind wir durch unser Kind. Bis hin zur Kommerzialisierung des Kindeserfolgs, namentlich durch Influencer – zu 90 Prozent Frauen. Ihr Lebensmotto: Präsentiere dich so, dass du gemocht wirst! Ein uraltes Muster. Das hat man Töchtern schon immer eingeflüstert. Tatsache ist, dass Säuglinge ohne die Aufmerksamkeit der Umwelt sterben – weshalb sie mit der Fähigkeit ausgestattet wurden, diese Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Manche Erwachsene haben das nie verlernt.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: