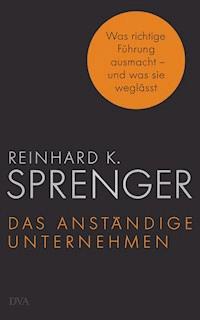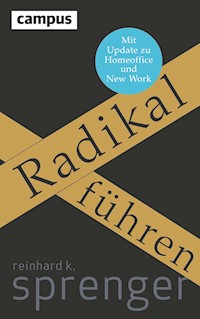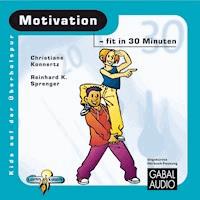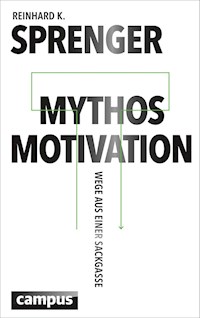Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
»Gehirnwäsche trage ich nicht«, so lesen wir in Wolfgang Hildesheimers Mitteilungen an Max, »ich bin leidlich abgehärtet«. Die eigenwillige Metapher hat Reinhard K. Sprenger zum Leitmotiv seines neuen Buches gewählt, das dem unabhängigen Denken ein »Denkmal« setzt. Dabei bezieht der Bestseller-Autor sein Lebensthema – Last und Lust der Freiheit – auf vielfältige Lebenswelten: Arbeit, Politik, Privates – sogar auf Schulen. Immer fragt er nach Alternativen, nach Spielräumen, nach Offenheit. Und nennt auch seine Gegner: Staatsgläubigkeit, Selbsteinsperrung, Meinungsepidemien, Deutlichkeitsverbote, Leugnungsmanöver. Vor allem zeigt er auf den »Leadershit«, den er in den Unternehmen beobachtet. Sprengers Buch, das besondere und wieder entdeckte Texte und Interviews der letzten Jahre versammelt, ermutigt zu Selbstvertrauen, aufrechtem Gang und selbstbestimmtem Handeln – gerade in unsicheren Zeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REINHARD K. SPRENGER
Gehirnwäsche trage ich nicht
Selbstbestimmt leben und arbeiten
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
»Gehirnwäsche trage ich nicht«, so lesen wir in Wolfgang Hildesheimers Mitteilungen an Max, »ich bin leidlich abgehärtet«. Die eigenwillige Metapher hat Reinhard K. Sprenger zum Leitmotiv seines neuen Buches gewählt, das dem unabhängigen Denken ein »Denkmal« setzt. Dabei bezieht der Bestseller-Autor sein Lebensthema – Last und Lust der Freiheit – auf vielfältige Lebenswelten: Arbeit, Politik, Privates – sogar auf Schulen. Immer fragt er nach Alternativen, nach Spielräumen, nach Offenheit. Und nennt auch seine Gegner: Staatsgläubigkeit, Selbsteinsperrung, Meinungsepidemien, Deutlichkeitsverbote, Leugnungsmanöver. Vor allem zeigt er auf den »Leadershit«, den er in den Unternehmen beobachtet. Sprengers Buch, das besondere und wieder entdeckte Texte und Interviews der letzten Jahre versammelt, ermutigt zu Selbstvertrauen, aufrechtem Gang und selbstbestimmtem Handeln – gerade in unsicheren Zeiten.
Vita
Reinhard K. Sprenger, promovierter Philosoph, ist der profilierteste Führungsexperte Deutschlands. Seine Thesen sind nicht immer bequem, werden aber seit Jahrzehnten erfolgreich umgesetzt. Zu seinen Kunden zählen zahlreiche internationale Konzerne sowie fast alle DAX-100-Unternehmen. Neben »Mythos Motivation« zählen zu seinen erfolgreichsten Publikationen »Das Prinzip Selbstverantwortung«, »Die Entscheidung liegt bei dir«, »Vertrauen führt«, »Radikal führen«, »Das anständige Unternehmen« und »Magie des Konflikts«. Der Bestsellerautor ist bekannt als kritischer Denker und brillanter Redner, der nachdrücklich dazu auffordert, selbstbestimmtes Handeln und unternehmerische Initiative zu wagen.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Ein Lob auf den Zufall
Betreutes Leben im Bevormundungsstaat
Hi, du Zeitgenosse! Über Distanzen zwischen Mensch und Mensch
Wie schaut der Staat den Bürger an?
Entscheidung
Menschenbild
Misstrauen
Gouvernementalität
Folgen
Reduziere nicht übermäßig Wahlmöglichkeiten!
Hört auf mit dem Frauenzählen!
Das eigene Rennen laufen
Last und Lust der Freiheit
Halbherzigkeit abwählen – Die Freude des Lehrens und die Motivation in der Schule
Die positive Kraft des negativen Denkens
Warum Impfanreize korrumpieren
Mein liberaler Liberalismus
Bekenne, du schlechter Mensch!
Der gerechte Preis
Die Sinngebung des Sinnlosen
Next Leadership?
Leadershit – und was wir damit anrichten
Richtig entscheiden – Management als Kontingenznegation
Authentisch Führen – Management als Entzivilisierungsprozess
Vorbildlich und authentisch?
Soziale Verantwortung – leerer Begriff ohne Furcht
Es gibt nur erfolgreiches und nicht-erfolgreiches Management
Wer fragt, der führt – auch an der Nase herum
Fürsorgepflicht – Leistungspartnerschaft oder betreutes Arbeiten?
Die Logik des Scheiterns
1.
Der Glaube an Erfolgsrezepte
2.
Eine lange, kausal erzählte Erfolgsgeschichte
3.
Unternehmensautismus
4.
Schlechte Nachrichten werden ignoriert.
5.
Individualisierung struktureller Schieflagen
Unsinn im Sinn: Purpose
Die Regierungen hatten keine Wahl
Führung muss an die Zukunft erinnern …
… und Alternativlosigkeit verhindern
Der neue Behauptungsdespotismus
»Sprache prägt das Bewusstsein.«
»Gemischte Teams entscheiden besser.«
»Gewinn und Aktienkurs steigen, wenn eine Frau in der Geschäftsleitung ist.«
»Arbeitszufriedenheit macht produktiv.«
»Ökonomischer Erfolg ist planbar.«
Der virologische Imperativ
Missbrauchte Solidarität
Das Büßerhemd als Outfit der Moderne
Homeoffice sollte nicht zum Regelfall werden
Die Wiedereinführung des Menschen
Warum gibt es Führung? Weil es Krisen gibt!
Ich saß an den Hausaufgaben, 1968, ich war 15 Jahre alt, das Kofferradio lief, ein Vorleser beschrieb ein Labyrinth, in dem sich ein Autofahrer vorwärts bewegt. Er fährt zwischen Hecken, die die enge Straße säumen, sie heben und senken sich. Hinter einer Biegung plötzlich ein Reiter, der Fahrer fantasiert über dessen Herkunft und Ziel, überholt ihn, stößt auf zwei weitere Reiter, er spinnt Beziehungen … Bald lauschte ich nur noch, ganz gebannt von der formschönen Sprache, der genauen Beobachtung. Der Sprecher beendete den Text: »Aus der Reihe ›Wir lesen vor‹ lasen wir aus Wolfgang Hildesheimers Buch Zeiten in Cornwall.« Ich ließ die Hausaufgaben sein, was sie meistens waren: unerledigt, erbat mir etwas Geld von meiner Mutter und lief zur Baedeker-Buchhandlung im Zentrum meiner Heimatstadt Essen. Da stand das schmale Suhrkamp-Bändchen! Es war der Beginn einer langen Lesefreundschaft. Und einer kurzen Brieffreundschaft: Hildesheimers plötzlicher Tod 1991 verunmöglichte ein verabredetes Treffen. Wolfgang Hildesheimer brachte mich also erst zum Hören, dann zum Lesen, dann zum Schreiben.
Ein Ergebnis dessen liegt vor Ihnen. Aus Hildesheimers fabelhaft lakonischen Mitteilungen an Max stammt das Zitat, das ich zum Titel dieser Aufsatzsammlung wählte: »Gehirnwäsche trage ich nicht«. Es verweist auf die mentalen Verseuchungen, die die Pathosformeln und das eilige Meinen tagtäglich anrichten. In seiner heiteren Kopfnote soll es Widerständiges andeuten. Denn alles Denken ist auf gewisse Weise polemisches Denken – wozu sollte ich meine Stimme heben, wenn nicht gegen etwas, was ich für verfehlt hielte?
Versammelt sind hier vorrangig Texte, die ich in der NZZ – Neue Zürcher Zeitung publizierte. Aktuelle Gegenstände waren mir jeweils Anlass, überzeitlich Gültiges zur Sprache zu bringen. Hinzugefügt habe ich einige Interviews und Artikel, die im letzten Jahrzehnt an verstreuten Orten erschienen sind. Allzu Zeitbedingtes habe ich getilgt. Und so hoffe ich, dass insgesamt ein »gutes Buch« entstanden ist – man sollte ja ohnehin nur »gute« Bücher lesen. Den Verkauf stelle ich mir nach Hildesheimer so vor: Eine Frau betritt die Buchhandlung. Der Buchhändler: »Was darf es sein?« Die Kundin: »Können Sie mir ein gutes Buch empfehlen?« Der Buchhändler: »Selbstverständlich!« (Er geht zu einem Regal, greift hinein, zieht ein Buch heraus und überreicht es der Kundin): »Der neue Sprenger!« Die Kundin schaut auf den Titel, liest »Gehirnwäsche trage ich nicht« und sagt: »Wunderbar, ich will mich ohnehin etwas abhärten …«
Winterthur, im Frühjahr 2023
»Ein unerklärlicher Erfolg war noch immer besser als ein gut analysiertes Scheitern.«
Ein Lob auf den Zufall
Blackout! Im Mai 2019 wurde eine süddeutsche Buchhandelskette Opfer eines schwerwiegenden Hacker-Angriffs. Alle Server mussten ausgeschaltet werden, alle Systeme runtergefahren. Per E-Mail war das Unternehmen nicht mehr erreichbar, der Webshop war tot. Etliche Mitarbeiter waren von dieser Situation überfordert, gleichsam paralysiert. Als wären sie »drogenabhängig« – abhängig von der Droge Computer. Schlagartig wurde klar, wie viel Zeit sie vor dem Monitor verbrachten. Vor allem sozialallergische Mitarbeiter wussten kaum mehr, was zu tun war. Sich dem Kunden zuwenden? Gespräche führen? Die Lage führte jedermann vor Augen, dass man sich vorrangig mit Nachrangigkeiten durch den Tag schlug. Es war jedoch noch eine weitere Lektion zu lernen: der Autonomieverlust durch zentralistische IT-Strukturen. Plötzlich war man auf sich allein gestellt. Musste wieder Verantwortung übernehmen. Selbst denken, selbst handeln. Weil sonst nichts lief. Und siehe da: Nicht nur die Verkaufszahlen stiegen – es machte auch mehr Spaß. Es war wie das Wiederentdecken des Erwachsenseins, der selbsthelferischen Kräfte.
Was auf den ersten Blick lediglich das Gute im Schlechten schildert, verdeckt den Blick auf Wesentlicheres – auf das, was nicht veränderbar ist. Wer hätte nicht schon mal versucht, dem Masterplan des Lebens auf die Spur zu kommen, dem Schicksal, dem Nicht-Wählbaren, dem Kontingenten? Fragen zu klären wie: Warum geschieht gerade dies mir, uns, ihnen? Als Kinder knödelreimten wir »Warum ist die Banane krumm?«, nicht ahnend, wie sehr wir an eine anthropologische Grundverfasstheit rührten: an den Menschen als Warum-Wesen. Er sucht für jedes Phänomen eine Erklärung, eine Ordnung. Eine Ur-Sache. Und wenn er sie nicht findet, er-findet er eine.
Früher war diese Ursache einsilbig: Gott. Wenn die Ernte ausblieb – Gott will uns strafen. Starb jemand zu früh – Gottes Wille. Hatten wir Glück – Gott hat Gnade walten lassen. Den Extremfall etikettierten wir als »Jüngsten Tag«. Wir verbeugten uns vor dem Göttlichen, dem Unabänderlichen, was ein Mensch ist und wie ihm geschieht.
Damit ist es vorbei. Nietzsches berühmte Formulierung »Gott ist tot« signalisierte das Ende der Bescheidenheit. Und den Beginn der Moderne. Diese hat ein Personaleinsatzproblem. Wer soll Gottes vakante Stelle besetzen? Wer »macht« jetzt das Schicksal? Kandidaten sind vor allem jene, die nicht Gott sind: die Menschen. Aber auch sie haben nicht alles im Griff, nicht alles verläuft nach Plan. Diesen Fall erklärt man heute mit dem Zufall. Er ist das große Unerklärliche, eine Entgleisung in Gottes Räderwerk, der Plandurchkreuzer in Dürrenmatts Die Physiker. Etwas kommt dazwischen, stellt sich quer zur Absicht. Nicht gewollt, nicht gewählt, weder notwendig, noch vorhersehbar. Ein Feind menschlicher Freiheit und Würde. Schallend lacht er über Beruhigungstechniken wie Risikokalkulation und Expertenautorität. Empörend.
Seit Angedenken übt sich deshalb der Mensch, den Zufall zu bändigen, die Fülle der Möglichkeiten zu begrenzen, seine Welt zu ordnen und festzulegen. Und je mehr der Moderne das gelingt, desto mehr leidet sie unter dem Restrisiko, desto mehr artikuliert sich ein extremes Bedürfnis, den Zufall möglichst vollständig aus dem Leben zu verbannen. Man will kontrollieren, alles, irgendwie, auch den eigenen Körper. Entsprechend wird der Zufall methodisch storniert: Vorsorge, Plan, Versicherung, Back-up, Nummer Sicher – übrigens ein Wort aus dem Strafvollzug. Das Leben wird unter eine vorauslaufende ceteris-paribus-Klausel gestellt: Alles soll gleichbleiben, und wenn sich etwas ändert, dann bitte nur als willkürlich herbeigeführte Perfektionierung.
Das lässt sich ausbeuten. Von der Politik etwa, die verspricht, den Menschen vor dem Zustoßenden zu schützen – und unter der Hand die Zufallsvorsorge zur infantilisierenden Volkspädagogik wandelt: Der Mensch ist, was er ist, das Ergebnis planerischer Absicht. Auch die Wirtschaft lässt sich nicht lumpen: Es gibt eine riesige Industrie, die nichts anderes verkauft als Angst. Und sich nach der Pathologisierung der Zukunft selbst als Therapeutikum empfiehlt. Sogar im Pakt mit der Philosophie: »Die philosophische Betrachtung hat keine andere Absicht, als das Zufällige zu entfernen.« Wer wollte Georg Wilhelm Friedrich Hegel widersprechen?
Legen wir dennoch ein gutes – naturgemäß »zufälliges« – Wort für den Zufall ein.
Zunächst ist der Zufall weder gut noch schlecht. Es gibt glückliche Zufälle, auf die niemand verzichten will. Oder er ist beides, wie oben am Beispiel des Buchhandels illustriert. Für die Evolution hingegen ist der Zufall eindeutig gut – als Überlebensprinzip. Die Biologie liebt die kleinen Kopierfehler bei der Herstellung von Imitationen: Über Sex werden die Erbanlagen zweier Individuen zufällig gemischt und auf gemeinsame Nachkommen verteilt. Die Bandbreite möglicher Varianz erhöht sich damit exponentiell. Das wiederum ist wichtig gegen evolutionäre Wettbewerber; sie können sich umso schlechter auf jemanden einstellen, der häufig die Form wechselt. Dasselbe gilt für ökonomische Akteure: Wirtschaftlich erfolgreich sind jene, die nicht ausrechenbar sind. Die Chancen sehen, die der Zufall bietet. Und handeln. Ersteres tun manche, das zweite ist seltener. Viele hat der Zufall gerufen, aber wenige haben ihn auserwählt.
Evident ist ebenso, dass wir uns als Individuen nicht durch planerische Erfolge entwickeln, sondern durch Schwierigkeiten. Wer den Zufall auszuschalten versucht, leidet mithin an Misserfolgsarmut. Zudem übersieht er die Blumen am Wegesrand. Überraschend Neues entsteht oft aus einem Zustand, der auf den ersten Blick wie eine Katastrophe wirkt. Das Unvorhergesehene bietet zumindest die Möglichkeit, neuer, anders, besser zu sein als zuvor. Und weil ihm etwas dazwischengekommen ist, hat er auch eine Geschichte, die der Persönlichkeit Form gibt. Die ist erzählenswert. Ohne Zufall keine Erzählung! Wer sie mitteilen will, sollte daher seine Selbstwirksamkeit relativieren: Unsere Geburt ist uns zugefallen, unser Land, in dem wir aufgewachsen sind, unsere Herkunftsfamilie, die Zeitbedingungen: Das haben wir nicht gewählt, da stecken wir drin. Als deutscher Mann zum Beispiel, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, hat man mit historisch vorbildlosen Friedensjahrzehnten das große Los gezogen.
Wer dafür votiert, dass alles dem Walten eines unpersönlichen Fatums unterliegt, kommt gleichwohl um den Zufall nicht herum: Die Welt, wie sie ist, hätte vom Schöpfer anders gestaltet werden können, unbegrenzt, ist also eine Schöpferlaune, insofern Realisation von Freiheit. Diese wiederum ist Voraussetzung unserer Reaktion auf das Zugefallene, einer beobachtenden und reagierenden Freiheit, einer Freiheit zweiter Ordnung. Deshalb dementiert der Zufall nicht die menschliche Freiheit, sondern ist ihre Bedingung. Angesichts des Zufalls sind wir also herausgefordert, uns in der Freiheit zu üben und die Gelegenheiten zu nutzen, deren endliche Summe das ganze Leben ist. Konkreter noch: Wenn es nur einen einzigen Menschen gibt, der auf dieselbe Zufälligkeit unterschiedlich reagiert, reicht das aus für Selbstverantwortung.
Nur auf den schicksalhaftesten aller Zufälle können wir nicht reagieren – auf unseren Tod. Dann fällt zu, was fällig ist. Wer aber mit Heidegger der Ansicht ist, dass der Mensch bereit ist zu sterben, wenn er geboren wurde, der hat auch die kalten Duschen des Lebens mitgewählt – der Möglichkeit nach.
Dem Zufall eine Chance geben – wie macht man das? Spiel und Kunst sind dafür Gelegenheiten. Zelte bauen statt Paläste. Wenn Planung, dann mittlerer Reichweite; das aviatische »Fliegen auf Sicht«. Die Lethal-Weapon-Lektion: Always have a backup plan. Brauchbare Momentlösungen statt »letztendliche« Lösungen. Experimentieren. Möglichkeitsbewusstsein entwickeln. Redundanzen bilden – wer zu schlank ist, hat im Fall der Fälle »nichts mehr zuzusetzen«. Bei der Personalauswahl: Würfeln! So wie man es schon in Athen tat, in Florenz, Venedig und Basel. Auf Ziele verzichten – sie verleiten zum Tunnelblick, verführen zum Festhalten, vermiesen die Gegenwart. Ein unerklärlicher Erfolg war noch immer besser als ein gut analysiertes Scheitern.
Das alles ist nicht leicht in einem Land, in dem Todesgefahr und Lebensgefahr dasselbe meint. Aber es lohnt sich – wenn es der Zufall will.
NZZ vom 28.10.2019
Betreutes Leben im Bevormundungsstaat
René Scheu: In Deutschland feiert man Sie als »deutschen Superstar unter den Management-Autoren«. Sie ziehen es jedoch vor, entfernt von Ihren Lesern in der Nachbarschaft zu wohnen, in der man Sie kaum behelligt. Warum sind Sie in die Schweiz gezogen?
Reinhard K. Sprenger: Die Mutter meiner beiden kleinen Söhne ist Schweizerin. Meine Eltern sind tot, Großeltern aber sind wichtig für Kinder, weil sie die alten Werte repräsentieren. Und da die Großeltern in der Schweiz leben, habe ich mich entschieden, hierher zu ziehen. Ein zweiter Grund für meinen Umzug ist, dass ein langjähriger Freund CEO von Adecco wurde, einem Personalvermittlungsunternehmen mit Sitz in Glattbrugg. Er hat mich gebeten, ihm im Management-Development zu helfen – insofern ist die Schweiz für mich die ideale Drehscheibe.
Wer Ihre jüngeren Veröffentlichungen liest, bekommt freilich den Eindruck, dass der Umzug nicht nur persönlich-beruflich motiviert sein könnte. Sie gehen mit dem deutschen Staat hart ins Gericht …
Deutschland wird für einen Menschen, dem Freiheit viel bedeutet, in der Tat immer unerträglicher.
Sind also dennoch politische Motive im Spiel?
Na ja, die Schweiz ist auch nicht mehr die Oase der Bürgerwürde, als die sie sich gerne sieht. Auch hier schwillt der Entmündigungskoeffizient beharrlich an, ich sehe da allenfalls graduelle Differenzen zu Deutschland. Meine deutschen Freunde unterstellen mir gerne steuervermeidende Umzugsgründe. Schön wär’s! Der relativ kleine und immer kleinere Steuervorteil, den die Schweiz gegenüber den umliegenden Ländern bietet, wird gerade in Zürich durch die sehr hohen Lebenshaltungskosten mehr als wettgemacht.
Machen wir uns in der Schweiz etwas vor?
Es ist eine Frage der Perspektive – verglichen mit Deutschland ist der Sozialstaat in der Schweiz noch vernünftig dimensioniert. Aber nirgendwo in Europa wachsen die Sozialbudgets proportional so wie in der Schweiz. Der wesentliche Unterschied liegt zwischen »geben« und »nicht nehmen«. In Deutschland nimmt mir der Staat viel weg und gibt mir dann etwas davon zurück. Natürlich abzüglich der Kosten für die Umverteiler selbst. In der Schweiz nimmt mir der Staat nicht so viel und lässt mich wählen, welche Dienstleistung ich kaufen will. Das ist schon respektvoller.
Dann stimmt also die Geschichte, die wir uns erzählen: Während der Schweizer Bürger dem Staat widerwillig einen Teil seines Geldes abliefert, gebärdet sich der deutsche Staat so, als würde er dem Bürger gleichsam aus Großzügigkeit einen Teil von dessen Geld lassen.
Der deutsche Staat hat sich verselbstständigt, er hat sich vom Rechtsstaat zum Bevormundungsstaat entwickelt. Er ist nicht mehr neutral gegenüber den Lebensentwürfen seiner Bürger, sondern er will ein volkspädagogisches Programm durchsetzen. Er ruft dem Bürger zu: »Ich weiß, was für dich gut ist!«, nämlich nicht rauchen, nicht fett sein, möglichst viele Kinder haben, und vor allem konsumieren. Wenn ich mich seiner Gesinnungsnötigung beuge, habe ich Steuervorteile. Was aber bedeutet, dass ich mit meiner Hand in der Tasche des Nachbarn lebe, da der Staat ja nicht plötzlich weniger Geld braucht. Der Nachbar versucht natürlich ebenfalls, seine Hand in meine Tasche zu stecken. Darüber schmettern die Fanfaren der Solidarität und des Gemeinwohls. Aber es ist institutionalisierte Respektlosigkeit.
Immerhin – die Umverteilungspolitik ist in der Schweiz schwächer ausgeprägt.
Das Individuum hat hier tendenziell mehr Wahlfreiheit, bestimmte Dienstleistungen zu nutzen, muss diese aber erheblich höher bezahlen. In Deutschland hat der Großteil der Bevölkerung eine ausgesprochen parasitäre Lebenseinstellung entwickelt. Über die Hälfte aller Deutschen lebt mittlerweile mehrheitlich von Sozialtransfers. Man holt sich an der Wahlurne, was man im Wirtschaftlichen nicht leistet.
Sie schrieben einmal: »Das [deutsche] Steuergesetz versorgt einen Verteilungskanal, der vorne ein gefrässiges, hinten ein verantwortungsloses Ungeheuer ist. Und zu dem man bei einer Staatsquote von 50 Prozent nur noch ein Verhältnis haben kann: Notwehr.« Was genau meinen Sie mit Notwehr?
Sie haben im Grunde zwei Möglichkeiten: voice oder exit. Voice ist Notwehr im Sinne von »ich begehre auf«, ich »weigere mich»; Exit ist Notwehr im Sinne von »ich gehe weg«, »ich verlasse das System«. Mein Buch Der dressierte Bürger gehört zur Kategorie Voice – aber in Deutschland hat es eine totalitäre Steuerbürokratie geschafft, aus dem Land der Dichter und Denker ein Land der Steuerhinterzieher zu machen. Sie unterwerfen sich dem Bevormundungsstaat und fühlen sich deshalb berechtigt, ihn auszubeuten.
Dies würde zu einer für Liberale ernüchternden Einsicht führen: Wenn die wachsende Anspruchshaltung des Staates gegenüber dem Bürger einhergeht mit einer wachsenden Anspruchshaltung des Bürgers gegenüber dem Staat, dann leben wir im perfekten System.
In Deutschland hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg für etwa fünfzig Jahre eine wirtschaftlich einzigartige Sonderkonjunktur. Es ist ganz natürlich, dass das Sicherheitsbedürfnis unter solchen Voraussetzungen zunimmt und die Bürger immer mehr Ansprüche auf Wohlstand und soziale Sicherung geltend machen. Aber dafür war ein Preis fällig: Die staatliche Verwöhnung hat die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Individuen sukzessive zerstört. Man glaubt nicht mehr an sich, man glaubt an den Staat. Das ging so lange relativ gut, wie es historisch vorbildlose Wachstumsraten gab. Aber diese Zeit ist vorbei. Und jetzt droht das System an der selbst induzierten Überforderung zusammenzubrechen.
Der Philosoph Peter Sloterdijk spricht in seinem Buch Sphären III vom »quasi-totalen Allomutterstaat des 20. Jahrhunderts«: »Der Staat fungiert seit seinem Umbau zur Wohlfahrts- und Betreuungsagentur als Metaprothese, die den konkreten mutterprothetischen Konstrukten, den sozialen Hilfsdiensten, den Pädagogen, den Therapeuten und ihren zahllosen Organisationen die Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben an die Hand gibt.«
In der Tat. Der real existierende Bürger wird ständig mit Verhaltensidealen konfrontiert, vor dessen Hintergrund er automatisch defizitär erscheint. Was wieder die Bevormundungsindustrie ermächtigt, die Kluft zwischen Sein und Sollen zu bewirtschaften. Das ist betreutes Leben. Aber was kostet uns die systematische Verbannung der Bürgerwürde? Oberflächlich ist es der Verlust der Fähigkeit, selbstbestimmt und selbstverantwortlich zu leben. Schaut man tiefer, dann ist es der Verlust der Selbstachtung. Blickt man auf den Grund, dann sieht man den hoffnungslosen Versuch, den Tod aus dem Leben auszusperren. Der Tod kehrt aber hinterrücks zurück – er treibt das Leben aus dem Hause.
Wenn man sich durchs Abendprogramm der deutschen Privatsender zappt, trifft man auf Menschen, die ein gegenleistungsloses Grundeinkommen beziehen. Sie scheinen weder besonders glücklich noch besonders unglücklich.
Ob jemand glücklich oder unglücklich ist, hängt weniger von den äußeren Umständen ab, als vielmehr von seiner inneren Einstellung. Der Staat kann und darf gar keine Glücksversprechen abgeben. Er soll einen Rechtsrahmen schaffen, in der die Bürger auf ihre je eigene Weise nach dem Glück streben können. Das ist die »negative« Freiheitsidee als weitgehende Abwesenheit von Zwang, die sich auch jeder erzieherischen Zudringlichkeit enthält. Das Grundeinkommen ist hingegen einer »positiven« Freiheit verpflichtet, die aktiv gestaltend in diesen Suchprozess der Individuen eingreift und sich mit sozialen Wünschbarkeiten verknüpft. Dabei wird die große Botschaft des nachparadiesischen Christengottes ignoriert: Tue, was du willst, und zahle dafür. Selbst! Und bürde nicht die Konsequenzen deines Tuns anderen Menschen auf.
Es ist unter den gegebenen Umständen absolut rational, sich so zu verhalten.
Die bloße Existenz sozialer Institutionen ist eine strukturelle Dauereinladung, sie auch zu nutzen. Sie erzeugt eine angebotsinduzierte Nachfrage. Eigentlich ist ein Depp, wer es nicht tut. Politik ist daher stets Beileidspolitik. Es gibt unendlich viele öffentliche Instanzen, die die gelernte Hilflosigkeit der Menschen ausbeutet, um sich unersetzlich zu machen. Je hilfloser die Menschen, desto mehr können Politiker verteilen und regulieren. Vor allem auch zu ihren eigenen Gunsten. Deshalb etikettieren sie ihre eigenen Interessen als Gemeinwohl.
In einem Ihrer Songs heißt es: »Bitte hilf mir nicht, es ist auch so schon schwer genug.« Das mutet vor dem Hintergrund des eben Gesagten idealistisch, ja fast anachronistisch an.
Gegenüber Menschen, die ihre Interessen selbst artikulieren können, verbietet sich jede Einstellung der Fürsorglichkeit. Führung, und das meint auch politische Führung, darf sich nur als Führung zur Selbstführung verstehen. Man muss den Menschen die Chance geben, erwachsen zu werden. Hilfe ist nur da notwendig, wo ein Mensch sich nicht mehr selbst helfen kann.
Der westliche Sozialstaat beruht ja auf dem Prinzip, dass er Menschen hilft, die nicht »selbstverschuldet« in eine Notlage geraten sind. Das Problem ist die Dehnbarkeit dieses Begriffs.
Man kann den Begriff so weit fassen, wie es die US-Amerikaner getan haben. Wer kein eigenes Haus besitzt, wer also nicht zur nation of home owners gehört, war dort offenbar in einer existenziellen Notlage. Der Preis für Risiko wurde daher durch die Politik künstlich gesenkt: Leute, die keinen Job und keinen einzigen Cent in der Tasche hatten, konnten nicht nur ohne Geld Häuser bauen, sondern kriegten gleich auch noch Kreditkarten mitgeliefert, die sie beliebig überziehen konnten – mit den ihnen faktisch nichtgehörenden Häusern als Sicherheit. So kauft man sich Wählerstimmen. Und führt die Wähler ins Elend, indem man die gute Absicht plakatiert und vor den bösen Konsequenzen die Augen verschließt. Einer der Hauptpromotoren dieses Großattentats auf die Menschheit war übrigens Barack Obama.
Ob ein Mensch noch über die Kraft verfügt, sich selbst zu helfen oder nicht, merkt er erst, wenn er leidet.
Wer Menschen ihrer Leidensfähigkeit beraubt, beraubt sie zugleich ihrer Selbstwirksamkeit. Wir müssen das Leiden als Kraftquelle und Lernimpuls neu entdecken. »Alle Veränderung erfolgt aus Leid«, sagte Goethe.
Wenn Sie dies ernsthaft propagieren, werden Sie als Unmensch hingestellt. Der Common Sense sagt: Wer heute noch leiden muss, verdankt sein Leiden jemandem, der ihn leiden macht.
Das Leid, von dem wir hier sprechen, ist zunächst ein selbstdefiniertes Phänomen. Und wir wissen aus der Anthropologie, dass sich alle unsere Talente und Kräfte den Problemen verdanken, die uns herausgefordert haben und an denen wir haben wachsen konnten.
Es gibt den Punkt, an dem das Leiden das Individuum nicht mehr anspornt, sondern kaputtmacht.
Ja, aber dieses Konto wird oft überzogen. Dennoch stellt sich hier die Frage nach der Solidargemeinschaft.
Diesen Punkt definiert in Demokratien die Politik.
Die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit, letztlich schon, ja.
Aber die Politiker, sagen Sie, haben ja ein Interesse an Menschen im Zustand der Unmündigkeit.
Die Politik hat viel von dem zerstört, was früher die Familien an Strukturen, Rahmen und Hilfe leisteten. Nehmen wir die »Solidarität« – sie ist immer individuell und freiwillig, niemals kollektiv und erzwungen. Sie gehört in die Familie, in den Nahbereich, dort ist sie unersetzlich. Was heute unter »Solidarität« verkauft wird, ist nichts anderes als Gruppenegoismus – positiv ummäntelt und nötigend präsentiert. Große Teile der Politik wollen die Gesellschaft nach dem Modell der Familie lenken, die »große Welt« den Regeln der »kleinen Welt« unterwerfen. Der Wohlfahrtsstaat hat den Anspruch, uns durch erzwungene Umverteilung von freiwilliger Solidarität zu entlasten. Am Ende des Verwöhnungsprozesses steht der mitleidlose, egoistische Bürger, den bloß noch interessiert, was er tun muss, um ein möglichst großes Stück vom Umverteilungskuchen zu bekommen.
Wir sind schon wieder in einer Sackgasse gelandet: Wie sollen verwöhnte Gesellschaften aus dieser Situation herausfinden?
Der Leidensdruck muss so groß sein, dass wir unsere Komfortzone verlassen müssen, weil sonst das Spiel zu Ende ist.
Das klingt zwar ehrenwert, ist aber doch wohl eher Wunschdenken. Der Leidensdruck ist nie groß genug.
Ich sehe kleine Hoffnungsschimmer. Die Finanzkrise hat in Deutschland beispielsweise nicht zu einer Erstarkung der Linken geführt. Ein weiteres Zeichen: Der EU-Zentralismus bröckelt. Es beginnt sich die Einsicht durchzusetzen, dass sich auch globale gesellschaftliche Probleme am besten in kleinen Einheiten lösen lassen.
Wer Ihre Bücher liest, kommt aber zum Schluss, dass der Staatsbankrott unvermeidlich sei. Ihr Buch Der dressierte Bürger beginnt mit dem Satz »Ich bin ein Staatsfeind«…
Ich bin zwar ein Freiheitsliebender, meine Staatskritik beschränkt sich jedoch auf die Mikroebene des Alltags. Ich analysiere, wie der Staat in meine Privatsphäre eindringt, wie er mich ködert, verführt, erzieht, lenken will, wie er mich abhängig macht. Was hingegen die Makroebene angeht, so würden Voraussagen meine Kompetenz überdehnen. Ich fürchte aber, auch die der Politik.
»Staatsfeind« ist ein krasses Wort. Man denkt dabei an Attentate und umstürzlerische Aktivitäten.
Das ist mir völlig fremd. Ich bin ein Feind jenes Staates, der mich nicht in Ruhe lässt. Es war die große Illusion der großen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, den »neuen Menschen« erschaffen zu können. Man will das Wollen abschaffen und es durch ein Sollen ersetzen. Auch in den Unternehmen: Die Menschen sollen – nicht mit Gewalt, sondern mit Anreizen – erzogen, konditioniert, motiviert werden. Am Ende hat man es stets mit verantwortungslosen Drogenabhängigen zu tun. Meine Botschaft ist eine andere: Nehmt den Menschen, wie er ist; wir haben keinen universalethischen Therapievertrag. An der Freiheit des anderen kommt ohnehin niemand vorbei.
Sie fordern eine neue Unternehmerbewegung. Die Zeiten könnten dafür besser nicht sein: Die Manager, lange als Helden gefeiert, werden als eigennutzmaximierende Karrieristen angeprangert. Dennoch ist es unter Unternehmern, wenigstens bisher, merkwürdig still geblieben.
Die Sollbruchstelle des gegenwärtigen Kapitalismus besteht darin, dass wir keine Antwort haben auf die Frage, wie der Übergang von einem Managerkapitalismus zu einem neuen Eigentümerkapitalismus zu bewerkstelligen sei. Fest steht: In den letzten Jahrzehnten war es möglich, ohne Einsatz von eigenem Geld, also ohne eigenes Risiko, so wohlhabend zu werden, wie es früher nur Unternehmer wurden. Das ist ein extrem attraktives Lebensmodell, das viele zu verwirklichen trachteten – unter dem wohlgefälligen Nicken staatlicher Aufsichtsbehörden. Unter solchen Bedingungen lohnt sich das Unternehmertum nicht mehr. Warum soll ich persönliches Risiko auf mich nehmen, wenn es auch ohne geht? Das heißt umgekehrt: Wer an einer Unternehmergesellschaft interessiert ist, muss die wertsetzenden Regularien innerhalb der Gesellschaft so bauen, dass sich Risikobereitschaft und Verantwortung wieder lohnen.
Die Unternehmer kämpfen gegen eine breite Front: nicht nur gegen markt- und innovationsskeptische Politiker, für die »Profit« ein Schimpfwort ist, sondern auch gegen die Manager und deren Vertreter in der Politik.