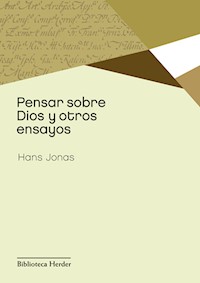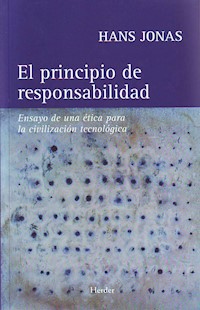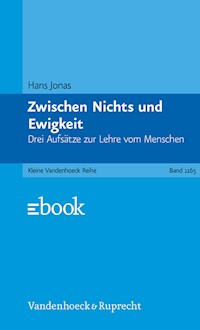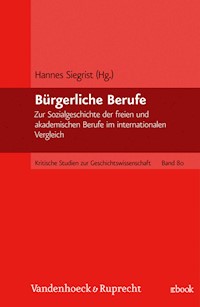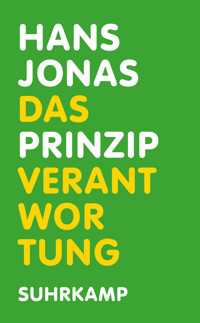
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Hans Jonas’ Einfluss auf die Entwicklung der Umweltethik ist kaum zu überschätzen.« Neue Zürcher Zeitung
Als Das Prinzip Verantwortung 1979 wenige Wochen vor der Gründung der Grünen erstmals erschien, war der Treibhauseffekt noch nicht im allgemeinen Bewusstsein angekommen. Heute sind die Auswirkungen des Klimawandels evident: Überflutungen in warmen Wintern, Waldbrände in trockenen Sommern. In seinem Standardwerk der Umweltethik formulierte Jonas allerdings schon vor vier Jahrzenten Antworten auf drängende moralische Fragen: Sind wir verantwortlich für den Fortbestand der Menschheit auf der Erde? Ist jeder Einzelne in der Pflicht? Und wie lassen sich Staaten und deren Institutionen zum Handeln bewegen?
Hans Jonas argumentiert für eine radikale Ethik der ökologischen Verantwortung, der Individuen, Unternehmen und Regierungen gleichermaßen unterworfen sind. Dabei geht er mit unserem bedingungslosen Technikglauben genauso hart ins Gericht wie mit den Dynamiken des Machterhalts in demokratischen Systemen, in denen Zukunft höchstens bis zur nächsten Wahl gedacht wird. Sein Plädoyer für den »Vorrang der schlechten vor der guten Prognose« ist aktueller denn je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hans Jonas
Das Prinzip Verantwortung
Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation
Mit einem Nachwort von Robert Habeck
Suhrkamp
Meinen Kindern Ayalah, Jonathan, Gabrielle
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Vorwort
Erstes Kapitel Das veränderte Wesen menschlichen Handelns
I
. Das Beispiel der Antike
1. Mensch und Natur
2. Das Menschenwerk der »Stadt«
II
. Merkmale bisheriger Ethik
III
. Neue Dimensionen der Verantwortung
1. Die Verletzlichkeit der Natur
2. Die neue Rolle des Wissens in der Moral
3. Sittliches Eigenrecht der Natur?
IV
. Technologie als »Beruf« der Menschheit
1. Homo faber über homo sapiens
2. Die universale Stadt als zweite Natur und das Seinsollen des Menschen in der Welt
V
. Alte und neue Imperative
VI
. Frühere Formen der »Zukunftsethik«
1. Ethik der jenseitigen Vollendung
2. Die Zukunftsverantwortung des Staatsmannes
3. Die moderne Utopie
VII
. Der Mensch als Objekt der Technik
1. Lebensverlängerung
2. Verhaltenskontrolle
3. Genetische Manipulation
VIII
. Die »utopische« Dynamik technischen Fortschritts und das Übermaß der Verantwortung
IX
. Das ethische Vakuum
Zweites Kapitel Grundlagen- und Methodenfragen
I
. Idealwissen und Realwissen in der »Zukunftsethik«
1. Vordringlichkeit der Prinzipienfrage
2. Tatsachenwissenschaft von den Fernwirkungen technischer Aktion
3. Beitrag dieser Wissenschaft zum Prinzipienwissen: Die Heuristik der Furcht
4. Die »erste Pflicht« der Zukunftsethik: Beschaffung der Vorstellung von den Fernwirkungen
5. Die »zweite Pflicht«: Aufbietung des dem Vorgestellten angemessenen Gefühls
6. Die Unsicherheit der Zukunftsprojektionen
7. Das Wissen vom Möglichen heuristisch zureichend für die Prinzipienlehre
8. Jedoch anscheinend unbrauchbar für die Anwendung der Prinzipien auf die Politik
II
. Vorrang der schlechten vor der guten Prognose
1. Die Wahrscheinlichkeiten bei den großen Wagnissen
2. Die kumulative Dynamik technischer Entwicklungen
3. Die Sakrosanktheit des Subjektes der Entwicklung
III
. Das Element der Wette im Handeln
1. Darf ich die Interessen Anderer in meiner Wette einsetzen?
2. Darf das Ganze der Interessen Anderer von mir aufs Spiel gesetzt werden?
3. Meliorismus rechtfertigt nicht totalen Einsatz
4. Kein Recht der Menschheit zum Selbstmord
5. Die Existenz »des Menschen« darf nicht zum Einsatz gemacht werden
IV
. Die Pflicht zur Zukunft
1. Fortfall der Reziprozität in der Zukunftsethik
2. Die Pflicht gegenüber den Nachkommen
3. Pflicht zum Dasein und Sosein einer Nachkommenschaft überhaupt
a. Bedarf die Pflicht zur Nachkommenschaft einer Begründung?
b. Priorität der Pflicht zum Dasein
c. Der erste Imperativ: daß eine Menschheit sei
4. Ontologische Verantwortung für die Idee des Menschen
5. Die ontologische Idee erzeugt einen kategorischen, nicht hypothetischen Imperativ
6. Zwei Dogmen: »keine metaphysische Wahrheit«; »kein Weg vom Ist zum Soll«
7. Zur Notwendigkeit der Metaphysik
V
. Sein und Sollen
1. Das Seinsollen von Etwas
2. Vorzug des Seins vor dem Nichts und das Individuum
3. Sinn der Leibnizischen Frage »warum ist etwas und nicht nichts?«
4. Die Frage eines möglichen Seinsollens ist unabhängig von der Religion zu beantworten
5. Die Frage verwandelt sich in die nach dem Status von »Wert«
Drittes Kapitel Über Zwecke und ihre Stellung im Sein
I
. Der Hammer
1. Durch Zweck konstituiert
2. Sitz des Zweckes nicht im Ding
II
. Der Gerichtshof
1. Immanenz des Zweckes
2. Unsichtbarkeit des Zweckes im körperlichen Apparat
3. Das Mittel überdauert nicht die Zweckimmanenz
4. Anzeige des Zweckes durch dingliche Instrumente
5. Gerichtshof und Hammer: Sitz des Zweckes bei beiden der Mensch
III
. Das Gehen
1. Künstliche und natürliche Mittel
2. Der Unterschied von Mittel und Funktion (Gebrauch)
3. Werkzeug, Organ und Organismus
4. Subjektive Zweck-Mittel-Kette im menschlichen Handeln
5. Aufteilung und objektive Mechanik der Kette im tierischen Handeln
6. Die kausale Macht subjektiver Zwecke
IV
. Das Verdauungsorgan
1. Die These bloßer Scheinbarkeit des Zweckes im physischen Organismus
2. Zweckkausalität beschränkt auf subjektbegabte Wesen?
a. Die dualistische Auslegung
b. Die monistische Emergenz-Theorie
3. Zweckkausalität auch in der vorbewußten Natur
a. Die naturwissenschaftliche Abstinenz
b. Der Fiktionscharakter der Abstinenz und seine Selbstberichtigung durch die wissenschaftliche Existenz
c. Der Zweckbegriff jenseits der Subjektivität: Vereinbarkeit mit der Naturwissenschaft
d. Der Zweckbegriff jenseits der Subjektivität: Sinn des Begriffs
e. Wollen, Gelegenheit und Kanalisierung der Kausalität
V
. Naturwirklichkeit und Gültigkeit: Von der Zweckfrage zur Wertfrage
1. Universalität und Rechtmäßigkeit
2. Freiheit zur Verneinung des Spruches der Natur
3. Unerwiesenheit der Pflicht zur Bejahung des Spruches
Viertes Kapitel Das Gute, das Sollen und das Sein: Theorie der Verantwortung
I
. Sein und Sollen
1. »Gut« oder »Schlecht« relativ zum Zweck
2. Zweckhaftigkeit als Gut-an-sich
3. Selbstbejahung des Seins im Zweck
4. Das Ja des Lebens: emphatisch als Nein zum Nichtsein
5. Sollenskraft des ontologischen Ja für den Menschen
6. Fraglichkeit eines Sollens im Unterschied vom Wollen
7. »Wert« und »Gut«
8. Tun des Guten und Sein des Täters: Die Prävalenz der »Sache«
9. Die Gefühlsseite der Sittlichkeit in bisheriger ethischer Theorie
a. Liebe zum »höchsten Gut«
b. Handlung um des Handelns willen
c. Kants »Ehrfurcht vor dem Gesetz«
d. Standpunkt der folgenden Untersuchung
II
. Theorie der Verantwortung: Erste Unterscheidungen
1. Verantwortung als kausale Zurechnung begangener Taten
2. Verantwortung für Zu-Tuendes: Die Pflicht der Macht
3. Was heißt »unverantwortlich handeln«?
4. Verantwortung ein nicht-reziprokes Verhältnis
5. Natürliche und vertragliche Verantwortung
6. Die selbstgewählte Verantwortung des Politikers
7. Politische und elterliche Verantwortung: Kontraste
III
. Theorie der Verantwortung: Eltern und Staatsmann als eminente Paradigmen
1. Primär ist Verantwortung von Menschen für Menschen
2. Existenz der Menschheit: das »erste Gebot«
3. »Verantwortung« des Künstlers für sein Werk
4. Eltern und Staatsmann:
Totalität
der Verantwortungen
5. Überschneidung der beiden im Gegenstand
6. Analogien der beiden im Gefühl
7. Eltern und Staatsmann:
Kontinuität
8. Eltern und Staatsmann:
Zukunft
IV
. Theorie der Verantwortung: Der Horizont der Zukunft
1. Das Ziel der Aufzucht: Erwachsensein
2. Geschichtliches mit organischem Werden nicht vergleichbar
3. »Jugend« und »Alter« als geschichtliche Metaphern
4. Die geschichtliche Gelegenheit: Erkennung ohne Vorwissen (Philipp von Mazedonien)
5. Die Rolle der Theorie in der Voraussicht: Das Beispiel Lenins
6. Vorhersage aus analytischem Kausalwissen
7. Vorhersage aus spekulativer Theorie: Der Marxismus
8. Selbsterfüllende Theorie und Spontaneität des Handelns
V
. Wie weit reicht politische Verantwortung in die Zukunft?
1. Alle Staatskunst verantwortlich für die Möglichkeit künftiger Staatskunst
2. Nah- und Fernhorizonte bei Herrschaft fortwährender Veränderung
3. Erwartung wissenschaftlich-technischer Fortschritte
4. Allgemein erweiterte Zeitspanne heutiger Kollektiv-Verantwortung
VI
. Warum »Verantwortung« bisher nicht im Zentrum ethischer Theorie stand
1. Engerer Umkreis von Wissen und Macht; das Ziel der Dauerhaftigkeit
2. Abwesenheit der Dynamik
3. »Vertikale«, nicht »horizontale« Ausrichtung früherer Ethik (Platon)
4. Kant, Hegel, Marx: Geschichtsprozeß als Eschatologie
5. Die heutige Umkehrung des Satzes »Du kannst, denn du sollst«
6. Die Macht des Menschen – Wurzel des Soll der Verantwortung
VII
. Das Kind – Urgegenstand der Verantwortung
1. Das elementare »Soll« im »Ist« des Neugeborenen
2. Weniger eindringliche Anrufe eines Seinsollens
3. Archetypische Evidenz des Säuglings für das Wesen der Verantwortung
Fünftes Kapitel Verantwortung heute: Gefährdete Zukunft und Fortschrittsgedanke
I
. Zukunft der Menschheit und Zukunft der Natur
1. Solidarität des Interesses mit der organischen Welt
2. Egoismus der Arten und sein symbiotisches Gesamtergebnis
3. Störung des symbiotischen Gleichgewichts durch den Menschen
4. Die Gefahr enthüllt das Nein zum Nichtsein als primäre Pflicht
II
. Die Unheilsdrohung des Baconischen Ideals
1. Drohung der Katastrophe vom Übermaß des Erfolgs
2. Dialektik von Macht über die Natur und Zwang zu ihrer Ausübung
3. Die gesuchte »Macht über die Macht«
III
. Kann der Marxismus oder der Kapitalismus der Gefahr besser begegnen?
1. Der Marxismus als Vollstrecker des Baconischen Ideals
2. Marxismus und Industrialisierung
3. Abwägung der Chancen zur Meisterung der technologischen Gefahr
a. Bedürfniswirtschaft contra Profitwirtschaft. Bürokratie contra Unternehmertum
b. Der Vorteil totaler Regierungsgewalt
c. Der Vorteil einer asketischen Moral bei den Massen und die Frage ihrer Dauer im Kommunismus
d. Kann Enthusiasmus für die Utopie in Enthusiasmus für die Bescheidung umgemünzt werden? (Politik und Wahrheit)
e. Der Vorteil der Gleichheit für die Bereitschaft zu verzichten
4. Bisheriges Ergebnis der Abwägung: Plus des Marxismus
IV
. Konkrete Überprüfung der abstrakten Chancen
1. Profitmotiv und Maximierungsantriebe im kommunistischen Nationalstaat
2. Weltkommunismus kein Schutz gegen regionalen ökonomischen Egoismus
3. Der Kult der Technik im Marxismus
4. Die Verführung der Utopie im Marxismus
V
. Die Utopie vom erst kommenden »eigentlichen Menschen«
1. Nietzsches »Übermensch« als künftiger eigentlicher Mensch
2. Die klassenlose Gesellschaft als
Bedingung
für den kommenden eigentlichen Menschen
a. Kulturelle Überlegenheit der klassenlosen Gesellschaft?
b. Sittliche Überlegenheit der Bürger einer klassenlosen Gesellschaft?
c. Materieller Wohlstand als Kausalbedingung der marxistischen Utopie
VI
. Utopie und Fortschrittsgedanke
1. Notwendigkeit des Abschieds vom utopischen Ideal
a. Die psychologische Gefahr des Wohlstandsversprechens
b. Wahrheit oder Unwahrheit des Ideals und die Aufgabe der Verantwortlichen
2. Zur Problematik des »sittlichen Fortschritts«
a. Fortschritt im Individuum
b. Fortschritt in der Zivilisation
3. Fortschritt in Wissenschaft und Technik
a. Wissenschaftlicher Fortschritt und sein Preis
b. Technischer Fortschritt und seine sittliche Ambivalenz
4. Von der Sittlichkeit gesellschaftlicher Einrichtungen
a. Demoralisierende Wirkungen der Despotie
b. Demoralisierende Wirkungen ökonomischer Ausbeutung
c. Der »gute Staat«: Politische Freiheit und bürgerliche Sittlichkeit
d. Der Kompromißcharakter freiheitlicher Systeme
5. Von den Arten der Utopie
a. Der ideale Staat und der bestmögliche Staat
b. Das Novum marxistischer Utopie
Sechstes Kapitel Kritik der Utopie und die Ethik der Verantwortung
I
. Die Verdammten dieser Erde und die Weltrevolution
1. Veränderung der »Klassenkampf«-Situation durch die neue planetarische Verteilung des Leidens
a. Pazifizierung des westlichen »Industrieproletariats«
b. Klassenkampf als Kampf der Nationen
2. Politische Antworten auf die neue Klassenkampflage
a. Global-konstruktive Politik im nationalen Selbstinteresse
b. Appell an die Gewalt im Namen der Utopie
II
. Kritik des marxistischen Utopismus.
A. Erster Schritt: Realbedingungen, oder von der
Möglichkeit
der Utopie
1. »Umbau des Sterns Erde« durch entfesselte Technologie
2. Toleranzgrenzen der Natur: Utopie und Physik
a. Das Nahrungsproblem
b. Das Rohstoffproblem
c. Das Energieproblem
d. Das ultimative Thermalproblem
3. Das Dauergebot sparsamer Energiewirtschaft und sein Veto gegen die Utopie
a. Fortschritt mit Vorsicht
b. Bescheidung in den Zielen gegen die Unbescheidenheit der Utopie
c. Warum nach erwiesener äußerer Unmöglichkeit die innere Kritik des Ideals noch nötig ist
1. Inhaltliche Bestimmung des utopischen Zustandes
a. Das Reich der Freiheit bei Karl Marx
b. Ernst Bloch und das irdische Paradies der tätigen Muße
(i) »Die glückliche Ehe mit dem Geist«
(ii) Das »Steckenpferd« und das Menschenwürdige
2. Das »Steckenpferd als Beruf« kritisch beleuchtet
a. Verlust der Spontaneität
b. Verlust der Freiheit
c. Verlust der Wirklichkeit und der Menschenwürde
d. Ohne Notwendigkeit keine Freiheit: Die Würde der Wirklichkeit
3. Andere Inhalte der Muße: Die zwischenmenschlichen Beziehungen
4. Die humanisierte Natur
5. Warum nach Widerlegung des Zukunftsbildes die Kritik des Vergangenheitsbildes noch nötig ist
1. Ernst
Blochs Ontologie des Noch-Nicht-Seins
a. Unterscheidung dieses »Noch Nicht« von sonstigen Lehren des unvollendeten Seins
b. »Vor-Schein des Rechten« und »Heuchelei« in der Vergangenheit
2. Vom »Schon Da« des eigentlichen Menschen
a. Zweideutigkeit gehört zum Menschen
b. Der anthropologische Irrtum der Utopie
c. Die Vergangenheit als Quelle des Wissens vom Menschen
d. Die »Natur« des Menschen offen für Gut und Böse
e. Verbesserung der Bedingungen ohne Köder der Utopie
f. Vom Selbstzweck jeder geschichtlichen Gegenwart
III
. Von der Kritik der Utopie zur Ethik der Verantwortung
1. Die Kritik der Utopie war Kritik der Technik im Extrem
2. Der praktische Sinn der Widerlegung des Traumes
3. Die nichtutopische Ethik der Verantwortung
a. Furcht, Hoffnung und Verantwortung
b. Um die Hütung des »Ebenbildes«
Nachwort
Robert Habeck Ein politischer Imperativ
Namenregister
Fußnoten
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Vorwort
Der endgültig entfesselte Prometheus, dem die Wissenschaft nie gekannte Kräfte und die Wirtschaft den rastlosen Antrieb gibt, ruft nach einer Ethik, die durch freiwillige Zügel seine Macht davor zurückhält, dem Menschen zum Unheil zu werden. Daß die Verheißung der modernen Technik in Drohung umgeschlagen ist, oder diese sich mit jener unlösbar verbunden hat, bildet die Ausgangsthese des Buches. Sie geht über die Feststellung physischer Bedrohung hinaus. Die dem Menschenglück zugedachte Unterwerfung der Natur hat im Übermaß ihres Erfolges, der sich nun auch auf die Natur des Menschen selbst erstreckt, zur größten Herausforderung geführt, die je dem menschlichen Sein aus eigenem Tun erwachsen ist. Alles daran ist neuartig, dem Bisherigen unähnlich, der Art wie der Größenordnung nach: Was der Mensch heute tun kann und dann, in der unwiderstehlichen Ausübung dieses Könnens, weiterhin zu tun gezwungen ist, das hat nicht seinesgleichen in vergangener Erfahrung. Auf sie war alle bisherige Weisheit über rechtes Verhalten zugeschnitten. Keine überlieferte Ethik belehrt uns daher über die Normen von »Gut« und »Böse«, denen die ganz neuen Modalitäten der Macht und ihrer möglichen Schöpfungen zu unterstellen sind. Das Neuland kollektiver Praxis, das wir mit der Hochtechnologie betreten haben, ist für die ethische Theorie noch ein Niemandsland.
In diesem Vakuum (das zugleich auch das Vakuum des heutigen Wertrelativismus ist) nimmt die hier vorgelegte Untersuchung ihren Stand. Was kann als Kompaß dienen? Die vorausgedachte Gefahr selber! In ihrem Wetterleuchten aus der Zukunft, im Vorschein ihres planetarischen Umfanges und ihres humanen Tiefganges, werden allererst die ethischen Prinzipien entdeckbar, aus denen sich die neuen Pflichten neuer Macht herleiten lassen. Dies nenne ich die »Heuristik der Furcht«: Erst die vorausgesehene Verzerrung des Menschen verhilft uns zu dem davor zu bewahrenden Begriff des Menschen. Wir wissen erst, was auf dem Spiele steht, wenn wir wissen, daß es auf dem Spiele steht. Da es dabei nicht nur um das Menschenlos, sondern auch um das Menschenbild geht, nicht nur um physisches Überleben, sondern auch um Unversehrtheit des Wesens, so muß die Ethik, die beides zu hüten hat, über die der Klugheit hinaus eine solche der Ehrfurcht sein.
Die Begründung einer solchen Ethik, die nicht mehr an den unmittelbar mitmenschlichen Bereich der Gleichzeitigen gebunden bleibt, muß in die Metaphysik reichen, aus der allein sich die Frage stellen läßt, warum überhaupt Menschen in der Welt sein sollen: warum also der unbedingte Imperativ gilt, ihre Existenz für die Zukunft zu sichern. Das Abenteuer der Technologie zwingt mit seinen äußersten Wagnissen zu diesem Wagnis äußerster Besinnung. Eine solche Grundlegung wird hier versucht, entgegen dem positivistisch-analytischen Verzicht der zeitgenössischen Philosophie. Ontologisch werden die alten Fragen nach dem Verhältnis von Sein und Sollen, Ursache und Zweck, Natur und Wert neu aufgerollt, um die neu erschienene Pflicht des Menschen jenseits des Wertsubjektivismus im Sein zu verankern.
Das eigentliche Thema jedoch ist diese neu hervorgetretene Pflicht selber, die im Begriff der Verantwortung zusammengefaßt ist. Gewiß kein neues Phänomen in der Sittlichkeit, hat die Verantwortung doch noch nie ein derartiges Objekt gehabt, auch bisher die ethische Theorie wenig beschäftigt. Sowohl Wissen wie Macht waren zu begrenzt, um die entferntere Zukunft in die Voraussicht und gar den Erdkreis in das Bewußtsein der eigenen Kausalität einzubeziehen. Statt des müßigen Erratens später Folgen im unbekannten Schicksal konzentrierte sich die Ethik auf die sittliche Qualität des augenblicklichen Aktes selber, in dem das Recht des mitlebenden Nächsten zu achten ist. Im Zeichen der Technologie aber hat es die Ethik mit Handlungen zu tun (wiewohl nicht mehr des Einzelsubjekts), die eine beispiellose kausale Reichweite in die Zukunft haben, begleitet von einem Vorwissen, das ebenfalls, wie immer unvollständig, über alles ehemalige weit hinausgeht. Dazu die schiere Größenordnung der Fernwirkungen und oft auch ihre Unumkehrbarkeit. All dies rückt Verantwortung ins Zentrum der Ethik, und zwar mit Zeit- und Raumhorizonten, die denen der Taten entsprechen. Demgemäß bildet die bis heute fehlende Theorie der Verantwortung die Mitte des Werkes.
Aus der erweiterten Zukunftsdimension heutiger Verantwortung ergibt sich das abschließende Thema: die Utopie. Die weltweite technologische Fortschrittsdynamik birgt als solche einen impliziten Utopismus in sich, der Tendenz, wenn nicht dem Programm nach. Und die eine schon existierende Ethik mit globaler Zukunftssicht, der Marxismus, hat eben im Bunde mit der Technik die Utopie zum ausdrücklichen Ziel erhoben. Dies nötigt zu einer eingehenden Kritik des utopischen Ideals. Da es älteste Menschheitsträume für sich hat und nun in der Technik auch die Mittel zu besitzen scheint, den Traum in ein Unternehmen umzusetzen, ist der vormals müßige Utopismus zur gefährlichsten – gerade weil idealistischen – Versuchung der heutigen Menschheit geworden. Der Unbescheidenheit seiner Zielsetzung, die ökologisch ebenso wie anthropologisch fehlgeht (ersteres nachweislich, letzteres philosophisch aufzeigbar), stellt das Prinzip Verantwortung die bescheidenere Aufgabe entgegen, welche Furcht und Ehrfurcht gebieten: dem Menschen in der verbleibenden Zweideutigkeit seiner Freiheit, die keine Änderung der Umstände je aufheben kann, die Unversehrtheit seiner Welt und seines Wesens gegen die Übergriffe seiner Macht zu bewahren.
Ein »Tractatus technologico-ethicus«, wie er hier versucht wird, stellt seine Anforderungen an Strenge, die den Leser nicht weniger als den Autor treffen. Was dem Thema einigermaßen gerecht werden soll, muß dem Stahl und nicht der Watte gleichen. Von der Watte guter Gesinnung und untadeliger Absicht, der Bekundung, daß man auf seiten der Engel steht und gegen die Sünde ist, für Gedeihen und gegen Verderben, gibt es in der ethischen Reflexion unserer Tage genug. Etwas härteres ist vonnöten und hier versucht. Die Absicht ist überall systematisch und nirgends homiletisch, und keine (zeitgemäße oder unzeitgemäße) Löblichkeit der Gesinnung kann philosophischen Unzulänglichkeiten des Gedankenganges zur Entschuldigung dienen. Das Ganze ist ein Argument, das durch die sechs Kapitel schrittweise – und, ich hoffe, dem Leser nicht zu mühselig – entwickelt wird. Nur eine Lücke im theoretischen Gang der Entwicklung ist mir selber bewußt: zwischen dem dritten und vierten Kapitel wurde eine Untersuchung über »Macht oder Ohnmacht der Subjektivität« fortgelassen, worin das psychophysische Problem neu behandelt und der naturalistische Determinismus des Seelenlebens widerlegt wird. Obwohl systematisch notwendig (denn mit Determinismus keine Ethik, oder ohne Freiheit kein Sollen), wurde aus Gründen des Umfangs beschlossen, diese Abhandlung hier herauszulösen und statt dessen später gesondert vorzulegen.
Dieselbe Erwägung führte auch dazu, einen der gesamten systematischen Untersuchung angehängten »angewandten Teil«, welcher die neue Art von ethischen Fragen und Pflichten an einer Auswahl von jetzt schon konkreten Einzelthemen illustrieren soll, einer Sonderveröffentlichung binnen Jahresfrist vorzubehalten. Mehr als eine solche vorläufige Kasuistik kann gegenwärtig nicht versucht werden. Zu einer systematischen Pflichtenlehre (die schließlich anzustreben wäre) ist beim Werdestadium ihrer »Dinge« noch nicht die Zeit.
Der Entschluß, nach Jahrzehnten fast ausschließlich englischer Autorschaft dies Buch auf deutsch zu schreiben, entsprang keinen sentimentalen Gründen, sondern allein der nüchternen Berechnung meines vorgerückten Alters. Da die gleichwertige Formulierung in der erworbenen Sprache mich immer noch zwei- bis dreimal so viel Zeit kostet wie die in der Muttersprache, so glaubte ich, sowohl der Grenzen des Lebens wie der Dringlichkeit des Gegenstandes wegen, nach den langen Jahren gedanklicher Vorarbeit für die Niederschrift den schnelleren Weg wählen zu sollen, der immer noch langsam genug war. Dem Leser wird es natürlich nicht entgehen, daß der Verfasser die deutsche Sprachentwicklung seit 1933 nicht mehr »mitbekommen« hat. Ein »archaisches« Deutsch ist ihm bei Vorträgen in Deutschland von Freundesseite nachgesagt worden; und was den vorliegenden Text betrifft, so nannte ein überaus wohlwollender Leser des Manuskripts (von bewiesener Stilkundigkeit) die Sprache sogar stellenweise »altfränkisch« – und riet mir, sie von anderer Hand modernisieren zu lassen. Aber dazu hätte ich mich selbst bei Abwesenheit des Zeitfaktors und Anwesenheit des idealen Bearbeiters nicht bringen können. Denn wie ich mir bewußt bin, daß ich einem höchst zeitgemäßen Gegenstand mit einer durchaus nicht zeitgemäßen, fast schon archaischen Philosophie zu Leibe gehe, so scheint es mir nicht unangemessen, daß eine ähnliche Spannung sich auch im Stile ausdrücke.
Durch die Jahre des Werdegangs dieses Buches wurde manches aus verschiedenen Kapiteln schon in Aufsatzform in Amerika veröffentlicht. Nämlich: (aus Kapitel 1) »Technology and Responsibility: Reflections on the New Tasks of Ethics«, Social Research 40/1, 1973; (aus Kapitel 2) »Responsibility Today: The Ethics of an Endangered Future«, ibid. 43/1, 1976; (aus Kapitel 4) »The Concept of Responsibility: An Inquiry into the Foundations of an Ethics for our Age«, in Knowledge, Value, and Belief, ed. H. T. Engelhardt & D. Callahan, Hastings-on-Hudson, N. Y. 1977. Ich danke den betr. Publikationsorganen für ihre Erlaubnis zum jetzigen und von Anfang an vorgesehenen Gebrauch.
Dank sei hier zuletzt auch Personen und Institutionen ausgesprochen, die das Werden dieses Werkes durch Gewährung günstiger Umstände gefordert haben. The National Endowment for the Humanities und The Rockefeller Foundation finanzierten großzügig ein akademisches Urlaubsjahr, in dem die Niederschrift begonnen wurde. In der schönen Abgeschiedenheit der Villa Feuerring in Beth Jizchak (Israel), die so manchen Geistesarbeiter beherbergt hat, durfte ich die ersten Kapitel schreiben. Der großherzigen Gastgeberin, Frau Gertrud Feuerring in Jerusalem, sei hierfür nun auch öffentlich gedankt. Mit gleicher Dankbarkeit gedenke ich weiterer behüteter Arbeitsklausuren in Freundeshäusern in Israel und der Schweiz, die über die Jahre wiederholt dem Werk zugute kamen, wenn geographische Ferne vom Amtssitz den besten Schutz gegen Übergriffe des Professorats in Ferien und Urlaube bot.
In der Widmung sind die genannt, denen im Sinne des Buches anderes geschuldet ist als Dank.
New Rochelle, New York, U. S. A.
Hans Jonas Juli 1979
Erstes Kapitel
Das veränderte Wesen menschlichen Handelns
Alle bisherige Ethik – ob als direkte Anweisung, gewisse Dinge zu tun und andere nicht zu tun, oder als Bestimmung von Prinzipien für solche Anweisungen, oder als Aufweisung eines Grundes der Verpflichtung, solchen Prinzipien zu gehorchen – teilte stillschweigend die folgenden, unter sich verbundenen Voraussetzungen: (1) Der menschliche Zustand, gegeben durch die Natur des Menschen und die Natur der Dinge, steht in den Grundzügen ein für allemal fest. (2) Das menschlich Gute läßt sich auf dieser Grundlage unschwer und einsichtig bestimmen. (3) Die Reichweite menschlichen Handelns und daher menschlicher Verantwortung ist eng umschrieben. Es ist die Absicht der folgenden Ausführungen, zu zeigen, daß diese Voraussetzungen nicht mehr gelten, und darüber zu reflektieren, was dies für unsere moralische Lage bedeutet. Spezifischer gefaßt ist meine Behauptung, daß mit gewissen Entwicklungen unserer Macht sich das Wesen menschlichen Handelns geändert hat; und da Ethik es mit Handeln zu tun hat, muß die weitere Behauptung sein, daß die veränderte Natur menschlichen Handelns auch eine Änderung in der Ethik erforderlich macht. Und dies nicht nur in dem Sinne, daß neue Objekte des Handelns stofflich den Bereich der Fälle erweitert hat, worauf die geltenden Regeln des Verhaltens anzuwenden sind, sondern in dem viel radikaleren Sinn, daß die qualitativ neuartige Natur mancher unserer Handlungen eine ganz neue Dimension ethischer Bedeutsamkeit aufgetan hat, die in den Gesichtspunkten und Kanons traditioneller Ethik nicht vorgesehen war.
Die neuartigen Vermögen, die ich im Auge habe, sind natürlich die der modernen Technik. Mein erster Punkt ist demgemäß, zu fragen, in welcher Weise diese Technik die Natur unseres Handelns affiziert, inwiefern sie Handeln in ihrem Zeichen verschieden macht von dem, was es durch alle Zeiten gewesen ist. Da durch all diese Zeiten der Mensch niemals ohne Technik war, zielt meine Frage auf den menschlichen Unterschied moderner von aller früheren Technik.
I. Das Beispiel der Antike
Beginnen wir mit einer alten Stimme über des Menschen Macht und Tun, die in einem archetypischen Sinne selbst schon sozusagen eine technologische Note anschlägt – mit dem berühmten Chorlied aus Sophokles' Antigone.
Ungeheuer ist viel, und nichts
ungeheurer als der Mensch.
Der nämlich, über das graue Meer
im stürmenden Süd fahrt er dahin,
andringend unter rings
umrauschenden Wogen. Die Erde auch,
der Göttlichen höchste, die nimmer vergeht
und nimmer ermüdet, schöpfet er aus
und wühlt, die Pflugschar pressend, Jahr
um Jahr mit Rössern und Mäulern.
Leichtaufmerkender Vögel Schar
umgarnt er und fängt, und des wilden Getiers
Stämme und des Meeres salzige Brut
mit reichgewundenem Netzgespinst –
er, der überaus kundige Mann.
Und wird mit Künsten Herr des Wildes,
des freien schweifenden auf den Höhen,
und zwingt den Nacken unter das Joch,
den dichtbemähnten des Pferdes, und
den immer rüstigen Bergstier.
Die Rede auch und den luft'gen Gedanken und
die Gefühle, auf denen gründet die Stadt,
lehrt er sich selbst, und Zuflucht zu finden vor
unwirtlicher Höhen Glut und des Regens Geschossen.
Allbewandert er, auf kein Künftiges
geht er unbewandert zu. Nur den Tod
ist ihm zu fliehen versagt.
Doch von einst ratlosen Krankheiten
hat er Entrinnen erdacht.
So über Verhoffen begabt mit der Klugheit erfindender Kunst,
geht zum Schlimmen er bald und bald zum Guten hin.
Ehrt des Landes Gesetze er und der Götter beschworenes Recht –
hoch steht dann seine Stadt. Stadtlos ist er, der verwegen das Schändliche tut.
1. Mensch und Natur
Diese beklommene Huldigung an des Menschen beklemmende Macht erzählt von seinem gewaltsamen und gewalttätigen Einbruch in die kosmische Ordnung, von der verwegenen Invasion der verschiedenen Naturbereiche durch seine rastlose Klugheit; aber zugleich auch davon, daß er mit den selbstgelehrten Vermögen der Rede, des Denkens und des sozialen Gefühls ein Haus für sein eigentliches Menschsein erbaut – nämlich das Kunstgebilde der Stadt. Die Vergewaltigung der Natur und die Zivilisierung seiner selbst gehen Hand in Hand. Beide bieten den Elementen Trotz, die eine, indem sie sich in diese vorwagt und ihre Geschöpfe überwältigt, die andere, indem sie in der Zuflucht der Stadt und ihrer Gesetze eine Enklave gegen sie errichtet. Der Mensch ist der Schöpfer seines Lebens als eines menschlichen; er fügt die Umstände seinem Willen und Bedürfen, und außer gegen den Tod ist er niemals ratlos.
Dennoch ist ein verhaltener und sogar ängstlicher Ton in diesem Preislied auf das Wunder des Menschen hörbar und niemand kann es für unbescheidenes Prahlen halten. Was ungesagt, aber für damals selbstverständlich dahinter steht, ist das Wissen, daß aller Größe seiner schrankenlosen Erfindsamkeit ungeachtet der Mensch, gemessen an den Elementen, immer noch klein ist: eben dies macht seine Ausfälle in sie so verwegen und erlaubt es jenen, seinen Vorwitz zu dulden. Alle Freiheiten, die er sich mit den Bewohnern des Landes, des Meeres und der Luft herausnimmt, lassen doch die umgreifende Natur dieser Bereiche unverändert und ihre zeugenden Kräfte unvermindert. Ihnen tut er nicht wirklich weh, wenn er sein kleines Königreich aus ihrem großen herausschneidet. Sie dauern, während seine Unternehmen ihren kurzlebigen Lauf nehmen. So sehr er auch die Erde Jahr um Jahr mit seinem Pfluge plagt – sie ist alterslos und unermüdbar; ihrer ausdauernden Geduld kann und muß er trauen und ihrem Zyklus muß er sich anpassen. Und ebenso alterslos ist das Meer. Kein Raub an seiner Brut kann seine Fruchtbarkeit erschöpfen, kein Durchkreuzen mit Schiffen ihm Schaden tun, kein Abwurf in seine Tiefen es beflecken. Und für wie viele Krankheiten der Mensch auch Heilung finden mag, die Sterblichkeit selbst beugt sich nicht seiner List.
All dies gilt, weil vor unserer Zeit des Menschen Eingriffe in die Natur, so wie er selbst sie sah, wesentlich oberflächlich waren und machtlos, ihr festgesetztes Gleichgewicht zu stören. (Die Rückschau entdeckt, daß die Wahrheit nicht immer so harmlos war.) Auch ist weder im Antigone-Chorlied noch irgendwo sonst eine Andeutung zu finden, daß dies erst ein Anfang sei und daß Größeres an Kunst und Macht noch bevorstehe – daß der Mensch in einer endlosen Laufbahn der Eroberung begriffen sei. Gerade so weit ist er gegangen in der Bändigung der Notwendigkeit, gerade so viel hat er ihr durch seinen Witz abzuringen gelernt für die Menschlichkeit seines Lebens, und nachsinnend darüber überkam ihn ein Schauer über die eigene Verwegenheit.
2. Das Menschenwerk der »Stadt«
Der Raum, den er sich so geschaffen hatte, wurde gefüllt von der Stadt der Menschen – deren Bestimmung es war, zu umschließen, und nicht sich auszudehnen – und hierdurch wurde ein neues Gleichgewicht im größeren Gleichgewicht des Ganzen hergestellt. Alles Wohl oder Übel, zu dem des Menschen erfinderische Kunst ihn ein um das andere Mal treiben mag, ist innerhalb der menschlichen Enklave und berührt nicht die Natur der Dinge.
Die Unverletzlichkeit des Ganzen, dessen Tiefen von des Menschen Zudringlichkeit ungestört bleiben, das heißt die wesentliche Unwandelbarkeit der Natur als der kosmischen Ordnung, war in der Tat der Hintergrund zu allen Unternehmungen des sterblichen Menschen einschließlich seiner Eingriffe in jene Ordnung selbst. Sein Leben spielte sich ab zwischen dem Bleibenden und dem Wechselnden: das Bleibende war die Natur, das Wechselnde seine eigenen Werke. Das größte dieser Werke war die Stadt, und ihr konnte er ein gewisses Maß von Dauer verleihen durch die Gesetze, die er für sie erdachte und zu ehren unternahm. Aber dieser künstlich hergestellten Dauer eignete keine Gewißheit auf lange Sicht. Als ein gefährdetes Kunstwerk kann das Kulturgebilde erschlaffen oder irregehen. Nicht einmal innerhalb seines künstlichen Raumes, bei aller Freiheit, die er der Selbstbestimmung gewährt, kann das Willkürliche jemals die Grundbedingungen des menschlichen Daseins außer Kraft setzen. Ja, gerade die Unbeständigkeit menschlichen Geschicks sichert die Beständigkeit des menschlichen Zustands. Zufall, Glück und Torheit, die großen Ausgleicher in den Angelegenheiten der Menschen, wirken wie eine Art Entropie und lassen alle bestimmten Entwürfe am Ende in die ewige Norm einmünden. Staaten steigen auf und fallen, Herrschaften kommen und gehen, Familien gedeihen und entarten – kein Wechsel ist für die Dauer und am Ende, im gegenseitigen Ausgleichen aller zeitweiligen Abweichungen, ist der Zustand des Menschen, wie er von jeher war. So ist selbst hier, in seinem eigenen Kunstprodukt, der gesellschaftlichen Welt, die Kontrolle des Menschen gering und seine bleibende Natur setzt sich durch.
Immerhin bildete diese Zitadelle seiner eigenen Schöpfung, die klar geschieden war vom Rest der Dinge und seiner Obhut anvertraut, die vollständige und einzige Domäne menschlicher Verantwortlichkeit. Die Natur war kein Gegenstand menschlicher Verantwortung – sie sorgte für sich selbst und, mit entsprechender Überredung und Bedrängung, auch für den Menschen: nicht Ethik, sondern Klugheit und Erfindungsgabe war ihr gegenüber angebracht. Aber in der »Stadt«, das heißt im gesellschaftlichen Kunstgebilde, wo Menschen mit Menschen umgehen, muß Klugheit sich mit Sittlichkeit vermählen, denn diese ist die Seele seines Daseins. In diesem innermenschlichen Rahmen wohnt denn auch alle überlieferte Ethik und ist den hierdurch bedingten Abmaßen des Handelns angepaßt.
II. Merkmale bisheriger Ethik
Entnehmen wir dem Vorangegangenen diejenigen Merkmale menschlichen Handelns, die für einen Vergleich mit dem heutigen Stand der Dinge bedeutsam sind.
1. Aller Umgang mit der außermenschlichen Welt, das heißt der ganze Bereich der techne (Kunstfertigkeit) war – mit Ausnahme der Medizin – ethisch neutral – im Hinblick auf das Objekt sowohl wie auf das Subjekt solchen Handelns: Im Hinblick auf das Objekt, weil die Kunst die selbsterhaltende Natur der Dinge nur unerheblich in Mitleidenschaft zog und somit keine Frage dauernden Schadens an der Integrität ihres Objektes, der natürlichen Ordnung im Ganzen, aufwarf; und im Hinblick auf das handelnde Subjekt, weil techne qua Tätigkeit sich selbst als begrenzten Tribut an die Notwendigkeit verstand und nicht als selbst-rechtfertigenden Fortschritt zum Hauptziel der Menschheit, in dessen Verfolgung des Menschen höchste Anstrengung und Teilnahme engagiert sind. Der wirkliche Beruf des Menschen liegt anderswo. Kurz, Wirkung auf nichtmenschliche Objekte bildete keinen Bereich ethischer Bedeutsamkeit.
2. Ethische Bedeutung gehörte zum direkten Umgang von Mensch mit Mensch, einschließlich des Umgangs mit sich selbst; alle traditionelle Ethik ist anthropozentrisch.
3. Für das Handeln in dieser Sphäre wurde die Entität »Mensch« und ihr fundamentaler Zustand als im Wesen konstant angesehen und nicht selber als Gegenstand umformender techne (Kunst).
4. Das Wohl oder Übel, worum das Handeln sich zu kümmern hatte, lag nahe bei der Handlung, entweder in der Praxis selbst oder in ihrer unmittelbaren Reichweite und war keine Sache entfernter Planung. Diese Nähe der Ziele galt für Zeit sowohl als Raum. Die wirksame Reichweite der Aktion war klein, die Zeitspanne für Voraussicht, Zielsetzung und Zurechenbarkeit kurz, die Kontrolle über Umstände begrenzt. Rechtes Verhalten hatte seine unmittelbaren Kriterien und seine fast unmittelbare Vollendung. Der lange Lauf der Folgen war dem Zufall, dem Schicksal oder der Vorsehung anheimgestellt. Ethik hatte es demgemäß mit dem Hier und Jetzt zu tun, mit Gelegenheiten, wie sie zwischen Menschen sich einstellen, mit den wiederkehrenden, typischen Situationen des privaten und öffentlichen Lebens. Der gute Mensch war ein solcher, der diesen Gelegenheiten mit Tugend und Weisheit begegnete, der die Fähigkeit dazu in sich selbst kultivierte und im übrigen sich mit dem Unbekannten abfand.
Alle Gebote und Maximen überlieferter Ethik, inhaltlich verschieden wie sie immer sein mögen, zeigen diese Beschränkung auf den unmittelbaren Umkreis der Handlung. »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«; »Tue Anderen, wie du wünschest, daß sie dir tun«; »Unterweise dein Kind im Wege der Wahrheit«; »Strebe nach Vorzüglichkeit durch Entwicklung und Verwirklichung der besten Möglichkeiten deines Seins qua Mensch«; »Ordne dein persönliches Wohl dem Gemeinwohl unter«; »Behandle deinen Mitmenschen niemals bloß als Mittel, sondern immer auch als einen Zweck in sich selbst«; und so fort. Man beachte, daß in all diesen Maximen der Handelnde und der »Andere« seines Handelns Teilhaber einer gemeinsamen Gegenwart sind. Es sind die jetzt Lebenden und in irgendwelchem Verkehr mit mir Stehenden, die einen Anspruch auf mein Verhalten haben, insofern es sie durch Tun oder Unterlassen affiziert. Das sittliche Universum besteht aus Zeitgenossen und sein Zukunftshorizont ist beschränkt auf deren voraussichtliche Lebensspanne. Ähnlich verhält es sich mit dem räumlichen Horizont des Ortes, worin der Handelnde und der Andere sich treffen als Nachbar, Freund oder Feind, als Vorgesetzter und Untergebener, als Stärkerer und Schwächerer, und in all den anderen Rollen, in denen Menschen miteinander zu tun haben. Alle Sittlichkeit war auf diesen Nahkreis des Handelns eingestellt.
Es folgt daraus, daß das Wissen, welches außer dem sittlichen Willen erfordert ist, um die Moralität der Handlung zu verbürgen, diesen Begrenzungen entsprach: Es ist nicht die Kenntnis des Wissenschaftlers oder Fachmanns, sondern Wissen einer Art, die allen Menschen guten Willens offensteht. Kant ging so weit zu sagen, daß »die menschliche Vernunft im Moralischen selbst beim gemeinsten Verstande leicht zu großer Richtigkeit und Ausführlichkeit gebracht werden kann«1; daß es »keiner Wissenschaft oder Philosophie bedürfe, um zu wissen, was man zu tun habe, um ehrlich und gut, ja sogar, um weise und tugendhaft zu sein … (Der gemeine Verstand kann) sich ebenso gut Hoffnung machen, es recht zu treffen, als es sich immer ein Philosoph versprechen mag«2; »Was ich … zu tun habe, damit mein Wollen sittlich gut sei, darzu brauche ich gar keine weitausholende Scharfsinnigkeit. Unerfahren in Ansehung des Weltlaufes, unfähig, auf alle sich eräugnenden Vorfälle desselben gefaßt zu sein,« kann ich doch wissen, wie ich in Übereinstimmung mit dem Sittengesetz zu handeln habe.3
Nicht jeder Theoretiker der Ethik ging soweit im Verkleinern der kognitiven Seite sittlichen Handelns. Aber selbst wenn sie weit größere Bedeutung erhielt, wie in Aristoteles, wo die Erkenntnis der Situation und dessen, was auf sie paßt, beträchtliche Anforderungen an Erfahrung und Urteil stellt, hat doch solches Wissen nichts mit theoretischer Wissenschaft zu tun. Es birgt natürlich in sich einen allgemeinen Begriff vom menschlichen Gut als solchen, bezogen auf die angenommenen Konstanten der menschlichen Natur und Lage, und dieser Allgemeinbegriff des Guten mag Ausarbeitung in einer eigenen Theorie finden oder nicht. Aber seine Übersetzung in die Praktik erfordert eine Kenntnis des Hier und Jetzt, und diese ist gänzlich untheoretisch. Diese der Tugend eigentümliche Kenntnis (des Wo, Wann, zu Wem und Wie man Was zu tun hat) bleibt beim unmittelbaren Anlaß, in dessen definiertem Zusammenhang die Handlung als die des individuellen Handelnden selbst ihren Lauf nimmt und in ihm auch zu ihrem Ende kommt. Das »gut« oder »schlecht« der Handlung ist völlig entschieden innerhalb dieses kurzfristigen Zusammenhangs. Ihre Autorschaft steht nie in Frage und ihre moralische Qualität wohnt ihr unmittelbar inne. Niemand wurde verantwortlich gehalten für die unbeabsichtigten späteren Wirkungen seines gut-gewollten, wohl-überlegten und wohl-ausgeführten Akts. Der kurze Arm menschlicher Macht verlangte keinen langen Arm vorhersagenden Wissens; die Kürze des einen war so wenig schuldhaft wie die des andern. Gerade weil das in seiner Allgemeinheit bekannte menschliche Gut dasselbe für alle Zeit ist, findet seine Verwirklichung oder Verletzung zu jeder Zeit statt, und sein vollständiger Ort ist immer die Gegenwart.
III. Neue Dimensionen der Verantwortung
All dies hat sich entscheidend geändert. Die moderne Technik hat Handlungen von so neuer Größenordnung, mit so neuartigen Objekten und so neuartigen Folgen eingeführt, daß der Rahmen früherer Ethik sie nicht mehr fassen kann. Der Antigone-Chor über das »Ungeheure«, über die wundersame Macht des Menschen müßte heute im Zeichen des ganz anders Ungeheuren anders lauten; und die Mahnung an den Einzelnen, die Gesetze zu ehren, wäre nicht mehr genug. Auch sind längst die Götter nicht mehr da, deren beschworenes Recht dem Ungeheuren menschlichen Tuns wehren könnte. Gewiß, die alten Vorschriften der »Nächsten«-Ethik – die Vorschriften der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Ehrlichkeit, usw. – gelten immer noch, in ihrer intimen Unmittelbarkeit, für die nächste, tägliche Sphäre menschlicher Wechselwirkung. Aber diese Sphäre ist überschattet von einem wachsenden Bereich kollektiven Tuns, in dem Täter, Tat und Wirkung nicht mehr dieselben sind wie in der Nahsphäre, und der durch die Enormität seiner Kräfte der Ethik eine neue, nie zuvor erträumte Dimension der Verantwortung aufzwingt.
1. Die Verletzlichkeit der Natur
Man nehme zum Beispiel, als die erste größere Veränderung in dem überkommenen Bild, die kritische Verletzlichkeit der Natur durch die technische Intervention des Menschen – eine Verletzlichkeit, die nicht vermutet war, bevor sie sich in schon angerichtetem Schaden zu erkennen gab. Diese Entdeckung, deren Schock zu dem Begriff und der beginnenden Wissenschaft der Umweltforschung (Ökologie) führte, verändert die ganze Vorstellung unserer selbst als eines kausalen Faktors im weiteren System der Dinge. Sie bringt durch die Wirkungen an den Tag, daß die Natur menschlichen Handelns sich de facto geändert hat, und daß ein Gegenstand von gänzlich neuer Ordnung, nicht weniger als die gesamte Biosphäre des Planeten, dem hinzugefügt worden ist, wofür wir verantwortlich sein müssen, weil wir Macht darüber haben. Und ein Gegenstand von welch überwältigender Größe, wogegen alle früheren Gegenstände menschlichen Handelns zwerghaft erscheinen! Die Natur als eine menschliche Verantwortlichkeit ist sicher ein Novum, über das ethische Theorie nachsinnen muß. Welche Art von Verpflichtung ist in ihr wirksam? Ist es mehr als utilitarisches Interesse? Ist es einfach die Klugheit, die gebietet, nicht die Gans zu schlachten, die die goldenen Eier legt, oder gar den Ast abzusägen, auf dem man sitzt? Aber das »man«, das hier sitzt und vielleicht ins Bodenlose fällt – wer ist es? Und was ist mein Interesse an seinem Sitzen oder Fallen?
Insoweit als der letzte Bezugspol, der das Interesse an der Erhaltung der Natur zu einem moralischen Interesse macht, das Schicksal des Menschen in seiner Abhängigkeit vom Zustand der Natur ist, ist auch hier noch die anthropozentrische Ausrichtung aller klassischen Ethik beibehalten. Selbst dann ist der Unterschied groß. Die Einhegung der Nähe und Gleichzeitigkeit ist dahin, fortgeschwemmt von der räumlichen Ausbreitung und Zeitlänge der Kausalreihen, welche die technische Praxis, auch wenn für Nahzwecke unternommen, in Gang setzt. Ihre Unumkehrbarkeit, im Verein mit ihrer zusammengefaßten Größenordnung, führt einen weiteren neuartigen Faktor in die moralische Gleichung ein. Dazu ihr kumulativer Charakter: ihre Wirkungen addieren sich, so daß die Lage für späteres Handeln und Sein nicht mehr dieselbe ist wie für den anfänglich Handelnden, sondern zunehmend davon verschieden und immer mehr ein Ergebnis dessen, was schon getan ward. Alle herkömmliche Ethik rechnete nur mit nicht-kumulativem Verhalten.4 Die Grundsituation von Mensch zu Mensch, in der Tugend sich erproben und Laster sich entblößen muß, bleibt stets dieselbe und mit ihr fängt jede Tat von neuem an. Die wiederkehrenden Gelegenheiten, die je nach ihrer Klasse ihre Alternativen des Handelns stellen – Mut oder Feigheit, Maß oder Exzeß, Wahrheit oder Lüge, usw. – stellen jedesmal die Urbedingungen wieder her. Diese sind unüberholbar. Aber die kumulative Selbstfortpflanzung technologischer Veränderung der Welt überholt fortwährend die Bedingungen jedes ihrer beitragenden Akte und verläuft durch lauter präzedenzlose Situationen, für die die Lehren der Erfahrung ohnmächtig sind. Ja, die Kumulation als solche, nicht genug damit, ihren Anfang bis zur Unkenntlichkeit zu verändern, mag die Grundbedingung der ganzen Reihe, die Voraussetzung ihrer selbst, verzehren. All dieses müßte im Willen der Einzeltat mitgewollt sein, wenn diese sittlich verantwortlich sein soll.
2. Die neue Rolle des Wissens in der Moral
Unter solchen Umständen wird Wissen zu einer vordringlichen Pflicht über alles hinaus, was je vorher für seine Rolle in Anspruch genommen wurde, und das Wissen muß dem kausalen Ausmaß unseres Handelns größengleich sein. Die Tatsache aber, daß es ihm nicht wirklich größengleich sein kann, das heißt, daß das vorhersagende Wissen hinter dem technischen Wissen, das unserem Handeln die Macht gibt, zurückbleibt, nimmt selbst ethische Bedeutung an. Die Kluft zwischen Kraft des Vorherwissens und Macht des Tuns erzeugt ein neues ethisches Problem. Anerkennung der Unwissenheit wird dann die Kehrseite der Pflicht des Wissens und damit ein Teil der Ethik, welche die immer nötiger werdende Selbstbeaufsichtigung unserer übermäßigen Macht unterrichten muß. Keine frühere Ethik hatte die globale Bedingung menschlichen Lebens und die ferne Zukunft, ja Existenz der Gattung zu berücksichtigen. Daß eben sie heute im Spiele sind, verlangt, mit einem Wort, eine neue Auffassung von Rechten und Pflichten, für die keine frühere Ethik und Metaphysik auch nur die Prinzipien, geschweige denn die fertige Doktrin bietet.
3. Sittliches Eigenrecht der Natur?
Und wie, wenn die neue Art menschlichen Handelns bedeuten würde, daß mehr als nur das Interesse »des Menschen« allein zu berücksichtigen ist – daß unsere Pflicht sich weiter erstreckt und die anthropozentrische Beschränkung aller früheren Ethik nicht mehr gilt? Es ist zumindest nicht mehr sinnlos, zu fragen, ob der Zustand der außermenschlichen Natur, die Biosphäre als Ganzes und in ihren Teilen, die jetzt unserer Macht unterworfen ist, eben damit ein menschliches Treugut geworden ist und so etwas wie einen moralischen Anspruch an uns hat – nicht nur um unsretwillen, sondern auch um ihrer selbst willen und aus eigenem Recht. Wenn solches der Fall wäre, so würde es kein geringes Umdenken in den Grundlagen der Ethik erfordern. Es würde bedeuten, nicht nur das menschliche Gut, sondern auch das Gut außermenschlicher Dinge zu suchen, das heißt die Anerkennung von »Zwecken an sich selbst« über die Sphäre des Menschen hinaus auszudehnen und die Sorge dafür in den Begriff des menschlichen Guts einzubeziehen. Für eine solche Treuhänderrolle hat keine frühere Ethik (außerhalb der Religion) uns vorbereitet – und die herrschende wissenschaftliche Ansicht der Natur noch viel weniger. Ja, die letztere versagt uns gerade mit Entschiedenheit jedes theoretische Recht, über die Natur noch als etwas zu Achtendes zu denken – hat sie diese doch zu der Indifferenz von Notwendigkeit und Zufall reduziert und aller Würde von Zwecken entkleidet. Und doch, ein stummer Appell um Schonung ihrer Integrität scheint von der bedrohten Fülle der Lebenswelt auszugehen. Sollen wir auf ihn hören, sollen wir seinen Anspruch als verbindlich, weil sanktioniert von der Natur der Dinge, anerkennen oder in ihm lediglich ein Sentiment unsererseits sehen, dem wir nachgeben mögen, wenn wir wollen und soweit wir's uns leisten können? Die erstere Alternative, in ihren theoretischen Implikationen ernst genommen, würde uns nötigen, das erwähnte Umdenken weit auszudehnen und über die Lehre vom Handeln, das heißt die Ethik, hinaus in die Lehre vom Sein, das heißt die Metaphysik, voranzutreiben, in der alle Ethik letztlich gegründet sein muß. Über diesen spekulativen Gegenstand will ich hier nicht mehr sagen, als daß wir uns offen halten sollten für den Gedanken, daß die Naturwissenschaft nicht die ganze Wahrheit über die Natur aussagt.
IV. Technologie als »Beruf« der Menschheit
1. Homo faber über homo sapiens
Kehren wir zurück zu strikt innermenschlichen Erwägungen, so gibt es noch einen weiteren ethischen Aspekt im Hinauswachsen der techne als menschlicher Bestrebung über die pragmatisch begrenzten Ziele früherer Zeiten. Damals, so fanden wir, war die Technik ein zugemessener Zoll an die Notwendigkeit, nicht die Straße zum erwählten Ziel der Menschheit – ein Mittel mit einem endlichen Grad der Angemessenheit an wohldefinierte naheliegende Zwecke. Heute, in der Form der modernen Technik, hat sich techne in einen unendlichen Vorwärtsdrang der Gattung verwandelt, in ihr bedeutsamstes Unternehmen, in dessen fortwährend sich selbst überbietendem Fortschreiten zu immer größeren Dingen man den Beruf des Menschen zu sehen versucht ist, und dessen Erfolg maximaler Herrschaft über die Dinge und über den Menschen selbst als die Erfüllung seiner Bestimmung erscheint. So bedeutet der Triumph des homo faber über sein äußeres Objekt zugleich seinen Triumph in der inneren Verfassung des homo sapiens, von dem er einst ein dienender Teil zu sein pflegte. Mit anderen Worten, auch abgesehen von ihren objektiven Werken nimmt die Technologie ethische Bedeutung an durch den zentralen Platz, den sie jetzt im subjektiven menschlichen Zweckleben einnimmt. Ihre kumulative Schöpfung, nämlich die sich ausdehnende künstliche Umwelt, verstärkt in stetiger Rückwirkung die besonderen Kräfte, welche sie hervorgebracht haben: das schon Geschaffene erzwingt deren immer neuen erfinderischen Einsatz in seiner Erhaltung und weiteren Entwicklung und belohnt sie mit vermehrtem Erfolg – der wieder zu dem gebieterischen Anspruch beiträgt. Dieser positive feed-back von funktioneller Notwendigkeit und Belohnung – in dessen Dynamik der Stolz auf die Leistung nicht zu vergessen ist – nährt die wachsende Überlegenheit einer Seite der menschlichen Natur über alle anderen, und unvermeidlich auf ihre Kosten. Wenn nichts so gelingt, wie das Gelingen, so nimmt auch nichts so gefangen, wie das Gelingen. Was immer sonst zur Fülle des Menschen gehört, wird an Prestige überstrahlt durch die Ausdehnung seiner Macht, und so ist diese Ausdehnung, indem sie mehr und mehr der Kräfte des Menschen an ihr Geschäft bindet, begleitet von einer Schrumpfung seines Selbstbegriffs und Seins. In dem Bilde, das er von sich selbst unterhält – der programmatischen Vorstellung, die sein aktuelles Sein so sehr bestimmt wie sie es spiegelt – ist der Mensch jetzt immer mehr der Hersteller dessen, was er hergestellt hat, und der Tuer dessen, was er tun kann – und am meisten der Vorbereiter dessen, was er demnächst zu tun imstande sein wird. Doch wer ist »er«? Nicht ihr oder ich: es ist der kollektive Täter und die kollektive Tat, nicht der individuelle Täter und die individuelle Tat, die hier eine Rolle spielen; und es ist die unbestimmte Zukunft viel mehr als der zeitgenössische Raum der Handlung, die den relevanten Horizont der Verantwortung abgibt. Dies erfordert Imperative neuer Art. Wenn die Sphäre des Herstellens in den Raum wesentlichen Handelns eingedrungen ist, dann muß Moralität in die Sphäre des Herstellens eindringen, von der sie sich früher ferngehalten hat, und sie muß dies in der Form öffentlicher Politik tun. Mit Fragen von solcher Umfangsbreite und solchen Längen projektierender Vorwegnahme hatte öffentliche Politik es nie vorher zu tun. In der Tat, das veränderte Wesen menschlichen Handelns verändert das Grundwesen der Politik.
2. Die universale Stadt als zweite Natur und das Seinsollen des Menschen in der Welt
Denn die Grenze zwischen »Staat« (polis) und »Natur« ist aufgehoben worden: Die Stadt der Menschen, einstmals eine Enklave in der nichtmenschlichen Welt, breitet sich über das Ganze der irdischen Natur aus und usurpiert ihren Platz. Der Unterschied zwischen dem Künstlichen und dem Natürlichen ist verschwunden, das Natürliche ist von der Sphäre des Künstlichen verschlungen worden; und gleichzeitig erzeugt das totale Artefakt, die zur Welt gewordenen Werke des Menschen, die auf ihn und durch ihn selbst wirken, eine neue Art von »Natur«, das heißt eine eigene dynamische Notwendigkeit, mit der die menschliche Freiheit in einem gänzlich neuen Sinn konfrontiert ist.
Einstmals konnte gesagt werden fiat iustitia, pereat mundus, »Gerechtigkeit soll geschehen und gehe die Welt darüber zugrunde« – wo »Welt« natürlich die erneuerbare Enklave im nie-zugrundegehenden Ganzen bedeutet; dies Wort kann nicht einmal mehr rhetorisch gesagt werden, wenn das Zugrundegehen des Ganzen durch Taten des Menschen, seien sie nun gerecht oder ungerecht, eine reale Möglichkeit geworden ist. Fragen, die nie zuvor Gegenstand der Gesetzgebung waren, treten in den Umkreis der Gesetze ein, die die globale »Stadt« sich geben muß, auf daß es eine Welt für die kommenden Geschlechter der Menschen gebe.
Daß es in alle Zukunft eine solche Welt geben soll – eine Welt geeignet für menschliche Bewohnung – und daß sie in alle Zukunft bewohnt sein soll von einer dieses Namens würdigen Menschheit, wird bereitwillig bejaht werden als ein allgemeines Axiom oder als überzeugende Wünschbarkeit spekulativer Phantasie (so überzeugend und so unbeweisbar wie der Satz, daß die Existenz einer Welt überhaupt besser sei als die Existenz keiner): aber als moralische Proposition, nämlich, als eine praktische Verpflichtung gegenüber der Nachwelt einer entfernten Zukunft und als Prinzip der Entscheidung in gegenwärtiger Aktion, ist der Satz sehr verschieden von den Imperativen der früheren Ethik der Gleichzeitigkeit; und er hat die sittliche Bühne erst mit unseren neuartigen Kräften und der neuen Reichweite unseres Vorherwissens betreten. Die Anwesenheit des Menschen in der Welt war ein erstes und fraglos Gegebenes gewesen, von dem jede Idee der Verpflichtung im menschlichen Verhalten ihren Ausgang nahm: jetzt ist sie selber ein Gegenstand der Verpflichtung geworden – der Verpflichtung nämlich, die erste Prämisse aller Verpflichtung, das heißt eben das Vorhandensein bloßer Kandidaten für ein moralisches Universum in der physischen Welt, für die Zukunft zu sichern; und das heißt unter anderem, diese physische Welt so zu erhalten, daß die Bedingungen für ein solches Vorhandensein intakt bleiben; und das heißt, ihre Verletzlichkeit vor einer Gefährdung dieser Bedingungen zu schützen. Ich will den Unterschied, den dies für die Ethik macht, an einem Beispiel illustrieren.
V. Alte und neue Imperative
1. Kants kategorischer Imperativ sagte: »Handle so, daß du auch wollen kannst, daß deine Maxime allgemeines Gesetz werde.« Das hier angerufene »kann« ist das der Vernunft und ihrer Einstimmung mit sich selbst: Die Existenz einer Gesellschaft menschlicher Akteure (handelnder Vernunftwesen) vorausgesetzt, muß die Handlung so sein, daß sie sich ohne Selbstwiderspruch als allgemeine Übung dieser Gemeinschaft vorstellen läßt. Man beachte, daß hier die Grundüberlegung der Moral nicht selber moralisch, sondern logisch ist: das »wollen können« oder »nicht können« drückt logische Selbstverträglichkeit oder -unverträglichkeit, nicht sittliche Approbation oder Revulsion aus. Es liegt aber kein Selbstwiderspruch in der Vorstellung, daß die Menschheit einmal aufhöre zu existieren, und somit auch kein Selbstwiderspruch in der Vorstellung, daß das Glück gegenwärtiger und nächstfolgender Generationen mit dem Unglück oder gar der Nichtexistenz späterer Generationen erkauft wird – so wenig, wie schließlich im Umgekehrten, daß die Existenz und das Glück späterer Generationen mit dem Unglück und teilweise sogar der Vertilgung gegenwärtiger erkauft wird. Das Opfer der Zukunft für die Gegenwart ist logisch nicht angreifbarer als das Opfer der Gegenwart für die Zukunft. Der Unterschied ist nur, daß im einen Fall die Reihe weitergeht, im andern nicht. Aber daß sie weitergehen soll, ungeachtet der Verteilung von Glück und Unglück, ja selbst mit Übergewicht des Unglücks über das Glück, und sogar der Unmoral über die Moral5, läßt sich nicht aus der Regel der Selbsteinstimmigkeit innerhalb der Reihe, so lange oder kurz sie eben dauert, ableiten: es ist ein außer ihr und ihr vorausliegendes Gebot ganz anderer Art und letztlich nur metaphysisch zu begründen.
2. Ein Imperativ, der auf den neuen Typ menschlichen Handelns paßt und an den neuen Typ von Handlungssubjekt gerichtet ist, würde etwa so lauten: »Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden«; oder negativ ausgedrückt: »Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstörerisch sind für die künftige Möglichkeit solchen Lebens«; oder einfach: »Gefährde nicht die Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf Erden«; oder, wieder positiv gewendet: »Schließe in deine gegenwärtige Wahl die zukünftige Integrität des Menschen als Mit-Gegenstand deines Wollens ein«.
3. Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß kein rationaler Widerspruch in der Verletzung dieser Art von Imperativ involviert ist. Ich kann das gegenwärtige Gut unter Aufopferung des zukünftigen Guts wollen. Ich kann, so wie mein eigenes Ende, auch das Ende der Menschheit wollen. Ich kann, ohne in Widerspruch mit mir selbst zu geraten, wie für mich so auch für die Menschheit ein kurzes Feuerwerk äußerster Selbsterfüllung der Langeweile endloser Fortsetzung im Mittelmaß vorziehen.
Aber der neue Imperativ sagt eben, daß wir zwar unser eigenes Leben, aber nicht das der Menschheit wagen dürfen; und daß Achill zwar das Recht hatte, für sich selbst ein kurzes Leben ruhmreicher Taten vor einem langen Leben ruhmloser Sicherheit zu wählen (unter der stillschweigenden Voraussetzung nämlich, daß eine Nachwelt da sein wird, die von seinen Taten zu erzählen weiß); daß wir aber nicht das Recht haben, das Nichtsein künftiger Generationen wegen des Seins der jetzigen zu wählen oder auch nur zu wagen. Warum wir dieses Recht nicht haben, warum wir im Gegenteil eine Verpflichtung gegenüber dem haben, was noch garnicht ist und »an sich« auch nicht zu sein braucht, jedenfalls als nicht existent keinen Anspruch auf Existenz hat, ist theoretisch garnicht leicht und vielleicht ohne Religion überhaupt nicht zu begründen. Unser Imperativ nimmt es zunächst ohne Begründung als Axiom.
4. Es ist ferner offensichtlich, daß der neue Imperativ sich viel mehr an öffentliche Politik als an privates Verhalten richtet, welches letztere nicht die kausale Dimension ist, auf die er anwendbar ist. Kants kategorischer Imperativ war an das Individuum gerichtet und sein Kriterium war augenblicklich. Er forderte jeden von uns auf, zu erwägen, was geschehen würde, wenn die Maxime meiner jetzigen Handlung zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gemacht würde oder es in diesem Augenblick schon wäre: die Selbsteinstimmigkeit oder Nichteinstimmigkeit einer solchen hypothetischen Verallgemeinerung wird zur Probe meiner privaten Wahl gemacht. Aber es war kein Teil dieser Vernunftüberlegung, es bestehe irgendeine Wahrscheinlichkeit dafür, daß meine private Wahl tatsächlich allgemeines Gesetz werde oder zu einem solchen Allgemeinwerden auch nur beitrage. In der Tat, reale Folgen sind überhaupt nicht ins Auge gefaßt und das Prinzip ist nicht dasjenige objektiver Verantwortung, sondern das der subjektiven Beschaffenheit meiner Selbstbestimmung. Der neue Imperativ ruft eine andere Einstimmigkeit an: nicht die des Aktes mit sich selbst, sondern die seiner schließlichen Wirkungen mit dem Fortbestand menschlicher Aktivität in der Zukunft. Und die »Universalisierung«, die er ins Auge faßt, ist keineswegs hypothetisch – das heißt die bloß logische Übertragung vom individuellen »Ich« auf ein imaginäres, kausal damit unverbundenes »Alle« (»wenn jeder so täte«): im Gegenteil, die dem neuen Imperativ unterworfenen Handlungen, nämlich Handlungen des kollektiven Ganzen, haben den universalen Bezug in dem tatsächlichen Ausmaß ihrer Wirksamkeit: sie »totalisieren« sich selbst im Fortschritt ihres Impulses und können nicht anders, als in der Gestaltung des universalen Zustands der Dinge zu terminieren. Dies nun fügt dem moralischen Kalkül den Zeithorizont hinzu, der in der logischen Augenblicksoperation des kantischen Imperativs gänzlich fehlt: extrapoliert der letztere in eine immer-gegenwärtige Ordnung abstrakter Kompatibilität, so extrapoliert unser Imperativ in eine berechenbare wirkliche Zukunft als die unabgeschlossene Dimension unserer Verantwortlichkeit.
VI. Frühere Formen der »Zukunftsethik«
Nun ließe sich einwenden, daß wir mit Kant ein extremes Beispiel der Gesinnungsethik gewählt haben und daß unsere Behauptung von dem Präsenzcharakter aller früheren Ethik als einer Ethik der Gleichzeitigen durch verschiedene ethische Formen in der Vergangenheit zu widerlegen sei. An folgende drei Beispiele läßt sich denken: die Führung des irdischen Lebens, bis zur Aufopferung seines Glücks, im Hinblick auf das ewige Heil der Seele; die vorausschauende Sorge des Gesetzgebers und Staatsmanns für das künftige Gemeinwohl; und die Politik der Utopie mit der Bereitschaft, die jetzt Lebenden als bloßes Mittel für ein Ziel nach ihnen zu benützen oder als Hindernis dafür zu beseitigen – wovon der revolutionäre Marxismus das prominente Beispiel ist.
1. Ethik der jenseitigen Vollendung
Von diesen drei Fällen haben der erste und dritte gemeinsam, daß sie die Zukunft als möglichen Ort absoluten Wertes über die Gegenwart stellen und die Gegenwart zu einer bloßen Vorbereitung für die Zukunft herabdrücken. Ein wichtiger Unterschied ist, daß im religiösen Fall das jetzige Handeln den künftigen Zustand nicht etwa kausal herbeiführen, sondern nur die Person dafür qualifizieren soll, nämlich in den Augen Gottes, dem der Glaube die Herbeiführung überlassen muß. Die Qualifizierung besteht aber in einem gottgefälligen Leben, von dem sich im allgemeinen annehmen läßt, daß es schon in sich das beste, lebenswerteste Leben ist und also garnicht erst um der etwaigen ewigen Seligkeit willen gewählt zu werden braucht – ja mit dieser als Hauptmotivierung der Wahl nur von seinem Wert und damit sogar von seiner Qualifizierungsfähigkeit verlieren würde. Das heißt, die letztere ist desto besser, je unbeabsichtigter sie ist. Fragt man aber, worin die Qualifizierung inhaltlich besteht, so muß man sich die betreffenden Lebensvorschriften ansehen, und dann mag sich finden, daß es eben die Vorschriften der Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Lauterkeit, usw. sind, die auch eine innerweltliche Ethik klassischen Stils vorschreiben würde oder könnte. Also haben wir es in der »gemäßigten« Version des Seelenheilsglauben, die, wenn ich nicht irre, zum Beispiel die jüdische ist, doch wieder mit einer Ethik der Gleichzeitigkeit und Unmittelbarkeit zu tun; und was für eine Ethik es im Einzelfall ist, ergibt sich nicht aus dem Jenseitsziel als solchen, von dessen Inhalt sich ohnehin keine Vorstellung machen läßt, sondern daraus, wie das gottgefällige Leben, das die Bedingung dafür sein soll, jeweils inhaltlich bestimmt war.
Allerdings nun kann die Bedingung inhaltlich so bestimmt sein – und das wird sie in den »extremen« Formen des Seelenheilsglaubens – daß ihre Erfüllung in keinem Fall als Wert in sich selbst, sondern ausschließlich als Einsatz in einer Wette betrachtet werden kann, mit deren Verlust, das heißt der Nichterlangung des ewigen Gewinns, alles verloren wäre. Denn in diesem Fall der – von Pascal ausgearbeiteten – grausigen metaphysischen Wette ist der Einsatz das ganze irdische Leben mit all seinen Glücks- und Erfüllungsmöglichkeiten, deren Versagung gerade die Bedingung für das ewige Heil wird. Hierher gehören alle Formen radikaler, sinnesabtötender und lebensverneinender Askese, deren Praktizierer sich beim Fehlschlag ihrer Erwartung um alles betrogen hätten. Von dem gewöhnlichen, diesseitigen hedonistischen Kalkül mit den Risiken seiner erwogenen Verzichte und zeitweiligen Aufschübe unterscheidet sich dieser nur durch die Totalität seines Quid-pro-quo und die Überschwenglichkeit der dem Einsatz gegenüberstehenden Chance. Aber eben diese Überschwenglichkeit rückt das ganze Unternehmen aus dem Bereich der Ethik heraus. Zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen, dem Zeitlichen und dem Ewigen, gibt es keine Kommensurabilität und daher auch keine sinnvolle Korrelation (das heißt weder einen qualitativen noch rechnerischen Sinn, in dem das eine dem andern vorzuziehen ist); und über den Wert des Zieles, dessen wissende Beurteilung doch ein Wesensstück ethischer Entscheidung bilden müßte, gibt es nicht mehr als die leere Aussage, daß er eben der absolute sei. Auch fehlt die jedenfalls für das ethische Denken notwendige Kausalverbindung zwischen der Handlung und ihrem (erhofften) Ergebnis, das der diesseitige Verzicht ja nicht etwa bewirken, sondern durch dessen anderweitige Gewährung er sich nur entschädigen lassen soll.
Fragt man daher, warum der radikale diesseitige Verzicht als so verdienstlich angesehen wird, daß er sich diese Entschädigung oder Belohnung versprechen darf, so kann eine Antwort sein, daß das Fleisch sündig, die Lust böse und die Welt unrein sei, und in diesem Fall (wie auch in dem etwas anderen, daß die Individuierung als solche schlecht sei) liegt allerdings in der Askese doch wieder eine echte Instrumentalität des Handelns und ein Weg innerer Zweckverwirklichung aus eigenem Tun – der Weg nämlich von Unreinheit zu Reinheit, von Sündigkeit zu Heiligkeit, von Knechtschaft zu Freiheit, von Selbstheit zu Entselbstung: insoweit sie dies ist, ist die Askese also in sich selbst schon die, unter solchen metaphysischen Bedingungen, beste Art des Lebens. Damit wären wir aber wieder bei der Ethik der Unmittelbarkeit und Gleichzeitigkeit angelangt – einer wenn auch hochegoistischen und extrem individualistischen Form der Ethik der Selbstvollendung, die dann auch in Momenten spiritueller Erleuchtung, wozu ihre Anstrengung es bringen kann, den künftigen Lohn als mystisches Erlebnis des Absoluten schon hier genießen darf.
In summa, so können wir sagen, insoweit dieser gesamte Komplex jenseitiger Ausrichtung überhaupt in die Ethik gehört – was er insbesondere in der ersterwähnten »gemäßigten« Form eines in sich gottgefälligen Lebens als Bedingung ewigen Lohnes tut – so fügt auch er sich in unseren Satz vom Präsenzcharakter aller bisherigen Ethik.
2. Die Zukunftsverantwortung des Staatsmannes
Wie aber steht es mit den Beispielen von innerweltlicher Zukunftsethik, die allein wirklich zur rationalen Ethik gehören? Wir nannten an zweiter Stelle die vorausschauende Sorge des Gesetzgebers und Staatsmanns für das künftige Wohl des Gemeinwesens. Über den uns hier interessierenden Zeitaspekt ist antike Theorie im ganzen stumm, aber schon dies Schweigen ist aufschlußreich, und einiges läßt sich außerhalb der Philosophie dem Lob großer Gesetzgeber wie Solon und Lykurg oder auch dem Tadel eines Staatsmanns wie Perikles entnehmen. Das Lob des Gesetzgebers schließt wohl die Dauerhaftigkeit seiner Schöpfung ein, aber nicht sein Vorausplanen von etwas, das erst für die Späteren Wirklichkeit werden soll und für die Mitlebenden noch unerreichbar ist. Sein Bestreben ist, ein lebensfähiges politisches Gebilde zu schaffen, und die Probe der Lebensfähigkeit liegt in der Dauer – und zwar möglichst unveränderten Dauer – des Geschaffenen. Der beste Staat, so war die Vorstellung, ist auch der für die Zukunft beste, eben weil er in seinem jederzeit jetzigen inneren Gleichgewicht die Zukunft als solche verbürgt, und dann natürlich auch der in der Zukunft beste, weil die Kriterien einer guten Ordnung (von denen die Dauerhaftigkeit eines ist) sich nicht ändern. Und sie ändern sich nicht, weil die menschliche Natur sich nicht ändert, die mit ihren Unvollkommenheiten in die Konzeption einer lebensfähigen politischen Ordnung, welches die Konzeption des weisen Gesetzgebers sein muß, eingeschlossen ist. Diese zielt daher nicht auf den ideal vollkommenen, sondern auf den real besten, das heißt bestmöglichen Staat, der jetzt ebenso möglich, aber auch so gefährdet ist, wie künftig. Eben diese Gefährdung, die aller Ordnung von der Unordnung der menschlichen Leidenschaften droht, macht über die einmalige, gründende Weisheit des Gesetzgebers hinaus die stetige, regierende Weisheit des Staatsmannes nötig. Aber der Vorwurf des Sokrates gegen die Staatskunst des Perikles ist nicht, daß seine grandiosen Unternehmungen später, nach seinem Tode, fehlschlugen,