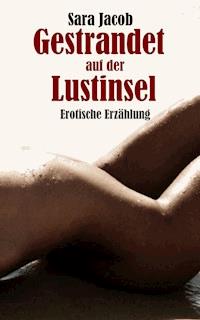Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wer ist der Geist, der nur das Eine will? Wer ist die Stimme in deinem Kopf? Wer steht in deinem Zimmer, um dich zu beobachten? Wer ist die Reinkarnation des heiligen Geists? Ein Unfall ändert Leons ganzes Leben und plötzlich steht ihm die ganze Welt offen. Denn Leon ist plötzlich unsichtbar – und von nun an das Sex-Phantom. Aus schnellen, erotischen Abenteuern wird schließlich eine intensive Reise zu sich selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sara Jacob
Das Sex-Phantom
Erotischer Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Unglück? Freiheit!
Voyeur im Glück
Lieber allein, als böse…
Die Schulfreundin
In vollen Zügen
Ich sehe was, was du nicht siehst
Mein Geist will immer nur das Eine
Geile Geisterjagd
Die Stimmen im Kopf
Solo für drei
Filmreifes Comeback
Impressum neobooks
Unglück? Freiheit!
1.
Ich arbeitete als freier Wissenschaftsjournalist in Berlin. Wildschutz durch Computer, Gesichtsscanner am Flughafen, Geothermiekraftwerk in Brandenburg – die Themen fanden sich im gleichen Maße leicht, wie sie schwer zu verkaufen waren. Meine Beiträge versuchte ich auf den Wissenschaftsseiten der Tageszeitungen unterzubringen, aber die Konkurrenz war groß, das Geld knapp, die Arbeit unbefriedigend.
Und im heißesten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen (darüber musste man einfach eine Reportage schreiben, das dachten sich jedenfalls meine Konkurrenten) machte sich der Frust über meine berufliche Situation auch in meiner Beziehung zu meiner langjährigen Freundin Katrin bemerkbar.
Nur wegen ihr war ich nach Berlin gezogen, weil sie einen unglaublich guten Job in einem Bundesministerium bekommen hatte. Sie bezahlte unsere Wohnung, unseren Urlaub, unser Leben. Und ich hoffte auf den Aufstieg in einer Branche, die von Selbstausbeutung lebte.
Es war der Abend vor einer neuen Recherche, als sie ihre Koffer packte und aus unserer stickigen Wohnung auszog. Der Schnitt, so überraschend er auch gezogen war, folgte einer schmerzvollen Konsequenz. Katrin hatte sich nicht in einem Ausbruch von Wut und Enttäuschung für die Trennung entschieden: Dieser Schritt war wohlüberlegt. Kein Heulen, kein Flehen ging unserem Abschied voraus.
Mit einer nüchternen Analyse, wie ich sie von Katrin erwartet hatte, bilanzierte sie die letzten Monate und zog daraus den logischen Schluss. Ich hatte versagt, hatte mit dem Schwanz gedacht und nicht mit dem Kopf, hatte nur daran gedacht, mit anderen Frauen ins Bett zu steigen und so zu werden wie mein Vater. Ich war nie besser gewesen.
Es war alles in meinem Kopf.
Wir waren zu Minensuchern geworden, und der andere war das Minenfeld. Jede falsche Bewegung löste eine Explosion aus und nahm sich mehr von unserer Liebe. Am Ende waren wir uns fremd. Früher wollte ich mich ändern, weniger dem Schwanz als vielmehr den Kopf das Denken überlassen, und früher wollte Katrin sich ändern, sensibler mit mir umgehen.
Doch um beim Bild zu bleiben: Ihre Hände begannen immer mehr zu zittern, und mein Zünder reagierte immer sensibler auf Fehlgriffe. Ich reagierte explosiv, unbeherrscht, nichts konnte sie richtigmachen, jede ihrer Fragen war ein Vorwurf, jede Bemerkung ein Seitenhieb auf mein berufliches Versagen. Ich warf ihr Arroganz vor und Überlegenheitsgefühl, und war doch nur geprägt von Minderwertigkeitskomplexen und unzufrieden mit mir selbst.
Als Katrin ging, brach die Welt noch nicht zusammen. Das tat sie erst ein paar Stunden später in der Hitze der Nacht. Ich hatte gesoffen, in der Kneipe die Straße runter, jeder Flirt ertrank dabei in einem neuen Bierglas.
Lasst mich doch in Ruhe, hatte ich nur gedacht und nicht gesagt, denn niemand war da gewesen, um mit mir zu ficken. Also hatte ich den Rest der Nacht im Internet nach Pornos gesucht, bis mir die Hand und der Arsch wehtaten. Der Alkohol betäubte nur meinen Schwanz, nicht den Schmerz.
Hohl und leer legte ich mich in unser, in mein Bett, in das leere Bett.
Die Nacht zog schmierige Schlieren, die hektisch zitternd verblassten.
Ich war frei, nein, ich war verlassen. Ich konnte alles tun, was ich wollte, konnte endlich, konnte was? Ich war wie mein Vater, ich war unfähig zu einer Beziehung, ich war unfähig, mit etwas anderem als mit meinem Schwanz zu denken.
Schluchzend wälzte ich mich auf einem schweißnassen Laken, spürte eine nie gekannte Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit. Schlaflos starrte ich zum Mond, der durch das offene Fenster unseres Schlafzimmers schien. Warme Luft an meiner Haut. Mein Leben würde nie wieder so sein, wie es war.
Pläne hatten ihre Gültigkeit verloren. Abmachungen waren wertlos geworden. Ficken, mit allem ficken, was jetzt in meine Nähe kam -das konnte ich noch, doch was hatte das für einen Sinn?
Jetzt konnte ich, doch jetzt wollte ich nicht mehr. Ich ekelte mich vor mir selber, vor dem Mann, der nur Schwanz war und nicht Kopf.
Katrins letzte Worte klangen wie die Warteschleife in einer Telefonanlage. »Ich habe versucht, dir zu helfen, aber du suhlst dich in deinem Selbstmitleid«, sagte Katrin immer und immer wieder.
Selbstmitleid. Wenn es nur das wäre. Ich hasste mich.
Bald wich das Dunkel über der Stadt einem blassen Schimmer und einem hässlich heißen Morgen. Ich zog mich schwankend an, schlich die Treppe hinunter auf die Straße, kaufte mir einen Kaffee und setzte mich mit brennenden Augen in die S-Bahn. Mein Blick wollte ins Leere gehen und fing sich doch als blasse Reflexion in der Scheibe des Wagens.
Das Gesicht kam mir seltsam fremd vor.
2.
Im Hahn-Meitner-Institut in Berlin-Wannsee wurde ich erwartet. Mein Name auf der Liste war falsch geschrieben. Welcher Idiot schrieb Leon mit einem W? Vom Pförtner bekam ich eine Plakette, an der die Strahlungsbelastung abzulesen war. Eine Physikerin namens Horkheimer begrüßte mich. In einem Fahrstuhl fuhren wir in das dritte Untergeschoss.
Es ging bei diesem Artikel um Forschungen an Bildern. Mittels einer speziellen radioaktiven Strahlung wollten Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern herausfinden, wie viele Farbschichten sich unter einem Bild von Tizian wirklich verbargen. Ich konnte den Erläuterungen von Dr. Horkheimer nicht zuhören.
In Gedanken war ich ständig bei Katrin. Der Kloß in meinem Hals schwand nicht. Wir gingen durch einige Türen und Gänge. Neonröhren an den Decken, grünes Linoleum auf dem Boden, weiße Wände. Schließlich gelangten wir zu einer schweren Stahlkammer. Das gelb-schwarze Zeichen für Radioaktivität darauf beeindruckte mich mehr als erwartet. Als sich die Tür hinter uns schloss, wirkte es wie das Finale in einem Film, wenn sich die letzten Menschen in einem Atomschutzbunker versteckten und die Atomraketen abgeschossen wurden.
Ein halbes Dutzend Wissenschaftler wirbelte um den Forschungsreaktor herum. Der Kontrollraum hatte bemerkenswert wenig Ähnlichkeit mit dem, was ich aus Filmen erkannte. Keine große Schalttafel, sondern viele herkömmliche Computer, Monitore, unbekannte Maschinen. Ich musste zugeben – ich war schlecht vorbereitet auf dieses Experiment. Außerdem war mir übel.
Ob die Menschen um mich herum bemerkten, dass ich noch immer besoffen war? Ich hatte keine Ahnung, was genau dort vor sich ging. Bei den Telefonaten mit Frau Dr. Horkheimer hatte ich die Pressemitteilung vorliegen, und ich verstand, was die Wissenschaftler dort machten. Aber vom Wie hatte ich keine Ahnung. Ich war Journalist, kein Physiker. Jetzt fehlten mir die Infos der Mitteilung, und außerdem fochten Bier und Tequila einen unfairen Kampf gegen mich.
Bald tauchte die Mitarbeiterin der Gemäldegalerie mit dem Bild auf. Neben ihr ein muskelbepackter Wachmann. Und schließlich gerieten die Wissenschaftler in Wallung. Drückten hier einen Knopf und gaben dort Befehle ein. Als Frau Dr. Horkheimer ankündigte, die Untersuchung würde um eine halbe Stunde verschoben, verlor ich den Kampf. Die Stahltür öffnete sich nur für mich, ich wankte in den Korridor dahinter. Dann fiel die schwere Pforte wieder ins Schloss. Die Toilette war ein erstaunlich schmuddeliger Raum. Penible Wissenschaftler waren wohl nur zu Hause und im Labor penibel, nicht jedoch in fremden Toiletten.
Das weiße Toilettenbecken nahm mir nur zu gerne meine Buße ab. Mit zitternden Händen umklammerte ich die Keramik und spürte, wie sich mein Magen wieder entkrampfte. Erschöpft hockte ich mich auf den Boden. Nach ein paar Minuten konnte ich mein Bild im Spiegel wieder klar fixieren, einen Schluck Wasser aus dem Hahn nehmen und mit festem Griff die Tür zum Korridor öffnen.
Die roten Lichter auf dem Weg zurück zur Kammer fand ich zunächst nur überraschend. Als dann jedoch die Sirenen zu dröhnen begannen, packte mich die Panik. Die letzte Kurve vor der Stahltür nahm ich schon mit zitternden Knien.
Mir brach der Schweiß aus. Was schiefgelaufen war, hat mich später nicht interessiert. Das Bild jedoch von der durchsichtigen Stahltür und den brennenden Menschen dahinter werde ich nie vergessen. Die Wissenschaftler, die Mitarbeiter, die Frau aus dem Museum, der Wachmann – sie alle rissen sich verzweifelt die lodernde Kleidung vom Körper. Ihre Haare brannten.
Und die Stahltür: Sie war durchsichtig, doch man konnte die Konturen weiter erkennen. Sie wirkte wie aus Glas, brach das Licht, verzerrte die Perspektive auf das Drama dahinter. Der Schock riss mir fast die Füße weg. Als dann mein Hemd und meine Hose zu qualmen begannen, konnte ich nur noch mein Leben retten. Ich riss mir die schmelzenden Schuhe von den Füßen, zog mir das bereits brennende Hemd über den Kopf, warf die Hose ab.
Die Menschen hinter der Stahltür waren zusammengebrochen, als ich das nächste Mal hinsah. Ich wollte fliehen und wusste nicht wohin. Meine Boxershorts wurden brennend heiß. Sie folgten als nächste.
Das Linoleum unter meinen Füßen wurde warm, wellte sich, löste sich auf. Ich rannte nackt den Korridor hinauf, als ich den Knall hörte. Etwas riss mich von den Füßen, ich prallte gegen eine Tür. Diese sprang auf, ich stürzte in den dunklen Raum dahinter und stieß mir den Kopf. Dann verlor ich das Bewusstsein.
3.
Zitternd wachte ich auf. Anfangs wusste ich nicht, wo ich war, hielt einen Feudel für mein Kopfkissen und ein altes Handtuch für meine Decke. Dann spürte ich den Besen in meinem Rücken. Es war noch immer dunkel in der Besenkammer. Notbeleuchtung im Korridor. Rotes Blinken.
Die Ruhe war brutal.
Ich rappelte mich auf. An meinen Füßen spürte ich den warmen Boden, im Gesicht den heißen Luftzug im Korridor, ich schmeckte den Rauch in der Luft und roch meinen eigenen Schweiß. Ich wagte kaum, den Blick zurück in den Korridor zu werfen. Doch es war weniger schlimm als befürchtet.
Dort, wo der Forschungsreaktor gewesen war, gähnte ein tiefes Loch, in dem ein kleines Feuer flackerte. Rohre, verbogen wie krumme Äste, ragten aus der Wand, Kabel griffen ausgefranst ins Leere. Keine verbrannten Reste von Menschen, kein Blut, keine Knochen.
Die Stahltür war verschwunden, meine Kleidung auf dem Boden zu Asche verbrannt und mit dem Linoleum verschmolzen. Meine Brieftasche ein schwarzer Klumpen. Als ich mich bückte und danach griff, fasste ich ins Leere.
Und dann bemerkte ich es. Der Schock überrollte mich wie ein Güterzug. Ich glaubte erst an eine optische Täuschung, blinzelte, wollte mir mit der Hand die Augen reiben und wurde noch panischer. Mein Herz raste wie eine Ratte in ihrem Käfig. Da war keine Hand, waren keine Finger. Ich konnte meine Hände nicht sehen, nicht meine Füße, nicht meine Beine.
Verblüfft fiel ich zurück auf meinen Hintern. Wieder blieb mir die Luft weg. Ich hob das, was ich als Hände spürte, vor meine Augen und sah durch sie hindurch. Ich führte sie näher an meine Augen und berührte plötzlich mein Gesicht. War ich tot? Ein Geist? Mein Herz raste, meine Knie zitterten, der Kater war verschwunden.
Ich musste mich berühren, meine Hände kneten um mich zu vergewissern, dass sie noch da waren. Ich fasste meine Füße an, meine Knie, meine Oberschenkel, tastete nach meinem Penis und meinen Hoden, spürte erleichtert das Schamhaar, beruhigend den Bauch, meine Oberarme, mein Gesicht, meine Haare.
Langsam erhob ich mich und griff erneut nach meinem verkohlten Portmonee im Linoleum. Die Koordination einer unsichtbaren Hand stellte mein Hirn vor eine schwere Aufgabe. Zweimal, dreimal griff ich daneben. Dann schließlich konnte ich die Lücke im Bild ersetzen und den steinharten schwarzen Klumpen, in dem meine Kreditkarten, mein Ausweis, mein Leben steckten, ungläubig betasten.
Mir wurde schwindelig. Schmerzen nur im Kopf, ansonsten ging es mir gut. Und jetzt? Wo sollte ich hin? Was sollte ich machen? Hier war ein Reaktor explodiert. Das mussten doch Feuerwehr und Polizei, Katastrophenschutz und THW bemerkt haben? Vorsichtig lief ich barfuß den Gang hinauf.
Wie hatte das geschehen können?
Warum war ich nicht verbrannt wie die anderen?
Und wie konnte ein Atomreaktor Materie unsichtbar machen?
So viele banale Fragen von einem, der keine Ahnung hatte. Ich zog eine Tür auf, ging durch einen weiteren Gang und stand schließlich wieder vor dem Fahrstuhl. Er war außer Betrieb. Ich wollte nur hier raus aus diesem Labyrinth, geriet beinahe in Panik und fand schließlich die Tür zum Treppenhaus.
Als ich im Erdgeschoss anlangte, war noch immer niemand zu sehen oder zu hören. Der Empfang war geräumt. Doch draußen auf der Straße standen eine Menge Menschen etwa 100 Meter vor dem Gebäude des Instituts in der prallen Sonne. Ich sah sie durch die Glastüren der Lobby.
Fahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr, des THW, Ambulanzen, Sanitäter, Männer in weiß, grün, blau sowie eine Menge Schaulustige. Durch eine offene Tür wehte heiße Sommerluft herein. Umschmeichelte mich.
Da stand ich. Nackt. An einem Ort des größten anzunehmenden Unfalls. War am Leben und fühlte mich gut. Niemand konnte mich sehen.
Mir pochte mein Herz bis zum Hals.
Was würde passieren, wenn ich mich zu erkennen gab? Welche Experimente würde man mit mir machen? Wieder sah ich an mir herab und sah – nichts. Ich war unsichtbar. Ich war alleine. Ich hatte kein Geld, keine Freundin und keine Ahnung, wie es weitergehen sollte.
Meine Welt war zusammengebrochen. Es gab nur noch die Welt um mich herum. War es Zufall? Schicksal? Fantasie oder der Tod? Was es war, wusste ich nicht. Es war, und das begriff ich: Es war. Ich traf meine Entscheidung im Bruchteil einer Sekunde.
4.
Bevor die Feuerwehr in Schutzanzügen das Institut betrat, hatte ich mich durch die Tür ins Freie geschlichen. Die Hitze eines regelwidrig sommerlichen Junitages raubte mir beinahe den Atem. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Die Sonne fühlte sich nach Mittag an. Sirenen heulten, Motoren brummten, Funkgeräte schnarrten Durchsagen.
Die Sonne war immer noch gelb, die Bäume vor dem Institut grün, der Himmel blau und der kochende Asphalt auf der Straße schwarz. Nur ich war unsichtbar. Niemand bemerkte mich, niemand ahnte auch nur, dass ich über den Platz vor dem Institut zur Absperrung lief. Auf den Lippen der Ruf: »Hallo, hier bin ich, etwas Schreckliches ist passiert! Helft mir!«
Doch ich sagte ihn nicht, war sprachlos. Vor mir die Welt. Und in mir nichts als der Wunsch, mein altes Leben hinter mir zu lassen.
Ich holte tief Luft und fing das neue Leben an.
Meine nackten Füße gaben auf den warmen Granitplatten anfangs kleine, platschende Geräusche von sich, doch nach ein paar Schritten ging ich beinahe geräuschlos. Das Gefühl der Verlorenheit schwand mit jedem Zentimeter, den ich zurücklegte, und die Aufregung, die ich zuletzt in einem Kindheitstraum gespürte hatte, wuchs.
Es war wie in dem Traum, den ich oft als Teenager hatte. Darin flog ich nackt und wie ein Vogel mit ausgebreiteten Armen in einer warmen Sommernacht über die Dächer meiner Kleinstadt, spähte durch hell erleuchtete Fenster in fremde Zimmer und spürte die Lust daran, im Schutze der Dunkelheit eine Erektion zu bekommen.
Die Realität war jedoch nie so schön. Manchmal überkam mich die Lust, wenn ich in unserem Viertel Zeitungen austrug und von der Dunkelheit eingeholt wurde, und ich fummelte in einer dunklen Ecke einer kaum befahrenen Straße meinen harten Schwanz aus der Hose, um zu masturbieren.
Ich konnte mich auch daran erinnern, wie ich mit 13 zum letzten Mal mit meinen Eltern Skifahren war und die Lust auf der Skipiste zu groß wurde, um ihr zu widerstehen. Dann glitt ich von der Piste in den Fichtenwald, schnallte die Skier ab und setzte mich hinter einen Baum um zu wichsen. Aber ich kam nie an dieses Gefühl in meinem Traum heran, in dem ich die warme Luft überall an meinem nackten Körper spürte und ich meine Erektion stolz unter mir zur Schau trug.
Das Prickeln in der Lendengegend wurde überraschend stark. Doch nicht die Katastrophe geilte mich auf, sondern die Aussicht, einen Traum wahr machen zu können.
Ich war frei. Katrin hatte mich verlassen, weil ich nur Schwanz und nicht Kopf war.
Na und?
Dann war ich eben nur Schwanz.
Ich stellte mich vor starrende Feuerwehrleute, nervöse Polizisten und schreiende Wissenschaftler. Keiner reagierte auf mich.
Ich stellte mich hüpfend vor eine wartende Sanitäterin. Sie sah durch mich hindurch zur Tür des Instituts.
Die Wärme an meinen Füßen erinnerte mich wieder daran, dass ich war. Die Sonne schien es jedoch nur zu ahnen. Ich sah hinter mich: kein Schatten. Die Sonnenstrahlen jedoch brannten auf meiner Haut, wärmten mich. Nur das sichtbare Licht ging durch mich durch. So würde ich also noch einmal nahtlos braun werden in meinem Leben, und niemand konnte es sehen. Schade.
Die warme Luft umschmeichelte mich. Ich ging nahe an die Sanitäterin heran. Sie sah auf ihre Uhr, suchte nach etwas in der Tasche ihrer roten Weste und griff dann in die Taschen der weißen Hose. Sie hatte ihre blonden Haare zu einem Zopf gebunden. Unruhig stand sie hinter dem weißroten Plastikband der Absperrung.
Ein paar Feuerwehrleute in Schutzanzügen gingen jetzt mit Messgeräten zum Eingang. Was auch immer nach der Explosion des Reaktors ausgetreten war – weit schien die Strahlung nicht gekommen zu sein, sonst hätte man das ganze Viertel geräumt.
Die Sanitäterin fand schließlich, wonach sie gesucht hatte, wickelte den Kaugummi aus und steckte sich den Streifen in den Mund. Auf einmal fand ich ihren Mund sehr sinnlich. Ihr Gesicht war rund, ein wenig zu blass nach meinem Geschmack. Sie war vielleicht Mitte zwanzig, einen Kopf kleiner als ich, schlank und doch mit einem großen Hintern in der Hose. Ich musterte sie, ging ganz nah an sie heran, und versuchte, kaum zu atmen, damit sie mich nicht hörte.
Jetzt konnte ich den schwachen Geruch wahrnehmen, der sie umgab. Sie roch warm, ein wenig nach frischem Deo und ein wenig nach Pfefferminz. Ich hörte das leise Schmatzen, ihr Atmen, ein paar Silben eines Selbstgesprächs. Dann drehte sie den Kopf, sah zu einem Sanitätswagen hinüber. Neben mir begannen zwei Feuerwehrleute eine Unterhaltung. Dann sah die Sanitäterin wieder durch mich hindurch.
Sie hatte schöne Zähne, die immer wieder im Sonnenlicht aufblitzten. Je länger ich sie anstarrte, umso mehr gefiel sie mir. Ich bekam, Lust, sie zu berühren, sie zu küssen. Ich hatte Katrin so gerne geküsst. Und in diesem Moment fehlte sie mir plötzlich. Oder fehlte mir die Nähe? Mein Herz schlug schneller.
Ich überlegte, etwas zu sagen wie: He, ich bin unsichtbar.
Rasch verwarf ich den Gedanken wieder. Denn als ich so vor der Sanitäterin stand, mit dem Verlangen nach Katrin und dem Wissen, dass alles vorbei war, dass es keine Möglichkeit gab, dort weiter zu machen, wo wir aufgehört hatten, bekam ich plötzlich eine Erektion. Langsam richtete sich mein Schwanz auf.
Nur Schwanz.
Der heiße Wind an meinem Körper, die warmen Steine unter den Füßen, das Wissen, vollkommen nackt unter Dutzenden von Menschen zu stehen und nicht gesehen zu werden, erregte mich plötzlich. Die Erregung überfiel mich regelrecht. Sie ließ mein Herz schneller schlagen, beschleunigte meinen Atem und pumpte Blut in meine Lenden.
Und dann fiel alles, fielen die ganze Traurigkeit, die Angst und die Unsicherheit von mir ab. Ich war am Leben. Ich war unsichtbar.
Frei, ich war frei. Ich konnte all das machen, was ich schon immer machen wollte, ohne dabei erwischt zu werden. Konnte nur Schwanz sein, nur Geilheit, ohne dass mich jemand verurteilen würde.
Konnte mich wichsend auf den Alexanderplatz stellen, in den besten Hotelbetten schlafen, in die Zimmer anderer Leute gucken, mich in den besten Restaurants vollfressen, gratis ins Kino gehen, Frauen unter den Rock sehen.
Ich hing am Gängelband der Gene? Ich war wie mein Vater? Natürlich war ich das. Und es war okay. Ich hatte einen dicken Schwanz und immer Lust, ich war Voyeur und liebte es, nackte Frauen anzusehen, ich wollte mir immer und überall einen runterholen und konnte keine Beziehung führen.
Als Unsichtbarer, so wurde mir jetzt bewusst, konnte ich alles und musste ich nichts.
Unsichtbar.
Langsam bekam das Wort für mich einen neuen Geschmack im Mund.
Ich trat einen Schritt zurück. Meine Erektion wuchs weiter. Ich konnte nicht anders als meine Hand daranlegen und mit ein paar schnellen Bewegungen zu kontern. Es war unglaublich. Ich stand vor so vielen Menschen und holte mir einen runter. Ich ging wieder zur Sanitäterin.
Sie hatte inzwischen ihr Poloshirt unter der Weste aufgeknöpft. Deutlich war jetzt die Wölbung ihrer Brüste zu erkennen. Sie trug eine dünne Kette aus Silber um den Hals. Ich stellte mich vor sie, ganz nah. Die Gespräche der Feuerwehrleute neben ihr übertönten das leise Klatschen meiner Hand am Schwanz.
Plötzlich ging die Sanitäterin in die Knie und öffnete ihre Tasche, die zwischen ihren Beinen auf dem Boden stand. Ich konnte der Frau jetzt von oben in den Ausschnitt sehen. Ihr Kopf war mit meinem Schwanz auf gleicher Höhe. Fast hätte sie mir einen blasen können. Ich führte meinen Steifen ganz nah an ihren Kopf. Uns trennten nur noch ein paar Zentimeter. Sie bewegte ihren Kopf auf und ab, während sie in ihrer Tasche wühlte.
Ein paar Mal wichste ich lautlos vor ihr. Wirre Gedanken schossen mir in den Kopf. Ich wollte ihr meinen Schwanz ins Gesicht pressen, in den Mund, zwischen die Lippen. Doch was dann? Mit Sicherheit würde sie mir keinen blasen, so viel verstand ich. Sie wartete nicht darauf, den Schwanz eines Unsichtbaren zu lutschen.
Wieder starrte ich ihr in den Ausschnitt.
Auch die Titten anfassen ging nicht. Darauf wartete sie noch weniger. Mein Herz pochte aufgeregt.
Narrenfreiheit, ja, aber mit Bedacht.
Leise ging ich um sie herum. Ihre Pobacken spreizten sich in der Hocke, die enge weiße Hose spannte sich über den Halbmonden. Das Poloshirt war aus der Hose gerutscht und entblößte einen dünnen Streifen Haut.
Vorsichtig ging ich hinter ihr in die Knie. Ich konnte ihr Deo riechen, die Härchen auf dem dünnen Streifen Haut zwischen den Säumen. Ich beugte mich vor und ließ die unsichtbare Hand ganz vorsichtig von hinten zwischen ihre gespreizten Beine gleiten, ohne sie zu berühren. Von unten musste mein Mittelfinger jetzt Millimeter unter der Naht schweben, die sich über ihrer Scham spannte. Meine Nase berührte beinahe ihren Rücken. Ich starrte in den Spalt zwischen Hosenbund und Rücken und erkannte den schwarzen Gummibund ihres Slips.
Vorsichtig legte ich meinen Mittelfinger auf die Naht, berührte sie zwischen den Beinen. Hauchdünn war die Bewegung, doch sie elektrisierte mich, als hätte ich in einen Weidestromzaun gefasst.
Die erste Berührung einer anderen Frau seit Jahren.
Ich hätte am liebsten meinen Mund auf den Rücken der Sanitäterin gepresst, sie geküsst, sie umarmt, ihr meine Hände in die Titten gegraben und ihr von hinten meinen harten Schwanz, der irgendwo an meinen unsichtbaren Oberschenkeln zitterte, zwischen die Beine geschoben.
Langsam glitt meine Fingerkuppe von vorne nach hinten über die Naht. Die Sanitäterin zuckte zusammen, drehte erschrocken den Kopf und starrte mich an, nein, starrte durch mich hindurch.
Sie konnte mich nicht sehen, nur spüren.
Vor Aufregung wurde ich beinahe ohnmächtig. Ich stand vorsichtig mit wippendem Penis auf und ging wieder um sie herum nach vorne.
Nach einer langen Schrecksekunde drehte sie den Kopf wieder nach vorne und wühlte weiter in ihrer Tasche.
Mehr konnte ich nicht ertragen. Wieder griff ich zu, doch diesmal ohne Zurückhaltung, Mein Schwanz war warm und fest. Ich stellte mir vor, wie die Vorhaut die Eichel freilegte, wie sich die rotglänzende Spitze meines harten Schwanzes aus der Haut schälte, bereit, das Sperma rauszurotzen, das längst in meinen Hoden kochte.
Wieder ging ich ganz nah an die Sanitäterin heran, bis ich beim Wichsen beinahe ihre Stirn berührte, ihr gescheiteltes Haar.
Sieh hoch, dachte ich, damit ich deinen Mund sehen kann, deine Augen. Doch das brauchte ich gar nicht mehr.
Zu geil war die Tatsache, dass ich mir hier in aller Öffentlichkeit einen runterholte und niemand daran Anstoß nahm.
Vielleicht keuchte ich zu laut, vielleicht spürte sie die Bewegung. Sie sah auf einmal hoch, erstaunt, überrascht, erschrocken. Ihr Mund vor meinem Schwanz, reglos, eine Handbreit entfernt. Das runde Gesicht, die blassblauen Augen, die vollen Lippen. Und plötzlich kam ich. So schnell, dass ich gar nicht mehr reagieren konnte.
Der erste unsichtbare Spritzer musste sie genau auf den Mund getroffen haben. Sie zuckte zurück, schloss erschrocken die Augen, die Hand fuhr zu den Lippen. Rasch drehte ich mich zur Seite. Die nächste Ladung spritzte ich auf die heißen Gehwegplatten. Und noch eine. Mir lief unsichtbares Sperma über meine unsichtbare Hand.
Ich Idiot! Wie konnte ich so leichtsinnig sein? Was, wenn sie jetzt laut aufschrie, auf mich aufmerksam machte, in Panik geriet und meine Tarnung aufflog, weil jemand damit rechnete, dass sich hier ein Unsichtbarer herumtrieb? Vorsichtig, obwohl mir die Beine zitterten, ging ich ein paar Schritte zurück.
Die Sanitäterin sah überrascht und ein wenig angewidert nach oben, spuckte erneut aus, sah auf ihre Hand, wischte sich noch einmal über den Mund und sah wieder in die Luft. Dort oben kreisten ein paar Möwen.
»Was war das denn?«, fragte sie verwirrt. Ob sie den Geschmack wiedererkannt hatte, ungläubig. Die Männer von der Feuerwehr neben ihr unterbrachen das Gespräch. Die Sanitäterin stand auf, sah auf ihre Hand.
»Ist was?«, fragte einer der Männer.
»Hab ich was im Gesicht?«
»Ich sehe nichts.«
»Ich hatte das Gefühl, ein Vogel...«
Der zweite Mann beugte sich vor. »Außer zwei wunderschönen Augen kann ich nichts Ungewöhnliches erkennen.«
Er lachte. Sie zögerte, lachte dann auch. Leise entfernte ich mich. Erleichtert, noch immer erschrocken aber noch viel erregter. Ein Vogel. Sie hatte nichts gesehen, keinen Verdacht geäußert. Bevor eine hübsche Frau auf die Idee kam, ein Unsichtbarer hätte ihr sein Sperma ins Gesicht gespritzt, musste die Welt erst einmal von mir hören. Bis dahin waren kackende Vögel, unvorsichtige Biertrinker und überraschende Regenschauer zwar falsch aber viel naheliegender.
Langsam schrumpfte mein Schwanz, aber nicht vollständig. Eine andauernde Erregung blieb. Vorsichtig lief ich an der Absperrung entlang, bis die Menschen dahinter weniger wurden. Schließlich endete das Plastikband an einem hohen Metallzaun. Dahinter stand niemand. Ich bückte mich und glitt unter dem Plastikband hindurch. Dann war ich frei.
Berlin war jetzt mein Spielplatz.
Voyeur im Glück
1.
Ich war unsichtbar und Berlin jetzt mein Spielplatz. Nur bei welchem Spielgerät fing ich an? Erst einmal musste ich weg vom Institut. Weg aus dieser Gegend.
Das Institut lag am Ende einer exklusiven Wohnsiedlung. Deshalb hatten sich auch nur einige wenige Schaulustige eingefunden. Hinter einer zweiten Absperrung standen Männer mit Bierbäuchen, alte Frauen in hässlichen Kleidern, kleine Kinder und dann auch ein paar vom Wohlstand verwöhnte Teenager und Twens, mit knappen Tops und engen Hosen.
Ich überlegte, zurückzugehen und ein wenig an der Rettungssanitäterin zu fummeln, doch dann wurde mein Wunsch zu groß, so schnell wie möglich diese Gefahrenzone hinter mir zu lassen.
Die Hitze umschmeichelte mich wie ein warmes Tuch. Ich kam mir vor, als sei ich in der Sauna. Nackt und schamlos, mit dem kleinen Unterschied, dass ich mich auf offener Straße befand.
Winzige Steinchen bohrten sich in meine Fußsohlen, an manchen Stellen war der Asphalt so heiß, dass ich Angst hatte, mich zu verbrennen. Auf dem Weg zur S-Bahn kam ich an den ersten Wohnhäusern vorbei. Hohe Hecken vor großen Gärten, dahinter alte Villen und schicke Einfamilienhäuser mit teuren Autos auf der Auffahrt.
Ich hatte Durst. War neugierig. Und der Weg war mein Ziel.
Je länger ich unterwegs war, umso deutlicher wurde mir, dass ich mit diesem Schicksal den Hauptgewinn gezogen hatte. Niemand wusste, dass ich noch lebte. Meine Brieftasche auf dem Boden, meine Kleidung – all das waren deutliche Indizien, dass ich nicht mehr am Leben war, offiziell. Dabei war ich einfach nur unsichtbar und konnte alles machen, was ich wollte, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Ich konnte gratis im Zug fahren, in fremde Häuser sehen.
Mit jedem Schritt fielen mir neue Dinge ein.
Ich hatte alles verloren, meine Freundin, mein altes Leben, meinen Job, mein Aussehen. Ich war endlich frei.
Ich konnte ins Bundeskanzleramt, in die Zentralstellen der Macht, ich konnte in die Hotels eindringen und Prominente, Schauspieler, Musiker beobachten und sehen, wie die Stars aussahen, wenn sie die Tür hinter sich zumachten.
Was wirst du machen, wenn du weißt, dass du nicht mit der Konsequenz leben musst? Gilt der kategorische Imperativ?
Die Vielfalt der Möglichkeiten machte mich schwindelig. All die verschütteten Wünsche kamen in mir hoch. Doch was würde ich machen, wenn ich sie sah. Nur zusehen? Oder anfassen? Wie konnte ich anfassen, ohne entdeckt zu werden?
Ratlos blieb ich stehen. Es war Sommer, wir hatten bestimmt 33° Celsius – wenn von diesen Villen nicht mindestens jede zweite mit einem Pool ausgestattet war, würde ich meinen Namen in Chevy Chase ändern.
Ich betrat über die erste Auffahrt, die nicht mit einem Tor gesichert war, ein großzügiges Anwesen. Das Problem, vor das ich mich dann gestellt sah, war ein ganz banales: Auch als Unsichtbarer konnte ich nicht durch geschlossene Türen gehen. Und hinter das Haus, so stellte ich schnell fest, führte der Weg nur über einen spitzen Zaun.
Diese Mühe wollte ich mir nicht machen, also versuchte ich es beim nächsten Haus nebenan. Dort gelangte ich zwar hinter das Haus auf die Terrasse, doch niemand war zuhause und alle Türen waren verschlossen.
Es war nicht so einfach wie gedacht, anderer Leute Privatsphäre zu missachten.
Beim nächsten Haus öffnete mir der Zufall die Tür. In dem Moment, in dem ich über das niedrige Tor klettern wollte, fuhr ein Teenager mit dem Rad vor. Sie schloss das Tor zur Auffahrt mit einem Schlüssel auf, und ich schlüpfte hinter ihr ebenfalls auf das Grundstück, bevor das Tor krachend ins Schloss fiel.
Das Mädchen trug einen Rucksack und schien gerade von der Schule zu kommen. Sie war ein Teenager mit kurzen blonden Haaren, einem hübschen Gesicht mit frechen Augen, großen Brüsten und langen schlanken Beinen. Sie öffnete die Garage mit einem elektronischen Sender, der in seinem Rucksack steckte. Das Tor rollte sich auf, ich folgte ihr leise auf Zehenspitzen, obwohl sie beim Abstellen des Rades Lärm wie ein rostender Ritter bei einem Tjost machte.
Beide Stellplätze waren leer. Durch eine Tür am Ende der Garage betrat er das Haus.
Diesmal wurde es knapp für mich, und fast hätte mich die schließende Tür erwischt.
Meine Füße hinterließen kleine feuchte Spuren in Form eines Fußes auf den spiegelblanken, kalten Fliesen in einer Eingangshalle, die größer war als meine letzte Wohnung.
Unsere letzte Wohnung, sollte ich besser sagen, nein, Quatsch, dachte ich. Katrins Wohnung, sie hatte sie schließlich bezahlt.
Die Spuren verschwanden wie Eis in der Sonne. Das Mädchen hatte aber ohnehin dafür keinen Blick.
»Mama? Tim?«
Sie legte ihren Rucksack in eine Ecke und betrat die Küche, die so weiß war, dass sie gut in einem Film über himmlische Köche eine Rolle hätte spielen können. Sie trug ein hellblaues T-Shirt, das den Bauchnabel frei ließ. Darunter zeichnete sich deutlich ein BH ab. Die weiße Hose war eng und betonte den festen und sehr runden Po. Mein Schwanz richtete sich sofort auf. Sie war wunderschön. Eine Stupsnase in einem ovalen Gesicht, ein paar vorwitzige Sommersprossen. Die Haut seidenweich und makellos. Die Wölbung ihrer Brüste war atemberaubend, die ihres Pos umwerfend. Mit einer schnellen Handbewegung machte ich meine Eichel frei. Die Erregung ließ mich erschauern.
Niemand antwortete.
Das Mädchen machte auf der Stelle kehrt und nahm von der Eingangshalle eine breite Treppe in den ersten Stock. Leichtfüßig sprintete sie hinauf, so schnell, dass ich beinahe nicht hinterherkam. Der enge Stoff ihrer weißen Hose betonte ihre köstlichen Pobacken. Ich folgte ihr langsam in einen hellen Flur, von dem mehrere Türen abgingen.
Sie nahm die erste Tür, donnerte in ihr Zimmer. Verärgerung ließ die Tür weit in den Raum aufschwingen und gegen die Wand stoßen. Glück für mich. Ich huschte hinter ihr ins Zimmer. An den Wänden hingen Poster von Avril Lavigne, von Green Day und Anastacia. Ohne die Namen unter den großformatigen Bildern hätte ich das allerdings nie herausgefunden.
Wie alt musste man sein, um das zu hören? 16? Jünger? Älter?
Ein Plakat mit der berühmten ‚I have a dream-Rede’ von Martin Luther King klebte neben einer Landkarte der Welt. Ein selbstgebautes Hochbett, darunter ein Schreibtisch, daneben eine Couch. Überall lagen Klamotten auf dem Boden. Ein großes Fenster gab den Blick frei zum Garten. Eine Tür führte zu einem Balkon. Anna nahm die Tür und knallte sie ins Schloss.
An einer Seite des großen Zimmers hing ein großer Spiegel an der Wand. Während das Mädchen eine CD einlegte, stellte ich mich vor den Spiegel. Wieder staunte ich darüber, wie vollständig ich verschwunden war. Nicht ein Schemen war von mir zu entdecken. Und zum ersten Mal fragte ich mich auch, wie ich mit durchsichtiger Netzhaut überhaupt sehen konnte.
Sie hörte irgendeinen Popstar, den ich mal gehört hatte, aber niemals beim Namen nennen konnte. Sie kam auf mich zu, ich wich zurück, stellte sich vor den Spiegel und betrachtete sich. Ein paar Male drehte sie sich vor dem Spiegel hin und her, legte die Hände an den Kopf, posierte für eine unsichtbare Kamera, machte einen Schmollmund, zerzauste sich das kurze, blonde Haar, rümpfte die freche Nase und zog sich ganz ohne Vorwarnung das T-Shirt über den Kopf.
Mir blieb die Luft weg. Mein Schwanz wippte aufgeregt. Der BH war eng und drückte ihre Brüste weit nach oben. Sie betrachtete sich im Spiegel, griff nach hinten und knöpfte den BH auf. Die Titten fielen saftig und fest heraus. Die hielten keinen Bleistift. Von solch perfekten Brüsten hatte ich bisher nur geträumt. Vorsichtig ging ich einen Schritt näher, um diese Pracht näher zu betrachten.
Das Mädchen legte ihre Hände unter die Titten, wog sie, drückte sie zusammen. Die Nippel waren groß, wiesen nach oben und hoben sich leicht erregt von den hellen Warzenhöfen ab. Der Sänger übertönte locker mein Keuchen, das die hemmungslose Manipulation an meinem Schwanz begleitete. Ihre flachen Hände glitten am Bauch entlang zum Bund ihrer Hose. Schlanke Finger öffneten den Knopf, zogen den Reißverschluss herunter. Ein blauweiß gestreifter Slip kam zum Vorschein. Sie schob die Hose herunter und stieg heraus. Das Paar Beine war glatt und wundervoll geformte. Ich hätte bereits jetzt abspritzen können. Das Mädchen schien es nicht so eilig zu haben, ins Wasser zu kommen. Stattdessen ging sie zur Balkontür, öffnete sie und ließ heiße Luft herein. Wie kühl es im Zimmer gewesen war, stellte ich erst jetzt fest, als mir die Hitze entgegenschlug.
Sie stellte sich wieder vor den Spiegel, hängte die Daumen in den Slip und sah sich an. Am liebsten hätte ich sie angefasst, ihre festen Brüste, den prallen Po. Doch das Risiko konnte ich nicht eingehen. Sie würde schreien, um Hilfe rufen, und dann wäre das Drama da. Doch auch so fand ich es erregender, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen hatte vorstellen können.
Und dann, endlich, streifte sie ihr Höschen herunter. Über den dunklen Busch ihres Schamhaares, die beiden prallen Hälften ihres Pos, die festen Oberschenkel und die schmalen Füße. Der Slip fiel zu Boden, sie stieg heraus, schleuderte ihn mit einer schnellen Fußbewegung in eine Zimmerecke, in der schon weitere Kleidungsstücke lagen, und stellte sich mit leicht geöffneten Beinen splitterfasernackt vor den Spiegel.
Die Arme hinter dem Kopf verschränkt, die Finger in das blonde Haar vergraben, drehte sie sich vor dem Spiegel, betrachtete ihren nackten Körper. Dann glitten ihre Hände von oben über ihre Titten und den Bauch zwischen ihre Schenkel. Sie legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen.
Ein heißer Windhauch wehte durch die offene Balkontür ins Zimmer. Der Popstar krähte ins Mikro. Meine Hand klatschte auf meinen Bauch. Das Mädchen seufzte. Ich konnte mich an ihr nicht satt sehen. Diese runden Schenkel, diese vollen Brüste, das hübsche Gesicht, die prallen Pobacken, das dunkle Schamhaar.
Plötzlich schien sie aus ihrem kurzen Traum zu erwachen, ging auf Zehenspitzen zur Tür, drehte vorsichtig den Schlüssel im Schloss und hastete mit hüpfenden Brüsten zu ihrem Schreibtisch. Dort lag eine Ausgabe eines Teenagermagazins. Auf dem Titelblatt prangte ein Foto eines Sängers. Sie nahm das Heft, küsste das Bild und setzte sich mit dem Magazin auf das Sofa.
„Du bist einfach zu geil“, seufzte sie, spreizte ihre Beine und vergrub augenblicklich eine Hand in ihrem Schoß. Der Kopf fiel nach hinten auf die hohe Lehne, die Hand mit dem Magazin folgte ihrem Blick, der jetzt zur Decke gerichtet war.
Ein Finger massierte ihren Kitzler, rieb ihn durch das dunkle Gestrüpp ihres Schamhaares. Dann zog sie die Beine an, setzte die schmalen Füße auf die Sitzfläche des Sofas und machte den Blick frei.
Ich hätte in der Zwischenzeit bestimmt dreimal kommen können, so geil war die Situation. Immer hektischer wichste ich mich bis kurz vor den Höhepunkt, bis ich beinahe abspritzte, und verschnaufte dann einige Sekunden. Das Mädchen rieb jetzt nicht nur ihre feuchte Spalte, sie steckte sich auch einen Finger zwischen die prallen Schamlippen. Seufzen wurde zum Stöhnen.
Das Klatschen ihrer nassen Finger war jetzt deutlich auch über die Musik zu hören. Ich ging auf die Knie, brachte mein Gesicht ganz nach an ihre Möse. Ich sah jedes Haar, jede Falte, das Glitzern der Feuchtigkeit, den hektisch ein- und ausfahrenden Finger, die Wölbungen ihrer Pobacken auf dem roten Sofa. Wie schön wäre es, sie zu lecken, ihr meine Finger ins Loch zu schieben, meinen Schwanz.
„Ach“, jammerte sie, wichste ihre Möse schneller und schneller, krümmte sich auf dem Sofa. Wir kamen beide gleichzeitig.
Sie zappelte und zuckte, und presste ihren süßen Hintern in die Couch. Ich wichste ein letztes Mal und spritzte dann quer über das Parkett. Zwei, drei dicke Spritzer, die ich leider nicht sehen konnte, schlugen auf das Holz wie Wasserbomben. Mir wurde schwarz vor Augen.
Das Mädchen sackte auf der Couch zusammen. Ihre Beine rutschen von der Sitzfläche, bis ihre Füße den Boden berührten. Ich rutschte mit letzter Kraft von dem nackten Mädchen nach hinten und streckte mich auf dem Boden aus. Mein erster Tag als Unsichtbarer fing gut an.
2.
Es war, als hätte ich nur an den falschen Türen gerüttelt. Kaum war ich zur Gartenseite hin aus dem Haus geschlichen und über den Zaun auf das angrenzende Wassergrundstück geklettert, der mir beinahe meine unsichtbaren Weichteile abgerissen hätte, wurde ich auf das Angenehmste überrascht.
Der Bau schien recht neu. Ein Architektenhaus mit viel Glas, geraden Linien, weißer Fassade. Ich erwartete eine alte Frau beim Kaffeetrinken oder einen Opa beim Blättern in einer ADAC-Motorwelt, doch kaum war ich um eine hohe Hecke gebogen, die nach links und rechts die Blicke abschirmte, empfing mich nackte Haut.
Sie lag in einem Liegestuhl, dessen Sitzfläche an den Knien endete. Die Füße berührten den mit hellen Platten belegten Boden. Die Frau war viel zu blond, aber sie hatte ein paar verdammt hübsche, perfekt geformte Titten, die von dunklen Warzen gekrönt waren. Ihre leicht geöffneten Beine bargen ein ausrasiertes Delta. und ich spürte die Geilheit zurückkehren.
Nackte Haut ganz ohne Monitor. Nicht als JPG verpixelt, keine Glasscheibe zwischen uns. Haut, Nähe, Wahnsinn. Komplett nackt schien sie sich ihrer Sache sehr sicher zu sein. Kein Nachbar konnte von hier auf das Grundstück blicken.
Mein Mund wurde trocken.
Penetration. Nichts wäre geiler als das.
Meine Hand fand auch in der Unsichtbarkeit ihr Ziel und machte mit zwei wenigen kurzen Bewegungen aus schlaffem Fleisch eine harte Stange.
Auf einem Tischchen neben ihrem Stuhl lagen eine Frauenzeitschrift und ein Handy, dazwischen glitzerten halbgeschmolzenen Eiswürfel in einem hohen Glas, in dem ein Strohhalm knickte.
Sie trug eine Sonnenbrille und las in einem Taschenbuch, vermutlich ein Thriller. Ich hoffte für sie, dass sie genug Sonnencreme aufgetragen hatte. Und sollte sie das noch nicht getan haben, so würde ich ihr gerne dabei zusehen. Dabei und bei all den anderen Dingen, die eine solche Traumfrau mit Modelmaßen noch so tun konnte.
Wie eindimensional ich doch dachte.
Allerdings, so musste ich zu meiner Enttäuschung feststellen, fand auch der einzige sichtbare Mann kein Interesse an ihr, der auf der anderen Seite der Terrasse unter einem riesigen Sonnenschirm saß.
Der Mann, Ende 30, mit nacktem, sehr durchtrainiertem und mit einer Tätowierung geschmücktem Oberkörper, tippte auf seinem Laptop herum, blaffte immer wieder aufgeregt in sein Handy, das er zwischen Kopf und Schulter geklemmt hatte, und hielt in der freien Hand eine Zigarette, an der er ab und zu hektisch sog. Der Aschenbecher quoll über.
Zu gerne hätte ich jetzt die beiden beim Ficken beobachtet und an der einen oder anderen Stelle ganz unbemerkt zugegriffen.
Unsichtbar.
Mein Gott, hoffentlich blieb das noch eine Weile so. Und hoffentlich traten nicht noch Nebenwirkungen aus. Immerhin war ich doch verstrahlt.
Die junge Frau ließ das Buch sinken, schob die Sonnenbrille in die Stirn und betrachtete ihren Freund. Ein spöttisches Grinsen löste sich von ihren Lippen.
Der Mann sprach offensichtlich mit einem Geschäftspartner, der einen Termin mit Geldgebern vereinbaren sollte und es nicht geschafft hatte. Aus Verärgerung wurde Wut wurde laut wurde erregtes Aufspringen.
»Dann mach es auch«, bellte er noch in das Handy, bevor er sich zum kleinen Tisch vorbeugte, die Zigarette in den Aschenbecher presste und das Hand in der geballten Faust schwang, als wolle er es in den Oleander werfen.
»Alles klar, Ben?«
Der Mann drehte sich zu ihr um und sah sie abwesend an.
»Weiß ich noch nicht.«
»Kann ich was für dich tun?«
»Hast du 5 Millionen übrig? Nein? Dann nicht.«
Die Frau machte einen Schmollmund und schloss die Augen. Der Mann rieb sich mit der Hand über sein Kinn. Ich hörte, wie der Dreitagebart an seiner Haut kratzte.
Fick sie doch, dachte ich, ist gut gegen Stress. Doch ich wusste, dass Stress auch der größte Sexkiller sein konnte. Wenn er es wie ich sah, würde er sich eher in der Sauna einen runterholen.
Er nahm das Handy in die Hand, pendelte unruhig zwischen seinem Stuhl und der Terrassentür hin und her, und schien zu überlegen.
Der Frau hingegen sank der Kopf zur Seite.
Eine Minute später war sie ganz offensichtlich eingeschlafen. Ich wusste es, weil ich in dieser Minute so nah an den Liegestuhl herangetreten war, dass ich die Poren der Haut auf ihren prächtigen Titten sehen konnte.
Ich näherte mich der Frau so weit, wie ich keiner Frau mehr gekommen war, seit ich die Fremde in der U-Bahn geküsst hatte. Ich sah nackte Haut aus einer Nähe, die mir seit dem letzten Sex mit Katrin nicht mehr vergönnt gewesen war.
Die Gier wuchs.
Mit der freien Hand wichste ich leise, dabei nahm ich den Anblick der rosa Nippel auf, des Bauchnabels und der runden Schenkel, ließ meine Hand über der gebräunten Haut schweben und meine Zungenspitze nur wenige Zentimeter über der rasierten Scham zwischen den leicht geöffneten Schenkeln tanzen.
Konnte ich es riskieren?
Mein Fluchtweg war frei, niemand hielt sich in der Nähe auf und der Mann war noch nicht zurückgekehrt.
Nur einmal den Kontakt herstellen, nach so vielen Jahren zum ersten Mal wieder fremde Haut anfassen.
Mein Körper brannte, und das lag nicht an der Sonne.
Die Blonde schmatzte schläfrig, ihre Augen waren noch immer geschlossen, also riskierte ich es.
Vorsichtig kniete ich mich an das Fußende des Stuhls, beugte mich vor und presste meine Lippen auf die leicht geöffnete Möse.
Mit der linken Hand griff ich nach vorne an ihre rechte Brust.
Kontakt.
Ich hätte in dieser Sekunde abspritzen können, so geil war ich. All die Jahre hatte ich darauf verzichten müssen, all die Jahre hatte ich mich danach gesehnt, nackte Haut zu berühren, die nicht Katrin gehörte. All die Jahre hatte ich es vermisst, einfach nur meinen Trieb zu stillen, ganz ohne Verpflichtungen, ohne Kompromisse, ohne den Gedanken an Beziehungsstress, Abwasch und nicht geschlossene Zahnpastatuben.
Ich schob meine Zunge zwischen die wulstigen Schamlippen. Eine salzige Perle zerplatzte auf meiner Zungenspitze. Die Berührung meines Mundes mit der Möse war satt und voll und ohne Kompromiss.
In meiner Handfläche spürte ich die Brustwarze hart werden. Ich knetete das feste Fleisch. Die samtweiche Haut schmiegte sich an meine Handfläche.
Endlich. Endlich
Ich hatte erwartet, sie würde aufschreien, erschrocken und panisch, würde von der Liege springen und sich mit angewidertem Blick schütteln, als sei ihr eine Spinne über den Bauch gekrabbelt, doch sie tat genau das Gegenteil.
»Ben, du Sau«, stöhnte sie. Ich schielte nach vorne, über ihren Bauchnabel und zwischen den Hügeln ihrer Titten hindurch, den Mund noch immer auf ihre Möse gepresst.
Ihre Hände krallten sich in die Armlehnen, die Augen blieben geschlossen. »Endlich machst du mal was Vernünftiges mit deinem Mund, nicht immer nur schreien und schimpfen.«
Unvermittelt zog sie die Beine an, setzte die Füße auf die Stuhlkante, drückte die Knie mit beiden Händen weit auseinander, so dass sich ihr Geschlecht wie eine Blume öffnete. Ich nahm den Mund von ihrer Möse und steckte einen Finger, nein, gleich zwei hinein.
Der Anblick war faszinierend.
Ihre Möse dehnte sich im wahrsten Sinne wie von Geisterhand, als hätte ich ihr einen durchsichtigen Dildo eingeführt. Die Sonne schien sogar hinein und riss rosa Lustfleisch aus dem Dunkel, das sonst diese intime Stelle dominierte.
Wieder presste ich meine Lippen auf den Kitzler, leckte die Falte, nahm den salzigen Mösensaft von meinen hinein und heraus orgelnden Fingern auf, brummte wie ein geiler Bär und hoffte, dass mein Brummen meine Sprachlosigkeit für ein paar Sekunden länger vertuschen konnte.
»Du machst das gut«, seufzte sie und griff mit beiden Händen an ihre Brüste, auf denen die aufgerichteten Nippel thronten. Ihre Daumen rieben die rosa Warzen, und ihr Mund entließ ein langgestrecktes Seufzen, als ich meine Zungenspitze über die glitzernde Falte ihres Kitzlers tanzen ließ, die Augen immer auf die Frau gerichtet.
Als ich meine Finger aus ihr zog, war die totale Unsichtbarkeit einer Halbtransparenz gewichen. Mösensaft machte meine Finger sichtbar.
Mein Herz schlug rascher. Sollte jetzt jemand außer uns beiden kommen, gäbe es einen Skandal.
Ich wichste sie schneller, bis das erste feuchte Schmatzen hörbar wurde. Mit der freien Hand drückte ich ihren linken Schenkel noch weiter zurück, so dass sich unter der mit meinen unsichtbaren Fingern gefüllten Muschi die Pobacken öffneten und einen geilen Blick auf ihren Hintereingang erlaubten.
»Ich komm gleich«, seufzte sie, und ich wusste, ahnte, sie würde zuvor noch Blickkontakt aufnehmen. Frauen sind doch so, oder nicht?
In diesem Moment ertönten Schritte im Haus. Die Frau öffnete die Augen. Ich zog meine Hand zurück und ließ ihr Bein los. Meine transparent gewordenen Finger wurden in der Sonne rasch wieder unsichtbar.
Ich stand nach hinten auf und ging ein paar Schritte zurück. Meine Erektion pulsierte machtvoll und ich wusste, auch wenn ich sie nicht sah, wie groß sie sich vor Erwartung aufbäumte.
Mit unsichtbarer Hand griff ich zu und erfreute mich am Anblick der nackten Frau im Liegestuhl. Noch immer hatte sie ihre Beine angezogen, die Möse weit geöffnet, an den Titten ihre Hände.
»Ben?«
Durch die Terrassentür trat Ben, in der Hand eine Flasche Bier. Er stutzte.
»Was machst du denn da?«
Irritiert blinzelte die Frau in meine Richtung, und für einen Moment hatte ich wieder diese Angst davor, plötzlich sichtbar zu sein, doch als ich an mir herunterblickte, erkannte ich wieder nur die Steinplatten der Terrasse.
»Hast du mich eben gerade nicht…«
Der Mann setzte sich in seinen Liegestuhl. Dass seine Freundin oder Frau hier nackt mit gespreizten Beinen und zum Sex bereit in einem Liegestuhl lag, schien ihn nicht zu beeindrucken.
Ich hingegen konnte mich kaum sattsehen.
»Ich habe jetzt keine Zeit für sowas…«
Sie nahm die Füße von der Stuhlkante und ließ ihre Titten los.
Ohne sie noch eines Blickes zu würdigen, hob er sein Handy ans Ohr und begann ein neues Telefonat. Termine, sagte er, dringend, komm, jetzt gleich? Sagte warte, kann nicht, Tine, egal, bist du sicher, okay, ich fahr los.
Gerade hatte ich mich wieder an die verwirrt und zugleich verärgert dreinblickende Frau, die vermutlich Tine hieß, angeschlichen, stand der Mann auf.
Sein Bier, von dem er kaum einen Schluck getrunken hatte, ließ er auf dem Tisch stehen.
»Ich muss los, Tine, bestell dir was zu essen, ich weiß nicht, ob ich es heute Abend noch schaffe, eher nicht, ich muss nach Frankfurt. Diese Wichser…«
Er drückte ihr einen Kuss auf den Mund und verschwand im Haus.
Tine verschränkte die Arme vor der Brust und schmollte.
Sekunden später griff sie zum Handy.
»Stör ich?«, sagte sie, ohne ihren Namen zu sagen. Ganz sicher ihr Lover, ein feuriger Latino mit langen Haaren und heißem Hüftschwung. »Ich weiß, ich hab gesagt, ich könnte nicht, aber Ben musste kurzfristig… Ja, wieder mal… Kommst du?«
Jetzt wird es spannend, dachte ich.
3.
Es klingelte. Tine hatte sich den Bikini, der über dem Sonnenstuhl hing, in einer Geschwindigkeit angezogen, die mir keine Chance zum Höhepunkt gelassen hatte. Aber vielleicht war das auch nicht nötig, so hoffte ich, als ich mich in der Küche umsah, die Teil des großen Wohn-Ess-Bereichs war.
Bereich war untertrieben. Palast. Landschaft.
Schränke mit schwarzen Fronten um eine Kücheninsel, die größer als das Badezimmer in manchen Sozialwohnungen war. Chromblitzende Abzugshaube über Induktionskochfeldern.
Es herrschte eine angenehme Kühle im Haus, und mir wurde erst in diesem Moment wieder bewusst, wie heiß es draußen war.
Tine ging mit unter dem knappen Bikini wippenden Brüsten an den Kühlschrank und holte eine Flasche Prosecco heraus. Ich konnte gerade noch erkennen, dass es bei weitem nicht die einzige war und zudem je eine angebrochene Weißwein-und Roséflasche in der Tür standen.
Aus einem Oberschrank nahm Tine zwei Gläser. Knallend flog der Korken quer durch die Küche. Die Flasche knallte singend auf die Arbeitsplatte aus schwarzem Marmor.
Die Türklingel schellte. Tine verschwand.
Wie lange hatte ich nichts mehr gegessen? Mein Magen knurrte. Ich griff nach der Flasche und setzte sie an meine Lippen.
Der kalte Schaumwein sprudelte in meinen Hals. Als ich an mir heruntersah, entstand mitten in der Luft, dort, wo sich mein Magen befinden musste, ein ovaler Tropfen aus gelber, schäumender Flüssigkeit.
Ich stellte die Flasche zurück auf die Arbeitsfläche.
Schock.
Ich war plötzlich sichtbar, auch wenn es nur ein kleiner Teil von mir war. Wenn das jemand sah, war ich aufgeschmissen. Doch nur Sekunden später verschwand der Prosecco, als hätte mein Körper die Eigenschaft, alles, das ich ihm einverleibte, ebenfalls unsichtbar zu machen.
Die Tür knallte. Stimmen. Lachender Besuch. Das war keine Männerstimme.
Ich nahm rasch noch einen zweiten Schluck, der ebenfalls schnell unsichtbar wurde, spürte bereits einen leichten Schwindel, und stellte die Flasche zurück auf den feuchten Ring auf der Arbeitsplatte.
Die Stimmen wurden lauter, Tina und ihr Gast traten durch eine doppelflügelige Tür in das Wohnzimmer.
Kein Lover, dachte ich enttäuscht, nur eine Freundin.
Tinas Gast wirkte optisch beinahe wie ein Double, nur dass ihre Haare schwarz waren. Auch sie war sehr hübsch und, wie ich ahnte, unter einem dünnen Sommerkleid sehr üppig gebaut.
Meine Fantasie schlug wieder Purzelbäume.
Ich beschloss, die beiden erst einmal alleine zu lassen und mich im Haus nach Essbarem umzusehen.
»Geh schon mal raus«, sagte Tine und machte einen kleinen Umweg über die Küche, schnappte sich die Flasche Prosecco und die Gläser, und folgte ihrer Freundin dann auf die Terrasse.
Ich wartete, bis die Stimmen gedämpft klangen, bis Gläser klirrten, und öffnete den Kühlschrank. Ich fand das ganze Sortiment eines Feinkostladens vor, von Edelschimmelkäse bis zu hauchdünn geschnittener Salami, Oliven und frische Butter.
Ich schnappte mir von allem etwas und holte es aus dem Kühlschrank.
Die fliegenden Lebensmittel brachten mich zum Staunen, auch die Fettflecke auf den Fingern, die wie flimmernde Luft wirkten.
Aufregung explodierte in meinem Magen, als ich nicht wusste, wo ich meine Beute zwischenlagern sollte, um mich nach Brot umsehen zu können. Ich wählte die blitzblank polierte Spüle aus Edelstahl. Schublade um Schublade öffnete ich, bevor ich endlich ein paar Scheiben vorgeschnittenes Brot fand.
Ich legte es in einen Brotkorb, warf die Feinkost hinzu, und noch bevor ich mich aus der Küche stahl, brandete Lachen von der Terrasse herüber.
Ich öffnete das stromverschlingende Kühlmonster ein weiteres Mal, nahm die angebrochene Roséflasche heraus und verzog mich in die obere Etage des Hauses.
Auf einem noch von der vergangenen Nacht zerwühlten Doppelbett sitzend, in dem vielleicht der Workoholic seine blondierte Modelfreundin seit Tagen vor Stress nicht angerührt hatte, stopfte ich mir gierig die mitgebrachten Lebensmittel in den Bauch.
Beim ersten Anblick der zerkauten Masse, die sich in der Luft sammelte, wurde mir ein wenig flau im Magen, und ich zwang mich, woanders hinzusehen. Ich konnte ja nicht einmal die Augen schließen, da meine Lider ebenfalls unsichtbar, also durchsichtig waren.
Ich zog den Korken aus der Flasche und stillte meine Lust auf Alkohol, die längst den Kater vertrieben hatte, der noch am Morgen mein Lebensretter gewesen war. Ohne ihn hätte ich schließlich nie die Toilette aufgesucht und wäre wie die Wissenschaftler verbrannt.
Der Alkohol auf nüchternen Magen zeigte Wirkung. Bald war ich heftig beschwipst, aber leicht, luftig, wie nur ein Rausch mit kühlem Rosé sein kann.
Ich aß die letzte Scheibe Brot, ließ mir Schinken und Käse auf der Zunge zergehen und durchsuchte das Schlafzimmer. Neben einem überdimensionierten Flachbildfernseher stand eine Videokamera. Ich schaltete sie an, spielte den letzten Clip ab und war rasch gelangweilt von einem nichtssagenden Urlaubsfilm an irgendeinem weißen Strand.
Als die Flasche geleert und die Köstlichkeiten aufgegessen waren, suchte ich das Badezimmer auf, das mit Regendusche, Whirlpool und Doppelwaschbecken wie der Rest des Hauses beneidenswert überdimensioniert war. Schwankend schlug ich mein unsichtbares Wasser in das Luxusklo ab und hüpfte leichtfüßig die Treppe hinab.
Ich stellte die leere Flasche in den Kühlschrank.
Im Wohnzimmer war es deutlich wärmer als oben, was an der weit geöffneten Terrassentür lag. Draußen jedoch schlug mir die Hitze wie die heiße Luft aus einem Backofen entgegen. Nackt wie ich war stellte ich mich in die Tür und sondierte die Lage.
Die beiden Frauen saßen noch immer auf der Terrasse, inzwischen hatten sie sich allerdings unter den Sonnenschirm verkrochen.
Sie kicherten und lachten. Auf dem Tisch stand eine leere Proseccoflaschen, eine zweite war fast zur Hälfte geleert. Gerade goss Tine ihrer Freundin, die mit schwerer Zunge vergeblich ablehnte, noch ein Glas ein
»Oh Gott, hör auf, ich bin schon total betrunken. Ich muss noch fahren.«
»Quatsch, Laura, du kannst dir doch ein Taxi nehmen. Oder hier übernachten.«
»Und Ben? Der hasst es doch, wenn ich hier übernachte.«
»Der kommt heute ganz sicher nicht zurück. Prost.«
Sie stießen an. Kicherten. Tranken. Tine trug noch immer ihren knappen Bikini, Laura ihr Sommerkleid mit dünnen Trägern. Ich trat ganz nah an sie heran, so dass ich ihr Parfum riechen konnte, das tapfer gegen die Hitze ankämpfte.
Laura wirkte weitaus natürlicher, selbst wenn ihre Haare ebenfalls nicht mehr die ursprüngliche Farbe hatten. Mit ihrem feinen, glatten Gesicht hätte sie gut auf einen Laufsteg gepasst. Wie Tine schätzte ich sie auf etwa Ende zwanzig.
Unter ihrem einfarbigen Kleid schien sie weder Top noch BH zu tragen, denn ihre Brustwarzen bohrten sich deutlich durch den Stoff. Im Schritt jedoch, wo sich das Kleid eng an ihre runden Hüften schmiegte und das Venusdelta andeutete, hoben sich die Nähte eines knappen Slips hervor.
Ich ging leise um die beiden angetrunkenen, kichernden, schwatzenden Frauen herum, immer darauf bedacht, dass meine nackten Füße nicht laut auf die Steine klatschten. Zum Glück hinterließ ich auch keine Schweißflecken auf den Steinen.
Was jetzt? Warten, bis ihre Freundin ging, bis sich beide zum Sonnen noch einmal auszogen, oder doch weiter, zum nächsten Haus? Was fing ich an mit meiner Unsichtbarkeit? Was sollte ich tun?
»Ben arbeitet viel zu viel. Im Bett läuft gar nichts mehr. Ich bin so ausgehungert, ich habe mir vorhin im Halbschlaf beim Sonnen schon vorgestellt, er würde mich lecken. Es war so realistisch.«
Laura nippte Prosecco.
»Warum suchst du dir nicht einen Freund?«
»Ich liebe ihn ja, ich will ihn nicht mit einem anderen Mann betrügen.«
»Du sollst ihn ja auch nicht mit einem Mann betrügen.«
»Soll ich eine platonische Freundschaft mit meinem Friseur schließen?«
Die Brünette schüttelte den Kopf. »Die Betonung lag nicht auf betrügen, sondern auf Mann.«
Oha. Schweigen. Laura nahm einen hastigen Schluck aus ihrem Glas, als wollte sie herunterspülen, was sie gerade gesagt hatte.
»Entschuldigung«, murmelte sie.
Die beiden Frauen starrten sekundenlang vor sich hin. Tine stellte ihr Sektglas ab.
»Wie kommst du darauf, ich könnte auf Frauen stehen?«
Laura räusperte sich. »Ich glaube, das war wohl eher Wunschdenken.«
Irgendwo im Garten zeterte eine Elster. Über den nahen See dröhnte ein Bootsmotor. Mir lief der Schweiß den Körper hinab.
Tine nahm einen großen Schluck Prosecco. Laura knipste nervös mit den Fingernägeln. Wer stand als erste auf? Würde Tine ihre Freundin empört zur Rede stellen, rauswerfen, nie wieder anrufen? Die eigene Freundin anbaggern, das taten Mädchen doch nur als Teenager, wenn sie noch nicht wussten, auf welche Seite sie gehörten.
Aber kannte ich die beiden? Wusste ich, wie lange sie schon Freundinnen waren, was sie voneinander wussten? Nicht jeder war so oberflächlich wie du.
Tine blieb verdammt ruhig. Ich sah genauer hin. Auf ihrem Sektglas bildeten sich kleine konzentrische Kreise. Ihre Hand zitterte. Ich ging noch näher an Tine heran. Tatsächlich. Ihre Nippel bohrten sich deutlich durch den Bikini.
Tines Stimme war hart, härter als erwartet.
»Also, ich glaube, du musst dich mal abkühlen. Du hast wohl einen Sonnenstich. Oder ist das der Prosecco?«
Laura stand auf. Der Stuhl schabte laut über die Steine. »Entschuldigung. Ich glaube, ich geh besser.«
Sie beugte sich vor, hob schwankend ihre Sandalen vom Boden auf und nahm das Handy vom Tisch.
Tine erhob sich ebenfalls unsicher aus ihrem Stuhl, während Laura bereits auf halbem Weg nach drinnen war.
»Na los«, sagte Tine. »Ich hol dir ein Handtuch. Du kennst dich ja hier aus.«
An der Terrassentür blieb Laura stehen, die Miene versteinert.
»Du willst nicht, dass ich gehe?«
Tine schluckte, und jetzt konnte zumindest ich erkennen, wie nervös sie war. »Doch, und zwar in die Dusche.«
Noch immer schien Laura nicht zu verstehen oder nicht verstehen zu wollen. »Hier? In eure Dusche?«
»Mein Gott, bist du heute schwer von Begriff. Geh schon mal vor, ich bring dir ein Handtuch.«
Laura blieb noch eine Sekunde regungslos an der Tür stehen. Tine scheuchte sie mit den Händen ins Haus, kicherte plötzlich. »Los, los.«
Was tat sie da? Welch seltsame Reaktion auf ein so eindeutiges Angebot. War sie von diesen Avancen so überrascht, dass sie nicht wusste, ob sie darauf wütend oder erfreut reagieren sollte? Wollte sie sich Zeit kaufen? Geh duschen.
»Du bist mir eine Nudel«, kicherte Laura. Ich ging vor und sie folgte mir.
Ich wusste ja, wo das Bad war.
4.
Auf dem Weg nach oben blieb Laura stehen, sah sich um, irritiert. Ich bewunderte den Hintern unter dem Sommerkleid.
Tine kam nicht nach. Ich hörte eine Tür knallen, vermutlich die Terrassentür, das Klingeln von Gläsern. Laura nahm die letzten Stufen und ging durch den Flur ins Bad. Ich ließ sie vorbei, musste langsam gehen, weil meine Füße zu laut auf das Parkett klatschten.
Bevor Laura die Tür zum Bad schließen konnte, schlüpfte ich hinter ihr hinein, doch Laura hatte gar nicht die Absicht. Die Tür schwang auf und blieb so. Laura streifte die Träger von den Schultern und bewies meine Vermutung, dass sie keinen BH trug.
Perfekt, dachte ich, einfach perfekt. Groß, schwer, rund und mit dunklen Höfen. Und auch die Hüften unter einer schmalen Taille passten ins Bild. Ihr Schamhaar war bis auf einen schmalen Streifen abrasiert.
Das Kleid fiel dort, wo sie stand, auf die schwarzen Fliesen. Ihr Po ein Gedicht, die Beine gerade. Die Hand an der Tür zur Duschkabine, nein: zum Duschpalast. Über ihr eine Regendusche. Hinter ihr die Glastür.
Beide Augen auf ihrem Hintern. Wasser rauschte. Tropfen behinderten die Sicht. Die Scheibe beschlug. Ich war dennoch im siebten Himmel.
Zitternd vor Erregung und Geilheit beobachtete ich Laura hinter der Scheibe, ergötzte mich an dem, was ich sah, und an dem Gedanken an das, was mir verborgen blieb.
Hinter mir ertönten Schritte.
Ich trat zur Seite. Tine war gekommen. Sie lehnte sich gegen die Tür, atmete tief durch.
»Du bist verrückt«, flüsterte sie sich zu. Das Wasser rauschte.
Sie wollte auf der Schwelle umdrehen, warf einen Blick zur Duschkabine, deren Scheibe mittlerweile gänzlich beschlagen war und nur noch schemenhaft die Konturen des weiblichen Körpers erkennen ließen.
Tine spielte mit ihren Fingern, rieb die Hände über ihren Körper. Nervös? Erregt? Aura schien sie nicht zu bemerken.
Ein Ruck ging durch sie. Tine streifte das Bikinoberteil ab und stieg aus dem Höschen. Was für ein Körper, dachte ich.
Wieder zögerte sie.
Mach schon, schrie ich ihr in Gedanken zu, die Hand am Schwanz. Geh rein.
Sie sah zu Boden, atmete tief durch und öffnete die Tür. Laura hob den Kopf, die Hände am Bauch, überall Schaum.
»Ich bin doch noch gar nicht fertig.«
Tine schluckte. »Ich brauch auch ne Dusche. Ist noch Platz?«
»Natürlich. In eurer Dusche könnte man ganze Orgien feiern.«
Die Tür fiel hinter den beiden zu, so dass ich nur noch von Wassertropfen und Dunst gebrochen sehen konnte, wie Tine sich unter das Wasser stellte.
»Und das Handtuch haste auch vergessen. Du bist mir eine.«