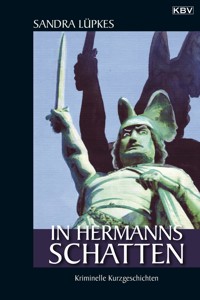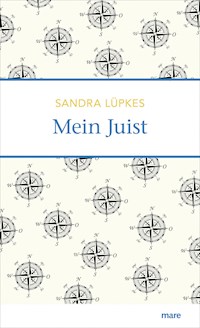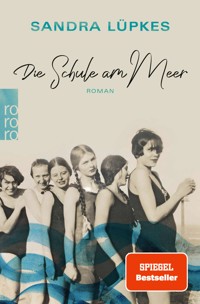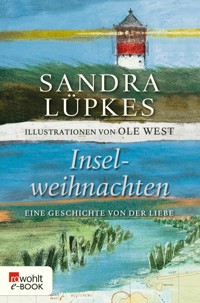7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wencke Tydmers ermittelt
- Sprache: Deutsch
Wie schafft man es nur, Job und Kind unter einen Hut zu bekommen? Die Auricher Kriminalkommissarin Wencke Tydmers ist verzweifelt: Soeben aus der Babypause zurück, fordert der erste Fall ihre gesamte Aufmerksamkeit. Ein rumänischer Au-pair-Junge wird tot in einer alten Torfhalle in Moordorf aufgefunden. Die Gasteltern vermuten Selbstmord, doch Wencke glaubt nicht daran. Die Spuren führen nach Rumänien – und zu einer zweiten Leiche. «Ein atmosphärisch dichtes, sehr spannendes und manchmal ironisches Leseabenteuer. Damit hat die Autorin wieder einmal bewiesen, dass sie der wirkliche Nachwuchsstar der deutschen Krimiszene ist, denn ihr fabelhaftes Buch ist bereits das fünfte aus der Reihe. ... Ein Krimi wie eine frische Brise.» (NDR 1 Bücherwelten) «Dieser Krimi ist eine stimmige Komposition – bis zum letzten Happen spannend und gut abgeschmeckt.» (Westdeutsche Allgemeine) «Kurzweiliger Krimi, der sich mit brisanten Themen auseinandersetzt.» (Frau von Heute) «Spannend.» (neue woche)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Sandra Lüpkes
Das Sonnentau-Kind
Ein Küstenkrimi
Hauptbahnhof Arad, Rumänien grau und zugig
Im Bahnhof ist eine Uhr mit großen leuchtenden Ziffern. Ich kann Zahlen lesen, du hast es mir beigebracht, als ich zehn Jahre alt war. Und ich weiß, was es bedeutet, wenn gleich die roten Striche umspringen und aus dem 23:59 eine 00:00 wird. Es heißt, dass ein neuer Tag begonnen hat. Es ist der Tag, an dem du endlich zurückkommen wirst. Ich kann es kaum erwarten. Mit einem der staubigen Züge wirst du dich auf den rostbraunen Gleisen in den Bahnhof schieben. Irgendwann heute.
Ich stehe an eine Plakatsäule gelehnt und kaue auf einer Käserinde herum, die ich aus dem Container hinter der Bäckerei gefischt habe. Die Leute um mich herum sind müde und schlecht gelaunt. Eine alte Frau schimpft im Vorübergehen, ich solle verschwinden, ich sei Ungeziefer, ihr Gehstock trifft meine Schulter. Es tut nicht weh. Ich schreie zurück, ziemlich schmutzige Verwünschungen, das würde dir sicher nicht gefallen, wenn du mich hören könntest. Aber sie behandelt mich wie den letzten Dreck. Und ich werde mich nicht von diesem Ort hier entfernen. Ganz egal, wenn die Menschen mich vertreiben wollen. Selbst wenn die Kinder nach mir rufen – du weißt, wie sie sind, immer wollen sie was von einem, man soll Streit schlichten oder was zu essen besorgen–, und auch wenn das Aurolac ausgeht, der Klebstoff in der Tüte seine Wirkung verliert und mein Kopf anfängt zu schwellen. Ich werde hierbleiben. Ich möchte keinen Zug verpassen.
Denn aus einem wirst du aussteigen. Und dann wird alles gut. Ich weiß es. Du wirst lächeln und mich in den Arm nehmen. Du wirst mir etwas Köstliches mitbringen, was ich noch nie gegessen habe. Du wirst mich nach den anderen fragen und wissen wollen, ob ich mein Lesen und Schreiben noch weiter verbessert habe. Du wirst wieder da sein. Und das bedeutet Glück.
Ich weiß, wenn die Ziffern der Bahnhofsuhr das nächste Mal auf einen neuen Tag umspringen, wird das Jahr vorbei sein. Das Jahr ohne dich.
Es ist so weit.
00:00.
Heute ist der Tag, an dem Aurel nach Hause kommt.
Lagerschuppen in einem Wald bei Aurich, Deutschland dämmrig und staubig
«Schade» war das erste Wort, welches Wencke in den Sinn kam, als sie nach einem Jahr Abstinenz ihre erste Leiche sah. Sie erinnerte sich an viele andere Worte, die ihr im Laufe ihres Kriminalbeamtinnendaseins durch den Kopf gesprungen waren, wenn sie an einem Tatort eintraf. «Kopfschuss» war eines davon oder «Fehlalarm», manchmal auch «Igitt» oder ein deftiges «Scheiße». Doch noch nie hatte sie angesichts eines vermeintlich gewaltsamen Todes «Schade» gedacht.
Der Junge, den man heute Morgen in einer abgelegenen alten Lagerhalle im Südbrookmerländer Moor gefunden hatte, hatte dichte schwarze Wimpern, die ihm fast bis zu den sichelförmigen Brauen reichten. Seine Augen mussten einmal geglänzt haben, als sie noch lebten. Die dunkle Haut war samtig, und das war es auch, was Wencke so schade fand, dass diese Haut weder warm noch pulsierend sein würde, wenn sie den Mut hätte, die Finger darauf zu legen. Manche Leichen sahen aus, als seien sie schon immer tot gewesen. Doch bei diesem jungen Mann hatte man das Gefühl, das Leben stünde noch neben ihm und wartete nur darauf, wieder in den Körper zu schlüpfen.
Meint Britzke jedoch machte wie immer dasselbe: Er suchte sich in dem riesigen, schlecht beleuchteten Lagerraum eine Sitzgelegenheit – in diesem Fall einen derben Holzbalken–, zückte seinen Notizblock und begann mit der Aufklärung des Falles an Ort und Stelle. Während er mit dem Stift über das karierte Papier flog, murmelte er leise vor sich hin.
«Männliche Leiche, Tod durch Erhängen, Seil bereits durchtrennt, Knoten unprofessionell, aber effektiv, Augen geöffnet, Hocker umgestoßen…»
«Britzke», unterbrach Wencke ihren Kollegen. «Du kannst dir die Kritzelei sparen. Die Spurensicherung ist bereits auf dem Weg.»
«Manche Dinge ändern sich nie: Wencke Tydmers wehrt sich mal wieder gegen bodenständige Polizeiarbeit.» Er blickte auf und grinste, sodass sein Oberlippenbart eine ganz neue Form bekam, nicht mehr nach Seehund aussah, eher nach den Schwingen einer Möwe. Sie hatte ihn schrecklich vermisst. Diesen Blick, diesen Kollegen, diesen Job.
Ein Jahr lang hatte sie sich mehr um das Leben als um den Tod gekümmert. Es war eine Umstellung gewesen, sich auf das Windelwechseln zu konzentrieren statt auf Schusswunden. Brei zu kochen, statt Verdächtige zu vernehmen. Nun stand sie seit Anfang des Monats wieder im Dienst der Polizei Aurich, halbtags nur, aber immerhin. Sie vermisste ihren Sohn Emil schon, wenn sie sich auf den Weg zur Arbeit machte, winkte ihm zu, wenn er am Fenster klebte und die Welt nicht mehr verstand, weil die Mama auf einmal wegfuhr. Zwar hatte sie seit zwei Monaten ein Au-pair-Mädchen aus Serbien, das sich liebevoll um Emil kümmerte, doch das erleichterte den Abschied nur geringfügig. Als sie noch Tag für Tag zu Hause geblieben war, war die Sehnsucht nach ihrem Job ebenso stark gewesen. Vielleicht – hoffentlich – war es jetzt nur eine Sache der Gewohnheit, bis sie beides unter einen Hut bekam, ohne sich ständig zerrissen zu fühlen.
Britzke hatte sich wieder in seine Studien vertieft: «…nicht älter als fünfundzwanzig… Strangulationsfurche weist starke Einblutungen auf, hat wohl länger gedauert, der arme Kerl… sieht nach Selbstmord aus…»
«Sieht nach Selbstmord aus?», hakte Wencke nach und trat noch einen Schritt näher an den Leblosen. «Warum sollte sich ein so junger hübscher Kerl in einem solch finsteren Loch freiwillig einen Strick um den Hals legen?»
«Man merkt, dass du eine zu lange Auszeit gehabt hast, liebe Wencke.» Meint Britzke schaute diesmal nicht auf, als er mit ihr sprach. «Du hast vergessen, dass die Welt voller Verzweiflung ist, auch hier in Ostfriesland. Selbst wenn man hübsch und jung ist, kann es einen umhauen.»
«Aber wir sind hier in Moordorf!», entgegnete Wencke und biss sich gleich auf die Zunge, weil sie sich zu dieser unbedachten Bemerkung hatte hinreißen lassen.
«Moordorf, das Land der fliegenden Messer», kommentierte Meint ironisch. «Nur weil wir hier eine der höchsten Kriminalitätsraten in Norddeutschland haben, muss es sich nicht bei jedem unnatürlichen Tod um ein Verbrechen handeln.»
Er schrieb weiter und sang dabei leise ein Lied, es war ein Kalauer hier in Ostfriesland, die bissige Variante mit der Melodie des traditionellen Bergvagabundenliedes: «Ja wenn die Fahrtenmesser blitzen und die Victorburer flitzen und die Moordorfer greifen an, was kann das Leben Schöneres geben, ich will ein Moordorfer sein.»
«Wer sich den Mist wohl ausgedacht hat», überlegte Wencke.
«Das ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht weiß. Aber den Text kannte ich schon als kleiner Junge in- und auswendig.» Meint summte weiter.
Wencke schaute sich um. Die Fläche der Lagerhalle war fast so groß wie ein Fußballfeld, die löchrige Holzdecke, in etwa so hoch wie ein zweigeschossiges Haus, wurde von Stempeln gestützt, die in Form und Farbe alten Galgen glichen. An einem der Balken baumelte das abgeschnittene Stück Seil, es war aus rauer Naturfaser, hellbraun und kratzig. Wencke fasste sich unwillkürlich an den Hals, auch wenn es ein seltsamer Gedanke war, sie würde sich niemals ein solch unbequemes Material aussuchen, sollte sie sich irgendwann einmal erhängen wollen. Und der Junge hier auf dem Boden sah mit seiner weichen, gepflegten Haut auch nicht aus, als sei ihm egal, welche Fasern mit seinem Körper in Berührung kamen. Er trug ein weißes T-Shirt, darüber einen hellblauen Pullover mit V-Ausschnitt, beides schien aus Baumwolle zu sein, dazu eine Jeans aus weichem Denim. Sportmode, praktisch und bequem. Das borstige Seil passte nicht ins Bild. Doch Wencke ahnte, Meint Britzke würde diese intuitiven Gedankengänge ohnehin nicht verstehen, deswegen behielt sie ihr Bauchgefühl für sich, auch wenn es ihr sagte, dass hier kein Selbstmord passiert sein konnte.
Die Maisonne blitzte durch die fast blinden Scheiben der kleinen Fensterchen, und in ihrem Licht flirrten dicht an dicht winzige Körnchen, dünne Fädchen, Heufasern. Auf dem Boden stand nicht viel herum, ein paar alte Maschinen und Werkzeuge zum Torfstechen, die wahrscheinlich besser verschrottet werden könnten, daneben einige Bretterkästen und Paletten. Es roch nach feuchter Erde und Schimmelpilz.
«Statt so verdattert herumzustehen, könntest du mit Sebastian Helliger reden. Er hat den Toten gefunden.»
Wencke zuckte zusammen. Vor ihrer Babypause war sie Meints Vorgesetzte gewesen, und wenn sie in absehbarer Zeit wieder voll ins Berufsleben einstieg, wäre dies wieder der Fall. Trotzdem ließ sie sich von ihm Anweisungen geben, was nun zu tun sei. Hatte sie in den letzten Monaten denn alles verlernt?
«Meinst du den Moorkönig Helliger?»
«Ihm gehört diese Halle hier. Er wohnt in dem Haus ein paar Schritte weiter den Weg hinauf und dann links. Geh doch schon mal vor, ich warte auf Rieger und Co., und wenn die ihre weißen Plastikanzüge übergeworfen haben, komme ich zu dir.»
Wencke nickte nur.
Meint blickte besorgt. «Alles klar, Wencke? Du bist blasser als der Tote hier.»
«Alles klar so weit.» Sie ging durch die schief in den Angeln hängende Tür hinaus. Draußen war es zum Glück wärmer als im kühlen Lager. Meine Güte, war der Winter schnell vergangen. Es war heute fast dasselbe Wetter wie am Tag von Emils Geburt, als sie sich mit Axel Sanders auf den Weg ins Krankenhaus gemacht hatte. Eine helle Sonne, ein blauer Himmel, wenige Bauschwolken, Friedefreudeeierkuchenwetter. Trotzdem lag unweit hinter ihr ein toter Mann in einem scheußlichen Schuppen.
Zwei Welten so nah beieinander. Nie war Wencke die Diskrepanz zwischen dem, was sie im Job zu sehen bekam, und dem, was sie sonst um sich hatte, so deutlich geworden wie in diesem Moment. Es lag alles an dem Kind. Emil hatte ihr Leben aufgewühlt. Nie wieder würde sie so unbefangen an Mordfälle herangehen können wie vor ihrem Mutterdasein.
Wencke ging in die Richtung, die Meint ihr beschrieben hatte. Da das Wetter seit einigen Wochen ausnahmslos sonnig gewesen war, war der ungepflasterte Weg hellbraun und fest. Im regennassen Zustand musste er unbefahrbar sein, Schlaglöcher und die Wadis ausgetrockneter Rinnsale zeugten davon. Feiner Sand legte sich auf ihre Schuhe, und bei jedem Schritt fabrizierten Wenckes Sohlen kleine Wolken aus Staub. Zwischen den hellgrünen Blättern der Bäume hindurch konnte sie das gewaltige Backsteinhaus erkennen, in dem die Familie Helliger lebte oder – besser – residierte. Jeder in Aurich und Umgebung kannte den Namen Helliger. Er war fest verknüpft mit dem Zusatz die Moorkönige, denn die Familie gehörte schon seit mehr als einem Jahrhundert zu den hiesigen Großgrundbesitzern, die sich mit dem Abbau von Torf ein mehr als imposantes Finanzpolster geschaffen hatten, auf dem sie sich jetzt ausruhten. Zumindest lauteten so die Gerüchte. Insbesondere in Moordorf fiel Reichtum auf. Die Mehrzahl der Bevölkerung zählte zu den Geringverdienern, wenn sie nicht sogar arbeitslos war. In dieser Umgebung stach er hervor, der Gutshof der Helligers, ungewöhnlich groß und chic, wie er war, machte er sich zwischen den geduckten Bauernkaten und den stillosen Einfamilienhäusern in der Nachbarschaft breit.
So nah wie heute war Wencke dem Helliger-Hof nie gekommen, normalerweise fuhr sie lediglich in Sichtweite daran vorbei, wenn sie mit dem Fahrrad zum Biobauern unterwegs war. Doch neugierig war sie schon immer darauf gewesen. Der Hof wirkte wie eine Filmkulisse, zu malerisch, um Wirklichkeit zu sein. Manchmal hatte Wencke gedacht, er sei vielleicht nur eine Pappfassade im flachen Land. Doch nun stand sie im Garten und konnte sich aus nächster Nähe davon überzeugen, dass das Haus dreidimensional und real war. Es hatte im Bereich des Wohnhauses mannshohe Fenster, die in ein weißes Sprossenmuster aus Rechtecken und Kreisen unterteilt waren. Das Dach war reetgedeckt und reichte an dem Teil, der früher als Stall gedient haben mochte, tiefer hinunter. Üppige Blumen quollen aus den gusseisernen Kästen darunter hervor. Der Backstein, der in kunstvollen Varianten zu einer Mauer geschichtet worden war, schien sehr alt zu sein, die Steine waren porös und hatten unterschiedliche Schattierungen. Unter einem Fenster stand stilecht die hellblau gestrichene Holzbank, auf der eine Katze schlummerte.
Es war still hier, bis auf ein leises, metallenes Quietschen und Scheppern, welches unrhythmisch aus einer Gartenecke neben der angrenzenden Scheune zu hören war. Wencke erkannte einige Windspiele aus Schrott, rostrote Objekte, die mit viel Phantasie als menschliche Gestalten zu erkennen waren.
Neben dem Scheuneneingang war ein Keramikschild angebracht. «Annegret Helliger– Kunststücke» stand darauf. Sie erinnerte sich, in den «Ostfriesischen Nachrichten» einmal gelesen zu haben, dass die Moorkönigin sich selbst verwirklich hatte und Skulpturen zusammenschweißte. Ihr kam eine Fotografie aus dem «Ostfriesland Magazin» in den Sinn, die eine attraktive Mittvierzigerin mit Schutzbrille und Handschuhen neben einer dieser Metallfiguren gezeigt hatte. Wencke würdigte diese «Kunststücke» keines Blickes, sie hatte eine Aversion gegen Dinge dieser Art. Schließlich war sie in Worpswede groß geworden, einem Künstlernest bei Bremen, in dem ihre Mutter eine der bekanntesten Malerinnen gewesen war. Und sie war gern aus diesen kreativen Kreisen geflüchtet.
«Kann ich Ihnen helfen?», fragte plötzlich eine tiefe Stimme direkt hinter ihr. Sie drehte sich um, aus einer Nische zwischen Stall und Wohnhaus war ein großer, glatzköpfiger Mann getreten. Er trug eine enge Jeans und eines von diesen Hemden, bei denen sich die Ärmel schon automatisch aufzukrempeln schienen. Die Oberarme waren es wert, gezeigt zu werden.
«Sind Sie Sebastian Helliger?»
Der Mann lachte kurz. «Nein, ganz bestimmt nicht. Und es ist auch noch nie jemand auf die Idee gekommen, mich mit dem Boss zu verwechseln.» Er schaute sie durchdringend an. «Sind Sie von der Kripo?»
Wencke nickte.
«Der Chef nimmt es mit der Privatsphäre ganz genau. Aber in Ihrem Fall…» Er zeigte kurz auf eine Tür, die zwischen den wild wuchernden Rosensträuchern kaum auszumachen war. «Ich glaube, Sie werden erwartet.» Der Zweimetermann trat nach einem gönnerhaften Winken wieder in die Scheune zurück.
Auf dem handbemalten Klingelschild stand «Familie Helliger», der Knopfdruck löste ein melodisches Dingdong aus, kurz darauf hörte sie Schritte auf die Tür zukommen.
«Guten Morgen, mein Name ist Wencke Tydmers, ich bin von der Kripo Aurich», sagte Wencke brav ihren Spruch auf und reichte dem schlanken, blonden Mann die Hand.
Dicht neben seinen Beinen strich ein drahtiger Jagdhund um den Stoff der Hose, er kläffte nur kurz, bis sein Herrchen ihn fest am Halsband nahm und den strammen Rücken streichelte.
«Schon gut!», murmelte er dem Tier zu. Dann wandte er sich an Wencke. «Sebastian Helliger. Kommen Sie doch herein.» Er ging einen Schritt zur Seite und lud sie mit einer Geste ein, in die große Halle zu treten. «Mandy, bringen Sie uns bitte einen Tee in die Bibliothek», rief er in eine unbestimmte Richtung, und die hohe Holzdecke sowie der schwarz-weiß geflieste Boden warfen das Echo seiner Aufforderung zurück. «Folgen Sie mir?», fragte er Wencke freundlich, dann steuerte er eine massive Tür im hinteren Teil des Raumes an.
«Ich habe mich schon immer gefragt, wie es hier drinnen wohl aussieht», bekannte Wencke.
«O ja, manchmal trauen sich auch Passanten aufs Grundstück und fragen, ob sie mal schauen dürfen.» Er lachte schüchtern, und Wencke konnte sich vorstellen, dass er eher ungern Menschen in sein Haus ließ. Sebastian Helliger schien ein stiller Mensch zu sein, er hatte ein freundliches Lächeln und sah so gar nicht nach einem Moorkönig aus in seiner dunkelblauen Strickjacke und abgetragenen Cordhose. An den Füßen trug er ausgelatschte Pantoffeln.
«Draußen war ein Mann, der mir sagte, Sie würden sich über neugierige Blicke nicht sehr freuen.»
«Hat Holländer das gesagt?»
«Holländer?»
«Er ist mein Mann für alle Fälle. Früher hieß es Hofknecht, heute würde ich ihn eher als Hausmeister bezeichnen. Ich habe zwei linke Hände, was alles Handwerkliche angeht. Und hier fällt nicht wenig Arbeit an, wo es von Nutzen sein kann, mit Hammer und Nagel umgehen zu können.»
«Er hatte keinen niederländischen Akzent.»
«Nein, Holländer ist sein Spitzname. Leitet sich aus seinem Familiennamen ab. Brauchen Sie seine Personalien?»
«Später vielleicht.» Wencke schaute sich staunend um. «Man könnte meinen, Sie leben hier noch genau so, wie man es vor hundert Jahren tat.»
Helliger lachte. «Keine Sorge, meine Familie und ich verfügen über fließend Wasser, elektrischen Strom und Telefon. Aber Sie haben recht, einiges ist seit Generationen nahezu unverändert. Der Hof ist zweihundert Jahre alt. Etliche Historiker lecken sich die Finger nach den Raritäten, die man in allen Ecken findet.» Sie traten in einen behaglichen Raum, dessen eine Wand bis zur Decke mit Büchern bestückt war. Gegenüber der dunkelgrünen Ledergarnitur, auf der sicherlich schon einige Generationen ihre Lesestunde verbracht haben mochten, war ein gemauerter Kamin, eingerahmt von unzähligen blau-weißen Kacheln. Helliger ging darauf zu. «Schauen Sie nur, beispielsweise diese Fliesen hier – ich kenne sie seit meiner Kindheit und habe ihnen bislang keine große Bedeutung zugemessen. Bis zur Beerdigung meines Vaters der Pastor zu Besuch kam, ein Experte für Bibelfliesen, und mich darauf aufmerksam machte, dass wir hier das komplette Neue Testament an der Wand hängen haben.»
Wencke näherte sich dem bebilderten Kamin. «Sie leben in einem Museum.»
«Für Außenstehende mag es so scheinen, ja. Für mich und meine Familie ist es jedoch einfach nur unser Zuhause, in dem wir uns sehr wohlfühlen.» Das Lächeln, welches sich die ganze Zeit auf seinem Gesicht gezeigt hatte, fiel mit einem Mal in sich zusammen. «Bis heute… fürchte ich.»
«Wegen des Toten?»
Sebastian Helliger nickte betroffen. «Setzen wir uns doch.»
Wencke nahm auf dem Zweisitzer Platz. «Sie haben uns heute Morgen den Leichenfund gemeldet. Kannten Sie den Toten?»
«Ja, er war sozusagen ein Teil der Familie.»
Wencke erinnerte sich an den dunklen Teint des Jungen und konnte sich nicht vorstellen, dass der blonde, etwas blasse Sebastian Helliger von Blutsverwandtschaft sprach. «Ein Angestellter?»
«Nein, er hat seit einem Jahr als Au-pair-Junge bei uns gearbeitet.»
«Ach!», sagte Wencke.
«Aurel Pasat aus Rumänien. Ein wunderbarer junger Mann. Unsere Kinder liebten ihn. Ich weiß gar nicht, wie ich den Kleinen das erklären soll.»
«Wo sind Ihre Kinder jetzt?»
«Mit meiner Frau ein paar Tage auf Spiekeroog. Wir haben dort ein Haus. Durch den Maifeiertag hat man ein verlängertes Wochenende, da haben die drei ihre Sachen gepackt. Ein paar Tage ausspannen. Meine Frau ist Künstlerin…»
«Ich weiß, ich habe ihre Skulpturen gesehen.»
«Nächste Woche eröffnet sie eine Ausstellung im Moormuseum, in den kommenden Tagen hat sie alle Hände voll mit den Vorbereitungen zu tun. Also kam ein Kurzurlaub auf der Insel vor dem Stress nochmal ganz gelegen. Heute Abend kommen die drei wieder.»
«Weiß ihre Frau schon…»
Er schüttelte den Kopf. «Annegret wird außer sich sein. Sie liebte Aurel wie einen eigenen Sohn.»
Die Tür wurde geöffnet, und ein junges Mädchen kam mit einem Tablett herein, auf dem das klassische Rosenservice, ein Stövchen, Kluntjes und Sahne standen. Auch das zartgelbe Teegebäck auf dem Porzellanteller fehlte nicht. Sie stellte alles schweigend auf den Tisch, goss den Tee ein, und Wencke bemerkte, dass sie verweint aussah. Natürlich, sie hatte bereits von dem Toten gehört, und wenn er in diesem Haus für die Kinderbetreuung zuständig gewesen war, waren sie sich sicher einige Male über den Weg gelaufen. Wencke nahm sich vor, die traurige Dienstmagd später noch aufzusuchen.
Sebastian Helliger berührte leicht den zitternden Unterarm des Mädchens. «Vielen Dank, Mandy! Nehmen Sie sich frei bis zum Abendessen, ruhen Sie sich etwas aus.»
Sie lächelte leicht und verließ das Zimmer, ohne ein Wort gesagt zu haben.
Wencke nahm einen Schluck Tee. «Wann haben Sie Ihren Au-pair-Jungen – wie war doch gleich sein Name…?»
«Aurel.»
«Wann haben Sie Aurel zum letzten Mal gesehen? Haben Sie ihn nicht vermisst?»
«Gestern Abend war er auf dem Hof. Er hat sich sein Mountainbike geschnappt und ist weggefahren. Ich habe ihn nicht gefragt, wohin.» Helliger seufzte und schüttelte ungläubig den Kopf. «Es waren seine letzten Tage hier. Wie schnell so ein Jahr vergehen kann, da staune ich immer wieder. Und da meine Familie ja einen Kurzurlaub macht, habe ich Aurel frei gegeben, damit er seine Koffer packen und sich von Freunden verabschieden konnte. Heute Abend wollten wir eine kleine Abschiedsparty geben, und morgen wäre er wieder nach Bukarest geflogen.»
«Und dann haben Sie ihn heute früh im Scheunenlager gefunden?»
«Ja.»
«Und Sie haben auch den Strick durchtrennt?»
Helliger schaute fast hektisch auf. «War das ein Fehler? Habe ich Beweise vernichtet?»
«Nun…»
Er hob abwehrend die Arme. «Das geschah instinktiv, ich habe nicht darüber nachgedacht. Wissen Sie, er sah irgendwie noch so… so lebendig aus. Ich hatte gehofft, ihn retten zu können.»
«Es ist schon okay», beruhigte Wencke ihn. «Wir kennen das. Im Grunde haben Sie richtig gehandelt. Sie konnten ja nicht wissen, dass er wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Stunden tot war.»
«Es ist in der Nacht passiert?»
«Die Spurensicherung überprüft alles, der Rechtsmediziner wird uns heute Abend Näheres dazu sagen.»
Helliger ließ seine Stirn in die Hände sinken. «O mein Gott, Aurel, warum hast du das getan?»
Wencke befürchtete, der Mann könnte jeden Moment in Tränen ausbrechen. Sie hasste weinende Zeugen, denn diese brachten Ermittlungen keinen Schritt voran und waren zudem nur schwer zu ertragen. Sie machten es ihr als Polizistin schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Tragik des Ganzen auszublenden. Ihre Erfahrung hatte sie gelehrt, dass man einen solchen Gefühlsausbruch am besten mit sachlichen Fragen hinauszögern, vielleicht sogar verhindern konnte. «Warum könnte Aurel sich das Leben genommen haben? Ist Ihnen etwas aufgefallen?»
«Aurel war einer der lebenslustigsten Menschen, den ich kannte. Sein Lachen…» Seine Stimme klang belegt, und Wencke glaubte einen Moment, ihr Ablenkungsmanöver sei fehlgeschlagen, doch dann sprach er weiter: «Wenn er lachte, blitzten seine Zähne nur so. Ein hübscher Kerl. Es ist so schade…»
Ja, das habe ich auch schon gedacht, kam es Wencke in den Sinn.
Helliger sprach weiter. Er schien sich wieder zu fangen. «Dass ein Mensch, der in einem Land wie Rumänien groß geworden ist, trotzdem noch so eine Fröhlichkeit entwickeln kann, ist ein Wunder. Wenn die Kinder mal übellaunig nach Hause gekommen sind, weil sie eine schlechte Note geschrieben haben oder es irgendwelche Probleme gab, da hat Aurel sie in Minutenschnelle wieder aufgemuntert und ihnen gezeigt, dass das Leben zu schön ist, um sich durch schlechte Laune den Tag zu vermiesen.»
«Dann glauben Sie nicht so recht an einen Selbstmord?», fragte Wencke vorsichtig.
Er schaute sie ungläubig an. «Was wäre denn die Alternative?»
«Nun, ein Unfall sicher nicht. Sie haben das Seil ja selbst gesehen, es war geknotet, er hätte nicht aus Versehen hineinfallen können», stellte Wencke fest.
«Mord?», kam es leise über Sebastian Helligers Lippen.
Wencke deutete ein Nicken an.
Es blieb einige Zeit still in der Bibliothek. Auf dem Schreibtisch tickte leise eine Uhr, von draußen hörte man gedämpft die Windspiele aus Metall, noch leiser war ein Weinen aus einem anderen Raum zu vernehmen. Wahrscheinlich das Dienstmädchen, dachte Wencke.
Sebastian Helliger unterbrach die Ruhe durch ein Räuspern, mit dem er seiner Stimme wieder Herr zu werden versuchte. «Nie im Leben Mord!»
Diese Behauptung klang so bestimmt, dass Wencke auf weitere Weshalbs und Warums verzichtete, zumindest vorerst. Stattdessen erkundigte sie sich nach Aurel Pasats Zimmer, nach seinen Papieren und weiteren persönlichen Gegenständen, die im Haus verteilt sein könnten. Helliger trank seine Tasse leer, stand auf und machte wieder diese Geste, die Wencke aus der Bibliothek in einen anderen Teil des Hauses lotsen sollte. Sie folgte bereitwillig.
Fähre Spiekeroog– Neuharlingersiel, Deutschland überfüllt und stickig
Wenn die Kinder nur einen Moment, einen winzigen Moment Ruhe geben würden, dachte Annegret. Thorben kletterte über die mit Kunstleder bezogenen Bänke, Henrike maulte, weil sie eine Geschichte vorgelesen haben wollte. Die Fähre hatte ungefähr die halbe Strecke in Richtung Festland hinter sich gebracht. Man konnte bereits den Deich von Neuharlingersiel sehen, doch wenn man zurückschaute, schien Spiekeroog auch noch nicht allzu weit entfernt zu sein. Ein kleiner Kurzurlaub auf der ruhigen Insel hatte es werden sollen, eine Ewigkeit schien er gedauert zu haben. So lieb sie die Kinder hatte, drei Tage auf engstem Raum waren einfach zu viel. Besonders, wenn man nichts nötiger hatte als Ruhe, als ein paar Momente Ruhe und Zeit, um sich alles durch den Kopf gehen zu lassen, was in den letzten Wochen geschehen war.
Annegrets Finger umschlossen im Verborgenen ihrer Handtasche wieder den Brief. Sie streichelte über das Papier, welches sie seit ihrer Abreise so unzählige Male auseinander- und wieder zusammengefaltet hatte.
«Ich gehe mal kurz nach draußen. Benehmt euch, Kinder, okay?»
Annegret schulterte ihren Lederbeutel, warf Thorben und Henrike einen ernsten Blick zu und ging an den Bankreihen vorbei bis zur Glastür, die zum Oberdeck führte. Das Wetter war schön; welch netter Maibeginn, besonders hier direkt am Meer, wenn man glaubte, in der klaren Luft die Sonne riechen zu können. Ein milder Wind umfasste Annegrets dunkelblonde Locken, die sie mit einer Holzspange zusammengesteckt hatte, eine Strähne löste sich und fiel ihr in das Gesicht. Das Kitzeln der Haare an ihren Lippen irritierte sie, denn sie hatte eben an Küssen gedacht. Im Brief stand, dass er sie küssen wolle. Dass er an nichts anderes denken könne. Und seitdem kribbelten ihre Lippen, und sie wusste nicht, ob es Vorfreude war oder die Ankündigung eines Herpesbläschens, wozu sie in Stresssituationen häufig neigte.
Das, was er ihr geschrieben hatte, war einfach unerhört. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er so weit gehen würde. Und jetzt schwebte sie seit Tagen in einem Zustand, den sie nicht zu beschreiben vermochte. Es war eine Mischung aus Erregung und Resignation. Sie war vierundvierzig, sie empfand sich als leidenschaftliche Frau, doch solch ein Gefühlschaos hatte sie noch nie erlebt. Und nie im Leben hatte sie damit gerechnet, etwas Derartiges überhaupt noch einmal zu spüren. Als Mutter und Ehefrau schaltete man so etwas doch irgendwann aus. Sie hatte ihre Kunst, ihre Skulpturen, eigentlich hätte sie bis vor kurzem schwören können, das reiche ihr an Emotionalität. Und jetzt?
Annegret zog den Umschlag heraus. Sie hatte eine Skizze auf die Rückseite gemalt. Es war der Entwurf einer neuen Skulptur, die sie gleich morgen beginnen wollte. Ein Mann, ein Lächeln, eine tief gebeugte Gestalt, die sich einerseits abwärts zu bewegen schien, in die Knie sank wie bei einer Unterwerfung. Die aber andererseits über genug Kraft verfügte, sich aufzubäumen, und groß genug war, um alles zu überragen. Sie würde einige Nähte schweißen müssen, zudem hatte sie sich für grobes, dickes Material entschieden, welches nur schwer zu schneiden war. Annegret konnte es kaum erwarten, morgen mit der Arbeit zu beginnen. Es würde kein Modell sein, um das sich die Käufer in ihrem Atelier reißen würden. Doch es würde eines ihrer besten Stücke werden, das wusste Annegret schon jetzt. Bis zur Ausstellungseröffnung nächste Woche wäre es mit Sicherheit noch nicht fertig, aber sie würde es dann später zwischen den anderen Skulpturen auf dem Gelände des Moormuseums unterbringen. Das Motto der Ausstellung – Gestaltenwechsel– Wechselgestalten – passte zweifellos zu dieser Figur. Nahezu unleserlich stand der Name des Objektes links neben den mehrfach übergemalten Umrissen: «Rumänien».
«Mama, der Thorben ärgert mich», sagte die Stimme ihrer Tochter, die sich unbemerkt neben sie an die Reling gestellt hatte.
«Henrike, du hast dir keine Jacke übergezogen und wirst dich erkälten, so warm ist es heute nicht.» Sie schob das Kind wieder in den Salon zurück, in dem es muffig roch, weil zu viele Menschen auf einmal mit dem kleinen weißen Schiff unterwegs waren. Einige schauten ihr hinterher. Annegret hatte sich daran gewöhnt, von Blicken verfolgt zu werden, es fiel eben auf, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs war. Sie selbst war groß, blond, hatte hellgrüne Augen und sommersprossige Haut. Und Thorben und Henrike waren klein und dunkel. Zu dunkel, um von irgendjemandem für ihre leiblichen Kinder gehalten zu werden. Besonders wenn Sebastian dabei war, der noch größer, heller und blasser war als sie selbst, besonders dann meinte Annegret die Gedanken der Passanten lesen zu können: Adoptiert. Aus Osteuropa. Und manchmal entdeckte sie auch Fragezeichen im Blick: Kann man in Osteuropa nicht Kinder kaufen?
Selten wurde sie darauf angesprochen. Aber immer wurde ihre Familie neugierig beobachtet.
Thorben hatte sich aus dem Rucksack einen Riegel Schokolade geklaut, Annegret erkannte es an seinem verlegenen Blick und der Art, wie er die Hände vor ihr versteckte. «Thorben!», sagte sie ernst. «Noch so etwas, und du darfst heute Abend nicht mitfeiern!»
Sofort war der Junge eingeschnappt. «Das ist unfair, morgen fährt doch Aurel. Außerdem haben wir für ihn ein Geschenk gebastelt. Du hast gesagt, wir sehen ihn vielleicht nie wieder.»
«Nie wieder ist schrecklich lang», fügte Henrike hinzu.
Beide Kinder schauten sie traurig an. Sie hatten schwer damit zu kämpfen, dass Aurel nach einem wunderbaren Jahr die Familie wieder verlassen würde. Sie hatten den Au-pair-Jungen gern bei sich gehabt. Und Rumänien war so weit weg.
Annegret seufzte. «Ja, nie wieder ist schrecklich lang», wiederholte sie und hoffte, die Kinder würden nicht bemerken, dass auch sie diesen Gedanken nicht ertragen konnte.
Im Dachgeschoss eines umgebauten Stalles, Moordorf sonnig
Das Zimmer des Jungen lag im Stallgebäude über dem Atelier. Es war großzügig geschnitten, mit hochwertigen Kiefernmöbeln ausgestattet und hatte eine Kochnische sowie ein eigenes Badezimmer. Man erkannte, dass der Bewohner dieser Räume nicht mehr lange blieb, es lagen kaum persönliche Dinge herum, nur ein paar Kleidungsstücke über der Stuhllehne, ein halb voller Kasten stilles Mineralwasser in großen Plastikflaschen in der Ecke, ein paar Reisepapiere auf dem Schreibtisch. Wencke dachte an ihr Au-pair-Mädchen Anivia, die nun schon seit zwei Monaten in ihrem ehemaligen Arbeitszimmer lebte, auf einer Ausziehcouch schlief und sich zum Waschen mit dem Gästeklo zufriedengab. Wenn sie erfahren würde, wie die Kindermädchen und -jungen auf dem Helliger-Hof untergebracht waren, würde sie vielleicht die Koffer packen. Schließlich war hier soeben eine Stelle frei geworden.
«Wohnen alle Ihre Angestellten so?», fragte Wencke den Hausherrn, der schweigend aus dem Fenster zum Hof hinunterschaute.
Helliger schien über diese Frage verwundert. «So viele Angestellte haben wir privat eigentlich nicht. Nur Holländer, aber er hat eine Wohnung in Aurich, und Mandy, die aus Sachsen-Anhalt stammt und Hauswirtschafterin ist, und unsere Au-pairs. Und da wir ja genügend Platz haben…»
«Dann stimmt es also, dass Sie mit der ostfriesischen Erde ein Vermögen gemacht haben, von dem Sie jetzt noch profitieren?»
«Wie kommen Sie darauf?»
«Eine Dienstmagd, ein Hofknecht, eine männliche Gouvernante…» Wencke wusste, mit ihrer schnippischen Art machte sie sich manchmal unbeliebt, doch der Mann schaute gelassen, schien sich in diesem Fall eher zu amüsieren. «Immerhin nennt man Sie den Moorkönig.»
«Wer tut das?»
«Die Moordorfer.»
Sebastian Helliger lachte. «Mit diesem Vorurteil hatte schon mein Vater zu kämpfen, und ich denke, mein Großvater auch. Nein, richtig reich sind wir nicht, waren wir auch noch nie.»
«Nur im Vergleich zu den Nachbarn…»
«Das mag eine Rolle spielen. Früher einmal hatten die Familien jeder einen Streifen Land, oft nur fünfzig Meter breit, auf dem sie ihren Torf stechen konnten. Dies deckte den Eigenbedarf, und einen Teil konnte man noch an eine Art Zwischenhändler, wie mein Großvater einer war, veräußern.»
«Das hört sich doch gut an.»
«Na ja, aber seit Mitte des vorigen Jahrhunderts wird Torf als Energielieferant nicht mehr eingesetzt. Mein Vater hat nach und nach die Ländereien auf Erbpacht von den Bauern übernommen und sich so ein beträchtliches Stück Land angeeignet. Und da Grundbesitz hier in Gold aufgewogen wird, gelten wir Helligers als steinreich, auch wenn der Ertrag zu wünschen übrig lässt. Torf braucht viele Jahrtausende Reife. Und wir haben hier in der Umgebung nicht mehr viel davon übrig gelassen.»
«Und womit halten Sie hier das ganze Anwesen über Wasser?»
«Ich habe meinen Betrieb modernisiert. Ich bin in die Verarbeitung von Biomüll eingestiegen, importiere teilweise Torf aus Russland oder von der niederländischen Grenze. Daraus machen wir in unserem Werk in Großheide beste Blumenerde.»
«Dann sind Sie also im Grunde genommen gar kein echter Moorkönig mehr?»
«Nein, eher ein Kompostkönig. Aber wer will schon so heißen?»
Wencke lachte kurz, bis sie merkte, dass Helliger den letzten Satz überhaupt nicht als Witz gedacht hatte. Er reichte ihr eine Visitenkarte, auf der neben dem Schriftzug «Helligers Kompostierwerke» ein schwarzer Klecks und eine daraus wachsende Blume zu erkennen waren.
In der Mitte des Zimmers stand ein gepackter Koffer. Er war braun und hatte etliche Macken auf dem zerschlissenen Leder. Am Henkel baumelte ein Schild, Wencke nahm es in die Hand und versuchte, die krakeligen Großbuchstaben zu entziffern. AUREL PASAT, STR. LACULUI 21, ARAD, ROMANIA, daneben eine Zahlenfolge, die man für eine Telefonnummer halten konnte.
«Haben Sie Kontakt zu Aurels Familie? Wir müssen sie schließlich irgendwie benachrichtigen.»
Helliger dachte nur kurz nach. «Er hat uns nie etwas über seine Eltern erzählt. Wir vermuten, dass sie entweder tot sind oder ihn fortgegeben haben. In Rumänien ist alles anders, müssen Sie wissen. Nichts lässt sich mit den Zuständen in Deutschland vergleichen.»
«Das klingt so, als hätten sie das Land schon einmal selbst besucht.»
«Ja, nicht nur einmal. Unsere Kinder stammen von dort, müssen Sie wissen. Meine Frau hatte vor Jahren eine schwere Operation, sie kann keine eigenen Kinder bekommen, deswegen haben wir Thorben und Henrike adoptiert, als sie knapp ein Jahr alt waren. Wir haben sie aus einem Kinderheim in Cluj-Napoca in Transsilvanien geholt.»
«Draculas Heimat?», entfuhr es Wencke.
«Ja, und auch wenn es sich bei den Vampirgeschichten um verklärte Schauermärchen handeln mag, die Zustände in diesem Ort sind teilweise tatsächlich ein Horror. Und glauben Sie mir, wenn Sie Heimkinder in Rumänien gesehen haben, dann schätzen Sie sich froh, in Deutschland geboren worden zu sein.»
Wencke hatte schon einmal einen Bericht im Fernsehen gesehen: Straßenkinder in Bukarest, Klebstoff in Plastiktüten, Schläge und Hunger. Es war während ihrer Schwangerschaft gewesen, als sie ohnehin anfällig für das Elend der Welt gewesen war. Sie konnte sich erinnern, irgendwann den Kanal gewechselt zu haben, weil sie die Szenen nicht mehr ertragen konnte.
Sebastian Helliger strich gedankenverloren über den Koffer. «Es lag nahe, dass wir immer Au-pairs aus Rumänien genommen haben. Erstens konnten wir so unseren Kindern ein kleines Stück ihrer Ursprungskultur vermitteln. Die Jungen und Mädchen waren ausdrücklich angewiesen, mit Thorben und Henrike in ihrer Muttersprache zu reden, auch die rumänischen Sprachkenntnisse von meiner Frau und mir haben davon profitiert. Zudem sollten die Au-pairs etwas von der Kultur – der rumänischen Küche, Bräuche und Lieder – verstehen. Rumänien wäre ein wunderschönes Land, wenn nur die Misswirtschaft während der Ceauşescu-Ära nicht ein solches Elend in der Bevölkerung herbeigeführt hätte. Und zweitens konnten wir auf diese Weise auch einem jungen Menschen für ein Jahr ein besseres Zuhause und eine Chance für die Zukunft geben.»
Wow, dachte Wencke, dieser Moorkönig hat ein gutes Herz. Während ich bei meiner Suche nach einem Kindermädchen nur den Gedanken verfolgt habe, eine adäquate und bezahlbare Betreuung für Klein Emil zu finden, rettet Sebastian Helliger mal eben ein kleines Stück der ganzen Welt. Und wirkt dabei nicht gönnerhaft oder moralistisch.
«Und wenn sie dann in ihre alte Welt zurückkehren müssen, ist das nicht… doppelt hart?», fragte Wencke.
«In Rumänien gibt es ein altes Sprichwort: Abschied ist ein kleiner Tod, nur wer Neues begrüßt, wird ihn überleben, so die sinngemäße Übersetzung.»
«Und? Hätte Aurel überlebt?»
«Ich weiß es nicht», antwortete Helliger. «Er hat nicht darüber gesprochen, was ihn zu Hause erwartet, was er dort zu tun gedachte. Sonst war er kein verschlossener Junge, ich habe selten einen solch offenen Menschen wie ihn kennengelernt. Aber wenn es um Rumänien ging…»
«Könnte es sein, dass er sich deswegen lieber das Leben genommen hat? Weil er keine Perspektive hatte? Weil er – um bei diesem Sprichwort zu bleiben – sich nicht imstande sah, Neues zu begrüßen?»
Helliger nickte nur, was Wencke allerdings nicht als Zustimmung deutete. Eher als hilflosen Versuch, seinem Unverständnis Ausdruck zu verleihen.
Es klopfte kurz an der Tür, und Meint Britzke trat ein, ohne ein Herein abgewartet zu haben. «Ihr Hausmeister sagte mir, dass ich Sie hier finde. Wencke, die Spurensicherung ist jetzt da, sie nehmen sich zuerst den Schuppen vor, anschließend wollen sie dieses Zimmer hier und das Atelier durchsuchen.»
«Das ist gut.» Wencke zog vorsichtig das beschriebene Papier aus dem Kofferanhänger und reichte es ihrem Kollegen. «Und in der Zwischenzeit wäre ich dir dankbar, wenn du herausfinden könntest, wer unter dieser Adresse hier zu finden ist und – falls es sich bei den Zahlen um eine Telefonnummer handelt – wer am anderen Ende den Hörer abnimmt. Ach, und für den Fall, dass jemand drangeht, brauchten wir wahrscheinlich auch einen entsprechenden Dolmetscher für Rumänisch.»
Meint Britzke grinste sie an. Sie wusste, was sein Gesicht zu bedeuten hatte: Sie war wieder da. Sie hatte ihm eben einen Haufen langwieriger Aufgaben zugeschoben, zu deren Erledigung sie selbst keine Lust hatte. Und das war genau das, was sie vor ihrer Auszeit auch immer getan hatte. Meint Britzke freute dies augenscheinlich. Wencke Tydmers war wieder in ihrem Element. Wieder da.
Hauptbahnhof Arad hektisch und schmutzig
Ich schaue wieder zur Uhr. 11.23 sagen die Ziffern. Bald ist die Hälfte des Tages herum, aber du bist noch aus keinem der Züge gestiegen. Bist wohl noch unterwegs. Ich rechne ohnehin erst gegen Abend mit dir.
Wie du jetzt wohl aussehen magst? Ich krame das alte Foto aus meiner Jackentasche. Du hast es mir damals zum Abschied geschenkt, erinnerst du dich? Du hast gesagt, es sei nicht gerade die neueste Aufnahme, aber es gebe nicht viele Bilder von dir, und dieses müsse ausreichen, damit ich dich nicht vergesse. Auf dem Foto bist du erst fünfzehn. So alt, wie ich jetzt bin. Das Bild wurde in einem der Heime aufgenommen. Ich glaube, es war in Cluj-Napoca. Damals warst du noch kleiner, deine Haare waren länger, dein Gesicht war magerer. Aurel, den Bleistift, haben sie dich genannt, ich habe mich als kleines Mädchen darüber kaputtgelacht. Aber als du vor einem Jahr gefahren bist, hast du nicht mehr wie ein hölzerner Strich ausgesehen. Ich erinnere mich noch genau, wie du in den Zug gestiegen bist, der dich nach Bukarest zum Flughafen bringen sollte. Du hast dich noch einmal zu mir umgedreht und gewunken. Die Zeit, die du nicht mehr auf der Straße gelebt hast, hat dir gutgetan. Du warst kräftig, hattest Muskeln aufgebaut, deine Frisur war sehr kurz, und du hattest dir einen Stoppelbart wachsen lassen, der dich erwachsener machte. Und die Brille, die du trugst, ließ dich wie einen Gelehrten aussehen. Nun, du kannst ja auch lesen und schreiben. Und es gibt nicht viele Heimkinder, die das beherrschen, also bist du, Aurel, tatsächlich so etwas wie ein Gelehrter. Für mich und die anderen sowieso. Du bist unser Vorbild. Alle wollen wir so werden wie du.
Aber ich werde das nie schaffen. Du weißt ja gar nicht, was ich inzwischen mache. Sicher hoffst du, dass ich noch immer die Schule besuche, die die Deutschen im alten Hotel Primặvarặeingerichtet haben. Ich weiß, du hast mich mehr als einmal gebeten, weiter dort hinzugehen, auch während deiner Abwesenheit. Es sei meine einzige Chance, hast du gesagt. Die müsse ich nutzen. Lesen und Schreiben und der ganze Kram, auch wenn es schwerfällt, auch wenn die Holzstühle unbequem sind und diese Lehrerin eine Hexe ist, dies sei der einzige Weg von der Straße weg. Ich hatte mir das auch fest vorgenommen, weiter ins Primặvarặ zu gehen, aber zwei Wochen nachdem du nach Deutschland geflogen bist, habe ich etwas erlebt, das alles verändert hat. Du kannst es ja nicht wissen. László ist von seinem Zuhälter zusammengeschlagen worden, so schlimm, dass er ein paar Tage später gestorben ist. Und da habe ich einfach keine Lust auf Schule gehabt. Ich war so wütend. Mit dreizehn ist man noch zu jung zum Sterben, finde ich. Und ausgerechnet László. Er war ein lieber Kerl, er hätte etwas Besseres verdient, wenn schon nicht ein besseres Leben, dann wenigstens einen schöneren Tod. Nicht auf der Pritsche in einem kalten Krankenhaus, wo sie uns Straßenkinder ohnehin immer liegen lassen, bis sich das Problem von selbst löst. Als László starb, haben die Krankenschwestern wahrscheinlich gerade Tee getrunken. Es ist so unfair. Also, warum soll ich Hoffnung haben und daran glauben, dass Lesen und Schreiben mir den ganzen Scheiß ersparen. Kannst du das nicht verstehen?
Ich hab’s verbockt, okay. Ich hätte auf dich hören sollen. Denn seitdem bin ich nicht mehr regelmäßig zum Primặvarặ hingegangen, habe mich mehr um den Klebstoff gekümmert und um meine Gruppe, für die ich schließlich verantwortlich bin, seitdem du fort bist. Dass László tot ist, geht auf meine Kappe. Ich hätte besser auf ihn aufpassen müssen, denn ich bin älter, und er ist bei mir, seit er zehn ist. Ich fühlte mich verantwortlich für ihn. Okay, du sagst immer, ich bin erst einmal für mich selbst verantwortlich, ich muss es erst einmal selbst auf die Reihe kriegen. Und ich weiß, du hast eigentlich recht.
Ach, Aurel. Wann kommst du endlich?
Ich vermisse dich so.
Es ist Mai. Gott sei Dank ist die kalte Zeit vorbei. Ich hatte in diesem Winter keinen Mantel, nur zwei Wollpullover, die ich übereinander getragen habe. Jetzt tut es einer, so warm ist inzwischen der Frühling in Arad. Manchmal finde ich die Stadt sogar schön. Derzeit schlafen wir im Teatrul vechi, erinnerst du dich, du hast mir mal erzählt, dass diese verfallene Ruine vor vielen Jahren ein prächtiges Theater gewesen ist. Viel kann man davon nicht mehr sehen. Aber der Ort besitzt noch immer einen Zauber, die alten Steine sind von Blumen überwuchert, die zurzeit sogar blühen und dem Ganzen Farbe geben, es fast fröhlich aussehen lassen.
Es ist allemal besser als die Straßenunterführungen oder der schmutzige Bahnhof, in dem ich gerade den Tag herumzukriegen versuche. Ich kann nicht mehr stehen, setze mich auf eine Bank und warte.
Ein Mann geht auf mich zu. Er kommt mir bekannt vor, doch es dauert ein paar Momente, bis ich in ihm einen der Sozialarbeiter von Primặvarặ erkenne, seinen Namen habe ich vergessen. Ich weiß, der Klebstoff, ich sollte es sein lassen, das Schnüffeln macht meinen Kopf löchrig, sodass viel zu viele Dinge herausfallen können und für immer verloren sind. So wie der Name dieses Typen, er ist etwas dicker und über vierzig Jahre alt, er ist ein anständiger Kerl, das weiß ich noch. Er lächelt mich an.
«Teresa», sagt er. Wie lange war ich schon nicht mehr in der Schule? Mehr als acht Monate. Trotzdem hat er meinen Namen nicht vergessen.
Das ist nett von ihm. Ich nicke ihm zu.
«Wie geht es dir? Mensch, du hast deine Haare ein bisschen wachsen lassen, es sieht hübsch aus.» Er ist Deutscher, aber sein Rumänisch ist absolut okay. Er ist schon seit ein paar Jahren in Arad, ich glaube, er hat eine Einheimische geheiratet. «Du solltest dich mal wieder bei uns sehen lassen!»
«Ich weiß…»
«Soweit ich informiert bin, wartet sogar ein Brief auf dich. Von Aurel aus Deutschland.»
«Ja?» Mein Herz pocht.
«Liegt schon seit ein paar Wochen in der Ablage im Flur.»
«Was steht drin?»
Der Sozialarbeiter zuckt die Schultern. «Wir nehmen das Briefgeheimnis ernst. Du musst ihn schon selbst öffnen, schließlich steht dein Name auf dem Umschlag.»
Ich seufze, und als könnte er meine Gedanken erraten, fügt er hinzu: «Und wenn es mit dem Lesen nicht so ganz hinhaut, dann helfen wir dir gern. Komm doch gleich mit!»
Ich bleibe sitzen. «Ich kann nicht. Gleich kommt ein Zug.»
«Wen erwartest du denn?»
«Aurel. Er wollte heute zurückkommen.»
«Wann hat er das gesagt?»
«Als er gefahren ist.»
«Also vor einem Jahr?»
Ich nicke, und auf einmal wird mir bewusst, wie seltsam es ist, auf eine Verabredung zu warten, die vor so langer Zeit getroffen wurde. Es ist so vieles geschehen in den letzten zwölf Monaten. Nicht nur die Sache mit László. Das war ja nur eine von vielen. György ist verschwunden, genau wie die kleine Veronica, die seit mehr als sechs Wochen kein Mensch gesehen hat. Und das sind nur die Kinder, die zu meiner Gruppe gehören. Ich weiß, dass es bei den anderen Gangs ähnlich ist.
Der Mann legt mir die Hand auf die Schulter, und ich schrecke zusammen, weil ich so in Gedanken vertieft war. «Was ist los, Teresa? Kommst du nun mit?»
«Ich kann ja ganz kurz…», sage ich. Das Primặvarặ ist nicht so weit vom Bahnhof entfernt. Wenn ich mich beeile, bin ich in einer Stunde wieder zurück. Ich laufe ihm also hinterher, er hat einen watschelnden Gang, hebt die Füße nicht richtig beim Gehen, hält den Oberkörper leicht nach vorn gebeugt. Wie eine Ente, denke ich und muss lachen.
«Was ist so lustig, Teresa?», fragt er, und in diesem Moment fällt mir auch sein Name wieder ein: Roland. Es ist, als sei die Erinnerung unter einem Wirrwarr verborgen gewesen und die wenigen Schritte aus dem Bahnhof heraus hätten den chaotischen Haufen zum Einfallen gebracht und den Namen freigelegt: Roland Peters, Lehrer für Deutsch und Rumänisch. Er bringt den Straßenkindern seine Landessprache bei, damit sie eine Chance haben, dort ein Jahr als Haushaltshilfe oder Kindermädchen zu arbeiten. Und die meisten, die dann dort waren, schaffen es auch nach ihrer Rückkehr, hier einen richtigen Job zu finden. Deswegen ist es so wichtig, Deutsch zu lernen. Aurel, du hast das gleich kapiert, hast es geschafft, hast Roland Peters in der Schule immer gut zugehört und bist dann ins gelobte Land gereist. Ich mache mir da keine Hoffnungen, jemals so weit zu kommen. Die Sprache ist so seltsam eckig, in meinen Ohren klingt sie hart und verdreht. Und ich bin ja schon froh, dass ich die einfachen rumänischen Wörter lesen und schreiben kann. Eine Fremdsprache zu lernen ist unvorstellbar.