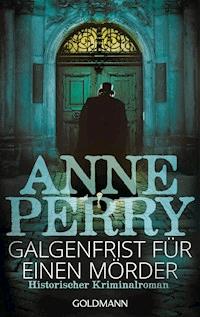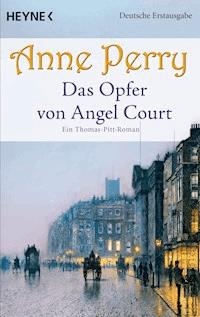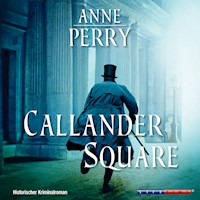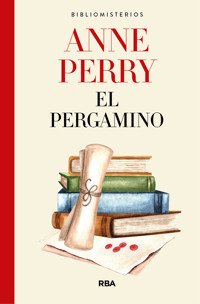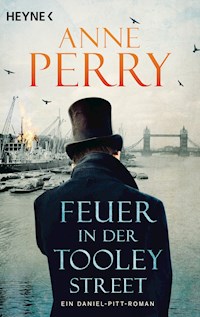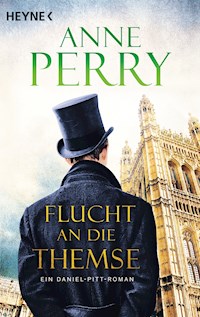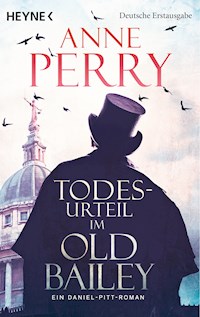9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel im Berlin der 30er-Jahre
1933: Während Europa auf eine Katastrophe zusteuert, lernt die englische Fotografin Elena Standish in einem Hotel an der Amalfiküste den charmanten Ian Newton kennen. Als dieser ein mysteriöses Telegramm erhält und überstürzt abreist, beschließt sie, ihn bis Paris zu begleiten. Doch im Zug wird Ian niedergestochen. Mit dem letzten Atemzug vertraut er Elena an, dass er für den britischen Geheimdienst MI6 arbeitet. Sie soll an seiner Stelle nach Berlin fahren, um ein Attentat zu verhindern, das eine internationale Krise auslösen könnte. Aber Elena kommt zu spät und wird schon bald selbst als Attentäterin gesucht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
1933: In einem Hotel an der Amalfiküste lernt die englische Fotografin Elena Standish den charmanten Ian Newton kennen. Ihr romantisches Abendessen endet jedoch mit einem grausigen Fund: eine Leiche im Wäscheschrank. Ian erhält daraufhin ein rätselhaftes Telegramm und bricht überstürzt nach Berlin auf. Elena beschließt, ihn bis Paris zu begleiten und von dort aus nach London zurückzukehren. Doch im Zug wird Ian niedergestochen. Mit dem letzten Atemzug kann er Elena noch anvertrauen, dass er für den britischen Geheimdienst MI6 arbeitet. Sie soll an seiner Stelle nach Berlin fahren, um ein Attentat zu verhindern, das eine internationale Krise auslösen könnte. Aber Elena kommt zu spät und wird in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt …
Weitere Informationen zu Anne Perry
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Anne Perry
Das Spiel des Verräters
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Peter Pfaffinger
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Death in Focus« bei HEADLINE PUBLISHING GROUP, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2021
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Anne Perry
Published by Arrangement with ANNE PERRY LTD.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München
Covermotive: Frau: Steve Peets/arcangel images; Berlin und Himmel: FinePic®, München
Redaktion: Ilse Wagner
LS · Herstellung: kw
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-25931-0V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Anna Maria Palombi, die mich in Neapel eingeführt hat
Personenliste
Elena Standish – Fotografin
Margot Driscoll – Elenas ältere Schwester, Kriegswitwe
Charles Standish – Elenas und Margots Vater, Botschafter
Katherine Standish – Elenas und Margots Mutter
Ian Newton – Journalist
Walter Mann – Journalist
Lucas Standish – Elenas und Margots Großvater
Josephine – Elenas und Margots Großmutter
Peter Howard – Mitarbeiter des MI6
Pamela Howard – seine Frau
Roger Cordell – Kulturattaché bei der britischen Botschaft in Berlin
Winifred Cordell – seine Frau
Cecily Cordell – Rogers und Winifreds Tochter
Winston Churchill – Politiker, zur Zeit der Handlung außer Dienst
Jerome Bradley – Präsident des MI6
Cossotto – MI6-Agent in Italien
Jacob Ritter – amerikanischer Journalist
Zillah Hubermann – hilft Verfolgten des Naziregimes
Eli – Zillahs Mann, Chemiker
Marta – Haushälterin der Hubermanns
Adolf Hitler – Reichskanzler von Deutschland
Joseph Goebbels – Reichsminister »für Volksaufklärung und Propaganda« unter Hitler
Kommandant Beimler – ranghoher Berliner Polizist
Mitzi Kopleck – alte Freundin von Katherine in Berlin
Kurt Weißmann – Cecily Cordells Verlobter, Mitglied der Gestapo
Max – Fälscher von Dokumenten
1
1933
Elena kniff die Augen zusammen. Allzu sehr blendete die vom Meer reflektierte Sonne sie. Es war warm an diesem Mainachmittag und das Licht hier in Amalfi so viel weicher als daheim an der englischen Küste. Vor dem Himmel bogen sich Bougainvilleen-Zweige unter ihren leuchtenden Blüten, ein Feuer aus Lila und Magenta, auch wenn sie keinen Duft verströmten. Sie hingen über antiken Mauern, wunderschönen alten Steinhäusern und beschatteten die Stufen, die zur sanft plätschernden See hinunterführten. Auf dem zweitausend Jahre alten Mosaikfliesenboden spielten Kinder mit Murmeln. Über all dem schwebten Möwen im Wind und hielten Ausschau nach Leckerbissen.
Elena beobachtete eine Frau in einem roten Kleid, die weiter unten auf dem Plateau des steilen Hügels nach ihrem eigenen Rhythmus vor sich hin tanzte. Vielleicht war sie aus der Zeit gefallen, hier, in dieser herrlichen Stadt am Rande des Mittelmeers, die schon die Caesaren fort von den Reichtümern und Intrigen Roms gelockt hatte.
»Glauben Sie, dass sie echt ist?«, fragte hinter ihr ein Mann mit einem sanften Lachen in der Stimme. »Oder könnte sie womöglich nur das Gespinst einer überhitzten Fantasie sein?«
Elena drehte sich um. Er war deutlich größer als sie. In seinem dichten kastanienbraunen Haar schimmerte das Sonnenlicht. Sein Gesicht lag im Schatten, doch immerhin konnte sie die markanten Konturen erahnen.
»Oh, sie ist durchaus echt«, erwiderte Elena mit einem breiten Lächeln. »Warum? Wäre eine Vision besser?«
»Höchstens für kurze Zeit. Am Ende setzt sich immer die Realität durch. Sonst würden die Leute einen für verrückt halten.«
»Oje«, seufzte Elena, die nur mit Mühe eine ernste Miene wahrte. »Und ich dachte schon, in einem roten Kleid zu tanzen sei der Inbegriff von Vernunft.«
Der Mann zuckte mit den Schultern. »Selbst eine alte Frau mit einer Tüte Zwiebeln wäre interessanter als die meisten Teilnehmer dieser Wirtschaftskonferenz, die ich hier verfolgen muss.«
Jetzt platzte das Lachen aus Elena heraus. »Ich werde Margot erzählen, was Sie gesagt haben!«
»Margot? Ist das ihr Name?«
»Wenn eine Frau in einem roten Kleid ganz allein einfach drauflostanzt, kann das nur meine Schwester Margot sein.« Sie sagte das voller Bewunderung, und einen Moment lang wünschte sie sich, selbst die Gestalt dort unten zu sein.
Der Mann blinzelte sie unsicher an, als wüsste er nicht so recht, ob er ihr glauben sollte.
Elena bemerkte seine Verwirrung und brach erneut in Lachen aus. »Doch, wirklich.«
Margot war ihre ältere Schwester, die aus einer bloßen Laune heraus zu dieser öden Konferenz mitgekommen war. Ihr war langweilig gewesen, und weil sie irgendwann ohnehin nach Amalfi hatte reisen wollen, hatte sie angeboten, Elena zu der Konferenz zu begleiten, wo diese Aufnahmen von den Teilnehmern machte. »Ist doch lustiger, wenn wir gemeinsam hinfahren«, hatte Margot gemeint. Und in dem leicht geringschätzigen Ton, den sie immer anschlug, wenn von der Arbeit ihrer Schwester die Rede war, hatte sie hinzugefügt: »Schließlich kannst du nicht die ganze Zeit knipsen!«
In Margots Augen stellte Elenas Beruf ein Hobby dar, das ein bescheidenes Einkommen einbrachte. Doch sie erkannte an, dass das Fotografieren im Fall ihrer Schwester eine Leidenschaft war, von der sie selbst nichts verstand.
Elena hatte Margots Vorschlag nichts entgegenzusetzen gehabt. Ihre Schwester kannte sie einfach zu gut und durchschaute sie meistens schnell, besonders wenn Elena sich unbehaglich fühlte und ihr irgendwelche Notlügen auftischte. Vielleicht lag das am Altersunterschied.
Natürlich war Margot auch über Aiden Strother im Bilde, obschon nicht in allen Einzelheiten. Die kannte außer Elena niemand, auch wenn der eine oder andere zweifelsohne etwas ahnte. Gleich nach dem Studium hatte Elena eine höhere Stellung im Außenministerium angenommen, was sie nicht nur ihren hervorragenden Leistungen verdankte, sondern auch dem Einfluss ihres Vaters, der viele Jahre lang als britischer Botschafter in den bedeutendsten Städten Europas gedient hatte, insbesondere in Berlin, Paris und Madrid.
In Aiden hatte Elena sich verliebt, als sie für ihn gearbeitet hatte. Kein Wunder: Er war charmant, gut aussehend, humorvoll und intelligent. Hochintelligent sogar. Tatsächlich hatte er sie alle zum Narren gehalten – sogar Elena! Doch sie war zu bezaubert von ihm gewesen, um auf die Zeichen zu achten, die ihr erst jetzt, im Nachhinein, ins Auge stachen. Er hatte sie alle nach Strich und Faden betrogen, und sie war auch noch so naiv gewesen, ihm dabei zu helfen – wenn auch unwissentlich. Im Rückblick schämte sie sich für ihre eigene Dummheit in Grund und Boden. Das einzig Gute an dem Ganzen war, dass niemand sie als Komplizin betrachtete, sondern nur als unerfahrenes und unglaublich naives junges Ding.
Gleichwohl hatte man sie vor die Tür gesetzt, so peinlich und beschämend das auch für Charles, ihren Vater, gewesen war. Er hatte immer geglaubt, dass von seinen beiden Töchtern sie diejenige wäre, die in seine Fußstapfen treten und im Auswärtigen Amt so hoch hinaufgelangen konnte, wie das einer Frau nur möglich war. Elenas kurze Vernarrtheit in Aiden stand nach wie vor zwischen ihr und ihrem Vater. Sie hatte sich grober Dummheit schuldig gemacht und das auch nie geleugnet. Noch immer tat es ihr weh, wenn dieses Thema erwähnt wurde. Mit Liebeskummer hatte das allerdings nichts zu tun, auch nicht mit dem Ende einer Illusion, sondern einzig und allein damit, dass sie dumm gewesen war und alle enttäuscht hatte, insbesondere sich selbst.
Seine ältere Tochter Margot hatte Charles nie wirklich verstanden, sie jedoch seit jeher geliebt und bewundert. Und er hatte von Anfang an gespürt, welch verzehrende Trauer ihr Leben erstickt hatte, als ihr Mann, mit dem sie nur eine Woche lang verheiratet gewesen war, in den letzten Kriegswochen fiel.
Allein auf dem Plateau am Hügel, hatte Margot mittlerweile aufgehört zu tanzen und sich darangemacht, langsam die Stufen zu erklimmen. Während sie sich Elena und dem jungen Mann näherte, verschwand sie hin und wieder hinter einer gewundenen Mauer oder einer der in verschwenderischen Farben blühenden Lauben.
»Sagen Sie mir bloß nicht, dass sie von Beruf Ökonomin ist.« Der Mann, nach wie vor mit einem Lachen in der Stimme, wurde leiser, als spürte er, dass Elena in diesem Moment nicht ganz bei der Sache war.
Selbst fünfzehn Jahre nach dem Krieg litt jeder immer noch unter seinem eigenen Kummer – sei es der Verlust eines Menschen oder vielleicht einer Hoffnung, eines Gefühls von Unschuld – und unter Angst. Schwermut lag in der Luft, in der Musik, im Humor, ja sogar in dem herrlichen, jetzt aber verblassenden Licht.
»Ganz bestimmt nicht.« Elena wahrte einen heiteren Ton, auch wenn es sie einige Mühe kostete. »Und bitte fragen Sie mich nicht, ob ich eine bin.«
»Ich würde nicht mal im Traum daran denken.« Der Mann reichte ihr die Hand. »Ian Newton. Wirtschaftsjournalist. Manchmal.«
Sie ergriff seine Hand, die sich kräftig und warm anfühlte und die ihre fest drückte. »Elena Standish. Fotografin. Manchmal.«
»Sehr erfreut.« Er ließ ihre Hand los.
»Und die Frau dort unten ist meine Schwester, Margot Driscoll«, erklärte Elena.
»Nicht Standish …? Ist sie mit ihrem Mann hier?«
»Margot ist Witwe. Ihr Mann Paul ist im Krieg gefallen.«
Ian Newton nickte. Natürlich … Mit einer Situation wie dieser wurde man immer wieder konfrontiert, sogar jetzt noch, fünfzehn Jahre nach Kriegsende. Sein Blick wanderte hinüber zu Margot, die in einer von überzähligen Frauen bevölkerten Welt dazu verdammt war, allein zu tanzen.
»Möchten Sie und Mrs Driscoll heute Abend mit mir speisen?«
Elena antwortete für sie beide. »Gern. Vielen Dank. Wir sind im Santa Catalina abgestiegen.«
»Ich weiß.«
»Sie wiss…?«
»Sicher. Ich bin Ihnen hierhergefolgt.«
Elena war sich nicht sicher, ob sie ihm glauben sollte, aber die Vorstellung gefiel ihr. »Um acht? Im Speisesaal?«
»Ich werde auf Sie warten«, antwortete Ian, dann wandte er sich ab und entfernte sich, den Rücken durchgestreckt, mit lässigen Schritten hügelaufwärts.
Im nächsten Moment tauchte Margot neben Elena auf. Äußerlich hätten die zwei Schwestern nicht unterschiedlicher sein können. Margot hatte dunkle Augen und schwarzes, wie Seide glänzendes Haar. Sie war schlank und wirkte immer elegant, egal, was sie trug. Elena war von gleicher Größe und besaß eine gewisse Anmut, die jedoch diejenige von Margot nicht erreichte. Ihre Augen waren von einem ganz gewöhnlichen Blau, ihr Haar hellbraun, fast blond. Im Vergleich zu ihrer aufsehenerregenden Schwester machte sie einen beinahe farblosen Eindruck.
»Träumst du wieder mit offenen Augen?«, fragte Margot mit kaum verhüllter Gereiztheit. Sie vergaß nur selten, dass sie mehrere Jahre älter war. »Wenn du eine seriöse Fotografin sein willst, wirst du ein paar ordentliche Aufnahmen schießen müssen, und da wirst du mit bloßem Herumstehen nicht weit kommen.«
»Ach, ich weiß nicht«, erwiderte Elena geduldig. Sie war es gewohnt, von Margot gescholten zu werden, wusste aber auch, dass ihre Schwester das aus Liebe und Besorgnis tat. »Ich habe schon zwei Bilder von einer Frau im Kasten, die dort unten getanzt hat, ganz allein und in einem knallroten Kleid. Leicht verrückt, aber eine hübsche Studie.«
In Margots Augen blitzte Zorn auf. »Gib sie mir.«
»Sei nicht albern!«, schnaubte Elena. »Ich verschwende doch keinen Film für dich. Es macht mir nur Spaß, dir dabei zuzuschauen, wie du dich vergnügst.« Und das war die Wahrheit.
Liebevoll legte Margot ihrer Schwester den Arm um die Schultern, und schweigend stiegen sie den Hügel hinauf zum Hotel.
Nach dem Mittagessen ging Elena nach draußen. Sie hoffte, ihr würden ein paar Bilder gelingen, auf denen sie die Schönheit Amalfis einfangen konnte. Es war eine sehr alte Stadt, die einst zu den größten Häfen am Mittelmeer gezählt hatte. Der Ort verströmte eine Aura von Beständigkeit und stellte damit einen paradoxen Kontrast zur fieberhaften Glückseligkeit der Urlauber dar, die der Realität für eine kurze Saison zu entkommen suchten. Hier schmolz das alles umhüllende Grau der Wirtschaftskrise in der Sonne. Aus den Bars drang amerikanische Musik, die mit ihren betörenden Melodien und den raffinierten, bittersüßen Texten die Atmosphäre dieses Städtchens in vollkommener Weise erfasste. Elena stellte sich vor, wie sie in den Armen des jungen Mannes mit dem kastanienbraun schimmernden Haar dazu tanzte.
Aber welches Bild würde die Brüchigkeit zeigen, die ebenfalls auf diesem Ort lastete? Sie war trotz seiner Schönheit überall zu spüren. Elena hatte aufrüttelnde Fotografien von Hunger und Hoffnungslosigkeit gesehen, von Menschen, die gegen Übermächtiges ankämpften – und sie hatten sie zu Tränen gerührt. Aber wie ließ sich die Atmosphäre hier einfangen? Sie brauchte unbedingt den Vesuv im Hintergrund, die Verkörperung jener schlafenden Katastrophe, die in jedem Bild zu sehen war. Es war fast zweitausend Jahre her, dass dieser Vulkan Pompeji und Herculaneum mit Feuer und giftigen Gasen heimgesucht und sie mit seiner brennenden Lava zugedeckt hatte – seitdem schien er nur auf die nächste Möglichkeit zu einem Ausbruch zu lauern.
Elena stellte sich eine Libelle in der Sonne vor. Ein Wesen, das ein herrliches Leben führte – eine kurze Zeit lang. Sie brauchte ein Gesicht, das dieses Phänomen widerspiegelte: einerseits unbändige Lebensfreude, andererseits das Wissen um die eigene Vergänglichkeit. Irgendwo musste es dieses Gesicht geben, sie benötigte nur genügend Fantasie, um es zu erkennen. Wie konnte sie erreichen, dass die Kamera mit ihrem Schwarz und Weiß Licht und Schatten darstellte und trotzdem all die Nuancen der Farben erfasste?
Die Sache mit den Farben war der Grund, warum sie Margot nicht fotografiert hatte, als diese in Rot gekleidet getanzt hatte. Um auszudrücken, was sie sagen wollte, hätte das Bild eine Explosion von Farben gebraucht. Eine in trotziges Scharlachrot gehüllte Frau, die sich allein und in ihrem eigenen Rhythmus bewegte. Das war das perfekte Bild von einer Million Frauen in Großbritannien – eigentlich fast zwei Millionen –, die als »überzählig« bezeichnet wurden. Gemeint war damit das Verhältnis zum Bedarf, denn es gab keine Männer, die sie hätten heiraten können. Elena war eine von ihnen.
Aber vielleicht war das ja sogar besser, als in den Armen eines Mannes gefangen zu sein, der überhaupt nicht zu ihr passte.
Im schräg einfallenden Licht der versinkenden Sonne bot sich Elena exakt das Bild, das sie aufnehmen wollte. Weiter vorn stand eine junge Frau, jünger als sie, vielleicht zwanzig Jahre alt, halb dem Licht zugewandt. Es war weich, fast golden, und berührte sie sanft, hob ihre Jugend, ihr absolut faltenloses Gesicht hervor. Sie hatte eine rotbraune Haarmähne und hellbraune Augen, in denen sich das Licht spiegelte. Sämtliche Linien wirkten bei ihr gerade, scharf konturiert, klassisch. Nur der Rauch ihrer Zigarette verflüchtigte sich im Ungefähren.
Schon hatte Elena die Leica aus der Kameratasche gezogen, richtete sie auf ihr Motiv, stellte die Schärfentiefe ein und drückte ab.
Als das Mädchen das leise Klicken hörte, drehte es sich um. Der Moment war vorbei.
»Hoffentlich haben Sie nichts dagegen«, entschuldigte sich Elena. »Sie sind so reizend und haben perfekt zur Szene gepasst …«
Die junge Frau zuckte mit den Schultern. »Schon gut, das macht mir nichts aus.« Und mit einem angedeuteten Lächeln entfernte sie sich.
Als sie die Treppe zu dem Hotelzimmer hinaufging, das sie mit Margot teilte, drehten sich Elenas Gedanken immer noch um das Foto. Erst als sie ins Zimmer trat, rief sie sich zur Ordnung: Es war an der Zeit, sich fürs Dinner umzuziehen. Schließlich freute sie sich darauf, mit Ian Newton zu speisen, ein Gefühl, das sie schon lange nicht mehr erlebt hatte.
Margot war bereits fertig mit ihren Vorbereitungen für den Abend. Das rote Kleid hatte sie gegen eine lilafarbene Paillettenrobe eingetauscht. Reichlich wagemutig und dennoch schmeichelhaft schmiegte das Kostüm sich an ihren Körper. Bei jemand anders hätte das vielleicht ordinär gewirkt, doch da Margot gertenschlank war, deutete die Robe ihre Figur eher an, als dass sie sie offenbarte. Sie sah schlicht umwerfend aus und war sich dessen eindeutig bewusst – so war Margot eben.
»Wo hast du gesteckt?«, wollte sie wissen, als Elena hereinschlenderte. »Einen Wirtschaftsfachmann, der so wahnsinnig interessant wäre, kann es unmöglich geben.«
»Ich habe ein Foto von einem Mädchen im Dämmerlicht geschossen. Daraus könnte was wirklich Gutes werden. Die Schatten haben die Linien in ihrem Gesicht wundervoll betont. Einen Moment lang war sie richtig schön … und jung … und hoffnungslos … Als hätte sie sehen können, wie die Zeit vor ihren Augen zerrinnt und verschwindet, noch ehe sie die Hand danach ausstrecken kann.«
»Und genauso ist es tatsächlich«, erwiderte Margot kurz angebunden. »Wir kommen zu spät zum Essen, wenn du dich nicht beeilst.«
Zehn Minuten später trat Elena frisch gewaschen und umgezogen aus dem Badezimmer. Sie hatte ihre Haare gebürstet und sich dezent geschminkt. Schmuck hatte sie nicht angelegt, nur den Ring, den sie immer an der rechten Hand trug.
Margot begutachtete sie kritisch. »Um Himmels willen, Elena! Dieses blaue Kleid schreit ja geradezu danach, in den Müll geworfen zu werden. Und es sagt auch noch was anderes: ›Kommt mir bloß nicht zu nahe! Ich bin eine Zuschauerin, keine Spielerin. Mir geht es um nichts als Sicherheit, lasst mich gefälligst in Ruhe!‹« Sie baute sich dicht vor ihrer Schwester auf. »Du könntest es bei deiner Beerdigung tragen, und niemand würde befürchten, dass du noch lebst.«
»Das ist wirklich nicht nett von dir«, protestierte Elena.
»Aber wahr. Wenn du keinen Busen hättest, würdest du darin aussehen wie eine Zwölfjährige. Nimm mein schwarzes Kleid. Ich habe es noch nicht getragen. Mach aber schnell.«
»Es wird mir nicht passen«, wandte Elena ein, ohne es ernst zu meinen. Sie wusste, dass es genau die richtige Größe hatte.
»Ach, sei still und zieh’s einfach an!«, befahl Margot. »Es wird wenigstens ein paar Leute aus dem Schlaf reißen. Vielleicht bringt es dir sogar eine gute Gelegenheit zum Fotografieren ein. Ich darf doch annehmen, dass du dich den ganzen Abend nicht von deiner Kamera trennen wirst?«
Elena gehorchte. Sie wusste, dass Margot mit dem blauen Kleid recht hatte. Es schützte tatsächlich vor Männerblicken. Seit der Sache mit Aiden hatte sie all die Jahre versucht, in Sicherheit zu bleiben. Auf verquere Weise war es sogar recht taktvoll von Margot gewesen, das nicht direkt zu sagen. Aber viel hatte nicht gefehlt, und sie wäre damit herausgeplatzt.
Zu guter Letzt gingen sie gemeinsam zum Speisesaal hinunter. In Margots Kleid fühlte Elena sich befangen. Deutlich spürte sie, dass sich mehrere Köpfe ihnen zuwandten. Aber wen die Männer anstarrten, war ihr nicht klar. Margots lila Kleid war mindestens genauso aufregend.
Wie er es versprochen hatte, wartete Ian vor der Tür. Er stand halb mit dem Rücken zu ihnen und unterhielt sich mit einem großen, dunkelhaarigen Mann von ungefähr seinem Alter und ansprechendem Äußeren. Als der Dunkelhaarige Elena bemerkte, wurden seine Augen groß.
Jetzt drehte sich Ian um und trat ihnen entgegen. »Sie sehen fantastisch aus«, sagte er schlicht. »Und Sie müssen Margot sein.« Dass er sie in dem roten Kleid hatte tanzen sehen, erwähnte er nicht. Er reichte ihr die Hand. »Ian Newton. Sehr erfreut.«
Margot lächelte. »Margot Driscoll. Die Freude ist ganz meinerseits, Mr Newton.«
Ian wandte sich an den anderen Mann. »Walter Mann, Margot Driscoll und Elena Standish.«
Es dauerte einen langen Moment, bis Walter Mann die Fassung wiedererlangt hatte. Elena nahm das überrascht, aber auch amüsiert zur Kenntnis. War das schwarze Kleid wirklich so atemberaubend? »Guten Abend, Mr Mann.«
»Miss Standish«, erwiderte er, immer noch etwas verwirrt. Er hatte ausgeprägte, dichte Brauen und extrem dunkle Augen. Er wandte sich Margot zu. »Miss Driscoll.«
»Mrs Driscoll«, korrigierte Margot ihn, lächelte aber. Witwen ihres Alters gab es mehr als genug.
Ian fasste Elena leicht am Arm. »Ich habe mir die Freiheit genommen, einen Tisch für vier zu bestellen. Ich kann doch hoffen, dass Ihnen das recht ist?« Er blickte beide Schwestern an.
»Aber natürlich«, antwortete Margot. Was hätte sie auch anderes sagen können?
2
Margot schritt durch den Speisesaal Richtung Fensterseite, die einen herrlichen Blick aufs Meer bot. Walter Mann war äußerst charmant und bemühte sich auch gar nicht darum, seine Bewunderung für sie zu verbergen. Das vermochte Margot allerdings nicht zu beeindrucken; Situationen wie diese war sie gewohnt.
Sie erreichte den reservierten Tisch, und während Ian für Elena einen Stuhl heranzog, fragte Walter Mann Margot, ob sie lieber aufs Meer oder in den Saal schauen wollte.
»Oh, in den Saal bitte«, antwortete Margot. »Ich liebe das Meer, aber es verändert sich nie allzu sehr. Bei den Menschen passiert da viel mehr.«
»Beobachten Sie gern Leute?« Er sah lächelnd zu, wie sie sich setzte, und nahm dann neben ihr Platz.
Margot lachte. »Dieser Typ ist eher meine Schwester. Sie ist Fotografin von Beruf. Mit einem Auge achtet sie ständig auf den Ausdruck von Gesichtern, auf Licht und Schatten und die Gestaltung von Szenen.«
»Und ist sie gut?« Walter Mann wirkte interessiert.
Margot sah, dass Elena und Ian Newton bereits in ein Gespräch vertieft waren. »Wie aufrichtig soll meine Antwort sein?«
»Oh, habe ich da etwa in ein Wespennest gestochen?« Walter Mann war zu höflich, um zu lachen, aber seine Augen funkelten vergnügt.
»Allerdings. Sie ist nämlich auf dem Sprung, eine sehr gute Fotografin zu werden.« Margot seufzte. »Wenn sie sich nur auch um ihre Gefühle kümmern würde und nicht bloß um ihr technisches Geschick!«
Trotz ihrer Sorge aß sie wenig später mit großem Appetit und warf immer mal wieder einen Blick zu Elena. Ihre Schwester schien ganz im Gespräch mit Ian Newton aufzugehen. So gelöst und lebhaft wie jetzt hatte Margot sie schon lange nicht mehr erlebt. Ähnlich lebensfroh war sie früher gewesen, bevor Aiden sein Land verraten und Elena betrogen hatte. Seitdem hatte sie entsetzliche Angst davor, erneut verletzt zu werden – wem wäre es nicht so ergangen? Sich jedoch jede weitere Liebesbeziehung zu verbieten, das bedeutete zwangsläufig, einen Teil seiner selbst abzutöten.
Was sie selbst betraf, hatte Margot geglaubt, sie würde nach einer angemessenen Zeit der Trauer um Paul jemand anders finden, den sie lieben konnte. Bloß wie lange war »angemessen«? Für sie existierte sogar fünfzehn Jahre nach Pauls Tod nichts, was über eine flüchtige Bekanntschaft hinausging. Sie war so dumm gewesen zu hoffen, irgendwo könnte es vielleicht eine neue Liebe geben, während sie sich zugleich schuldig fühlte, weil sie an eine solche Möglichkeit zu glauben wagte. Doch dann war in all den Jahren einfach niemand aufgetaucht, der ihr etwas bedeutete. Vielleicht erging es halb Europa so, wenn man hinter die Fassade der Menschen schaute und in ihr Inneres vordrang.
Bei Elena verhielt es sich allerdings anders. Sie hatte schlicht keine ungetrübten Erinnerungen an die Zeit mit Aiden. Für sie war alles im Zusammenhang mit ihm schmerzhaft und musste getilgt werden.
Während Margot Walter Mann zerstreut zuhörte, beobachtete sie Ian Newton. Dem Wenigen, was sie aufschnappen konnte, entnahm sie, dass er in Cambridge gewesen war. So viele Verwandte von ihr hatten dort studiert. Darunter ihr Großvater, Lucas Standish, obwohl sie nicht wusste, was sein Spezialgebiet gewesen war – wahrscheinlich Geschichte und Altphilologie. Ihr Vater, Charles Standish, hatte Sprachen und neuere Geschichte studiert, was bei jemandem, der eine Karriere im Auswärtigen Amt anstrebte, praktisch auf der Hand lag. Ihr Bruder Mike hatte sich für Latein und Altgriechisch immatrikuliert, ehe der Krieg dazwischenkam.
Auch Elena war nach Cambridge gegangen und hatte ein Studium der Altphilologie aufgenommen, ganz einfach weil sie für ihr Leben gern lernte. Margot konnte sich gut vorstellen, wie ihre Schwester elegant in einem dieser flachen Kähne saß, für die Cambridge bekannt war, während Ian lässig, einen Stab in der Hand, im Heck stand und das Boot ruhig über den glitzernden Fluss Cam glitt. Kannte Elena Ian vielleicht schon länger, zumindest vom Sehen? Sie nahm sich vor, ihre Schwester zu fragen.
Margot hatte weder in Cambridge noch irgendwo anders studiert. Mit achtzehn Jahren war sie bereits Braut gewesen – und eine Woche nach ihrer Hochzeit Witwe.
Sie bemerkte, dass Walter Mann sie beobachtete. War das etwa Mitgefühl, das in seinen Augen schimmerte? Verdammt noch mal, sie brauchte sein Mitleid nicht! Sie schenkte ihm ein demonstratives Lächeln. Auf derlei verstand sie sich. Darin hatte sie genügend Übung.
Eine Band spielte leise im Hintergrund. Das Stück hatte einen hypnotischen Klang und einen unwiderstehlichen Rhythmus. Es war irgendetwas Amerikanisches. Auf dem Parkett tanzten junge Leute, umhüllt von der Musik und anscheinend weltvergessen. Sie konnte ihre Gesichter sehen, so viele davon auf ihre eigene Weise wunderschön.
Warum sah sie eigentlich nur zu, statt mitzutanzen? Mittlerweile hatten alle an ihrem Tisch gegessen; Zeit, den Abend zu genießen.
Als hätte er ihre Gedanken gelesen, stand Walter abrupt auf. Lächelnd schaute er ihr in die Augen. »Möchten Sie mit mir tanzen? Ihr Kleid ist exquisit und schreit geradezu nach anmutigen Bewegungen. Mit anderen Worten: Sie sind genau das, was ihm zur Vollendung fehlt.«
Margot blickte mit einem schnellen und ungekünstelten Lächeln zu ihm auf. Dass er sie auf diese Weise ansprechen würde, hatte sie nicht erwartet. »Danke. Das ist ein neuer und reizvoller Gedanke. Schließlich ist so Weniges vollkommen.«
»Da muss ich Ihnen widersprechen«, erwiderte Walter leichthin. »Alles hier ist perfekt: das Licht, die Musik, der Hauch von Verzweiflung, als würde das ganze Ambiente sich in Luft auflösen, sobald wir aufhören, es zu genießen. Es ist wie Sonnenschein im englischen April, der deshalb so kostbar ist, weil wir wissen, dass es in spätestens einer Stunde wieder regnen wird. Das Licht wird nicht bleiben, und dann wird es noch kälter sein als zuvor.«
Mit aufrichtigem Interesse musterte sie sein Gesicht.
Er behielt sein charmantes Lächeln unverändert bei. »Und andererseits: Wenn wir hier die ganze Zeit Licht hätten, würden wir es als selbstverständlich voraussetzen und gar nicht mehr wertschätzen.«
Das Lied war inzwischen verhallt, und die Musiker setzten ihre Instrumente für die nächste Nummer an.
Margot stand auf. »Ich würde sehr gern tanzen.« Sie trat einen halben Schritt auf Walter zu.
Er hielt sie ganz leicht in den Armen. Und als die nächste Melodie erklang, war es Margot, als würde sie von einer Strömung fortgetragen. Walter war ein wunderbarer Tänzer und Gott sei Dank feinfühlig genug, um nicht zu sprechen. Margot gab sich einfach dem Rhythmus hin und folgte Walters Bewegungen.
Die Stücke und Rhythmen wechselten, aber das machte nichts aus. Geschmeidig passte Walter sich an und sie mit ihm. Das machte zu einem großen Teil das Geheimnis des Erfolgs aus – nicht nur in der Kunst, sondern auch im richtigen Leben: die Fähigkeit, sich ohne Zögern einem neuen Rhythmus anzupassen.
Margot stieß ein leises, entzücktes Lachen aus.
Er zog sie etwas näher an sich, nur wenige Zentimeter.
Sie lehnte sich in seinem Arm zurück und sah zu ihm auf. Er hatte außergewöhnliche Augen. Lagen darin schmerzhafte Erinnerungen verborgen, die die ihren widerspiegelten, oder bildete sie sich das nur ein? Er hielt sie wunderbar sanft und behutsam. Vielleicht hatte auch er jemanden verloren? Doch wer hatte das nicht? Sie sollten einander noch fester halten, dachte Margot, und sich ganz der Musik hingeben.
Elena tanzte nun ebenfalls. In Ians Armen schwebte sie mit einer Leichtigkeit dahin, als hätte sie ihn schon immer gekannt. Wie Margot hasste sie es, beim Tanzen zu sprechen. Die Konversation lag in den Bewegungen, und über alles herrschte die Musik.
Elena blickte sich im Saal um. Hier waren fast nur Männer: kultiviert, intelligent – und staubtrocken. Einige hatten ein bisschen über den Durst getrunken, wirkten aber lediglich schläfrig. Himmel, hatten sie sich etwa gelangweilt?
Die Musiker ließen die letzten Töne ausklingen und erhoben sich. Offenbar war es mit der Musik vorbei.
Margot, Elena und die zwei Männer kehrten zu ihrem Tisch zurück, wo Ian allen eine gute Nacht wünschte. »Darf ich Sie zu Ihrem Zimmer begleiten?«, fragte er Elena und reichte ihr seinen Arm.
Nachdem sie mehrere Türen durchschritten und den ersten Stock erreicht hatten, blieb Elena stehen und drehte sich zu Ian um. »Danke für einen wunderbaren Abend«, sagte sie lächelnd. Es war mehr als eine höfliche Floskel. So glücklich wie heute war sie seit Jahren nicht mehr gewesen.
»Es hat Spaß gemacht«, erwiderte Ian flapsig, doch seine Augen blieben ernst dabei. »Ich denke, ich sollte Assistent einer Fotografin werden. Das ist unendlich viel befriedigender, als Artikel über Wirtschaftsthemen zu schreiben.«
»Das ist ein sehr unsicherer Beruf«, antwortete Elena ebenso leichthin.
»Das Leben an sich ist sehr unsicher«, konterte Ian. Dann plötzlich fiel alles Humorvolle von ihm ab. »Man sollte sich an das halten, was gut daran ist, und …«
Was immer er hatte hinzufügen wollen, wurde durch ein grässliches Kreischen ein Stockwerk höher übertönt. Für einen Moment erstarrten sie, dann wirbelte Ian herum und rannte nach oben in die Richtung der Schreie, die wieder und wieder durch das Haus gellten.
Elena folgte ihm. Im Laufen fingerte sie die Kamera aus der Tasche. Da musste jemand in höchster Not sein.
Im nächsten Moment blieb Ian abrupt vor einer jungen Frau im schwarzen Kleid und der weißen Schürze eines Zimmermädchens stehen. Ihr Gesicht war aschfahl, und sie hatte sich die Hand auf den Mund geschlagen. Die Tür des Wäscheschranks hinter ihr klaffte auf, und davor lag ein verkrümmter Mann. Der groteske Winkel von Kopf und Genick verriet, dass er tot sein musste.
Aus Ians Gesicht wich alle Farbe. Er legte die Arme um das schluchzende Zimmermädchen und drückte es an sich. Als er sprach, klang seine Stimme halb erstickt. »Kommen Sie mit. Sie können ihm nicht helfen. Schauen Sie nicht hin …« Mit festem Griff führte er die Hotelangestellte um die Ecke, fort von der Leiche.
Elena blieb allein zurück und starrte wie gebannt den Toten an, der aus dem Schrank herausgerollt war, als das Zimmermädchen die Tür geöffnet hatte. Es war ein Mann mittleren Alters von unauffälligem Äußeren. Olivfarbene Haut, etwas schütteres schwarzes Haar. Er mochte aus Italien oder einem anderen südlichen Land stammen. Kannte Ian ihn? War das der Grund, warum er so entsetzt reagiert hatte? Elena zitterte, schaffte es aber trotzdem, eine Aufnahme zu machen, bevor sie die Kamera wieder in der Tasche verstaute. Gewiss, sie war Fotografin, doch vielleicht verstieß sie gegen ein Gesetz, wenn sie eigenmächtig einen Tatort ablichtete.
Jemand ergriff sie schüchtern am Arm. »Signorina … bitte setzen Sie sich …«
Sie drehte sich um. »Mir fehlt nichts, danke. Aber dieser Mann … er ist …« Mit bebenden Nasenflügeln holte sie Luft. »Tot … eindeutig tot. Wer ist das?«
»Das weiß ich nicht.« Der Mann ihr gegenüber war der stellvertretende Geschäftsführer des Hotels. Sie kannte ihn vom Sehen, da er in den letzten Tagen mehrmals an ihr vorbeigelaufen war. »Bitte … ich möchte die Behörden informieren. Das kann kein Unfall gewesen sein. So, wie er daliegt …«
»Nein, natürlich nicht.« Zumindest versuchte der Mann nicht, sie mit Lügen abzuspeisen. »Ich gehe jetzt in mein Zimmer.«
»Fehlt Ihnen wirklich nichts? Soll jemand zu Ihnen kommen?«
»Nein danke. Ich bin mit meiner Schwester zusammen.« Elena bedankte sich noch einmal und lief durch den langen Korridor zurück zu der Stelle, wo Ian in fließendem Italienisch mit dem Zimmermädchen redete. Sein Ton war sehr sanft, doch er war immer noch kreidebleich. Die Knöchel der Hand, die das Mädchen stützte, waren weiß, als kostete ihn diese Geste eine ungeheure Anstrengung. Endlich tauchte eine ältere Hotelangestellte auf und übernahm die Kontrolle über die Situation. Freundlich, aber bestimmt dankte sie Ian und entließ ihn.
Offenbar war die Polizei bereits vor Ort, denn nun traten zwei uniformierte Beamte an Ian heran. Anders als die Frau sprachen sie Englisch mit ihm.
»Nun, Sir, möchten Sie uns schildern, was geschehen ist?«, begann der Ranghöhere der beiden.
Ian erklärte es ihm wahrheitsgemäß, ebenfalls auf Englisch.
»Und diese junge Dame war in Ihrer Begleitung?« Der Polizist blickte Elena an.
Elena nickte. »Ja.«
»Sie kennen diesen armen Mann?« Er deutete auf die Leiche zu ihren Füßen.
»Nein, Sir«, antwortete Ian mit leicht zitternder Stimme, das Kinn vor Anspannung vorgeschoben.
Doch Elena war sich fast sicher, dass er log.
3
Lucas Standish saß in seinem Arbeitszimmer im Sessel und blickte in den Garten hinaus. Das Muster der Blätter vor dem Himmel gefiel ihm jedes Mal aufs Neue. Selbst die im Winter kahlen Zweige hatten etwas einzigartig Zartes. Und jetzt präsentierten sich die Bäume in ihrer ganzen Frühlingspracht.
In diesem Raum sah es aus, wie man es sich bei einem älteren Herrn vorstellte, der das angenehme Dasein eines Pensionärs genoss, nur die außerordentlich vielen Bücher längs der Wände waren vielleicht etwas Besonderes. Lucas war ein ruhiger Mann, der sich mit Literatur und Philosophie beschäftigte. Jedenfalls stellte er es nach außen so dar, auch vor seiner eigenen Familie.
Doch in Wahrheit war er im Krieg lange der Direktor des MI6 gewesen, des militärischen Geheimdienstes. In Gedanken bezeichnete er diese Zeit häufig als den »letzten Krieg«, denn er befürchtete, dass es bald wieder einen geben würde. Inzwischen war er Anfang siebzig und gehörte nicht mehr offiziell der Spionageabwehr an, doch sein Interesse daran hatte keineswegs nachgelassen, und er wusste auch jetzt noch bestens über die aktuellen Geschehnisse Bescheid. Er verfügte über die verschiedensten Quellen und war überdies scharfsinnig genug, all das, was in den Zeitungen zu lesen war, zu einem größeren Ganzen zu verknüpfen, und teilweise auch das, was zwischen den Zeilen stand, die Halbwahrheiten, die eine große Lüge verbargen.
Der einzige Politiker, dessen Urteil er traute, war Winston Churchill. Er kannte diesen Mann persönlich und mochte ihn. Doch Churchill hatte sich schon seit einiger Zeit von der Macht entfernt, und es war nicht damit zu rechnen, dass er sie in absehbarer Zukunft wiedererlangen würde. Diejenigen, die jetzt in Amt und Würden waren, hörten nicht auf ihn; man schien seine Überzeugungen nicht mehr ernst zu nehmen.
Teilweise konnte Lucas diese Skeptiker gut verstehen. Nur allzu gern hätte auch er geglaubt, dass Adolf Hitlers kometenhafter Aufstieg keine Bedrohung darstellte, für Europa nicht und schon gar nicht für England. Doch all seine Instinkte warnten ihn, dass die Gefahr in Wahrheit von Woche zu Woche zunahm. Erst Ende Januar, vor nicht ganz vier Monaten, hatte Hitler mit der Zustimmung einer überwältigenden Mehrheit des deutschen Volkes die Macht an sich gerissen.
Infolge der verheerenden Verluste durch den Krieg waren in ganz Europa neue Ideologien aus dem Boden geschossen. Seit der Ermordung des russischen Zaren verhalf in allen anderen Ländern die Angst vor dem Kommunismus rechten Ideologen zu ungeheurem Zulauf. Hatte Benito Mussolini in Italien zunächst einige Veränderungen zum Guten durchgeführt, wurde sein Regime immer autoritärer, ja momentan schuf er die Grundlage für den Wahnsinn einer Diktatur. Einige der Geschichten, die Lucas gehört hatte, grenzten ans Groteske, doch er wusste, dass sie nur allzu wahr waren und dass den Leuten das Lachen bald vergehen würde.
In Spanien kämpften gegenwärtig mehrere politische Gruppierungen erbittert um die Macht, und niemand wusste, wohin das führen würde.
Die tiefsten Sorgen löste Deutschland bei ihm aus. Der Vertrag nach dem Krieg war einfach zu hart für das Land gewesen. Millionen von Menschen, die nicht für die Ruhmsucht ihres Kaisers verantwortlich gemacht werden konnten, waren ins Elend gestürzt worden. Irgendjemandem die Schuld zu geben hatte keinen Zweck. Wie Lucas das sah, war niemand wirklich frei davon – nicht wegen seines Tuns, sondern wegen seiner Tatenlosigkeit.
Ein leises Klopfen an der Tür riss Lucas aus seinen Gedanken. »Komm rein«, sagte er sofort. Ohne Zweifel war das seine Frau Josephine, die ihn daran erinnern wollte, dass ihr Sohn Charles mit ihrer Schwiegertochter Katherine zum Essen kam und er sich darauf vorbereiten musste. Rein äußerlich brauchte er ein frisches Hemd, während er sich innerlich gegen die Meinungsverschiedenheiten wappnen musste, die es zwangsläufig geben würde, egal, wie eindringlich er sich schwor, sich nicht in einen Streit verwickeln zu lassen.
Josephine kam herein. Sie war so alt wie er, und obwohl sie seit über einem halben Jahrhundert miteinander verheiratet waren, bereitete es Lucas immer noch Freude, sie anzuschauen. Er empfand tiefe Zuneigung und Dankbarkeit für alles, was sie miteinander geteilt hatten. Viele andere Männer hätten sie vielleicht nicht besonders schön gefunden, aber ihm gefiel sie nach wie vor. Die Schönheit lag in ihren Augen, ihrem schnellen Lächeln, in der Lebenskraft, die sie sogar dann verströmte, wenn sie regungslos dasaß. Er wusste, dass ihre Freimütigkeit manche verschreckte, doch er sah darin ein Zeichen für Ehrlichkeit, für Klarheit im Denken und sogar für Frieden mit sich selbst und schätzte es. Seine Enkelin Elena besaß diese Eigenschaft wohl auch, allerdings hatte sie eine Generation übersprungen. In Charles war leider nichts davon zu entdecken.
»Ich weiß«, murmelte Lucas, bevor Josephine etwas sagen konnte. »Sie werden in weniger als einer halben Stunde vor der Tür stehen. Er kommt ja immer pünktlich.« Er wusste nicht so recht, ob das als Lob oder als Tadel gemeint war. Nun, wenn er ehrlich war, freute er sich ganz und gar nicht auf diesen Besuch. Was Politik betraf, waren er und sein Sohn zuletzt ständig in Streit geraten. Natürlich hatte Charles nicht den Hauch einer Ahnung von Lucas’ Aufgabe beim Geheimdienst. Über solche Dinge sprach man nicht einmal mit seinen engsten Angehörigen. Für die Familie war er ein ziviler Ministeriumsbeamter, dessen Tätigkeit zu langweilig war, um auch nur ein Wort darüber zu verlieren. Die Allgemeinheit wusste ja nicht einmal, dass es den MI6 überhaupt gab.
Charles war in den diplomatischen Dienst gegangen und hatte dort glänzende Erfolge erzielt. In vielen europäischen Hauptstädten und sogar in Washington hatte er hohe Ämter bekleidet. Dabei war seine charmante und sehr kluge Frau, die aus Amerika stammte, natürlich von Vorteil gewesen. All das war öffentliches Wissen.
Als Lucas beim Geheimdienst angefangen hatte, war es ihm zunächst schwergefallen, völliges Schweigen über seine Arbeit zu wahren, doch mit der Zeit war ihm diese Geheimhaltung zur Gewohnheit geworden. Auf keinen Fall wollte er seine Familie mit der Wahrheit über seine Tätigkeit belasten, über die Natur der Entscheidungen, die er treffen musste. Je höher er in seinem Amt aufgestiegen war, desto diskreter hatte er vorgehen müssen. »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold« war unter Spionen mehr als ein bloßes Sprichwort, sodass kein Wort darüber nach außen drang, welche Truppen wohin bewegt wurden oder was in welchen Fabriken hergestellt wurde.
Allmählich schien Josephine des Wartens auf eine Antwort überdrüssig zu werden. »Zeit fürs Abendbrot, Toby!«, rief sie fröhlich, worauf der Hund, der bisher zu Lucas’ Füßen gelegen hatte, aufsprang und hinter ihr hertapste. Er verstand eine ganze Reihe von menschlichen Wörtern, und »Abendbrot« gehörte zu den wichtigsten. In seinem Eifer folgte er ihr so dicht auf dem Fuß, dass er ihr unweigerlich gegen die Beine geprallt wäre, wenn sie abrupt stehen geblieben wäre.
Lächelnd erhob sich nun auch Lucas und schritt langsam zur Tür, vorbei am Bücherschrank, der all seine Lieblingswerke enthielt, Titel, die er ausnahmslos gelesen und mehrmals wiedergelesen hatte. Es war viel Lyrik dabei, vor allem zeitgenössische Dichter wie Housman, Sassoon und Chesterton, an denen sein Herz hing. Dazu eine sehr abgegriffene Shakespeare-Ausgabe, die sich bei Hamlet oder Julius Caesar fast schon von selbst aufschlug, sowie ein nicht weniger oft benutzter Dante, dessen Inferno der häufige Gebrauch besonders deutlich anzusehen war. Gerade dieses Werk war für Lucas zeitlos gültig. Wenn ein Mensch begreifen könnte, dass er nicht für seine Sünden bestraft wurde, sondern durch sie, und dass er deswegen nicht zu seiner vollen Entfaltung gelangte – wie grundlegend würde ihn diese Erkenntnis verändern!
Darüber hinaus gab es noch etwas im Bücherschrank, das anzuschauen er nicht immer über sich brachte: ein Foto von Mike, seinem einzigen Enkel. Elena hatte es geschossen, um für Porträtaufnahmen zu üben. Es zeigte einen Neunzehnjährigen in der Uniform der Armee, der mit strahlendem Gesicht in die Ferne blickte. Es war eine der letzten Aufnahmen, die er von sich hatte anfertigen lassen, und hatte ihn auf das Treffendste erfasst mit seiner Herzenswärme und seinem Lebensmut. Umso schmerzhafter war es, sich damit abzufinden, dass er nie wieder nach Hause kommen würde.
Wie so oft blickte Lucas auch diesmal an der Fotografie vorbei. Nicht dass das etwas nützte! Sie hatte sich ihm bis ins kleinste Detail eingeprägt, und er konnte sie sogar mit geschlossenen Augen vor sich sehen. Mikes Abschied hatte er in lebhafter Erinnerung. Wie sehr der Junge seinen letzten Aufenthalt hier genossen hatte! Jede Stunde hatte er ausgekostet, als hätte er gewusst, dass er nicht mehr zurückkehren würde. Doch wenn es in den Krieg ging, hatten alle Männer diese Befürchtung. Jeder hatte Freunde verloren, Menschen, mit denen er aufgewachsen war, und neue Gefährten, mit denen er im Grauen und der Einsamkeit des Kriegs Freundschaft geschlossen hatte. Das war eine Kameradschaft, für die es keine Vergleiche gab. Mike hatte gern wilde, unglaublich alberne Witze gemacht, und er hatte stets eine solche Lebendigkeit versprüht, dass Lucas es einfach nicht glauben konnte, als das Telegramm eingetroffen war.
Spürten alle das Gleiche? Dieses entschlossene Nichtwahrhabenwollen? Diese Verwirrung? Und dann diesen Schmerz, der sich in einen hineinbohrte und einem das Herz, die Seele zerfraß?
Margot hatte ihren Mann in derselben Woche und an derselben Front verloren. Er erinnerte sich an ihr Gesicht, als wäre es gestern gewesen. Manchmal zeigte sich der Ausdruck, wenn sie glaubte, niemand würde sie beobachten. Arme Margot! Sie war immer noch in so vielerlei Hinsicht verloren. Und es gab nichts, was Lucas oder sonst jemand tun konnte. Elena hatte es versucht, und auch Josephine – vergeblich. Nicht einmal Charles, der ihr so nahestand, war zu ihr durchgedrungen.
Lucas unterdrückte einen Seufzer. Einfach jede Familie, die er kannte, hatte jemanden verloren. Das hielt er sich vor Augen, als er den Hausflur durchquerte und die Treppe erklomm, denn er musste geduldig mit Charles sein, dem Sohn, der jetzt so leidenschaftlich verkündete, dass es nie wieder einen Krieg wie den letzten geben durfte. Niemand sollte mehr so um ein Kind trauern müssen wie er. Für Charles war das die einzige vernünftige Lehre, die der Krieg der nächsten Generation vermitteln konnte: nie wieder.
Lucas wusste, dass Tausende dasselbe empfanden. Es musste einen anderen Weg geben, egal, was es kostete. Wer gekämpft hatte und zurückgekehrt war, spürte es in seinem tiefsten Inneren. Man brauchte diesen Männern nur in die Augen zu sehen, um das zu erkennen.
Charles hatte seinen einzigen Sohn verloren. Lucas hatte seinen noch, und wie unterschiedlich ihre Ansichten auch sein mochten, er durfte einfach nicht mit ihm streiten.
Allein schon um Josephines willen, die auch genug über den Krieg wusste. Damals hatte sie einen großen Teil ihrer Zeit in der außerhalb von London stationierten Dechiffrierabteilung der Armee verbracht. Auch wenn er ihr nichts über seine Tätigkeit erzählen durfte, hatte er durchaus Kenntnis über die ihre.
Peter Howard gehörte zu den Wenigen, mit denen er offen sprechen konnte, und sie waren immer noch Freunde. Howard war sein einziger Verbindungsmann beim MI6 und damit sein Zugang zu den Geheimnissen, die er noch kannte, zu den Maßnahmen, an denen er noch beteiligt war. Die Technologie war vorangeschritten, die Codes waren größtenteils geändert worden, aber die menschliche Natur war immer noch dieselbe – mit all ihren Stärken und Schwächen.
Während Lucas sich für den Abend herrichtete, betrachtete er sein Gesicht im Spiegel. Hager war es, markant und auf den ersten Blick asketisch. Erst bei näherem Hinsehen bemerkte man den humorvollen Ausdruck und eine gewisse Zartheit um die Augen.
Wie Lucas schon erwartet hatte, trafen Charles und Katherine pünktlich ein. Katherine war eine auf einzigartige Weise elegante Frau, nicht wirklich schön, doch mit ausdrucksstarken Zügen. Ein bisschen größer als der Durchschnitt und sehr schlank, gelang es ihr stets, anmutig zu wirken und sich ebenso geschmackvoll wie raffiniert zu kleiden. Heute trug sie ein langes, dunkelgraues, leger sitzendes Seidenkostüm mit weichem Futter, das ihrem kantigen Körper schmeichelte. Auch das gehörte zu ihren Fähigkeiten.
Die kühle Abendbrise im Rücken, eilte sie ihren Schwiegereltern entgegen. Zur Begrüßung sagte sie etwas von Vorfreude auf einen angenehmen Abend, strahlte Lucas an und hauchte ihm einen Kuss auf die Wange. Während er die Geste flüchtig erwiderte, stellte er – wie immer – fest, dass er keine Ahnung hatte, was Katherine wirklich dachte.
Dicht hinter ihr stand Charles. »Abend, Vater«, murmelte er lächelnd, Zoll für Zoll der geschniegelte Diplomat: elegant, makellos, der überaus gepflegte Schnurrbart ein schwarzer Strich in seinem Gesicht.
Lucas hielt die Tür weit auf. »Kommt rein! Wie geht es euch?«
Charles trat in den Flur, wo Vater und Sohn einander herzlich die Hand schüttelten, ehe Charles seine Mutter umarmte. Sie drückte ihn plötzlich fest an sich, als hätte sie soeben erst bemerkt, wie sehr sie ihn liebte.
Nach der Begrüßung gingen sie in den Salon. Dort gab es immer noch den türkischen Teppich aus tiefem Rot und Blau, der einer ganzen Generation standgehalten hatte, und das holländische Gemälde von einer Hafenszene, ganz in gedämpften Blau- und Grauschattierungen, das seit Ewigkeiten an seinem Platz hing, länger, als sie alle sich erinnern konnten – wie ein Fenster mit einem Ausblick, der sich nie änderte. Dem Raum haftete eine Aura von Frieden an, eine Zeitlosigkeit, die alles beherrschte. Die von einer Gardine verhüllte Terrassentür führte zum Garten, doch obwohl es schon Mai war und auf den Sommer zuging, war sie geschlossen, sodass man meinen konnte, das Zimmer sei vom Rest der Welt isoliert. Rein äußerlich mochte das zutreffen. Was die Gefühle der Familienmitglieder betraf, war es der Mittelpunkt der Erde.
Sie hatten sich kaum gesetzt, als Charles bereits auf die neuesten Nachrichten zu sprechen kam. »Ich weiß ja, dass er etwas exzentrisch ist«, begann er ohne jede Einleitung, da das Thema in diesen Tagen allgegenwärtig war und alle wussten, dass er nur Oswald Mosley meinen konnte. »Aber er ist der Einzige, der begriffen hat, worum es geht. Wir können es uns einfach nicht leisten, das Geld weiter mit vollen Händen auszugeben. Hat uns die Wirtschaftskrise denn gar nichts gelehrt? Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es doch reiner Wahnsinn, an Wiederbewaffnung zu denken, geschweige denn an den Bau von noch mehr Schiffen. Das können wir uns schlichtweg nicht leisten!«
»Es würde Menschen, die dringend darauf angewiesen sind, Arbeitsplätze verschaffen«, gab Josephine zu bedenken. »Insbesondere auf den Werften.«
»Wir brauchen keine Kriegsschiffe, Mutter«, erwiderte Charles in einem offenbar um Geduld bemühten Ton. »Der Krieg ist lange vorbei, und wir alle haben begriffen, dass sich eine solche weltweite Katastrophe niemals wiederholen darf.« Sein Gesicht verzerrte sich. Das bloße Wort »Krieg« löste bei ihm unweigerlich Erinnerungen an die Verluste aus, die die Schlachten mit sich gebracht hatten, nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für jeden, mit dem er zur Schule oder auf die Universität gegangen, mit dem er in seinem Leben befreundet gewesen war.
Lucas empfand Mitgefühl für seinen Sohn. Er wusste aus eigener Erfahrung, was es bedeutete, von Trauer überwältigt zu sein, doch in diesem Fall konnte er einfach nicht zustimmen. Gleichwohl verkniff er sich jeden Widerspruch, wenn auch nur mit Mühe. Heute sollte es ein Familienessen ohne jenen Zorn geben, der bei ihren politischen Streitgesprächen stets unmittelbar unter der Oberfläche schwelte.
Josephine betrachtete ihren Sohn fürsorglich. »Falls wir sie doch noch brauchen, wäre es allerdings etwas zu spät, erst dann mit der Arbeit daran zu beginnen«, wandte sie ein. »Der Bau von Schiffen erfordert viel Zeit.«
»Und eine Menge Eisen, Stahl und andere Materialien, die sich besser für Häuser oder die Eisenbahn verwenden ließen – oder für die Handelsmarine –, wenn wir denn unbedingt Schiffe bauen müssen«, konterte Charles. Und ohne Lucas anzublicken, fügte er hinzu: »Du hörst eben auf Vater, und er hört auf Churchill.« Er senkte die Stimme und schlug einen milderen Ton an, was ihn deutlich erkennbar erhebliche Mühe kostete. »Churchill ist weg vom Fenster, Mutter. Er ist Schnee von gestern und hängt auch Vorstellungen von gestern an. Ich weiß, dass Mosley manchmal ein bisschen … vulgär sein kann, aber was er sagt, trifft zu einem großen Teil zu. Und sieh dir nur an, was Mussolini für Italien geleistet hat! Wenn man die Infrastruktur richtig hinbekommt, die Straßen und Eisenbahnlinien, die Trockenlegung der Moore, den Bau von Häusern und Straßen, und wenn man die Leute dazu bringt, sich zusammenzunehmen, sodass alle an einem Strang ziehen, dann kann man wahre Wunder vollbringen!«
»Bei den Italienern mag das ja vielleicht klappen …«, murmelte Josephine.
»Es klappt bei ihnen«, beharrte Charles. »Da gibt es kein ›vielleicht‹. Frag Margot, wenn sie wieder zu Hause ist. Sie wird es dir bestätigen.«
»Oder Elena …«, regte Katherine an.
Charles bedachte sie mit einem flüchtigen Lächeln. »Schatz, Elena wird dergleichen nicht einmal bemerken. Sie ist sicher zu sehr mit der Suche nach Gesichtern beschäftigt, die sich als Fotomotive eignen. Neuerdings ist sie ganz versessen darauf, eine große Fotografin zu werden. Da wird sie kaum auf neue Fabriken, die pünktliche An- und Abfahrt von Zügen oder irgendwelche Kunstwerke achten. Ich bin nur froh, dass sie eine harmlose Beschäftigung gefunden hat …« Das war eine Anspielung auf Elenas Desaster im Auswärtigen Amt und diente Lucas als Erinnerung daran, dass Charles die Sache weder vergessen noch irgendjemandem die Blamage verziehen hatte, die er dadurch erlitten hatte.
»Hat eigentlich irgendwer von ihr gehört?«, fragte Josephine, bevor Charles weitersprechen konnte. »Oder von Margot?«
»Dafür ist es noch etwas zu früh«, meinte Katherine schulterzuckend. »Margot hat ein Telegramm geschickt, um zu bestätigen, dass sie heil angekommen sind. Aber das war vor drei Tagen. Ich nehme an, dass sie viel Spaß haben. Amalfi ist eine tolle Stadt und gerade in dieser Jahreszeit der letzte Schrei. Wer etwas darstellt, fährt von dort weiter nach Capri.«
»Dann wird Margot auch dort sein«, sinnierte Charles lächelnd. Er freute sich immer, wenn von Margot und ihrer glanzvollen Ausstrahlung die Rede war. Wie er wusste sie aus eigener Erfahrung, was es bedeutete, jemanden zu verlieren.
»Es gibt keinen Grund, warum sie sich dort nicht vergnügen sollte«, intervenierte Katherine, die Charles’ Bemerkung als Kritik an Margot missverstand. Als Frau, der eindringlich bewusst war, welche Schmerzen ihre Kinder in sich trugen, wünschte sie Margot von Herzen jedes Glück der Welt. Meistens wusste Katherine ihre fürsorgliche Seite allerdings zu verbergen.
Josephine nickte. »Natürlich vergnügt sie sich. Das gehört mit zum Überleben. Und wenn andere Leute sie so sehen, macht ihnen das vielleicht Mut.«
Charles holte Luft, überlegte es sich dann aber offenbar anders. Fürs Erste schien die Diskussion beendet.
Josephine war das nur recht. In der für jeden deutlich erkennbaren Absicht, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, erkundigte sie sich, ob jemand kürzlich einen neuen Kinofilm gesehen hatte und was er davon hielt.
»Dr. Jekyll und Mr Hyde!«, rief Katherine wie aus der Pistole geschossen. »Fredric March ist brillant!« Dann pries sie die Fähigkeiten des Schauspielers und erklärte begeistert, dass er den Oscar für seine Rolle völlig zu Recht verdient habe.
Lucas lächelte. Damit wollte er Interesse signalisieren, konnte aber nicht ganz verbergen, dass ihn die Situation amüsierte. Er bewunderte Katherines diplomatisches Geschick ebenso sehr wie ihren Humor. Hatte Charles begriffen, wie wertvoll Katherine für ihn in seiner beruflichen Karriere war? Wahrscheinlich. Lucas musterte ihn genauer und bemerkte, mit welcher Hingabe sein Sohn das Gesicht seiner Frau betrachtete. Dass er die höchste Achtung vor ihr hatte, sprang geradezu ins Auge. Bestimmt war ihm nicht entgangen, dass sie bewusst ins Gespräch eingegriffen hatte, um ihnen allen zuliebe den Frieden zu wahren. Niemand konnte die Meinungsunterschiede zwischen ihnen beheben, aber Katherine war es gegeben, sie einfach zu ignorieren. War diese Fähigkeit vielleicht das, worauf es in der Diplomatie ankam? Bei Fragen, wo es möglich war, eine gemeinsame Basis zu finden und nicht auf diejenigen Aspekte zu achten, die nicht miteinander vereinbar waren, da ein erzwungener Kompromiss automatisch einen Sieger und einen Verlierer hervorbrachte? Bei einer guten Vereinbarung gab es keine Verlierer.
Bald begaben sich alle ins Esszimmer, nur Josephine verschwand in der Küche. Wie immer bot Katherine ihre Hilfe an, was jedoch abgelehnt wurde – ebenfalls wie immer. Nun, da nur noch Lucas und sie im Haus waren, zog Josephine es vor, selbst zu kochen. Das beherrschte sie nicht nur hervorragend, es machte ihr auch Spaß, obschon ihr für andere Aufgaben eine Haushaltshilfe zur Seite stand.
Wie üblich hatten sie das Beste für ihren Besuch aufgehoben, und wenig später genossen alle einen hervorragenden Hammelrücken mit den ersten Frühlingszwiebeln aus dem Garten.
Es war Katherine, die das Gespräch noch einmal auf Dr. Jekyll und Mr Hyde lenkte. »Eine wirklich außergewöhnliche schauspielerische Leistung«, erklärte sie voller Bewunderung. »Keine speziellen Effekte oder Tricks mit der Maske. Man kann förmlich verfolgen, wie er sich verwandelt. Am Anfang ist er ein freundlicher, harmloser Mann, dann gewinnt die dunkle Seite die Oberhand, und binnen Sekunden, weniger als einer Minute, wird er zum Tier. Alles Menschliche verschwindet, und an dessen Stelle tritt etwas Bestialisches, das ihn völlig beherrscht.«
»So steht es im Buch«, bemerkte Charles. »Aber wie March das im Film macht, das ist wirklich raffiniert. Ich würde gern wissen, wie lange es gedauert hat, bis er so weit war, diese Wirkung zu erzielen.«
Darauf gab Lucas keine Antwort. Unvermittelt hatte er das Gefühl, dass es hier noch um etwas anderes ging als um die Leistung eines Schauspielers oder die Fantasie eines guten Autors. »Glaubst du denn, dass er befürchtete, das könnte auch in ihm selbst stecken?«, erkundigte sich Lucas bei seinen Sohn.
»Was?«, fragte Charles verwirrt.
»Stevenson«, erklärte Lucas. »Weiß Jekyll, dass in ihm ein Monster steckt, über das er keinerlei Kontrolle hat? Ist es das, was Stevenson uns mit seinem Buch zeigen will? Dass ein Mensch so viel wissen und trotzdem völlig hilflos sein kann?«
»Was, um alles in der Welt, bringt dich auf so eine Idee?« Charles’ vorgeschobener Unterkiefer verriet Entschlossenheit. Offenbar witterte er ein Thema, das zu einer tiefschürfenden Diskussion führen mochte und weit über einen bloßen Austausch höflicher Floskeln am Esstisch hinausging.
»Alles Mögliche kann Gefühle auslösen, die sich nicht mehr beherrschen lassen«, entgegnete Lucas. »Ein guter Künstler weiß das, ein guter Politiker ebenso – oder ein guter Demagoge.«
»Ein Widerspruch in sich selbst«, murmelte Josephine kopfschüttelnd. »Demagogie ist von Haus aus nicht gut. Eine Gesellschaft ist nur dann zivilisiert, wenn sie auf gemeinsam vereinbarten Regeln beruht.«
»Das meinte ich in dem Fall nicht«, erwiderte Lucas. »›Gut‹ klingt wohl zu moralisch. Vielleicht hätte ich es anders formulieren und stattdessen ›erfahren‹ oder ›geschickt‹ sagen sollen.«
»Für ein solches Vorgehen lassen sich zweifellos Argumente finden«, sagte Charles und blickte Lucas in die Augen. »Zu bestimmten Zeiten. Jetzt, zum Beispiel. Den Hungernden Nahrung geben, den Obdachlosen eine Wohnung und den Arbeitslosen eine Beschäftigung, damit sie ihre Ehre wiedererlangen und einen Zweck finden, wo keiner da war. Ist das etwa Demagogie?« Er funkelte seinen Vater herausfordernd an.
Mit einem Mal schien es kühler zu werden. Alle beobachteten Lucas. Josephine hielt immer noch die Kuchengabel in der Hand, hatte aber vergessen, wozu sie sie hatte benutzen wollen. Sie kannte Lucas zu gut, um zu glauben, dass er einer Diskussion aus dem Weg gehen würde.
Lucas wählte seine Worte sorgfältig. »Dafür verwendet man seine Macht aber nicht. Die Frage ist, ob diejenigen, die sie einem verleihen, auch eine Möglichkeit haben, sie zu beschränken, wenn man sie missbraucht – und eines Tages wird man sie missbrauchen.«
Charles wich diesem Argument aus. »Wäre es dir lieber, die Leute frieren oder hungern? Es hat doch keinen Sinn, sich den Kopf über die Probleme von morgen zu zerbrechen, wenn man den heutigen Tag nicht überlebt. Jede Frau, der hungernde Kinder an den Rockzipfeln hängen, wird dir das bestätigen, Vater. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du völlig abgehoben von der Wirklichkeit in einem Elfenbeinturm lebst und nicht siehst, was der Krieg und die Wirtschaftskrise angerichtet haben.« Seine Stimme zitterte vor Schmerz und auch Zorn. »Wenn man Menschen in eine Ecke drängt und ihnen ihre Würde und Hoffnung raubt, werden sie früher oder später kämpfen … und zwar bis auf den Tod, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Man sollte den anderen immer einen Ausweg lassen, damit sie ihr Gesicht wahren können. Das ist das Wesen der Diplomatie. Du lebst natürlich als Beamter in deiner sicheren Burg und bekommst von der Lebenswirklichkeit der Menschen außerhalb der Festungsmauern nichts mit.«
Josephine sog scharf die Luft ein, als wollte sie etwas sagen, senkte dann aber schweigend den Blick auf ihren Teller.
Natürlich wusste Charles nichts darüber, was Lucas im Krieg getan hatte, nichts von den vor Sorgen schlaflosen Nächten, weil er Männer auf hoffnungslose, fast schon verrückte Missionen hinter die Feindeslinie geschickt hatte. Nie hatten sie gewusst, ob sie zurückkehren würden – nur allzu viele taten es dann auch nicht. Charles wusste nichts von den geheimen Treffen, dem Warten, den Entscheidungen, die Sieg oder Niederlage bringen, die Menschenleben retten oder kosten konnten. Er wusste nicht, wie oft Lucas mitten in der Nacht mit einem kleinen Boot den Ärmelkanal überquert hatte und in den von den Deutschen besetzten belgischen oder holländischen Gebieten an Land gegangen war – ob zu konspirativen Treffen oder um Desinformationen zu streuen oder den Feind auszuspionieren. Unmöglich zu sagen, ob das schwieriger war als bei Tageslicht, wenn man den Feind sehen konnte – oder wenigstens die Freunde. Was konnte Lucas seinem Sohn antworten, ohne die all die Jahre streng gehüteten Geheimnisse zu offenbaren, zu deren Wahrung er auch heute noch verpflichtet war? Eines, das er sogar vor sich selbst verbarg, bestand darin, dass er all das vermisste – die Leidenschaft, mit der man seine Ziele verfolgte, die Gewissheit, dass man selbst Teil der Schlacht war, kein bloßer Zuschauer. Er sah den Zorn und auch eine gewisse Verachtung in den Augen seines Sohnes. Und Letzteres tat ihm weh.
Mit leiser Stimme, aber in tadelndem Ton meldete sich Josephine nun doch zu Wort. »Du hast nicht den Schimmer einer Ahnung davon, was dein Vater im Krieg getan oder nicht getan hat, Charles. Deine Annahme, du hättest das Recht, über ihn zu urteilen, ist an diesem Tisch fehl am Platze. Wären die Diplomaten etwas fähiger gewesen und bei der Ausübung ihres Berufs sorgfältiger vorgegangen, dann hätten wir vielleicht nie in einen Krieg ziehen müssen. Hast du auch das bedacht?«
Charles starrte sie verblüfft an. Mit einer solchen Schelte hatte er nicht gerechnet, schon gar nicht von ihr.
Lucas ahnte, was jetzt im Kopf seines Sohnes vorging, verzichtete aber darauf, das Thema weiterzuverfolgen. Stattdessen wandte er sich Josephine zu, doch die blickte ihn nicht an.
Das Thema, das Lucas hatte ansprechen wollen, hätte sich um Furcht gedreht, genauer gesagt um die Frage, wie Menschen Ängste dazu benutzen konnten, andere zu manipulieren. Man brauchte einem Menschen bloß Angst einzujagen – nicht nur um sich selbst, sondern um seine Familie –, und er glaubte bereitwillig alles, wenn man ihm Sicherheit versprach. »Ich weiß, dass viele hungern und frieren«, sagte Lucas schließlich und achtete darauf, frei von jedem Anflug von Zorn zu sprechen. »Noch dazu haben die Obdachlosen keinerlei Aussichten auf Arbeit. Wer keine Angst vor der Zukunft hat, hat keine Ahnung, was im Land gespielt wird. Hitler vermittelt den Leuten Hoffnung, und ich nehme an, dass Mosley das auf seine Weise auch tut. Uns allen graut vor einem Krieg, denn wir haben bei Gott am eigenen Leib erfahren, was das bedeutet. Über den letzten sind wir noch lange nicht hinweggekommen. Wir sind anfällig dafür, uns vor Angst in die Hosen zu machen oder unsere Werte zu vergessen und damit einen Großteil jener Eigenschaften, die uns schon einmal gerettet haben. Das alles weiß ich, Charles. Auch ich habe den Krieg erlebt. Und ich weiß, wie leicht es ist zu glauben, dass jemand Bestimmtes an dem ganzen Elend schuld ist und dass wir ihn nur aus dem Weg zu räumen brauchen, damit alles wieder gut wird.«
»Weißt du das?« Charles blickte seinen Vater an, den Kopf leicht zu Seite geneigt. »Weißt du das wirklich? Verzeih mir, Vater, ich glaube dir ja, dass du einiges weißt – theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass du auch nur den Hauch einer Ahnung von der Wirklichkeit hast.«
Jetzt musste Lucas vorsichtig sein. Es war so leicht, sich zu einer unbedachten Reaktion hinreißen zu lassen, wenn die Eitelkeit verletzt war und einem von denen, die man liebte, nicht genügend Respekt entgegengebracht wurde. Betont ruhig lehnte er sich zurück. »Bilde dir nicht ein, du wärst der Einzige, der weiß, was in der Welt los ist, Charles. Das ist eine gefährliche Einstellung. Einen neuen Krieg will ich genauso wenig wie du, nur bin ich mir nicht ganz so sicher, wie er sich am besten verhindern lässt oder welchen Preis ich bereit bin zu zahlen, um …«