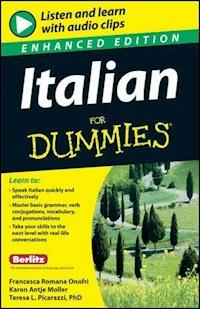Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Einbeziehung des kindlichen Spiels in heilpädagogische Förderangebote hat eine lange Tradition. Unter dem Leitbild der Inklusion wird die Spielpädagogik sogar noch an Gewicht als zentrales Konzept gewinnen: Das Spiel erweist sich dann als Ort der Begegnung zwischen Kindern mit und ohne heilpädagogischen Förderbedarf. Das Buch liefert eine philosophisch basierte und neuropsychologisch orientierte Einführung in das Grundphänomen Spiel. Die Spielentwicklung wird anhand der relevanten Spielformen wie Funktions-, Rollen-, Konstruktions- und Regelspiel differenziert dargestellt. Der Text zeigt auf, wie über die förderdiagnostische Spielbeobachtung und -auswertung Spielformen und -materialien entwickelt und letztendlich heilpädagogische Spielräume gestaltet werden können. Das Buch führt anschließend in etablierte spielbasierte Handlungskonzepte ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 328
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Praxis Heilpädagogik – Konzepte und Methoden
Herausgegeben von
Heinrich Greving
Barbara Schroer/Elke Biene-Deißler/ Heinrich Greving
Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-025890-7
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-025891-4
epub: ISBN 978-3-17-025892-1
mobi: ISBN 978-3-17-025893-8
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Inhalt
Einleitung
1 Eine philosophische Basis: Der Mensch als »homo ludens«
1.1 Das Spiel als grundlegendes Phänomen menschlichen Lebens
1.2 Das Spiel als Identitätsmarkierung
2 Spielrelevante Erkenntnisse der Gehirnforschung und Gehirnentwicklung
3 Spiel: Ein In-der-Welt-Sein
3.1 Elementare Bausteine des Phänomens Spiel
3.2 Die Kinder der Heilpädagogik
3.3 Die heilpädagogische Bedeutung des Spiels
4 Spielentwicklung in ihren typischen Grundformen und Ausprägungen
4.1 Funktionsspiel
4.2 Rollenspiel
4.3 Konstruktionsspiel
4.4 Regelspiel
4.5 Spiel unter erschwerten Bedingungen: Besonderheiten in der Spielentwicklung von Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen
5 Spiel: Das zentrale Medium in heilpädagogischen Tätigkeitsfeldern
5.1 Zwei Förderkonzepte: Heilpädagogische Übungsbehandlung (HPÜ) und Heilpädagogische Spieltherapie (HPS)
5.2 Von der heilpädagogischen Diagnose zur Stundenplanung und -gestaltung
5.3 Überlegungen zum Einzelkontakt von Heilpädagogin und Kind
5.4 Überlegungen zur Anleitung von Eltern im gemeinsamen Spiel
5.5 Überlegungen zur Kleingruppenarbeit
6 Ausblick
Literatur
Sachwortregister
Einleitung
Für den Menschen ist das Spiel ein kulturelles Element, in dem er sich mit den gewachsenen Bezügen seiner Welt auseinandersetzt. Leben und Spiel werden zu einer Lebenskunst verbunden. In allen Lebensaltern kann es als das grundlegende Phänomen menschlichen Lebens verstanden werden. Das Spiel bleibt über die Lebensspanne hinweg als Identitätsmarkierung bedeutend. In der Begleitung von Kindern ist es das vorrangige Medium in der heilpädagogischen Arbeit.
Eine Vielzahl an Spieltheorien, die in ihren Aussagen noch immer unausgeschöpft erscheinen, thematisiert das Grundphänomen Spiel und zeigt seine schillernde Vielseitigkeit. Spielen kann das Kind von Anfang an und dennoch ist sein Tun an Entwicklung und Lernen gebunden, um sich differenzieren, erweitern und stabilisieren zu können. Seine Selbst- und Welterfahrung werden im Spiel in Szene gesetzt, überprüft und neu geordnet. Spielen wirkt sich aktivierend und ordnungsgebend aus. Es ist somit existenzsichernd und -steigernd.
Um seine innere Balance (wieder) zu finden, braucht gerade das Kind mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung das Erleben, dass sein Handeln für es einen konstruktiven Sinn erhält. Im Spiel – unter der behutsamen Führung der Heilpädagogin oder des Heilpädagogen – kann das Kind eine Chance finden, unverbundene Erfahrungsanteile zu einer neuen Gestalt zu verknüpfen, die sich positiv auf seine weitere Entwicklung auswirkt: Das Kind kann zu sich selbst heimkommen.
Spiel ist also die Lebenswelt, die Sprache des Kindes. Hier setzt es sich mit seiner sozialen und dinglichen Umwelt auseinander und drückt seine emotionale Befindlichkeit aus. Das Spiel kann als das zentrale Medium im heilpädagogischen Tätigkeitsfeld der frühen Hilfen im Kindesalter (Frühförderung, Kindertagesstätte) verstanden werden. Im und über das Spiel werden entwicklungsförderliche Impulse in der Begleitung gegeben, wodurch das Kind die anstehende Entwicklungsaufgabe positiv bewältigen kann. Praxisrelevant sind die Handlungskonzepte der »Heilpädagogischen Übungsbehandlung« und der »Heilpädagogischen Spieltherapie«, die von den Grundphänomenen personaler Existenz abgeleitet werden.
In diesem Buch soll das Grundphänomen Spiel theoretisch durchdacht werden. Um dem Wesen des spielenden Menschen, dem »homo ludens« (Huizinga), auf die Spur zu kommen, eröffnen philosophische Überlegungen einen verstehenden Zugang. Ausgehend von einem zeitgemäßen bio-psycho-sozialen Erklärungsmodell erfährt das Spiel eine mehrdimensionale Betrachtung. Im Kontext der biologischen Faktoren wird der Versuch unternommen, neurobiologische/neuropsychologische Erkenntnisse auf das Spiel zu übertragen. Die psychologischen Faktoren umfassen entwicklungspsychologisch fundierte Prozesse, die sich im Wandel der Spielformen abzeichnen. Im Kontext der sozialen Faktoren ist einerseits davon auszugehen, dass sich aus der Eltern-Kind-Interaktion heraus Spielszenen gestalten und das Kind in einer sozial sicheren Bindung sein Spiel entfalten kann. Andererseits sammelt das Kind im Spiel mit anderen soziale Erfahrungen, baut seine Kompetenzen aus und kann hierüber seine Ich-Identität finden. Das Zusammenwirken der einzelnen Faktoren wird deutlich und muss in der Praxis berücksichtigt werden.
Im weiteren Text wird das Spiel in seiner praktischen Relevanz veranschaulicht. Im gemeinsamen Spiel wird mit dem Kind auf der Handlungsebene ein Kontakt aufgenommen, die Begegnung gestaltet und eine tragfähige Beziehung aufgebaut. Eine Auswertung der Beobachtungen – wie spielt das Kind und was spielt es, wo bewegt es sich und was braucht es – erfolgt auf der Metaebene, um heilpädagogische Impulse im Spiel geben zu können. Die Spielthemen des Kindes können aufgegriffen und am Kind orientiert weiterentwickelt werden. Die Spielraumgestaltung, die Auswahl der Spielmaterialien und das methodische Vorgehen sind individuell verschieden. Es kann ein freies Spiel mit offenen, vielseitigen Angeboten bis hin zu einem gelenkten, strukturierten Spiel mit gezielten Angeboten sein: in der Einzelsituation oder im Gruppengeschehen. Im Sinne der inklusiven Bildung bedarf es einer lernzieldifferenzierten Förderung. Nach dem Motto: »gemeinsam spielen – voneinander lernen« wird die konzeptionelle Umsetzung einer heilpädagogischen Kleingruppe vorgestellt.
Coesfeld/Sinn-Fleisbach/Münster, im Juni 2016
Barbara Schroer, Elke Biene-Deißler, Heinrich Greving
1 Eine philosophische Basis: Der Mensch als »homo ludens«
Das Spiel stellt – nicht erst nach Huizinga (vgl. Huizinga 1938) – ein kulturelles Element dar: Spiel erscheint in der Kultur, Spiel wird durch Kultur real, Spiel ist Kultur. Mehr noch: Spiel bekommt eine kulturschaffende Funktion, wird lebendig und gestaltend in Fragen der Dichtung, des Wissens, ja sogar der Philosophie und der Kunst (vgl. Huizinga 1938, 75–278). Im Spiel stellt sich der Mensch somit in die kulturellen Bezüge seiner Welt: Diese werden im Spiel und durch Spielen generell geschaffen, verändert und in einigen Teilen sogar auch zu ernsten Themen und Vollzügen (wie z. B. in liturgischen Handlungen). Im Spiel erfährt das Kind ein Hineinkommen, ein Ankommen in die jeweilige Kultur – so z. B. durch die Rollenspiele. Das Spiel umfasst hierbei sowohl pädagogische als auch kulturprägende und sozialisierende Funktionen – so z. B. in der Entwicklung der Beziehung zwischen den Spielenden, im Kennenlernen von Normen und Werten einer Gesellschaft und vieles andere mehr. Weit über diesen argumentativen Kontext hinaus betrifft das Spiel nicht nur das Kind, sondern hat auch eine »Bedeutung für unsere Lebensführung« (Prange/Strobel-Eisele 2015, 120). Mit Bezug auf Huizinga stellen Prange und Strobel-Eisele fest, dass es »ohne Spiel keine Kultur (gibt)« (ebd.). Eine solchermaßen verstandene Wirksamkeit und Wirkmächtigkeit des Spiels führt dazu, dies sehr weit zu fassen, so dass mit Huizinga dargestellt werden kann, dass hierunter »alle sinndarstellenden Handlungen, in denen wir unser kollektives und individuelles Verständnis des Lebens ausdrücken[, fallen], d. h., wie wir uns und die anderen sehen« (ebd.). So wird auch der erwachsene Mensch zu einem spielenden Menschen: Er erfährt bzw. bringt kreativ im Spiel folgende Merkmale hervor:
Das Spiel ist immer eine freie Handlung. Das Spiel entsteht in Freiheit und erschafft hierbei auch Freiheit. Das Spiel ist nicht wirtschaftlich orientiert, sondern auf sich selbst bezogen – es genügt sich folglich selbst. Zu diesem Spiel gehören immer auch Raum und Zeit, also Spielraum und Spielzeit, in denen es stattzufinden vermag. Zu jedem Spiel gehören Regeln, welche je nach Spielform immer aber auch wieder verändert werden können – wie dieses im Regel-, aber auch im Funktionsspiel der Fall ist. Durch das Spiel erlebt der Mensch sich in der Erfahrung des »Als-ob«: Er tut so, als sei er jemand, jemand anderer, ein Ding, ein Tier, in einer anderen Welt usw. Last but not least: Durch all diese Merkmale erzeugt und erhält das Spiel Formen der Gemeinsamkeit zwischen den Spielenden. Es entstehen Dialog und Nähe (ebd., 121).
Auf diesem argumentativen Hintergrund erscheint »Leben als Spiel« (Schmidt 2005, 23). Leben und Spiel werden zu einer Lebenskunst verbunden, in welcher der Spielende sich mit dem Zufälligen, mit dem Widerständigen, mit unterschiedlichsten Ebenen der (weltlichen, gegenständlichen und menschlichen) Polarität auseinandersetzen muss, um so, mehr oder weniger, zu sich zu finden (ebd., 23–31). Das Spiel verfolgt hier, z. T. ohne es bewusst zu tun, unterschiedliche Ziele: Es ereignet sich an Schnittpunkten von bildenden, philosophischen und auf die Ästhetik bezogenen Handlungsspielräumen (vgl. Reitemeyer 2005, 47). In den Konkretionen des Spiels erfährt sich der Mensch, so zumindest Schiller recht treffend, erst recht als Mensch. Das Spiel stellt sich hierbei als »gestaltete Zeit« (Portmann 1976, 58) dar. Durch das Spiel bekommt die Zeit, welche ansonsten unscheinbar, unmerklich, unstrukturiert – vielleicht durch Arbeit organisiert – verfließt, eine individuelle Kantigkeit. Die Zeit erfährt eine deutliche Bestimmung, eine zutiefst subjekt-, aber auch auf den anderen bezogene Normierung, welche so einzig und allein durch das Spiel entstehen kann. Hierzu noch einmal Schiller: Der Mensch ist dort ganz Mensch, wo er spielt! Der ›homo ludens‹, welcher durch sein Spiel Kultur schafft bzw. wird, wird somit von klein auf in die Möglichkeitsräume des Spieles eingeführt, begeht und erforscht diese, konstruiert sie neu, gestaltet sie aus – und das am besten immer mit anderen, im Dialog mit diesen. Hieran anschließend werden in diesem einführenden Kapitel zwei weitere Aspekte zum menschlichen Spiel näher erläutert:
• das Spiel als grundlegendes Phänomen menschlichen Lebens,
• das Spiel als Identitätsmarkierung, bzw. als Konturierung der Identität.
1.1 Das Spiel als grundlegendes Phänomen menschlichen Lebens
Immer wenn wir als Mensch kreativ, gestaltend und dialogisch da sind, sind wir als mitspielende Menschen unterwegs. Spielen stellt sich somit als »Grundvollzug des menschlichen Daseins« (Zaborowski 2013, 131) dar. Hierzu noch einmal Zaborowski ausführlich:
»Das Spiel ist ein Phänomen, das – bei allen Unterschieden im Detail – in allen Kulturkreisen und geschichtlichen Epochen nachgewiesen werden kann: Immer spielen Menschen auch. Der Mensch ist nicht nur ein politisches Wesen, nicht nur ein Wesen, das über Sprache und Vernunft verfügt, nicht nur homo faber oder homo laborans, sondern auch ein homo ludens, der spielende Mensch, und zwar derart, dass er nicht das eine oder das andere wäre oder zu gewissen Zeiten das eine, dann, zu anderen Zeiten, das andere, sondern in einer derartigen Weise, dass sich in der Regel diese Grundzüge menschlicher Existenz lebendig durchdringen und aufeinander ›abfärben‹: Gerade auch in der Arbeit, im Herstellen oder in politischer Tätigkeit ist der Mensch auch und vor allem dies: ein Spieler.« (Zaborowski 2013, 132)
Durch das Spiel erlebt der Mensch aber auch seine Gegenseite: Elementar wird ihm deutlich, dass es eben nicht nur um Arbeit, um Streben, um Bemühen geht, sondern vielmehr um ein menschliches Miteinander, welches auch in Bezug auf die Endlichkeit spielerisch gedeutet werden kann. Der Mensch erlebt sich spielerisch in Auseinandersetzungen mit Tragik, mit Komik, mit Leben schlechthin (vgl. ebd., 135). In dieser Bedeutung des grundlegenden Charakters des Spiels für den Menschen stellen sich die Elemente der Zeit, des individuell Projektierenden und die Auseinandersetzung mit Alltäglichkeiten als weitere zentrale Merkmale dar.
In einem ersten Schritt kann nun im Hinblick auf den Erlebnisraum der Zeit, also auf die Relevanz für die Begegnungserfahrungen und das Erleben, was sich zeitlich orientiert alltäglich wiederholt, eine grundlegende Bedeutung des Spiels skizziert werden. In dieser Alltäglichkeit wird das Spiel zum Urphänomen, also im Sinne Goethes zu einer Dimension, die »die ursprüngliche Einheit in der Mannigfaltigkeit alles Seienden bezeichnet« (Röhrs 1981, 3). Hierdurch wird zudem angedeutet »dass das Spiel zu den konstitutiven Prinzipien des Lebens gehört, dass das Lebendige trägt und sich quer durch alle Lebensbereiche erstreckt [… somit] erweist [… es] sich sowohl unter ontogenetischem als auch unter phylogenetischem Aspekt als ein grundlegendes Prinzip, in dem das Leben über die jeweilige Bewährung zur Selbstvollendung findet« (ebd., 4). Das Spiel begleitet hierbei die Entwicklung eines jeden Menschen – und ist folglich im Rahmen heilpädagogischer Methoden und Konzepte sehr relevant – von seinen Ursprüngen an, in der Gestalt einer »motivierenden Tätigkeitsform« (ebd., 5). Es spricht diesen in seiner Personenhaftigkeit an, da es neben den intellektuell-kognitiven vor allem auch die sensomotorischen und emotionalen Erlebensbereiche in den Blick nimmt und aufeinander abstimmt. Dieses ereignet sich im Spiel immer in der Bezogenheit auf und in der Auseinandersetzung mit einer Umwelt, welche sich in Objektbereichen (also Spielmaterialien, räumlichen Gegebenheiten etc.) und Subjektgestalten (Spielpartner, Geschwister, Eltern, Pädagogen etc.) dem spielenden Kind zur kommunikativen Verständigung darbietet, denn »Verständigung im Spiel ist das Grundelement der Kommunikation« (ebd., 6). Folglich kann das Spiel auch als eine die Ausformung menschlicher Kommunikation erheblich mitbedingende »primäre Wirklichkeit begriffen« werden (Eichler 1979, 129).
Hierbei realisiert sich das Spiel erneut grundlegend auf dem Hintergrund der Zeit: Spiel stellt sich als gestaltete Zeit dar. Der Mensch erfährt Zeit als Ureigenschaft – Zeit bedingt alles und jeden, alles und jedes (Da-)Sein. Der Mensch ist in einem Zeitraum unwiderruflich eingespannt; er ist genötigt, diesen immer wieder sinnvoll (was immer das auch im Einzelfall konkret bedeuten mag) auszufüllen. Leben erscheint hierbei als realisierende Konkretisierung der Zeit »[…] ist Sinngebung für leere Uhrenzeit« (Portmann 1987, 52). Das Eingebundensein des Menschen in den unaufhaltsamen Verlauf der zeitlichen Dimension, des Vollzuges unwiederbringlich verrinnender Augenblicke, Stunden und Jahre stellt ihn von Anbeginn seines Daseins vor die Aufgabe, diese, als die Möglichkeit Sinn zu erfahren, immer einmal wieder lebendig werden zu lassen. Der Mensch erlebt den Vollzug der Zeit in der Wandelbarkeit allen Seins:
• Blumen wachsen, blühen, verwelken;
• die Länge der Tage, die Sonnendauer nimmt zu und wieder ab;
• die Jahreszeiten gestalten die Natur in ständig wechselnden Farbspielen;
• nicht zuletzt ist auch der Mensch selbst der Verwandlung unterworfen: Er erlebt sich als Geborener, sich Entwickelnder, sich Verändernder und Sterbender.
Die vielfältigen Zeitgestalten erscheinen folglich als integrierende Phasen und Aufgaben einer kontinuierlichen Entwicklung, sie werden erfahrbar und »fassbar durch das sinnlich Wahrnehmbare« (Portmann 1987, 52). Der Mensch erlebt sich geformt und gestaltet durch die Beziehungen zur Außenwelt, welche bei ihm immer einmal wieder eine (seine) innere Welt grundlegen und ausformen. Diese innere Welt erscheint ihm als Identität, als Selbstbewusstsein, wird von ihm als eine solche erfahren und weiter konturiert. Im Verlauf einer permanenten Ausdifferenzierung dieser Innerlichkeit, durch intensivere Beziehungen zum Außenseienden, kommt es im Laufe der Menschheitsgeschichte »[…] zu lustbetontem Verhalten, das nicht unmittelbar dem Zwang der Lebenserhaltung dient – es begegnet uns zweckfreies Tun – zweckfrei, aber nicht sinnlos – es begegnet uns erlebtes […] Spielen« (ebd., 54). Hierbei lässt sich das Spiel als sehr freies Erleben der Zeit, letztlich als »erfüllte Zeit« (ebd.), also als Kairos definieren. In dieser gestaltet der Mensch sein Dasein mit einem Spielpartner, auf dem Hintergrund einer sinnlich und sinnvoll wahrnehmbaren Wirklichkeit, immer wieder neu aus. Die Vergangenheit der spielenden Personen wirkt hierbei auf ihr aktuelles Spiel ein, welches in seiner Vergegenwärtigung eine Zukunft für beide (oder auch mehrere) grundlegt und entwirft. Eine Zukunft, welche ohne die Ausgestaltung in gerade diesem Spiel vielleicht anders verlaufen würde – auch dieses kommt in den Rollenspielen der Kinder immer wieder deutlich zur Geltung. Das Spiel kann in diesem Kontext also auch als »Lebensversuch« (Hillebrand 1987, 96) gelten, in welchem immer einmal wieder neu ein Experiment hinsichtlich der subjektiv-sinnvollsten Gestaltung der eigenen Entwicklung (und somit auch der Beziehung zu anderen) versucht wird.
In einem zweiten Schritt lässt sich das Spiel aber auch als individuelles und subjektives Projektionsfeld darstellen: Abgehoben vom freien Vollzug des Spieles werden diesem bestimmte Funktionen zugeschrieben, von denen die wichtigsten die Entfaltung und die Ausformung der je altersgemäßen Fähigkeiten sein dürften: In sich ständig wechselseitig vollziehenden Beziehungsschleifen hält es die Voraussetzung für die Entwicklung der Sozialisation und Enkulturation bereit (s. o.) (Röhrs 1981, 8/9). Der spielende Mensch – mithin primär und häufig leider meist nur das Kind – erfährt das Spiel somit als Möglichkeit, mit welcher notwendige Elemente des Lebensvollzuges erfahren und eingeübt werden können. Vergangene Erfahrungen und die eigene Geschichte werden hierdurch in ihrer individuellen Ausprägung projiziert, von den Spielpartnern in ihrer je individuellen Subjekthaftigkeit wahrgenommen, aufgegriffen und in einem kommunikativen Vollzug des gemeinsamen Spielens verändert. So gesehen ereignet sich ein sich ständig erweiternder Zuwachs in der Erfahrung und Handhabung gesellschaftssystemischer Lebensmechanismen und (diese zum Teil bedingend) interindividueller Begriffsbildungen durch das Spiel.
Diese Prozesse vollziehen sich zwar in dem, was der Mensch als Alltäglichkeit wahrnimmt, dennoch stellen sie diese Alltäglichkeit aber auch deutlich in Frage, so dass das Spiel in einem dritten Schritt als Fragestellung des Alltäglichen gelten kann:
Ein grundsätzliches Merkmal eines jeden Spieles besteht in der »Kontrastwirkung als scheinbare Randgegebenheit, die aber von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von relativer Freiheit ist« (Röhrs 1981, 15). Das Spiel ereignet sich also als Begleitelement des Lebens, dient aber dennoch der Entwicklung der Lebensfunktionen, welche sich erst aufgrund dieses teilweisen Ausklinkens aus der Ernsthaftigkeit des Lebens in immer neuen Variationen und Möglichkeiten entwickeln können. Dieses Grundmerkmal des Spiels lässt sich also in dem »Wechselbezug zwischen dem scheinbar zweckfreien Handeln und dem Vorvollzug partieller Lebensfunktionen [erkennen]« (ebd.). Der Charakter des Spiels zeigt sich somit in dem Gefühl der Wahrnehmung des »Als-ob« (s. o.), welches immer den freien Vollzug, also immer auch den Abbruch (aber nicht das Scheitern!) des Spiels mit einschließt. Das Spiel ereignet sich hierbei erneut als Experimentierfeld, welches den schmalen Grat zwischen spielerischem Sein und nichtspielerischem Schein begehen und neu festlegen muss. Hierbei erprobt sich der spielende Mensch selbst, ohne dass hierin »die Notwendigkeit des existentiellen Vor- oder Nachvollzugs des Erprobten eingeschlossen wäre« (ebd., 16). Dennoch aber hält das Spiel, aufgrund seiner subjektiv erfahrenen Wirklichkeit, die Möglichkeit der Bewährung des Erprobten offen, ohne dass diese freilich im Spielprozess erzwungen werden könnte.
Die Welt des Spiels und die Welt des Lebens stehen somit in permanenter Wechselwirkung, sind voneinander abhängig, ohne hierbei aber ihren spezifischen eigenständigen Charakter (also den des Spiels und den der Welt) aufzugeben. »Der ›Spielkreis‹ ist Glied des ›Lebenskreises‹, so dass beide sich wechselseitig beeinflussen und nicht beziehungslos einander gegenüber oder gar gegeneinander stehen« (ebd.). Eine Kommunikation zwischen diesen beiden Welten ist somit immer intendiert und in jedem Spiel neu zu gestalten, wobei jeder Spieler seine Alltäglichkeit infrage stellen können muss, um zu einer gewissen Selbstdistanz, also zu einer Loslösung von sich selbst und hin zu einem Weg auf den anderen zu und somit zu einer Veränderung seines Selbst- und Welterlebens zu erlangen. Dieses wird an Abbildung 1 deutlich.
Abb. 1: Beziehung zwischen Spielkreis und Lebenskreis
Das Spiel kann also nur dann als Spiel betrachtet werden, »sofern es […] die Spieler zu einer Gemeinschaft bindet, damit aus einer anderen vorhandenen löst« (Röhrs 1981, 17). Für die heilpädagogisch Tätigen bedeutet das, dass sie ihr Erleben des Spieles, ihr Bild der spielerisch-verspielten Wirklichkeit hinterfragen und immer wieder neu erkennen sollten, um so den grundlegenden Charakter ihrer Spielmöglichkeiten und Spielvarianten im Zusammensein mit dem gegenüber seienden Menschen wahrzunehmen. Sie können sich hierbei folgende Frage stellen und sie gegebenenfalls zu beantworten suchen:
• Wie erlebt der andere Mensch eine gemeinsam zu gestaltende Zeiteinheit?
• Welche Erfahrungen hat er gegenüber seinem Spielpartner bislang mit dem Spiel gemacht?
• Wie projiziert er diese Erfahrung auf das nun zu realisierende gemeinsame neue Spiel?
• Wie wirkt das Herausgenommenwerden aus den alltäglichen Lebensvollzügen im Spiel auf den Spielpartner (gegebenenfalls verunsichernd, verängstigend und vielleicht auch beflügelnd)?
• Wie wirkt das Spiel auf die alltäglichen Lebensvollzüge (wie der Alltag in der Familie, in der Schule etc.) zurück?
• Ist vom Spielpartner eine Transferleistung vom Spiel zur nichtspielerischen Wirklichkeit zu leisten oder muss diese vielleicht durch andere pädagogische Maßnahmen angebahnt werden?
• Wie erfährt sich der/die heilpädagogisch Tätige im Spiel (als Mitspieler oder als Mitvollziehender eines irgendwie gearteten Berufsauftrages)?
• Wie erlebt der/die heilpädagogisch Tätige das Spiel (als Freiraum gegenseitigen Lebensvollzuges oder als pädagogische Methode)?
• Wie verbindet der/die heilpädagogisch Handelnde den Berufsauftrag mit den Grundelementen und Grundgedanken des Spieles?
1.2 Das Spiel als Identitätsmarkierung
Der Mensch gestaltet sich durch das Spiel selbst: Das Spiel ist somit im Letzten eine »kreative Erwiderung des Menschen auf die Zufälligkeit« (Marsal/Dobashi 2008, 33). Der Mensch erlebt sich immer auch als in das Leben und die Welt »Geworfener«, als in die Gegenwart einer kaum zu kontrollierenden Welt Hinausgesetzter. Dieses erfährt er erst recht in den Ausprägungen postmoderner Beliebigkeiten, in denen scheinbar alles möglich und doch vieles unmöglich ist – nur dass der Mensch selten einmal das eine vom anderen zu unterscheiden vermag. Auf diesem Hintergrund definiert der Mensch sich durch das Spiel bzw. die Gegebenheiten der Welt, indem er sie hierdurch fassbar, greifbar und vielleicht sogar begrifflich zu fassen vermag. Mit Bezug auf Nietzsche definieren Marsal und Dobashi hierbei »das Leben als künstlerisches Spiel« (ebd., 37). Durch diese Form, sich selbst im Spiel an die Welt zu geben, bzw. die Welt in Teilen durch das Spiel zu gestalten, kommt es zu einer Selbst- und Weltkonstruktion der Spielenden: »Um der Zufälligkeit nicht anheim zu fallen, wird sie in das Spiel hineingenommen, aufgesucht, als Möglichkeit vorweggenommen oder – aus einer innerlichen Größe heraus – akzeptiert […]. Spiel ist also mit ›Vision‹, ›Gefahr‹, und ›Anstrengung‹ verbunden […]« (ebd., 39 f.). In der Art des Spielens, in der kreativen Auseinandersetzung mit Zufälligkeit entsteht ein Verhältnis des Menschen zu eben dieser: Es gelingt ihm eventuell mehr und mehr, seine eigene Positionierung in den Zeiten des Unzuverlässigen, des Ungenauen zu kartieren, um sich (zumindest für die Momente und Augenblicke eines gelingenden Spieles) einer Nichtzufälligkeit bewusst zu werden. Um die Vernetzungen von Spiel und Identität näher zu fokussieren müsste es daher zu einer »Anthropologie ludischer Selbstverhältnisse« (Ferrin 2013, 109) kommen – wobei Ferrin sich hierbei auf die Art und Weise der Gestaltung eines Avatars in Bezug auf Computerspiele bezieht. Aber dennoch: Wie sich ein Mensch durch das Spiel als Kulturseiender und Kulturgebender, hierbei seine eigene Identität stets neu Schaffender versteht, müsste deutlicher in die Fassung anthropologischer Grundaussagen zum Menschen eingepasst werden.
Einige Positionierungen hierzu hat schon Scheuerl in seinen Untersuchungen über das Wesen bzw. die pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen des Spiels formuliert (vgl. Scheuerl 1994). Hierin erläutert er unterschiedlichste Themen, um dem Wesen des Spieles als identitätsmarkierendes Szenario beizukommen: so das Moment der Freiheit, das Moment der inneren Unendlichkeit, das Moment der Scheinhaftigkeit, das Moment der Ambivalenz, das Moment der Geschlossenheit, wie auch das Moment der Gegenwärtigkeit (vgl. ebd., 67–102). Auf diesem Hintergrund sollen im Folgenden drei Punkte herausgegriffen werden, um die identitätsstiftende Funktion des Spieles beispielhaft zu konkretisieren:
• Freiheit und Spiel,
• Ambivalenz und Spiel,
• Glück und Spiel.
Wenn die Freiheit als die »Pflicht zur subjektiven Entscheidung« (Ziethen 1988) bezeichnet werden kann, ist das Spiel grundsätzlich als freies Handeln zu betrachten, da sich hier einzelne Subjekte aufeinander beziehen, um in ihrer je eigenen individuellen Entscheidung festzulegen, was, wie und auf welchem Hintergrund sie miteinander spielen möchten. Ein gefordertes, aufgetragenes oder gar befohlenes Spiel ist somit »kein Spiel mehr« (Huizinga 1958, 15). Im Spiel ereignet sich daher also einerseits das »Freiheitsbedürfnis« (Hildebrand 1987, 90) des Menschen. Andererseits führt es den Menschen aber auch erst zum Erlebnis des Freiseins, lässt es dieses grundlegend selbstgestaltend einüben und immer wieder neu variieren, so dass es auch als »frei gewählte Tätigkeit schöpferischen Charakters« (ebd., 98) beschrieben werden kann. In dieser hinterfragt und bestimmt der Mensch sein Verhältnis zum Dasein der anderen und zur Welt immer wieder neu.
Das Spiel ist infolgedessen in seinem Vollzug frei von allen Ziel- und Zwecksetzungen, die außerhalb dieses Spieles liegen bzw. an dieses Spiel herangetragen werden (vgl. Scheuerl 1981, 42). – Oder es sollte es zumindest sein, wobei gerade in der professionellen pädagogischen Anwendung des Spielens Probleme auftreten können, da es hierbei darauf ankommt, den schmalen Grat zwischen methodischer Strukturierung und freier Gestaltung zu begehen. Weiterhin ist das freie Spiel durch das Moment der »inneren Unendlichkeit« (ebd.) gekennzeichnet, die auf die fortwährende Wiederholung des Spielgeschehens hindeutet, welches um seiner selbst willen vollzogen wird. Streben somit bestimmte Bedürfnishandlungen ganz bestimmten, außerhalb ihrer selbst liegenden Zielen zu (wie dieses zum Beispiel beim Arbeiten oder beim Erfüllen bestimmter Leistungen der Fall ist), ist das Spiel primär zweckfrei und will in diesem Erleben des Ungebundenseins einen ewigen Vollzug erreichen. Das Spiel »strebt […] nach Ausdehnung in der Zeit« (ebd.). Hierbei ist den Spielenden die Aufgabe gestellt, diese Zeit als die ihrige wahrzunehmen. Sie müssen hierbei Zeitstrukturen als solche realisieren, und zwar im Erleben ihrer je eigenen Freiheit, in der Beziehung des Freiseins des je anderen, wobei beides kreativ auszufüllen ist. Ein weiteres Strukturmoment des freien Spiels ist dasjenige der »Scheinhaftigkeit« (ebd.): Es ist nur scheinbar herausgehoben aus dem kontinuierlichen Verlauf des Lebens. Es ist in Wirklichkeit eng mit diesem verwoben und wirkt auf diesen zurück. Das Spiel kann dieses aber nur deshalb in solcher Intensität leisten, da es seine »besondere Spielqualität auf einer eigenen, sich von der sonstigen Realität abhebenden Ebene [erreicht]« (ebd.). Spielende sind also immer wieder vor die Aufgabe gestellt, die Wanderung zwischen den Welten der Realität und der spielerischen Illusion zu wagen und zu konkretisieren. Sie sind dazu aufgefordert, in freier Entscheidung die eine Seite der anderen vorzuziehen, die jeweiligen Ebenen und Sichtweisen hierbei zu variieren und dieses im gemeinsamen Vollzug spielerisch zu gestalten.
Im Spiel treten also freie Partner in der Durchführung und im Erleben und Gestalten der ihr eigenen Freiheit in eine Beziehung, welche gerade erst durch diese zu einem Mehr an Freiheit führt. Hierdurch verwirklichen sie ihr Bedürfnis nach dieser Freiheit, indem sie nicht nur mit etwas spielen, sondern vielmehr spielt dieses Etwas auch mit ihnen. Hierdurch kann es zu einem Prozess der gegenseitigen Dynamikentwicklung und Dynamiksteigerung im freien Spiel kommen, in welchem immer wieder neue Varianten und Variationen die Spieler vor immer neue Aufgaben ihrer je eigenen Freiheitsdefinition stellen. Diese Konfrontation mit der eigenen Freiheit bindet den spielenden Menschen in freiheitlicher Selbstbestimmung letztlich an sich selbst. Es wirft ihn aber auch auf seine Existenz zurück und veranlasst ihn dazu, dieses spielerisch reflektierend wahrzunehmen und gegebenenfalls umzudeuten (vgl. Schäfer/Schöller 1973, 95). Hierbei ist er aber immer auch auf das mitspielende Gegenüber angewiesen, so dass sich das Erlebnis der Freiheit nur im kommunikativen Dialog mit diesem Anderen zu realisieren vermag.
In einem zweiten Punkt kann nun näher auf das Wesensmerkmal der Ambivalenz (also der Widersprüchlichkeit) im Kontext des Spieles eingegangen werden. Das oben skizzierte Phänomen der Freiheit reflektierend kann hierzu festgestellt werden, dass diese, wenn sie im Spiel erfahren wird, immer auch mit »der Bindung gekoppelt ist […] Spielen ist immer ein Handeln unter Bedingungen, sonst verflüchtigt sich sein Charakter und wir haben nicht Spiel, sondern ›Spielerei‹ vor uns« (Hildebrand 1987, 98). Die miteinander Spielenden erleben sich in ein regelhaftes Umfeld eingebunden, übernehmen Elemente hieraus in ihr Spiel, entwerfen Regeln, üben sich in diesen und übertragen sie gegebenenfalls auf ihr außerspielerisches Dasein. Durch diesen ständigen Wechsel zwischen Freiheit und Bindung erfahren die Spieler die Ambivalenz des Spieles, wie aber auch den stetigen Wandel ihres je eigenen Daseins. Sie müssen immer wieder realisieren, wie ihre Identität hierin begründet ist, wie sie aber auch hierauf reagieren und sich somit weiterentwickeln können.
Ein zweites Moment der Ambivalenz drückt sich in der Vereinigung von Ernst und Unernst im Spiel aus. Dieses erfahren die Spielenden und müssen es gleichermaßen aushalten. Sie sind also permanent vor die Aufgabe gestellt, sich »die Scheinhaftigkeit des Spieles […] bewusst zu machen und dennoch das Ganze als […] Zustand einer äußerst wirksamen Wirklichkeit zu erleben […]« (Hildebrand 1987, 110). Die Verwandlung von ernsten in unernste Momente (und umgekehrt) ereignet sich immer wieder im Spiel mit einem Handlungspartner, so dass sich als ein drittes Merkmal dieses ambivalenten Charakters des Spieles die Wahrnehmung eigener Interessen und Wünsche im Spiel mit dem Anderen beschreiben lässt: Manche Spielziele lassen sich eben nur mit einem Spielpartner erreichen. Durch den spielerischen Vollzug dieser Tatsache kommt es zum Aufbau einer »Binnenspannung« (Scheuerl 1981, 43) im Spiel, welche durch den ständigen Wandel von Spannung und Lösung gekennzeichnet ist. Diesen müssen die Spieler im kommunikativen und interaktiven Austausch immer wieder neu zu realisieren in der Lage sein. Der spielerische Vollzug stellt sich also folglich durch seinen »antithetischen Charakter« (Huizinga 1958, 52) dar, indem sich kommunikative Spannung und spielauflösende Unsicherheit wechselseitig bedingen und immer wieder neu ausgehandelt werden müssen. Das kann zu einer Wahrnehmung und Entwicklung der Identitäten der Spielenden beitragen. Diese müssen diese Ambivalenz aushalten, denn in dem Moment, in dem sie sich »[…] in Eindeutigkeit wandelt, erlischt das Spiel« (Scheuerl 1981, 43).
Als dritten und letzten Punkt dieses einführenden Kapitels können die Verhältnisse von Glück und Spiel skizziert werden: Glücksmomente können als Erfahrung des Getragenwerdens sowie als Erlebnisse der individuellen Ganzheit des Lebens beschrieben werden. Ein glücklicher Mensch erfährt sein Dasein als sinnvoll eingespannt in einen wechselseitigen Vollzugrahmen allen Daseins, an dem er in seiner umfassenden Personhaftigkeit kreativ teilnimmt. Spiele können hierbei als »Spielräume des Glücks« (Höhler 1987, 108) erfahren werden, indem der Spielende im Mitsein zu sich selbst gelangen kann. Das Erleben eines spannenden Spieles im freiheitlichen Vollzug stellt also immer wieder einen Moment geglückten und glücklichen Lebens für alle Beteiligten dar. Dieses vermag sich in einem intensiven Selbst- und Weltverstehen aufleuchtend kundzutun. Dieses lustvolle Empfinden des Seins bereitet den Spielenden, hierbei die Welt genießend, auf diese vor. Das Außen wird nun nicht mehr nur als Bedrohung der eigenen Identität erlebt, es wird vielmehr zum Spielball, mit dem die eigene Entwicklung jonglierend entfaltet und erlernt werden kann. »Spielen ist (somit) eine Schule des Glücks« (ebd., 111) – in welcher jeder Spielpartner – und vielleicht hierbei gerade der Erwachsene – mehr und mehr erfährt, was es bedeuten kann, glücklich zu sein.
Das aktive Erleben des Eintauchens in die Welt des kreativ-kommunikativen Spielgeschehens führt alle Spielpartner hierbei auf den Weg gegenseitiger und voneinander abhängiger Lebensgestaltung. Diese sollte nun nicht – auch nicht in der methodischen Anwendung des Spiels in der Pädagogik, obwohl dieses ein recht hoher Anspruch ist – in verplanten Spielverläufen angestrebt werden. Hierdurch kann das Moment der Selbsterfahrung glücklos verloren gehen, da der Raum selbständiger Daseinsgestaltung eingeengt wird, denn »wer nicht Spiel-Raum hatte, der ist unsicher bei der Gestaltung seines Lebensraumes« (Höhler 1987, 114). Dennoch ist es pädagogisch bedeutsam, dass das Kind diese Spielräume gegebenenfalls erst erlernen muss. Die Markierung und das Erfahren gegenseitiger Identitätsentwicklungen kann demnach im professionell gespielten Spiel immer nur auf dem Hintergrund dialogischer Daseinsgestaltung angestrebt und umgesetzt werden.
Das Spiel stellt sich also als »[…] umfassende Lebensmacht (dar), weil es alle Schichten des Menschen beschäftigt und ergreift« (Höhler 1987, 120). Dem spielenden Menschen glückt hierbei eine Überwindung des Geknechtetseins durch die Objekte, aber auch durch die Zufälligkeiten des Daseins. Er wird frei zum subjektiven Welterleben, wobei ihm das Spiel »die Erlaubnis zur Subjektivität« (Höhler 1987, 123) erteilt. Hierbei kann das Glück als »Vollständigkeitserlebnis« (ebd., 128) benannt werden, welches durch das Spiel immer wieder eingeübt werden kann. Für den und die heilpädagogisch Tätigen ergeben sich, wenn die Realisation der eigenen und auch fremden Identität im Spiel wahrgenommen und zum Ausgangspunkt des Handelns gemacht werden, unter anderem folgende Fragen:
• Ist der mitspielende Mensch dazu in der Lage, den Raum der Freiheit wahrzunehmen und auszuhalten?
• Ist der/die heilpädagogisch Tätige dazu fähig, ungebunden von konkreten Zielvorstellungen und in Freiheit zu spielen?
• Gelingt es dem/der heilpädagogisch Tätigen, sich im Spiel mit verschiedenen Partnern immer wieder neu auf deren Lebenswirklichkeiten einzuspielen?
• Gelingt es dem mitspielenden Menschen, die Spannung der Ambivalenz im Spiel auszuhalten?
• Ist der/die heilpädagogisch Tätige dazu in der Lage, mit dem Partner ein spielerisches Spannungsverhältnis aufzubauen, in welchem sich beide als kreativ Tätige erleben können?
• Wie nimmt der gegenüber seiende Spielpartner Glück wahr, wie äußert er seine Glücksmomente?
• Gelingt es dem/der heilpädagogisch Tätigen, das Glücksempfinden des Mitspielers wahrzunehmen und sein Glück für diesen erfahrbar werden zu lassen?
• Erlebt der Spielpartner das Spiel überhaupt als beglückend?
• Ist es durch das gemeinsame Spiel von heilpädagogisch Tätigen und Spielpartnern möglich, neue Glücksmomente auch im Außerspielerischen zu entdecken?
Diese Fragen werden nun in ersten Ansätzen im Hinblick auf die heilpädagogische Relevanz des Grundphänomens Spiel im Weiteren ausgeführt.
2 Spielrelevante Erkenntnisse der Gehirnforschung und Gehirnentwicklung
Aktuell gibt es mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Zugangswege, die Funktionen des Gehirns im Hinblick auf die Gestaltung des menschlichen Bewusstseins zu beschreiben: Eine Position – man könnte sie eher die klassische Position der Neurologie nennen – bezeichnet das Gehirn als Konstrukteur. Hierbei werden dem Gehirn und den neuronalen Schaltkreisen die grundlegenden Funktionen zur Entstehung des menschlichen Bewusstseins (nahezu losgelöst von den übrigen Teilen und Bereichen des Körpers) zugeschrieben. Ein zweiter, hiervon deutlich zu unterscheidender, Beitrag bezeichnet das Gehirn eher im Rahmen einer phänomenologischen und ökologischen Beschreibung und Betrachtung, in welcher das Gehirn eine Funktion unter vielen aufnimmt und hierbei dafür zuständig ist, die Beziehungen des Menschen zu seiner Umwelt zu gestalten. Eine dritte Position schließlich gibt dem Gehirn keine intensive Funktion zur Entwicklung des Bewusstseins – diese käme eher dem Unbewussten zu. Im Folgenden werden vor allem grundlegende Erkenntnisse der ersten beiden Positionen skizziert, weil diese unseres Erachtens dafür zweckdienlich sind, Entwicklungspotentiale des Menschen (hier vor allem des Kindes) im Hinblick auf das Spiel zu veranschaulichen.
Da in dieser kurzen Hinführung nicht alle Funktionsweisen des Gehirns beschrieben werden können, mögen im Hinblick auf die eher konstruktorientierte Begründung des neuronalen Systems Hinweise zum Lernen, zur Gedächtnisentwicklung bzw. zur Plastizität des Gehirns genügen (vgl. Amthor 2013, 219–251). Die Lernfähigkeit bzw. die Gedächtnisentwicklung des Menschen dient dazu, sich unterschiedlichen Umwelten anzupassen und das Verhalten im Hinblick auf diese Umwelten zu gestalten und zu verbessern. Vor allem im Rahmen der Anpassung der menschlichen Entwicklung bzw. im Hinblick auf eher klassisch zu beschreibende Lernprogramme ist hierbei das Gehirn zentral (vgl. ebd., 219 f.). Nach der Geburt modifiziert das Gehirn sich vor allem im Hinblick auf die Größe und Struktur des Nervensystems. Dieses vollzieht sich bis weit in das Erwachsenenalter des Menschen hinein – danach »finden Veränderungen nicht mehr durch die Vermehrung von Nervenzellen statt, sondern indem sich die Synapsenstärke verändert« (ebd., 220). Grundlegend ist hierbei festzustellen, dass der Lernprozess des Menschen darin besteht, dass die Reaktionen auf Gegebenheiten durch die Erfahrungen bzw. durch vorangegangene Erfahrungen mit diesen Gegebenheiten modifiziert werden.
»Es gibt zwar Mechanismen, durch die sich die Nervenreaktionen ändern: Anpassung (oder im Fall von sich wiederholenden Reizen Gewöhnung) und Verstärkung (im Fall von sich wiederholenden Reizen Sensibilisierung). Bei der Anpassung werden im Laufe der Zeit weniger Aktionspotentiale gesendet, obwohl die Nervenzelle weiterhin konstant Informationen erhält oder im Fall der Gewöhnung, wenn die Reize sich wiederholen. Diese Anpassung findet im Nervensystem statt. Eine Anpassung in ihrem sensorischen System hat stattgefunden, wenn etwas, das Sie hören, sehen oder fühlen, für Sie zuerst gut, doch mit der Zeit kaum mehr wahrnehmbar ist. Verstärkung ist das Gegenteil der Anpassung. Sie tritt auf, wenn die Antwort der Nervenzellen mit der Zeit oder nach einigen Wiederholungen immer weiter zunimmt. Die Verstärkung ist häufig mit Stimuli verbunden, die schädlich sind (dann wird es auch Sensibilisierung genannt).« (ebd., 221)
Das Kind erfährt und erlebt somit in der Auseinandersetzung mit Spielmöglichkeiten schon von Beginn seiner Entwicklung an, dass es sich anpassen kann bzw. dass bestimmte Phänomene, wie zum Beispiel die Wahrnehmung einer Farbe, eines Geräusches, einer Spielperson verstärkt werden können. Diese Lernprozesse hinterlassen im Gehirn so genannte »Gedächtnisspuren« (ebd., 223). Dieses wird z. B. an einem Mobile deutlich, was sich evtl. über dem Kinderbett befindet und sich durch den Windzug bewegt. Das Kind sieht die sich verändernden Farb- und Lichtreize des Mobiles. Es erkennt dieses aber als Mobile, was für es eine Relevanz hat und interessant ist, wieder. Ähnliches gilt für die Melodie des Schlafliedes, welches die Eltern am Ende des Tages singen. Lernprozesse modifizieren infolgedessen das Gehirn, hierbei verändert sich vor allem die Stärke der Synapsen. Dieses »erlaubt ein schnelleres Lernen als über die Vermehrung der Nervenzellen oder der Nervenzellverbindungen« (ebd., 223). Der s. g. Hippocampus hat hierbei eine zentrale Rolle: vor allem das Kurzzeitgedächtnis (welches sich auch im seitlichen Präfrontalcortex befindet) wird hierbei vom Hippocampus unterstützt, da dieser Informationen vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis zu überführen in der Lage ist. Kinder erfahren somit, dass in einer ganz bestimmten Situation ein ganz bestimmtes Ereignis dazu geführt hat, dass sie eine ganz bestimmte Erfahrung machen durften, und behalten diese auch (vgl. ebd., 228): Beim Mittagstisch haben sie z. B. mit dem Löffel auf den Tisch geschlagen, daraufhin hat die Mutter sie angeschaut, daraufhin hat das Kind den Löffel auf den Boden geworfen, daraufhin hat die Mutter dem Kind etwas gesagt und den Löffel aufgehoben und daraufhin hat das Kind erneut den Löffel auf den Boden geworfen etc. Der Hippocampus erstellt hierbei sozusagen eine »Gedächtnismatrix« (ebd.).
»Verschiedene Bereiche der Großhirnrinde projizieren in einer Art Raster Informationen auf den Hippocampus, um dort Koinzidenzdetektoren bereit zu stellen […]. Dem liegt stark vereinfacht folgende Idee zugrunde: Die Farben von bestimmten Dingen werden an einem Ort im Gehirn repräsentiert und die Art des Tieres in einem anderen. Wenn Sie einen grünen Frosch sehen, kommt es im Hippocampus-Raster bei grün und Frosch am Neuron, das den Koinzidenzdetektor dafür bereitstellt, zu einer Überschneidung. Wenn Sie einen grünen Frosch sehen, werden die Hirnareale für grün und Frosch aktiviert. Diese wiederum aktivieren die Grüne-Frosch-Zelle im Hippocampus, deren Synapsen damit gestärkt werden.« (Amthor 2013, 228)
Die Verbindung der Synapsen untereinander im Hippocampus ereignet sich hierbei durch so genannte Langzeitpotenzierungen, durch welche die einzelnen Nervenverbindungen, also die Synapsen verstärkt werden. Aber auch das Gegenteil ist der Fall: Durch eine Langzeitdepression kann die Synapsenstärke auch geschwächt werden. Im Hinblick auf das Gedächtnis kann festgehalten werden, dass
»nicht nur der Kortex auf den Hippocampus [Erinnerungen projiziert] und […] dort zu einer Stärkung der Synapsen [führt], sondern die aktivierten Nervenzellen des Hippocampus projizieren auch zurück zum Kortex. Sie können die Nervenzellen des Kortex eher aktivieren als sensorische Signale. Das bedeutet, dass sie im Kortex ein Aktivitätsmuster wieder herstellen können, das aufgetreten ist, als Sie etwas gerade erlebt haben. Wenn Sie weiterhin in der Erinnerung an eine Erfahrung denken, wird die Aktivität zwischen dem Hippocampus und dem Kortex reflektiert. Wiederholen Sie das oft genug […] ändern sich modifizierbare Synapsen im Kortex so, dass er das neuronale Aktivitätsmuster, das mit dem Erlebnis zusammenhängt, selbst reproduzieren kann.« (Amthor 2013, 230)
Die Wiederholungen, welche Kinder im Spiel erleben, das ständige Experimentieren und Ausprobieren z. B. im Rollenspiel, aber auch im Konstruktionsspiel und anderen Spielformen, führt dazu, dass es zu einer erweiterten Kompetenz der Kinder im Bereich dieser Spielformen kommt. Das Erfahren, das Neuerfahren, das Denken an diese Erfahrungen, das Ausprobieren dieser Erfahrungen, ja sogar das Denken an das Ausprobieren dieser Erfahrung führt dazu, weitere Gedächtnisinhalte zu thematisieren, diese zu aktualisieren und in Bezug auf motorische, auf episodische und auf weitere Gedächtnisinhalte versuchen und umsetzen zu können. Hierbei ist das Gehirn nicht eindimensional, sondern lernt aus Erfahrungen und entwickelt sich permanent weiter:
»Der Embryo entwickelt sich nicht in einem Vakuum. Der Fetus nimmt bereits Empfindungen über die Haut wahr. Auch Geräusche dringen durch die Gebärmutter und aktivieren den Gehörsinn. Und in den Bereichen des Nervensystems, die keine direkte Stimulation erfahren können (wie beispielsweise das Sehen) kommt es zu spontanen Nervenzellaktivitäten. Es bewirkt, dass sich Muskeln kontrahieren und die Ganglienzellen der Netzhaut Aktionspotentiale senden. Diese organisierte Nervenzellaktivität hilft dabei, die richtigen Synapsen zwischen Verbindungen aufzubauen. Die Plastizität funktioniert durch eine Art Datenflusskontrolle zwischen den prä- und postsynaptischen Neuronen. Aus den anfänglich vielen Nervenverbindungen stechen einige Neuronen heraus, die erfolgreicher dabei sind, die Informationen an das postsynaptische Neuron weiterzugeben. Diese Verbindungen werden stabilisiert und die anderen werden wieder gelöscht. Neuronen, die deshalb nicht genügend Synapsen bilden konnten, sterben vielleicht sogar ab. Plastizität ermöglicht es dem Organismus, unvorhersehbare Abweichungen vom allgemeinen Bauplan, die durch Mutationen oder Verletzungen entstehen können, zu kompensieren.« (ebd., 242 f.)