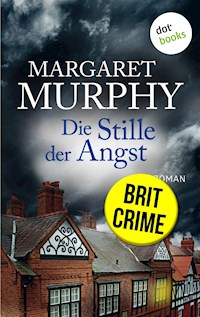5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Wenn der Albtraum zur Wirklichkeit wird ... Der abgründige psychologische Spannungsroman »Das stumme Kind« von Margaret Murphy als eBook bei dotbooks. Als auf den Straßen Liverpools ein kleiner Junge gefunden wird, bittet die Polizei die Kinderpsychologin Jenny Campbell um Hilfe. Das Kind spricht kein einziges Wort, malt nur immer wieder ein Bild: ein Haus, alle Fenster vergittert, alle Türen verriegelt. Handelt es sich dabei nur um die Fantasie eines vernachlässigten Kindes – oder verbirgt sich etwas viel Schlimmeres dahinter? Jenny nimmt den Jungen mit zu sich nach Hause, um ihm Sicherheit zu geben. Doch Jennys Ehemann reagiert plötzlich abweisend und rätselhaft – gibt es womöglich eine Verbindung zu seiner eigenen dunklen Vergangenheit? Mehr und mehr beschleicht Jenny der Verdacht, dass ein Ende des Schweigens auch das Ende aller Unschuld in ihrem Leben bedeuten könnte ... »Eine äußerst talentierte Autorin – Margaret Murphy erzeugt höchste psychologische Spannung.« The Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Psycho-Thriller »Das stumme Kind« von Margaret Murphy bietet Hochspannung aus England für alle Fans von Val McDermid und Elizabeth George. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als auf den Straßen Liverpools ein kleiner Junge gefunden wird, bittet die Polizei die Kinderpsychologin Jenny Campbell um Hilfe. Das Kind spricht kein einziges Wort, malt nur immer wieder ein Bild: ein Haus, alle Fenster vergittert, alle Türen verriegelt. Handelt es sich dabei nur um die Fantasie eines vernachlässigten Kindes – oder verbirgt sich etwas viel Schlimmeres dahinter? Jenny nimmt den Jungen mit zu sich nach Hause, um ihm Sicherheit zu geben. Doch Jennys Ehemann reagiert plötzlich abweisend und rätselhaft – gibt es womöglich eine Verbindung zu seiner eigenen dunklen Vergangenheit? Mehr und mehr beschleicht Jenny der Verdacht, dass ein Ende des Schweigens auch das Ende aller Unschuld in ihrem Leben bedeuten könnte ...
»Eine äußerst talentierte Autorin – Margaret Murphy erzeugt höchste psychologische Spannung.« The Times
Über die Autorin:
Margaret Murphy ist diplomierte Umweltbiologin und hat mehrere Jahre als Biologielehrerin in Lancashire und Liverpool gearbeitet. Ihr erster Roman »Der sanfte Schlaf des Todes« wurde von der Kritik begeistert aufgenommen und mit dem First Blood Award als bester Debüt-Krimi ausgezeichnet. Seitdem hat sie zahlreiche weitere psychologische Spannungsromane und Thriller veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Heute lebt sie auf der Halbinsel Wirral im Nordwesten Englands.
Die englischsprachige Website der Autorin: www.margaret-murphy.co.uk/
Margaret Murphy veröffentlichte bei dotbooks auch ihre Spannungsromane:»Die Stille der Angst«»Der sanfte Schlaf des Todes«»Im Schatten der Schuld«
Außerdem ist bei dotbooks ihre Thriller-Reihe um die Anwältin Clara Pascal erschienen:»Warte, bis es dunkel wird – Band 1«»Der Tod kennt kein Vergessen – Band 2«
Sowie ihre Reihe um die Liverpool Police Station:
»Wer für das Böse lebt – Band 1«»Wer kein Erbarmen kennt – Band 2«»Wer Rache sucht – Band 3«
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »Past Reason« bei Macmillan, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1999 Margaret Murphy
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von Shutterstock/gyn9037, trabantos
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-867-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das stumme Kind« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Margaret Murphy
Das stumme Kind
Roman
Aus dem Englischen von Christine Heinzius
dotbooks.
In Erinnerung an meinen Vater, Harry Wright
Teil I
Prolog
Der Junge stand unentschlossen neben dem Auto. Er sog an seiner Unterlippe und kaute auf ihr ‒ eine neue Angewohnheit. Steig niemals in ein fremdes Auto. Wie oft ist ihm das gesagt worden? Zu Hause, in der Schule, bei Beavers und zuletzt erst bei Cubs.
»Komm jetzt, um Himmels willen!«
Aber er würde nicht in das Auto eines Fremden steigen. Er war ja nicht blöd.
»Ich hab’ nicht den ganzen Tag Zeit.«
Der Junge warf einen Blick über seine Schulter und verdrehte unbewusst seine Füße.
»Ich werde langsam böse …«
Er war nicht gerne unartig, aber wenn er nicht in das Auto stieg, war er ungehorsam, und wenn er einstieg ‒
»Hör mit den Dummheiten auf und steig ein!«
Der Junge stolperte, fiel fast hin, fing sich aber gerade noch rechtzeitig. »Mami hat gesagt …«, brachte er hervor.
»Mami hat gesagt. Mami hat gesagt. Wo ist Mami denn jetzt?«
Der Junge runzelte die Stirn. Er liebte seine Mami, und er wollte, dass sie ihn liebte, aber sie schrie ihn ständig an und zog ihn auf, wenn er weinte. Er blickte noch mal zum Haus zurück, in der Hoffnung, dass sie wie von Zauberhand erschiene und ihm die Entscheidung aus den Händen nahm, aber sie kam nicht. Sie kam nie.
»Komm jetzt! … Hör mal, wenn du dir solche Sorgen machst, rufen wir deine Mutter an, wenn wir in ‒ Wir rufen deine Mutter später an, damit sie sich keine Sorgen macht. O. K.?«
Der Junge schlurfte vorwärts und kratzte dabei mit seinen Zehen über den Kies.
Die Küche war makellos; alle Oberflächen gewischt und desinfiziert, der Edelstahl zu mattem Glanz poliert. Aus einem Hahn tropfte Wasser mit gemessener Feierlichkeit in eine einzelne Tasse, die sich langsam füllte. Eine Hummel flog durch die geöffnete Tür, untersuchte desinteressiert und geistesabwesend den Raum, stieß sich an den Glastüren der Vitrinenschränke, flog weiter zu den bunten Bildkacheln an den Wänden und schließlich denselben Weg hinaus, den sie hereingekommen war; dabei ignorierte sie die regungslose Form einer auf dem Boden liegenden Frau.
Eine Zeit lang ‒ vielleicht eine Stunde ‒, nachdem sie blutend auf den Boden gefallen war, hatte sie das Tap Tap Tap des Wasserhahns gehört und es für ihr eigenes im Hals pulsierendes Blut gehalten, das neben ihr auf dem Boden eine Pfütze bildete. Als das Tropfen des Wasserhahns langsamer wurde, spürte sie auch ihren Puls langsamer und unregelmäßig werden, er stolperte, als ob ihr Herz den Rhythmus vergessen hätte. Aber sie hatte keine Kraft mehr, sich selbst zu retten: Sie hatte alle Kraft aufgebraucht, um ihn zu retten.
Plötzlich kamen immer schneller werdende systolische Krämpfe, um es zu Ende zu bringen, um ihr Leiden zu beenden. Es hörte auf. Der Tod kam leicht, nach dem Schmerz, dem ersten Schock der Gewalt, ihrem hilflosen Kampf gegen solche Wut. Sie wusste nicht, dass sie sterben würde, sie fühlte nur Erschöpfung, Müdigkeit. Sie war sich des langsamen Dunklerwerdens am Rande ihres Gesichtsfeldes nicht bewusst, sie musste nicht einmal ihren Mut zusammennehmen, um der Angst ins Gesicht zu sehen. Es war ein ruhiges Sichergeben, ein stilles Weggehen. Kein himmlischer Chor, kein strahlendes Licht, kein warmes Willkommen, niemand, um sie zu begrüßen und ihr den Weg zu weisen. Nur Dunkelheit, Leere. Die Pfütze um ihren Kopf und Hals hörte auf, größer zu werden, und begann zu gerinnen, und das Tap Tap des Wassers veränderte langsam seinen Klang, wurde dunkler, bösartig.
Kapitel 1
Sie rannten wie die Verrückten brüllend durch die Nacht, ihre Schuhe hallten in den leeren Straßen wie die lauten Schritte eines Mörders in einem Film der vierziger Jahre.
Ein wenig unterdrücktes Bellen war zu hören ‒ halbherziges Gejaule größtenteils; die Wut der Hunde wurde durch die unüberwindlichen, verschlossenen Türen und hohen Gartenmauern der Reichen gemildert.
Lobo sah ein Licht angehen und schrie zum Fenster hoch. »Wonach guckst du, neugierige alte Kuh?« Lee-Anne griff nach seinem Arm, sie lachte immer noch und rang nach Luft. »Du bringst uns noch in Schwierigkeiten, du bekloppter Scheißkerl!« Sie stand vornübergebeugt, beide Hände auf den Knien, und versuchte, zu Atem zu kommen. Das brachte Lobo auf eine Idee. Er zog an seinem Gürtel, ließ die Hose herunter und streckte seinen nackten Hintern der erschreckten Hausbesitzerin entgegen. Sie rannten den ganzen Weg hinunter bis zur Aigburth Road und winkten einem Taxi. Sie ließen sich hineinfallen und waren immer noch am Kichern.
»Ich kann nicht glauben, dass du wirklich deine Hosen runtergelassen hast! Ich dachte, die Alte kriegt ’nen Herzinfarkt!«
»Da hatte sie was zum Glotzen, nicht wahr? Verdammte neugierige Schlampe!«
Lee-Anne stieß auf. »O Gott, Lobo, ich glaube, ich muss kotzen.«
»Hey, hey!« Der Taxifahrer hatte sie in seinem Spiegel beobachtet, aber bisher noch nichts gesagt. »Kübel bloß nicht in mein Taxi.«
»Warum?«, fragte Lobo. »Ist ihre Kotze nicht gut genug für dich?« Er hatte das im Fernsehen bei Harry Enfield gesehen. Er war der Boss.
Lee-Anne machte würgende Geräusche, und der Fahrer sagte wieder: »Hey, hey.« Sie machten ihn nach und lachten sich dann kaputt. Es war toll, dass sie genau denselben Humor hatten.
Lee-Anne sah auf, vor Lachen rannen ihr Tränen übers Gesicht. »Keine Angst«, sagte sie, »ich werde nicht kotzen. Ich glaube, ich werde mich stattdessen bepissen.«
Genialer Humor. Sie könnte im Fernsehen auftreten, dachte Lobo. Plötzlich wollte er sie. »Hey, komm schon«, sagte er. »Mach keinen Scheiß. Wir wollen heute noch nach Hause.«
»Es wäre vielleicht hilfreich, wenn ihr mir sagen würdet, wo ihr hin wollt«, sagte der Fahrer.
Lobo nannte eine Adresse ungefähr eine viertel Meile von ihrer Wohnung entfernt und fummelte an einer fremden Haustür, bis das Taxi verschwunden war ‒ sie wollten schließlich nicht, dass die Polizei sie zu Hause auf spürte. Und an Lobo konnte man sich leicht erinnern: dunkles, fast schwarzes Haar, das aggressiv und unkontrolliert in alle Richtungen von seinem Kopf abstand, einen großen, roten Mund und einen verrückten Blick, an dem er seit seiner Schulzeit gearbeitet hatte. Lee-Anne war klein, rothaarig ‒ sie sah zart aus, aber doch hübsch. Bring beide zusammen, und die Leute mussten sich einfach an den bekloppten bösen Buben und das dürre Mädchen erinnern.
Als das Taxi um die Ecke verschwand, steckte Lobo seine Hände in die Taschen und machte sich auf den Weg nach Hause, er hielt an, als er sah, dass Lee-Anne nicht folgte. Sie lehnte gegen die Wand des Hauses, an dem sie das Taxi abgesetzt hatte.
»Ich muss echt kotzen«, sagte sie kläglich.
Sie war tatsächlich grün im Gesicht. Lobo zerrte an ihrem T-Shirt und sah über seine Schulter.
»Komm jetzt«, sagte er. »Es ist vorbei.«
»Wie sie aussah, Lobo: Du hättest mich nicht dahin bringen dürfen. Ich wünschte, wir hätten nie … Ich will so etwas nie wieder sehen. Nie wieder!« Anstatt sich zu übergeben, überraschte sie ihn damit, in Tränen auszubrechen.
»Komm schon«, sagte er. »Wir gehen zum Bankautomaten. Wollen mal sehen, ob eine von den Zahlen funktioniert. Das wird dich aufmuntern.«
Sie heulte wieder, und er wurde nervös: Jeder, der sie so sah, würde Rückschlüsse ziehen, wenn es in den Nachrichten kam. Ihm war klar, dass Reden nichts bringen würde, also griff er sie am Genick und zog sie weinend die Straße hinunter. Das Bellen war in diesem Stadtteil schärfer, als ob die Hunde wirklich aus ihren Hinterhöfen kommen könnten, jedenfalls mit ein bisschen Glück und ein paar verrotteten Holzplanken auf ihrem Weg; von der Vorstellung bekam Lobo vor Aufregung ein nervöses Kribbeln in der Magengrube.
Kapitel 2
»Er ist vielleicht nur spazieren gegangen.« Es sollte beruhigen, aber Mrs Harvey war nicht in der Stimmung, beruhigt zu werden.
»Er ist seit Stunden weg, verdammt! Er würde niemals so lange Weggehen.« Mrs Harvey lief im Wohnzimmer hin und her und rückte Nippes zurecht, dann blieb sie abrupt stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden. »Er fährt jeden Morgen mehr als zwanzig Meilen mit dem Bus zur Schule. Die meisten seiner Schulfreunde wohnen in Chester. Wo, zum Teufel, kann er denn hin sein?«
District Commissioner Lisa Calcot verstand, was sie meinte. Zwischen den einzelnen pittoresken und mit Reet gedeckten Häusern in Haie Village lag jeweils eine halbe Straßenlänge und dann eine belebte Straße zu den bescheidenen Reihenhäusern weiter oben. Und Lisa Calcot konnte sich nicht vorstellen, dass Mrs Harvey ihrem Sohn den Umgang mit den Bewohnern dieser minderwertigen Wohnungen erlaubte.
»Einen Freund besuchen?«
Vi Harvey sah aus, als ob ihr die Vorstellung, dass ihr Sohn Freunde hatte, völlig fremd wäre. »Er hat ihn geschnappt. Dieser Mann. Der vor der Schule. Er muss zurückgekommen sein. Er muss dem Schulbus gefolgt sein ‒ er muss rausgekriegt haben, wo wir wohnen …«
»Mrs Harvey«, unterbrach Commissioner Weston, »das müssen Sie uns erklären.«
Vi sah von dem Polizisten zu seiner Kollegin. »Sprecht ihr denn überhaupt nicht miteinander? Er hat’s schon mal versucht!«
»Wer hat was versucht?«, fragte Lisa Calcot.
»Der Entführer! O Gott, er wird mich umbringen, wenn er es herausfindet! Sie müssen ihn finden!«
Weston schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, hatte Lisa Calcot Mrs Harvey am Ellbogen gepackt und führte sie zu einem Stuhl. »Sie müssen es uns von Anfang an erzählen, sonst können wir Ihnen nicht helfen«, sagte sie.
Vi sah zu ihr auf, öffnete und schloss ihren Mund ein paar Mal und brach dann in Tränen aus. Lisa Calcot schnappte ein Papiertuch aus einem polierten Metallständer auf dem Couchtisch und nahm ihr die Zigarette weg, um sie auszudrücken. Sie warteten, bis sie sich beruhigt hatte.
Mrs Harvey hatte Freitagnachmittag den Notruf gewählt und gesagt, dass jemand ihren kleinen Jungen entführt hätte. Als sie zwanzig Minuten später ankamen, hatte sie ihre Geschichte dahingehend geändert, dass sie ihnen sagte, er sei /verschwundene Eine Suche in der Umgebung hatte nichts gebracht.
Vi tupfte mit dem Papiertuch ihre Augen und versuchte, ihre hoffnungslos verschmierte Wimperntusche zu retten. Ihre Armreifen klingelten im Rhythmus ihrer Aufregung. Sie glänzte vor Metall ‒ Gold vor allem; ihre Gürtelschnalle glitzerte golden, ihre schwarzen Pantoffeln hatten goldene Paspeln, und ihre Jackenmanschetten waren golden bestickt. Es hing in teuren Schlingen von ihren Ohrläppchen und lag als passende Kette auf ihrem gebräunten Dekolletee. Sogar ihre Haare schienen einen Goldschimmer zu haben; sie war von einem diskreten Glanz umgeben, als ob sie Edelmetall aus ihren Poren schied.
Sie beendete ihre Make-up-Korrekturen und starrte die beiden Polizisten traurig an. »Das Kindermädchen hatte sich krank gemeldet. Ich musste eine Verabredung zum Mittagessen absagen.«
Sie sagte dies in einem sehr bestimmten Ton. »Er spielte oben ‒«
»Ihr Sohn?«
Sie runzelte verärgert die Stirn. »Wer sonst? Er war in seinem Zimmer ‒«
»Sein Name?«
»Wessen Name?«
»Der Ihres Sohnes«, sagte Weston und wechselte einen müden Blick mit Lisa Calcot. »Wie heißt er?«
»Das habe ich doch alles schon …«, sagte sie ärgerlich. »Connor.« Dann, als ob sie es einer langsamen und eher unterbelichteten Sekretärin diktierte: »Sein Name ist … Connor. Ich habe mich fünf Minuten abgewandt ‒ fünf Minuten.«
»Abgewandt?«, fragte Weston.
Lisa Calcot sah, wie Vi schuldbewusst rot wurde. Abgewandt! Wohl eher ihre Bräune aufgefrischt. Im Garten eingenickt.
»Er war weg, bevor ich etwas gemerkt habe«, fuhr Vi fort. »Bill wird es mir nie verzeihen. Er sagte, er würde es vielleicht noch mal versuchen.« Sie spürte, dass sie die Geduld der Polizisten bis aufs Äußerste strapaziert hatte, und versuchte daher eine Art zusammenhängender Erklärung zu geben. »Jemand hat letzte Woche versucht, Connor zu entführen. Aus der Schule. Connor kam frei, aber … O Gottl« Sie schlug die Hände vors Gesicht. »Was soll ich bloß Bill sagen?«
»Bill ist Ihr Ehemann?«, fragte Weston. Vi nickte. »Wo ist er jetzt?«
»Woher, zum Teufel, soll ich das wissen?«, sagte sie schnippisch, in einem Augenblick wechselte sie von Verzweiflung zu Aggressivität. »In irgendeiner langweiligen Besprechung wahrscheinlich ‒ und redet über die Wunder der Klarsichtfolie oder irgendein anderes faszinierendes Thema.«
Lisa Calcot interpretierte diese Schärfe automatisch als eine seit Jahren angesammelte Bitterkeit. »Wo können wir ihn erreichen?«, fragte sie.
»Er ist viel unterwegs.«
»Haben Sie seine Handynummer?«
»Hier.« Vi kritzelte die Nummer auf einen Zettel aus einem (ebenfalls goldenen) Ständer neben dem Telefon. Ihre Armreifen stießen aufgeregt aneinander. »Sie werden ihn nicht erreichen. Sein Telefon ist ausgeschaltet.« Sie schien plötzlich zu bemerken, dass sie keine Zigarette mehr in den Fingern hielt, und ging zum Couchtisch, um sich eine zu nehmen. Als sie sie anzündete, sagte sie: »Würden Sie jetzt bitte aufhören, hier herumzuhängen, und endlich meinen Sohn suchen!«
Weston starrte sie an und fragte sich, ob Connor nicht einfach ein bisschen von dieser hohen, ziemlich unangenehmen Stimme wegwollte. »Ein Foto wäre hilfreich«, sagte er.
Für einen Augenblick sah sie aus, als ob sie ihn anfallen wollte, dann legte sie ihre Zigarette mit übertriebener Sorgfalt in den Aschenbecher und ging zum Bücherregal am anderen Ende des Zimmers. Sie nahm ein Bild aus einem Album, das zu einer ganzen Reihe gehörte, die aufwendig wie ledergebundene Bücher aufgemacht waren, und gab es Lisa Calcot.
»Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Haus!«
»Was denkst du?«, fragte Weston. Lisa wählte zum vierten Mal Mr Harveys Handynummer.
»Mit einem hatte sie jedenfalls Recht ‒ er hat es ausgeschaltet.«
Sie hatten es bereits bei der Fabrik versucht, aber das Creative Plastics Management hatte seinen Boss seit dem Morgen nicht mehr gesehen.
»Sie schien sich größere Sorgen darüber zu machen, dass er es erfährt, als dass dem Kind etwas passiert ist.«
Weston sah sie von der Seite an. »Glaubst du, es ist was Familiäres?«
Lisa Calcot lächelte. Sie hatte diese gewisse Art, einen Mundwinkel hochzuziehen, so dass sich ein Grübchen bildete, das zu sagen schien: Mich kann nichts überraschen.
»Das passt nicht zu dem vorherigen Versuch, oder?« Castel Esplanade hatte sich um den ersten Vorfall gekümmert, da Connors Schule in der Nähe vom Zentrum Chesters lag; das Polizeipräsidium hatte bestätigt, dass weder er noch sonst jemand, der die versuchte Entführung beobachtet hatte, den Angreifer erkannt hatte.
Lisa Calcot zuckte mit den Schultern. »Ich hasse Frauen wie sie. Viel Geld, viel Haar, viel Ego.«
Weston lachte. »Danke, Professor Cantor.«
»Wer?«
»Weißt du nicht, wer Professor Cantor ist?«
»Sollte ich?«
»Du solltest deine Allgemeinbildung auffrischen, Lisa.«
Sie waren auf dem Weg zur Wohnung des Kindermädchens. Lisa stieg vor ihm aus dem Auto, und Weston schaute ihr anerkennend dabei zu. Ihr Gesicht war vielleicht ein bisschen zu kantig, ihre Schultern waren durch zu enthusiastisches Krafttraining sehr breit geworden, aber Lisa Calcot hatte wunderschöne Beine ‒ und sie versteckte sie nicht in Hosen.
»Kommst du?«, fragte Lisa.
Weston riss seinen Blick von ihren Beinen los, sah über ihre Hüften nach oben und schließlich in ihr Gesicht. Sie lächelte ‒ nur ein bisschen, gerade so viel, um ihm zu zeigen, dass sie sein Spielchen verstand, gerade genug, um ihn wissen zu lassen, dass die Zweideutigkeit beabsichtigt war. Er wurde leicht rot, und sie drehte sich um und ging die Stufen zur Eingangstür hoch.
Das Kindermädchen antwortete nicht. Schließlich reagierte der Bewohner der vorderen Wohnung, ein verschlafener Mann um die vierzig, der meckerte, dass er, verdammt noch mal, die blöde Klingel ausschalten würde, falls noch ein Idiot ihn wecken sollte, man könnte nachts nicht pennen, und es war ihm egal, wer sie seien, er hätte jedenfalls ein Recht auf ein paar Stunden Ruhe und Frieden. Sie gingen die Treppe hinauf zu Miss Halliwells Wohnung und klopften an die Tür. Eine schwache Stimme fragte, wer da sei.
»Die Polizei, Miss Halliwell, machen Sie auf.«
Das tat sie, soweit es die Kette erlaubte. »Sie übertreibt es mit ihren Arbeitgeberrechten aber ein bisschen, wenn sie die Polizei kontrollieren schickt, oder?« Lisa Calcot lächelte und wechselte einen Blick mit Weston. Miss Halliwell wollte ihren Ausweis sehen. Lisa gab ihr ihren durch den schmalen Türspalt. Sie schloss die Tür, während sie ihn las, und Weston, der seinen Ärger nicht länger verbergen konnte, sagte: »Wir verlieren Zeit, Miss Halliwell. Connor Harvey wird vermisst, und wir brauchen Ihre Hilfe.«
»Connor ‒?« Sie hörten die Kette klicken, dann öffnete sie die Tür. »Connor vermisst? Ist es derselbe Mann? Der vor seiner Schule?«
Weder Lisa noch Weston antworteten. Sie starrten ihr Gesicht an. Selbst im schwachen Flurlicht konnte man sehen, dass es durch unregelmäßige, erhabene, tiefrote Striemen entstellt war. Als sie sich plötzlich ihrer musternden Blicke bewusst wurde, schüttelte sie ihre Haare vors Gesicht und zog ihren Morgenmantel enger um den Hals.
»Es ist nicht ansteckend«, beruhigte sie sie. »Eine Art Allergie, hat der Arzt gesagt.« Sie ging durch den Flur in das kleine Wohnzimmer und sprach dabei über ihre Schulter. Das Sofa war zu einem improvisierten Bett umgebaut, und auf dem Boden daneben lagen lauter Zeitschriften. Sie schien sich für die Unordnung entschuldigen zu wollen, änderte dann aber ihre Meinung und bot ihnen Platz an. Lisa Calcot sah sich um; außer dem Sofa gab es nur einen Schaukelstuhl und ein paar Esszimmerstühle an einem Ausziehtisch. Sie nahm einen der Esszimmerstühle, Weston setzte sich in den Schaukelstuhl.
»Sie haben sich krank gemeldet«, sagte Lisa Calcot. Das Kindermädchen strich sich eine mausgraue Haarsträhne aus dem Gesicht, und Lisa bemerkte, dass die roten Flecken auch ihre Hände befallen hatten.
»Ich habe kaum geschlafen«, sagte sie. »Ich konnte doch nicht hingehen, so wie ich aussehe. Und überhaupt, ich fühle mich schrecklich …«
»Niemand beschuldigt Sie«, sagte Weston, als er sah, dass sie kurz davor war, in fiebrige Tränen auszubrechen. »Wir versuchen nur, alle Fakten zu sammeln.«
Miss Halliwell nickte, versuchte tapfer zu sein. »Während der Ferien bin ich normalerweise um halb neun dort, so dass sie sich nicht um ihn zu kümmern braucht. Sie ist so leicht genervt ‒ und er ist wirklich so ein lieber Junge. Ich rief um halb acht an. Ich konnte einfach nicht …« Sie unterbrach sich: »Glauben Sie, es geht ihm gut?«
Schön zu wissen, dass sich jemand Sorgen macht, dachte Lisa. »Sie wohnen nicht dort?«, fragte sie.
»Früher, als er kleiner war, schon. Aber er ist meist im Internat, jetzt, wo sein Vater mehr zu tun hat, deshalb brauchen sie mich nicht mehr so oft.«
»Was ist mit seiner Mutter?«
»Mit seiner Mutter?«
»Könnte sie sich nicht um ihn kümmern?«
Miss Halliwell lachte. »Sie ist viel zu beschäftigt.«
»Arbeiten Sie schon lange für sie?«, fragte Weston.
»Achteinhalb Jahre. Seit Connor ein Baby war. Es war meine erste Arbeitsstelle nach dem College.«
Dann, als ob sie ihre Ungläubigkeit vorwegnehmen wollte, dass sie Mrs Harveys selbstherrliches Regime so lange hatte ertragen können, setzte sie hinzu: »Sie ist nicht so oft da. Und wenn sie da ist, gehen wir ihr aus dem Weg.«
»Kommen Sie mit Mrs Harvey aus?«, fragte Weston.
Sie sah Weston mit einem Blick an, den sie sonst wohl bei nervösen Fünfjährigen benutzte: »Kamen Sie mit ihr aus?«
»Aber Sie blieben.«
»Connor ist ein Schatz. Ich konnte ihn nicht verlassen. Und Mr Harvey passte auf, dass sie mich nicht feuerte.« Ihr Gesicht fiel plötzlich ein, und sie sagte: »Es ist alles meine Schuld, nicht wahr? Wenn ich da gewesen wäre ‒«
»Seine Mutter war da«, sagte Lisa Calcot.
Miss Halliwell verschränkte ihre Arme vor der Brust und jammerte leicht vor Unbehagen. »Sie wissen nicht, wie sie ist.«
»Dann sagen Sie es uns«, sagte Weston.
»Sie benimmt sich wie ein verwöhntes Gör. Nimmt Connor die meiste Zeit überhaupt nicht wahr. Oh, er wird auf Partys und Ähnlichem für eine halbe Stunde vorgeführt, so dass sie mit ihm angeben kann ‒ um ihre Freunde mit ihrer Hingebungsvolle-Mutter-Show zu beeindrucken ‒, dann wird er in sein Zimmer abgeschoben, und Gott gnade ihm, wenn er ihre Unterhaltung stört.«
»Was ist mit Mr Harvey?«
Ihr Gesicht entspannte sich. »Er tut, was er kann, aber seine Arbeit … Er macht so viele Überstunden.«
»Wissen Sie, wo er jetzt ist?«
Miss Halliwell wurde rot, was die Flecken auf ihrem Gesicht zu einem matten Leuchten brachte. Sie überhörte die Anspielung. »Natürlich nicht. Ich meine … Ich weiß, dass er bis spät heute Abend weg sein wird ‒ ich sollte dort übernachten, aber …«
»Also wissen Sie nicht, wie wir ihn erreichen können?«
»Nein! Mein Gott, was wollen Sie damit andeuten?«
»Was wolltest du damit andeuten?«, fragte Lisa, als sie wieder im Auto waren.
»Ich weiß nicht. Glaubst du, sie schwärmt für Mr H.? Natürlich ist sie noch ein halbes Kind ‒«
Lisa lächelte. »Siebenundzwanzig ‒ vielleicht älter. Fliegen Männer mittleren Alters nicht angeblich auf so was?«
»Warum fragst du mich?«
Lisa lachte kurz und rau. Weston sah missmutig und wütend aus und fuhr quietschend vom Bordstein los.
Kapitel 3
Jenny Campbell blieb stehen. Max Greenberg saß der Treppe gegenüber, auf der anderen Seite der glänzenden Marleyfliesen in der sogenannten Lobby des dritten Stocks der Verwaltung. Er sah cool aus in seinem hellgrünen Sommeranzug, wenn auch etwas fehl am Platz. Er saß auf einem schäbigen Plastikstuhl ‒ entspannt, aber selbstsicher ‒, bereit loszulegen. Ein kleiner Junge mit dunklen Haaren und leuchtenden Augen saß neben ihm. Selbst aus dieser Entfernung konnte Jenny seine Angst spüren: Seine Augen glitzerten eher, als dass sie glänzten. Er trug den Schlafanzug und den rotbraunen Bademantel, in dem er angekommen war, ab und zu zupfte er an den Paspeln der Etiketten und Taschen.
Jenny lächelte den Jungen an, es war eine reflexartige Reaktion und der instinktive Wunsch, ihm die Befangenheit zu nehmen. Obwohl er ins Leere schaute und abwesend wirkte, schien ihn dieser Kontaktversuch nervös zu machen; er sah nach unten, weg, seine Augen blickten in der Lobby umher, um ihr auszuweichen.
Jenny dachte daran, sich einfach umzudrehen und wegzugehen, aber laut den Krankenhausregeln durfte das Pflegepersonal das Gebäude nicht in Arbeitskleidung verlassen, und ihre Autoschlüssel lagen sowieso in ihrem Spind. Der einzige Weg zum Umkleideraum führte sie an Dr. Greenberg vorbei. Das gerissene Funkeln in seinen Augen brachte die Entscheidung; sie atmete tief ein, versuchte die in ihr aufsteigende Wut zu unterdrücken und ging los.
Max kam ihr entgegen; an der einen Seite seines Revers trug er das Namensschild des Krankenhauses, welches ihn als Facharzt für Kinderpsychologie auswies, an der anderen Seite trug er einen Button aus seiner Sammlung ‒ heute war es ein Clown. Jenny hatte ihn schon einmal gesehen: Wenn man auf seine Nase drückte, leuchteten nacheinander in einem Halbkreis kleine LED-Lichter auf, die der Clown zu jonglieren schien, dabei lachte er.
Jenny mochte Max: Sie hatten sich das erste Mal getroffen, als er sie aufgesucht hatte, um ihren Artikel in der Counselling News über Pflegeeltern als Sozialberater zu loben. Er hatte sie ermutigt, über Pflegekinder zu schreiben, hatte ihr Textmaterial besorgt und seinen Einfluss geltend gemacht, um sie mit bedeutenden Autoren und Ärzten des Fachgebiets zusammenzubringen.
Sein modischer Kleidungsstil und seine Schlagfertigkeit schienen nicht zu seiner Arbeit mit kranken und emotional gestörten Kindern zu passen, aber er strahlte eine solche Wärme und einen tiefen Respekt vor den Kindern in seiner Obhut aus, dass diese mit instinktivem Vertrauen auf ihn reagierten.
Max fing Jenny auf halbem Weg ab; trotz ihrer stärker werdenden Empörung konnte sie nicht umhin zu bemerken, dass der Junge überhaupt nicht besorgt darüber wirkte, dass ihn sein Aufpasser verlassen hatte. Er saß völlig teilnahmslos auf seinem Stuhl, seine Arme hingen herab, seine Hände waren in den Ärmeln seines Bademantels versteckt, sein Rücken war rund, und seine Augen hatte er auf den Boden geheftet.
Max lächelte Jenny reuevoll an.
»Was für ein Scheißtrick«, brachte Jenny leise hervor.
»Ah-ah. Pas devant l’enfant«, antwortete Max mit einem breiten Grinsen.
Der Junge regte sich, als ob er aus einem Tagtraum erwachte, blinzelte und sah auf. Jenny, die ihm gegenüber stand, spürte die volle Kraft seiner strahlenden, braunen Augen. Sie schloss ihre eigenen einen Moment.
»Warum tust du mir das an, Max?«, klagte sie.
Sie hatten vorher bereits darüber gesprochen, auf der Station, während Jenny versucht hatte, ihre Patientenbeobachtungen der Nacht aufzuschreiben. Sie hatte zu viel zu tun. Nicht nur hier im Krankenhaus. Ihre Vortragsreise für den Nationalverband der Pflegeeltern sollte in zwei Wochen beginnen, und sie hatte ihre Unterlagen und Vorbereitungen noch nicht fertig. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich viel zu tun habe. Sylvia von der Notaufnahme hat es auch versucht. Ich habe ihr dasselbe gesagt: Ich werde nicht die Zeit haben, mich so um ihn zu kümmern, wie er es braucht.«
Werde nicht, nicht würde nicht. Max sah, dass Jennys Entschlossenheit einen Augenblick lang schwankte, und handelte sofort. Er sah sich um, um sicherzugehen, dass der Junge nicht weglief, dann packte er Jenny am Ellbogen und lenkte sie zur anderen Seite der Lobby. Unbewusst stellten sich beide so, dass sie das Kind im Auge behalten konnten. Ein ständiger Strom von Krankenschwestern kam und ging, die Verwaltung war zwar geschlossen, aber die Umkleideräume waren auf derselben Etage. Es war vor allem die Nachtschicht, die Feierabend machte, die Frühschicht hatte bereits vor einer Stunde angefangen, damit noch Notizen gelesen sowie Informationen und Anweisungen ausgetauscht werden konnten. Die meisten sagten etwas zu dem Jungen, der so offensichtlich teilnahmslos dasaß, und doch glaubte Jenny, dass er den Geräuschen und Bewegungen seiner Umgebung gegenüber ungewöhnlich sensibel war. Er sah ab und zu verstohlen zu ihnen herüber, wich ihrem Blick dabei aber aus.
Er reagierte auf die freundlichen Grüße der Schwestern, indem er noch mehr in sich zusammenkroch und sich weigerte aufzusehen, bis sie schließlich unzufrieden mit den Schultern zuckten und an ihm vorbei in den Umkleideraum gingen.
»Ich kann ihn nicht irgendwem anvertrauen, Jen«, sagte Max. »Du hast die Ergebnisse seiner Untersuchungen gesehen.«
Jenny kämpfte gegen die emotionale Bedeutung der Beweislage, die ihr Kollege detailliert aufzeigte und gewissenhaft darlegte: Verschlossen, still und ängstlich hatte der Junge die Untersuchungen über sich ergehen lassen, aber er hatte Narben, die vermuten ließen, dass er irgendwann einmal misshandelt worden war. Die Verhaltensauffälligkeiten bestätigten diese Einschätzung. Ein direkterer und zwingender Beweis waren die Röntgenaufnahmen seiner Hände, die gezeigt hatten, dass alle Finger an beiden Händen bei einem traumatischen Zwischenfall in der Vergangenheit gebrochen worden waren.
Jenny runzelte die Stirn: »Ich könnte mich nicht genug um ihn kümmern, Max.«
Könnte nicht, nicht kann nicht. Sie war einen Schritt weiter, was die Wahrscheinlichkeit anging, den Jungen anzunehmen.
»Fraser hat bald Ferien, oder?«
»Er würde dich dafür lieben«, sagte Jenny. »Drei Wochen allein auf einen schwer gestörten Jungen aufzupassen, während ich zu meiner Vortragsreise abhaue.«
»Nicht so lange, das verspreche ich …«
»Sieh mal, Max, wir waren uns doch einig über eine kleine Atempause, nachdem Luke zu seinen Adoptiveltern gezogen ist …«
Max überlegte, ob er Jenny erzählen sollte, dass Luke auf seine Adoptiveltern ziemlich verstört reagierte. Verstört und störend. Er entschied sich dagegen. Jenny und Fraser hätten ihn in null Komma nichts zurückgeholt, aber Luke hatte eine zu starke Beziehung zu ihnen entwickelt, was auch der Grund für seine Weigerung war, seine neuen Eltern zu akzeptieren. Es würde die Situation nur verschlimmern, wenn er zu Jenny und Fraser zurückkehrte, nur um in ein paar Monaten zu jemand anderem geschickt zu werden.
Luke war fast zwei Jahre bei ihnen gewesen, und sie hingen mehr an ihm als an irgendeinem anderen ihrer vorherigen Kinder. Sie litten unter seinem Verlust.
Max sah seine Freundin direkt an. »Ich weiß, wenn irgendjemand ihn aus der Reserve locken kann, bist du das. Auf der Station sind sie zu beschäftigt, selbst wenn ein Bett frei wäre, und das ist es nicht«, sagte er bestimmt, um Jennys Einsprüchen zuvorzukommen. »Es gibt keinen körperlichen Grund für ihn, im Krankenhaus zu bleiben ‒ seine Verletzungen sind alt. Er braucht persönliche Betreuung, Jen.« Keine Antwort, also fuhr er fort: »Der Sozialdienst versucht verzweifelt, einen Platz für ihn zu finden. Sie würden ihr Bestes tun, um dich zu unterstützen, wie Notfallbetreuung, falls du sie brauchst … Komm schon, Jenny, du weißt, wie es ist, wenn man an einem Wochenende einen Platz für einen Notfall braucht. Es wäre nur für ein, zwei Wochen, bis seine Eltern auftauchen. Keine Sorge«, fügte er hinzu, als er sah, dass Jennys Gesichtsausdruck von Trotz zu Sorge um den Jungen gewechselt war. »Wir werden schon sicherstellen, dass er ohne Gefahr zurückgehen kann.« Er fühlte sich plötzlich schuldig ‒ Jenny war so leicht zu überreden. Manchmal schockierte ihn seine Bereitschaft, Erwachsene im Dienste der ihm anvertrauten Kinder zu manipulieren.
Jenny beobachtete eine weitere misslungene Unterhaltung zwischen einer Krankenschwester und der winzigen Person, die ein paar Meter weiter saß. Sie seufzte. »Wie alt ist er?«
Max kannte sie zu gut, um zu glauben, dass er sie bereits rumgekriegt hätte ‒ Jenny hatte noch nicht zugestimmt, das Kind aufzunehmen ‒, und trotz ihrer Großherzigkeit konnte sie stur sein, wenn sie das Gefühl hatte, in eine Situation gebracht zu werden, die sie nicht mochte. »Ich würde ihn auf sieben oder acht schätzen.« Er runzelte die Stirn und maß den Jungen im Geiste an einer Skala der Größe, körperlichen Merkmale und des Verhaltens all der Tausende von Kindern, die er in den fünfzehn Jahren seiner Arbeit als Kinderpsychologe im Krankenhaus betreut hatte. »Meiner Einschätzung nach ein kleiner Achtjähriger.«
Sie schauderte. »Was erschreckt ein Kind so sehr, dass man es nicht einmal zum Sprechen bringt?«
Max zuckte mit den Schultern. »Es bringt nichts, darüber zu spekulieren, was passiert ist. Er könnte ein Zigeunerkind sein. Er hat die richtige Hautfarbe dafür. Sie bringen ihren Kindern bei, nicht mit Vertretern der Obrigkeit zu sprechen. Falls ihm beigebracht wurde, den Mund zu halten …« Er zog die Augenbrauen hoch. »Kinder in diesem Alter können Sachen sehr wörtlich nehmen.«
»Spar dir deine Piaget-Theorien für deine Studenten.«
Max grinste. »Es wäre nur für eine Woche ‒ höchstens zwei. Vielleicht ist er weggelaufen, und sie haben es erst gemerkt, als es schon zu spät war. Sie werden ihn holen kommen.«
Jenny sah ihn misstrauisch an. »Wenn du wirklich glauben würdest, er wäre ein Zigeunerkind, wärst du nicht so scharf darauf, dass ich ihn nehme.« Die Kleidung des Jungen deutete nicht auf Zigeuner hin, sondern auf Geld, und seine große Angst ließ etwas Schlimmeres als simples Weglaufen vermuten.
Max zögerte. Es nutzte nichts, Jenny etwas vormachen zu wollen: Sie durchschaute jeden Versuch, an der Wahrheit herumzudeuten, und war darüber zu erbost, um den Ärger zu rechtfertigen.
»O. K. Mein Gefühl sagt mir, dass seine Reaktionen Besorgnis erregend waren. Ich möchte ihn irgendwohin bringen, wo er sich sicher fühlt.«
»Gibt’s denn niemand anderen ?«
»Der einzige andere freie Platz ist eine unruhige Familie mit älteren Pflegekindern. Es wäre nicht das Richtige für ihn.«
»Wo hat man ihn gefunden ?«
»South End, Garston, aber er ist vielleicht ein gutes Stück weit von zu Elause weggelaufen.«
Jenny schüttelte den Kopf. »Ein Achtjähriger, der in den frühen Morgenstunden in seinem Schlafanzug und in Pantoffeln durch die Stadt läuft. Ihm hätte alles Mögliche passieren können.«
Max fuhr fort: »Die Polizei befragt die Anwohner, ob sie irgendwas gesehen haben. Morgen oder übermorgen wollen sie ein paar Fotos machen, vielleicht antwortet jemand auf eine Anzeige im Liverpool Echo oder im regionalen Fernsehen. Die Kontaktperson ist Mike Delaney«, fügte er hinzu, er wusste, dass Jenny schon mit Sergeant Delaney gearbeitet hatte und ihn mochte.
Jenny seufzte noch einmal, dieses Mal tiefer, und Max glaubte einen vielversprechenden Ton der Resignation darin zu hören.
»Wie nennst du ihn?«, fragte Jenny.
»Ich dachte vielleicht Paul«, schlug Max vor, immer noch sehr vorsichtig, da er noch nicht glauben konnte, dass Jenny endgültig kapituliert hatte.
In diesem Moment war plötzlich die Hölle los. Jarmon Willis, ein Stationsleiter und alter Studienkollege von Jenny, hatte den Jungen angesprochen, so wie es seine Kolleginnen getan hatten, aber anstatt zurückzuweichen und zu schweigen, war der Junge plötzlich aufgesprungen und schreiend zur Treppe gelaufen. Jenny fing ihn ab und hob ihn hoch; er trat und schrie: wortlose, unwirkliche, schreckliche Laute, die an den kahlen Wänden abprallten und das Treppenhaus hinunterhallten.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte sie, »du bist in Sicherheit.« Sie wiederholte es immer und immer wieder, hielt dabei seine Hände, damit er ihr Gesicht nicht zerkratzte, sie hielt ihn sanft fest und drehte sich von Jarmon weg. Sie winkte den geschockten Stationsleiter fort, und er verschwand durch die Tür rechts neben dem Frauenumkleideraum. »Siehst du, er ist weg.« Das Kind starrte wild über ihre Schulter und ließ sich dann abrupt in ihre Arme fallen, wieder völlig teilnahmslos.
Max hielt sich zurück, wie vorhin, als der Junge so heftig reagiert hatte, in der Hoffnung, dass Jenny, wenn sie einmal den Kontakt aufgebaut hatte, es unmöglich finden würde, ihn wieder zu verlassen. Max musste den Jungen in guten Händen wissen, bei jemandem, dem er vertraute. Er empfand viel für dieses Kind, er war besorgt, fühlte sich unwohl bei der ganzen Sache. Jenny war die Beste dafür, sich um den Jungen zu kümmern, und er konnte sehen, dass sie jetzt eine Entscheidung fällte.
Jenny stellte das Kind behutsam auf den Boden, sie hatte fast Angst, dass er hinfallen würde, aber das tat er nicht. Er stand neben ihr, sah auf den Boden, atmete ein wenig stärker, während ihm Tränen ungehindert die Wangen herunterrannen und seine Nase lief. Sie fischte ein Papiertaschentuch aus ihrer Tasche, wischte ihm die Nase ab und hockte sich dann neben ihn. Der Junge wurde daraufhin unnatürlich ruhig, so dass die Luft um ihn herum stillzustehen schien. Jenny erinnerte das an den Reflex der Rehe, sich tot zu stellen, und fühlte eine Art ehrfurchtsvolle Scheu.
Sie drehte sich zu dem Jungen und senkte den Kopf so, dass er ihr ins Gesicht sehen konnte, wenn er sie denn mit einem seiner flüchtigen, verstohlenen Blicke beehren wollte.
»Ich heiße Jenny Campbell«, sagte sie. »Ich weiß nicht, wie du heißt.« Die Stille des Jungen schien größer zu werden. Sie gab ihm genug Zeit, einen Namen zu nennen, dann nickte sie, als Zeichen, dass sie seine Entscheidung, ihn ihr nicht zu sagen, akzeptierte. »Ich dachte, wenn es dir nichts ausmacht, werde ich dich erst einmal Paul nennen. Wäre das in Ordnung?« Der Junge schien sich ein klitzekleines bisschen zu entspannen, und Jenny nahm dies als Zustimmung.
»Max findet, es wäre das Beste, wenn du mit zu mir nach Hause kämst, für eine Weile, nur bis wir deine Mami und deinen Daddy gefunden haben.« Eine Bewegung am Rande ihres Gesichtsfeldes sagte ihr, dass der Junge einen Blick auf sie geworfen hatte.
Sie stand langsam auf. »Wirst du mit mir kommen, Paul?« Sie hielt ihm ihre Hand hin. Der Junge brauchte eine halbe Minute, um zu reagieren, und legte dann seine kleine, kalte Hand in ihre. Die Hand des Jungen wurde von der der Frau gewärmt. Ihr Haar glänzte und war ein bisschen durcheinander. Auf ihrer rechten Wange hatte sie einen Leberfleck in der Farbe und Form eines Teeblatts. Ihre Stimme klang wie eine Windorgel: zart und musikalisch. Als sie seine Nase abgewischt hatte, hatte ihr Taschentuch nach Minze gerochen. Sein Bewusstsein war im Moment auf das rein Sinnliche beschränkt. Farben und Krach waren seine ersten Eindrücke nach der bitteren Kälte der letzten Nacht gewesen. Er hatte bereits das Haus der anderen Lady vergessen, das kleine rote Haus mit seinem Geruch nach Toast und Kohl und Feuchtigkeit und dem Geräusch einer langsam tickenden Uhr, aber er erinnerte sich an das Blaulicht, die heulende Sirene. Das Innere des Krankenwagens roch nach den Ärzten ‒ Metall und einer Spezialseife und dem kalten Zeug,, das sie auf dich reiben, bevor sie dir eine Spritze geben.
Dann Bilder, Spielzeug, silberne Fische, die an Fäden von der Decke hingen. Stimmen, Stimmen. Da waren vielleicht auch Worte, aber er konnte keinen Sinn in ihnen erkennen. Farben-Lärm und Geräusch-Lärm. Gerüche, ein bisschen wie Hustenbonbons und Kampfer, aber nicht so beruhigend wie zu Hause.
Er wimmerte ein wenig bei den Bildern in seinem Kopf. Er wollte nicht an zu Hause denken, also konzentrierte er sich auf die Geräusche um ihn herum, bis alle Gedanken, ja sogar alle Erinnerungen an zu Hause weg waren. Die Geräusche hier waren dünnes Metall gegen scharfe Kanten: feilend, hart, scheppernd, unfreundlich. Es war ein kaltes Geräusch, welches ihn an Schmerzen erinnerte, er wollte seine Hände verstecken, er wollte sich verstecken, irgendwo, wo es eng ist, weit weg, wo ihn niemand finden würde. Er fühlte das alles ohne Worte, denn Worte ‒ das wusste er, ohne dass es ihm jemand gesagt hätte ‒, Worte waren gefährlich.
Kapitel 4
Jenny schloss die Tür zwei Mal ab. Er sollte keine Gelegenheit haben, noch mal davonzulaufen. Auf der Fahrt nach Hause hatte er zusammengesunken auf dem Beifahrersitz neben ihr gesessen, ohne Interesse für die Umgebung, ohne Anzeichen für ein Wiedererkennen. Es war fast neun Uhr, als sie schließlich alle notwendigen Formulare ausgefüllt und sich umgezogen hatte. Der Morgenverkehr hatte die Stadt bereits in einen bräunlichen Dunst aus Stickstoffmonoxid gehüllt. Es würde heiß werden. Jenny sah ab und zu zu dem Jungen hinüber. Er starrte vor sich hin, die Augen auf der Höhe des Armaturenbretts, die Augenlider halb geschlossen, er vergaß sie mehr, als dass er sie ignorierte.
Jenny und Fraser wohnten in einem großen, viktorianischen Haus am Rand von Sefton Park, welches sie vor zehn Jahren gekauft hatten. Die einzelnen Apartments darin hatten sie wieder zu einer zusammenhängenden Wohnung umgebaut. Das Haus war warm und einladend. Nach dem leichten Schnarchen zu urteilen, das man sogar im Eingang hören konnte, war Fraser noch im Bett.
Der Junge stand neben ihr, reglos, wie ohne eigenen Antrieb, aber er akzeptierte Jennys Vorschläge und folgte ihr in die Küche, wo er sich an den Tisch setzte und etwas Müsli aß. Danach gab sie ihm ein Glas warme Milch und einen Keks. Obwohl es nicht so aussah, als ob er sie verstehen würde, erklärte sie ihm, dass ihr Ehemann oben schlafen würde und dass nur sie drei im Haus wären. Sie machte eine Pause und beobachtete ihn, um eine Reaktion zu sehen, aber der Junge behielt denselben hübschen, nichtssagenden Ausdruck bei. Sie hätte ihn für taub halten können, hätte Max ihr nicht gesagt, dass das Gehör des Jungen normal schien, ja, er wirkte sogar besonders geräuschempfindlich.
Nach seinem Frühstück zeigte sie ihm das Badezimmer, das Spielzimmer, das Gästezimmer und ihr Schlafzimmer, aus dem man Frasers Schnarchen nun noch lauter hörte. Der Junge drückte sich mit dem Rücken zur Wand an der geschlossenen Tür vorbei, und sie gingen weiter zu seinem Schlafzimmer, das bis vor kurzem Lukes Zimmer gewesen war. Sie hatten es in Pastellfarben gestrichen, da die Kinder, die zu ihnen kamen, die kräftigen, leuchtenden, typischen Kinderzimmerfarben meist zu unruhig fanden.
Jenny öffnete und schloss die Schranktüren, vorgeblich um ihm zu zeigen, was darin war, das Spielzeug und die Spiele, mit denen sie spielen würden, wenn er sich eingelebt hatte, aber ihre eigentliche Absicht war, dem Jungen zu versichern, dass nichts ‒ niemand ‒ darin versteckt war, nichts, wovor man sich fürchten müsste.
»Denkst du, du könntest dir die Zähne putzen, bevor du ins Bett gehst?«, fragte Jenny.
Er ging zur Tür und wartete dort, er starrte sie mit diesen großen, verletzten Augen an. Er folgte ihr ins Badezimmer. Ein Micky-Maus-Becher ‒ von Luke ‒ stand noch auf dem Regal über dem Waschbecken und in ihm immer noch die Zahnbürste, so wie er sie vor vier Wochen stehen gelassen hatte. Keiner der beiden hatte es übers Herz gebracht, sie wegzuwerfen.
Lukes Adoptiveltern hatten zugestimmt, ihn bis nach seinem fünften Geburtstag bei Jenny und Fraser zu lassen. Sie waren liebe, ruhige Leute, die ihm den Übergang von einer Pflegestelle zu einer richtigen Familie so leicht und schmerzlos wie möglich machen wollten. Die Geburtstagsfeier war eine Katastrophe gewesen: Luke hatte sich geweigert, die Kerzen auf seinem Geburtstagskuchen auszublasen, und war weinend nach oben geflohen, während seine Freunde Happy Birthday gesungen hatten.
Jenny schluckte und griff dann nach dem Becher. Der Junge zuckte bei der plötzlichen Bewegung zusammen, und sie sagte ein paar beruhigende Worte, erklärte ihm, was sie tat, während sie eine neue Zahnbürste aus dem Schrank nahm und sie auspackte.
Er putzte seine Zähne ohne Hilfe und stellte die Zahnbürste von allein wieder in den Becher. Er hielt Jenny seine Hand hin, und sie nahm sie lächelnd. »Du kannst so lange schlafen, wie du willst, Paul.« Sie fühlte sich unwohl mit dem Namen, den Max ihm der Bequemlichkeit halber wegen der Formulare gegeben hatte; sie glaubte, er müsse ihn durcheinander bringen, und entschied, ihn nur zu benutzen, wenn es nicht anders ging ‒ vielleicht würde er dann seinen eigenen Namen eher nennen.
Sie gingen vom Badezimmer in den Flur.
Fraser stand in ihrer Schlafzimmertür. Er sah aus, als ob er gerade erst wach geworden wäre. »Wer ‒?«, fragte er. Die nächtlichen Bartstoppeln sahen auf seiner furchtbar weißen Haut sehr schwarz aus.
O Gott, dachte Jenny. Armer Fraser! Halbwach hatte er den Jungen gesehen und gedacht, Luke wäre zurückgekommen. Sie fühlte den Griff des Jungen fester werden, er atmete erschreckt ein. »Paul«, sagte sie ruhig und wusste, dass sie damit schon ihren Vorsatz gebrochen hatte, »das ist mein Mann, Fraser. Er wird mir dabei helfen, mich um dich zu kümmern.«
Fraser stand am Geländer, als ob er sich daran festhalten müsste. »Das ist Paul«, fuhr sie fort. »Es ist nicht sein richtiger Name, aber den wissen wir noch nicht. Er wird eine Weile bei uns bleiben.« Sie erinnerte sich an den schnellen, nervösen Blick, als sie vorher seine Mutter und seinen Vater erwähnt hatte, und entschied, seine Eltern nicht mehr zu nennen, bis der Junge richtig sprach.
»Paul geht zu Bett, weil er gestern Nacht überhaupt nicht geschlafen hat.« Sie ging weiter, an ihrem Mann vorbei, und der Junge verkroch sich hinter ihr. Er ließ Fraser den ganzen Flur entlang nicht aus den Augen, sondern hielt Jennys Hand ganz fest, drehte sich herum und starrte Fraser an, bis sie bei seinem Schlafzimmer waren, hineingingen und Fraser nicht mehr zu sehen war. Jenny zog ihm den Bademantel aus und schlug das Bett auf. Der Junge kletterte ins Bett, es war das zweite Mal, dass er etwas ungefragt tat: seine Zahnbürste wegstellen und ins Bett gehen; Jenny verspürte daraufhin einen unvernünftigen Anflug von Optimismus.
Er starrte die Decke an, ohne zu blinzeln, hellwach. Ab und zu warf er einen Blick zur Tür.
»Möchtest du, dass ich sie zumache?«, fragte Jenny und strich ihm die Haare aus den Augen.
»Weißt du was«, sagte sie, als sie aufstand. »Ich werde draußen dieses Schild aufhängen, dann kann niemand reinkommen, außer du erlaubst es.« Es hatte bei Luke funktioniert, als er Alpträume über das Monster im Flur hatte. Sie nahm das Bitte-nicht-stören-Schild, das sie für Luke gemacht hatte, und hängte es außen hin, dann schloss sie fest die Tür. Sie glaubte einen Schimmer der Erleichterung bei dem Jungen gesehen zu haben.
Das Zimmer lag in der Morgensonne und wurde im Julisonnenschein schnell warm. Jenny ging durch das Zimmer, um das Fenster zu öffnen, und der Junge stieß einen kehligen Schrei der Panik aus. Sie drehte sich zu ihm um.
»Möchtest du, dass ich es zu lasse?«
Der Junge starrte wild. Jenny zog die Jalousien herunter. Seine Augen waren weit aufgerissen, voller Panik.
Ich verspreche es. Ich habe gesagt, ich wäre brav. Schließ die Tür, schließ die Fenster. Sichere alles.
Jenny saß neben ihm, hielt seine Hand und sang in ihrem süßen Sopran ein Schlaflied, und innerhalb weniger Minuten ließ der Griff des Jungen nach, und sein Kopf fiel zur Seite. Sie sang noch ein bisschen weiter, schlich dann zur Tür und sah sich nach ihm um.
Sein Gesicht war etwas gerötet, und sein Pony, der ein wenig zu lang war, fiel in einem umgekehrten Fragezeichen über seinen Nasenrücken. Er seufzte, drehte sich zum Fenster, und warme Farbflecken flössen von den Vorhängen auf seine schlafende Figur.
Blumen. Das Haus roch nach Blumen. Es war ruhig. Sogar die Farben waren ruhig. Er hatte alles gesehen: den korallenroten Teppich in der Diele; die Schale mit Rosen auf dem Küchentisch; die glitzernden Töpfe mit Keksen, Nudeln, Linsen und Reis auf der warmen Oberfläche der Schränke. Und er hatte die blassgelbe Spinne gesehen, deren Farbe so gut zu den gelben Rosenblättern passte, in denen sie sich versteckte. Er würde nichts sagen. Die Spinne beobachtete ihn aus ihrem Versteck, und ihre langen Vorderbeine zitterten vor Anspannung ‒ er hatte das schon mal bei einer Katze gesehen. Es war auf dem Rasen, sie saß da, fett, wie diese Spinne, halb geduckt, sie zitterte, bis sie ihm Leid tat, weil sie Angst zu haben schien, sich zu bewegen. Und dann sprang sie los, rannte auf das Beet zu und fing einen Vogel, den sie dann nachlässig im Maul trug, sie starrte blicklos zum Fenster, und da verstand er mit elender Sicherheit, dass das Zittern kein Zeichen von Angst, sondern von Aufregung war. Er hatte das alles gesehen, bis ihm die Augen vom Hinschauen wehtaten und er es ignorieren wollte.
Der Junge döste, wachsam auf jedes Geräusch horchend, er wachte oft auf, immer voller Angst und orientierungslos in der neuen Umgebung. Die Frau mit dem glänzenden Haar roch nach Handcreme. Er mochte den Mann nicht. Der Kopfkissenbezug fühlte sich kühl an seinem Hinterkopf an, und er drehte sich um, um ihn mit seinem Gesicht anzuwärmen. Das Kissen roch nach Bügeln und dem Wäscheschrank. Er sah im Geiste das Gesicht des Mannes, seltsam, kränklich, und es machte ihm Angst. Ich mag ihn nicht! Dieser Gedanke hatte keine klare Form, keine Kontur, er fühlte es mehr wie eine innere Furcht. Er schloss seine Augen ganz fest und stellte sich vor, wie die Frau den Mann wegjagte.
Fraser war wach und wartete auf sie. Sie zog sich aus und schlüpfte in ein weites T-Shirt. Er sah sie unverwandt an, ohne zu zwinkern.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie. Sie kroch unter die Bettdecke und legte eine Hand auf seine Brust. Er fühlte sich klamm an, sie stützte sich auf einen Ellbogen, um ihn anzusehen. »Ich weiß«, sagte sie. »Wir hatten abgemacht, keine Kinder mehr bis zum Herbst.« Sie zog entschuldigend die Schultern hoch. »Max hat mich regelrecht überfallen, er hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt. Es tut mir Leid, Fraser.«
Später, bei Toast und Tee am Küchentisch, brachte er das Thema noch einmal auf. »Eine Woche Vorbereitung, dann auf deine Vortragsreise, hast du gesagt. Ich sollte die Zeit nutzen, um alles für das nächste Semester klarzumachen und um dann noch ein paar Reparaturen zu erledigen.«
»Und dann würden zwei Wochen für eine gemeinsame Reise übrig bleiben, ich weiß.« Die Sonne schien durchs offene Fenster, Vogelgesang drang in verstümmelten Wellen hinein.
»Du hältst dich also nicht an die Spielregeln«, warf er ihr vor.
Als sie ihn das erste Mal traf, lange bevor die siebzehn Jahre in England seinen Dialekt zu einem brummenden Tonfall abgeschliffen hatten, war Frasers Glasgower Akzent für Jenny nahezu unverständlich gewesen. Es war das zweite Jahr ihres Studiums der Krankenpflege und Psychologie, und sie war gerade erst zurückgekehrt, nachdem sie sechs Wochen im Sommer in den Staaten gearbeitet hatte. Sie war mit einem Hochgefühl heimgekehrt, das mehr auf Erleichterung denn auf Selbstvertrauen gründete. Sie war noch nie so weit weg gewesen, sogar die Hochschule hatte sie so ausgewählt, dass sie nahe bei Freunden und der Familie sein konnte; und obwohl es ihr gut gefallen hatte, war es schön, wieder in heimischen Gefilden zu sein.
Das Semester hatte mit einem Nebel angefangen, der den öffentlichen Nahverkehr zum Stillstand brachte, aber Jenny und ein paar Freunde wollten lieber zu Fuß gehen, als den ersten Tag verpassen. Es war nicht so weit von ihrer Wohnung in Wavertree zur Hochschule, sie lachten und redeten den ganzen Weg über, taten geheimnisvoll und fühlten sich in der alles einhüllenden Düsternis geborgen.
Jenny trennte sich nach der Vorlesung von der Gruppe, weil sie vor dem Mittagessen noch etwas in der Harold Cohen Bibliothek nachschlagen wollte. Der Weg zur Bibliothek war ein kurzer Gang vom Biologiegebäude, am Hof vorbei und durch einen Torbogen; einfach an einem klaren Tag, wenn man mit dem Grundriss der Gebäude und den Wegen und Sackgassen vertraut war, aber dieser Teil der Universität war eine Mischung aus viktorianischem Stil, Art Deco aus den vierziger Jahren und funktionalen Glas- und Betongebäuden aus den Sechzigern. Es schien kein verbindendes Schema zu geben, und die Ansammlung von Geländen mit und ohne Zaun, Untergeschossen und Sackgassen war im Dunst, der vom Mersey aufzog, besonders verwirrend.
Rechts von ihr konnte Jenny den Verkehr auf dem Brownlow Hill wie ein langes, monotones Dröhnen hören und nicht wie sonst einen Dopplereffekt aus den hohen und tiefen Tönen der schnell fahrenden Autos um die Mittagszeit.
Aus dem braunen Mief links von ihr hörte Jenny ein deutliches und leidenschaftliches »Scheiße!«. Dann stolperte eine dunkle und sehr gut aussehende Person von links aus einem Weg.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte sie und sah ihn mit unverhohlenem Interesse an. Der Fremde murmelte etwas Unverständliches.
Sie zog die Augenbrauen hoch und lächelte. »Wie bitte?«
»Ich habe schon genug von diesem Rattenloch, dabei ist es gerade mal mein erster Tag.«
Ihre Ohren fingen an, sich an den Akzent zu gewöhnen, so dass sie ihn ohne allzu große Schwierigkeiten verstehen konnte.
»Ich weiß, was du meinst«, sagte sie, »ich komme aus diesem Rattenloch.«
»Oh, entschuldige, es ist bloß …« Er sah in den dreckigen Dunst um ihn herum.
Sie lachte. »Es ist nicht immer so. Ich heiße übrigens Jenny.«
Fraser kam zu spät zu seiner ersten Vorlesung, nachdem er sich bei dem Versuch, nur mit Hilfe eines Straßenführers zu Fuß vom Wohnheim in Mossley Hill zur Universität zu kommen, hoffnungslos verlaufen hatte.
»Warum hast du nicht auf den Bus gewartet?«
»Im Radio hieß es, dass sie nicht fahren.«
»Das betrifft nur die Mersey Busse. Die Wohnheime haben ihre eigene Busflotte, um die zarten Lieblinge von A nach B zu bringen, ohne dass sie neben dem bösen, dreckigen Volk stehen müssen.«
»Warum weißt du so viel darüber?«, fragte er, als sie gemütlich bei einem Bier und zwei Tüten Chips im Pub Augustus John saßen.
Jenny zupfte an ihrem Schal. »Erkennst du die Unifarben nicht?«, fragte sie.
»Wie ich gesagt hab …«
»Du bist erst gestern Abend angekommen und kennst dich noch nicht aus.« Er grinste, und Jenny musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht zu stöhnen. Er war wirklich wundervoll. »Du wolltest nicht wirklich mit dem ersten Zug wieder heimfahren, oder?«
Er guckte ein bisschen verlegen.
»Sieh mal, sie wirken vielleicht wie eine Menge Snobs und Privatschulidioten, aber das hegt nur daran, dass du die Einführungswoche verpasst hast und keine Gelegenheit hattest, die Guten von den Bescheuerten zu trennen. Sie sind nicht alle schlecht.« Er sah sie zweifelnd an, und sie fügte hinzu, »meistens ist es nur Fassade. Sie haben genauso viel Panik wie du oder ich.«
Er nippte an seinem Bier, immer noch unsicher. »Glaubst du?«
Sie machte das Pfadfinderehrenwortzeichen. »So. Was studierst du?«, fragte sie.
Er wurde rot und nahm einen großen Schluck Bier.
»Ich studiere Psychologie und Krankenpflege«, sagte sie. »Im zweiten Jahr«, fügte sie hinzu und grinste angesichts der unwürdigen Selbstgefälligkeit, die ihr die zusätzliche Erfahrung eines Jahrs gab. »Also?«
Er rutschte unwohl herum. »Ich studiere auch zwei Fächer«, sagte er.
»Welche?« Sein ausweichendes Gerede nervte langsam.
»Soziologie und —«, er zuckte die Schultern und wurde noch etwas stärker rot ‒, »Geographie.«
Jenny grinste und hob dann die Hände auf seine gegrummelte Antwort hin. »Ich verspreche, dass ich es keiner Menschenseele sagen werde«, sagte sie.
Sie hatte ihn davon überzeugt, da zu bleiben, und während des Studiums wurden sie, etwas enttäuschend für Jenny, gute Freunde. Nach dem Abschluss waren sie in Kontakt geblieben und hatten sich manchmal mit anderen Kommilitonen getroffen, aber dann immer öfter allein. Ohne die Ablenkung der üblichen Clique stellten sie fest, dass ihre Freude an der Gesellschaft des anderen mehr als nur platonisch war. Fraser hatte ihr an dem Tag einen Antrag gemacht, an dem er seine erste Lehrerstelle bekam, und Jenny hatte ohne Zögern ja gesagt.
»Wir werden eine Woche wegfahren, das verspreche ich. Mindestens eine Woche ‒ zwei, wenn ich es einrichten kann.« Sie nahm seine Hand. »Max denkt, dass es nur ein paar Wochen dauern wird, seine Eltern zu finden. Er denkt, es könnten Roma sein, die weitergezogen sind und ihn versehentlich zurückgelassen haben ‒« Ein Anflug von Panik, den Jenny schon vorher in Frasers Gesicht bemerkt hatte, war wieder da, und Jenny erinnerte sich an etwas, das Max ihr einmal gesagt hatte: »Es ist leicht, die Monster der Kindheit zu verjagen ‒ man braucht nur ein bisschen Magie und viel Vertrauen; die Teufel der Erwachsenen sind viel zäher.«
»Fraser«, sagte sie. »Ist alles in Ordnung? Vorhin, im Treppenhaus ‒ du hast furchtbar ausgesehen.«
»Es war der Schock, das ist alles. Ich dachte ‒«
»Du hast gedacht, Luke wäre nach Hause gekommen.« Sie schüttelte den Kopf. »Es tut mir wirklich Leid.« Sie stand auf und beugte sich über den Tisch, um Fraser zu küssen. Er ging darauf ein, berührte ihre Wange mit seinem Handrücken, streichelte ihren Nacken und zog sie an sich.
Jenny machte sich zärtlich los. »Ins Bett?«, fragte sie. Er nickte, und sie sah, dass er ihr verziehen hatte.