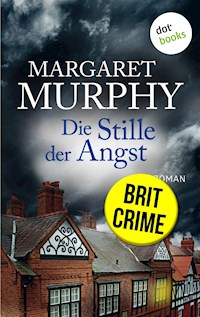4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dunkelheit legt sich über Liverpool, die Stadt der Mörder! Der Kriminalroman »Wer für das Böse lebt« von Margaret Murphy jetzt als eBook bei dotbooks. Der junge Sergeant Forster und Chief Inspector Alan Jameson müssen in Liverpool gleich zwei rätselhafte Mordfälle aufklären – die einzige Verbindung zwischen den Opfern: Beide Frauen haben früher im selben Kinderheim gearbeitet. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Polizisten auf eine Mauer aus Schweigen – es scheint, als sei die dunkle Wahrheit schon vor langer Zeit begraben worden, um nie wieder ans Tageslicht zu kommen. Einzig die Kinderpsychiaterin Christine Radcliffe ist bereit, ihnen zu helfen. Doch während Jameson zunehmend fasziniert von der smarten Psychologin ist, beschleicht ihn der Verdacht, dass sie weitaus mehr darüber weiß, wer in dem perfiden Mörderspiel Opfer und wer Täter ist … »Margaret Murphy schreibt typisch britische Krimis mit dem Tempo eines amerikanischen Thrillers – genau solche Romane brauchen wir!« Bestsellerautor Mo Hayder Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Kriminalroman »Wer für das Böse lebt« von Margaret Murphy ist der Auftakt ihrer spannungsgeladenen Reihe um die »Liverpool Police Station«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der junge Sergeant Forster und Chief Inspector Alan Jameson müssen in Liverpool gleich zwei rätselhafte Mordfälle aufklären – die einzige Verbindung zwischen den Opfern: Beide Frauen haben früher im selben Kinderheim gearbeitet. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Polizisten auf eine Mauer aus Schweigen – es scheint, als sei die dunkle Wahrheit schon vor langer Zeit begraben worden, um nie wieder ans Tageslicht zu kommen. Einzig die Kinderpsychiaterin Christine Radcliffe ist bereit, ihnen zu helfen. Doch während Jameson zunehmend fasziniert von der smarten Psychologin ist, beschleicht ihn der Verdacht, dass sie weitaus mehr darüber weiß, wer in dem perfiden Mörderspiel Opfer und wer Täter ist …
»Margaret Murphy schreibt typisch britische Krimis mit dem Tempo eines amerikanischen Thrillers – genau solche Romane brauchen wir!« Bestsellerautor Mo Hayder
Über die Autorin:
Margaret Murphy ist diplomierte Umweltbiologin und hat mehrere Jahre als Biologielehrerin in Lancashire und Liverpool gearbeitet. Ihr erster Roman »Der sanfte Schlaf des Todes« wurde von der Kritik begeistert aufgenommen und mit dem First Blood Award als bester Debüt-Krimi ausgezeichnet. Seitdem hat sie zahlreiche weitere psychologische Spannungsromane und Thriller veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Heute lebt sie auf der Halbinsel Wirral im Nordwesten Englands.
Die Website der Autorin: www.margaret-murphy.co.uk/
Bei dotbooks veröffentlichte Margaret Murphy ihre Reihe um die Liverpool Police Station:
»Wer für das Böse lebt – Band 1«
»Wer kein Erbarmen kennt – Band 2«
»Wer Rache sucht – Band 3«
Außerdem ist bei dotbooks ihre Thriller-Reihe um die Anwältin Clara Pascal erschienen:
»Warte, bis es dunkel wird – Band 1«
»Der Tod kennt kein Vergessen – Band 2«
Sowie ihre psychologischen Spannungsromane:
»Die Stille der Angst«
»Der sanfte Schlaf des Todes«
»Im Schatten der Schuld«
»Das stumme Kind«
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »The Desire of the Moth« bei Macmillan Publishers, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »Wie Motten das Licht« bei Goldmann.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Margaret Murphy
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 by Wilhelm Goldmann Verlag, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Diogo Shruberry
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-252-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wer für das Böse lebt« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Margaret Murphy
Wer für das Böse lebt
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Karin Szpott
dotbooks.
Für
Lisanne, Jane und Beverley
Prolog
Ein dicker Dreiviertelmond stand tief am Horizont hinter den Bäumen und schien jede seiner Bewegungen stumm und mißbilligend zu verfolgen ‒ jedenfalls kam es ihm so vor, gespannt wie seine Nerven waren. Dabei wurden die staubigen Felder in ein fahles Licht getaucht. Lange Schatten bildeten nahezu tiefschwarze Löcher, in denen man sich verstecken konnte. In zehn Minuten würde sie wie jeden Abend den Weg, der einen Meter vor ihm aufschimmerte, mit ihrem Hund entlangkommen, einem albernen, herumschnüffelnden und kläffenden Stück Fell, das aussah wie ein bräunlicher Mopp. Erst der Hund, dann sie. Rasch, leise und endgültig.
Ann hatte ihn sofort erkannt. Obwohl es dunkel war. Obwohl eine Skimütze sein Gesicht verdeckte. Aber was noch wichtiger war, sie hatte gewußt, warum. Das hatte ihm eine schmerzliche Erklärung erspart und ihm eine Art Rechtfertigung geliefert: Da sie sich erinnern konnte, hatte sie eindeutig ihre Schuld zugegeben. Angst hatte sie keine gehabt, nein, erst nicht, aber später hatte sie gelernt, ihn zu fürchten.
Kapitel 1
Beim ersten Fall sprach die regionale unabhängige Tageszeitung von Verschwinden, aber Chris hatte nur selten Zeit, die Nachrichten im Fernsehen anzuschauen, und hörte nie den örtlichen Radiosender, erst recht nicht, seitdem sie dort eine eigene Sendung hatte. Der zweite Fall wurde auch in der überregionalen Presse gebracht.
»Was tust du da?« Ted May schlug ungehalten eine Ecke seiner Zeitung um und sah finster zu seiner Kollegin hoch. »Ich versuche, über deine Schulter zu lesen, aber du machst es mir nicht gerade leicht.« Chris runzelte die Stirn.
Sie verbrachten gerade ihre Pause im Gemeinschaftsraum der Abteilung für Kindliche Entwicklungspsychologie des Hazel-Mount-Kinderkrankenhauses. Der Raum nahm ein Fünftel der Gesamtfläche der Abteilung ein. Auf dieses Ungleichgewicht hatten die Psychologen und Logopäden während der vorangegangenen wochenlangen Hitzeperiode des öfteren aufmerksam gemacht. Sie mußten ihre Sitzungen bei lähmenden Temperaturen in unzulänglichen Zimmern abhalten.
»Hat dir noch nie jemand gesagt, daß es sich nicht gehört, über anderer Leute Schulter zu lesen?«
»Leider nein. Schlechte Erziehung. Ich gieße außerdem die Milch vor dem Tee in die Tasse. Was ist denn bloß heute morgen mit dir los?«
»Die Hitze«, sagte Jo Dowling, ohne von dem Bericht aufzusehen, den sie gerade las. »Sei froh, daß du gestern nicht hier warst. Nachmittags war es nicht mehr auszuhalten mit ihm.«
»Dann versuch du doch mal, bei 30 Grad Hitze in einem stickigen Raum Kinder mit Konzentrationsstörungen zu beurteilen.«
»Wenn du es nicht kannst, kann es keiner«, räumte Chris ein. Ted war bekannt für seine unendliche Geduld sowohl mit Eltern als auch mit Kindern. »Aber jetzt laß mich mal einen Blick in die Zeitung werfen. Ich glaube, ich kenne sie.«
»Die Sozialarbeiterin?« fragte er. »Warum hast du das denn nicht gleich gesagt?«
Chris wollte etwas erwidern, hielt aber inne. »Ich weiß auch nicht«, sagte sie. »Ist nicht so wichtig.«
Die Überschrift lautete:
Zweite Sozialarbeiterin entführt
Darunter war ein Foto des Weges abgebildet, auf dem Ann Lee zuletzt gesehen worden war. Die Polizei hatte den Weg mit gestreiftem Band abgesperrt. Chris überflog den Text und nahm bereits beim ersten Lesen fast alle Fakten auf. Anns kleiner Hund war auf dem Fußweg erwürgt aufgefunden worden, die Leine fest um den Hals gewickelt. Aber man hatte keine Spur von seiner Besitzerin gefunden.
Ted beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Insgeheim genoß er es, Dr. Christine Radcliffe einmal so nah zu sein. Ihr Parfum war leicht und unaufdringlich, aber er roch es, als sie sich beim Lesen über ihn beugte. Sie legte eine Hand auf seine Schulter; durch sein Hemd hindurch spürte er ihre Wärme und mußte sich zwingen, normal weiterzuatmen. Ihr Haar, das sorgfältig hochgesteckt war, glänzte wie mattes Gold. Sie war leicht gebräunt; dadurch hatte ihre sonst eher blasse Haut einen gesunden Schimmer angenommen. Chris war nur leicht geschminkt, gerade so viel, daß ihre Vorzüge noch betont wurden: ihre ausdrucksvollen, violett-blauen Augen und ihr üppiger, sinnlicher Mund.
Frances Lowe, die in der Küchenecke des Gemeinschaftsraumes stand, drehte sich zum Waschbecken um, und weil sie die Hitze nicht länger ertragen konnte, riß sie ein Papierhandtuch vom Halter, tränkte es mit Wasser und betupfte sich damit sorgfältig ihr Gesicht. »Diese verdammte Hitze!« murmelte sie. Als sie sich wieder umwandte, hielt Chris Radcliffe die Zeitung in den Händen, und sowohl Jo als auch Ted sahen sie mit einer Mischung aus Besorgnis und Neugier an.
»Was in aller Welt ist denn auf einmal los?« wollte sie wissen. Offensichtlich hatte sie etwas Wichtiges verpaßt.
»Die Sozialarbeiterin«, sagte Jo und riß die Augen auf, um ihre Bemerkung noch zu betonen. »Chris kennt sie.«
»Kannte sie«, verbesserte Chris, während sie weiter las. »Beruflich. Wir haben eine Weile zusammengearbeitet.«
»Die, die verschwunden ist?« fragte Fran und fuhr mit einem leichten Schauder von Vergnügen fort: »Wie furchtbar.«
Jo sah die Sprechstundenhilfe mit vorwurfsvoll gerunzelter Stirn an. Frances konnte manchmal wirklich unsensibel sein. Fran warf ihr einen frechen Blick zu und klapperte mit ihren hochhackigen Sandalen hinüber zum Couchtisch. Dabei hielt sie in der einen verschwitzten Hand ein Glas Wasser und in der anderen ein feuchtes Papierhandtuch. Sie stellte das Glas vorsichtig auf den Tisch und tupfte sich mit dem Papierhandtuch über die Stirn. Dadurch rutschte ihr Pony nach oben, und sie wirkte auf einmal zerzaust und mädchenhaft. Auf ihren runden, rosigen Wangen erschienen vergnügte Grübchen. »Also, los … erzählen Sie uns alles über sie.«
Jo verdrehte die Augen. »Sie sind wirklich unmöglich, Frances.«
»Versuchen Sie ja nicht, uns weiszumachen, daß Sie das nicht interessiert.« Frans Verachtung war deutlich zu spüren. Jo Dowling wurde langsam größenwahnsinnig, nur weil sie bei ein paar Beurteilungsgesprächen dabei gewesen war. Sie hielt Jos starrem Blick stand, sah in die ausdruckslosen, grauen Augen der Logopädin, forderte sie zum Widerspruch heraus.
»Es gibt nichts zu erzählen«, sagte Chris mit nüchterner Entschiedenheit. »Es muß zehn Jahre her sein, daß ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich hab sie eigentlich nur bei ein paar Besprechungen von irgendwelchen Fällen getroffen.«
Fran schmollte. »Also, wenn das alles ist, warum erzählen Sie uns dann überhaupt, daß Sie sie kannten?« Sowohl Ted als auch Jo starrten sie an, und sie hob trotzig das Kinn.
»Das ist die zweite«, sagte Ted schließlich.
»Ja«, erwiderte Chris. »Die zweite.«
»Die andere war diese Mutter von zwei Kindern, ein Stück die Straße runter.«
»Auf dem Nachhauseweg von der Aerobicstunde entführt«, sagte Fran aufgeregt. »Ist das nicht schrecklich? Wenn ich nur daran denke … Es hätte jeden von uns treffen können.«
Jo sah Fran an. Sie bezweifelte, daß Fran jemals in ihrem Leben eine Aerobicstunde gehabt hatte. »Ziemlich unwahrscheinlich, Fran«, sagte sie. »Oder haben Sie etwa jemals für das Jugendamt gearbeitet?«
Frans Gesicht nahm einen Moment lang einen verständnislosen Ausdruck an, dann formten sich ihre fleischigen Lippen zu einem perfekten ›O‹. Sie gab sich keine Mühe, ihre Aufregung zu verbergen und sagte: »Sie meinen, es hat etwas mit der Kinderheimgeschichte zu tun?« Ihre Augen wurden größer. »Haben Sie nicht damals für das Jugendamt gearbeitet, als diese Geschichte passiert ist, Chris?«
Jo zischte Fran an und warf Ted einen flehentlichen Blick zu, aber der war gerade damit beschäftigt, eingehend Chris’ Gesichtsausdruck zu studieren. Also wirklich, dachte sie, er könnte seine Anbetung ruhig ein bißchen weniger deutlich zum Ausdruck bringen. Jo mochte Ted May. Bei all seiner chaotischen, ziemlich rauhen Persönlichkeit besaß er eine ungeheure Intuition, die er sehr erfolgreich einsetzte. Als Logopädin war Jo bei unzähligen Sitzungen mit Eltern und Kindern dabei gewesen und hatte diesen großen, schwerfälligen Mann beobachtet. Wie er sich irgendwie zusammengefaltet hatte, damit er sich neben seine Patienten in ein winziges Kinderstühlchen zwängen konnte. Wie er scheinbar zufällig irgendwelche Tests auswählte und dabei die ganze Zeit mit dem Kind und den Eltern sprach, offenkundig harmlose Fragen stellte und so selbst diejenigen aus der Reserve lockte, die sich zuvor äußerst abwehrend verhalten hatten. Er lernte innerhalb von einer Stunde ihre Probleme so genau kennen wie manche ihrer Sozialarbeiter erst nach Monaten oder Jahren.
Wenn ein Fall in eine Sackgasse geraten war, wurde oft Ted hinzugezogen, angeblich, um eine gutachterliche Stellungnahme vorzunehmen, in Wirklichkeit aber, um eine Lösung zu finden, die beiden Seiten zusagte.
Sie blickte ihn an. Mit seinen grauen Haaren, die von der Stirn bis zum Scheitel in einer Reihe hochstanden, sah er aus wie ein alternder Punker.
Wenn Chris um die Stärke seiner Gefühle zu ihr wußte, so zeigte sie es nicht; Jo war sich sicher, daß sie Ted respektierte, aber sie war ebenso davon überzeugt, daß Chris den Mann lediglich wegen seiner beruflichen Fähigkeiten bewunderte, sich gern in seiner Gegenwart aufhielt und ihn als Kollegen schätzte.
Fran seufzte und stand auf, um sich ein Glas Wasser einzugießen. Ted erhob sich und näherte sich Chris. Jo hörte, daß er ihr etwas zumurmelte. Er beugte sich über sie, während sie den Artikel noch einmal las.
»Ich bin verdammt noch mal nicht behindert, Ted«, antwortete Chris. Dabei drehte sie sich zu schnell um und stieß mit ihm zusammen. Sie fluchte leise, drückte ihm die Zeitung in die Hand und ging aus dem Zimmer, irgend etwas vor sich hin murmelnd.
Darren Lewis kniete auf dem dreckigen Beton und las die Zeitung. Er hatte sie dazu benutzt, ein Feuer anzufachen. Eine Versicherungsgeschichte ‒ leeres Grundstück. Nichts Unangenehmes.
Skandal um Calderbank-Kinderheim
Die Überschrift traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Er hatte in letzter Zeit ziemlich viel mit der Presse zu tun gehabt ‒ auf die eine oder andere Weise. Erst diese blöde Kuh Hardy, die sich immer widerspruchslos alles hatte gefallen lassen, dann der alte Fischkopf Lee, und jetzt das. Skandale um Kinderheime: Das schien für die Presse immer ein gefundenes Fressen zu sein. Die Journalisten interessierte nicht, daß es sich dabei um Menschen mit Gefühlen handelte, die einen Ruf zu verlieren hatten. Kinder, die wie Huren von der Lime Street behandelt worden waren, gaben der ganzen Sache lediglich mehr Biß: Kindesmißhandlung erregte nach wie vor große Aufmerksamkeit.
Lewis wurde plötzlich ganz heiß, und seine Augen fingen an zu tränen. Bloß der Staub in der Luft, beruhigte er sich. »Ich muß ja nicht dran denken«, sagte er laut. »Sie können mich nicht dazu zwingen.«
Er konzentrierte sich darauf, Feuer zu machen; das war eine Kunst, bei der man vorsichtig und sorgfältig vorgehen mußte. Wenn man es zu eng schichtet, bekommt es nicht genug Luft ‒ oder schlimmer noch, es schmort unter Umständen stundenlang vor sich hin, ohne daß es richtig in Brand gerät; eine Katastrophe, wenn ein Neugieriger den Rauch entdeckt. Wenn man es aber zu locker schichtet, flammt es auf und geht sofort wieder aus, ohne daß es Hitze erzeugt.
Er hielt inne, nahm erneut die weggeworfene Zeitung in die Hand und merkte sich den Namen des Journalisten: Milton. Vielleicht würde er Milton mal anrufen. Vielleicht würde er ihm auch mal einen Besuch abstatten.
Er faltete die Zeitung, rollte sie fest zusammen und stopfte sie unten ins Feuer.
Als Chris ihre Sitzung kurz nach zwölf beendet hatte, wartete Fran draußen auf sie. Sie wußte, daß sie gut daran tat, Dr. Radcliffe während einer Sitzung nicht zu stören; was Mr. May hinnahm, akzeptierte Dr. Radcliffe noch lange nicht. Chris bemerkte den Ausdruck stiller Zufriedenheit auf Frans Gesicht.
»Detective Sergeant Foster von der Kriminalpolizei, Abteilung Merseyside, möchte einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Er hat eine Telefonnummer hinterlassen.«
Chris’ Magen zog sich zusammen. Also doch. Sie hatten eine Verbindung hergestellt. »Ich erledige das sofort«, erwiderte sie und nahm das Stück Papier aus Frans feuchten Händen.
»Ist Ihnen heiß?« fragte Fran munter.
»Was?« Chris folgte dem Blick der Sprechstundenhilfe durch das kleine Zimmer, wo sie ihre Sitzung abgehalten hatte. Ihre Jacke war über die Rückenlehne eines Sessels gehängt. Du darfst dich von Fran nicht aus der Fassung bringen lassen, dachte sie, lächelte ein wenig und machte sich bewußt, daß diese Frau nicht raffiniert genug für Zweideutigkeiten war. Gönn ihr doch diesen kleinen Triumph.
Sie nahm ihre Jacke und ging in ihr Büro, das sie mit Ted May teilte. Die Vorhänge waren zugezogen, und der Raum war dunkel, aber sie machte kein Licht. Ted hatte im Nebenzimmer gerade eine Sitzung, und die Jalousie, die normalerweise den Spionspiegel verdeckte, war hochgezogen. Chris sah, daß die Mutter angespannt auf der Vorderkante ihres Sessels hockte. Ted saß mit dem Rücken zum Spiegel und unterhielt sich auf seine übliche entwaffnende Art mit ihr. Chris konnte kein Wort verstehen ‒ der Lautsprecher war ausgeschaltet. Sie wandte sich ab und setzte sich an den Schreibtisch, um die Nummer zu wählen, die Fran ihr gegeben hatte. Sergeant Foster verabredete mit ihr, daß er nachmittags vorbeikommen würde. Nur Routinefragen, versicherte er ihr, aber er weigerte sich, ihr das näher zu erklären. Ein leichter Luftzug setzte den schweren Verdunklungsvorhang in Bewegung, und Chris schloß die Augen. Sie genoß die kurze Abkühlung.
»Entschuldigung.«
Chris öffnete ihre Augen wieder. Dr. Silverman war aus dem benachbarten Büro hereingekommen. Sie war die Neurologin der Abteilung, die bei Sitzungen oft hinzugezogen wurde. Sie arbeitete eng mit dem Team zusammen, gab Ratschläge bei schwierigen Diagnosen, machte Vorschläge zur Behandlung und Therapie. »Ted hat mich gebeten, diese Sitzung hier mit zu beobachten. Macht es dir etwas aus?«
»Nein, nur los«, sagte Chris.
Sie streckte ihre Hand aus und legte unter dem Spiegel einen Schalter um. Teds Stimme donnerte plötzlich: »… kein Problem?«
Die Frau zuckte mit den Schultern. »Sie behaupten, es gibt keins.«
Die Tür zum Sitzungszimmer ging auf, und ein Junge kam hereingerannt. Er war acht oder neun Jahre alt, und obwohl er rote Haare hatte wie seine Mutter, waren seine Augen schmal und schräggestellt und verliehen ihm ein orientalisches Aussehen. Seine Bewegungen hatten etwas Hektisches, fast Manisches. Er ging, ohne seine Mutter zu beachten direkt zu dem Tisch, der vor dem Spiegel stand. Er nahm Spielzeug in die Hand, legte es wieder hin und machte dazu ständig laute Geräusche: Grollen und Schreie, aber keine richtigen Worte. Dann fiel ihm plötzlich der Spiegel auf. Er stieß vor Überraschung einen Schrei aus und fing an, Grimassen zu schneiden und den Mund zu verziehen. Seine schiefen Zähne sahen so aus, als seien sie nach dem Zufallsprinzip in seinem Mund verteilt worden, sie waren der physische Ausdruck seiner chaotischen Psyche. Er verdrehte die Augen, stöhnte bei seinem Anblick und kletterte sogar auf den Tisch, um besser sehen zu können.
Seine Mutter ging zu ihm hin und sprach ihn an. Er schien sie nicht zu hören. Sie hockte sich neben ihn und streichelte ihm über das Gesicht, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. »Jason, du solltest doch nicht reinkommen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst bei Daddy bleiben.«
Der Junge protestierte aufgebracht.
»Geh wieder zu Daddy«, sagte sie bestimmt.
Der Junge verließ widerstrebend das Zimmer, nur um ein paar Minuten später erneut hereinzuplatzen und seine vorherigen Handlungen zu wiederholen.
»Und er spricht kein einziges Wort?« fragte Ted.
»Früher schon, bis er die Hirnhautentzündung hatte. Seitdem nicht mehr.«
»Und sein Gehör ist normal?«
»Den Tests zufolge ja.«
Ted nickte. »Er scheint zu verstehen, was Sie ihm sagen.«
»Simple Anweisungen.«
»Und die Schule beharrt darauf, daß er einfach nur langsam sei beim Lernen.«
Dr. Silverman stand mit leicht gespreizten Füßen da, die Hände tief in den Taschen ihres Kittels vergraben. Sie beobachtete die Gruppe im Besprechungszimmer aufmerksam und blinzelte dabei über ihre halbmondförmigen Brillengläser hinweg. Ihre intelligenten grauen Augen sahen rasch von der Mutter zum Kind und zurück zu Ted.
»Und es gibt keine anderen Probleme …« Ted setzte eine seiner üblichen Techniken ein: Er kam auf eine frühere Frage zurück, die seiner Meinung nach nicht ausreichend beantwortet worden war.
Dr. Silverman wandte sich zu Chris um. »Er ist zur Zeit an einer Schule für Erziehungshilfe«, erklärte sie.
Chris nickte und betrachtete durch den Spiegel die Frau, die ihre Haltung im Sessel verändert hatte und ihr Kind beobachtete.
»Es kommt drauf an«, erwiderte die Mutter.
»Richtig …« Ted machte eine Pause, und als sie nicht fortfuhr, fragte er: »Und wovon hängt es ab?«
Chris sah, wie sich der Kiefer der Frau anspannte. Ihr Sohn hatte eine der Puppen auseinandergerissen und wirkte nun beunruhigt wegen des Schadens, den er angerichtet hatte. Er lief zu ihr, drückte ihr das Spielzeug in die Hand und stieß dabei dringliche Grunzgeräusche aus. Sie fügte, während sie sprach, die Puppe mit geübten Bewegungen wieder zusammen. »Wovon es abhängt?« wiederholte sie. »Vom Lehrer. Von der Tageszeit. Vom Wetter.«
Ted ließ zu, daß die Gesprächspause länger wurde, er machte deutlich, daß er sie nicht drängen, sondern ihre Sichtweise hören wollte.
»Sie sagen, daß es ihm gut gehe, aber ob ich ins Krankenhaus kommen könne, weil er mit der Faust ein Fenster kaputtgeschlagen hat. Er ist kein Problemfall, aber er hat einen Lehrer geschlagen oder ein Kind gebissen oder einen Stuhl zertrümmert, oder er hat einen Wutanfall, und keiner traut sich an ihn ran …« Sie hielt inne, überrascht, daß sie sich zu einer so unvorsichtigen Antwort hatte hinreißen lassen. Gleichzeitig wirkte sie besorgt darüber, was der Psychologe wohl dazu sagen würde. Sie war daran gewöhnt, die Schuld für das Verhalten ihres Sohnes auf sich zu nehmen, und jetzt wurde ihr auf einmal klar, daß sie all die Jahre, in denen ihr Umgang mit Jason unterschwellig kritisiert worden war, verbittert hatten.
Ted versuchte, einige Tests mit dem Jungen durchzuführen, aber er mußte aufgeben, weil der Junge begann, die Karten zu zerreißen, als er feststellte, daß er sie nicht entsprechend der Vorlage im Buch anordnen konnte.
»Konzentrationsstörung?« fragte Chris.
Dr. Silverman nickte und heftete ihren eindringlichen Blick auf sie.
»Aber noch weit mehr als das …«
Die Neurologin nickte zustimmend, ihre leichten grauen Locken wippten vor jugendlichem Enthusiasmus. »Konzentrationsstörung, Epilepsie, Aphasie … Gehirnschaden nach einer Hirnhautentzündung. Das arme Kind braucht dringend Hilfe.«
»Seine Mutter auch«, sagte Chris.
»Seine Mutter vielleicht sogar noch mehr.« Dr. Silverman erhob sich, um zu gehen. Sie schaltete den Lautsprecher ab und entschuldigte sich nochmals für die Störung.
Nach ein paar Minuten sah Chris, wie sich die Tür zum Besprechungszimmer öffnete und eine Pantomime ablief, in deren Verlauf Ted Dr. Silverman vorstellte, die der Mutter die Hand gab, sich dann setzte und etwas zu ihr sagte.
Chris wandte sich ihrem Computer zu und fing an, die Notizen, die sie sich bei ihrer eigenen Sitzung gemacht hatte, abzutippen. Doch sie konnte sich kaum konzentrieren. Was wollte Sergeant Foster?
Die erste, die verschwunden war, war Dorothy Hardy gewesen, eine stille, mollige, matronenhafte Frau, eine ehemalige Lehrerin, die sich im Alter von dreißig Jahren entschlossen hatte, ihren Job als stellvertretende Leiterin einer Grundschule aufzugeben und statt dessen auf Abruf bei der städtischen Schulbehörde Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu betreuen. Eine ziemlich schüchterne Person, die vor Konflikten zurückschreckte und sich bei Grenzfällen immer der Mehrheit anschloß.
Mutter von zwei Kindern, hatte in der Zeitung gestanden. Die Kinder mußten erst später gekommen sein; sie hatte keine Kinder erwähnt, als Chris mit ihr zusammengearbeitet hatte.
Sie wurde durch ein Klopfen an der Tür hochgeschreckt. Es war eine von Teds eher liebenswerten Besonderheiten, daß er an die Tür zu seinem eigenen Büro klopfte, wenn er annahm, daß Chris sich darin aufhielt.
»Ich störe doch nicht, oder?«
Chris sah hoch. »Ich bin allein. Ich wollte gerade Mittagspause machen.«
»Äh …« Ted fummelte an seiner Armbanduhr herum und warf einen Blick nach oben auf die Wanduhr.
»Sie zeigt immer noch halb elf an«, sagte Chris. »Seit zwei Monaten.«
Ted lächelte schwach. »Ich wollte nur sagen … oder eigentlich fragen … ob alles in Ordnung ist. Wegen des Zeitungsartikels meine ich.«
»Hat Fran mit dir geredet?«
Sein Lächeln wurde breiter. »Hört sie jemals auf zu reden? Aber ich habe sie seit der Pause nicht mehr gesehen. Warum? Gibt es etwas, das ich wissen sollte?« Ted entging selten eine versteckte Anspielung. Er kam ganz herein und machte die Tür hinter sich zu.
Chris dachte kurz nach. »Du kannst es genausogut von mir erfahren. Jemand von der Kriminalpolizei aus Merseyside kommt später vorbei, um mir ein paar Fragen zu stellen. Sei nicht gleich beunruhigt, Ted«, fügte sie hinzu, als sie sein besorgtes Gesicht sah. »Nur die üblichen Erkundigungen. Wahrscheinlich reden sie mit jedem, der ihnen womöglich etwas über sie erzählen kann.«
»Aber ich dachte, du kennst diese Lee so gut wie gar nicht … und das ist außerdem Jahre her! Was könntest du ihnen also schon erzählen?«
Chris zuckte mit den Schultern. »Kann ich das Büro haben?« fragte sie. »Ich fühle mich in diesen Sitzungszimmern immer ein bißchen unsicher. Man weiß nie, wer einem noch zuhört.«
Ted errötete leicht. »Ich hoffe, du denkst nicht …«
Chris lächelte gequält. »Jetzt werd’ aber nicht paranoid, Ted. Alles, worum ich dich bitte, ist etwas Privatsphäre.«
Ted runzelte die Stirn, als er sie ansah. »Ich schreibe dir ein Schild ›Bitte nicht stören‹, wenn du möchtest.« Dann ging er und machte die Tür mit einer so überaus kontrollierten Vorsicht hinter sich zu, daß Chris keinerlei Zweifel daran haben konnte, daß er wütend auf sie war.
Kapitel 2
Detective Chief Inspector Alan Jameson mußte mit zuwenig Mitarbeitern auskommen. Sein Vorgesetzter, der Superintendent, hatte ihn von einer Ermittlung abgezogen, die sich mit einer Reihe von Brandstiftungen beschäftigte. Jameson hatte dafür Verständnis, aber Tatsache war, daß ihm weniger Mitarbeiter blieben als er brauchte, um bei den Entführungen zu ermitteln.
Nach der zweiten Entführung hatte man die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß irgend jemand eine Art Rachefeldzug gegen Mitarbeiter des Jugendamtes von Calderbank unternahm. Seine Beamten waren zur Zeit damit beschäftigt, Freunde, Bekannte, derzeitige und ehemalige Kollegen und Patienten der beiden Frauen zu interviewen. Außerdem gingen sie in der Umgebung des Parks, in dem Ann Lee verschwunden war, von Haus zu Haus und stellten Nachforschungen an. Andere überprüften Querverweise von Aufzeichnungen, die bis in die Zeit vor zehn Jahren zurückreichten, als Ann Lee und Dorothy Hardy anfingen zusammenzuarbeiten. Durch die Kombination der beiden Fälle war die Aufgabe gewaltig. Die Computeraufzeichnungen waren relativ leicht auszuwerten gewesen, aber die älteren Akten waren noch nicht alle in die Datenbank der Stadt übertragen worden. Das bedeutete, daß jemand eigenhändig umfangreiche Akten durchsehen und dabei versuchen mußte, Namen herauszufiltern, die sowohl mit Hardy als auch mit Lee in Verbindung gebracht werden konnten.
Der Superintendent von Calderbank hatte getan, was er konnte, hatte alle einander vorgestellt, dafür gesorgt, daß die Kommunikationsmaschinerie gut geschmiert war, und ihnen sogar noch einen Detective Inspector als Verbindungsmann zur Verfügung gestellt. Aber die kleine Dienststelle von Calderbank war sogar noch dünner besetzt als das Polizeipräsidium in Merseyside, und da beide Frauen steuerzahlende Bürgerinnen von Liverpool waren, war dies eine Ermittlung der Polizei von Merseyside.
Er beobachtete traurig und ernüchtert die geschäftige Betriebsamkeit in der Einsatzzentrale. Telefone klingelten und wurden blitzschnell abgehoben, Angestellte gaben Informationen aus den älteren Akten in eine Datenbank ein, Beamte hoben den Hörer ab, um eine Nummer zu wählen oder nahmen Anrufe entgegen, machten sich auf einem Block unverdrossen Notizen, riefen Informationen aus dem Computer ab, tauschten Meinungen und Notizen mit Kollegen aus ‒ all das in der hermetisch abgeriegelten Atmosphäre und den klimatisierten Räumen des Polizeipräsidiums.
»Sie arbeiten wie die Teufel, Chef«, sagte Sergeant Foster, der auf einmal neben ihm auftauchte.
Jameson nickte. »Aber bringt es uns denn auch weiter?«
»Wir haben einige mögliche Verdächtige herausgefiltert …«
»Und was ist, wenn die Verbindung zwischen beiden Frauen reiner Zufall ist? Dann haben wir wertvolle Zeit damit verschwendet, Verbindungen herzustellen, die völlig irrelevant sind. Wir sind noch nicht einmal sicher, ob sie von demselben Mann entführt wurden ‒ wenn sie überhaupt entführt wurden. Und wenn sie noch am Leben sind, können wir es uns nicht leisten, unsere Energien für fruchtlose Vermutungen zu verplempern. Jede falsche Spur kostet Zeit, und es sind Dorothy Hardy und Ann Lee, die für unsere Fehler bezahlen werden.«
Foster kannte diesen fatalistischen Zug bei seinem Vorgesetzten bereits, es war damit im Laufe des letzten Jahres lediglich schlimmer geworden. Er vermutete, daß das nur normal war. Doch was in der Vergangenheit hilfreiche Umsicht gewesen war, ein sorgfältiges Abwägen der Möglichkeiten, hatte sich mittlerweile eher in besorgte Ausflüchte verwandelt, die zunächst die Ermittlungen behinderten. Wenn er jedoch einmal in Fahrt war, besaß Jameson immer noch das alte Feuer.
»Wir könnten es uns ja leicht machen und die Ermittlungen eingrenzen, indem wir nur noch Patienten mit anständigen Umgangsformen interviewen«, lachte Foster, in dem Versuch, Jamesons ansteckenden Pessimismus abzuwehren. Jameson hob sein Kinn. Er hatte einen entschlossenen, ziemlich ausgeprägten Unterkiefer, der ihm einen Ausdruck von Hartherzigkeit hätte verleihen können, wenn da nicht sein sensibler Mund und eine fast schüchterne Art zu sprechen gewesen wären ‒ die er selten, aber in Gegenwart von Frauen immer an den Tag legte. »Das grenzt das Gebiet vermutlich nicht sehr ein«, sagte er.
»Zyniker.«
Jameson warf Foster einen leicht amüsierten Blick zu. »Aber es ist einen Versuch wert. Wir müssen allerdings trotzdem alle Patienten identifizieren, und zwar für den Zeitraum, der zehn Jahre zurückreicht, für den Fall, daß dieser Pfad der Ermittlung nichts bringt. Aber ich denke, es ist ein sinnvoller Kompromiß, Bob.«
»Gut«, sagte Foster, der sich schon viel besser fühlte. Er drehte sich um und wollte gehen, doch Jameson hielt ihn zurück.
»Wenn Sie schon dabei sind, überprüfen Sie auch, ob es Verbindungen zum Kinderheim Sunnyside gibt.«
Fosters Augenbrauen schossen in die Höhe. »Haben diese beiden …?«
»Ihrem Chef zufolge, ja. Ann und Dorothy hatten beide mit Kindern zu tun, die Mitte bis Ende der achtziger Jahre nach Sunnyside geschickt wurden. Und meiner Erfahrung nach warten Menschen manchmal sehr lange darauf, alte Rechnungen zu begleichen.«
Chris Radcliffe schlenderte durch den Garten ihres neuen Zuhauses, berauscht vom Duft des Geißblatts. Es war schon spät, der Tag war übergangslos zur Nacht geworden. Am Lavendel zeigten sich allmählich kleine lilafarbene Büschel, und die Rosen präsentierten sich in voller Pracht; große, kugelförmige Blüten in tiefem Violett und mattem Rosa krönten jeden Blütenstiel.
Die Wohnung, die sie mit Hugh zusammen bewohnt hatte, war groß und gemütlich gewesen, aber nicht ihre. Hugh hatte ihr dies unaufdringlich, aber trotzdem unmißverständlich zu verstehen gegeben. Sie war bei ihm in Wallasey geblieben, noch lange, nachdem sie es kaum hatte erwarten können wegzuziehen. Er wäre auf ewig dageblieben, wenn ihm nicht dieser einjährige Studienaufenthalt in Indien angeboten worden wäre, wo er an biologischen Mitteln zur Bekämpfung von Schädlingen bei Reispflanzen arbeiten konnte. Er hatte sogar einen Vorschuß für die Wohnung bezahlt, nur damit er seine Sachen nicht einlagern und nach seiner Rückkehr eine neue Wohnung suchen mußte ‒ das wäre ihm viel zu lästig gewesen. Hugh wollte, daß sein Leben in geordneten Bahnen ablief, und zum Schluß hatte sie das fast verrückt gemacht. Er hatte ihr ziemlich leidenschaftslos gesagt, daß sie gerne bleiben könne, wenn sie wolle. Eine kalte Abfuhr nach drei gemeinsamen Jahren.
Wütend hatte Chris nach einer neuen Wohnung gesucht. Das kleine Cottage war ein Zufallstreffer gewesen. Sie hatte sich im ländlichen Cheshire verfahren, als sie von einem Pub nach Hause fuhr, in dem sie sich zum Mittagessen mit einem alten Freund von der Universität getroffen hatte. Das Cottage hatte sie in der Abendsonne angestrahlt, der Sandstein leuchtete rosafarben. Das Schild, auf dem »Zu verkaufen« stand, hing ein wenig schief, es wirkte wie ein Zeichen stummer Verzweiflung. Sie wunderte sich über die Freude der Besitzer, daß sie sofort einziehen konnte. Aber Ted hatte ihr, als sie ihn danach fragte, die Probleme erklärt, die man erlebt, wenn man ein Haus verkauft. Eiligst wurde über ein Angebot verhandelt, es wurden städtische Bebauungspläne studiert, Papiere unterzeichnet und Verträge ausgetauscht ‒ alles innerhalb eines Monats. Und nun, wo Hugh gerade zwei Wochen weg war, war dies ihr Zuhause. Sie fand die Landschaft von Cheshire beruhigend, die sanften Böschungen, die Abwechslung durch die hohen, grünen Hecken auf den ausgedehnten Ebenen.
Chris seufzte und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Garten. Der Vermieter ihrer alten Wohnung ‒ sie fing schon an, sich gedanklich von ihr zu entfernen ‒ hatte nicht gestattet, daß außer ihm und seiner Frau jemand den Garten benutzte. Und es war die Freiheit des Gartens, die sie hier mehr genoß als den zusätzlichen Platz oder die Gewißheit, daß die nächsten Nachbarn weiter als fünfzig Meter entfernt wohnten. Noch mehr als die befriedigende Tatsache, daß sie nun zur besitzenden Klasse gehörte (eine Vorstellung, bei der sie über sich selbst lachen mußte, wenn sie nur daran dachte), noch mehr als die Freiheit, die ihre Abgeschiedenheit mit sich brachte, mehr als alles andere genoß sie ihren Garten. Voller Entzücken lernte sie den täglichen Wechsel von Duft und Temperatur und Betriebsamkeit kennen, die bestimmten Tageszeiten eigen waren. Den frühen Morgen hatte sie am liebsten, dann zeigte sich auf den flachen, wächsernen Blättern der Akelei noch ein wenig vom nächtlichen Tau, und die Tautropfen lagen wie quecksilber-farbene Kügelchen auf den grau-grünen Blättern. Es war die stillste Zeit des Tages, eine Zeit der Ruhe, die nur von dem plötzlichen, aggressiven Gesang der Rotkehlchen oder den eher besonnenen, balladenähnlichen Melodien einer Amsel oder Singdrossel unterbrochen wurde. Der Abend, an dem Duft und Geräusche intensiver wurden, war eine geschäftigere Zeit, jedoch bedächtig und zweckmäßig, wie es der Natur entsprach: Bienen summten um die Rabatten, und das ständige Geräusch wurde hin und wieder von dem aufgebrachten Gezeter der Singdrossel unterbrochen, die die Nachbarskatze dabei beobachtete, wie sie am Ende des Gartens im Schatten der Bäume umherschlich. Aber es war dabei trotzdem so friedlich; man hatte das Gefühl, daß alle Ereignisse des Tages zu einem Abschluß gebracht wurden, und sich alles auf die hereinbrechende Dunkelheit vorbereitete. Chris stellte fest, daß sich diese Stimmung auf sie übertrug. Die Menschen, die sie während des Tages beurteilt und beraten hatte, wurden Teil der Hintergrundgeräusche im Garten, und sie verschwanden mit der Sonne in die Dunkelheit.
Alle, außer Sergeant Foster.
Ihr Zusammentreffen war ziemlich unerfreulich gewesen. Fran hatte Chris’ Zorn damit herausgefordert, daß sie Foster fälschlicherweise in das Sprechzimmer geführt hatte, in dem sie gerade versuchte, eine ziemlich defensiv eingestellte Mutter davon zu überzeugen, daß eine Familienberatung helfen würde, das zerstörerische Verhalten ihres Sohnes zu ändern. Sie hatte das Gespräch unterbrechen müssen, um den Sergeant in ihr Büro zu bringen, und hatte sicherstellen müssen, daß die Jalousie vor dem Spionspiegel heruntergezogen war, bevor sie in das Sprechzimmer zurückkehren konnte. Durch ihre kurze Abwesenheit war es wie erwartet unmöglich, die Diskussion der letzten Stunde wieder in Gang zu bringen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als einen neuen Termin zu vereinbaren und zu hoffen, daß sie die Situation dann würde klären können.
Die Tür zu ihrem Büro war offen, und als sie eintrat, sah sie, daß der Sergeant mit dem Rücken zu ihr stand, und, den Kopf zur Seite geneigt, einen Blick auf die Notizen warf, die sie sich zu einem Fall gemacht hatte.
»Bin ich da eben in etwas hereingeplatzt, meine Liebe?« fragte er. Er fühlte sich durch ihr Erscheinen keineswegs ertappt.
Chris war noch immer wütend auf Fran und frustriert wegen der Zeitverschwendung. In Anbetracht dieser Laune empfand sie seine herablassende Haltung als beleidigend. Sie ging zu ihrem Schreibtisch und schloß die Akte, in der Foster gelesen hatte.
»Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie mich fragen wollen, Sergeant?« sagte sie. »Ich bin ziemlich beschäftigt.«
Angespannt, dachte Foster. Jameson hatte ihn gebeten, besonders auf die Reaktionen der Ärztin zu achten. Er hatte sie letzten Mittwoch im Radio gehört, in einer Sendung mit Jilly Henderson, die Kindersachen hieß. Dr. Radcliffe hatte dreißig Minuten Sendezeit bekommen, die unter dem Motto standen: »Psychologische Ratschläge zu Familienangelegenheiten«. In der Zusammenfassung über ihren Werdegang hatte die Ärztin erwähnt, daß sie für das Jugendamt von Calderbank tätig gewesen war, und eine kurze Überprüfung hatte ergeben, daß sie sowohl mit Dorothy als auch mit Ann zusammengearbeitet hatte.
Foster nahm sein Notizbuch und sagte: »Nur ein paar kurze Fragen.«
Ziemlich klein für einen Polizisten, dachte Chris. Er war nicht größer als sie; ein drahtiger Mann, schick gekleidet. Er trug einen hellgrauen Anzug mit kleinem Revers und einen schmalen Schlips. Sein Bart war sauber getrimmt, sein Haar sorgfältig gekämmt und kurz geschnitten. Das Hemd hatte ein Muster, bei dem Chris immer an Verkäufer denken mußte: es hatte breite, blau-weiße Streifen und einen breiten Kragen, der nicht zu den Proportionen der Jackettaufschläge paßte. Auch seine Art entsprach der eines Verkäufers ‒ jedenfalls anfangs ‒ die vertrauliche Anrede, die geschniegelte Kleidung. Sie hatte fast erwartet, daß er sich in ihrem Büro umsehen und einen schmeichelhaften Kommentar zur Einrichtung abgeben würde.
»Sie haben mal mit Mrs. Hardy und Mrs. Lee zusammengearbeitet.«
Chris lehnte mit einem Arm auf dem Aktenschrank; die Kühle linderte ihre schlechte Laune ein wenig.
Foster warf ihr einen ungeduldigen Blick zu und fragte: »Nun?«
»Tut mir leid«, erwiderte sie. »War das eine Frage?«
Foster preßte die Lippen zusammen. Dabei verflochten sich die getrimmten Härchen an seiner Unter- und Oberlippe. »Gab es irgendwelche … besonderen Vorkommnisse bei den Fällen, mit denen Sie in dieser Zeit zu tun hatten?«
Chris schüttelte den Kopf. »Nicht, soweit ich mich erinnern kann. Es ist lange her.«
»Ungefähr zehn Jahre.« Wieder wartete er auf eine Antwort, und als sie weiterhin beharrlich nichts sagte, entschied er, es etwas direkter zu versuchen. »Wie lange haben Sie mit den beiden zusammengearbeitet?«
»Achtzehn Monate … vielleicht zwei Jahre.«
»Und es gibt nichts, an das Sie sich besonders gut erinnern? Niemanden, den Mrs. Hardy oder Mrs. Lee besonders erwähnten?«
»In welchem Zusammenhang?«
Er zuckte mit den Achseln. »Ich weiß nicht. Ein Fall. Jemand, der ungemütlich wurde. Jemand, den sie aus der Fassung gebracht haben.«
Chris betrachtete ihn mit neu gewecktem Interesse. Sie hatte erwartet, daß er sie über ihr Verhältnis bei der Arbeit ausfragen würde. Über persönliche Details aus ihrem Privatleben ‒ nicht, daß sie ihm da hätte helfen können ‒, aber er schien bei seinen Ermittlungen eine unheilvollere Spur zu verfolgen. »Sie glauben, daß das Verschwinden der beiden in einem Zusammenhang steht, nicht wahr?«
Diesmal gab er keine Antwort, sondern wartete, daß sie etwas sagte, und es sah so aus, als sei er bereit, eine endlose Gesprächspause zu riskieren.
»Also gut«, sagte Chris. »Lassen Sie mich nachdenken. Dorothy Hardy hatte sehr wenig direkten Kontakt zu den Kindern oder deren Eltern. Sie sammelte Informationen und nahm als Vertreterin der Schulbehörde an Besprechungen der Fälle teil. Ich glaube nicht, daß sie in der Lage ist, jemanden aus der Fassung zu bringen oder sonstwie zu verärgern. Jedenfalls schien es mir damals so. Aber das ist lange her.«
»Und Mrs. Lee?«
Sie zuckte mit den Achseln. Ann Lee hatte im Alter von vierzig Jahren an der Fernuniversität einen Abschluß im Fach Sozialwissenschaften gemacht, sich kurz danach von ihrem Mann scheiden lassen und dann als Sozialarbeiterin angefangen. »Sie hatte den Ruf, die Frau für schwere Fälle zu sein. Sie konnte ziemlich schroff werden … löste bei den Leuten heftige Reaktionen aus. Die Kinder nannten sie Fischkopf.«
Foster zog seine Augenbrauen in die Höhe.
»Aber«, fuhr Chris fort, »Ann machte das nichts aus. Irgendwie schien ihr der Spitzname sogar zu gefallen.« Chris erinnerte sich an Anns hervortretende Augen, die sie immer halb geschlossen hielt, wegen des Qualms aus all den Zigaretten, die ihr ständig im herunterhängenden Mundwinkel klebten. »Wenn ein Kind ein unkontrollierbares Miststück ist, dann sage ich ihm das … Und wenn man austeilt, muß man auch einstecken können«, pflegte sie zu sagen.
»Ich nehme an, daß Sie das nicht gebilligt haben«, sagte Poster, und Chris wurde bewußt, daß sie zu lange geschwiegen hatte.
»Bei einigen hat es etwas genutzt«, antwortete sie. »Das Problem war nur, daß Ann lediglich diesen einen Ansatz hatte, nur eine einzige Methode … und die bedeutete Angriff.«
»Warum reden Sie von ihr in der Vergangenheit? Sie war, sie hatte nur?«
Chris errötete leicht. »Oh. Ich … ich meinte damit nur, so war sie, als ich sie kannte. Das ist lange her.«
»Okay.« Poster klappte sein Notizbuch zu. »Das war’s schon.«
»Ich weiß nicht, ob es Ihnen weiterhilft«, sagte Chris, der vor Überraschung über das plötzliche Ende der Befragung eine unbedachte Bemerkung herausrutschte. »Wenn Sie glauben, daß die beiden Frauen von einem Elternteil einer ihrer Patienten entführt wurden ‒ dann ist es wahrscheinlich, daß die Entführung die Folge einer Entscheidung ist, die die Kommission gefällt hat.«
»Warum sagen Sie das?«
»Die Eltern, mit denen Ann und Dorothy zu tun haben, stehen meistens unter sehr großem Druck. Sie sind aus den verschiedensten Gründen verzweifelt … Ihr Kind ist zum Beispiel besonders weinerlich und unglücklich oder, schlimmer noch, wütend und aggressiv, oder es geht in einer zu großen Klasse unter, kommt nicht mit dem Lehrplan zurecht, dessen Anforderungen seine Fähigkeiten bei weitem übersteigen. Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Sie möchten ihr Kind glücklich sehen, alles richtig machen, und nicht immer bekommen sie das, von dem sie denken, daß es das Beste wäre. Manchmal verlieren sie die Beherrschung, aber das ist meist nur vorübergehend … Im Grunde machen die Menschen das Beste aus dem, was ihnen geboten wird.«
»Und was ist mit den Kindern? Werden sie auch manchmal gewalttätig?«
»Sie sind auch nur Menschen. Sie werden genauso enttäuscht und sind genauso ängstlich und besorgt wie Erwachsene. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, daß ein Kind das getan haben könnte, oder?«
Foster fuhr sich mit dem Handrücken vom Hals bis zum Kinn über seinen Bart. »Kinder werden doch erwachsen, nicht wahr?« stieß er mit einem kehligen Liverpooler Akzent und einem aggressiven Ton hervor.
Seit Stunden waren ihr diese Worte nun schon im Kopf herumgegangen. Daß Kinder einen Groll gegen eine Autorität hegten, die in ihren Augen willkürlich über ihr Leben und ihr Glück entschied, war kaum verwunderlich. Chris wußte nur zu gut über die Bitterkeit Bescheid, die man bis ins Erwachsenenleben mitschleppen konnte …
Ein plötzliches Geräusch schreckte sie auf; sie drehte sich um und sah, wie sich der Riegel der alten Holztür hob, die in den Garten führte.
»Tut mir leid, Chris. Ich habe ein paarmal geklingelt.« Es war Simon. Er war besorgt, daß er sie erschreckt hatte, rastlos und aufgeregt und übereifrig. Und er versuchte, all diese Gefühle hinter einer Lässigkeit zu verbergen, die nicht ganz überzeugend war.
»Macht nichts, Simon. Ich war nur in Gedanken versunken. Und ich kann die Klingel hier draußen nicht hören«, sagte sie lächelnd und zupfte nervös an ihrem Pony. Dabei zog sie ein paar Strähnen über ihre linke Augenbraue und verdeckte so die Narbe über dem Auge.
»Ich könnte dir eine zusätzliche Klingel legen.« Er brachte die Worte mit einer Begeisterung hervor, die ständig unter seiner unergründlichen äußeren Schale brodelte; dann nahm er sich wieder zusammen und fügte hinzu: »Wenn du möchtest.«
Chris fand, daß Simon sich in den letzten Jahren nicht sehr verändert hatte. Er war ordentlich rasiert, obwohl sie sich nicht vorstellen konnte, daß er mehr als ein- oder zweimal in der Woche zum Rasierapparat greifen mußte; seine Haut war glatt und ziemlich blaß. Die Augenbrauen hatten die Form von damals behalten, als sie ihn kennenlernte, sie waren heute nur etwas dicker als die des elfjährigen Jungen, bildeten eine nahezu gerade Linie und waren mausbraun, ein paar Schattierungen dunkler als seine Haare.
»Hast du schon gegessen?« fragte sie. Zusammen zu Abend zu essen war eines ihrer Rituale geworden und rührte zum einen daher, daß Chris oft erst bewußt wurde, daß sie seit mittags nichts gegessen hatte, wenn es an der Tür klingelte und ihre Arbeit somit unterbrochen wurde. Zum anderen hatte sie den Verdacht, daß Simon ebenfalls vergaß zu essen. Hugh hatte sie in einem seltenen Anfall von Gereiztheit einmal gefragt, ob es einen psychologischen Fachbegriff dafür gäbe, daß Frauen sich immer verpflichtet fühlten, ihre Männer zu verpflegen. Sie hatte es als einen Anflug von Eifersucht abgetan, der sich nicht so sehr auf Simon bezog, sondern auf ihre Arbeit, die so viel Zeit in ihrem Leben beanspruchte.
Sie aßen draußen, saßen auf dem groben, hölzernen Sitz in der Rosenlaube und balancierten die Teller auf den Knien. Die Luft um sie herum war erfüllt vom Duft der Rosen und dem lauten Summen der Bienen.
»Ich sollte wahrscheinlich mal Tisch und Stühle kaufen«, sagte Chris. »Ich glaube, ich muß mich erst noch an den Gedanken gewöhnen, jetzt ein Haus zu besitzen.«
»Das ist lecker«, sagte Simon und lächelte flüchtig. Er hatte intelligente Augen, die eher einschätzten als fragten, aber sie wußte, daß sie sich die Zuneigung, die freundschaftlichen Gefühle für sie, die in seinen scheuen, graublauen Augen lagen, nicht einbildete. Er aß das Hühnerfleisch mit den Frühlingszwiebeln, das sie für sie beide gebraten hatte, rasch auf.
»Ich hab die Verweise rausgesucht, die du mir gegeben hast. Die Fotokopien sind im Auto.« Er fügte schüchtern hinzu: »Ich habe durch sie noch ein paar andere Sachen gefunden.« Er bestand darauf, die Sachen gleich zu holen und kam beladen mit mehreren Büchern und einem ganzen Stapel von fotokopierten Artikeln und Exzerpten wieder.
Chris forschte seit etwas länger als einem Jahr für ihr neues Buch. Die Opfer sollten ihre Erlebnisse in eigenen Worten schildern; sie hatte vor, sie thematisch zu ordnen. Aber sie wollte, daß das Buch mehr war als nur eine Zusammenstellung von Fallstudien. Sie hoffte, daß sie wenigstens teilweise die unsicheren Bindungen würde erklären können, die zu jener Art von Psychopathie führten, die aus Männern Vergewaltiger machte. Vor diesem Hintergrund hatte sie Simon eine Auswahlliste der Literatur von vier Kapazitäten auf diesem Gebiet genannt, angefangen mit Bowlby. Sie hatte Wedge und Prosser sowie Wedge und Essen als Lektüre vorgeschlagen, da sie unter Umständen mögliche Gründe nennen konnten, warum emotionale Beziehungen nicht funktionierten; außerdem noch Rutters moderne Theorien über die Auswirkungen von mangelnder mütterlicher Zuwendung, die vielleicht ein Gegengewicht zu Bowlby darstellten.
Chris lachte über den dicken Stapel an Literatur, den er mitgebracht hatte, und Simon grinste. »Findest du, daß ich es übertrieben habe?« fragte er und errötete dabei leicht.
»Es gibt zwei Dinge, von denen ein Akademiker nie genug bekommen kann«, antwortete Chris. »Zeit …«
»… und Forschungsarbeit«, beendete Simon den Satz. »Ich trage die Sachen.«
Chris nahm seinen Teller, den er auf dem Rasen abgestellt hatte und folgte ihm ins Eßzimmer. Er erklärte ihr die Wichtigkeit jedes einzelnen Exzerpts ‒ er hatte alle gelesen und sich kurze Notizen dazu gemacht.
Chris stieß einen leisen Pfiff aus, und er strahlte sie an. »Weißt du, du könntest das auch für dich selbst tun«, sagte sie.
»Ich? Mit meiner zweitklassigen Gefängnisbildung?«
Nachdenklich betrachtete Chris ihn für ein paar Augenblicke. War es jetzt an der Zeit, das Thema einer weiterführenden Ausbildung anzuschneiden? Aber Simon hatte sich bereits halb von ihr abgewandt und präsentierte ihr Schulter und Profil, er war offenbar mit den Fotokopien beschäftigt und runzelte die Stirn, während er die entsprechenden Seiten mit Büroklammern zusammenheftete. Sie seufzte. Am besten war, man drängte ihn nicht.
Detective Chief Inspector Jameson ging um sechs Uhr für eine Stunde nach Hause. Er mußte mal für eine Weile dem Büro den Rücken kehren und außerdem noch mit den Hunden Gassi gehen. Ihm fiel ihre stürmische Begrüßung kaum auf. Er duschte und zog einen anderen, aber ebenso verknitterten Anzug an und hoffte, daß man unter der Anzugjacke nicht allzu deutlich sah, daß er ein ungebügeltes Hemd trug. Doch das war wohl kaum wichtig, wenn zwei Frauen vermißt wurden ‒ die vielleicht schon tot waren. Er hatte keine einzige Spur, keine Verdächtigen, niemanden, der etwas gesehen hatte. Aber es mußte jemanden geben, der etwas beobachtet hatte. Die Gespräche mit Kollegen und Bekannten der beiden Frauen kamen nur langsam voran, viel zu langsam. Er mußte sie, wenn nötig, bis in den späten Abend hinein fortsetzen. Foster sollte das organisieren.
Er blieb nur zwanzig Minuten im Park und kam wieder zu Hause an, ohne daß er sich erinnern konnte, die Straße überquert zu haben. Er schloß die Tür auf, und die Hunde drängten aufgeregt Richtung Küche, ihre Pfoten polterten und rutschten auf dem Holzboden den Flur entlang. Die Standuhr schlug dumpf und dissonant die Viertelstunden. Er warf auf dem Weg in die Küche einen Blick auf das vergilbte Zifferblatt. Es war sieben Uhr.
Die Hunde schlabberten geräuschvoll aus ihren Wassernäpfen und stießen dabei mit dem Blechrand des Napfs immer wieder gegen die Fußleiste. Dies verursachte ein ständiges metallenes Klappern. Jameson ging über die neuen roten Fliesen, die den alten, rissigen und ausgetretenen Küchenboden ersetzt hatten und öffnete die Kühlschranktür. Drinnen herrschte weiße glänzende Leere. Er seufzte. Es gab an der Lark Lane jede Menge Restaurants, vielleicht würde er später essen gehen, falls sie noch geöffnet hatten, wenn er von der Arbeit kam. Er drehte sich um und betrachtete die leere Küche. Der alte Tisch aus Kiefernholz war geschrubbt, und das Durcheinander, das er morgens darauf zurückgelassen hatte, war weggeräumt. Mrs. Delaney war da gewesen ‒ eine ihrer üblichen Morgenrunden, wie sie sie nannte. Sie kam dreimal die Woche, obwohl er sie, seit er alleine war, eigentlich nicht mehr brauchte. Aber er brachte es nicht übers Herz, ihr das zu sagen, und schließlich sah sie auch nach den Hunden; er fand, daß es sowohl ihnen als auch Mrs. Delaney gegenüber unfair wäre, wenn sie nicht mehr so oft kam. Also wurde das Haus gründlich saubergehalten. Sauber und steril, dachte er.
Die Hunde saßen jetzt da und sahen zu ihm hoch, mit verlangendem und erwartungsvollem Blick leckten sie sich die Schnauzen und hechelten. Ihre Kiefer waren dabei wie zu einem Grinsen auseinandergezogen.
»Worauf wartet ihr denn noch?« fragte er. Sie wackelten beide gleichzeitig mit dem Schwanz, stießen gegen die Blechnäpfe und warfen ihm einen flehentlichen Blick zu. Er füllte ihre Trinknäpfe erneut mit Wasser und öffnete eine Dose Hundefutter. »Wie ihr diesen Mist essen könnt, werde ich nie begreifen«, sagte er und stellte beiden Hunden eine Schüssel voll hin.
Tizzy und Lizzy. Zoe hatte alle Einwände, daß die ähnlich klingenden Namen die Hunde verwirren könnten, zurückgewiesen ‒ und es hatte sich im Gegenteil als praktisch herausgestellt, weil beide Hunde auf beide Namen reagierten und, was den Gehorsam betraf, der eine dem anderen immer mit gutem Beispiel voranging. Zoe hatte recht behalten.
»Ach du lieber Himmel … Zoe!«
Er rannte zum Telefon und wählte eine Auslandsnummer. »Roz? Hallo, hier ist Alan.« Er klang angestrengt und versuchte erfolglos, sich zu entspannen. »Hör mal, kann ich dich um einen Gefallen bitten?«
»Es ist Alan«, hörte er sie sagen. Sie machte keine Anstalten, zu verbergen, daß sie ganz offensichtlich verärgert war. Die Stimme seiner Exfrau war so lebendig und so nah, daß Jameson eine Woge von Gefühlen in sich aufwallen spürte, obwohl sie so abweisend klang.
»Du hast es doch nicht etwa vergessen Alan, oder?«
»Ich arbeite gerade an einem Fall«, erklärte er. »Zwei Frauen sind verschwunden. Ich arbeite seit zwei Wochen ohne Unterbrechung.«
»Er hat es vergessen«, sagte sie zu ihrem unsichtbaren Zuhörer.
»Ist Brian bei dir?«
»Wer sollte es sonst sein?«
»Hör mal, ich hätte ihr etwas geschickt. Ich hatte alles schon geplant, als dieser Fall dazwischenkam.«
»Irgendwas kommt immer dazwischen.«
»Mein Gott, ich habe es doch nicht absichtlich vergessen!«
»Weißt du, daß es das irgendwie noch schlimmer macht? Wenn es wenigstens Absicht gewesen wäre, würde das heißen, daß du vorher immerhin daran gedacht hast.«
»Ich habe dir doch gesagt, ich habe mich dran erinnert … Es ist nur dieser blöde Fall. Ich arbeite sechzehn Stunden am Tag …«
»Hör auf damit, Alan«, unterbrach sie ihn, »heb dir das für ein Gespräch mit deinen Chefs auf, wenn eine Beförderung ansteht. Mich beeindruckt es ganz und gar nicht, wie besessen du von deiner Arbeit bist.«
Meine Güte, dachte er. Sie klingt schon richtig amerikanisch. Es folgte Stille. Das war neuerdings typisch für ihre Telefongespräche: ein schneller Angriff und ein paar Seitenhiebe von Roz, gefolgt von einer Pause, die angefüllt war mit all den verletzenden Dingen, die sie einander sagen wollten, aber nie sagen würden.
»Wir haben noch etwas extra besorgt«, sagte Roz schließlich. Normalerweise war sie es, die das Gespräch wieder aufnahm, ob aus Mitleid oder weil sie den Anruf möglichst schnell hinter sich bringen wollte, konnte er nicht sagen. »Nur für alle Fälle«, fügte sie höhnisch hinzu. »Und zwar genau das, was sie sich gewünscht hat … ein Paar Rollerblades ‒ damit du nicht raten mußt, wenn du es bei deinem engen Terminplan einrichten kannst, deine Tochter an ihrem Geburtstag anzurufen.«
Er atmete tief aus, dankbar, daß Roz Zoe seine Fehler nicht wissen ließ, auch wenn sie vor ihm keinerlei Anstalten unternahm, ihre Abneigung gegen ihn zu verbergen. »Was bin ich dir schuldig?« fragte er. Geld war ein weiteres schwieriges Thema zwischen ihnen beiden, und er fügte leicht verlegen hinzu: »Ich schicke dir einen Scheck.«