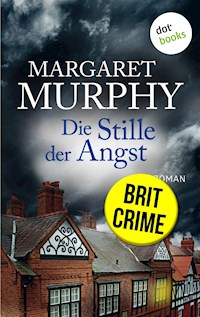5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Liverpool Police Station
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Böse schwelt in den Straßen Liverpools, der Stadt der Mörder! Der Kriminalroman »Wer kein Erbarmen kennt« von Margaret Murphy als eBook bei dotbooks. Der junge Sergeant Forster und Detective Inspector Jeff Rickman werden mit einem schockierenden Fall konfrontiert: In einem Müllwagen findet man die Leiche einer jungen Frau, entsorgt wie ein Stück Abfall. An der Kleidung des Opfers werden Blutspuren gefunden, die von Rickman selbst zu stammen scheinen – doch er hat die Frau noch nie gesehen. Um seine Unschuld zu beweisen, ermittelt er auf eigene Faust in den dunkelsten Vierteln von Liverpool – wo Asylbewerber Zuflucht in den Schatten suchen und Verbrecherringe regieren. Rickman wird hier nur überleben, wenn er sich auf seinen Kollegen Forster verlassen kann, aber von Sekunde zu Sekunde wächst das Misstrauen zwischen ihnen … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Kriminalroman »Wer kein Erbarmen kennt« von Margaret Murphy ist der zweite Band ihrer spannungsgeladenen Reihe um die »Liverpool Police Station«, in der jeder Band unabhängig gelesen werden kann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der junge Sergeant Forster und Detective Inspector Jeff Rickman werden mit einem schockierenden Fall konfrontiert: In einem Müllwagen findet man die Leiche einer jungen Frau, entsorgt wie ein Stück Abfall. An der Kleidung des Opfers werden Blutspuren gefunden, die von Rickman selbst zu stammen scheinen – doch er hat die Frau noch nie gesehen. Um seine Unschuld zu beweisen, ermittelt er auf eigene Faust in den dunkelsten Vierteln von Liverpool – wo Asylbewerber Zuflucht in den Schatten suchen und Verbrecherringe regieren. Rickman wird hier nur überleben, wenn er sich auf seinen Kollegen Forster verlassen kann, aber von Sekunde zu Sekunde wächst das Misstrauen zwischen ihnen …
Über die Autorin:
Margaret Murphy ist diplomierte Umweltbiologin und hat mehrere Jahre als Biologielehrerin in Lancashire und Liverpool gearbeitet. Ihr erster Roman »Der sanfte Schlaf des Todes« wurde von der Kritik begeistert aufgenommen und mit dem First Blood Award als bester Debüt-Krimi ausgezeichnet. Seitdem hat sie zahlreiche weitere psychologische Spannungsromane und Thriller veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Heute lebt sie auf der Halbinsel Wirral im Nordwesten Englands.
Die Website der Autorin: www.margaret-murphy.co.uk/
Bei dotbooks veröffentlichte Margaret Murphy ihre Reihe um die Liverpool Police Station:
»Wer für das Böse lebt – Band 1«
»Wer kein Erbarmen kennt – Band 2«
»Wer Rache sucht – Band 3«
Außerdem ist bei dotbooks ihre Thriller-Reihe um die Anwältin Clara Pascal erschienen:
»Warte, bis es dunkel wird – Band 1«
»Der Tod kennt kein Vergessen – Band 2«
Sowie ihre psychologischen Spannungsromane:
»Die Stille der Angst«
»Der sanfte Schlaf des Todes«
»Im Schatten der Schuld«
»Das stumme Kind«
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »The Dispossessed« bei Hodder & Stoughton Ltd., London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2004 by Margaret Murphy
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Maurice Gunnery
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-096-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wer kein Erbarmen kennt« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Margaret Murphy
Wer kein Erbarmen kennt
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Christine Heinzius
dotbooks.
Dem Murphy-Clan – danke für alles!
Kapitel 1
Während Jeff Rickman beobachtete, wie das Blut langsam aus ihm herausfloss, wurde ihm schlecht. Speichel lief ihm im Mund zusammen, und er zwang sich, vom stetigen, Übelkeit erregenden Pulsieren wegzusehen, und blickte zu den hohen Dachbalken des Deckengewölbes der Kirche. Im Gebäude roch es nach altem Holz, Wachs und Weihrauch, der Geruch der Heiligkeit, den Jahre der Vernachlässigung und sogar die Entweihung nicht hatten vertreiben können.
Vom gotischen Bogen des Westfensters lächelte ihn der wieder auferstandene Christus mit ausgebreiteten Armen und nach oben gewandten Handflächen an. Oktobersonne schien durch die bunten Glasfenster, und die Wunden Christi erstrahlten in rotem Licht.
Rickman fühlte sich wie losgelöst, heiter und klar. Aus jedem Staubflecken in den Strahlen der Abendsonne wurde ein Stück tanzendes Licht. Das Knirschen und Knacken des Holzes schien der Spur der Sonnenstrahlen zu folgen, und er sah, wie sich die Sonne zentimeterweise über den gewachsten Fußboden bewegte. Er schloss die Augen und stellte sich vor, er könne sogar fast das Seufzen und Flüstern von Generationen von reuigen Sündern hören.
Sein Puls schlug heftig in seinem Hals, und Rickman öffnete die Augen wieder. Er konnte den stetigen Blutverlust nicht länger ignorieren. Er schluckte, kämpfte gegen die Übelkeit an und konzentrierte sich auf die rosafarbene Granitsäule einen Meter vor ihm. Auf ihrer polierten Oberfläche entdeckte er weiße, goldene und graue Flecken zwischen den rosa Kristallen. Er sah nach unten zu den marmornen Weinranken und nach oben zu den grauen Trauben, die vor der lebendigen Wärme des Granits am Kapitel blass wirkten. Langsam ließ die Übelkeit nach.
Es geht immer ums Blut, dachte er, um das Geben und Nehmen von Blut. Die Religion basierte darauf und watete darin. Kirche war ja schön und gut, aber es hieß, dass die Blutsbande die stärksten seien: die Verbindung zur Familie und zur Nation. Allerdings nicht für Rickman. Familie war für ihn nicht mehr als ein Wort, und noch dazu eines, auf das man sich nicht verlassen konnte. Rickman, Reichmann oder Richter, eine Theorie besagte sogar, dass der Familienname eigentlich Lichtmann heiße und die aktuelle falsche Schreibweise das Ergebnis eines lispelnden Vorfahren und der Nachlässigkeit eines Zollbeamten sei. So hieß es zumindest.
Freundschaft war für Rickman immer viel wichtiger gewesen als Kirche, Familie oder Nation.
Er drehte seinen Kopf zur Seite. Neben ihm, nah genug, um ihn zu berühren, war Lee Foster. Er lag da, den linken Arm ausgestreckt und den rechten über seinen Augen. Rickman kannte Foster schon lange und hatte während der letzten zwei Jahre eng mit ihm zusammengearbeitet. Er wusste, dass diese Tortur für Foster sehr viel schlimmer war als für ihn. Foster hätte dieses Gebäude niemals betreten, hätte Rickman ihn nicht dazu gedrängt. Keiner sah den anderen an oder sagte etwas. Sie bluteten, und jeder hing seinen eigenen Gedanken nach.
Jemand tippte ihm leicht auf die Schulter. Eine dunkelhaarige Frau in einem weißen Laborkittel stand neben ihm. »Sie sind fertig«, sagte sie, klemmte die Kanüle ab und löste sie von Rickmans Arm, dann entfernte sie die Nadel.
»Du bist schuld, Jeff«, sagte Foster.
Rickman wandte sich zu ihm um. Trotz gelöster Krawatte und seinen Schuhen, die unter dem Laborwagen standen, schaffte Foster es, gut auszusehen. »Du hast dich freiwillig gemeldet, erinnerst du dich, Lee?«
»Na ja, gut, falls ich mich jemals wieder freiwillig für irgendwas melden sollte«, sagte Foster, und seine Stimme wurde durch den Hemdsärmel etwas gedämpft, »egal, was, dann sperr mich ein, bis das Bedürfnis verschwunden ist, in Ordnung?«
»Wir planen, das nächste Mal ins Polizeihauptquartier zu kommen«, sagte die Frau. »Wenn Inspector Rickman es so arrangieren würde, dass wir die Zellen benutzen können, könnten Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.«
Sie lächelte Rickman an, und er spürte, wie sein Puls sich einen Augenblick lang beschleunigte. Sie war blass, krankhaft blass, als wäre sie den ganzen Sommer im Haus gewesen, aber ihre Haut strahlte ein bisschen, und ihre großen Augen mit den langen Wimpern hatten die Farbe von polierter Eiche im Sonnenschein. Sie hatte Rickmans Arm verbunden und ging weiter zu Foster.
Rickman bemerkte, dass Foster seinen rechten Arm so hingelegt hatte, dass er seine Haare nicht platt drückte. Fosters Haare waren wie immer sorgfältig zerzaust. Mit Gel modellierte er sie so, dass sie dunkelbraun glänzend und stachelig abstanden. Lee Foster war ziemlich eitel, eine Eigenschaft, die Frauen sowohl amüsierte als auch aufregte.
»Seien Sie sanft«, sagte er, »ich hasse Nadeln. Er hat gedroht, es dem gesamten Revier zu erzählen, wenn ich mich weigere, das hier zu tun«, fuhr er fort und spähte unter seinem Arm hervor. »Das ist furchtbar, nicht wahr? Einen Mann mit seiner eigenen Phobie zu erpressen.«
»Sie würden kaum glauben, dass er mal bei den Marines war, oder?«, sagte Rickman.
»Na los, streu Salz auf die Wunden«, sagte Foster. »Breite alle meine Schwächen aus, alle meine kleinen Eigenheiten, um mich lächerlich zu machen.«
Die Augen der Frau blitzten amüsiert, aber sie kommentierte nicht, sondern ließ die beiden sich streiten, während sie die Kanüle abklemmte und löste.
»Am besten, Sie sehen jetzt nicht hin«, sagte sie, als sie damit fertig war. »Ich werde Sie jetzt befreien.«
»Niemand muss Lee Foster befreien«, sagte er, hob seinen Arm vom Gesicht und lächelte sie strahlend an. »So heiße ich übrigens.«
Sie lehnte sich vor und flüsterte: »Sie sind nicht mein Typ.«
Er kämpfte sich auf einen Ellbogen. »Das war kein Heiratsantrag«, entgegnete er. »Was ist Ihr Typ?«
Sie und Rickman hörten beide das leichte Jammern in Fosters Stimme und sahen sich kurz amüsiert an, was Foster falsch verstand.
»Er?«, rief er aus. »Das harte römische Profil war in Gladiator ja ganz nett, aber wir sind jetzt im einundzwanzigsten Jahrhundert.«
»Seltsam«, gab sie zurück, »irgendwie riecht es hier ein bisschen nach Neandertaler. Nur damit Sie es wissen, ich befreie Sie von der Nadel. Aber wenn Sie dabei zusehen wollen, liegt das ganz bei Ihnen ...«
»Ich dachte, Ihr Krankenschwestern solltet den Patienten Mut machen«, sagte er und versuchte es immer noch mit seinem Charme, aber Rickman sah, dass er im Gesicht ein bisschen Farbe verloren hatte.
»Ich bin keine Krankenschwester, ich bin medizinischtechnische Assistentin, und Sie sind kein Patient, Sie sind ein Blutspender«, sagte sie. »Also, machen Sie jetzt die Augen zu?«
»Ich würde lieber Ihre Augen ansehen.«
Diese Augen ... An den Winkeln zeigten sich Fältchen, und Rickman erinnerten sie einen Moment lang an jemanden, aber noch bevor er sich klar werden konnte, an wen, war die Ähnlichkeit schon wieder verschwunden und hinterließ nur ein irgendwie verstörendes Bild.
»Sie möchten meine Augen sehen?«, fragte sie.
Die großäugige Unschuld in Fosters dunkelblauen Augen ließ ihn jünger als dreißig erscheinen. Er lächelte sie mit seinem Welpenlächeln an und betrachtete sie bewundernd. Sie schaute ihn an, ihr Mund ließ ein Lächeln erahnen, dann zog sie die Nadel heraus, und Foster schrie auf.
»Das hat doch überhaupt nicht wehgetan, oder?« Sie hob seine Hand und legte zwei Finger auf den Wattebausch in seiner Armbeuge. »Fest drücken«, sagte sie.
»Fest drücken?« Foster machte ein finsteres Gesicht. »Ich könnte eine Klage gegen Sie durchdrücken.«
Sie kicherte und klebte ein Pflaster darüber.
»Heben Sie in den nächsten Stunden nichts, was schwerer als ein Pfund ist, in Ordnung?«
Foster schüttelte zweifelnd den Kopf. »Ich glaube, ich brauche Betreuung«, sagte er. »Von einem Profi.« Er hielt einen Augenblick inne. »Wann kommen Sie?«
Die winterliche Blässe der Frau färbte sich kurzfristig rot vor Ärger. »Wo kommen Sie?«, fragte sie.
Kapitel 2
Die Luft war frisch. Grace Chandler zögerte auf der Türschwelle und überlegte, ob sie noch mal hineingehen sollte, um sich eine Jacke zu holen.
Die Sonne war nur als milchige Scheibe hinter einer dünnen Wolkenschicht zu sehen. Grace beschloss, auf die Chance zu setzen, dass die Sonne durchbrechen würde. Sie sprang die Stufen hinunter, ein bisschen aufgekratzt wegen des kühlen Morgens und der Hoffnung auf gutes Wetter. Sie warf ihre Aktentasche in den Kofferraum und legte die Handtasche in Reichweite auf den Beifahrersitz.
Die Fahrt von Mossley Hill zum Liverpooler Stadtzentrum dauerte zwanzig Minuten, aber sie war spät dran, und der Berufsverkehr hatte eingesetzt, was die Fahrtzeit verdoppeln konnte.
Sie fuhr in Richtung Sefton Park, oben am See vorbei und entlang dem nierenförmigen Park, zusammen mit einem stetigen Strom gestresster Pendler, die ebenfalls die Ampeln und Staus der Hauptstraßen vermeiden wollten.
Sie hatte angenehme Tagträume während der Fahrt. Sie dachte daran, wie Jeff im Schlafzimmersessel gesessen hatte, während sie sich nach der Dusche die Haare mit einem Handtuch trocken rieb, und sie voller Liebe und Lust mit seinen braunen Augen angesehen hatte.
Ein paar Minuten lang hatte sie so getan, als hätte sie es nicht bemerkt. Er war schon gewaschen und rasiert, ordentlich angezogen und bereit, zur Arbeit zu fahren. Ein Kollege hatte mal gesagt, dass Jeff in einem Anzug wie ein Gauner aussah. Seine Nase war irgendwann einmal gebrochen und schlecht gerichtet worden, außerdem hatte er einige Narben; eine davon teilte seine rechte Augenbraue. Seine kastanienbraunen Haare waren kurz geschnitten wie bei den meisten Polizisten, die sie kennen gelernt hatte, und sie nahm an, dass man ihn beim ersten Treffen leicht für einen harten Typ halten konnte. Falls er hart war, dann erlebte Grace ihn nie so, aber sie fand sowohl seine Charakterstärke als auch seine körperliche Stärke beruhigend.
»Siehst du was, das dir gefällt?«, hatte sie ihn mit einem schiefen Blick gefragt.
Er hatte gelächelt. »Allerdings.«
Er hatte nach ihrer Hand gegriffen, als sie zum Frisiertisch ging, hatte sie auf seinen Schoß gezogen, um ihre Lippen, ihren Hals, ihre Brüste zu küssen. Dann hatte er sie hochgehoben und zum Bett getragen. Ihre Finger hatten seine Gürtelschnalle gefunden, und sie stöhnte und hob sich ihm entgegen.
Die Sonne hatte bereits mehr Kraft. Innerhalb der fünf Minuten, die Grace gebraucht hatte, um Sefton Park zu erreichen, hatte sie den dunstigen Wolkenschleier aufgelöst und schien nun durch die Ahorn- und Rosskastanienbäume am Zaun, warf Flecken auf die honigfarbenen Schindeln der viktorianischen Häuser, die wie eine Kruste um den inneren Edelstein lagen. Ein Juwel aus Wiesen und Bäumen und Wasser, das für Grace Lunge und Herz der Stadt bedeutete.
Auf der Hauptstraße stand der Verkehr, und sie blinkte rechts, nutzte eine Lücke zwischen den Autos und flüchtete aus dem Stau in eine schmale Seitenstraße, die parkende Autos an beiden Seiten noch stärker verengten. Grace fuhr in eine Lücke, um ein entgegenkommendes Auto passieren zu lassen. Knapp dreißig Meter vor dem Ende der Straße stand ein Müllwagen schräg am Bordstein. Es würde eng werden, aber sie müsste eigentlich daran vorbeikommen. Plötzlich fuhr der Wagen zurück und blockierte die Straße. Der Fahrer sah sie in seinem Rückspiegel an. Sie konnte fast das Glitzern in seinen Augen erkennen.
»Verdammt«, murmelte sie und beugte sich vor, um das Radio einzuschalten. Eine coole Rapversion von Summertime erklang, und sie lehnte sich im Sitz zurück, bereit, lange zu warten.
Die Müllmänner zerrten zwei Mülltonnen heran und hängten sie an den Wagen. Der gesammelte Gestank von verdorbenen Lebensmitteln, süßlich und Ekel erregend, drang aus dem Wagen. Tüten und loser Müll fielen in seinen schmutzigen Bauch und verströmten eine Wolke fauliger Luft, die so dicht war, dass sie sie fast sehen konnte.
»Danke, Jungs«, murmelte Grace und schaltete die Lüftung aus.
Der Wagen kroch drei Meter vor und kam rüttelnd zum Stehen.
»Verdammt!« Sie riss die Handbremse hoch und starrte den Fahrer wütend an. Er starrte in seinem Seitenspiegel zurück.
Zwei weitere Mülltonnen wurden gebracht und die leeren zurück an die Bordsteinkante gerollt. Die Hydraulik zischte und grummelte, als sie die zwei Tonnen anhob. Plötzlich war ihr das hirnverbrannte Geschwätz des Radiosprechers unerträglich. Grace suchte im Türfach nach einer Kassette und fand Peggy Lee. Sie legte die Kassette ein, dann lehnte sie sich zurück, um sie zu genießen, während die Tonnen ihren Inhalt in den Bauch des Wagens entleerten. Tüten, Zeitungen, leere Kartons, Kartoffelschalen. Der Inhalt der Tonne links blieb stecken, dann fiel ein Stück Teppich heraus.
Danach ...
Eine Leiche.
Eine Frau. Nackt. Kopfüber. Ihre dunkelbraunen Haare voller Dreck. Grüne Augen. Ein helles, strahlendes Grün. Ihr Arm fiel über ihr Gesicht, als wolle sie sich verteidigen. An ihrer linken Pobacke klebte ein Butterpapier. Ihre Oberschenkel leuchteten innen rot. Grace empfand Entsetzen und Mitleid und Empörung. Die Leiche rutschte mit einem dumpfen Geräusch in den Schlund des Wagens, dann folgte vom Boden der Tonne etwas Glitschiges, Geleeartiges, Rot-Schwarzes. Blut.
Die Constables Allen und Tunstall waren als Erste am Tatort. Sie stritten sich, als sie neben dem Müllwagen anhielten. Tunstall war der erfahrenere Beamte. Ein großer Mann mit breiten Schultern und einem noch breiteren Lancashire-Akzent. Er würde sich nicht überreden lassen.
»Ich habe es dir schon einmal gesagt, nein«, sagte er. »Nur einer von uns nähert sich der Leiche. ›Haltet den Tatort sauber‹, du kennst die Regel.«
»Komm schon, Kumpel, es ist mein erster verdächtiger Todesfall«, sagte Allen.
Sie stiegen aus dem Auto, Allen beschwerte sich immer noch, aber Tunstall unterbrach ihn: »Halt die Klappe und hol das Tatortset aus dem Kofferraum.«
Allen schimpfte, seine Laune besserte sich jedoch, als Tunstall ihn den Fundort absperren ließ. »Was wirst du machen?«, wollte er wissen.
»Mich vergewissern, dass es sich um ein Verbrechen handelt ...«
»Du meinst, dir die Leiche ansehen.«
Tunstall ignorierte die Unterbrechung. »Dann werde ich einen Gerichtsmediziner, den leitenden Ermittler und die Spurensicherung bestellen.«
Tunstall sah sich die Leiche an, bevor er die Namen der Zeugen notierte, dann erstattete er dem diensthabenden Sergeant im Toxteth-Revier Meldung. »Ich brauche einen Gerichtsmediziner und die Spurensicherung. Was ist mit dem leitenden Inspector?«
»Darum kümmert sich das Einsatzteam. Darüber brauchen Sie sich nicht den Kopf zu zerbrechen, Tunstall.«
»Nein, ich meine, kommt er her?«
»Wozu?«, fragte der Sergeant.
Tunstall war sich nicht sicher, was er darauf antworten sollte. Leitende Ermittler kamen, weil das ihre Aufgabe war, oder nicht?
»Schafft ihr Jungs das nicht?«, fragte der Sergeant.
»Na ja, schon, aber wir sind schließlich nicht von der Kripo, oder? Ich meine, ich möchte nicht dumm klingen, Sarge, aber werden die nicht, Sie wissen schon, ermitteln wollen?«
»Die können sowieso nichts machen, bevor die Spurensicherung nicht fertig ist. Es ist Ihr Tatort, Tunstall. Lassen Sie niemanden dorthin, der nicht da sein muss. Falls ein leitender Ermittler auftaucht, können Sie darauf wetten, dass er nur auf die Leiche neugierig ist. Lassen Sie ihn warten, bis die Spurensicherung fertig ist.«
»Alles klar ...« Tunstall war sich immer noch nicht sicher, ob er einen leitenden Ermittler tatsächlich nicht durch die Absperrung lassen sollte, aber wenn der Sergeant meinte, dass es so richtig sei ...
»Beschreiben Sie mir den Tatort«, sagte der Sergeant.
Tunstall sah zu Constable Allen hinüber. »Wir haben vom Müllwagen bis zu dem Haus, aus dem die Tonnen stammen, alles abgesperrt.«
»Das Haus selbst ist auch ein Teil des Tatorts«, sagte der Sergeant. »Haben Sie einen allgemeinen Zugang ausgewiesen?«
Daran hatte Tunstall nicht gedacht. »Allen sollte sich um den Zugang kümmern, Sarge.«
»Allen ist noch nicht lang genug dabei, um sich seine Schuhe allein schnüren zu können«, sagte der Sergeant. »Kümmern Sie sich darum. Halten Sie, wenn möglich, jeden davon ab, die Haustür zu benutzen.«
Tunstall löste das Problem, indem er Allen überall klingeln ließ, um die Leute zu bitten, das Haus über die Feuerleitern zu verlassen und zu betreten. Die Leute im Erdgeschoss hatten keine Wahl und mussten die Haustür benutzen.
»Hast du ihnen gesagt, dass sie drinnen bleiben sollen, solange nichts Dringendes passiert?«, fragte Tunstall, als Allen zurückkam.
Allen grinste. »Mach dir darüber mal keine Gedanken, Kumpel«, sagte er. »Die meisten der Mädchen arbeiten nachts, falls du verstehst, was ich meine.«
»Oh«, sagte Tunstall. Es dauerte einen Moment, dann wiederholte er: »Oh!« Dieses Mal etwas verständiger. »Falls es Strichmädchen sind, sollten wir wohl besser jemanden auf der Rückseite des Hauses aufstellen, damit er ihre Namen notiert, für den Fall, dass sie abhauen.«
»Also, sieh mich nicht so an«, sagte Allen, bereit, um sein Recht, vor dem Haus zu bleiben, zu kämpfen.
An jedem Straßenende fuhr ein Streifenwagen vor, und Tunstall und Allen grinsten sich verschmitzt an. »Geregelt«, sagten sie gemeinsam.
Innerhalb von zehn Minuten war die Straße abgesperrt und ein Beamter am Fuß der Feuerleiter postiert. Der Gerichtsmediziner durfte zu Fuß gehen. Neben einem der Polizeiwagen zog er seinen weißen Overall an. Bevor er weiterging, steckte er ein Namensschild an und schlüpfte in seine Überschuhe. Als er am Polizeiwagen vorbeikam, bemerkte er auf dem Rücksitz eine Frau. Eine kleine Frau Mitte dreißig, ihre Haare waren schulterlang, leicht gestuft und hellrot, und sie trug ein weites rotes Top über einer engen Hose.
»Grace?«
Die Autotür öffnete sich, also musste sie ihn gehört haben, aber sie reagierte zunächst nicht.
»Grace, bist du ...?« Er sah auf den Müllwagen und die Müllmänner, die unsicher neben dem Auto herumstanden. »Hast du sie gefunden?«
Grace sah langsam zu ihm hoch. Ihr Gesicht war blass und ihre Haare zerwühlt, als wäre sie immer wieder mit ihren Fingern durchgefahren.
»Sie ist noch ein Kind«, sagte Grace, der Satz war fast eine Frage. Ihre blauen Augen blickten verstört, verständnislos. »Sie kann doch nicht älter als siebzehn sein.«
»Hast du die Leiche berührt?«
Grace schüttelte den Kopf. Durch die Bewegung wurde ihr übel, sie schluckte und schloss einen Moment lang ihre Augen.
Der Gerichtsmediziner zog Handschuhe an und band eine Maske über Mund und Nase, bevor er die Kapuze seines Anzugs aufsetzte. Es schien eigentlich nicht notwendig angesichts des Schmutzes und Abfalls, aber es war die Standardvorgehensweise, und er mochte Standards, denn sie schufen Ordnung in einer chaotischen Welt.
Er ging zum Müllwagen und nickte einem der Dienst habenden Beamten zu. Es dauerte nicht lang. Er kehrte zurück, als ein großer Lastwagen die Straße entlanggerumpelt kam und sich vorsichtig durch die Menschen kämpfte, die sich an der Absperrung versammelt hatten.
»Ab hier übernimmt die Spurensicherung«, sagte er.
Es fiel Grace auf, dass das wie in einem Film klang. Sie wollte es sogar kommentieren, aber dann wurde ihr klar, dass es egal war. Alles schien egal zu sein, im Vergleich zu dieser furchtbaren Verschwendung von Leben.
Kapitel 3
Die Kriminalpolizei im Polizeirevier von Toxteth hatte viel zu tun. Ein bewaffneter Überfall, ein Einbruch in einer Grundschule, ein gestohlenes Auto, das man ausgebrannt in der Granby Street gefunden hatte, und einige Handydiebstähle bei Studenten.
»Wenn sie diese dämlichen Dinger nicht wie Modeaccessoires mit sich herumschleppen würden, würde man sie ihnen auch nicht klauen«, grummelte Sergeant Foster. »Haben die den Sicherheitsvortrag noch nicht gehört?«
Lee Foster teilte sich ein Büro mit Inspector Rickman, das durch Pressspanplatten und Glas im hinteren Ende des Raumes abgetrennt war.
»Ich hätte gedacht, dir müsste es gefallen, mit all diesen großäugigen Erstsemestern zu reden«, sagte Rickman und sah von einem Budgetbericht auf, mit dem er schon seit Tagen kämpfte. Foster war schmal und nach einem Wildwasserrafting-Urlaub in den kanadischen Rockies braun gebrannt, wodurch seine kobaltblauen Augen noch mehr strahlten. Rickman fragte sich beiläufig, wie viele Eroberungen er während der Ferien gemacht hatte und ob das Fehlen von Gel und einem Föhn seinen Stil ruiniert hatte.
Foster lächelte. »Ich bevorzuge Frauen mit ein bisschen Erfahrung.«
»Du machst Witze, oder? Jede erfahrene Frau weiß, dass sie dir aus dem Weg gehen muss«, sagte Rickman.
Foster nahm die spöttische Bemerkung gutmütig hin. »Das ist meine persönliche Tragödie: Ich bin dazu verdammt, missverstanden zu werden.«
»Deine persönliche Tragödie«, sagte Rickman, »ist, dass du kein bisschen Fingerspitzengefühl hast.«
Foster nickte nachdenklich. Er holte ein Stück Papier aus seiner Tasche, faltete es auf und hielt es zwischen Zeige- und Mittelfinger. »Du hast wahrscheinlich Recht.«
»Was ist das?«
Foster lächelte. In diesem Lächeln lag etwas Raubtierhaftes, sodass Rickman sagte: »Doch nicht die ...?«
»Ihre Privatnummer. Weißt du, Jeff, nicht alle Mädchen mögen den starken, ruhigen Typ.«
Rickman musste lächeln. »Ein Glück für dich, was, Lee? Na ja, du weißt ja, wie es heißt.«
»Was?«
»Stille Wasser«, sagte Rickman und tippte sich gegen die Nase. »Sie sind tief.«
Foster lachte. »In deinem Fall wohl eher schlammige Wasser.«
Das Telefon klingelte, und Rickman hob ab.
»Ich verstehe nicht, warum wir ihnen nicht einfach eine Bearbeitungsnummer für die Versicherung geben und diesen Haufen Müll in den Papierkorb schmeißen können«, murmelte Foster und blätterte die Berichte durch. »Wir werden so was Kleines wie ein Handy sowieso nie finden. Und selbst wenn, wie identifiziert man die? Es ist ja schließlich nicht so, dass ...«
Rickman legte eine Hand über den Hörer. »Halt mal die Klappe, okay?«
Foster ging die Berichte schweigend durch, hörte dabei mit halbem Ohr Rickmans Telefongespräch zu und merkte, wie seine Aufregung wuchs.
»Lass das liegen«, sagte Rickman, als er auflegte.
Foster ließ die Berichte ohne einen weiteren Gedanken fallen. »Wohin geht’s, Boss?« Hier ging es ums Geschäft, das verlangte eine gewisse Förmlichkeit.
»Sieht so aus, als hätten wir einen Mord«, sagte Rickman.
»Oh, klasse. Ein Tatort.« Foster schnappte sich seine Sonnenbrille, die er über den Griff seiner Kaffeetasse gehängt hatte. Wegen der aufgedruckten Silhouette einer Insel und dem Logo »Ein Geschenk von der Plum-Island-Tierkrankenstation« verschwand Fosters Becher nur selten.
Rickman schüttelte den Kopf.
Foster ließ die Schultern sinken. »Kein Tatort?«
»Wir wären bloß im Weg«, sagte Rickman, als spräche er mit einem enttäuschten Teenager. »Sobald die Spurensicherung fertig ist, werden wir mit einem Team hinfahren.«
»Dann wird alles Interessante schon verschwunden sein«, sagte Foster seufzend. Er wusste, dass es sinnlos war, zu streiten. Rickman bewegte sich keinen Millimeter, wenn es darum ging, die forensische Reinheit eines Tatortes sicherzustellen. Er zuckte mit den Schultern. »Also, wie ich schon sagte, wohin geht’s?«
»Zu einem Managementtreffen.«
Das genügte, um Foster die rosa Zettel vergessen zu lassen, die sich auf seinem Schreibtisch stapelten, jeder ein Bericht eines Handydiebstahls.
Sie gingen zum Konferenzzimmer, das sich größer anhörte, als es tatsächlich war. Es war ein rechteckiger Raum mit einem grauen Teppich und Gipswänden. Die Wände waren weiß gestrichen, und an der hinteren Wand standen eine weiße Tafel und ein mit Filz bezogenes schwarzes Brett nebeneinander. Die Fenster waren klein und nutzlos, sodass konstant Neonröhren summten, die das Zimmer grell erleuchteten und den Männern eine ungesunde graue Hautfarbe verliehen.
Detective Chief Inspector Hinchcliffe war extra vom Hauptquartier zu diesem Treffen gekommen. Er war groß, wirkte asketisch, hatte graue Haare und tiefe Sorgenfalten zwischen den Augenbrauen. Rickman kannte ihn nur vom Hörensagen. Hinchcliffe stellte sich vor und nickte Foster, mit dem er früher bereits zusammengearbeitet hatte, zu.
»Ich glaube, Sie kennen Tony Mayle«, sagte er.
Mayle war der leitende Beamte der Spurensicherung. Er war Mitte vierzig und ein Expolizist, sechs Jahre in Uniform, zehn als Detective Sergeant bei der Kripo. Er war ausgebildeter Forensiker, und da die wissenschaftliche Abteilung immer stärker mit Zivilisten besetzt wurde, nahm er seine Polizeipension, machte einen Universitätsabschluss in forensischen Wissenschaften und kam dann wieder zur Spurensicherung zurück. Er verfügte über den klaren Blick und die unerschütterliche Ruhe eines erfahrenen Beamten. Zusammen mit seiner wissenschaftlichen Distanz und seiner Beobachtungsgabe machte ihn das zum besten Spurensicherer, den Rickman kannte.
Nachdem sich alle vorgestellt hatten, setzten sie sich an den Konferenztisch, und Mayle sprach die Einzelheiten durch.
»Eine junge, weiße Frau«, sagte er. »Die Leiche war in einer Mülltonne versteckt, in einer Seitenstraße der Ullett Road. Sie wurde heute Morgen entdeckt, als die Mülltonnen geleert wurden. In der Leistengegend des linken Beines befanden sich große Wunden. Es sieht so aus, als sei sie in der Mülltonne verblutet.«
Stille. Jeder Mann überlegte, wie viel Blut das bedeuten musste.
»Der Gerichtsmediziner kann möglicherweise heute Nachmittag herkommen, um die Obduktion durchzuführen, falls er seine Termine ändern kann.«
»Irgendwelche Anzeichen von Fesseln?«, fragte Rickman.
»Nichts Offensichtliches, aber vielleicht wurden sie ihr nach dem Tod abgenommen.«
»Oder sie wurde unter Drogen gesetzt«, schlug Hinchcliffe vor.
»Fotos?«, fragte Rickman.
»Ich werde Ihnen Abzüge schicken lassen, sobald die Bildstelle sie entwickelt hat«, sagte Mayle. »Das sollte innerhalb der nächsten Stunde sein. Die Technik meinte, die Videokopien müssten gegen vier Uhr fertig sein.«
»Wie viele Tatorte?«, fragte Rickman.
»Der Müllwagen, den bringen wir zu einer gründlichen Untersuchung her. Natürlich die Mülltonne. Es ist wahrscheinlich, dass sie in dem Haus, aus dem die Mülltonne stammt, gewohnt hat, also behandeln wir auch das als Tatort.«
Das Risiko der Querkontamination bedeutete, dass jeder Ort mit einem eigenen, forensischen Team untersucht werden musste. Das klang bereits teuer.
Während Rickman sich Notizen machte, sagte Hinchcliffe: »Eines der Mädchen hat angegeben, dass die Bewohnerin des Nachbarapartments seit letztem Abend nicht nach Hause gekommen war.«
»Sie könnte sich die Leiche ansehen, oder nicht?«, fragte Foster.
»Kontamination«, sagte Mayle. »Ich will niemanden in der Nähe des Opfers sehen, bis wir alle DNS-Proben haben, die wir wahrscheinlich brauchen werden.«
»Rufen Sie Foster an, wenn Sie fertig sind«, sagte Hinchcliffe zu ihm. »Er kann die Nachbarin herbringen, um die Leiche zu identifizieren.«
»Haben wir einen Namen?«, fragte Rickman.
Hinchcliffe schüttelte den Kopf. »Die anderen Mädchen sagen, dass sie sie nur vom Sehen kannten.«
»In dem Haus wohnen viele Prostituierte«, fügte Mayle hinzu. »Wir haben andere Beweise«, fuhr er fort. »Blutspritzer im Flur. Könnten allerdings auch schon älter sein. Und Blutflecke auf Kleidern, die wir in ihrer Wohnung gefunden haben.«
»Lohnt es sich, einen Kriminaltechniker zu schicken, damit er sich die Blutflecken ansieht?«, fragte Rickman.
»Nicht, solange wir nicht wissen, ob es ihres ist. Nach allem, was wir wissen, könnte es auch von einem nächtlichen Streit stammen.«
»Und das Blut auf den Kleidern? Wie lange dauert die DNS-Analyse?«
»Bei einem Kapitalverbrechen sieben Tage«, sagte Mayle. »Aber das Labor könnte es in vierundzwanzig Stunden erledigen, wenn Sie den Extrapreis bezahlen.«
»Jeff?«, hakte Hinchcliffe nach.
»Das entzieht sich meiner Verantwortung, Sir«, erwiderte Rickman, »aber ich würde sagen, sehen wir mal, was wir haben, bevor wir anfangen, viel Geld auszugeben.« Er ging alles, was sie bisher hatten, in Gedanken durch. »Wenn wir eine direkte Identifizierung bekämen, würde das Zeit sparen. Ich schlage vor, dass wir die Zeugen und jeden, der in dem Haus wohnt, vernehmen. Mal sehen, wohin uns das führt.«
Hinchcliffe nickte zustimmend. »Es ist übrigens doch Ihre Verantwortung, zumindest im Augenblick. Ich werde die nächsten Tage verhindert sein, denn es gibt noch Fragen zu der Schießerei in der Mathew Street.« Vor sechs Monaten war zwischen rivalisierenden Drogengangs ein Revierkampf ausgebrochen, der in der Erschießung eines Gangführers in einem Pub im Stadtzentrum gipfelte.
»Sie machen mich zum leitenden Ermittler?« Seit der Schießerei gab es einen Personalengpass, da Hinchcliffes Ergebnisse einige weitere Ermittlungen notwendig gemacht hatten, doch das hatte Rickman nicht erwartet.
»Sie haben Ihre Chief-Inspector-Prüfung vor ein paar Monaten abgelegt, oder etwa nicht?«, fragte Hinchcliffe.
»Ja, Sir«, Rickman sah zu Foster, der seine Augenbrauen hochzog.
»Dann werden Sie der verantwortliche Chief Inspector sein. Sie werden mir direkt berichten oder dem Detective Superintendent, falls ich nicht erreichbar bin. Das gilt vorläufig«, warnte Hinchcliffe, »und auch nur so lange, bis ich mit der Staatsanwaltschaft in diesem anderen Fall alles geklärt habe.«
»Das ist mir recht«, sagte Rickman und rieb sich innerlich die Hände. Er war bereit für diese Herausforderung. »Wann können wir das Haus betreten?«, fragte er Mayle.
»Wir werden in einer Stunde fort sein.«
»Bekannte Zeugen?«
»Bisher sind es die Müllmänner und der Fahrer und eine Frau, die hinter dem Wagen stand. Sie sollte eigentlich eine gute Zeugin sein, sie ist Ärztin.«
Rickman war alarmiert. »Eine Ärztin? Wissen Sie ihren Namen?«
»Der wird wohl im Tatortbericht stehen«, sagte Mayle.
»Jemand, den Sie kennen?«, fragte Hinchcliffe.
Rickman antwortete nicht sofort. Er wusste, dass Grace manchmal durch die Seitenstraßen zur Arbeit fuhr, aber er wollte diese Chance nicht ruinieren. Er hatte seine Chief-Inspector-Prüfung zwar bestanden, aber er war immer noch nur ein Inspector, und Inspectors bekamen normalerweise nicht die Verantwortung für eine große Ermittlung zugewiesen. Und falls Hinchcliffe dachte, seine Objektivität könnte irgendwie beeinträchtigt sein, würde er ihn von dem Fall abziehen. »Das glaube ich nicht, Sir«, sagte er.
Hinchcliffe sah ihn einen Moment lang zweifelnd an, dann sagte er: »In dem Fall sollten Sie sich besser auf den Weg ins Edge-Hill-Revier machen. Ich habe angeordnet, dass dort ein Ermittlungsraum für Sie eingerichtet wird.«
Schließlich verschoben sie den Umzug noch für mehr als eine Stunde. Rickman musste einige dringende Fälle an Junior Officers weitergeben und ein paar Treffen absagen. Was ihm noch wichtiger war: Er musste Grace erreichen, und dafür bot ihm sein eigenes Büro eine größere Privatsphäre.
Während Foster ein Ermittlungsteam zusammenstellte, rief Rickman im Krankenhaus an.
»Und?«, fragte Foster zwischen den Anrufen.
»Sie hat das Krankenhaus verlassen. Sie arbeitet nachmittags in einer Klinik«, erklärte Rickman. Grace arbeitete halbtags als Notärztin und halbtags als Allgemeinmedizinerin und Leiterin eines Teams einer Hilfsorganisation für Flüchtlinge. »Ihr Handy ist ausgeschaltet, und in der Klinik ist ständig besetzt.«
»Sie hat zu tun, vermutlich ist das am besten für sie.«
»Du hast wahrscheinlich Recht ...«
Foster seufzte. »Du solltest hinfahren.«
Rickman zögerte. Es war schon schlimm genug gewesen, Chief Inspector Hinchcliffes Frage auszuweichen, aber direkt zu Beginn einer Mordermittlung ohne Erlaubnis zu verschwinden, hieße, sein Glück sehr zu strapazieren. Er sollte das Team zusammenstellen, die Ausrüstung bestellen, eine Ermittlungsstrategie erarbeiten und nicht abhauen, um nach seiner Freundin zu sehen.
»Solange du dir wegen Grace Sorgen machst, wirst du überhaupt nichts hinkriegen«, beharrte Foster. »Ich kann dich auf deinem Handy erreichen. Falls der Boss fragt, bist du auf dem Weg zum Tatort.« Er grinste ihn an. »Ich werde dich dort treffen, wenn du willst.« Es schien, dass Foster fest entschlossen war, sich den Tatort anzusehen.
»Danke, Lee«, sagte Rickman und griff nach seiner Jacke.
»Bist du in Ordnung, Kumpel?«, fragte Foster. »Das ist nämlich schwer zu sagen.« Fosters Durchschaubarkeit im Gegensatz zu Rickmans Distanziertheit war eine Quelle stetiger Neckereien.
»Sie sollte mit so einer Kacke nichts zu tun haben«, sagte Rickman schließlich.
»Das sollte niemand, Kumpel«, sagte Foster.
Die Arztpraxis lag in einem niedrigen Gebäude an der Princes Road. Durch das Satteldach und die knallroten Fensterrahmen sah es eher wie ein Kindergarten und nicht wie ein öffentliches Gebäude aus. Cotoneaster und Feuerdorn kletterten über die dreißig Zentimeter hohe Backsteinmauer am Eingang und ließen die harten Kanten der Architektur weicher erscheinen. Die Sträucher hingen voller orangefarbener und roter Beeren sowie Bonbonpapierchen und ein paar Supermarkttüten. Der Asphalt war an einigen Stellen aufgebrochen worden, um Betonpoller einzulassen, nachdem es letztes Jahr einen Überfall gegeben hatte, bei dem das Gebäude mit einem Fahrzeug gerammt wurde. Die Fenster wurden durch passende rote Läden geschützt, die jeden Abend herabgelassen wurden.
Inspector Rickman zeigte seinen Ausweis an der Rezeption, ein achteckiger Kasten, in dem sich die Telefonzentrale und das Archiv befanden und der die Eingangshalle des Gebäudes beherrschte. Die Frau zeigte nach links, an einer Reihe Leute unterschiedlicher Nationalitäten vorbei, die anscheinend alle auf Dr. Chandler warteten.
Er wartete, bis sich die Tür öffnete, und trat ein, als Grace ihren nächsten Patienten rief.
Ihr Gesichtsausdruck des professionellen Willkommens wurde ärgerlich, als sie ihn sah. »Ich habe Sprechstunde, Jeff«, sagte sie ruhig.
»Das sehe ich.« Sie sah blass aus. Ihre Haut wirkte milchweiß vor dem Kupferblond ihrer Haare. Ihre blutrote Bluse ließ ihr Gesicht nicht wärmer erscheinen, und ihre hellblauen Augen strahlten mit fast übernatürlicher Intensität. Rickman erkannte das Aussehen von jemandem, der dem Tod zu nah gekommen war. Einen Augenblick lang dachte er, sie würde ihn fortschicken. Dann trat sie einen Schritt zur Seite und ließ ihn in ihr Behandlungszimmer.
Das Zimmer zeigte unverkennbar Grace’ persönlichen Einfluss: eine Leiste mit Jack und der Bohnenstange, um die Größe von Kindern zu messen, ein Gemälde, das Rickman als eines von Grace’ eigenen Aquarellen wiedererkannte. Hinter ihrem Schreibtisch hingen an einem Korkbrett Hunderte von Fotos: Kinder, Erwachsene, Familien, Geburtstage, Taufen, Picknicks.
Auf einem Stuhl neben Grace’ Tisch saß eine dünne, blasse Frau und betrachtete ihn. Sie hatte ein schmales Gesicht mit hohen Wangenknochen und dunklen, misstrauischen Augen. Ihre fast schwarzen Haare waren aus dem Gesicht gekämmt und zu einem schlichten Pferdeschwanz gebunden.
»Entschuldigung«, sagte er. »Ich wusste nicht, dass du noch eine Patientin hast.«
»Das ist Natalja Sremać«, sagte Grace, »meine Dolmetscherin.«
Rickman hielt ihr die Hand hin.
Natalja stand mit einer fließenden Bewegung auf. Sie war groß, vielleicht einssiebenundsiebzig, und hatte lange Gliedmaßen. Sie berührte seine Hand kaum; ihre Hand war feucht.
»Grace hat viel von Ihnen erzählt«, sagte er.
»Sie wollen sicher allein sein.« Ihre Stimme war tief und hatte einen starken mitteleuropäischen Akzent.
Grace lächelte sie an. »Er bemuttert mich nur ein bisschen«, sagte sie.
Natalja lächelte zurück. Sie hatte einen breiten Mund und volle Lippen, aber das Lächeln schien nervös, zitterte, verschwand. Sie wirkte aufgeregt. »Ich brauche eine Zigarette«, sagte sie. »Ich bin draußen.«
Sie schloss die Tür leise hinter sich, und Grace verschränkte die Arme. »Du hast sie vertrieben.«
»Was habe ich gesagt?« Er breitete seine Hände in einer Geste der verletzten Unschuld aus.
»Du brauchst gar nichts zu sagen«, sagte Grace.
»Sie ist deine Freundin. Du kennst sie seit, wie lange, sechs, sieben Jahren?«
»Sieben.«
»Und doch habe ich sie noch nie getroffen.«
»Sie ist schüchtern.«
»Ich bin neugierig.«
»Du hast sie begutachtet.«
Rickman schnaufte. »Was soll ich sagen? Ich bin ein Bulle.«
»Zuallererst und zuallerletzt.«
Er sah Humor in ihren Augen blitzen und nahm das als Zeichen, dass es möglich war, zum Grund seines Besuchs zu kommen. »Ich habe mir Sorgen um dich gemacht.«
Grace antwortete mit einem Überraschungsangriff. »Du kommst hierher, unterbrichst meine Sprechstunde, erschreckst meine Dolmetscherin, siehst wie ein Polizist aus ...«
»Ach ja? Wie sieht ein Polizist denn aus?«
Ein Lächeln umspielte ihre Lippen. »Wie du«, sagte sie.
»Ich dachte, du hättest gesagt, ich sehe wie ein Boxer aus«, gab Rickman zurück.
»Wie ein gescheiterter Boxer.« Jetzt lächelte sie richtig. »Zu viele Wunden, um ein erfolgreicher Schläger gewesen zu sein.« Sie berührte mit den Fingerspitzen die Narbe an seinem Kinn und die weiße Linie, die seine Augenbraue durchzog.
Er griff nach ihrer Hand und sah ihr ins Gesicht. »Geht es dir gut?«
»Es geht mir gut«, sagte sie bestimmt, aber sie sah ihn nicht an.
Er betrachtete ihr Gesicht, und sie seufzte. »Ich habe früher schon Leichen gesehen, Jeff. Ich habe mit ihnen gearbeitet. Sie aufgeschnitten. Ich habe sie als Studentin sogar ausgenommen.«
Er sah sie weiterhin an. »Du hast aber noch nie eine entdeckt, oder?«, sagte er.
Er bemerkte die Tränen in ihren Augen. Sie sah so blass aus, und die Falte zwischen ihren Augenbrauen schien tiefer als sonst. Sie räusperte sich und sagte noch einmal: »Es geht mir gut.«
Er atmete tief durch. »Ich leite die Ermittlungen.« Er hielt ihre Hand noch eine Weile.
Sie nickte und runzelte die Stirn, als hätte sie Schwierigkeiten, das zu begreifen. Schließlich erwiderte sie: »Du leitest die Ermittlungen«, als ob sie es sich bewusst machen wollte. Dann schien sie sich zu schütteln und wurde plötzlich forsch und geschäftsmäßig. »Wenn das so ist, können wir auch später darüber sprechen.«
Er schaute auf ihre Hand, die in seiner lag, so klein, so fähig. »Ich hätte auf Lee Foster hören sollen«, sagte er. »Er hat mir gesagt, dass es dir gut gehen würde.«
»Er ist ein weiser und wundervoller Detective Sergeant«, erwiderte sie lächelnd.
»Jetzt weiß ich, dass du es nicht ernst meinst.« Rickman lehnte sich vor, um sie zu küssen. Ihre Lippen waren kalt.
»Er ist gegangen.«
Natalja saß auf der niedrigen Mauer, die den Parkplatz hinter der Klinik begrenzte. Nach dem kühlen Morgen war die Luft ruhig und schwer, und dunstiger Sonnenschein strahlte auf die Autodächer.
»Wie bitte?«
Natalja war zusammengesunken und sah ängstlich aus, ihr Gesicht war bleich. Grace schämte sich, ihre Angst vor der Polizei auf die leichte Schulter genommen zu haben. Sie versuchte eine Ablenkungstaktik. »Gib mir eine«, sagte sie.
»Du willst eine Zigarette?«, fragte Natalja. »Ich wusste nicht, dass du rauchst.«
Grace setzte sich neben sie auf die Mauer. »Du kanntest mich nicht während meiner zügellosen Jugend. Nach fünfzehn Jahren habe ich immer noch Lust darauf.«
Natalja gab Grace die Packung und das Feuerzeug und sah neugierig zu, wie Grace sich eine Zigarette anzündete.
»Geht es dir gut?«, fragte sie.
Grace runzelte die Stirn. »Das hat Jeff gerade gefragt.«
Natalja wartete auf eine Antwort. Als keine kam, fragte sie nach: »Und?«
»Ich bin mir nicht sicher«, entgegnete Grace. Es war leichter, zu Natalja ehrlich zu sein als zu Jeff. »Ich fühle mich vor allem wie betäubt.« Sie schaute in Nataljas besorgtes Gesicht. Ihr war bewusst, dass sie in Kroatien viel Schlimmeres gesehen haben musste. »Es war die ...« Was war das richtige Wort? »Die Würdelosigkeit, die mich fertig gemacht hat. Wie kann man einen anderen Menschen so würdelos behandeln?«
»Indem man ihn nicht als Menschen sieht.« Nataljas Augen wurden leer, sie sah zur Seite, stand auf und trat die Zigarette unter ihrem Absatz aus. »Mrs Dubuisson ist die Nächste«, sagte sie.
Grace hielt ihr Gesicht in die warme Herbstsonne. Ein Spatz zwitscherte monoton in dem Ahorn hinter dem Parkplatz. »Mrs Dubuisson«, wiederholte sie und seufzte. Seit sieben Jahren kannten sie einander, arbeiteten zusammen, gingen zusammen einkaufen, zum Mittagessen und zu Frauenabenden, und doch war Natalja immer davor zurückgeschreckt, über ihre Vergangenheit zu sprechen. Grace hatte so etwas schon bei anderen Traumaopfern erlebt, eine fehlgeleitete Scham wegen der Erniedrigung, die sie erlitten hatten. Die Schuld des Überlebenden. Grace empfand es als einen persönlichen Misserfolg, dass sie Natalja nie davon hatte überzeugen können, dass sie keine Schuld traf.
Kapitel 4
Sergeant Foster parkte nicht direkt vor dem Haus. Ein Teil der Straße war immer noch abgesperrt, und es war sogar noch schwieriger als sonst, einen Parkplatz zu finden. Tony Mayle hatte ihn aus dem forensischen Labor angerufen. Sie hatten alle notwendigen Proben genommen, die Leiche des Mädchens war zur Identifikation freigegeben.
Er zeigte seinen Ausweis und wurde hinter das Absperrband gewunken. Vor dem Haus hielt ein großer Constable mit einem roten Gesicht Wache. Foster stemmte die Hände in die Hüften und sah am Haus hoch. Die oberen Fenster hatten weder Vorhänge noch Jalousien. Löcher waren mit Pappe und Tesafilm geflickt, ein schmuddeliges Stück Holz war über ein Fenster im ersten Stock genagelt. Es schien unmöglich, die ursprüngliche Farbe des Putzes zu benennen, da das meiste abgefallen war. Die Vordertreppe war uneben und voller Risse, keine einzige der roten Fliesen war ganz. Der Garten bestand aus einem wuchernden Schmetterlingsfliederbusch, der sich durch den schlecht verarbeiteten Beton gekämpft hatte. Ein paar verspätete Schmetterlinge suchten in den Blüten nach Nektar.
»Hübsch, nicht wahr?«, sagte Tunstall.
Ein Akzent aus Widnes, dachte Foster. Ein Landei.
»Erstklassige Entwicklungsmöglichkeiten, Kumpel«, sagte Foster.
Tunstall sah zweifelnd über seine Schulter. »Meinen Sie?«
»Wenn ich das Geld hätte, würde ich selbst ein Angebot abgeben.« Er sah den riesigen Schmetterlingsfliederbusch und das verrostete Motorrad, aus dem Öl tropfte, kritisch an. »Natürlich müsste man alles ausräuchern, noch bevor man es abreißen lässt.«
»Nee«, sagte Tunstall, »Ungeziefer hat es gern sauber.«
Drinnen roch das Haus vor allem feucht, nach feuchtem Putz und verrottendem Holz. Der Flur war dunkel, und er musste vorsichtig sein, um nicht über die Risse und Löcher im Linoleum zu stolpern. Er fand einen Lichtschalter, eine alte Zeitschaltuhr, und ging in den ersten Stock. Als er die oberste Stufe erreicht hatte, ging das Licht aus, und er musste es noch einmal einschalten.
Die Tür links vom Treppenabsatz war mit Polizeiband abgesperrt. Foster klopfte an die Tür daneben und wartete. Er hörte gedämpfte Schritte, spürte, wie jemand über die brüchigen Dielen ging.
»Ja?« Eine schrille Stimme, die durch Zigaretten und zu viele Nächte, die sie im Freien gearbeitet hatte, rau geworden war.
»Polizei, Miss Carr.«
Eine Pause. Dann: »Und?«
Super, er hatte den kooperativen Typ für eine Vernehmung erwischt. »Könnten Sie bitte die Tür öffnen? Ich würde gern mit Ihnen sprechen.«
Die Kette wurde vorgelegt und die Tür ein paar Zentimeter geöffnet, sodass ein Auge und die Nase sichtbar wurden. Das Auge war graublau und blass, der Mund ein dünner, rosa Strich. Foster zeigte seinen Ausweis und stellte sich vor.
»Und?«, fragte sie noch einmal.
»Darf ich reinkommen?«, sagte er. »Ich komme mir wie ein Idiot vor, wenn ich durch den Türspalt reden soll.«
Die Augen verdunkelten sich. »Genau das, was ich brauche, einen neunmalklugen Bullen.«
»Entweder wir unterhalten uns jetzt, oder ich komme während der Geschäftszeit zurück, und wir sprechen auf dem Revier«, sagte er und fügte hinzu: »Ich meine Ihre Geschäftszeit, nicht meine.«
Sie murmelte etwas Unverständliches, dann schloss sie die Tür, und er hörte die Kette rasseln. Die Nase und der Mund gehörten zu einem müden Gesicht, das fast so verblichen wirkte wie das Jeansblau ihrer Augen. Sie hatte Falten von zu vielen Zigaretten und zu viel Elend, aber sie war höchstens dreißig. Sie trug einen flauschigen, rosa Bademantel, und ihre Haare, die sie gerade gewaschen hatte, hingen in dunklen, tropfenden Locken herab.
Die Tür öffnete sich zur Ecke einer Wand hin. Ein riesiges Doppelbett nahm den meisten Platz ein. Ein Waschbecken und ein Herd mit zwei Platten standen in der hinteren Ecke, rechts neben dem Fenster.
»Sind Sie Trina Carr?«
Sie antwortete, indem sie leicht den Kopf hob. »Sie können sich dort hinsetzen.« Sie zeigte auf einen grellrosa, aufblasbaren Sessel neben dem Fenster. Das Zimmer war sehr rosa: rosa Wände, rosa Teppichboden, frisch gesaugt, saubere rosa Laken auf dem Bett. Sogar die Lichterkette, die um das Kopfende des Bettes gewickelt war, war rosa.
Die Vorstellung, sich in eine Blase aus quietschendem, furzendem Plastik zu setzen, gefiel ihm nicht, und Foster lehnte ab. »Ich bleibe einfach ...« Er ging zum anderen Ende des Bettes und schob vorsichtig einen ganzen Zoo Plüschtiere von einem Stuhl.
Sie beobachtete ihn, als wäre sie davon überzeugt, dass der Stuhl unter ihm zusammenbrechen würde.
»Nettes Zimmer«, sagte er. »Sehr ... rosa.«
»Was ist verkehrt an Rosa?«, wollte sie wissen.
»Nichts«, sagte Foster. »Es ist eine feminine Farbe, nicht wahr?«
Das schien sie zu besänftigen. Sie setzte sich aufs Bett, lehnte sich zu ihm vor und zeigte mehr Dekolleté als nötig. »Mir gefällt es«, sagte sie.
Foster beschloss, seinen Vorteil auszunutzen, und setzte weiter auf Schmeichelei. »Sie sind sehr ordentlich.«
Trina richtete sich beleidigt auf, war sofort zum Angriff bereit. »Was haben Sie erwartet? Ein schmuddeliges Bett mit dreckigen Laken und benutzten Gummis im Aschenbecher?«
Foster hob seine Hände und lehnte sich in seinem Stuhl zurück, versöhnlich und verteidigend. »Ich sage ja nur, dass es hier nicht gerade einfach ist.«
Sie blieb kerzengerade sitzen, aber in ihrem misstrauischen Gesicht zeigte sich vorsichtige Zustimmung. »Und?«, fragte sie.
»Ich meine ja nur ...«, sagte er in beruhigendem Tonfall.
»Ja, klar, erzählen Sie das mal dem Vermieter.«
»Sie sollten mit dem Sozialamt reden«, schlug er vor. »Es gibt ein paar nette Sozialwohnungen im Stadtzentrum.«
Sie schnaubte. »Ich hatte mal eine Sozialwohnung. Sie sehen es nicht so gern, wenn man einen Job wie meinen hat.«
»Sie könnten den Beruf wechseln.«
»Als ob ich die Wahl hätte.«
»Es gibt immer eine Wahl«, sagte Foster. Er sah, dass sie wieder gereizt reagierte, deshalb stellte er schnell die nächste Frage. »Bringen viele Mädchen ihre Freier hierher?«
»Das müssen Sie die fragen«, sagte sie.
Foster widerstand der Versuchung, die Augen zu verdrehen, und fragte: »Was ist mit Ihnen?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich bringe ein paar nach Hause, wenn sie sauber sind und den Spitzenpreis bezahlen.«
»Dünne Wände«, sagte Foster. »Sie müssen sie kommen und gehen hören, entschuldigen Sie das Wortspiel.«
»Es ist kein Bordell, falls Sie das meinen.« Er dachte, er hätte sie wieder beleidigt, aber sie fuhr fort: »Ich habe in einem Bordell gearbeitet. Es muss organisiert werden, man braucht Leute am Telefon, an der Rezeption, einen Schichtplan für die Mädchen, eine Provision für den Besitzer. Der Vermieter, der alte Preston, könnte den Verkehr in einem Bordell nicht regeln, entschuldigen Sie das Wortspiel.«
Foster lächelte. Er mochte ihren Stil, aber falls sie versuchte, ihn vom Thema abzubringen und ihn mit ihrem netten Geschwätz über die logistischen Probleme eines Bumsschuppens durcheinander zu bringen, dann probierte sie es beim Falschen.
»Wann sind Sie nach Hause gekommen?«, fragte er.
»Wann?«
»Gestern Nacht.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Das hängt davon ab. Ich bin die ganze Nacht gekommen und gegangen.«
Foster schluckte einen Witz hinunter und fragte: »Mit einigen Ihrer sauberen Freier?«
Sie runzelte die Stirn, ohne zu begreifen.
»Sie haben sie hierher gebracht.«
»Ach so«, sagte sie. »Ja.«
»Haben Sie irgendetwas gehört?«
Sie sah peinlich berührt aus. »Was, zum Beispiel?«
»Oh, ich weiß nicht«, sagte Foster und verlor schließlich die Geduld. »Welche Geräusche macht ein Mädchen wohl, wenn man es verbluten lässt?«
Trina zuckte zusammen. Sie stand vom Bett auf und ging zum Kaminsims, um ihre Zigaretten und das Feuerzeug zu holen. Sie zündete sich nicht sofort eine an, sondern spielte mit der Packung, die sie auf- und zuklappte.
»Sie war neu.«
»Aha?«
»Wenn man neu ist, dann ... manchmal ...«
»Manchmal?«, ermunterte er sie.
Sie atmete tief durch, es hörte sich fast wie ein Schluchzen an. »Ich habe sie vielleicht weinen hören.« Sie sah ihn an, als bitte sie um Verständnis.
»Wann?«
»Kurz nach halb zwei, als ich für eine Pause nach Hause gekommen war.«
»Allein?«
Sie starrte ihn an. »Allein, okay? Hören Sie, ich hatte die Nase voll davon, mir da draußen die Titten abzufrieren, also bin ich nach Hause gegangen, um mich aufzuwärmen und mir eine Tasse Kaffee zu machen.«
»Ich bin nicht Ihr Zuhälter«, sagte Foster. »Ich werfe Ihnen nicht vor, faul gewesen zu sein, ich muss einfach nur wissen, ob wir noch andere Zeugen vernehmen müssen.«
»Kein Freier«, sagte sie bestimmt. »Ich war allein.«
»Was ist mit Ihrer Nachbarin? War irgendjemand bei ihr?«
»Woher soll ich das wissen?«
Er klopfte gegen die Wand hinter ihrem Bett. »Dieses Stück Schrott muss ungefähr so schallisolierend sein wie ein Duschvorhang. Haben Sie jemanden bei ihr gehört?«
Trina sah auf den sauberen rosa Teppich. »Ich habe vielleicht eine Männerstimme gehört, aber er redete nur. Er war nicht – es klang nicht so, als ob, als ob er ihr wehtat.«
»In Ordnung. Was haben Sie dann getan?«
Trina nahm eine Zigarette und zündete sie an. »Sie weinte immer. Das macht jede durch.« Sie wich seinem Blick aus. »Nach einer Weile ist es nicht mehr so schlimm.«
»Was«, wiederholte Foster, »haben Sie getan?«
Sie drehte sich zum Fenster um, öffnete es und blies Zigarettenrauch in die eisige Luft. »Ich habe eine CD eingelegt und die Lautstärke hochgedreht.«
Foster starrte ihren Rücken an. Nach ein paar Sekunden drehte sie sich mit flammenden Augen zu ihm um. »Verurteilen Sie mich bloß nicht!«, rief sie. Eine Träne hing an ihrem unteren Augenlid. »Wenn ich gewusst hätte, dass sie, dass sie ...« Die Träne tropfte auf ihre Wange. Sie wischte sie mit zitternder Hand weg.
»Sie dachten, dieser Mann wäre ein Freier«, sagte Foster.
»Was hätte ich sonst denken sollen?«
»Sie brachte also Männer hierher?«
»Sie war erst seit ein paar Tagen hier.«
»Und Sie kannten ihren Namen nicht?«
»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Mein Gott!« Sie warf ihre Zigarette aus dem Fenster und holte ein Taschentuch vom Nachttisch.
»Woher kam sie?«
Sie schnäuzte sich. »Woher soll ich das wissen? Ich bin schließlich nicht ihre Mutter.«
»Im Augenblick, Trina, sind Sie ihre nächste Anverwandte«, sagte Foster, zog die Augenbrauen hoch und wartete, bis sie begriff.
Als sie es endlich tat, wich alle aggressive Spannung von ihr, und ihre Schultern sanken herab. »Ach, kommen Sie, ich habe sie den Bullen schon beschrieben.«
Foster runzelte die Stirn. »Tut mir Leid, meine Liebe, das genügt nicht«, sagte er. »Wir brauchen eine zweifelsfreie Identifikation.«
»Nein.« Ihre Stimme wurde schrill und panisch. »Dazu können Sie mich nicht zwingen. Ich kannte sie nicht einmal.«
»Aber Sie wissen, wie sie aussieht. Sie können uns sagen, ob sie das Mädchen von nebenan ist.«
»Ich arbeite heute Abend ...«, sagte sie in einem letzten, verzweifelten Versuch, die Fahrt zur Leichenhalle zu verhindern.
»Kein Problem«, sagte Foster. »Wir sind hier in ungefähr einer Stunde fertig. Ich werde Sie mitnehmen und Sie, wo auch immer Sie arbeiten, absetzen. Wie klingt das?«
Sie starrte ihn missmutig an. »Ich habe keine Wahl, oder?«
Er lächelte sie an. »Überhaupt keine.«
Kapitel 5
Der Einsatzraum im Edge-Hill-Polizeirevier war schon eingerichtet und in Betrieb, als Rickman ankam. Er fuhr an dem zweistöckigen Gebäude aus schlammfarbenem Backstein vorbei. Die Geschäfte auf der gegenüberliegenden Straßenseite waren größtenteils aufgegeben worden. In der Mitte befand sich die verblasste gelbe Ladenfassade eines Wavertree-Fahrradladens, an der nächsten Ecke verkündete das stolze Logo eines weiteren erfolglosen Optimisten »Spezialisiert auf Möbel und Luxuseinrichtungen«. In der gesamten Straße waren die Rollläden herabgelassen und die oberen Fenster zugemauert.
Der Parkplatz lag hinter dem Gebäude. Ein Schulbus suchte zwischen den Polizeiwagen Schutz. Rickman schraubte die Antenne ab und warf sie in den Kofferraum. Eine hohe Mauer und Überwachungskameras sorgten dafür, dass die Autos relativ sicher vor Diebstahl und Vandalismus waren, aber in so einer Gegend ging man kein Risiko ein. Er lief zum Vordereingang. Die von niedrigen Backsteinmauern umgebenen Blumenbeete waren mit Asphalt bedeckt worden, auf dem nun Unkraut wuchs. Er zeigte seinen Ausweis, und die Tür zu den Büros auf der linken Seite wurde geöffnet.
Ein paar zusätzliche Schreibtische waren in den Einsatzraum gestellt worden, und jeder freie Zentimeter war voll von Computerzubehör, Aktenschränken und Menschen. Er blieb stehen und genoss den Geräuschpegel in einem Einsatzraum, wo man sich auf eine Ermittlung vorbereitete.
Eine große Blondine rauschte an ihm vorbei und begann, mit einer anderen Polizistin über die Ergebnisse der Nachbarschaftsbefragung zu diskutieren. Ein paar Leute telefonierten, stellten Fragen, machten Notizen. Ein Mann, den Rickman vage als einen Commissioner aus dem Süden der Stadt wiedererkannte, scrollte auf dem Bildschirm durch eine Liste mit vermissten Personen. Sein Telefon klingelte, er hob den Hörer ab und machte mit seiner Computersuche weiter, während er sprach.
Rickman beobachtete Foster am anderen Ende des Zimmers, wie er Einzelheiten über die Tote unter ein Foto des Tatorts schrieb, das an der weißen Tafel hing. Er schlängelte sich durch den Parcours aus Tischen und Stühlen zu dem Sergeant. Mit einem Meter neunzig war Rickman eine imposante Figur, und es dauerte nicht lange, bis es ruhig wurde, Finger nicht mehr auf Tastaturen tippten und Telefongespräche beendet wurden.
Rickman sah in einigen der Gesichter Eifer und Aufregung, in anderen schieren Ehrgeiz. Als alle aufmerksam waren, fing er an.
»Sie alle haben erste Informationen erhalten: Ein weibliches Opfer, wahrscheinlich eine Jugendliche, noch kein Name.« Er sah wegen einer Bestätigung zu Foster, der leicht nickte.
»Die forensische Abteilung hat am Tatort Spuren gesammelt«, sagte er, »aber es kann etwas dauern, bis die Ergebnisse kommen, also müssen wir Prioritäten setzen. Die Zeugen sind die allererste Priorität. Die Leute bleiben nicht lange dort. Wenn wir sie nicht schnell erwischen, werden wir sie verlieren.
Dann, das Opfer: ihr Name, ihre Freunde, falls sie welche hatte, Bekannte, Gewohnheiten, und vor allem, was sie in den Stunden vor ihrem Mord getan hat.«
»Diese Mädels machen nur aus einem einzigen Grund die Klappe auf, und sie erwarten dafür eine Bezahlung«, sagte Foster.
Rickman war an Fosters nicht gerade taktvolle Ausdrucksweise gewöhnt. Er zog eine Augenbraue hoch und sagte: »Seien Sie nicht aggressiv, aber beharrlich. Ein Mädchen wurde umgebracht, andere könnten in Gefahr sein. Versuchen Sie, damit zu ihnen durchzudringen. Wir müssen das Mädchen identifizieren.«
Er entdeckte den Beamten, der sich durch die Liste mit den vermissten Personen gearbeitet hatte, und fragte ihn nach Neuigkeiten.
»Bisher noch nichts, Boss«, sagte er. »Aber ich hatte erst Zeit, die letzten zwei Wochen zu überprüfen. Wie weit soll ich zurückgehen?«
Rickman dachte darüber nach. Das Opfer hatte keine Freundin im Haus gehabt, zumindest gab keine zu, ihre Freundin gewesen zu sein. Das war ungewöhnlich, normalerweise passten die Mädchen aufeinander auf.
»Hat irgendjemand mit dem Vermieter gesprochen?«
Die große Blondine, die Rickman schon vorher aufgefallen war, meldete sich. »Naomi Hart, Sir. Der Name des Vermieters ist Preston.« Sie zuckte mit einer Schulter. Ihre Haare waren hochgesteckt, was die Länge und die Linie ihres Halses betonte. Rickman bemerkte, dass die Männer des Teams sie anstarrten.
»Es ist, wie Sie gesagt haben«, fuhr Naomi Hart fort. »Die Mieter bleiben nicht lange. Das Mädchen, dessen Name in dem Mietbuch steht, ist verschwunden. Er sagt, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass die Mieter das Mietbuch an einen Freund weitergeben. So erspart man sich den Stress der Wohnungssuche. Es ist ihm egal, solange sie pünktlich bezahlen.«
»Hat sie das getan?«, fragte Rickman.
»Das konnte er nicht mehr herausfinden. Sie war noch keine ganze Woche da.«
»Das bestätigt ihre Nachbarin«, warf Foster ein.
»Gehen Sie noch einmal zu dem Vermieter«, sagte Rickman zu Commissioner Hart. »Erinnern Sie ihn an seine gesetzliche Verpflichtung. Versuchen Sie, die Vormieterin zu finden, vielleicht kannte sie das Opfer.«
Rickman wandte sich wieder dem Beamten zu, der in der Datenbank mit den vermissten Personen suchte. »Probieren Sie es mit den Vermissten der letzten drei Monate, Sie werden sich nach der Beschreibung und dem ungefähren Alter richten müssen. Wir müssen sie schnell identifizieren.«
»Falls sie wirklich eine Nutte war, könnte ihre DNS in der Datenbank sein«, sagte Foster.
Rickman dachte darüber nach. »Ich werde bei der Bestimmung der DNS des Opfers und des Blutes auf der Kleidung um den Premiumservice bitten. Falls wir Glück haben, hat der Mörder vielleicht Blut am Tatort hinterlassen.«
Alle nickten zustimmend, die Neulinge machten sich Notizen und fassten eifrig das Wichtigste der Besprechung zusammen, was Rickman an etwas erinnerte: »Notizbücher sind draußen schön und gut, aber alle Notizen sind Teil der Ermittlungen. Sie sollten einen möglichst detaillierten Überblick über Ihre Ermittlungen erstellen und täglich aktualisieren«, riet er. »Und da Ihre Kritzeleien von einem erfahrenen Verteidiger als Beweismittel genutzt werden können, wäre es am besten, wenn Sie Ihr Notizbuch nicht auch für die wöchentliche Einkaufsliste nutzen ...« Er betrachtete amüsiert, wie die jüngeren Beamten sich pflichtbewusst notierten, dass sie ein Notizbuch brauchten.
»Ich will, dass ein Team von Beamten heute Abend die Mädchen in der Hope Street, der Mount Street, am Falkner Square und an allen anderen, üblichen Orten befragt, ob sie auf den Strich ging. Irgendjemand muss sie kennen. War sie neu auf der Straße? War sie selbstständig? Falls nicht, wer war ihr Zuhälter? Er könnte unser Hauptverdächtiger sein.«
»Falls sie neu war«, sagte Foster, »könnte es sein, dass niemand sie kennt.«
»Deswegen überprüfen wir die Liste der Vermissten. Wir haben morgen vielleicht schon einen Namen, falls die DNS-Ergebnisse mit der Datenbank übereinstimmen, aber wir brauchen so viele Hintergrundinformationen über das Opfer, wie wir bekommen können. Wenn man den Mörder finden will, muss man das Opfer kennen.«
Einige der Älteren nickten bei dieser Polizeiweisheit zustimmend.
»Wer kümmert sich um die Vernehmung der Nachbarn?«
Der verantwortliche Commissioner stand auf. »Wir haben mit dem Haus selbst angefangen«, sagte er. »Die meisten der Mädchen haben gestern Abend gearbeitet und sind erst in den frühen Morgenstunden zurückgekommen.«
»Ich will exakte Uhrzeiten, wann sie gegangen und wann sie ins Haus zurückgekommen sind. Auf diese Weise können wir den Todeszeitpunkt etwas näher bestimmen. Was ist mit der Nachbarin?«, fragte er.
»Sie hat sie nachts weinen hören«, antwortete Foster. »Um halb zwei morgens. Sie hat natürlich nicht daran gedacht, es zu melden.«
»Was hat sie getan?«
»Die Stereoanlage laut gestellt, gewartet, bis es ruhig war, und ist dann wieder zur Arbeit.«
Ein paar Leute wechselten Blicke und schüttelten ungläubig die Köpfe.
»Ist ihr irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Besucher, fremde Autos auf der Straße?«
»Vor dem Haus stehen Tag und Nacht fremde Autos, Boss«, sagte Foster, »aber sie hat gesagt, dass es seltsam war, dass die Mülltonnen schon draußen standen, als sie heute früh um halb fünf nach Hause kam. Anscheinend muss sie das sonst erledigen.«
»Also hat der Mörder die Mülltonnen hinausgestellt. Fingerabdrücke?«
»Viele«, sagte Foster. »Aber nichts Verwertbares. Vor allem von den Mädchen. Ein paar von den Müllmännern, die übrigens die drei weisen Affen ziemlich gut imitiert haben.«
Rickman fragte: »Verbergen sie etwas?«
Foster zuckte mit den Schultern. »Nee, sie sind bloß verdammt nutzlos.«
»In Ordnung.« Rickman fand, dass er einen ziemlich guten Überblick über den Stand der Ermittlungen hatte. Es war Zeit, ein paar eigene Informationen weiterzugeben. »Die ersten Ergebnisse der Obduktion sind unklar.« Ein oder zwei Beamte schnappten überrascht nach Luft. Sie wussten alle, in welchem Zustand das Mädchen gefunden worden war, und Tunstall hatte das teilweise geronnene Blut, das aus der Mülltonne in den Müllwagen gerutscht war, so detailliert beschrieben, dass sich einem der Magen umdrehte.
Tunstall war dem Team zugeordnet worden. Er streckte wie ein Schuljunge die Hand hoch. »Ich will ja nichts Dummes sagen, Sir, aber man muss kein Arzt sein, um festzustellen, dass sie verblutet ist. Dieser Müllwagen sah aus, als käme er aus dem Film Carrie.«
Ein paar Leute kicherten, aber Rickman brachte sie mit gerunzelter Stirn zum Schweigen. »In diesem Team gibt es frisch ausgebildete Beamte, die gern auf sich aufmerksam machen wollen«, sagte er, »und erfahrene Beamte, die glauben, dass sie alles schon einmal gesehen haben.« Er schaute sich im Zimmer um und sah jeden Einzelnen an. »Ich möchte, dass das von Anfang an klar ist: Wir halten uns an die Regeln. Wir arbeiten mit Tatsachen, nicht mit Annahmen oder dem Bauchgefühl oder nach dem, wie etwas aussieht.«
»Sir«, sagte Tunstall und sank auf seinem Stuhl zusammen.