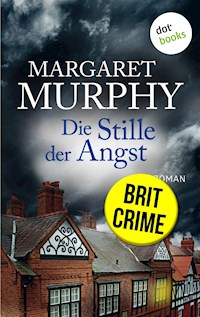5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Clara Pascal
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine Frau und ein Mörder – allein in einer Gefängniszelle: Der Thriller »Der Tod kennt kein Vergessen« von Margaret Murphy als eBook bei dotbooks. Chester, England. Nach einem traumatischen Erlebnis hat Clara Pascal sich geschworen, nie wieder eine Strafverteidigung zu übernehmen: Zu oft verwischt die Grenze zwischen Schuld und Unschuld vor Gericht, zu oft muss sich Clara fragen, ob sie als Anwältin wirklich zum Guten beiträgt. Doch die Ruhe der Kleinstadt wird erschüttert, als ein Mann, der schon einmal verurteilt wurde, nun unter Verdacht steht, erneut einen Mord begangen zu haben. Und Clara ist zur falschen Zeit am falschen Ort – als ein aufgehetzter Lynchmob versucht, in das Polizeirevier zu gelangen, und den mutmaßlichen Täter selbst zu richten, wird Clara versehentlich mit ihm in eine Zelle gesperrt. Während draußen die Menge tobt und alles im Aufruhr ist, muss sie Anwältin ihrem schlimmsten Albtraum ins Auge sehen: Sie ist allein mit einem Mörder! »Das Paradebeispiel eines Spannungsromans: gruselig und absolut packend!« Bestsellerautorin Val McDermid Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Psycho-Thriller »Der Tod kennt kein Vergessen« von Margaret Murphy ist der zweite Band ihrer »Clara Pascal«-Reihe, die mit einer toughen Frau und abgründigen Psycho-Duellen fesselt. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Ähnliche
Über dieses Buch:
Chester, England. Nach einem traumatischen Erlebnis hat Clara Pascal sich geschworen, nie wieder eine Strafverteidigung zu übernehmen: Zu oft verwischt die Grenze zwischen Schuld und Unschuld vor Gericht, zu oft muss sich Clara fragen, ob sie als Anwältin wirklich zum Guten beiträgt. Doch die Ruhe der Kleinstadt wird erschüttert, als ein Mann, der schon einmal verurteilt wurde, nun unter Verdacht steht, erneut einen Mord begangen zu haben. Und Clara ist zur falschen Zeit am falschen Ort – als ein aufgehetzter Lynchmob versucht, in das Polizeirevier zu gelangen, und den mutmaßlichen Täter selbst zu richten, wird Clara versehentlich mit ihm in eine Zelle gesperrt. Während draußen die Menge tobt und alles im Aufruhr ist, muss sie Anwältin ihrem schlimmsten Albtraum ins Auge sehen: Sie ist allein mit einem Mörder!
Über die Autorin:
Margaret Murphy ist diplomierte Umweltbiologin und hat mehrere Jahre als Biologielehrerin in Lancashire und Liverpool gearbeitet. Ihr erster Roman »Der sanfte Schlaf des Todes« wurde von der Kritik begeistert aufgenommen und mit dem First Blood Award als bester Debüt-Krimi ausgezeichnet. Seitdem hat sie zahlreiche weitere psychologische Spannungsromane und Thriller veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Heute lebt sie auf der Halbinsel Wirral im Nordwesten Englands.
Die Website der Autorin: www.margaret-murphy.co.uk/
Margaret Murphy veröffentlichte in ihrer Reihe um die Anwältin Clara Pascal auch:
»Warte, bis es dunkel wird – Band 1«
Sowie ihre Reihe um die Liverpool Police Station:
»Wer für das Böse lebt – Band 1«
»Wer kein Erbarmen kennt – Band 2«
»Wer Rache sucht – Band 3«
Und ihre Spannungsromane:
»Das stumme Kind«
»Der sanfte Schlaf des Todes«
»Im Schatten der Schuld«
»Die Stille der Angst«
***
eBook-Neuausgabe März 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2003 unter dem Originaltitel »Weaving Shadows« bei Hodder & Stoughton Ltd, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2003 by Margaret Murphy
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/gyn9037, Aleksandr Stezhkin
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-983-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Tod kennt kein Vergessen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Margaret Murphy
Der Tod kennt kein Vergessen
Roman
Aus dem Englischen von Christine Heinzius
dotbooks.
Für James und Brenda White
Prolog
Ende August und heiß wie die Hölle. Clemence öffnete das Autofenster und sah sich nach neugierigen Nachbarn um, da er mit offenem Fenster auffiel. Der Geruch von verblühtem Liguster und frisch gemähtem Rasen traf sein Gesicht wie eine feste Masse. Erschrocken bemerkte er, dass die Sonne gewandert war und genau auf eine Ecke seiner Kamera schien, die neben ihm auf dem Beifahrersitz lag. Er hob sie hoch. Sie war warm. Scheiße! Einen Augenblick lang hielt er sie in die kühlere Luft am Fenster, zog sie aber zurück, als ein vorbeigehendes Kind ihn neugierig ansah.
Er beobachtete es, bis es in der Ferne zu einem kaulquappenförmigen Schatten wurde. Das Ergebnis von Hitzeflimmern und von zwölf Jahren, in denen er nichts gesehen hatte, das weiter als neunhundert Meter entfernt lag. Eine leichte Schwäche der visuellen Wahrnehmung, hatte der Arzt erklärt, die sich mit der Zeit legen würde. Das Mädchen ging um die Ecke, und er lehnte sich zurück. Das 28-200-mm-Objektiv, das er wegen seiner Vielseitigkeit ausgewählt hatte, lag als beruhigendes Gewicht auf seinem Schoß.
Er wischte sich den Schweiß mit dem Arm von der Stirn, und ein juckendes Rinnsal floss langsam über seine Brust zum Bund seiner Khakihose. Wenn sie nicht bald käme, müsste er das Auto an eine schattige Stelle fahren.
Er blinzelte nach oben in das glitzernde Mosaik des Blattwerks der Platane über ihm; die Blätter waren hart und spröde, noch ohne herbstliche Färbung, doch weit vom zarten Grün des Frühlings entfernt. Er müsste noch ein Jahr warten, bis er das wieder sehen konnte.
Ein paar Straßen weiter spielte in einem Eiscremewagen der Song »Greensleeves« und näherte sich seiner Lieblingsstelle. Einen Augenblick lang wurde der Gestank des Ligusters von einer Kindheitserinnerung verdrängt: Als Siebenjähriger nach dem Tee auf die Straße laufen, mit feuchten Münzen in der Hand, der brennend heiße Bürgersteig schien fast weiß. Er erreichte den sich schüttelnden, senfgelben Wagen und atmete die berauschende Mischung von Himbeersirup und Dieselabgas ein.
Die Jahre drinnen schienen im Vergleich grau. Ihre Eintönigkeit hatte ihnen die Farbe geraubt, die durch Angst und Wut abgetötet worden war. Diese Jahre, in denen die vorherrschenden Gerüche von gekochtem Kohl und alter Scheiße fast austauschbar schienen, hatten ihn gierig gemacht nach sinnlichen Erfahrungen einer gesünderen Art. Er schloss die Augen und atmete tief ein, um sich von den Gefängnisgerüchen zu reinigen, er genoss das Kratzen des Ligustergeruchs an seinem Gaumen und tief im Hals.
Ein Auto hielt fast gegenüber an, und Clemence rutschte tiefer in seinen Sitz. Er hielt die Hand beschützend über das Zoomobjektiv auf seinem Schoß, dann hob er die Kamera vorsichtig auf Taillenhöhe und wandte seinen Kopf langsam um; sein Herz pochte schmerzhaft. Sie war es.
Er fühlte eine seltsame Mischung aus Aufregung und Angst: Diese Frau stellte ein Ziel dar, vielleicht sogar eine Herausforderung. Es hatte einige Zeit gedauert, diesen Augenblick vorzubereiten. Er hatte sie ausgesucht, und nun war er entschlossen, das zu bekommen, weswegen er hergekommen war.
Sie stieg aus dem Auto und ging auf das Haus mit der verblassten roten Tür, dem kaputten Zaun und der ausgewachsenen Ligusterhecke zu. Er hatte sie sich an einem großartigeren Ort vorgestellt, pittoresker, mit ordentlich geschnittenen Büschen und Blumenrabatten, die präzise nach dem Farbkreis bepflanzt waren: Kein hartes Aufeinandertreffen von Orange und Lila, sondern geschmackvoll ineinander übergehende Farben und eine sorgfältige Kombination von Strukturen und Formen.
Sie war an der Haustür, und während sie sich ins Sonnenlicht drehte, um in ihrer Handtasche nach den Schlüsseln zu suchen, schoss er ein paar Bilder. Er mochte es, Frauen zu beobachten, ohne dass sie sich dessen bewusst waren, denn in solchen Momenten zeigten sie oft eine unbewusste Eleganz.
Sie ging durch die Tür, und er wartete. Unnötig, sie zu erschrecken. Lass ihr ein paar Minuten, um die Schuhe auszuziehen, ihre Jacke aufzuhängen und vielleicht auch, um Wasser aufzustellen. Möglicherweise würde sie ihm sogar eine Tasse Tee anbieten. Der diffuse Schrecken war einem stärker werdenden Gefühl der konkreten Angst gewichen. In den Gruppentherapiesitzungen während der letzten drei Jahre drinnen hatte er gelernt, die oft verwirrenden Gefühle zu erkennen. Sie hatten auch Aggressionsbewältigung geübt: Die Anzeichen identifizieren und die Wut deaktivieren oder, falls sie unkontrollierbar wurde, weggehen, was drinnen nicht immer möglich war. Aber draußen zu sein machte die Sache in dieser Hinsicht einfacher, weil es so groß war, es gab so viele Orte, wo man hingehen konnte. Und die Wut zu kontrollieren brachte unerwartete Vorteile: Einen gewissen Abstand zwischen dem Auslöser der Wut und der Vergeltung herzustellen, machte es schwieriger, entdeckt zu werden.
Er sah auf die Uhr. Er hatte ihr genug Zeit gegeben. Er schloss das Fenster und griff nach dem Türöffner. Ein Augenblick des Zweifels erwischte ihn wie ein krampfender Schmerz. Was, wenn sie nicht mit ihm sprechen wollte? Er zwang sich, ein paarmal durchzuatmen. Er würde reden, und sie würde zuhören. Er würde sie überzeugen.
Er stieg aus dem Auto und überquerte die Straße.
Kapitel 1
Michaela O’Connor hatte diesen Gesichtsausdruck, der bedeutete, dass sie diesen Fall bis zu seinem natürlichen Ende verfolgen würde, was üblicherweise hieß, so lange, bis sie ihren Willen bekam.
»Mitch, du weißt, dass ich dir dankbar bin.« Clara Pascal sammelte ihre Unterlagen ein und versuchte, ihrer Freundin nicht in die Augen zu sehen. »Ich meine, für die Arbeit, und … na ja, für alles.«
Dieses Gespräch hatten sie schon oft geführt, und Michaela ‒ für ihre Freunde Mitch ‒ zeigte keinerlei Anzeichen dafür, dieses Streits überdrüssig zu werden. »Dann tu es«, sagte sie, unnachgiebig und unerbittlich, »für mich.«
Clara sah sie warnend an.
»Ich bin Anwältin«, entgegnete Mitch und fuhr fort, als ob Clara laut widersprochen hätte: »Skrupellose Manipulation ist Teil des Berufsbildes.«
Es war eine so unpassende Beschreibung ihrer Freundin und Kollegin, dass Clara unter anderen Umständen gelacht hätte. So jedoch packte sie ihre Papiere für den Prozess morgen zusammen und stellte ihre Aktentasche auf den abgewetzten Eichenholzschreibtisch. Sie blickte in Mitchs offenes, furchtloses Gesicht, und es tat ihr weh, dort Liebe und Enttäuschung zu sehen, beides auf sie gerichtet.
»Es ist eine Frau, Clara«, sagte Mitch. »Nicht irgendein hundert Kilo schwerer, testosteronverseuchter Schlägertyp. Sie ist nur eine Frau, die es nicht mehr ertragen konnte. Sie streitet nicht ab, dass sie es getan hat. Sie will niemandem etwas vormachen oder mit etwas durchkommen. Aber sie will Gerechtigkeit.« Sie schwieg, so dass Clara, trotz ihrer Entschlossenheit, schnell hinauszukommen und nicht zuzustimmen, das Gefühl hatte, dass sie antworten musste.
»Es spricht viel für sie, Mitch, jeder könnte …«
»Ich möchte nicht irgendjemanden«, beharrte Mitch. »Sie braucht jemanden mit Erfahrung und Überzeugungskraft.«
»Sie könnte es schlechter treffen, als dich zur Anwältin zu haben«, sagte Clara mit einem erzwungenen Lächeln.
»Ich kümmere mich schon um die unberechtigte Entlassung.« Understatement war eine der eher entwaffnenden Eigenschaften Mitchs. Obwohl sie so tat, als ob es Routine sei, sah es nach einem Präzedenzfall aus.
Clara wurde übel. »Himmel, Mitch, bitte mich doch nicht darum, das zu tun.«
»Ich bitte dich aber, Clara.«
Mitch war eine der Ersten gewesen, die Clara angerufen hatte, nachdem sie befreit worden war. Sie war nicht verlegen gewesen, wie so viele andere, die gut gemeinte Nachrichten hinterlassen hatten und Hugo baten, die Kranke um Gottes willen nicht zu stören. Mitch hatte darum gebeten, mit Clara sprechen zu können, und hatte sofort gefragt, ob sie sich gut genug für einen Besuch fühlte.
»Ist es wichtig?« Clara war von Anfang an anderen Menschen aus dem Weg gegangen. »Können wir das nicht am Telefon besprechen?«
»Natürlich ist es wichtig.« Mitchs Dubliner Akzent war immer dann am stärksten, wenn sie ihren Freunden simple Wahrheiten sagte. »Und, nein, wir können es nicht am Telefon besprechen. Ich möchte dich ansehen können, wenn du mir erzählst, dass es dir gut geht, damit ich dir in die Augen blicken kann, wenn ich dich eine Lügnerin nenne.«
Seit diesem Tag hatte Mitch ihr tausend Gefallen getan, und im Gegenzug bat sie nur um einen. Hätte Mitchs Kanzlei in den letzten Monaten ihr nicht immer wieder Fälle zugeteilt, hätte Clara keinen Grund gehabt, morgens aufzustehen. Von der Jericho-Kanzlei hatte sie immer weniger Fälle übernommen, weil sie recht wählerisch geworden war. In wenigen Wochen würden es vermutlich nur noch einzelne Aufträge sein. Aber der bloße Gedanke daran, einen Strafrechtsfall zu übernehmen, ließ sie in kalten Schweiß ausbrechen.
Sie sah in Mitchs freundliches ovales Gesicht und sagte leise: »Es tut mir Leid. Ich mache Zivilrecht, ich mache Familienrecht, ich mache die verdammte Aktenablage, falls es hilft! Aber bitte mich nicht, einen Strafrechtsfall zu übernehmen.«
Draußen folgte sie wieder dem Ritual, wegen dem sie sich schämte: Sie sah in beide Richtungen, bevor sie auf den schmalen Bürgersteig trat, die Straße überquerte und über den eingezäunten Weg auf den Kaleyards-Parkplatz zuging, ihre Autoschlüssel hielt sie in der Hand, für eine schnelle Flucht oder als Waffe. Kaleyards wurde auf der einen Seite von Geschäften und auf der anderen vom blanken Sandstein der Stadtmauer Chesters eingerahmt, aber er war dem grauen Betongefängnis des Parkhauses in der Pepper Street auf jeden Fall vorzuziehen. Sie sah über die Schulter, während sie die Autotüren von weitem entriegelte. Ihr Herz pochte heftig, und sie war kurzatmig, als ob sie gerannt wäre. Der schlimmste Moment war, die Tür zu öffnen und sich hinter das Lenkrad zu setzen.
Als Kind hatte sie Angst vor etwas gehabt, das sich auf dem Treppenabsatz versteckte. Wenn sie allein nach unten gehen musste, hatte sie immer die Stufen gezählt. Auf der siebten wusste sie, dass er bis ans Geländer gekrochen war und auf sie heruntersah. Auf der zehnten war er oben auf der Treppe, bereit, sich auf sie zu stürzen, der namenlose, gestaltlose Schrecken, der in den dunklen Ecken ihrer Kindheit lauerte. Der Trick war, schnell nach unten zu gelangen und ins Wohnzimmer zu laufen, ohne sich umzusehen. Manchmal hatte sie geglaubt, den schweren Schritt auf der Treppe hinter sich zu hören, und einmal hatte sie einen warmen Luftzug gespürt, als er nach ihr gegriffen, sie aber verfehlt hatte. Er hatte sie nie erwischt. Damals nicht.
Sie war dem schwarzen Mann erst als Erwachsene begegnet. Sie wusste jetzt, dass der schwarze Mann einen Namen und eine menschliche Gestalt hatte. Sie hatte dem schwarzen Mann ins Gesicht gesehen.
Pippa lief abends nicht mehr an die Tür, um sie zu begrüßen. Aber Trish kam wie immer in den Flur und hieß sie lächelnd willkommen.
»Einen guten Tag gehabt?«, fragte sie und wischte ihre Hände an einem Geschirrtuch ab. Sie hatte ihre Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, und ihr rundes, freundliches Gesicht war gerötet. Trish war bei ihnen, seit Pippa ein Baby gewesen war, zuerst als Kindermädchen, später dann als Babysitterin und Teilzeithaushälterin. Sie war genauso alt wie Clara und hatte einen ähnlichen Geschmack. Sie betrachteten sie alle als Familienmitglied. In den letzten Monaten war Trish für Pippa der einzige zuverlässige, ruhige Pol in einer unsicheren Welt.
Sie hielt Abstand, aber Clara kannte Trish gut genug, um sicher zu sein, dass, wenn sie auch nur einen Augenblick Schwäche oder einen Hauch Empfänglichkeit zeigte, Trish sie fest umarmen würde, in dem Versuch, allen Schmerz aus ihr herauszudrücken.
Clara hängte ihr Jackett an die Garderobe und zog ihre Schuhe aus. »Was gibt’s zum Abendessen?«, fragte sie, einen Tick zu laut, einen Tick zu fröhlich. Schrill, Clara. Du klingst schrill.
Trish drehte sich halb um, sie war sich nicht sicher, ob sie die Neuigkeiten erzählen sollte. »Ich glaube, Hugo …«
Er kam aus der Küche. In letzter Zeit ging er immer leicht gebeugt, trotzdem überragte er Trish. »Ich dachte, dass wir essen gehen könnten«, sagte er. »Um Trish eine Kochpause zu gönnen.«
Nicht nur ich klinge schrill. Clara bekam eine kurze Panikattacke. So viel Liebe und wozu? Sie schob den Gedanken beiseite. Richtig weit weg.
»Gute Idee«, sagte sie und schloss die Garderobentür. Sie wollte seinen erfreuten Gesichtsausdruck nicht sehen, weil sie ihn einen Augenblick später enttäuschen würde. »Ihr drei geht. Ich muss arbeiten.«
»Es ist nur eine Stunde oder zwei …« Sie konnte den Vorwurf und den Schmerz in seinem Gesicht nicht sehen, aber sie waren deutlich genug in seiner Stimme zu hören.
»Ich kann keine zwei Stunden entbehren«, sagte sie. »Dieser Fall …«
»Welcher Fall?« Jetzt war er wütend. »Es ist ja nicht gerade so, dass du mit Arbeit überhäuft wirst …«
Sie sah ihn scharf an, und Trish ging verlegen an Hugo vorbei in die Küche.
»Der Fall, an dem ich arbeite«, sagte sie ruhig.
Er schluckte eine Antwort hinunter und trat einen Schritt auf sie zu, Bedauern und Sorge verdrängten seine Ungeduld.
»Ich bin in meinem Büro.« Sie ging auf die Treppe zu.
»Pippa hat dich am Wochenende kaum gesehen«, protestierte Hugo.
»Ich werde ihr auf jeden Fall Gute Nacht sagen, wenn ihr nach Hause kommt.«
»Mach dir bloß keine Mühe.«
Pippa stand oben auf der Treppe. Sie sah aus wie eine Miniaturausgabe ihres Vaters: Nach den Sommerferien, die sie die meiste Zeit im Freien verbracht hatte, war ihre helle Haut einen Hauch dunkler als seine, aber ihre Haare waren genauso glänzend schwarz wie die ihres Vaters, und ihre Augen genauso auffallend blau. Ihr kleiner Körper bebte vor verletztem Stolz. »Ich möchte dich nicht stören.« Sie stakste vorbei, und Clara stellte mit einem distanzierten Interesse fest, dass sie nichts empfand: Sie bereute nichts, es tat nicht weh, sie ärgerte sich nicht einmal über die Wut ihrer Tochter.
Hugo packte sie, als sie den Flur entlanglief.
»Entschuldige dich bei deiner Mutter, kleine Lady«, sagte er.
»Nein.« Die Antwort war unerbittlich. Sie starrte ihren Vater herausfordernd an, die kleine Falte zwischen ihren Augen eine Kopie seiner eigenen.
»Entschuldige dich, Pippa.«
»Hugo, es ist egal«, sagte Clara.
»Siehst du?«, sagte Pippa. »Ihr ist es egal.«
Aber Hugo wollte das nicht auf sich beruhen lassen. Nach einer oder zwei Sekunden gab Pippa nach. »In Ordnung. Es tut mir Leid.« Sie schüttelte ihren Vater ab, stürmte davon und rief: »Es tut mir Leid, dass ich so eine verdammte Plage bin!«
Hugo rief hinter ihr her, aber sie knallte die Küchentür so fest zu, dass sie im Rahmen vibrierte.
»Sie ist durcheinander, Clara«, sagte er. »Sie versteht nicht, warum …«
»Ich lege besser mal los«, unterbrach Clara ihn.
»Dann bleiben wir zu Hause.«
»Um Himmels willen, Hugo! Geht einfach!«
Sie wusste, dass sie ihn abwies, und ein Teil von ihr wollte das. Sie war auf jeden wütend und vertraute niemandem. Aber warum war sie auf Hugo wütend? Sie erlaubte sich nicht, darüber nachzudenken, sie gestand es sich nicht einmal ein, aber ihre Wut auf Hugo war real und heftig. Sie schlug verbal nach ihm. Und manchmal wollte sie physisch nach ihm schlagen. Sie hatte es noch nicht getan, aber die Vehemenz ihrer Gefühle machte ihr Angst. Sie schloss die Augen, verdrängte ihr Bedürfnis, sich zu entschuldigen, und versteckte ihr Schuldgefühl hinter Wut.
Er sprach leise. »Ich lasse dich nicht gern allein hier.«
Sie lachte. Es klang bitter und hart, sogar in ihren eigenen Ohren, und sie erkannte sich selbst kaum wieder. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen«, sagte sie. »Trish schließt das Paracetamol weg.«
Hugo sah eher verwirrt als wütend aus. »Das habe ich nicht gemeint.«
Das wusste sie. Was er gemeint hatte, war, dass er sie nicht gern in ihrem großen, alten Haus mit den quietschenden Dielen und den knarzenden Balken allein ließ, mit dem Seufzen und Knacken, das sie jede Nacht wach hielt. Ein Teil von ihr wollte zu ihm gehen und die Sorgenfalten auf seiner Stirn glätten, aber die harte, selbstzerstörerische Stimme, die in den letzten Monaten solche Macht über sie gewonnen hatte, sprach voller kalter Verachtung: »Ich glaube, ich komme ein oder zwei Stunden allein klar.«
Eine halbe Stunde, nachdem sie gegangen waren, befand Clara sich wieder auf der Straße und fuhr in Richtung Upton-by-Chester. Marcia Liddle wohnte in einer großen Doppelhaushälfte aus den zwanziger Jahren, direkt am Golfplatz. Sie hielt ihre Therapiesitzungen in einem hohen Zimmer mit Stuck, honigfarbenem Holzfußboden und Blick auf den Golfplatz ab. Im Winter brannte ein Feuer im Kamin und unterstützte die Zentralheizung, aber heute strahlte dort eine riesige Vase mit Spätsommerblumen. Die Vorhänge waren zurückgezogen, und der Geruch nachtduftender Levkojen wehte herein und ab und an Vogelgezwitscher, Zaunkönige und Rotkehlchen und der charakteristische zweigeteilte Ruf der Kohlmeisen.
»Ich bin froh, dass Sie wiedergekommen sind«, sagte Marcia lächelnd und führte sie zu einem Stuhl. »Ich war mir nicht sicher, ob Sie das tun würden.« Es war erst ihre dritte Sitzung, und die zweite war mit einem erbitterten Streit zu Ende gegangen.
Clara biss sich auf die Unterlippe. »Wegen letzter Woche …«
Marcia sagte nichts, und Clara erkannte einen ihrer Tricks: Während Marcias Sitzungen gab es kein höfliches Übergehen von unhöflichem Verhalten oder von Gefühlsausbrüchen, auch keine Vorwürfe, aber Erklärungen wurden gefordert. Und sie war zu monumentalem Schweigen fähig, um die Antworten zu bekommen, die sie wollte. Clara versuchte, an etwas anderes zu denken, sie betrachtete die Regale voller Bücher über Therapie und Psychologie, den Kassettenrekorder, den Marcia manchmal während ihrer Sitzungen einschaltete, die Porzellanmasken, die sie sammelte.
Marcia wartete, und Clara, unfähig, die Stille weiter zu ertragen, sagte: »Ich war wütend.«
»Warum?«
»Das sollten Sie mir sagen.«
»Wir arbeiten gemeinsam daran, Clara.«
»Ich habe die Nase voll von Rätseln, Marcia«, sagte sie. »Ich verstehe die Regeln nicht.«
Marcia sah sie leicht überrascht an. »Es gibt keine Regeln. Nicht so, wie Sie das meinen. Wenn es eine Regel gibt, dann die, dass wir beide daran arbeiten, dass es Ihnen wieder gut geht.«
»Ich bin nicht krank.«
»Es geht Ihnen aber auch nicht gut.«
Marcia war Mitte fünfzig. Ihre feinen, grauen Haare waren kurz geschnitten, und das einzige Make-up, dass Clara je bei ihr gesehen hatte, war ihr Lippenstift, der ein bisschen zu grell für ihre helle Haut war. Sie sah Clara mit ihren freundlichen, kurzsichtigen Augen an, und Clara hätte sie schlagen wollen, um an ihrer unerschütterlichen Ruhe zu rütteln. Sie schloss die Augen, die Brutalität ihrer Gedanken erschreckte sie. Es war ein Fehler. Sie hätte nicht mehr zu ihrer Therapie gehen sollen. Ihre Nase juckte, und ihre Augen fühlten sich heiß und nass an. Ich werde es nicht tun. Ich werde nicht weinen!
Sie schluckte, atmete tief ein und öffnete die Augen. »Manchmal bin ich so voller Zorn …« Sie starrte auf eine Pierrotmaske aus Porzellan auf dem Bücherregal hinter Marcia und zwang sich, nicht zusammenzubrechen.
»Es ist eine Art der Selbstverteidigung, Clara«, erklärte Marcia. »Die Wut. Auf diese Weise haben Sie das Gefühl, Kontrolle auszuüben.«
Das erkannte Clara wieder. Ihr Entführer hatte ihr die Freiheit genommen, aber noch schlimmer, er hatte ihr das Recht auf die grundlegende, menschliche Würde verwehrt. Er hatte sie terrorisiert, sie verrohen lassen und sie gedemütigt, und während dieser langen, kalten, furchtbaren Gefangenschaft war aus ihrer Angst Wut geworden. Nur ihre Wut und ihr absoluter Zorn hatten sie vor der Verzweiflung bewahrt. Jetzt hatte die Wut einen anderen Effekt: Sie bewahrte sie davor, sich hilflos zu fühlen.
»Ich möchte nicht, dass Hugo mich wie eine Kranke behandelt«, sagte sie.
»Selbst wenn Sie sich wie eine verhalten?«
»Was?«
»Sie haben Angst, auszugehen. Angst vor der Dunkelheit, vorm Alleinsein, vor geschlossenen Räumen, vor Menschenmengen, davor, Ihren eigenen, selbst gewählten Beruf wieder zu ergreifen …«
»Einen Moment mal«, unterbrach Clara.
Marcia hob eine Hand, damit sie nicht weitersprach. »Sie senden verwirrende Signale aus. Sie sagen: ›kümmert euch um mich‹, und sobald sich jemand Ihnen nähert, verjagen Sie denjenigen mit Händen und Füßen. Glauben Sie, dass Sie verdient haben, was Ihnen passiert ist, Clara, lehnen Sie deswegen Mitgefühl ab?«
»Ich muss mir das nicht anhören«, sagte Clara, stand auf und ging schnell zur Tür.
»Nein, das müssen Sie nicht. Warum sind Sie dann gekommen?«
Clara legte ihre Hand auf die Türklinke, bereit, zu flüchten. »Ich dachte, Sie würden mir helfen.«
»Aber Sie brauchen doch keine Hilfe. Sie sind nicht krank.«
Clara lehnte ihren Kopf an die glänzende Tür. Sie fühlte sich kühl und angenehm an.
»Auf wen sind Sie am meisten wütend? Auf sich selbst oder auf Hugo?«
Die Frage war so seltsam, dass Clara sich zu ihrer Therapeutin umdrehte. »Was, zum Teufel, sollte ich Hugo vorwerfen?«
Marcia zog ihre Augenbrauen hoch. »Vorwerfen?«, wiederholte sie. »Ich habe das Wort ›vorwerfen‹ nicht benutzt, ich habe gesagt, dass Sie wütend sind.«
»Sie drehen mir die Worte im Mund herum«, sagte Clara. »Ich bin nicht wütend auf ihn, und ich werfe ihm nichts vor.«
»Warum nicht? Schließlich hat er Sie nicht gerettet.« Marcias Stimme war ruhig, aber eindringlich.
Clara lachte überrascht. »Das ist absurd.«
»Ist es das? Was ist mit dem irrationalen Teil von Ihnen, dem Teil, der beim Gedanken daran hyperventiliert, den Keller eines Gebäudes zu betreten? Ist es nicht dieser Teil von Ihnen, der rasend vor Wut ist, weil Hugo nichts getan hat, um Ihre Entführung zu verhindern?«
»Wie hätte er das tun sollen? Das ergibt keinen Sinn …«
»Das ist genau der Punkt bei diesen furchtbaren Ereignissen, Clara. Nichts ergibt mehr einen Sinn. Unser Blickwinkel verändert sich. Wir sehen uns nicht mehr als wertvoll an oder die Welt als sicher.«
»Das war sie nie«, sagte Clara.
»Sie haben Recht«, stimmte Marcia zu. »Es ist alles nur Show. Aber was bleibt uns ohne unsere Illusionen? Eine gleichgültige Welt? Eine feindliche Welt? Schlimmer noch, eine gefährliche Welt?«
Clara schloss kurz die Augen. »Das hilft mir nicht«, sagte sie. »Es immer und immer wieder durchsprechen. Das habe ich während der letzten neun Monate gemacht, und alles, was dabei herauskommt, ist, dass ich noch wütender und noch ängstlicher werde.«
Marcia nickte zustimmend. »Die Panikattacken werden schlimmer, und Sie entwickeln mehr Phobien, weil Sie Ihre Illusionen durch irrationale Ängste ersetzt haben.«
»Wie können Sie meine Ängste irrational nennen, nach allem, was ich durchgemacht habe?«
»Wenn ein Hauch Zigarettenrauch eine Panikattacke auslöst, dann glaube ich, dass es vertretbar ist, das eine irrationale Reaktion zu nennen. Sie waren in einer schrecklichen Situation, in der Sie schreckliche Angst hatten, und Sie rochen Zigarettenrauch. Also bedeutet Zigarettenrauch für Sie jetzt Gefahr. Klassische Konditionierung.«
»Dadurch wird es nicht weniger real.«
»Ich weiß. Und, wie Sie gesagt haben, es hilft nicht, es immer wieder durchzukauen. Die Frage ist, was werden Sie jetzt dagegen tun?«
Clara hörte auf ihren eigenen Atem. »Ich weiß es nicht, Marcia. Ich wünschte, ich wüsste es.«
Marcia sah sie einige Augenblicke lang intensiv an, dann nickte sie kurz, als wäre sie sicher, dass Clara bereit war, zu hören, was sie zu sagen hatte. »Illusionen und irrationale Ängste basieren beide auf falschen Voraussetzungen, Clara. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich jedes Mal für die Illusionen entscheiden. Sie machen das Leben erträglich. Sie helfen uns, morgens aus dem Bett zu kommen. Leider kann man eine Illusion nicht wieder einsetzen. Wenn sie einmal zerstört wurde, kann sie nicht wiederhergestellt werden. Aber man kann mit dem Verstand rangehen. Man kann Logik anwenden, die Statistik, die Gesetze der Wahrscheinlichkeit, wenn man möchte.«
»Aber es hilft nicht«, rief Clara voller Verzweiflung. »Glauben Sie nicht, dass ich mir das alles nicht auch schon gesagt habe: ›Es ist nur Zigarettenrauch‹ ›Bloß ein Gerichtssaal‹?«
»Das sind erlernte Verhaltensweisen«, sagte Marcia. »Man kann erlernte Verhaltensweisen wieder verlernen.«
»Das habe ich mit meinem letzten Therapeuten versucht, es hat nicht funktioniert.«
»Sie haben Desensibilisierung versucht?«
»Ja.«
»Wie lang haben Sie es versucht?«
Clara sah aus dem Fenster.
»Wie viele Therapiesitzungen?«
Ein paar hundert Meter entfernt gingen zwei Männer still über den Golfplatz.
»Clara?«
»Drei.« Als sie sich umsah, blickte Marcia sie amüsiert an. Sie brauchte nichts zu sagen, sie hatte klargemacht, was sie meinte. Clara lächelte zögernd, sie kam sich etwas dumm vor.
»Was muss ich tun?«, fragte sie.
»Wir fangen mit Entspannungstechniken an. Wir werden während der Therapiesitzungen hier zunächst Ihre Phobien angehen und die Angstreaktion durch Gedanken an die Auslöser verringern. Wenn Sie das unter Kontrolle haben, dann werden wir langsam die Auslöser selbst ins Spiel bringen. Wir werden daran arbeiten, dass Sie Ihre Wut kontrollieren können. Ich werde Ihnen Hausaufgaben geben. Techniken, die Sie üben sollen, Entspannung, Visualisierung, Rationalisierung.
Wir werden sehr langsam vorgehen, Sie bestimmen das Tempo.«
Clara nickte langsam. Das klang machbar. »Okay.«
»Erklären Sie Ihrem Mann und Ihren Freunden, was wir hier versuchen, Sie werden deren Hilfe brauchen.«
»Nein.«
»Wie bitte?«
»Hugo weiß es nicht. Niemand weiß es.« Sie war erleichtert gewesen, als Hugo ihr von ihren Plänen, auswärts zu essen erzählt hatte, zumindest musste sie ihn dann nicht darüber belügen, wo sie hinfuhr. Marcia wartete, und Clara seufzte ungeduldig. »Da steckt nichts Schlimmes dahinter. Es funktioniert vielleicht nicht. Ich wollte bloß nicht, dass er sich Hoffnungen macht.«
»Und Sie wollten nicht, dass Leute unangenehme Fragen stellen. Schließlich ist es einfacher, alles abzubrechen, wenn niemand außer mir und Ihnen davon weiß …«
Das stimmte. Clara hatte die Sitzungen auf unterschiedliche Termine gelegt, während der Arbeitszeit und abends, so dass weder Hugo noch Mitch Verdacht schöpften. Sie hatte Hugo sogar angelogen und ihm von einer Arbeit außerhalb der Stadt erzählt, um ihm nicht etwas sagen zu müssen, das ihm Hoffnung machen könnte, weil sie eigentlich nicht daran glaubte, dass sie es bis zum Ende durchhalten würde.
Marcia lehnte sich in ihrem Stuhl vor, lebhaft und eifrig, ihre professionelle Distanz war einen Augenblick lang aufgehoben. »Sie sind von Leuten umgeben, die Sie lieben. Lassen Sie sich von ihnen helfen. Versuchen Sie es. Was ist das Schlimmste, das passieren kann?«
»Dass ich versage.« Clara schluckte. Der Gedanke war fast unerträglich. »Dass ich sie verliere.«
»Und wenn Sie es nicht versuchen? Was passiert dann? Glauben Sie, dass Sie sie dann behalten?«
Kapitel 2
Du hast versucht, sie zu überreden, aber sie wollte nicht hören. Es war nicht deine Schuld. Sie wollte es nicht einsehen.
Dir ist übel, du wirst das hier nicht genießen, aber du kannst auch nicht abstreiten, dass es eine Art von Triumph ist. Weil sie bettelt. Sie wird alles tun. Jetzt wird sie alles tun. Jetzt, wo es zu spät ist. Jetzt, wo die Dinge zu weit gegangen sind.
Beim ersten Schlag hast du so große Angst, er könnte nicht fest genug sein, dass du überreagierst. Das Knirschen der Knochen und des Knorpels erinnert dich an das Geräusch, wenn man Schnecken zertritt. Ihre Augenhöhle zerbirst. Blut spritzt überall hin. O Gott … Blut und noch etwas Graues mit der Konsistenz von Pudding landet klatschend an der Wand. Übelkeit macht dich schwach. Zu viel Kraft. Dein Herz schlägt so stark, dass du das Gefühl hast, dein Brustkorb explodiert.
Sie windet sich und röchelt, aber sogar jetzt weißt du schon, dass sie es hinter sich hat. Warte nur lang genug, und sie hat es hinter sich. Sie kämpft nicht. Lass dir Zeit. Du kannst jetzt aufhören. Alles, was du tun musst, ist warten.
Aber du kannst nicht aufhören. Es erschreckt dich, wie sehr du sie hasst. Sie hat dein Leben ruiniert. Sie hat sich geweigert, zu tun, was jeder anständige Mensch getan hätte. Du willst sie auslöschen. Sie vernichten. Gesicht (zack!) Körper (zack!) Geist (zack!) … Du verlierst den Überblick. Du keuchst. Bist atemlos vor Schrecken und Wut. Genug.
Der Geruch im Zimmer lässt dich würgen. Eine Metzgerei. Metzgerei-Abfälle. In deinem Mund hast du einen Geschmack, als würdest du Pennys lutschen. Du hörst etwas: ein leises Ausatmen. Lieber Gott! Kann sie nicht still sein?
»Du bist tot, verdammt! Du bist tot! Warum stirbst du nicht?«
Du wartest. Ein paar furchtbare Sekunden lang zuckt ihr Körper, ihre Beine bewegen sich ruckartig, ihre Hände fuchteln. Ihr Kopf ist eine blutige Masse, aber ihr Körper akzeptiert den Tod nicht. Er wehrt sich gegen die Realität. Du möchtest schreien. Du möchtest loslaufen und dich verstecken, aber du musst bleiben, bis sie tot ist, bis du sicher sein kannst, dass sie dich nicht identifizieren kann. Du kannst nicht ins Gefängnis gehen. Das wirst du nicht.
Wie lange wartest du? Bis sie endlich still ist. Bis die zarte rosa Gischt aus dem breiigen Durcheinander, das ihre Lippen waren, versiegt, und als du die Hände von deinen Ohren nimmst, hörst du das hässliche nasse Gurgeln von Blut und Luft in ihrem Hals nicht mehr, bis dir kalt wird, während ihr Körper auskühlt, und deine Beine und dein Rücken und dein Kopf tun weh vor lauter Warten.
Sauber machen ist der schlimmste Teil. Schlimmer, als ihr etwas vorzumachen, um hereinzukommen? Schlimmer als der erste Schlag mit dem Hammer?
Ja. Weil die Wut dich zu Beginn davon abhielt, fortzulaufen. Aber jetzt, worauf solltest du noch wütend sein? Es sieht nicht einmal mehr nach ihr aus. Die Beine und Arme und der Torso sind da, aber sie ist es nicht. Sie ist nichts weiter als Dreck an deiner Schuhsohle. Du denkst wieder an Schneckenhäuser, die du zertrittst, und musst würgen.
Hör auf. Hör auf und denk nach. Du musst einen klaren Kopf behalten. Dieser Moment ist entscheidend. Hier werden die meisten Fehler gemacht. Vertuschen ist der nächste Schritt. Und du musst die Waffe und deine Kleider loswerden.
Du weißt, dass du Albträume bekommen wirst. Vorher hattest du dir gesagt, dass du dich darauf einstellen musst, ihr blutiges Gesicht in deinen Träumen zu sehen, Blut und Fleisch und Knochen. Aber jetzt weißt du sicher, dass die eine Sache, an die du dich erinnern und die du sehen wirst, ihr blauer Mokassinslipper sein wird, wie er auf der Seite neben ihrem nackten Fuß liegt.
Und sogar während du noch sauber machst, weißt du, dass der schlimmste, der schwerste Teil erst noch kommt. Du wirst mit dem Wissen um deine Tat Leuten gegenübertreten müssen. Und jedes Mal wirst du dir sagen, dass sie nicht erkennen können, was in deinem Herzen vor sich geht, wenn sie dich ansehen. Sie können deine Gedanken nicht lesen.
Lügner wissen das. Und Falschspieler und Betrüger und Ehebrecher … und Mörder. Wenn Leute dich anschauen, sehen sie die Oberfläche, und sie beurteilen dich nach dem, was sie sehen.
Kapitel 3
Um sechs Uhr morgens hatte sich der dünne Nebel, der in Schwaden direkt über dem Boden schwebte, fast ganz aufgelöst. Tautropfen lagen auf den ordentlich gemähten Rasenquadraten, die die Grenze zwischen Privatbesitz und öffentlichem Fußweg markierten. Doch die nach Süden gerichteten Häuser in der Leahurst Street wärmten sich schon in der Sonne.
Eine Taube gurrte traurig in der leeren Straße, und die Luft, in der immer noch der würzig-süße Geruch von Geißblatt hing, verwischte die Grenze zwischen Nacht und Tag.
Mark Tidswells Milchwagen fuhr knatternd die Straße entlang und hielt alle zwanzig Meter. Er war ein ordentlicher, drahtiger Mann, und er arbeitete schnell. Bei heißem Wetter gab es mehr Bestellungen für Orangensaft, und in diesem August hatte es eine Rekordhitze gegeben, was bedeutete, dass er die Lieferungen im Laufschritt erledigen musste, wenn er in der Zeit bleiben wollte.
Hausnummer neunundzwanzig war früh auf. Die Vordertür stand offen, und die Milchflaschen strahlten auf der Treppenstufe. Eine hübsche Tussi war das. Er ließ sich auf eine leicht erotische Fantasie ein, während er sich bückte, um die von der Sonne erwärmten leeren Flaschen aufzuheben und sie durch je einen halben Liter Milch und Orangensaft zu ersetzen. Er war sich nicht sicher, warum er sich noch einmal umdrehte. Irgendwas hatte er gesehen, aber nicht bewusst wahrgenommen. Was er seiner Frau erzählte, aber nicht den Jungs in der Molkerei, war, dass sich seine Nackenhaare aufstellten und er etwas Düsteres hinter sich spürte.
Als er noch einmal auf den weißen PVC-Türrahmen schaute, sah er Blut. Ein breiter Streifen Blut, als ob etwas Blutdurchtränktes daran vorbeigestreift wäre und eine zehn Zentimeter breite Spur hinterlassen hätte. Auf der Türklinke war ebenfalls Blut, als hätte jemand versucht, die Tür auf dem Weg nach draußen hinter sich zuzuziehen. Er schaute nach unten und sah, dass die Fußmatte schief dalag und eine Ecke am Türpfosten hochstand, weswegen die Tür nicht schloss.
Tidswell stellte die leeren Flaschen vorsichtig wieder auf die Türschwelle und zuckte beim leisen Klirren von Glas gegen Glas zusammen. Er fasste in seine Uniformjacke, holte sein Handy aus der Hemdtasche und wählte den Notruf. Sein Finger lag auf dem Rufknopf, während er die Tür aufdrückte und dabei aufpasste, die Blutspuren nicht zu berühren.
Sein Herz pochte heftig. Er fühlte sich gleichzeitig dumm und panisch. Was wusste er schon? Sie könnte sich beim Rosenschneiden verletzt haben, oder vielleicht war es gar kein Blut. Es könnte ihm passieren, dass er die Tür öffnete und sie Toast knabbernd im Nachthemd überraschte. Die Vorstellung hatte überhaupt nichts Erotisches mehr.
Er wollte gerade hineingehen, als ihm klar wurde, dass er nichts Schwereres als sein Handy hatte, um sich gegen einen Angreifer zu verteidigen, daher bückte er sich, um eine volle Milchflasche hochzuheben. Der Flur war leer und ruhig, fast so, als hielte das Haus den Atem an.
»Hallo?«, rief er, bereit, schnell nach draußen zu laufen, falls jemand antwortete. Er ging ein paar Schritte weiter und rief noch einmal. »Hallo?« Er konnte sich nicht an ihren Namen erinnern, Hausnummer neunundzwanzig, einen halben Liter pro Tag und mittwochs und samstags Orangensaft, das wusste er, aber nicht ihren Namen.
An der Tür des vorderen Zimmers war noch mehr Blut. Auf dem Stück Teppich, das er durch den Türspalt sah, befand sich eine große Fußspur, wie von einem Mann. Und es roch wie beim Metzger. Er atmete flacher und schneller. Drück auf Anrufen und warte auf die Polizei, Mark, sagte er sich selbst. Aber der Stolz trieb ihn weiter. Er würde sich wie der Idiot des Monats fühlen, wenn er sie riefe und Mrs. Neunundzwanzig käme die Treppe herunter und würde wissen wollen, was, zum Teufel, er in ihrem Flur tat und warum die Polizei in ihre Auffahrt fuhr.
Also öffnete er die Tür, rief noch einmal, froh, dass seine Kumpel das vorsichtige, tuntige »Hallooo?« nicht hörten.
Sie lag auf dem Rücken, ihre Füße ihm entgegengestreckt. Die Milchflasche rutschte ihm durch die Finger und prallte auf den Teppichboden. Durch den Druck hob sich die Aluminiumkappe etwas. Die Milch floss lautlos auf den Boden und wurde rosa, als sie sich mit einer Blutlache mischte. Ihr Gesicht war mit einem Kissen vom Sofa neben dem Fenster bedeckt, aber es gab keinen Zweifel daran, wie sie gestorben war. Überhaupt keinen Zweifel.
Er stöhnte, ging rückwärts zur Tür hinaus, unfähig, seinen Blick von ihr abzuwenden. Kaum dass er im Flur war, lief er los. Er stürzte auf seinen Milchwagen zu und brach auf dem Trittbrett zusammen. Mit dem Kopf zwischen den Knien wartete er darauf, dass die Übelkeit nachließ. Erst fünf Minuten später, als Hausnummer siebenundvierzig auf dem Weg zur Arbeit an ihm vorbeikam, erinnerte er sich an das Telefon in seiner Hand und drückte die entscheidende Taste für die Polizei.
Detective Sergeant Barton kam im selben Moment an, in dem vor dem Haus zwei uniformierte Beamte in einem Streifenwagen anhielten. Leahurst Street war nur drei Straßen von seinem Haus entfernt, Fran hatte den Anruf entgegengenommen, als er sich nach der Dusche abtrocknete.
Barton war ein stämmiger Mann, der sowohl Autorität als auch körperliche Kraft ausstrahlte. Ihm gingen die Haare aus, und er trug sie extrem kurz, heute waren sie nach zwei Tagen ohne Schnitt borstig. Als die Beamten aus dem Auto stiegen, zeigte er dem uniformierten Sergeant und dem Police Constable seinen Ausweis.
»Wer hat es gemeldet?«
Der Sergeant machte eine Kopfbewegung in Richtung des Milchmannes, der immer noch auf dem Trittbrett seines Milchwagens saß und die Hände knetete. »Mark Tidswell«, sagte er. »Ich spreche mit ihm, in Ordnung? Mal sehen, ob ich was Hilfreiches aus ihm herausbekomme.«
Der Constable machte sich daran, eine Gruppe von Leuten, die sich vor der Haustür von Nummer neunundzwanzig versammelt hatten, wieder zurück auf die Straße zu scheuchen. Barton hielt einen von ihnen am Gartentor an. »Wer ist der Hauseigentümer?«, fragte er. »Wissen Sie das?«
Der Mann zuckte entschuldigend mit den Schultern. »Man sieht hier nicht viele Leute. Außer, man ist tagsüber zu Hause.«
Barton sprach lauter. »Weiß es irgendjemand sonst?« Alles, was er als Antwort bekam, waren beschämte Blicke. »In Ordnung«, sagte er und strich mit einer Hand über die stacheligen Haare auf seinem Kopf. »Nennen Sie dem Constable Ihre Namen und Adressen, für den Fall, dass wir noch einmal mit Ihnen sprechen müssen.«
Er ging mit gebeugtem Kopf ins Haus, fast so, als ob er sich hineindrängeln wollte. Es gab Polizisten, die so etwas kalt ließ. Er gehörte nicht dazu. An der Haustür atmete er tief ein, dann trat er in den kühlen Schatten des Flurs.
Der Geruch war ekelhaft süßlich, mit schärferen und metallischen Duftnoten. Blut. Die Tür links vom Eingang stand offen. Er ging langsam in das Zimmer und passte auf, dass er die Tür nicht berührte. Bartons erste Aufgabe war festzustellen, ob es sich um ein Verbrechen handelte, seine zweite, die Unberührtheit des Tatortes für die Spurensicherung zu gewährleisten.
Er stand im Türrahmen und sah sich alles lange und genau an. Ein dunkler, trocknender Fleck hatte sich wie ein Heiligenschein um den Kopf des Opfers ausgebreitet, die Ränder waren schon verkrustet und fast schwarz. Ein Tisch war während eines Kampfs umgeworfen worden, und eine Lampe lag zerbrochen daneben, aber die Glühbirne war unversehrt und angeschaltet. Also war das Opfer in der Dunkelheit überfallen worden. Möglicherweise.
Eine Milchflasche lag da, die Hälfte des Inhalts hatte sich mit ein bisschen Blut vermischt. Es erinnerte ihn an den Erdbeermilchshake, den Timothy so gern mochte, aber er verdrängte den Gedanken, bevor sein Verdauungssystem reagieren konnte. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Details. Er hielt sich strikt an die Fakten und unterdrückte alle Assoziationen, alle Gefühle.
Viel Blut war auf die Wände, die Fußleisten, sogar an die Decke gespritzt. Was war dieses graue Zeug an den Wänden? Himmel! Er war dankbar, dass er das alles, das aussah wie aus einem Actionfilm, nicht fotografieren musste. Er glaubte, auch das Kissen auf ihrem Gesicht zu verstehen: Ekel, wenn nicht vor der Tat, dann zumindest vor deren Resultat.
Er empfand eine schreckliche Trauer und Wut wegen dieser Frau, nicht zuletzt, weil sie so beiläufig missachtet worden war: Das Kissen schien ihm eine letzte Beleidigung. Aber nichts hätte ihn dazu gebracht, es wegzunehmen. Schließlich war es nicht seine Aufgabe, den Tod festzustellen, das überließ er dem Pathologen.
Ein leises Rascheln, gefolgt von einem dumpfen Knall. Bartons Herz schlug schneller. Oben. Verdammte Scheiße! War der Mörder noch im Haus? Er holte seinen Schlagstock, ging zum Treppenaufgang und stieg vorsichtig, ohne das Geländer zu berühren, die Stufen hinauf.
Plötzlich klapperte Holz auf Holz. Er duckte sich, blieb zwischen zwei Stufen stehen und wartete einen Augenblick, bevor er weiterging. Kurz vor dem Treppenabsatz hörte er noch einmal das Klappern, ein bekannter Klang und doch so unpassend bei diesen Umständen, dass er seinen eigenen Ohren nicht traute. Er hielt noch einmal inne und wartete, da war es, und dieses Mal war er sich sicher.
Ein Baby! Mein Gott, im Haus ist ein Baby!
Er lief ins Schlafzimmer. Vor der Tür senkte er seinen Schlagstock und horchte, ob jemand bei dem Kind war. Es war nichts zu hören, außer dem Klappern der Holzstäbe eines Kinderbettes und dem unverständlichen Gebrabbel eines in Selbstgespräche vertieften Kindes. Er bewegte die Türklinke und öffnete langsam die Tür.
Das kleine Mädchen stand in ihrem Kinderbett. Helle Locken umrahmten ihr Gesicht, auf der linken Wange hatte sie einen Ausschlag durchs Zahnen. Sie war höchstens ein Jahr alt. Sie sah aus, als hätte sie geweint, aber jetzt war sie neugierig auf den Fremden an ihrer Schlafzimmertür.
Sie machte große, erstaunte Augen und rüttelte aufgeregt an den Holzstäben. Sie streckte ihren gepolsterten Po hoch und rief »Mamamama«.
Barton hob sie hoch. Sie wand sich in seinen Armen, zeigte mit einem Finger auf die Tür und machte ein überraschtes Geräusch.
Wo ist Mami?, dachte Barton. Sie will wissen, wo ihre Mami ist. War sie wach gewesen, als der Mörder ihre Mutter erschlagen hat? Hatte sie ihre Mutter schreien hören?
Er bückte sich, um einen Teddy aufzuheben, der zu Boden gefallen war, das Geräusch, das er auf dem Weg zur Haustür gehört hatte, und gab ihn ihr. Sie schrie begeistert auf und vergrub ihr Gesicht in ihm. Sie war warm, trotz der kurzärmeligen Weste und der kurzen Hose, die sie trug. Er holte einen Beißring aus dem Bettchen. Er dachte, dass sie während der nächsten Stunden etwas Beruhigendes brauchen würde. Sie nahm ihn und begann sofort darauf herumzukauen, dabei tropfte Speichel auf ihre Weste und seinen Jackettärmel.
»Lass uns hinausgehen und nachsehen, was da los ist«, schlug er vor.
Das Baby quiekte und wippte vor aufgeregter Zustimmung auf seinem Arm auf und ab. Barton schob sie auf seinen linken Arm und klappte den Schlagstock zu voller Länge auf, bevor er sich vorsichtig auf den Weg nach unten machte.
Kapitel 4
Ian Clemence arbeitete in völliger Dunkelheit. Es war eine Fähigkeit, die er erst vor kurzem erlernt hatte und die ihn begeisterte, ohne dass er sagen könnte, warum. Vielleicht war es die handwerkliche Geschicklichkeit, die man dafür brauchte. Vielleicht war es die Tatsache, etwas so gut zu können, dass man es tatsächlich mit verbundenen Augen erledigen konnte. Er hatte vorher alles vorbereitet: Die Lösungen waren gemischt, abgemessen und wurden in einer Schale, die er als improvisiertes Wasserbad benutzte, auf 20 °C erwärmt.
Mit einem Flaschenöffner nahm er die Kappe der Filmkassette ab und den Film heraus. Er achtete darauf, ihn nur am Rand zu berühren. Dann zog er den Filmanfang ab, tastete vor sich auf der Arbeitsfläche nach der Plastikspirale und wickelte den Film auf die Spule, bevor er ihn in den lichtundurchlässigen Entwicklungsbehälter legte und den Deckel fest schloss. Die restliche Prozedur konnte man auch im Hellen erledigen.
Er zog an der Schnur und kontrollierte die Temperatur der Entwicklerflüssigkeit. Fast fertig. Er war stolz auf seine Dunkelkammer. Der Vermieter, Walker, hatte darauf bestanden, dass alles wieder leicht zu entfernen war, daher hatte er die Pressspanplatten zur Verdunklung mit Riegeln an den Fenstern befestigt. Es hatte ihm nicht gefallen, als Clemence gesagt hatte, dass er die Spüle und den wackeligen Schrank herausreißen wollte, die die gesamte Einrichtung der alten Küche darstellten, aber er hatte dann doch zugestimmt, als er sah, welche Verbesserungen Clemence erreicht hatte, indem er das Fett und den Dreck von fünfzehn Jahren entfernt hatte, bevor er strich und seine Einbauküche, die er von einer Hausrenovierung weiter oben in der Straße hatte, installierte. Natürlich war der alte Walker nicht gerade begeistert von schwarzen Wänden, er sagte, dass es eigentlich nicht zur Küchenatmosphäre passte.
»Ich hatte mehr an mediterrane Farben gedacht«, sagte er. »Terrakotta und Blautöne.«
Clemence hatte versprechen müssen, alles neu zu streichen, falls er je auszog. Er machte sich ein bisschen Sorgen, dass das Zimmer nicht nur licht-, sondern auch luftundurchlässig war, aber darum würde er sich kümmern, wenn er länger bliebe.
Er kontrollierte jede Arbeitsphase sorgfältig mit der Uhr: Entwickler, Stoppbad, Fixierbad, dann zum Wässern. Er stellte die Wanne in die Doppelspüle und drehte das Wasser auf. Die Wässerung würde dreißig Minuten dauern. Er hörte in einem der Zimmer über sich eine Tür schlagen, dann das dumpfe Geräusch schneller Schritte auf der Treppe. Seine Küchendunkelkammer war ursprünglich eine Speisekammer gewesen, die unter die Treppe des alten Hauses eingebaut worden war. Zunächst hatte er befürchtet, dass Staub von den Treppenstufen auf seine trocknenden Negative und Abzüge fallen könnte, aber er hatte dieses Problem gelöst, indem er die Stufen mit Folie abgedeckt und dann mit Brettern verkleidet hatte.
Als die Haustür zuknallte, hob er einen Streifen mit sechsunddreißig Negativen hoch, die er gestern Abend entwickelt hatte, und suchte nach etwas Interessantem. Er entdeckte ein halbes Dutzend Aufnahmen von der Frau mit dem kleinen Top mit den Spaghettiträgern und erinnerte sich daran, dass man den BH-Träger sehen konnte. Heutzutage war es anscheinend in Ordnung, den schmalen BH-Träger zu zeigen.
Er lächelte und fuhr mit einem Finger ihre Gesichtskonturen entlang. Es war eine Quelle stetiger Überraschung und Freude, dass die Fotografie ihm solche Freiheiten ermöglichte. Er konnte sich keine anderen Umstände vorstellen, unter denen er eine Frau so intensiv anstarren konnte, ohne dass sie sich aufregen würde. Nicht, dass er ein Perverser war, aber es war eine lange Zeit gewesen, und, auch wenn er gern hinsah, würde es eine Weile dauern, bis er sich wieder trauen würde, sich mit einer Frau zu treffen.
Er machte die Kontaktabzüge. Er säuberte die Negative mit einem Künstlerpinsel, dann knipste er die Laborleuchte an, bevor er das weiße Licht ausschaltete. Er hatte gedacht, dass die Enge in diesem kleinen, stickigen Raum ein Problem wäre, aber er fand in der Ruhe und Dunkelheit zu einer gewissen Heiterkeit. Er lächelte, als er sich an etwas erinnerte, das er in einem der Fotobücher gelesen hatte, die er in der Bibliothek ausgeliehen hatte. »Bilder«, hatte der Autor poetisch geschrieben, »sind wie Frauen. Sie verlangen unsere volle Aufmerksamkeit, und die delikateste Arbeit wird im Dunkeln erledigt.«
Entwickeln und Abzüge machen war etwas Neues für ihn. Drinnen hatte er keine Wahl gehabt, alles aus dem Fotografiekurs wurde an ein Labor geschickt, und jetzt, da er nach seiner Entlassung in einem gearbeitet hatte, wusste er, dass es keinen Spielraum für künstlerische Interpretationen oder auch nur technische Finessen gab. Alles, was er im Labor tat, war, die Filme einzulegen und das Papier nachzufüllen, den Rest erledigte die Maschine. Trotzdem hatte er ein paar Dinge über Kameratechnik gelernt, und der Besitzer hatte ihm erlaubt, Restmengen mit nach Hause zu nehmen, die Schnipsel und den Bodensatz, wie er es nannte. Und falls Clemence die Länge des Rollenendes manchmal etwas frei interpretierte oder falls ab und an mehr als bloß ein paar Tropfen Fixierer in den Kanistern übrig war ‒ wer würde ihm schon vorwerfen, es für sich selbst zu benutzen?
Er schnitt die sechsunddreißig Negative in Sechserstreifen und legte sie nebeneinander in den Wannendeckel des Kontaktkopierers, dann legte er einen Zwanzig-mal-fünfundzwanzig-Bogen Fotopapier auf das Baseboard und begann mit dem Vergrößern. Fünfzehn Sekunden Belichtungszeit müssten ausreichen. Er stoppte sie auf die Sekunde genau, schaltete die Lampe aus und legte den Bogen in den Entwickler.
Diese Phase war eine Offenbarung gewesen. Als er die ersten Male dabei zusah, wie die Bilder wie von Geisterhand auf dem Papier erschienen, wie sie schnell Form und Kontur gewannen, musste er sich darauf konzentrieren, nicht den Atem anzuhalten. Und er hatte ein paar überentwickelt, da er vom schärfer werdenden Bild wie hypnotisiert war. Jetzt stoppte er jeden Arbeitsgang auf die Sekunde genau nach den Angaben auf den Entwicklerflaschen. Er freute sich über den scheinbaren Widerspruch, aus dem gute Fotos wurden, der Kombination von Wissenschaft und Kunst, Ehrlichkeit und Künstlichkeit.
Die Zeit war um. Er hob die Abzüge mit einer Pinzette aus dem Entwicklerbad und legte sie in das Stoppbad. Mist. Selbst ohne Lupe konnte er einen Fehler erkennen. Wie, zum Teufel, hatte er das übersehen können? Hinter der Frau steht ein Gerüst. Es lenkt ab und ist ästhetisch unschön. Er war dem Ratschlag des Maestros etwas zu genau gefolgt und hatte sich voll auf die Frau konzentriert, obwohl er sich auch um die Umgebung hätte kümmern sollen. Er hätte eine größere Blende benutzen sollen, um so die Bildtiefe zu reduzieren und den Hintergrund etwas zu verwischen. Er war versucht, alles wegzuwerfen, doch dann entschloss er sich, den Prozess zu Ende zu bringen. Vielleicht würde er versuchen, daraus eine dieser Vignetten zu machen, indem er den Hintergrund unter- oder überbelichtete, damit er unscharf würde. Könnte einen Versuch wert sein.
Manchmal muss man das Bild, das man möchte, einfach aus dem Bild, das man gemacht hat, herauslocken, dachte er. Er hatte das nirgendwo gelesen, aber er hatte selbst entdeckt, dass das Bild oft in der Entwicklung versteckt war, und manchmal war es das Modell, das Verstecken spielte und mit der Kamera flirtete.
Clemence kannte sich mit dem Verstecken aus. Er war ein Meister im Verbergen. Zwölf Jahre lang hatte er der Entdeckung getrotzt, hatte seine Gefühle versteckt, seine Ängste, seine Wünsche und Bedürfnisse. Er hatte sogar gelernt, Freude zu verbergen. Drinnen wurde ein Lächeln als eine Geste der Besänftigung angesehen. In den meisten Häusern, in denen er eingesperrt gewesen war, hätte man genauso gut auf dem Bauch herumrutschen oder mit einem Lächeln auf den Lippen herumlaufen können. Schwuchteln lächelten, Opfer lächelten. Wenn man sicher sein wollte, lächelte man nicht, und man lernte, nur dann Blickkontakt herzustellen, wenn man auch handeln wollte.
Es war ihm nicht bewusst gewesen, wie vollkommen sein Verschwinden gewesen war, bis ihm auffiel, dass seine Kollegen im Labor ihm aus dem Weg gingen, und zwar weiträumig, als hätte er eine drei Meter breite Bannmeile um sich herum, und sie passten auf, seine Privatsphäre nicht zu verletzen. Er musste sich bewusst anstrengen, seine Gesichtsmuskeln zu entspannen und manchmal zu lächeln. Und langsam hatte er ihr Vertrauen gewonnen.
Wenn er sich eines der Schwarz-Weiß-Fotos von Gefängnisinsassen ansah und etwas bemerkte, von dem der Mann glaubte, dass er es verbarg, war das ein Augenblick purer Aufregung. Manchmal sah er Trauer, die sich in einem hängenden Augenlid verriet, manchmal Abwehr in einem angehobenen Kinn. Knastbrüder waren Meister im Verbergen, aber die Kamera, obwohl auch sie lügt ‒ natürlich tut sie das, wo wäre sonst das Vergnügen? ‒, war auch zu großer Ehrlichkeit fähig.
Draußen zu überleben verlangte nach einer anderen Art des Verbergens, nach neuen Regeln. Das Image als Insasse, als harter Kerl, das ihm in all den Jahren so gut gedient hatte, half nicht, wenn die Leute die Freiheit hatten wegzugehen. Man musste lernen, auf eine andere Art und Weise mit Leuten umzugehen, und es ging dabei nicht immer um Stärke. Wenn man Leute fotografieren möchte, muss man ihnen ein entspanntes, sicheres Gefühl vermitteln.
Entwickeln und Abzüge machen war dasselbe. Man musste den richtigen Kontrast hervorlocken, Licht und Schatten ausbalancieren, aufpassen, dass sie nicht zu hart werden und nicht zu weich. Er hatte viel aus Büchern gelernt, einiges durch Versuch und Irrtum, aber Fehler waren teuer, bei der Fotografie genauso wie im Leben, und er hatte kein Geld zu verschenken. Er hatte darum gerungen, Struktur und Tiefe und Bewegung und, mehr als alles andere, Klarheit in seinen Bildern zu erreichen.
Nicht die Art von Klarheit, die durch Brennpunkt und Tiefenschärfe zu erzielen war. Bei dieser Klarheit ging es um die Sichtweise. Es ging darum, die Essenz einzufangen, der Person, der Situation, sogar des Lichtes. Es ging darum, das Bild in der Szene zu finden, den Augenblick einzufangen, das Gefühl dieses Augenblicks in einer Kopfbewegung oder, ja, in einem Lächeln zu destillieren.
Er versah seine Bilder mit Namen, Uhrzeit, Datum und katalogisierte und ordnete sie sorgfältig. Sie bedeuteten eine Geschichte, ein Protokoll seiner Fortschritte, und auf eine weniger eindeutige Art stellten sie seine Rückkehr ins Leben dar. Der bloße Unterschied der Szenen, der Leute, der Situationen, die er auf Film festhielt, war ein Beweis seiner Freiheit.
Das leuchtende Ziffernblatt erinnerte ihn daran, dass es fast Zeit für seine Schicht war. Der Rest würde bis später warten müssen. Er nahm seine Kamera und öffnete sie. Der Film war bereits in die Kassette zurückgespult. Er kippte ihn heraus, legte einen neuen Film ein und schloss die Klappe. Zufrieden hörte er zu, wie der Film automatisch zur ersten Aufnahme vorgespult wurde. Er legte den vollen Film in einen Plastikzylinder und klappte den Deckel zu.
Er räumte die Lebensmittel aus dem Schrank über der Arbeitsplatte, löste mit einem Taschenmesser die Haken und hob die Bretterverkleidung an, um den Spalt dann mit den Fingerspitzen zu vergrößern. Die Lücke hinter dem Brett war gerade groß genug, um den Film aufzunehmen.
Diese Bilder waren nicht seine beste Arbeit, aber die Bedingungen waren schließlich auch nicht ideal gewesen. Es war unmöglich gewesen, den Blitz zu benutzen, und er musste schnell fotografieren und schnell verschwinden. Trotzdem …
Er warf die Dose in die Luft und fing sie wieder auf. Es war das Risiko wert gewesen.
Kapitel 5
Das Radio lief leise. Ein örtlicher Musiksender. Hugo und Pippa unterhielten sich am Küchentisch. Trish holte Pippa ab, um in den Zoo zu gehen, und Pippa freute sich auf eines von Trishs berühmten Picknicks.
»Es ist schade, dass es im Chester Zoo keine Giraffen mehr gibt«, sagte Hugo. »Ich hätte dir sonst erklären können, warum Giraffen so lange Hälse haben.«
Pippa starrte ihn mit großen Augen an. »Warum haben Giraffen so lange Hälse?«
Er grinste. »Um ihren Kopf mit dem Körper zu verbinden.«
Sie kicherte und stieß ihn mit dem Ellbogen in die Seite: »Du bist so ein dämlicher Dad.«
Einen Augenblick lang waren beide still, und das Klackern ihrer Löffel in den Müslischalen vermischte sich mit dem Warnruf einer Amsel. Obwohl die Küchenfenster offen waren, bewegte sich die Luft kaum. Es würde einer dieser windstillen, drückenden Tage werden, an dem die Besprechungszimmer im Amtsgericht Wrexham zum Ersticken heiß waren.
Clara hoffte, dass ihre Mandantin dadurch nicht schlechte Laune bekäme. Sie vertrat Jill Quigley, eine Zwanzigjährige, die sich mit ihrem Exmann über das Besuchsrecht stritt. Clara glaubte, dass eigentlich keiner der beiden dem anderen die Zeit mit ihrem Kind missgönnte, und doch hatte Gary zwei Mal vor einem leeren Haus gestanden, als er kam, um Daniel, ihren gemeinsamen Sohn, abzuholen. Es war schwierig, sagte Jill, da sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen war, und sie fügte hinzu, dass er diese Entschuldigung nicht hatte, als er Daniel nach seinem letzten Besuch zu spät nach Hause gebracht hatte, so dass sie dadurch einen Krankenhaustermin verpasst hatten.
Clara vermutete, dass jeder versuchte, dem anderen zunächst durch Unpünktlichkeit und nun durch das Gerichtsverfahren klar zu machen, dass er verletzt war. Weil sie gedacht hatten, die Liebe würde ewig halten, und für den Geldmangel und die schlechte Wohnsituation entschädigt werden wollten. Die Liebe sollte das Leben versüßen, und stattdessen waren sie voller Bitterkeit und fühlten sich hilflos durch die Hoffnungslosigkeit, noch bevor einer der beiden einundzwanzig Jahre alt geworden war.
Clara seufzte, und Hugo griff über den Tisch, um ihre Hand zu drücken. Sie sah überrascht auf. Pippa blickte von ihrem Vater zu ihrer Mutter und wieder zurück, eine vorsichtige Hoffnung erhellte ihr Gesicht, dann rappelte es im Briefkasten, und der Bann war gebrochen. Sie sprang von ihrem Stuhl auf, lief in den Flur und rief: »Ich hole sie!«
Hugo streichelte die Falte zwischen Claras Daumen und Zeigefinger. »Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Warum nicht?« Sie sah die leichte Distanzierung, die sie in den letzten Monaten so oft gesehen hatte. Es war, als ob er sich nicht mehr voll auf sie konzentrierte, nur eine minimale Veränderung, aber genug, um einen sicheren Abstand zwischen ihnen zu schaffen.
Um Himmels willen, Clara, er wirft dir nichts vor. Kannst du nicht wenigstens höflich sein? Sie legte ihre Hand auf seine und verhinderte so, dass er sie langsam zurückzog. »Entschuldigung,« sagte sie. »Mir geht es gut.«
Er lehnte sich vor, drückte ihre Hand fester, und die Hoffnung in seinen Augen brach ihr fast das Herz.
Pippa fand am Ende des Tischs Platz und fing an, die Post in Mummy-, Daddy- und Papierkorbstapel zu sortieren, und dabei kommentierte sie alles. Die Radionachrichten hatten gerade begonnen, Clara räumte den Frühstückstisch ab und hörte mit halbem Ohr zu. Der Nachrichtensprecher las die Schlagzeilen kurz vor, jeweils von einem synthetischen Trommelschlag getrennt. Die dritte Nachricht ließ sie zusammenzucken.
Sie stand an der Kühlschranktür, die Butterdose in der Hand, und der kühle Luftzug, der in der bereits drückenden Atmosphäre zunächst eine willkommene Erfrischung gewesen war, wurde zu einem eiskalten Schauer.
Hugo schaltete das Radio aus, und in der Stille hörte sie wieder das Zwitschern der Amsel, die warnte: Ein Raubtier ist unterwegs.
Hugo wandte sich Pippa zu, die mit dem Sortieren aufgehört hatte und noch zwei Umschläge in der Hand hielt. »Mach dich für deinen Ausflug fertig, Poppet«, sagte er und lächelte sie beruhigend an.
»Daddy …«
»Trish wird jeden Augenblick hier sein, ich wette, dass sie mit dir zuerst in ein Café gehen und dir ein Eis am Stiel kaufen wird.«
Pippa nickte kurz, ihr Haar wippte hoch und sank wieder zurück. Sie hatte es den Sommer über wachsen lassen, es hing wie ein glänzendes, schwarzes Tuch bis auf ihre knochigen Schultern.
Clara wartete, bis sie die Schritte ihrer Tochter auf der Treppe hörte, dann ging sie durch die Küche und schaltete das Radio wieder ein. Die zweite Nachricht war gerade zu Ende. Clara hörte atemlos zu.
»Die Polizei in Cheshire hat heute Morgen die Suche nach einem Mörder aufgenommen«, begann der Sprecher in einem angemessen feierlichen Tonfall.
»Du musst dir das nicht anhören«, sagte Hugo und sprach lauter als die Nachrichten.
Clara drehte die Lautstärke hoch.
»... die schwer misshandelte Leiche der Frau wurde …«
»Das bedeutet nicht, dass du nicht in Sicherheit bist.«
Clara sah ihn düster an und stellte das Radio noch lauter.
»Die Polizei teilt mit, dass der örtliche Milchmann die furchtbare Entdeckung auf seiner morgendlichen Runde machte …«
»In Ordnung. In Ordnung!« Er beugte sich an ihr vorbei nach vorne und stellte die Lautstärke leiser. »Aber du musst sie nicht dazu zwingen, zuzuhören.«
»Möchtest du, dass sie sich in Sicherheit wiegt, weil Mummy und Daddy da sind, um sich um sie zu kümmern?«
»Nicht, Clara. Bitte tu das nicht.«
»Was tun, Hugo?«