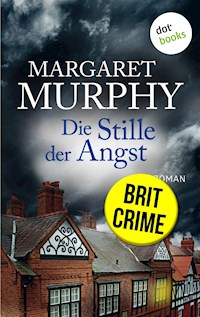
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die düsteren Geheimnisse einer englischen Kleinstadt ... Der Psycho-Thriller »Die Stille der Angst« von Margaret Murphy als eBook bei dotbooks. Kann Gerechtigkeit mehr wiegen als Schuld? Als Inspector Nelson zu einem Tatort gerufen wird, ahnt er noch nicht, dass dieser Fall ihn in die schlimmsten Abgründe führen wird – die der menschlichen Seele … Dr. Edmund Wilkinson, ein angesehener Professor, wird brutal ermordet in seinem Haus gefunden. Die einzige Verdächtige: seine eigene Ehefrau. Aber ist das vermeintliche Geständnis, dass Helen Wilkinson immer wieder vor sich hinmurmelt, wirklich glaubhaft? Schon bald beschleicht Nelson der Verdacht, dass sich hinter der Hochglanzfassade dieser Ehe ein Albtraumleben verborgen hat. Und auch am Institut scheint der Professor ein verhasster Tyrann gewesen zu sein. Doch wer ist Opfer, wer ist Täter? Mehr und mehr verfängt sich der Inspector in einem dunklen Netz, aus dem der einzige Ausweg der Tod zu sein scheint … »Margaret Murphys Ziel, ihre Leser das Fürchten zu lehren, erfüllt sie brillant!« Literary Review Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der psychologische Spannungsroman »Die Stille der Angst« von Margaret Murphy überrascht wie »Gone Girl« und »Girl on the Train« mit unvorhersehbaren Wendungen, die den Atem rauben und Gänsehaut garantieren. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kann Gerechtigkeit mehr wiegen als Schuld? Als Inspector Nelson zu einem Tatort gerufen wird, ahnt er noch nicht, dass dieser Fall ihn in die schlimmsten Abgründe führen wird – die der menschlichen Seele … Dr. Edmund Wilkinson, ein angesehener Professor, wird brutal ermordet in seinem Haus gefunden. Die einzige Verdächtige: seine eigene Ehefrau. Aber ist das vermeintliche Geständnis, dass Helen Wilkinson immer wieder vor sich hinmurmelt, wirklich glaubhaft? Schon bald beschleicht Nelson der Verdacht, dass sich hinter der Hochglanzfassade dieser Ehe ein Albtraumleben verborgen hat. Und auch am Institut scheint der Professor ein verhasster Tyrann gewesen zu sein. Doch wer ist Opfer, wer ist Täter? Mehr und mehr verfängt sich der Inspector in einem dunklen Netz, aus dem der einzige Ausweg der Tod zu sein scheint …
»Margaret Murphys Ziel, ihre Leser das Fürchten zu lehren, erfüllt sie brillant!« Literary Review
Über die Autorin:
Margaret Murphy ist diplomierte Umweltbiologin und hat mehrere Jahre als Biologielehrerin in Lancashire und Liverpool gearbeitet. Ihr erster Roman »Der sanfte Schlaf des Todes« wurde von der Kritik begeistert aufgenommen und mit dem First Blood Award als bester Debüt-Krimi ausgezeichnet. Seitdem hat sie zahlreiche weitere psychologische Spannungsromane und Thriller veröffentlicht, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Heute lebt sie auf der Halbinsel Wirral im Nordwesten Englands.
Die englischsprachige Website der Autorin: www.margaret-murphy.co.uk/
Margaret Murphy veröffentlichte bei dotbooks auch ihre Spannungsromane:
»Das stumme Kind«
»Der sanfte Schlaf des Todes«
»Im Schatten der Schuld«
Außerdem ist bei dotbooks ihre Thriller-Reihe um die Anwältin Clara Pascal erschienen:
»Warte, bis es dunkel wird – Band 1«
»Der Tod kennt kein Vergessen – Band 2«
Sowie ihre Reihe um die Liverpool Police Station:
»Wer für das Böse lebt – Band 1«
»Wer kein Erbarmen kennt – Band 2«
»Wer Rache sucht – Band 3«
***
eBook-Neuausgabe September 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Caging the Tiger« bei Macmillan, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Der Rest ist Schweigen« bei Goldmann.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1998 by Margaret Murphy
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/gyn9037, jennyt
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-895-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Stille der Angst« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Margaret Murphy
Die Stille der Angst
Roman
Aus dem Englischen von Karin Diemerling
dotbooks.
Für Barbara Meiling, deren Optimismus mir durch die mageren Jahre half.
O Tigerherz, in Weiberhaut gesteckt!
König Heinrich VI,
3. Teil, 1. Akt, 4. Szene, 137
Kapitel 1
Er sieht friedlich aus im Tod. Wie sie es sich immer wieder vorgestellt hatte. Seine Augen sind geschlossen. Sie konnten so kritisch und vorwurfsvoll, manchmal so furchtbar verächtlich blicken. Nun ist dies alles gnädig hinter den Lidern verborgen, und sie wird nie wieder unter seinem erbarmungslosen Blick zu leiden haben. Seine markanten Gesichtszüge sind entspannt und ausdruckslos, sie zeigen weder Überraschung noch Angst. Sie hatte also daran gedacht, ihm die Augen zu schließen, mit einem geübten, sanften Streichen über das Gesicht, sie hatte die Bettdecke seinem Griff entwunden, sie glattgezogen und seine Hände ordentlich darüber gefaltet.
Stirnrunzelnd legt sie nun ihre Aktenmappe ab und stellt die Einkaufstasche vorsichtig auf den blanken Holzfußboden. Irgend etwas stimmt nicht. Sie betrachtet das Bild mit distanziertem Interesse. Die Nachmittagssonne schickt blasse Strahlen durch die aufgezogenen Vorhänge herein. Frühlingssonnenschein, dahinjagende Wolken. Sein Körper, der unter der Bettdecke nackt ist, liegt ruhig da, unbewegt vom Spiel des Lichts und noch warm. Sein friedliches Gesicht ist schön, wie immer, wenn er ruht, sein Haar wirkt fast schwarz gegen das Blütenweiß der Bettwäsche und scheint im aufblitzenden Sonnenlicht Feuer zu fangen. Sie sieht besorgt auf sein Gesicht, voll Angst, daß das schnell wechselnde Spiel von Licht und Schatten ihn aufwecken könnte. Sie ist in Sicherheit, denn seine Augen sind geschlossen ‒ zum Glück hatte sie nicht vergessen, dafür zu sorgen. Erschöpft von der Anstrengung der Konzentration ist sie versucht, sich neben ihn zu legen, aber sie hält sich zurück. Was ist es nur?
»Irgendetwas stimmt nicht«, murmelt sie. Ruth wird es wissen. Sie kennt sich aus mit der Symbolik von Träumen, deren Geheimsprache. Ein rascher, heftiger Atemzug ‒ es ist das Blut. So viel Blut. Zuviel. Es hat sich über die Bettdecke ergossen, tiefrot, glänzend, noch nicht geronnen. Nach jeder Wolke wird es vom Sonnenlicht unbarmherzig beleuchtet, sein kupferartiger Geruch liegt schwer in der Luft. Ein Geruch, der sie in letzter Zeit immer aus dem Seziersaal vertrieben, sich wie eine Barriere vor ihr aufgebaut und ihm einen weiteren Grund für seine kaum verhohlene Verachtung geliefert hatte.
»Helen, was ist los?«
Sie hält den Telefonhörer in der Hand. Wie ist er dort hingekommen? Sie steht im Flur und hört wieder Ruths Stimme, drängender diesmal: »Helen, ist etwas passiert?«
Helen starrt auf die drei leuchtendroten Tropfen, die auf den Fußboden fallen, während die Wolken sich erneut kurz teilen und die Sonne mit plötzlicher Wärme durch die Buntglasscheiben der Haustür strömt. »Da stimmt etwas nicht«, wiederholt sie, als ob das alles erklärte.
Kapitel 2
Jack Nelsons bernsteinfarbene Augen betrachteten aufmerksam die Szene, die sich ihnen darbot. Eine kleine, dunkelhaarige Frau saß an einem Küchentisch aus Pinienholz, ihr Kopf war gesenkt, das Haar fiel ihr ins Gesicht und verbarg es zum größten Teil. Sie schüttelte den Kopf als Antwort auf etwas, das eine andere Frau zu ihr sagte. Diese zweite Frau, eine große, schlanke, energisch wirkende Blondine, beugte sich über sie und schien ihr Ratschläge zu erteilen. Sie hatte ihn hereinkommen sehen, ihn aber ignoriert und weiter murmelnd auf die Dunkelhaarige eingeredet. Ein wenig abseits von den beiden stand ein Mann, der sich offenbar bemühte, nicht hinzuhören. Er hob jetzt den Kopf, ging auf Nelson zu und stellte sich als Detective Sergeant Hackett vor. Der Neue also. Ein Import aus Warrington. Groß und stämmig, aber mit rotblonden Haaren. In Nelsons Augen stellte das einen ernstlichen Mangel dar, für ihn waren rotblonde Haare ein unverkennbares Zeichen von Schwäche. Er nickte Hackett flüchtig zu, ohne die beiden Frauen aus den Augen zu lassen, als versuchte er, bestimmte Schlüsse aus ihrem Verhalten zu ziehen.
»Mrs. Wilkinson?« sagte er endlich, und die kleinere Frau sah auf. Schöne Augen. Blau. Sie zeigten im Moment nicht viel anderes als Bestürzung, aber es waren Augen, die sie möglicherweise einmal verraten konnten.
»Doktor Wilkinson.«
Nelson ließ seinen Blick auf der Frau des Professors ruhen, auf ihrem hübschen, oval geschnittenen Gesicht und dem kleinen Schmollmund, bis diese ihren Kopf wieder senkte und ihn bereits vergessen zu haben schien. Dann wandte er sich betont langsam der anderen Frau zu, die Augenbrauen ironisch emporgezogen.
Die Blonde richtete sich gelassen zu voller Höhe auf und warf einen Blick auf seinen nassen Trenchcoat und die tropfenden Haare, ehe sie wiederholte: »Ihr Name ist Doktor Wilkinson.«
»Und Sie sind?« Nelson glaubte einen Funken von Belustigung in den Augen mit den schweren Lidern aufglimmen zu sehen. Sie waren ein bis zwei Schattierungen heller als Mrs. Wilkinsons und sandten widersprüchliche Signale aus: ungeduldige Intelligenz und gelangweilte Gleichgültigkeit.
»Ruth Marks«, antwortete sie. »Doktor Marks.«
»Inspector Nelson«, stellte er sich vor und zeigte mit mechanischer Geste seinen Dienstausweis. »Nun, da wir die Formalitäten hinter uns haben, könnten Sie uns vielleicht erklären, was passiert ist, Doktor Wilkinson.«
Die Angesprochene hob den Kopf, und er konnte Angst in ihren großen blauen Augen und eine Reihe perlweißer Zähne erkennen, als sie zu einer Antwort ansetzte.
»Helen geht es nicht gut. Sie kann jetzt nicht mit Ihnen sprechen.«
Nelson funkelte Doktor Marks ärgerlich an. »Sind Sie ihre Hausärztin, Doktor?«
»Ich bin ihre Freundin, und man braucht keinen Abschluß in Medizin, um zu sehen, daß sie unter Schock steht.«
Er hielt Doktor Marks’ Blick wortlos fest, aber die Frau schien unempfindlich gegen sein wütendes Starren zu sein. Ihr breiter, attraktiver Mund begann sich sogar zu einem Lächeln zu verziehen, als amüsierte sie sich über seinen Anblick und seine mürrische Miene, die sich dadurch, daß ihm das Regenwasser in die Augen tropfte und auf seinen Wangen kitzelte, auch nicht gerade aufhellte. Nelson, der es nicht gewohnt war, daß jemand seinem vernichtenden Funkeln so selbstbewußt standhielt, war kurz davor, klein beizugeben. Als die Türglocke den stummen Zweikampf unterbrach, glaubte Sergeant Hackett, der die Auseinandersetzung mit Interesse verfolgt hatte, eine Spur von Erleichterung im Blick des Inspectors zu erkennen.
Der Besucher war Doktor Wilkinsons Hausarzt, ein Inder oder Araber, vermutete Nelson, mit dem für seine Herkunft ungewöhnlichen Namen Patterson. Ruth Marks hatte ihn verständigt. Er nickte den beiden Polizisten zu und führte Helen ohne weitere Erklärung in ein von dem breiten Flur abgehendes Zimmer. Doktor Marks folgte ihnen, und Nelson, der wohl oder übel akzeptieren mußte, daß er nichts tun konnte, bis der Hausarzt seine Untersuchung beendet hatte, fiel über Hackett her.
»Sie haben dieser Zicke einfach das Feld überlassen ‒ haben zugelassen, daß sie den Hausarzt anruft und auf die Wilkinson einflötet. Ich schätze, Sie wissen auch nicht, was sie zu ihr gesagt hat. Ich schätze, Sie konnten noch kein vernünftiges Wort aus der Ehefrau herausbekommen.«
Hackett musterte seinen neuen Vorgesetzten mit kühler Gelassenheit. Jack Nelson ‒ auch »Jackie Messer« genannt ‒ besaß einen Ruf, der weit über den kleinen Teil von Cheshire hinausreichte, in dem er seit seinem Eintritt in den Polizeidienst vor fünfundzwanzig Jahren tätig war. Manche sagten, er habe sich den Spitznamen durch seinen messerscharfen Verstand verdient. Andere, die seinen Jähzorn und sein totales Unverständnis für einen weniger als hundertfünfzigprozentigen Einsatz im Beruf zu spüren bekommen hatten, behaupteten, er trage den Beinamen »Messer«, weil er ein hinterhältiger Mistkerl sei. Er scheue nicht davor zurück, das Messer noch einmal in der Wunde umzudrehen, nachdem er es einem in den Rücken gerammt hatte. Hackett, der schon länger bei der Kriminalpolizei war, als seine helle, faltenlose Haut und sein jugendliches Aussehen auf den ersten Blick vermuten ließen, wußte, daß es Gründe für Nelsons unliebenswürdiges Verhalten gab.
»Doktor Marks hatte ihn bereits angerufen, als wir eintrafen, Sir.« Er zögerte kurz, ehe er hinzufügte: »Ich fürchte, ich konnte nicht mehr vernünftige Worte aus Doktor Wilkinson herausbringen als Sie.«
In den grünen Katzenaugen und dem glatten Jungengesicht des Sergeants deutete nichts auf eine beabsichtigte Unverschämtheit hin, aber Nelson, der sehr empfindlich in diesen Dingen war, ahnte eine Spur von Aufsässigkeit. Er zog sein Taschentuch aus dem Mantel und trocknete sich das Gesicht. »Fassen Sie zusammen, was vorgefallen ist.«
Hackett erstattete in klaren, knappen und betont ungehetzten Worten Bericht. »Doktor Marks sagt, sie habe um Viertel nach vier einen Anruf von Doktor Wilkinson erhalten. Sie sei sofort hierhergeeilt. Als sie die Leiche des Professors fand, habe sie umgehend uns und den Hausarzt verständigt. Wir waren um Viertel vor fünf hier. Der Pathologe und die Spurensicherung sind kurz vor Ihnen eingetroffen.«
»Die Waffe?«
»Ein Messer …«
»Verdammt, das sehe ich, Hackett! Das viele Blut auf dem Bettzeug und die klaffende Wunde in der Brust des armen Kerls deuten ja wohl darauf hin.«
Nelson hatte das Haus vor knapp zwanzig Minuten nässetriefend, atemlos und bereits in miserabler Laune erreicht, weil er seinen Wagen in einer Parallelstraße hatte parken müssen ‒ bloß weil diese geizigen Touristen die Parkgebühren in der Innenstadt nicht zahlen wollten und weitere verdammte Touristen in den Bed & Breakfasts hausten, von denen es in diesem Teil von Chester nur so wimmelte.
Er hatte Dreckspuren auf den Mosaikfliesen der Vorhalle hinterlassen und Dreck in den grün-blau gemusterten, abgetretenen Läufer im Flur getrampelt. An der Tür zum Schlafzimmer war er vom Gerichtsmediziner und seinem Team abgefangen worden. Eine Stichwunde. Tödlich. Mitten durchs Herz. Noch recht frisch ‒ erst ein oder zwei Stunden alt. Er hatte die Leiche nur von der Tür aus in Augenschein nehmen können.
»Ich wollte gerade sagen«, nahm Hackett ungerührt in seinem freundlichen, gemessenen Tonfall das Wort wieder auf, »daß ein Messer aus dem Block in der Küche fehlt. Ein Tranchiermesser.«
»Woher wissen Sie, daß es sich um ein Tranchiermesser handelt?«
»Doktor Marks hat es mir gesagt. Die anderen Messer sind zur Laboruntersuchung mitgenommen worden.«
»Um wieviel Uhr ist Doktor Wilkinson nach Hause gekommen?«
»Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie zu befragen, Sir.«
Nelson gab ein entnervtes Grunzen von sich. »Jetzt reicht’s mir aber!« Er ging mit großen Schritten durch den Flur auf die Tür zu, durch die er Wilkinson mit Marks und dem Arzt hatte verschwinden sehen, und wollte gerade nach der Klinke greifen, als sie von innen geöffnet wurde. Er stutzte überrascht, nicht weil er plötzlich dem dunkelhäutigen Hausarzt gegenüberstand, sondern weil der Raum sich so deutlich von den anderen im Haus unterschied. Selbst in seiner finsteren Stimmung hatte Nelson das Vorherrschen von blassen, ausgewaschenen Farben bemerkt. Ein gewollter, kultiviert-dekadenter Charme ging von dem abgetretenen Fischgrätparkett und den verblichenen Teppichen in den Räumen aus. Die Wände des Schlafzimmers waren hellgrau gestrichen, keine Bilder hingen an ihnen. Sie wurden von schiefergrauen Fußleisten begrenzt, und selbst die Vorhänge trugen ein undefinierbares Muster aus Beige- und Grautönen. Der lebhafteste Farbfleck im Zimmer war die über die weißen Laken ausgebreitete Blutlache.
Der Hausarzt trat einen Schritt zurück und gewährte Nelson Einlaß ins Wohnzimmer. Es war in leuchtenden, nach der würdevollen Schäbigkeit des restlichen Hauses fast blendenden Farben gehalten. An einer Wand hing ein riesiges abstraktes Gemälde in Orange, Gold und Grün. Vor einer anderen rankten sich tropische Pflanzen empor. Deckenhohe Regale, die mit Büchern, Zeitschriften und bunten Karteikästen vollgestopft waren, nahmen eine weitere Seite des Raums ein, und gegenüber ging ein Panoramafenster auf einen großen, von einer Mauer umgebenen Garten hinaus, in dem Primeln und Narzissen schon üppig blühten.
»Meine Patientin ist vorläufig nicht in der Lage, Ihre Fragen zu beantworten, Inspector«, sagte der Arzt und bestimmte damit über die Situation und die Frau, die Nelson vernehmen mußte. Wo habe ich das bloß schon einmal gehört? dachte Nelson sarkastisch. Der Doktor sah unbehaglich drein. Nelson vermutete, daß er noch nicht lange praktizierte. Ein junger, ehrgeiziger Arzt, der Eindruck machen wollte und offenbar schon die ersten Stufen der Karriereleiter erklommen hatte, da er auf der Ärzteliste der inneruniversitären Gesundheitsfürsorge stand. Keine schlechte Ausgangsposition. Nelson kannte die Quotenregelung des Antidiskriminierungsgesetzes und fragte sich mit einem Blick auf den gutaussehenden, durchtrainierten Arzt, ob sie auch für gemischtrassige Bewerber galt.
Die Frau des Professors lag von ihm abgewandt auf einem über Eck gestellten Sofa mit Blick auf das Panoramafenster. Er konnte nicht erkennen, ob ihre Augen offen waren, aber ihre angespannte Haltung und die kontrollierten Atemzüge sagten ihm, daß sie wach war und auf sein Gehen wartete. Nun, ganz so einfach würde er es ihr nicht machen.
»Wir müssen dringend mit Doktor Wilkinson sprechen, Doktor Patterson«, sagte er mit so viel Höflichkeit, wie er unter den gegebenen Umständen aufbringen konnte. Aus dem Augenwinkel sah er, daß Ruth Marks ihn beobachtete, ihre herausfordernd amüsierte Miene konnte den abschätzenden Blick nicht ganz verbergen.
»Morgen«, entgegnete Patterson. »Sie sehen doch, daß sie im Moment nicht vernehmungsfähig ist.«
»Ihr Mann ist ermordet worden. Wir können keine Zeit mit Anstandsregeln verplempern.«
Patterson sah in das zerfurchte Gesicht des Inspectors. Dessen fleckiger Teint, ein Barometer der Stimmungslage, war ärgerlich gerötet. Aus Gewohnheit erstellte Patterson eine rasche Diagnose: chronischer Alkoholismus; eine leichte Gelbsucht, vor allem im Weiß der Augen erkennbar, deren Verfärbung auf ein frühes Stadium von Leberzirrhose hindeutete; eine von ausgiebigen Besäufnissen hervorgerufene und verschlimmerte Rosenakne. Mehr Schnaps als Bier, nach der Reibeisenstimme zu urteilen. Bei einer zweiten, eher intuitiven Analyse entdeckte er außerdem Spuren beginnenden Wahnsinns in den Augen des Polizisten. Patterson hatte Angst vor dem Inspector und war sich seiner Kompetenzen nicht ganz sicher, aber er würde nicht nachgeben. Helen verließ sich auf ihn. »Ich muß das Wohl meiner Patientin an erste Stelle setzen, Inspector, und kann kein Verhör gestatten, bevor ich sie morgen früh noch einmal gründlich untersucht habe.«
Nelson blickte finster von Patterson zu Ruth Marks, und der Arzt erschrak erneut vor seinen wilden, wolfsartigen Bernsteinaugen. Dann machte der Inspector plötzlich und unerwartet auf dem Absatz kehrt und verließ den Raum.
»Ist er weg?«
»Ja, wir sind jetzt allein«, antwortete Ruth. Patterson war kurz nach dem Inspector gegangen und hatte ein Rezept dagelassen, für den Fall, daß Helen sich doch noch entschließen würde, ein Schlafmittel zu nehmen. Ruth kniete sich neben sie und strich ihr übers Haar. Helen sah sie eine Weile schweigend an. Ihre Augen, die von einem Blau waren, das an tiefes Wasser erinnerte, blickten besorgt; sie schien mit etwas zu ringen, von dem sie nicht wußte, ob sie es sagen oder wie sie danach fragen sollte. Ruth wartete, bis sie die Worte fand. Als sie kamen, schwangen sowohl Angst als auch Hoffnung darin mit.
»Er ist doch wirklich tot, oder?«
»Ja, er ist tot.«
Helen starrte an Ruth vorbei auf die vom letzten heftigen Regenguß flachgedrückten Primeln. »Ich dachte schon …«
»Was hast du gedacht?«
Helen zuckte die Achseln. Was sollte sie Ruth sagen? Daß sie geglaubt hatte, es handele sich wieder um eine ihrer Phantasien, eines jener geistigen Bühnenbilder, mit denen sie sich an Edward zu rächen pflegte? Manchmal, so wie jetzt, fühlte sie ihre Kräfte dahinschwinden ‒ als ob ihr Geist sich langsam von ihrem Körper entfernte, um damit der Krankheit vorzubeugen, von der sie ihren Geist bedroht fühlte, und eine auch körperlich spürbare seelische Qual zu betäuben. Hinterher war es oft schwer, die beiden Teile ihres Selbst wieder zusammenzufügen, wieder ganz und vollständig zu werden. Die zwei Hälften schienen nicht mehr richtig ineinanderzupassen.
Als Kind war sie mehrfach operiert worden, um ihr Schielen zu beheben. Ihre Mutter hatte jahrelang die Fahrt von Bolton zum Kinderkrankenhaus in Manchester mit ihr unternommen und sich von alten, wackeligen Bussen durchrütteln lassen, nur damit sie dort ‒ so erschien es ihrer kindlichen Auffassung ‒ ein Spiel spielen konnte, bei dem sie durch ein Sehgerät auf zwei Bilder schaute. Auf der linken Seite war ein Tiger mit gefährlich entblößten Fangzähnen dargestellt, auf der rechten ein Käfig. Sie sollte den Tiger in den Käfig bringen, indem sie an den seitlich angebrachten Knöpfen des Geräts drehte. Vermutlich konnten die Ärzte am Grad der fehlerhaften Deckung der beiden Bilder erkennen, wieviel noch an ihrem trägen linken Auge getan werden mußte. Denn während sie den Tiger sicher im Käfig wähnte, hatten für gesunde Augen immer noch ein paar Zentimeter gefehlt. Sah Ruth sie jetzt auch so? Beobachtete Ruth, wie sie versuchte, die beiden getrennten Teile ihres Selbst zur Deckung zu bringen, den Tiger in den Käfig zu sperren, und es nicht schaffte?
Kapitel 3
So. Es ist also wirklich geschehen. Ich habe es wirklich getan, und er ist wirklich tot. Kein Traum, keine Einbildung. Ich habe den Plan, den zu schmieden schon so vergnüglich, so tröstlich gewesen ist, der Phantasie entsprechend in die Tat umgesetzt. Ich habe exakt den richtigen Zeitpunkt abgepaßt! Das Messer ist mit einem einzigen, glatten, befriedigenden Stoß durch die Zwischenrippenmuskulatur und in das Herzgewebe gedrungen.
Hätte ich den Mut dazu gehabt, wenn das Baby nicht gewesen wäre? Mut? Das ist nicht das richtige Wort ‒ es hatte nichts mit Mut zu tun. Entschlossenheit trifft es eher. Hätte ich die Entschlossenheit besessen, die Phantasie Wirklichkeit werden zu lassen, von der ersten Probe bis zur Aufführung des Stücks durchzuhalten? Wahrscheinlich nicht. Das Baby hat alles verändert. Ich konnte keine Distanz mehr wahren.
Es war höchste Zeit zu handeln.
Kapitel 4
Der Konferenzsaal des Fachbereichs Zoologie und Meeresbiologie war einmal eine an die Wohnung des Universitätsgeistlichen angegliederte Bibliothek gewesen. Mit seinen holzgetäfelten Wänden und durch Kleeblattbögen gekrönten gotischen Fenstern hatte sich der Raum eine kirchliche Erhabenheit bewahrt, aber es war nicht religiöse Ehrfurcht, die eine gedämpfte Stimmung bei der sonst so selbstbewußten und lautstarken Versammlung der Fachbereichsmitglieder am Morgen nach Professor Wilkinsons Tod hervorrief.
Sie saßen in mehreren Grüppchen auf den billigen, senfgelben Plastikstühlen in der kleinen Kaffeebar. Der Konferenztisch, der hinter stoffbespannten Wandschirmen und Topfpflanzen die andere Hälfte des Raums einnahm, war mit Notizblöcken, Gläsern und Wasserflaschen bestückt, aber niemand bewegte sich auf ihn zu oder warf auch nur einen Blick in seine Richtung. Als ob etwas Beängstigendes von ihm ausginge. Es gab dafür keinen erkennbaren Grund: Diese Versammlung war bei der letzten monatlichen Fachbereichskonferenz routinemäßig anberaumt worden. Trotzdem lag eine deutlich spürbare Nervosität in der Luft.
Der Senat der Universität hatte die planmäßige Zusammenkunft genutzt, um alle Mitarbeiter der Abteilung, von den Assistenten bis zu den Fachbereichsleitern, über die heikle Angelegenheit von Professor Wilkinsons Ermordung und die damit einhergehenden Komplikationen zu informieren.
David Ainsley beobachtete die Versammlung mit dem distanzierten Interesse eines Naturforschers, eine Rolle, in die er sich immer zurückzog, wenn wissenschaftliche Objektivität einer persönlichen Beteiligung vorzuziehen war. Er hatte Tuttle hereinkommen sehen, befangen wie immer und ängstlich darauf bedacht zu verbergen, was für alle offensichtlich war. Er hatte zugesehen, wie die anderen nacheinander von der Kaffeemaschine zu den kreuz und quer stehenden Stühlen schlurften, wobei der erste jeweils seine Nische etablierte, die die Nachfolgenden kolonisierten. Gleich und gleich gesellte sich gern, und das Territorium wurde gegen Annäherungsversuche von unwillkommenen oder inkompatiblen Außenstehenden mit warnendem Stirnrunzeln verteidigt. Der Raum roch nach starkem Kaffee und unterdrückter Furcht. Mick Tuttle hatte sich neben die Kaffeemaschine plaziert; der Stuhl stand der Tür am nächsten, und man konnte sich im Sitzen nachschenken. Er haßte es, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, indem er sich von einem Ende eines überfüllten Raums zum anderen quälte. Das quietschende Leder und die klingenden Metallgelenke seiner Gehschienen waren ihm selbst ebenso peinlich wie den anderen. Die Geräusche und die Mühseligkeit, mit der er sich fortbewegte, erinnerte die Leute daran, daß er ein Krüppel war ‒ obwohl sie das Wort nie benutzen würden, jedenfalls nicht in seinem Beisein ‒, und Tuttle wollte ihnen seine Behinderung nicht mehr als nötig vor Augen führen. Er war als einer der ersten gekommen, hatte sich seinen Platz gesichert und die Aufschläge seiner Hosen sorgfältig über die Stäbe und Stützen an seinen Beinen gezogen.
»Was zum Teufel macht sie denn hier?« sagte Mallory laut genug, daß der Großteil der Versammlung es hören konnte. Mallory meinte Helen Wilkinson. Sie saß im hinteren Teil der Kaffeebar neben Ruth Marks und ahnte nicht, daß ihre Anwesenheit ein solches Interesse hervorrief. Mit geistesabwesender Miene schlürfte sie ihren Kaffee und starrte auf das Muster aus gelben Rauten, das die Sonne durch die Fenster zu ihrer Linken auf den Boden zeichnete.
Hat er noch etwas gesagt? Ich versuche die ganze Zeit, mich zu erinnern, aber es ging alles so schnell, so glatt, wie in einem Film. Fehlte nur noch die Filmmusik. Ich glaube ‒ ich glaube, er lächelte nur, während er das weiße Laken glattstrich und eine Hand auf die noch körperwarme Stelle neben sich legte. Der Geruch von Sex in der Luft. Stickig, leicht übelkeitserregend. Unverkennbar.
Kein Kampf, keine Panik. Nur ein schneller, erstaunter Atemzug, Hände, die sich in die Bettdecke gruben, sie umklammerten, Schock über das Unerwartete. Das bei jeder ritualisierten Probe dieses sorgfältig geplanten Todes geschliffene Messer durchdrang mühelos Lederhaut, Fettgewebe, gestreifte Muskeln, Herzbeutel und Herzmuskel. So ein kleiner, leichter Gegenstand, mit einer schmalen, eleganten Klinge, von unzähligen kleinen Kratzern markiert und in Vorbereitung ihres Einsatzes immer wieder geschärft. Seltsam, wie man Achtung, ja fast Zuneigung für seine Werkzeuge entwickeln kann ‒ zumindest wenn sie einem gute Dienste leisten.
Er sank in sich zusammen wie ein angepikster Ballon. Schneller Druckabfall. Innerhalb von Sekunden war er tot. Es war ein humaner Tod, fast schmerzlos. Der kleine Einstich in seiner Brust, aus dem tief rotes Blut drang, erinnerte an Darstellungen des gekreuzigten Christus.
David Ainsley sah wieder zu Mallory hinüber. Er hatte die graue Gesichtsfarbe und das reizbare Temperament eines Rekonvaleszenten. Buschige Augenbrauen überschatteten stechende schwarze Augen, und die faltigen Hängewangen deuteten darauf hin, daß Alter und Verdauungsstörungen diesen einst kräftigen Mann hager gemacht hatten. Mallorys Anhänger hielten seine Ungehobeltheit für Offenheit, sie vertrauten darauf, daß er all das äußerte, was sie sich nicht zu sagen trauten, und daß sie durch die Verbindung mit ihm ebenfalls für geradeheraus und mutig in ihren Meinungsäußerungen gehalten würden. Aber da Mallory selten nachdachte, bevor er den Mund aufmachte, und seine Meinungsäußerungen vorwiegend auf Gehässigkeit und Vorurteilen beruhten, wurden sie von den meisten ignoriert. Ainsley verachtete ihn.
Seine Kritik an Helen Wilkinsons Anwesenheit hatte aufgeregtes Tuscheln bei seiner kleinen Gefolgschaft von Unzufriedenen ausgelöst ‒ vier Zoologen, die noch verstimmter als der Rest darüber waren, daß die Verwaltung der neuen Fakultät der Biowissenschaften aller Wahrscheinlichkeit nach in ihr gemütliches und frisch renoviertes Gebäude aus dem achtzehnten Jahrhundert einziehen würde, während diejenigen Zoologen, die die Neuorganisation und die Stellenstreichungen überlebten, in ein architektonisch weniger ansprechendes und an einer lauten Straße gelegenes viktorianisches Ziegelsteingebäude verlegt würden. Ainsley musterte die Gruppe mit unverhohlener Geringschätzung. Die beiden jüngeren Lehrbeauftragten verstummten unter dem Blick. John Ellis, ein Nachwuchsforscher, der in den letzten Wehen seiner Doktorarbeit lag, sprach weiter. Seine Gesten wirkten in Ainsleys kritischen Augen übertrieben, geradezu theatralisch. Ellis war nervös, entschied er. Er redete immer zuviel, wenn er nervös war. Feeney, ein Honorarprofessor, der näher an Mallorys Alter war, schlürfte seinen Kaffee in scheinbarer Unbekümmertheit, aber Ainsley bemerkte, daß seine Hände zitterten, als er die Tasse mit lautem Klappern auf dem Unterteller abstellte.
»Man sollte sie auffordern zu gehen«, hetzte Mallory weiter.
»Widerlicher alter Stänkerer«, murmelte Ainsley darauf zwischen den Zähnen hindurch.
Mallory warf ihm einen finsteren Blick zu.
»Er hat wahrscheinlich Angst, daß Edward sein miserables Abschneiden bei der Evaluierung der Forschungsarbeit mit dem lieben Frauchen besprochen hat«, bemerkte Julian Rutherford zu Ainsley, wobei er verstohlen zu Helen Wilkinsons verträumtem Profil hinüberschielte. »Allerdings ist es wirklich merkwürdig, daß Helen so schnell nach …«
»Sie hat genauso ein Recht hier zu sein wie wir«, entgegnete Ainsley und war nicht weniger überrascht als die anderen seiner Gruppe, daß er Wilkinsons Witwe verteidigte. »Na ja«, versuchte er seinen heftigen Ton abzuschwächen, »ich verstehe einfach nicht, warum die Leute immer ihre Nasen in die Angelegenheiten anderer stecken müssen.«
»Wenn sie mit ihren eigenen mehr als genug zu tun haben, meinst du?«
Ainsley ging auf Rutherford los. »Was willst du damit sagen?« Rutherford registrierte sein ärgerliches Aufbrausen nachdenklich. Ainsley hatte die Fäuste geballt, und seine sonst so klaren grauen Augen waren an diesem Morgen blutunterlaufen. Was hat er letzte Nacht bloß getrieben? fragte sich Rutherford. »Nur, daß es in unserer fürsorglichen Gemeinschaft zu viele Wichtigtuer gibt«, sagte er, zufrieden, daß seine Botschaft angekommen war. Im allgemeinen mochte Rutherford Ainsley, aber dessen Neigung zur Selbstgerechtigkeit stieß ihn ab. Er hatte während der letzten halben Stunde mitbekommen, wie Ainsley das Verhalten seiner Kollegen analysierte, wie er jeden Eintreffenden abschätzte und dessen Chancen auf Weiterbeschäftigung nach der Reorganisation der Fachbereiche bewertete. Es würde Ainsley nie in den Sinn kommen, daß auch er möglicherweise beobachtet wurde, daß auch sein Privatleben Gegenstand von Klatsch und Spekulationen sein könnte.
Ist doch seltsam, dachte Rutherford, daß Edward, der unser Schicksal oder doch zumindest unsere Karrieren in seinen schmierigen Händen hielt, auf einmal tot ist; daß die Macht, die er so despotisch ausübte, keine Bedeutung mehr hat und das Wenige, was noch an ihn erinnert, durch die zerstörerische Kraft entopischer Unordnung bereits in Auflösung begriffen ist.
Eine Bewegung am Rand seines Gesichtsfelds veranlaßte Rutherford, sich von Ainsley abzuwenden. Smolder ging steif auf Mallory zu, und es kam zu einem hitzigen Wortwechsel, von dem er nichts verstehen konnte. Smolder war ein Gentleman der alten Schule, der lautstarke Bemerkungen über andere Anwesende für unverzeihlich schlechtes Benehmen hielt. Rutherford warf einen Blick auf Helen Wilkinson. Sie schien nichts von dem Streit zu bemerken, was umso besser war, denn Rutherford hegte den Verdacht, daß Smolders Beistand Doktor Wilkinson höchst unwillkommen wäre, wie gut gemeint er auch sein mochte. Andere jedoch bemerkten die Auseinandersetzung sehr wohl und unterbrachen ihre Gespräche lange genug, daß ein merkliches Schweigen entstand. Da ertönte im rechten Moment ein aufmerksamkeitsheischendes Hüsteln vom anderen Ende des Raums, und alle Augen wandten sich der Frau zu, die aus dem Konferenzsaal aufgetaucht war.
»O Gott«, stöhnte Ainsley, »sie haben Chambers vorgeschickt.« Sie waren die Mitglieder des universitären Senats, die sich nun in der unangenehmen Situation befanden, etwa ein Drittel des akademischen Personals der zu den Biowissenschaften gehörenden Fachbereiche selbst entlassen zu müssen, eine undankbare Aufgabe, die sie bis zu dessen vorzeitigem Ableben gern Professor Wilkinson überlassen hatten.
Alice Chambers war eine Frau von unbestimmbarem Alter mit einem wirren Schopf brauner Locken, die jedesmal auf und ab hüpften, wenn sie zur Unterstreichung einer Äußerung mit dem Kopf nickte, was sie häufig und mit einigem Nachdruck tat.
»Meine Damen und Herren«, sagte sie, wobei sie sich etwas vorbeugte und auf ihren Fußsohlen balancierte, »ich weiß, daß Sie die betrübliche Nachricht von Professor Wilkinsons Tod inzwischen vernommen haben …« Sie nickte bei den Worten »betrüblich« und »Tod«. Ein kollektives Atemanhalten war die Folge, und Chambers Blick, der so allumfassend in seiner Wahrnehmung zu sein schien wie ein Fischaugenobjektiv, schoß kurz in Helens Richtung, bevor er sich wieder auf das Gros der Zuhörerschaft konzentrierte. Sie ließ sich Zeit, als ob sie im Geiste eine Anwesenheitsliste durchginge. Ihre Augen traten leicht hervor, was die verunsichernde Intensität ihres Blicks noch verstärkte, und viele hatten Schwierigkeiten, ihr ins Gesicht zu sehen. »Leider«, fuhr sie fort und gab ihrer Ansprache aus Rücksicht auf Helens Gefühle eine neue Richtung, »hat der Senat keine andere Wahl, als die geplanten Maßnahmen wie vorgesehen durchzuführen. Die Umstände sind alles andere als ideal, und wir würden das Auswahlverfahren natürlich« ‒ kräftiges Nicken ‒ »gern verschieben, aber die Stellenvergabe muß bis zum Beginn des Sommersemesters abgeschlossen sein, so daß …« Hier unterbrach sie sich kurz und legte statt eines Nickens den Kopf ein wenig schräg. »So daß jeder von Ihnen weiß, woran er ist, wenn das neue akademische Jahr anfängt.«
Sie ließ ihre Augen erneut über die Versammlung schweifen. Einige waren plötzlich ganz fasziniert vom Inhalt ihrer Kaffeebecher, andere verspürten das dringende Bedürfnis, in ihren Aktentaschen zu kramen. Zwei erwiderten ihren Blick direkt: Helen Wilkinson, die Mühe zu haben schien, ihrer Ansprache zu folgen, und Ruth Marks, deren Gesichtsausdruck eine Mischung aus Verachtung und Belustigung widerspiegelte.
»Wir haben noch zwei Wochen, um die … Angleichungen vorzunehmen«, schloß Chambers.
»Wenn sie es Umstrukturierung oder Rationalisierung nennt, bring ich sie um«, sagte Ainsley.
Rutherford warf ihm einen Blick zu, der keinen Zweifel daran ließ, daß er die Bemerkung für geschmacklos hielt. Mallory rief: »Sie wollen also, daß wir die verdammte Farce der Probevorlesungen und -seminare beibehalten?«
Chambers zögerte. Sie hatte nicht damit gerechnet, schon zu einem so frühen Zeitpunkt an dem Selektionsverfahren beteiligt zu werden. Sie hätte erst in der letzten Phase, bei den Einzelgesprächen, mitwirken sollen, nachdem Professor Wilkinson seine Empfehlungen abgegeben hatte. Daher war sie zufrieden gewesen, ihm alles weitere zu überlassen, und er hatte ihr nichts von Vorlesungen und Seminaren gesagt. Würde sie ihr Gesicht verlieren, wenn sie dies offen zugab, oder würde die Offenheit zu ihren Gunsten ausgelegt werden? Sie entschied sich dafür, Mallorys letzte Worte zu wiederholen und zu hoffen, daß er von sich aus Erklärendes hinzufügen würde, ohne daß sie ihre Unwissenheit eingestehen mußte. »Vorlesungen und Seminare …« sagte sie nachdenklich.
»Falls Ihnen die Zeitknappheit Sorgen macht …« warf Rutherford ein. »Wir könnten ein paar Tage gewinnen, indem wir unsere jeweiligen Forschungsprojekte schriftlich in Form eines Antrags oder Exposés darlegen, sodaß eine Grundlage existiert, auf der bei den Einzelgesprächen diskutiert werden kann.«
Ein allgemeines Gemurmel der Zustimmung erhob sich.
»Jedenfalls besser, als uns wie Zirkustiere vor unseren Kollegen vorführen zu lassen.«
Chambers starrte Mallory an, von dem der letzte Zwischenruf stammte. Sie bewunderte die Dreistigkeit dieses Mannes, der nach seinem katastrophalen Abschneiden vor der Evaluierungskommission noch die Stirn hatte, den Mund aufzureißen. Mallory legte ihren Blick als Tadel für seine Kritik an Wilkinsons Methoden aus und starrte mit offener Feindseligkeit zurück.
Aha, dachte Chambers, Wilkinson hatte also von seinen Kollegen erwartet, voreinander um ihre Stellen zu kämpfen. Eine unnötige Demütigung. Unnötig, korrigierte sie sich, außer für Wilkinson, der wegen seiner Rachsucht berüchtigt gewesen war. Sie sah erneut zu Helen Wilkinson hinüber und fragte sich nicht zum ersten Mal, was eine intelligente Frau wie sie nur an einem so anmaßenden und sadistischen Mann gefunden haben mochte. Helen seufzte und nippte an ihrem Kaffee. Er mußte inzwischen kalt sein, aber sie schien es nicht zu bemerken, war ganz in ihre Gedanken versunken.
Er protzte mit seinen Affären. Sie machten ihm keinen Spaß ohne den zusätzlichen Kitzel andere zu verletzen, indem er sie wissen ‒ oder zumindest ahnen ‒ ließ, was vorging. Edward versäumte nie eine Gelegenheit, andere zu demütigen. Er liebte es, zufällige Begegnungen zu arrangieren, um sich an der Situation zu weiden, den Verdacht zu schüren und die Schmach noch zu steigern.
Nun, das war einmal zuviel, Edward.
Plötzlich ertönte ein Ausruf von der entgegengesetzten Seite des Raums, und Miss Chambers wandte ihren Blick bedauernd von Helens hübschem, gequältem Gesicht ab. John Ellis war aufgesprungen und zur Kaffeemaschine gestürmt, Helens Augen folgten ihm mit gedankenverlorener Ausdruckslosigkeit. Mallory versuchte, ihn aufzuhalten, als er an ihm vorbeikam, aber Ellis schüttelte ihn ab. Er schenkte sich Kaffee nach und drehte sich wieder zu der Versammlung um, die ihn schweigend beobachtete. Ainsley sah fasziniert zu, als Ellis ein paar Schritte in den Raum hinein tat und Helen ansprach:
»Ich weiß nicht, warum Sie gerade mich so anstarren«, zischte er. »Können Sie mich nicht in Ruhe lassen?« Das akademische Publikum war zwiegespalten: Die Mehrheit fühlte sich von dem Auftritt peinlich berührt, aber einige wenige genossen ihn und waren enttäuscht, als Tuttle sich von seinem Platz neben der Maschine erhob und auf Ellis zuhumpelte. Er sagte mit gesenkter Stimme etwas zu ihm, worauf Ellis ängstlich blinzelte und fluchtartig den Raum verließ.
Sein Abgang löste aufgeregte Unruhe aus, wie bei einem Schwarm Stare, der von einer vorbeifliegenden Eule aufgeschreckt wird, doch dann ergriff Miss Chambers wieder das Wort.
»Eine Zusammenfassung Ihrer Arbeit von etwa fünfzehnhundert Wörtern, die einen Überblick über Inhalt und Ziele sowie in Frage kommende Förderer oder andere Geldquellen gibt, wäre vollkommen ausreichend«, sagte sie mit einem abschließenden Nicken und verschränkte ihre Hände. »Sagen wir, bis Ende der Woche? Gut. Ansonsten sollten die Fachbereichsleiter inzwischen ihre Rechenschaftsberichte und Anträge auf neue Mittel zur Begutachtung vorlegen können. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, kann der Rest jetzt gehen. Die Fachbereichsleiter oder ihre Vertreter finden sich bitte« ‒ sie sah auf ihre Armbanduhr ‒ »in zehn Minuten am Konferenztisch ein.«
Auf ihrem Weg zum abgeteilten Konferenzbereich blieb sie kurz stehen. »Es tut mir so leid wegen Edward, Helen.«
Helen sah verwirrt auf. »Wirklich?« fragte sie. Sie schien überhaupt nichts von dem Geschehen um sie herum mitzubekommen. »Warum?«
Alice Chambers blinzelte. »Warum? Aber meine Liebe«, stammelte sie und suchte nach den passenden Platitüden, »er war ein großartiger Wissenschaftler. Er hätte der neuen Fakultät vorstehen sollen …«
»Ach so, natürlich«, sagte Helen.
Chambers war ganz aus der Fassung gebracht. Sie fragte sich, ob die andere sich über sie lustig machte, aber dann sprach Helen in einem Ton weiter, der keinen Zweifel daran ließ, daß ihre Verwirrung echt gewesen war: »Ich verstehe, es wird schwierig sein, so kurzfristig einen Ersatz zu finden.«
»Nein, das meinte ich nicht …« Sie hatte dieser Frau, mit der sie keinerlei Gemeinsamkeit und erst recht kein Verständnis verband und deren Mann ihr ausgesprochen unsympathisch gewesen war, nur ein paar Worte des Beileids sagen wollen, um dann zur Tagesordnung überzugehen und ihren Pflichten als Verwaltungsleiterin und Kollegin nachzukommen. Diese seltsame Reaktion hatte sie nicht erwartet, und sie wußte nicht, wie sie damit umgehen sollte.
Ruth Marks griff ein. »Helen ist nicht ganz bei sich heute morgen, Miss Chambers. Sie hätte wirklich nicht kommen sollen.«
»Ganz recht«, pflichtete Chambers ihr bei und schüttelte mißbilligend die Locken.
»Ich muß doch wissen, was mich erwartet… das Auswahlverfahren. Ob ich entlassen werde«, sagte Helen mit dieser träumerischen Entrücktheit, die Alice Chambers so beunruhigend fand. »Wenn ich arbeitslos werde, muß ich das Haus verkaufen und mich nach einer neuen Stelle umsehen.«
Miss Chambers Augenbrauen schossen überrascht nach oben. Konnte die Witwe wirklich an ihre berufliche Sicherheit denken, einen Tag, nachdem ihr Mann ermordet worden war? Ruth Marks schien ihre Gedanken zu lesen. »Du redest Unsinn, Helen«, sagte sie. »Ich werde dich nach Hause bringen. Vielleicht sollte ich Doktor Patterson anrufen.«
»Ehe Sie gehen …« sagte Chambers und erinnerte sich an den anderen Grund für ihren Umweg durch die Kaffeebar. »Hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit für mich?« Ihre Augen schnellten durch den Raum.
Neugierig geworden, legte Ruth den Kopf schräg und sah auf die zwei Köpfe kleinere Verwaltungsleiterin herunter. »In Ordnung.« Als sie sich umwandte, um nach Helen zu sehen, starrte diese stirnrunzelnd auf ihre Hände, schon wieder meilenweit entfernt von der Wirklichkeit. Ruth seufzte und folgte Miss Chambers in den Konferenzsaal.
»Ich wende mich an Sie, weil ich weiß, daß ich eine objektive Antwort bekommen werde.«
»Geschickter Eröffnungszug«, entgegnete Ruth lächelnd. »Eine Schmeichelei, verpackt in eine Bitte um Ehrlichkeit.«
»Keine Schmeichelei«, sagte Chambers ernst. »Da Sie uns verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen und daher nichts mit dem Auswahlverfahren zu tun haben, glaube ich, auf Ihre Offenheit zählen zu können. Aus Doktor Mallorys Äußerung schließe ich, daß Professor Wilkinson plante, diejenigen Kollegen, die eine Weiterbeschäftigung innerhalb der Fakultät wünschen, zu verpflichten, ihre Arbeit und ihre Forschungsvorhaben vor den anderen Kollegen zu präsentieren?«
Ruth antwortete nicht sofort. »Das sah Edward ähnlich, Ihnen nichts davon zu sagen. Und es sieht dem Senat ähnlich, keine Fragen zu stellen.« Sie warf Chambers, die immerhin den Anstand hatte, ein verlegenes Gesicht zu machen, einen boshaften Blick zu. »Mallory hat einmal in seinem erbärmlichen Leben etwas Wahres gesagt. Eine abstoßende Vorstellung, nicht wahr?« Die zweideutige Bemerkung war an Miss Chambers verschwendet, der nur an einer direkten Antwort auf ihre Frage gelegen war. Ruth seufzte. »Edward hat gestern morgen alle zu sich bestellt und ihnen gesagt, daß sie eine Vorlesung vor ihren Kollegen halten und eine Plenarsitzung leiten müßten, bei der sie ihre Arbeit präsentieren sollten. Teilnahmepflicht für alle. Eine geheime Abstimmung sollte auf jede Präsentation folgen. Von unseren vorzüglichen Gelehrten wurde also erwartet, bei genau den Kollegen um eine Weiterbeschäftigung zu buhlen, die sie arbeitslos machen würden, wenn ihr Vortrag überzeugte.«
Miss Chambers dünne Lippen wurden zu einem Strich. »Sie selbst waren jedoch zweifellos von diesem … Verfahren ausgenommen.«
Ruth empfand Genugtuung darüber, daß die Verwaltungsleiterin ihren Abscheu kaum verbergen konnte. Sie lächelte knapp. »Er räumte mir allerdings das Stimmrecht ein. Ganz unter uns, ich glaube, daß Ed sich längst entschieden hatte, wen er dem Senat empfehlen würde. Aber der Gute liebte es, zu teilen und zu herrschen. Sie werden in den Fachbereichen, die Sie so stark beschneiden wollen, kaum noch Leute finden, die einander über den Weg trauen, Miss Chambers.« Daraufhin mußte sie sich ein paar Minuten lang Alice Chambers’ Erklärungen über Rationalisierungen und eingeschränkte Studentenzahlen, die Schwierigkeiten einer umfassenden Betreuung, die Geräte- und Ausstattungskosten in den angewandten Naturwissenschaften, Pro-Kopf-Zuschüsse, Drittmittel und Wirtschaftsförderung anhören.
»Einige Fachbereiche haben bei der letzten Bewertung der Forschungsleistungen durch die Evaluierungskommission sehr schlecht abgeschnitten«, fuhr Miss Chambers fort. »Als Ergebnis werden die staatlichen Mittel entscheidend gekürzt werden. Wir müssen Personalreduzierungen vornehmen, um mit unserem Budget auszukommen, aber auch um für die Zukunft vorzubauen und bei der nächsten Evaluierung ein besseres Abschneiden sicherzustellen.«
»Früher ging es in den Universitäten einmal um wissenschaftliche Leistungen«, bemerkte Ruth, als sie genug gehört hatte. »Nicht um Budgetausgleich und Drittmittel. Wissenschaftler konnten forschen, ohne ihr Interesse ständig durch kommerzielle Verwertbarkeit rechtfertigen und sich durch möglichst viele Veröffentlichungen im Gespräch halten zu müssen. Und was ist eigentlich aus der Lehre geworden? Was ist mit Leuten, die den Studenten hervorragende Lehrer sind? Wird deren Beitrag gar nicht mehr anerkannt?«
Miss Chambers kräuselte spöttisch die Lippen. »Ihre Loyalität ist wirklich herzerwärmend, Doktor Marks …«
Ruth lachte. »Ich möchte Sie nicht enttäuschen, Miss Chambers, aber ich rede nicht von Mallory. Er ist ein fauler, alter Sack, der dachte, er könne sich die nächsten fünf Jahre bis zu seiner Pensionierung noch so durchmogeln. Nein, ich spreche von den armen jüngeren Kollegen, die vor lauter Vorlesungen und Tutorien und Seminaren und Hausarbeitsgutachten nicht mehr ein noch aus wissen ‒ sie haben Gruppen zu betreuen, die dreimal größer sind als zu der Zeit, als ich an der Universität zu lehren anfing.«
»Effizienz«, nickte Miss Chambers nachdrücklich, »wird von manchen Leuten offenbar für ein Schimpfwort gehalten.«
»Das hat nichts mit Effizienz zu tun. Sehen Sie das doch ein. Menschen zu überfordern ist nicht effizient. Wir sind eben keine Maschinen. Sie können uns nicht an den Rand der Erschöpfung treiben und obendrein erwarten, daß wir noch genug Kreativität und Inspiration besitzen, um die Forschungsleistungen und Veröffentlichungen zu erbringen, die Ihre Bewertungskriterien von uns fordern. Ich möchte wissen, wie Sie einen Wissenschaftler Doktor X, der irgendwelchen Leuten für einen Forschungszuschuß in den Arsch kriecht, gegenüber einem Doktor Y bewerten würden, der einen neuen Weg auf seinem Gebiet geht, eine neue Perspektive eröffnet. Wissen wurde einmal als erstrebenswertes Ziel an sich erachtet. Es war unsere Aufgabe, Fragen zu stellen, das Geheimnis des Lebens zu erforschen. Eine sentimentale Auffassung, was? Geradezu peinlich. Aber nicht peinlicher, kann ich Ihnen versichern, Miss Chambers, als mit der Mütze ‒ oder sollte ich sagen mit dem Doktorhut? ‒ in der Hand um Fördergelder zu betteln. Wir verbringen mehr Zeit damit, vor unseren Sponsoren zu kriechen, als zu forschen oder etwa ‒ welch vermessener Gedanke ‒ zu lehren.«
Alice Chambers schien angestrengt nachzudenken, ehe sie auf diese Rede antwortete. »Ich empfinde eine gewisse Sympathie für Ihre Ansichten, Doktor Marks, aber wir haben es hier mit der Wirklichkeit zu tun.«
»Mit der Wirklichkeit des akademischen Rechnungswesens, ja …« Ruth unterbrach sich. Mallory war hereingekommen. Er sah sie mit dem ängstlich besorgten Blick an, den ihre Erstsemesterstudenten bei ihren ersten Experimenten mit elektrischer Reizung zeigten. Sie wußten, daß das Tier tot war und ihnen nichts tun konnte, aber sein Anblick war seltsam verstörend, und vielen machte das Zucken eines toten Wirbeltierglieds mehr zu schaffen als die vorausgehende Präparierung. Mallory hatte allen Grund mißtrauisch zu sein, wenn er ein rangjüngeres Mitglied seiner Abteilung ‒ vor allem eines, das nichts mehr zu verlieren hatte ‒ ins Gespräch mit einer hochrangigen Vertreterin der Senatsverwaltung vertieft sah. Als angestellter Wissenschaftler, der auf die Sechzig zuging und seit fünf Jahren nichts Bemerkenswertes und seit zwei Jahren überhaupt nichts mehr publiziert hatte, hatte er noch mehr Grund zur Sorge. Er hatte nichts vorzuweisen, nichts, das den Senat davon überzeugen konnte, seine Arbeit bis zur nächsten Evaluierungsrunde, nach der er einvernehmlich in den Ruhestand entlassen werden konnte, durch neue Gelder zu unterstützen. Seine Hoffnung darauf, daß die verrückten Ideen seines Assistenten Ellis etwas hervorbringen würden, das zur Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift geeignet wäre, machte nur noch deutlicher, wie sehr sich der Mann auf dem absteigenden Ast befand.
David Ainsley überlegte, ob er nach Hause fahren und versuchen sollte, sich wieder mit Clara zusammenzuraufen. Er hatte Helen Wilkinson mit diesem rotgesichtigen, pockennarbigen Polizisten Weggehen sehen und fühlte sich nicht in der Verfassung, selbst eine Befragung über sich ergehen zu lassen. Er verließ das Zoologiegebäude und trat durch eine Pforte in die belaubte Gasse auf seiner Rückseite. Der böige Wind des Vortags mit seinem schnellen Wechsel von Sonne und Schauern hatte sich gelegt, und ein strahlender Morgen war von trübem, grauem Wetter vertrieben worden. Die Wolken hingen in schweren, dunklen Schichten tief am Himmel, unbeweglich wie erstarrter Rauch, und verhießen Regen. Er schlug seinen Mantelkragen hoch und sah zuerst nach links, in Richtung seines Zuhauses, dann nach rechts, in Richtung seines Büros im Gebäude des Fachbereichs Ökologie und Umweltwissenschaften. Er entschied, daß er sich im Moment nicht mit Clara zusammenraufen wollte. Er wußte nicht einmal, ob er das überhaupt je wieder wollte.
Er konnte nicht so tun, als ob er Edwards Tod bedauerte ‒ der Mann hatte ihn verdient. David bedauerte höchstens, daß sein Ende so schnell und leicht gewesen war. Und was jetzt? Die Boulevardpresse würde sich mit Gusto saftige Schlagzeilen ausdenken. Er hatte den Eindruck, daß diese Blätter nur eines mehr haßten als erfolgreiche Menschen, und das waren Intellektuelle. Sie würden sämtliche schmutzigen Geheimnisse aufdecken und sie mit hämischer Befriedigung drucken.
Er nahm ein paar Fachzeitschriften zur Hand und trug sie in die Bibliothek. Dort war es ruhig, die meisten Erst- und Zweitsemester waren über die Ferien nach Hause gefahren, aber David konnte sich nicht konzentrieren. Schließlich fand er sich in der Horace-Shelby-Cafeteria wieder, mit einem Tablett in der Hand und einem leicht verwirrten Ausdruck auf dem Gesicht, wie er im Spiegel hinter dem Tresen erkennen konnte. Die Cafeteria war einer der beliebtesten Treffpunkte des Campus. Das Essen schmeckte deutlich besser als in der Mensa, wenn es auch dreimal so teuer war, und es gab zusätzlich selbstgebackenen Kuchen, Kekse und frisch gemachte Sandwiches. Sie befand sich im Souterrain der Bibliothek, war erst kürzlich renoviert worden und hatte ein luftiges, modernes, japanisch angehauchtes Flair. Die Tische standen nicht zu dicht beieinander, und die meisten waren leer, so daß Ainsley nicht Gefahr lief, sich in Gesellschaft eines der Kollegen begeben zu müssen, die er hier und dort im Raum verstreut sah. Er konzentrierte sich mit finsterer Entschlossenheit auf die Wandtafel mit den Speisen und Getränken und runzelte abweisend die Stirn, während er seine Wahl traf. Dann setzte er sich an einen der abgelegensten Tische und versuchte, jeglichen Augenkontakt mit anderen Dozenten zu vermeiden. Es gelang ihm jedoch nicht ganz, Ruth Marks zu ignorieren, die mit einem Studenten aus einem ihrer Tutorien zusammensaß. Sie schien einen Aufsatz oder eine Hausarbeit durchzugehen. Nachlässig Kaffee über die Seiten verschüttend und Krümel darauf verteilend saß sie minutenlang schweigend da, um dann in stakkatoartige Redeschwälle auszubrechen, während der Student respektvoll nickte, sich Notizen machte und besorgte Blicke auf sein immer schmuddeliger aussehendes kostbares Manuskript warf.
Plötzlich hob Ruth den Kopf und lächelte zu ihm hinüber. Ainsley sah schnell weg und verschanzte sich hinter einer liegengelassenen Zeitung. Auf der Titelseite prangte das Foto eines lächelnden, gutaussehenden Wilkinson. Spontan riß er es heraus und machte zuerst schmale Papierstreifen, dann winzige, schwarzweiße Konfettistücke daraus. Er versuchte sich zu sagen, daß Wilkinson jetzt niemandem mehr weh tun konnte, fand aber weder Beruhigung noch Trost in diesem Gedanken. Edward, fürchtete er, würde wie ein Schadstoff ins Grundwasser sickern und ihrer aller Leben vergiften.
Kapitel 5
Ruth fand Helen in ihrem Büro. Sie hatte die vergangene Stunde damit verbracht, nach der Freundin zu suchen, war von Leuten, die sie hier und da gesehen hatten, von einem Ende der Abteilung zum anderen geschickt worden und hatte es schließlich sogar bei ihr zu Hause versucht.
Helen saß an ihrem Schreibtisch, die Arme um sich geschlungen, als fröre sie. Ihre Lippen zeigten eine bläuliche Färbung, ihr Gesicht war aschfahl. Ruth griff zum Telefon und wählte die Nummer von Pattersons Praxis, dann zog sie einen Stuhl neben Helen und legte ihr beide Hände auf die Schultern. Helen zuckte zusammen, sah auf und lächelte entschuldigend.
»Ich kann nicht aufhören zu zittern«, sagte sie.
»Das sehe ich. Wo bist du bloß gewesen?«
Helen blickte ängstlich über ihre Schulter. »Inspector Nelson …«
»Dieses Schwein!« brüllte Ruth. Helen fuhr zusammen und stieß einen kleinen Schrei aus. »Ist schon gut.« Ruth tätschelte beschwichtigend ihre Schulter. »Mein Gott, er hat dir einen ganz schönen Schrecken eingejagt, was?«





























