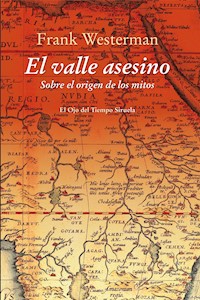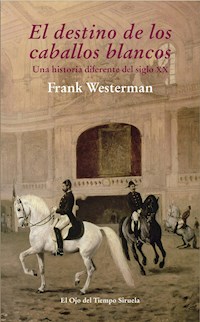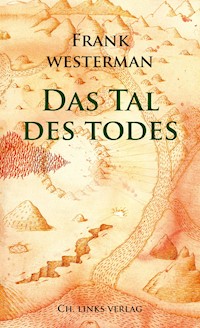
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Politik & Zeitgeschichte
- Sprache: Deutsch
Am 21. August 1986 ereignet sich im malerischen Tal von Nyos im Nordwesten Kameruns eine der rätselhaftesten Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts: 1746 Menschen sterben, Vögel fallen tot von den Bäumen, 3500 Rinder, Paviane und andere Tiere verenden innerhalb weniger Stunden. Was hat diese Tragödie ausgelöst? Nach mehr als 30 Jahren hat sich ein Gespinst von Geschichten über das Geschehen gelegt und immer neue Mythen sind entstanden. Doch was sind die Fakten? Und wie können aus den gleichen Fakten die unterschiedlichsten Geschichten entstehen?
Frank Westerman geht allen Spuren nach und betrachtet das Massensterben aus den Perspektiven der Wissenschaftler aus aller Welt, der Einheimischen und der Missionare vor Ort. Dabei gelingt ihm eine faszinierende und hochspannende Erkundung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
FRANKWESTERMAN
DAS TALDES TODES
Eine Katastrophe undihre Erfindung
Aus dem Niederländischen von Thomas Hauthund Verena Kiefer
Die Originalausgabe erschien 2013im Verlag De Bezige Bij, Amsterdam© Frank Westerman 2013(www.frankwesterman.nl)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnetdiese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überwww.dnb.de abrufbar.
© der deutschen Ausgabe als E-Book:
Christoph Links Verlag GmbH, September 2018entspricht der 1. Druckauflage vom September 2018Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0www.christoph-links-verlag.de; [email protected]: Beate Clausnitzer, BerlinKarte: Peter Palm, Berlin
Cover: Eugen Bohnstedt, Ch. Links Verlag, unterVerwendung einer Illustration aus The Conference of the Birds von Peter Sís
eISBN 978-3-86284-432-6
Inhalt
Prolog
I Mythentöter
II Mythenbringer
III Mythenmacher
Epilog
Quellennachweis und Danksagung
Über den Autor
Prolog
Es war die Zeit der großen Völkerwanderungen. Die Kom kamen aus dem Osten. Keiner weiß, weshalb sie ihre Bohnenfelder und Beete mit Cocoyams eines Tages im Stich ließen. Lag es an den Kameltreibern aus Darfur, die Frauen und Kinder raubten? Oder herrschte dort die von Fadenwürmern ausgelöste Flussblindheit?
Eines Tages nahmen die Kom ihre Töpfe und Pfannen, ihre Stoßhacken und ihre Vorräte an Mais und Maniok auf den Kopf. Parallel zum Äquator machten sie sich auf den Weg nach Westen. Alle Frauen und Mädchen trugen ein Kleinkind oder Baby in einem Tuch auf dem Rücken. Vorsichtig watend, im Bogen um die badenden Nilpferde, durchquerten sie den Fluss, der ihr Land begrenzte. Manchmal mussten sie kurz anhalten. Dann wurde jemand begraben oder geboren, und die anderen konnten sich ausruhen.
Auf der anderen Seite des Flusses zogen die Kom in die Berge, hintereinander, in einer langen Reihe. Der Wald öffnete sich, machte hügeliger Savanne und hier und da einer im Elefantengras verborgenen Siedlung Platz. Ihr Anführer, der Fon, schickte immer wieder Kundschafter aus, Krieger, die mit Speeren ausgestattet waren. Bei einem Rascheln oder drohender Gefahr tauchten sie die Eisenspitzen in Kobragift. Aber sie trugen auch Kalebassen mit Palmwein bei sich. Begegneten sie einem friedliebenden Volk (was man aus weiter Ferne am ruhigen Rhythmus der Trommeln hören konnte), ließen sie eine Kalebasse herumgehen, und alle lachten.
Auf der Ebene von Ndop, wo viele Raphiapalmen wachsen, trafen die Kom auf die Bamessi. Der Anführer des Bamessivolks hieß die Auswanderer überschwänglich willkommen und lud sie ein, in seinem Land zu wohnen. Wie viele Monde waren sie unterwegs gewesen? Keiner wusste es noch.
In der Nacht nach ihrer Ankunft hatte der Mond »sein Antlitz hinter einem Bananenblatt verborgen«: Alte Kalender von Eklipsen verzeichnen für das Jahr 1735 eine vollständige Mondfinsternis. In diesem Jahr müssen sich die Kom auf der Ebene von Ndop niedergelassen haben. Das Herz Afrikas war noch unversehrt, aber die Portugiesen, die Dänen und die Holländer nagten schon überall wie fleischfressende Fische an den Rändern des Kontinents. Die Sklavenjagd drang immer tiefer ins Land vor.
Konnten die Bamessi Verstärkung gebrauchen? Suchten sie Geborgenheit in der größeren Zahl? Wenn das die Absicht des Fons der Bamessi gewesen war, schien sie von Erfolg gekrönt. Die Kom vermehrten sich. Ihre Fruchtbarkeit war enorm, es war fast, als wagten sie sich an eine Aufholjagd, um den Mangel an Geburten während ihrer Wanderung auszugleichen. Die ersten zehn, fünfzehn Jahre verliefen harmonisch, aber danach befürchteten die Bamessi allmählich, ihre Gäste würden von einer Minderheit zu einer Mehrheit werden. Zu einer Bedrohung. Ihre Expansion weckte den Neid der Bamessi, die immer näher zusammenrücken mussten. Um der Bevölkerungsexplosion entgegenzuwirken, ließ der Fon der Bamessi den Fon der Kom in seinen Palast kommen. Auf seinem mit Leopardenfell gepolsterten Thron sitzend, schlug er eine Entvölkerungsmaßnahme vor: Beide Fons würden jeweils ein Gemeinschaftshaus bauen und all ihre Männer darin zusammenrufen. Sobald diese in den Häusern wären, würden sie die Tür verriegeln und die Häuser anzünden.
Jung und Alt, alle arbeiteten mit. Die Dächer bestanden aus riesigen Schilden verwobener Bambusstängel, zusammengebunden mit Sisal, bedeckt mit getrocknetem Schilf. Bei der Einweihung kamen die Männer in Scharen und drängten hinein, nicht wissend, was sie erwartete. Beide Fons entzündeten mit Fackeln ihre Bauwerke und opferten so ihre Söhne für das Überleben des Stammes. Ein trauriges, aber notwendiges Opferfeuer flammte auf. Funken schossen in die Höhe, und über das Prasseln der Flammen hinweg war das Wimmern der Männer zu hören.
Seltsamerweise kam aus dem Gemeinschaftshaus der Bamessi kein einziger Schrei, obwohl es ebenfalls in Schutt und Asche gelegt wurde. Die Männer waren über eine verborgene Hintertür entkommen.
Der Fon der Kom, in unendlicher Wut über den Betrug, zog sich in die Raphiawälder zurück. Er sang ein Trauerlied nach dem nächsten und dachte nach. Seiner Schwester Nandong – die einzige, die ihn besuchte – erzählte er seinen Plan, die Kom zu rächen. Er würde sich aufhängen. Niemand dürfe ihn abschneiden und begraben. »Eines Tages wird eine Python erscheinen«, sagte er. »Folgt ihr. Ruht euch aus, wo die Python sich ausruht. Kriechend werde ich euch in das Land führen, wo mein Volk wohnen wird.«
Der Fon hängte sich an einem Ast auf. Es dauerte nicht lange, da tropften Blut und Galle an seinen Füßen hinunter. Seine Körpersäfte bildeten eine Pfütze, die Pfütze wurde zu einem Pfuhl und der Pfuhl zu einem See. Die Maden, die aus der Leiche schlüpften, fielen gesättigt in den See und änderten ihre Gestalt – sie wurden zu Fischen.
Ein Bamessi-Jäger, der die Ufer des neugebildeten Sees erkundete, entdeckte die Fische als erster. Er verständigte seinen Fon. Das Wasser funkelte nicht nur im Sonnenlicht, es brodelte und spritzte nur so von wedelnden Schwanzflossen. Nachdem die königlichen Ratgeber das Wesen des Sees als gutartig beurteilt hatten, kündigte der Fon der Bamessi einen allgemeinen Fischereitag an. Alle Jungen und Männer versammelten sich mit Körben am Ufer. Auf ein Zeichen des Fons liefen sie bis zur Taille ins Wasser und begannen, wild mit ihren Körben um sich zu schöpfen. Sie ahnten nicht, dass die Stunde der Rache angebrochen war. Mitten im Tumult, dem Plätschern und den anfeuernden Schreien der Kinder erhob sich der See aus seinem Bett, zerplatzte in Nebeln und versank in einem Erdloch, wobei er alle Bamessi-Fischer mit sich riss.
Wenig später kroch eine Python aus dem Gebüsch. Nandong und ihre Schicksalsgefährten nahmen ihre Habe und folgten der schwarzgelben Schlange. Als das dezimierte Volk der Kom nach zwei Monaten auf einem gefältelten, majestätisch herausragenden Bergrücken ankam, sah Nandong, wie die Python in einer Höhle im Boden verschwand. An dieser Stelle ließ ihr Sohn Jinabo I. einen Palast bauen. Das war im Jahr 1755.
Der von einer Mauer umgebene, aus Lehmblöcken errichtete Königssitz – mit Tempeln, Gerichtsgebäuden und Haremshütten – blickt unnahbar über das Land der Kom: eine Handvoll grüner Täler, übersät von blauen Seen.
RÄTSELHAFTES STERBEN TRIFFT AFRIKANISCHES TAL
Jaunde, 25. August 1986 – In einem abgelegenen Tal in Westkamerun sind aufgrund einer noch unbekannten Ursache mindestens 1200 Menschen ums Leben gekommen.
Die Tragödie ereignete sich in der Nacht vom 21. auf den 22. August im Nyos-Tal, rund dreihundert Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Jaunde.
Die meisten Opfer sind offenbar im Schlaf gestorben. Spuren von Verwüstungen an Häusern oder Pflanzen sind nicht zu erkennen. Jedoch sollen im Tal zahllose Tiere tot vorgefunden worden sein, darunter Rinder, Vögel und Insekten.
Radio Kamerun meldet, dass mit Gasmasken und Sauerstoffflaschen ausgestattete Rettungsteams das betroffene Gebiet zu erreichen versuchen.
Hunderte Verwundete sind mittlerweile in ein Krankenhaus der Stadt Wum gebracht worden. Ein behandelnder Arzt beschreibt die Symptome als »blasenartige Geschwüre« und »Zeichen von Ersticken wie durch Würgen«.
Am Abend des 21. August war in der entfernteren Umgebung eine Explosion zu hören gewesen. Augenzeugen berichten, das klare Wasser des nahegelegenen Nyos-Sees habe sich rot gefärbt, nachdem ein plötzlich auffrischender Wind riesige Wellen verursacht habe.
Zwei Jahre zuvor, am 15. August 1984, hatten 37 Plantagenarbeiter am Manoun-See, hundert Kilometer südöstlich vom Nyos-See, den Tod gefunden. Auch die Ursache dieses Sterbens ist noch immer nicht geklärt. (BBC, Reuters)
I
MYTHENTÖTER
1.
Am 7. Dezember 2010 war ich abends verabredet, doch das Treffen kam nicht zustande. Ich war speziell dafür nach Paris gekommen, in der Hoffnung und Erwartung, diese Geschichte damit zu beginnen.
Unterwegs im Zug, über die nordfranzösischen Ebenen jagend, schlug ich die Zeitung auf. Eine Zeitlang starrte ich auf ein Close-up der Sonne, aufgenommen von der NASA. Aus dem Ball schoss eine Sonnenflamme aus gelborangen Schlieren, »ein Feuerausbruch, der den irdischen Datenverkehr aus dem Gleis werfen könne«, der aber – wie immer – auf der kosmischen Skala nicht einmal ein leichtes Kräuseln zuwege brachte.
Draußen verlief der Tag sonnenlos. Es war Schnee vorhergesagt und er kam auch. Die ersten Flocken fielen, als ich auf dem Gare du Nord den Bahnsteig betrat – das Endstück des Thalys passte nicht unter die Überdachung. Bis ich mein Hotel erreichte, hatte sich Paris in eine beschneite Weihnachtskulisse verwandelt, märchenhaft beleuchtet, aber mit schmutzigen Rändern. Auf Bürgersteigen und Treppen zur U-Bahn lag angetauter Schnee, der in der fallenden Dämmerung weiß aufleuchtete. Auf der Straße hatten es alle eilig. Der Strudel roter Rücklichter auf der Place de la Concorde drehte sich fest.
Bei meinem Treffen in Paris sollte es um die Bergseen von Kamerun gehen und ihre Fähigkeit, Tod und Verderben zu säen. Vor etlichen Jahren, 1992, hatte ich darüber eine Radioreportage gemacht. Das Ergebnis – 45 Minuten Geräusche, Gesänge und Gespräche – war eine Momentaufnahme. Oder, wie ich es jetzt sehe: eine Vorstudie. Der Knall war verebbt, die Leichen begraben, aber eine schlüssige Erklärung war ausgeblieben. Über eine Länge von 18 Kilometern war das Totental von Nyos noch immer ein von der Armee bewachtes Sperrgebiet – mit der Folge, dass sich die Geschichten über das, was sich 1986 dort ereignet hatte, ungestört verzweigen und fortpflanzen konnten.
Auf dem Weg zu meiner Verabredung hob ich Geld ab. Das Restaurant, in dem ich um acht Uhr abends sein sollte, würde ich an einem Holzschaf am Eingang erkennen. Es lag an einem Platz im Schatten der Basilika Sainte-Clotilde und hieß »Le Basilic«.
Das Schaf stand da.
2.
Folgendes wusste ich bereits:
In seinem Haus in Paris, am Quai de Bourbon 15, schaltet Haroun Tazieff am frühen Montagmorgen des 25. August 1986 das Radio ein. Der Nachrichtensprecher berichtet von »mindestens 1200 Toten« in einem Tal im Westen Kameruns. Die Opfer scheinen im Schlaf von einem giftigen Nebel überrascht worden zu sein, der vermutlich am 21. August aus einem Bergsee – »le lac Nyos« – ausgetreten war.
Kurz nachdem Tazieff dies in den Nachrichten hört, klingelt das Telefon. Er nimmt das Gespräch in seinem Arbeitszimmer entgegen und hat die Agence France Presse an der Strippe. Der diensthabende Redakteur bittet ihn um einen Kommentar zu der mysteriösen Katastrophe. Eine Explosion sei zu hören gewesen, ein See habe seine Farbe verändert, und plötzlich seien Mensch und Tier in beträchtlicher Zahl gestorben.
Tazieff sagt ohne Zögern, sie seien in einer Kohlendioxidwolke erstickt, dem Gas, das wir ausatmen.
»Le gaz toxique est du gaz carbonique«, selon le vulcanologue français Haroun Tazieff.
»Das giftige Gas ist Kohlendioxid«, so der französische Vulkanologe Haroun Tazieff.
So steht es in dem AFP-Bericht, der um 8.49 Uhr an diesem Montagmorgen um die Welt geht. Das ist eine Premiere: Während Reuters und AP, die Nachrichtenkonkurrenten, noch dabei sind, die spärlichen Fakten zusammenzutragen, berichtet AFP bereits über den Hergang.
Kohlendioxid, verdeutlicht der weltweit renommierteste Vulkanologe Haroun Tazieff, ist anderthalb Mal schwerer als Luft. Tritt es in reiner Form auf, strömt es über den Boden, wobei es wie Wasser nach dem niedrigsten Punkt strebt. Er selbst sei einmal auf einer Kongo-Expedition von einer solchen unsichtbaren CO2-Wolke umhüllt worden und »buchstäblich knock-out« gegangen. Wer da nicht sofort rauskomme, sterbe einen Erstickungstod – mit dem einzigen Trost, dass dieser schmerzlos ist.
3.
Acht Zeitzonen östlich des Meridians von Paris stimmt Haraldur Sigurdsson seinen Weltempfänger auf die Frequenz von BBC WORLD ab. Er schaut aus 2800 Metern Höhe über den Java-See.
Sigurdsson, 47, flachsblond, sitzt vor seinem Zelt auf dem Kamm des Tambora im Indonesischen Archipel – ein Isländer in den Tropen. Sobald er die Meldung aus Kamerun vernimmt, gerät er völlig aus dem Häuschen. Sigurdsson ist drauf und dran, seinen Trägern zu befehlen, alle Gerätschaften einzupacken und zur Küste abzusteigen. Es beginnt bereits zu dämmern. Frühestens am Mittwoch, dem 27. August, könnte er ein Boot nach Bali und von dort ein Flugzeug bekommen. Er berechnet, dass er eine Woche bräuchte, um das Katastrophengebiet zu erreichen. Aber das Adrenalin, das durch seinen Körper schießt, ist vergeudet: Er ist an seinen Vertrag mit der University of Rhode Island gebunden.
Im Laufe des Abends weicht seine Erregung der Wut, und als die Wut verebbt, steigt Groll in ihm auf. Haraldur Sigurdsson, der einzige westliche Wissenschaftler, der die tödlichen Tücken der Kamerunischen Seen erklären zu können glaubt, sitzt auf Sumbawa, Indonesien, fest.
4.
Nachdem Haroun Tazieff dem Journalisten von AFP Rede und Antwort gestanden hat, widmet er sich seiner Nassrasur. Dieser feste Zeitpunkt vor dem Spiegel gehört zu seinem Morgenritual. Da Tazieff der französischen Regierung bis vor vier Monaten als Staatssekretär für Katastrophenvorsorge angehörte, ist sein Draht zur Macht noch immer kurz. Gleich nach dem Rasieren nimmt er Kontakt mit der entsprechenden Abteilung im Außenministerium am Quai d’Orsay am Südufer der Seine auf.
Die französische Diplomatie ist bereits seit dem Wochenende in Bewegung. Am Samstagabend, dem 23. August, hatte Roger Vanni, General der kamerunischen Armee, den Militärattaché der französischen Botschaft in Jaunde über das Erlöschen allen Lebens in einem Tal im Nordwesten seines Landes informiert. Ein verschlüsselter Bericht darüber mit dem Vermerk »immédiate« – sofort – geht erst vierundzwanzig Stunden später über den Äther, weil der Botschafter frei hat. Ganz Frankreich ist im Urlaub. Trotzdem werden verschiedene Pariser Behörden ab Sonntag, dem 24. August, aktiv:
–Es muss eine Beileidsbekundung für die Angehörigen der Opfer in der ehemaligen Kolonie aufgesetzt werden.
–Es muss ein konkretes Hilfsangebot gemacht werden, sowohl in französischen Francs als auch hinsichtlich benötigter Güter (Gasmasken, hat Jaunde wissen lassen; oder in den Worten von General Vanni: »Ausrüstungen, um das Gebiet betreten zu können«).
–Der Botschafter muss aus seinem Urlaub in Aurillac geholt werden.
Ohne Zögern dirigiert das Heereskommando in Paris bereits eine Militäreinheit (Verbindungsoffiziere sowie Pioniere mit einem Tankwagen voll Diesel) von ihrem Einsatzort in der Zentralafrikanischen Republik ins Katastrophengebiet in Kamerun – 750 Kilometer entfernt.
Unterdessen sorgt Haroun Tazieff dafür, dass sein verlässlichster und treuster Mitarbeiter, ein Vulkangaskenner mit dem Spitznamen Fanfan, in dem Flugzeug sitzt, mit dem auch der französische Botschafter auf seinen Posten in Afrika zurückgeflogen wird. Sie starten noch am selben Tag mit einer Militärmaschine vom Typ Mystère 20.
5.
Um die Kassetten meiner Radioreportage aus dem Jahr 1992 anhören zu können (ich hatte zwei aufgehoben: eine mit der Rohmontage des Materials und eine von der Sendung selbst), musste ich sie zunächst digitalisieren lassen. Erst dann erklangen klare Stimmen des 20. aus meinem Abspielgerät des 21. Jahrhunderts. Der Gesang einer Klasse von Waisenkindern aus einem der Nyos-Flüchtlingslager ließ mich schaudern. Ich erinnerte mich, dass sie als Chor aufgestellt standen, die kleinsten ganz vorn. Was war aus ihnen geworden?
Bei Minute 18 hörte ich mich selbst »Hasan den Unsterblichen« ansprechen, einen Verkäufer, der ungekühltes Frischfleisch anbot. »No man can kill me« – keiner kann mich töten, sagt Hasan, während er sich selbst auf die Brust schlägt, um zu zeigen, wie kugelsicher er ist. Hasan erzählt, er habe in Nigeria den Biafra-Krieg überlebt und als Flüchtling in Kamerun die Nyos-Katastrophe. »Hasan ist unsterblich«, rufen die Umstehenden auf dem Markt.
In der Rohmontage folgt die nüchterne Feststellung eines Wissenschaftlers: »Ein klarer Augenzeugenbericht ist so gut wie nicht vorhanden.« Für die ausländischen Experten, die kommen, um Boden- und Wasserproben zu nehmen, ist Afrika eine zufällige Kulisse und die Geschichte der Überlebenden Lokalkolorit.
»Massa«, sagt eine Gemüseverkäuferin. »Das ist die Rache von Mawes.« Sie erzählt, Gott Mawes herrsche über das Totenreich am Grund des Sees, wo er ein Python-Ei bewache, das immer nass bleiben müsse. Aber aus Wut über ausbleibende Opfergaben habe er das Ei kaputtgeschlagen – daher die unerträglich stinkende Wolke, die alles Atmende erstickt hat: Das Schlangenei war faul!
»Den kleinen See da, an dem wir jetzt vorbeifahren, den gab es dort früher nicht«, höre ich (bei Minute 38) den sehr jungen Fahrer eines Kleintransporters sagen. »Er hat sich fortbewegt.«
»Fortbewegt?«
»Ja, früher lag er unten im Tal. Aber er ist nach oben gestiegen.«
»Im Ernst?«
»Das erzählen sich die Leute.«
»Wie kann das sein?«
6.
Unter dem Stichwort »Mythos« findet sich im niederländischen Wörterbuch Van Dale als erste Beschreibung: »Geschichte von Menschen und Göttern.« Ein Mythos ist auch (Bedeutung 2): »Fabel – Geschwätz ohne Hintergrund: Das ist nur ein Mythos.« Und Bedeutung 3: »für richtig hingenommene, aber unbegründete Darstellung bezüglich einer Person, einer Sache oder eines Hergangs.«
Das Wort Mythos stammt aus dem Griechischen und stand ursprünglich für »das, was gesagt wird«, »die gesprochene Geschichte«. Meiner Vermutung nach hat jede Geschichte einmal mit einem Staunen begonnen (»Wie kann das sein?«). Der Mythos (»Das erzählen sich die Leute«) folgt erst Jahre oder Generationen später.
7.
François »Fanfan« Le Guern ins Flugzeug nach Afrika zu verfrachten, kommt einem Schachzug gleich: Tazieff rückt einen Bauern nach vorn. Seine Eile ist verständlich: Je frischer die Spuren des Sterbens, desto besser kann man die Geschehnisse rekonstruieren. Eile ist auch geboten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Wer im Wissenschaftsbetrieb eine Entdeckung macht, wird nur dann Lorbeeren ernten, wenn es ihm gelingt, seinen Fund als Erster in einer anerkannten Fachzeitschrift zu veröffentlichen. Nummer zwei, drei, vier und fünf, die zum selben Ergebnis kommen, verstärken nur den Glanz des Siegers. Und auch das sind die Spielregeln: Sobald François Le Guern das abgelegene Tal erreicht, ist das »Team Tazieff« vor Ort und damit Tazieff selbst. Dass der Meister persönlich noch in Paris weilt, zählt bei diesem Rennen nicht. Es geht um Kommen, Sehen und Veröffentlichen – und Letzteres wird unter seinem Namen geschehen.
In Großbritannien, der Schweiz, Neuseeland, Japan, Deutschland und auf Hawaii – überall packen Toxikologen, Biologen und Vulkanologen ihre Koffer. In Pisa, Italien, erteilt Professor Giorgio Marinelli seiner Sekretärin den Auftrag, drei Sitze für den nächsten Flug nach Kamerun zu buchen. Marinelli – Junggeselle mit seitlich über den Schädel gekämmten Haaren –, ist Petrologe, ein Gesteinskenner. Stellt man ihn ins Rampenlicht, schrumpft er, statt aufzublühen. Nichtsdestotrotz genießt er unter Geologen ein großes Ansehen. Sein Großvater war ein früher Kartograf in Abessinien, und dank dessen gutem Namen konnte der Enkel – mit persönlichem Segen von Kaiser Haile Selassie – in seine Fußstapfen treten. Gemeinsam mit Haroun Tazieff untersuchte er 1967 und 1968 eine Vulkankette in der Wüste im nördlichen Äthiopien.
Als »wandelnde Enzyklopädie« hatte Tazieff ihn einst gepriesen. Außerdem bezeichnete er ihn als »Treusten der Treuen«.
Doch eines Tages in den Siebzigerjahren kündigte Tazieff diese Freundschaft einseitig auf, und zwar in einem Interview: Marinelli sei allmählich auf die Medienaufmerksamkeit, die Tazieff erhalte, neidisch geworden. »Diese Missgunst, in Kombination mit seinem übertriebenen Chauvinismus, hat mich dazu gebracht, meine 15 Jahre andauernde Freundschaft und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem großen Petrologen, der Marinelli einmal war, zu beenden.«
War. Durch die Wahl der Vergangenheitsform kommt seine Aussage einem Fluch gleich, als könnte Tazieff Marinellis Karriere mit einem einzigen Seufzer knicken. Aber jetzt, in der letzten Augustwoche 1986, macht das Gerücht die Runde, Marinelli verfüge über eine Kiste mit Sendegeräten, mit denen er über einen Satelliten Daten an seinen Fachbereich in Pisa schicken könne. Und er sei mit zwei Assistenten auf dem Weg nach Nyos.
8.
Der August ist in Kamerun der nasseste Monat der Regenzeit. Kaum hat man die befestigten Straßen verlassen, gibt es kein Durchkommen mehr. Der einzige Zugang zum Katastrophengebiet, die über 300 Kilometer lange Ringroad, ist eine saisonal nutzbare Straße: Die am schlechtesten passierbaren Strecken werden in der Regenzeit mit Schlagbäumen gesperrt. »Rain Gate ahead« ist dann schon weit im Voraus angekündigt mit den beiden Optionen closed / open. Ein Kamerateam des staatlichen Fernsehens, unterwegs in einem braunen Chevrolet-Geländewagen, fährt sich im Schlamm fest.
Das Fernsehen hat erst ein Jahr zuvor, 1985, in Kamerun Einzug gehalten. Wöchentlich wird von Donnerstag bis Sonntag gesendet.
9.
Von meiner Reise nach Kamerun im Jahr 1992 fand ich meine mit Klebeband zusammengehaltene Michelin-Karte von Afrika wieder, gemeinsam mit einer alten Carte du Cameroun/Map of Cameroon.
Afrika als Ganzes zeigt sich auf der Karte wuchtiger als es ist, als würde sich der Kontinent in die Brust werfen, während alle wissen, dass er von Ost nach West lediglich mit Saharasand gefüllt ist. Kamerun liegt in der Achsel, dem schwülsten Ort, wo alles feucht, warm und grün ist. Kamerun ist nach den Garnelen – camarão – benannt, die der portugiesische Seefahrer und Erforscher Fernão do Pó 1472 bei einer Flussmündung in der Bucht von Biafra vorfand.
In den Jahrhunderten danach, als die meisten Küstenlinien bereits kartiert waren, fiel auf, dass diese Höhlung von Afrika sehr gut – zu gut für einen Zufall – in den Buckel von Südamerika auf der anderen Seite des Atlantiks passte. Die beiden Weltteile wirkten wie die Scherben derselben Vase. Ein deutscher Theologe äußerte im 18. Jahrhundert die Vermutung, die Sintflut habe sie roh auseinandergerissen, aber andere Deutsche, Alexander von Humboldt (im 19. Jahrhundert) und Alfred Wegener (im 20.), kamen mit der eher stichhaltigen Idee der sich bewegenden Kontinentalplatten. Zu dieser Theorie gehörten ein flüssiger Erdkern, Konvektionsströme von Magma, auf denen Erdkrustenstücke trieben, und Bruchlinien, die man an der Oberfläche an Vulkanketten erkennen könne. Eine dieser Bruchlinien ist die Kamerunlinie. Auf der Karte ist diese sichtbar als schnurgerade gepunktete Vulkanlinie im Meer, die die Inseln Annobón, São Tomé, Príncipe und Bioko verbindet, lotrecht auf der Achselhöhle von Afrika. Der dickste Punkt ist der Mount Cameroon: ein Koloss von 4040 Metern, unmittelbar an der Atlantikküste, der durchschnittlich einmal in einem Menschenleben ausbricht.
Die Bevölkerung, die auf den Flanken dieses aktiven Vulkans lebt, pflegte ihre Albinos dem Feuergott zu opfern. Noch während der Eruptionen von 1909 und 1922 banden sie diese lebendig an Pfähle, die sie entlang der kriechenden Lavazungen wie Fleischspieße in den Boden steckten.
10.
Ich liebe Geschichten. Wahrhaftige und fantastische. Als Schriftsteller pflanze ich hin und wieder eine neue Geschichte in den Wald der bereits vorhandenen. Die Idee für dieses Buch entstand im Darwin-Jahr 2009, als das Teylers Museum in Haarlem mich in eine Ausstellung zur Geschichte zweier legendärer Schiffe einbezog: der Arche Noah und der Beagle von Darwin. Erstere war Symbol für die Mythen aus der Heiligen Schrift, die zweite für die wissenschaftliche Wahrheit.
»Im letzten Saal werden wir ganz theatralisch«, versicherte der Kurator. »Wir lassen die Arche mittschiffs von der Beagle rammen und bringen sie zum Sinken. Was hältst du davon?«
Ich sah die Bresche im Rumpf bereits vor mir. Aber später dachte ich: Die Arche Noah hat nicht einmal den kleinsten Kratzer abbekommen durch Darwins Entdeckungen auf dessen Segelfahrt mit der Beagle. Die unmögliche Überlebensgeschichte von Mensch und Tier auf dieser wogenden, die Erdkugel umspülenden See spricht die Fantasie nun einmal mehr an als die Studienreise des jungen Darwin. Bevor man einem Kind die Evolutionslehre erläutert, hat es die Arche Noah schon ungezählte Male an sich vorbeiziehen sehen – in Büchern, Filmen oder als Bausätze von Lego oder Playmobil. Erzählungen können sich so bequem in die Wirklichkeit einnisten, dass sie ein Teil von ihr werden. Das fehlende Zimmer mit der Nummer 13 im Hotel, der an Himmelfahrt geschlossene Börsenhandel, das Horoskop in der Zeitung. Ein jeder auf dieser Welt zieht seine Kinder mit Essen, Trinken und Märchen groß.
Als ich klein war, bekam ich immer wieder zu hören – verpackt in die Schöpfungsgeschichte der Genesis –, die Schlange im Paradies habe das Unrecht in die Welt gebracht, indem sie Eva dazu verführte, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Später, als Erwachsener, begann ich, alle Religionen als mythische Geschichten zu sehen, die mit »Du sollst« und »Du sollst nicht« in das Leben von Milliarden eingreifen.
Geht es um Lebensfragen, vertraut das Gros der Weltbevölkerung lieber auf Fiktion als auf Fakten. Menschen sind Tiere, die sich gegenseitig Geschichten erzählen; wir binden uns ständig Bären auf, denen wir, falls nicht wortwörtlich Glauben schenken, so doch zumindest Bedeutung beimessen.
Ich fragte mich, woher Mythen stammen, die eine so enorme Kraft besitzen, dass sie sich unter die Wirklichkeit mischen. Haben sie klein angefangen? Wie wurden sie zu dem, was sie sind?
Schließlich funkte es. Ich erinnerte mich an das Totental von Kamerun und sah darin die ideale Versuchsanordnung für das, was ich wissen wollte. Das gesamte Setting eignete sich auf fast unheimliche Art und Weise zur Erforschung des Entstehens und Aufblühens von Geschichten: Das Nyos-Tal ist ein übersichtliches, begrenztes Stück Erdoberfläche. Am 21. August 1986, bei Neumond, ereignet sich zwischen neun und zehn Uhr abends eine Explosion. Das ist meine Stunde Null, der Urknall, mit dem alles beginnt. Bei Sonnenaufgang ist es stiller als still – selbst die Grillen haben aufgehört zu zirpen. Vom Talboden kommt keinerlei Lebenszeichen. In den nächsten Tagen, Monaten und Jahren wird über das Totental gesprochen, gejammert, gestritten, spekuliert und fabuliert.
Ich möchte versuchen, alles, oder zumindest das Meiste, was darüber gesagt und geschrieben wurde, in einzelne Stränge zu zerlegen. Beim Entwirren des Knäuels hoffe ich, verfolgen zu können, welche Wörter sich mit den Fakten verbunden haben und wie diese zu Sätzen, Metaphern und Geschichten wurden.
Ein Vierteljahrhundert ist vielleicht kurz, ich erwarte nicht, dass innerhalb von fünfundzwanzig Jahren eine ausgewachsene, abgerundete »Totental-Legende« entstanden ist. Doch zumindest müsste es möglich sein, das Aufkeimen mythischer Erzählstränge zu erkennen.
11.
Auf dem Boulevard Montmartre war der Schneematsch geschmolzen, die Bäume und Balkone tropften noch. Es war der 8. Dezember 2010, am Abend zuvor hätte ich Haroun Tazieffs Sohn treffen sollen. In dem Restaurant, in dem wir verabredet waren, war er nicht aufgetaucht.
An Fassaden und Ladenfronten entlang drängte sich eine Menschenschlange, die nach einigen Metern in dem funkelnden Eingang des Musée Grévin verschwand. Weil ich in diesem Wachsfigurenkabinett einen Termin hatte, brauchte ich mich nicht hinten anzustellen. Véronique Berecz begrüßte mich vor der Loge vom Wachdienst und setzte sogleich nach, was für ein großartiger Mann Haroun Tazieff doch sei. Wir stiegen in den Personalaufzug, der uns in ihr Arbeitszimmer brachte. Der Fahrstuhlkäfig war so eng, dass wir Bauch an Bauch standen, mit abgewandtem Blick und angehaltenem Atem. Nachdem wir uns nach draußen gezwängt hatten, fragte ich sie, was genau Tazieff denn so großartig mache.
»Wissen Sie, was es ist«, sagte sie, während sie hinter ihrem Schreibtisch Platz nahm. »Als Kinder lasen wir Jules Verne. Sie kennen Jules Verne?« Ich bekam ihre Visitenkarte gereicht – Véronique Berecz war Leiterin der Presseabteilung. »Die Reise zum Mittelpunkt der Erde«, fuhr sie fort. »So fantastisch, so anregend für die Fantasie. Wir träumten davon. Und Haroun Tazieff, der tat es.«
1985, zehn Monate vor der Nyos-Katastrophe, hatte Tazieff sein Abbild im Musée Grévin bekommen. In meinem veralteten Paris-Stadtführer stand, seine Wachsfigur nehme einen Ehrenplatz auf dem roten Läufer bei der Kasse ein: »Haroun Tazieff empfängt Sie am Fuße eines feuerspeienden Bergs und lädt Sie in die mit Blattgold und Marmor verzierte Säulenhalle ein.« Das wollte ich gern sehen, aber unten beim Eingang, in dem mit roten Teppichen ausgelegten Vestibül, stand keine einzige Figur. An der Wand hingen nur zwei Zerrspiegel, die einen dick oder dünn machten.
»Unser Museum ist eine Widerspiegelung der Gegenwart«, erklärte Véronique Berecz Tazieffs Abwesenheit. »Es ist kein Pantheon für berühmte Tote.«
Sie begann zu erzählen, wie erfreut Tazieff seinerzeit gewesen sei, dass das Musée Grévin ihn aufnehmen wollte. Die Sitzungen im Atelier des Bildhauers habe er genossen. Sie hatten den Vulkanologen und Staatssekretär von Kopf bis Fuß vermessen: die Form des Schädels, die Breite des Kiefers, den Winkel, in dem die Ohren abstanden. Anhand einer Schachtel mit künstlichen Augen wurde seine Irisfarbe bestimmt: graublau. Seine wenigen noch verbliebenen Haare wurden als dünn und grau klassifiziert. Haroun Tazieff hatte sich vermessen lassen wie Anthropologen noch bis in die Siebzigerjahre Pygmäen und Papuas vermaßen. Unterdessen erzählte er von seinen Expeditionen, und Véronique und ihre Kollegen hingen an seinen Lippen.
»Er war ein sehr liebenswürdiger Mann und stolz darauf, dass wir ihn auserwählt hatten«, sagte sie.
Ich fragte, ob es für Tazieff wichtiger als für andere Berühmtheiten war, eine Wachsfigur zu haben.
»Ja«, antwortete die Pressedame entschieden. »Es war ihm auch lieber, als einen Orden zu bekommen.«
»Glauben Sie das, oder sagte er das?«
»Das sagte er.«
Véronique schob mir ein Blatt mit Feldaufzeichnungen zu, das er dem Museum gestiftet hatte. Sie entnahm es einem Ordner, aus dem sie auch die handgeschriebene Gästeliste fischte, die Tazieff anlässlich der festlichen Enthüllung seines Doppelgängers erstellt hatte. Ich überflog die Reihe der Namen, bis ich plötzlich stutzte: M. et Mme F. Lavachery, 5 Rue du Zodiaque, Bruxelles.
Ich wusste, wer das war. Das F. stand für Frédéric, Tazieffs Sohn, auf den ich am Abend zuvor vergebens gewartet hatte, und der seit Kurzem von einem Weiler an den Quellen der Loire aus das Sekretariat des Centre Haroun Tazieff leitete.
Offenbar hatte er 1985 in Belgien gewohnt.
Véronique wusste jedoch nichts von einem Sohn. Ihrer Erinnerung nach waren außer France Tazieff, Harouns Frau, keine weiteren Familienmitglieder bei der Enthüllung dabei gewesen. Während sie dies sagte, reichte sie mir eine Plastikhülle mit Pressedias.
Ich hielt die Dias gegen das Licht und sah einen sitzenden Mann in khakifarbenem Hemd, Bleistift und Papier gezückt, vorgebeugt wie der Denker von Rodin, aber nach oben schauend. Unter seinen Bergschuhen: Bimsstein und Asche. Auf dem Boden lag ein hitzebeständiger Schutzanzug aus Aluminium. Das derbe Gesicht des Mannes war gebräunt. Seine Lippen bildeten einen Strich, doch er wirkte nicht unfreundlich.
»Und wo ist die Wachsfigur jetzt?«, wollte ich wissen.
Sie war beim großen Umbau 2001 demontiert worden und nicht wieder zurückgekehrt.
»Also liegt er hier irgendwo im Keller?«
»In unserem Lager am Stadtrand«, erklärte Véronique. Dort würden die Köpfe fachkundig von den Rümpfen getrennt, sie kämen in gesonderte Kartons – wie auch die Hände. Ich sah einen Keller vor mir mit gestapelten Hutschachteln, in denen, auf einem Bett aus Holzwolle, die Köpfe und Hände ehemaliger Berühmtheiten lagen. Ich wollte wissen, ob die Wachsfiguren hin und wieder für eine glorreiche Rückkehr aus der Mottenkiste geholt würden.
»Deswegen heben wir sie auf«, sagte Véronique, »aber in der Praxis kommt das selten vor.«
12.
Vier Tage nach der Nyos-Katastrophe, am Montag, dem 25. August 1986, korrigiert die Regierung von Kamerun die Zahl der Toten nach oben: von »mindestens 1200« auf 1532.
13.
Das erste Bild aus dem Totental, das um die Welt geht, stammt von einem Missionar. Einem Korrespondenten eines internationalen Pressebüros ist es gelungen, einen Piloten namens Dean Yeoman ausfindig zu machen. Dieser Amerikaner verbreitet das Evangelium mithilfe eines Helikopters direkt aus dem Himmel. »Helimission« heißt die Organisation, die ihn ausgesandt hat. Von seiner Basis in der Stadt Bamenda aus hat Yeoman nach der Nyos-Katastrophe seinen Helikopter für Rettungsflüge eingesetzt und dabei Fotos vom Tal gemacht. Eine dieser Aufnahmen zeigt einen grünen, mit totem Vieh gesprenkelten Hang. Das sind die Kadaver Hunderter weißer Zebus. Die Tiere liegen rücklings im Gras, aufgequollen zu Karikaturen ihrer selbst.
AP verbreitet das Luftbild der toten Rinder am Montag, dem 25. August, zeitgleich mit den ersten Augenzeugenberichten. Es handelt sich um Aussagen von Überlebenden, die eine Explosion gehört haben, die sie mit dem Dröhnen eines Flugzeugs im Tiefflug vergleichen. Manche haben Schießpulver gerochen, andere den Gestank fauler Eier. Eine blinde Frau hat die Erde zittern gespürt.
Ich erinnere mich an die Nachrichten dieses Abends. Ich war einundzwanzig und Student. Wo ich war oder was ich an diesem Tag tat, weiß ich nicht mehr, aber ich sehe noch die Nachrichtensprecherin vor mir, im Hintergrund das Grün mit den Sprenkeln der Rinderkadaver. Das Bild wirkte makaber, aber auch irgendwie faszinierend. Ich wollte mehr darüber wissen – und bekam immer nur ein Puzzleteil in die Hand.
Die Zeitungen von Dienstag, dem 26. August, bieten keinen Trost. »Keine Verwüstung, aber auch kein Leben mehr«, lautet eine der Schlagzeilen. Die Wissenschaftsredaktion vom NRC Handelsblad schreibt: »Ein großes Problem für die Erklärung der Katastrophe liegt darin, dass die Bevölkerung sehr abergläubisch ist.« Nur die Trouw weiß, was passiert ist: »Gestank fauler Eier wurde Viehhaltern zum Verhängnis.« Die Zeitung zitiert Prof. Dr. Schuiling von der Universität Utrecht, der den Tod der Bauern und ihres Viehs dem Schwefelwasserstoff, H2S, zuschreibt. Das Einatmen dieses Gases in hoher Konzentration habe zur Lähmung der Atemmuskulatur geführt. H2S gehört zu den gefährlichsten Schwefeldämpfen, die bei Vulkanausbrüchen freigesetzt werden. Der intensive Gestank nach faulen Eiern lässt Mensch und Tier die Flucht ergreifen, aber in diesem Fall muss die Wolke so gigantisch gewesen sein, dass es kein Entkommen gab. Der Utrechter Professor spricht von einem einzigartigen Phänomen.
14.
Jeder fragte sich nach den Nachrichten aus dem Totental: Was ist dort passiert? Auch ich fragte mich das. Das Staunen siegte über das Mitgefühl. Dies konnte mit dem Mangel an Spuren zu tun haben, dem Grundrezept jedes Krimis. Das Totental erwies sich als ein Nährboden für Gespinste und Spekulationen. Freunde, denen ich 2011 erzählte, womit ich 1992 meine Radioreportage über die Geschehnisse im Totental begonnen hatte, rätselten, als hätte ich ihnen eine Quizfrage gestellt.
»Mit einem elektromagnetischen Impuls?«, versuchte es der eine.
»Sumpfgas«, vermutete ein anderer.
»Irgendwas mit Strahlung.«
Ich hatte in Kamerun die Geschichten der Hinterbliebenen aufzeichnen sollen, der Hilfeleistenden, der Berater des Fon und des Fon selbst. Aber ich selbst hatte zunächst die Wissenschaftler und ihre exakten Aussagen hören wollen – und ihnen schließlich auch das erste Wort gegeben: den professionellen Forschern, die es als ihre Aufgabe sehen, mit Messungen und Logik die Welt von ihren Mythen zu befreien.
»Le gas toxique est du gaz carbonique« – das giftige Gas ist Kohlendioxid. So klar und einfach kann es klingen. Das Rätsel des Nyos-Tals entzaubert und auf eine chemische Formel gebracht: CO2. Oder nach Auffassung anderer Wissenschaftler H2S. Aus wissenschaftlicher Perspektive jedenfalls war die Ursache klar: ein Molekül.
15.
Haroun Tazieff hatte seine Berufung als Vulkanologe mit 33 Jahren in Afrika gefunden. Er arbeitete in Costermansstad im Kongo als Bergbauingenieur im belgischen Kolonialdienst, als am 1. März 1948 im Albert Park – Afrikas ältestem Naturreservat – ein Vulkan ausbrach. Angezogen von Gerüchten (»die Stadt Goma ist dem Tode geweiht, die Lava steht bereits an den ersten Häusern«), war er am folgenden Tag dorthin aufgebrochen – gemeinsam mit seinen Trägern Paya und Kaniépala. Tazieff hatte in Cratères en feu darüber geschrieben, seinem erfolgreichen populärwissenschaftlichen Debüt aus dem Jahr 1951. Nur zwei Antiquariate boten die Übersetzung ins Niederländische an, eines für 130 Euro, das andere für 200. Ich rief das erste an und sagte, 100 sei es mir wert.
»Sie müssen wissen, dass die Übersetzung von niemand Geringerem als Willem Frederik Hermans stammt«, sagte der Händler.
Sobald ich die volle Summe entrichtet hatte, erhielt ich das Buch in einem Schuhkarton. Ich befreite es aus drei Schichten Luftpolsterfolie und begann irgendwo mittendrin zu lesen:
Nachdem wir das Lager in der Morgendämmerung verlassen hatten, gingen wir in die Richtung, aus der das mächtige Tosen kam. Hatte Napoleon nicht einst gesagt, man müsse dem Kanonendonner entgegengehen?
Auch wenn es sich um eine Übersetzung handelte – dies war nicht die bissige, unterkühlte Prosa, die ich von Willem Frederik Hermans kannte. Ich begann von vorn und las den Text in einem Rutsch. Die Handlung beginnt mit einem Mann, der in den Krater eines aktiven Vulkans schaut. Er sieht »ein geheimnisvolles Herz«, das anschwillt und schrumpft. Zugleich hört er das Grollen »einer abscheulichen Bulldogge«. Die Metaphern sprühen nur so von den Seiten, mit derselben Frequenz, mit der »das Innere der Erde« Lavabrocken auswirft.
Dieses Maul, dessen Hitze mich streift wie der Atem eines Tieres, macht mir Angst. Der Mann, der sich über dieses Feuermeer beugt, ist nicht mehr der Geologe, der die Naturphänomene kennenlernen will, sondern ein verängstigter Primitiver.
In Todesverachtung bewegt er sich am Kraterrand entlang. Nachdem er den Krater zu drei Vierteln umrundet hat, gerät er, fast stolpernd, in ein Sperrfeuer von Gesteinsgeschossen. Als ihm klar wird, dass er seinen Rundgang nicht vollenden kann, beschließt er, in den Krater hinabzusteigen.
Für einen Moment war ich erstaunt über meinen eigenen Wahnsinn. Was soll’s, es ist gar zu verführerisch … »Es geht, es geht.« Ich beginne den Abstieg und presse meine Absätze so tief wie möglich in die glühenden Schlacken. Immer näher kommt das Oval des riesigen Mauls unter mir und wächst mit dem Anstieg des schrecklichen Tumults um mich herum. Meine weit aufgerissenen Augen laben sich an so viel grauenhaftem Glanz. Dort sind die schweren Vorhänge, geschmolzenes Gold und Kupfer, so nahe, so nahe, dass es scheint, als wäre ich, ein Mensch, in ihre Märchenwelt vorgedrungen.
Der Erzähler strengt sich an, damit er nicht der Sinnestäuschung oder einem unangebrachten Glauben an übernatürliche Kräfte zum Opfer fällt. Schließlich ist er ein rational denkendes und im »Atomzeitalter« lebendes Wesen.
Mit einem Aufschrei der Anspannung gelingt es mir, mich dennoch von diesem Schauspiel loszureißen. Ich muss versuchen, wieder »wissenschaftlich« zu werden! … Schnell, die Temperatur messen. Die Temperatur des Bodens und die der Luft.
Das Buch, mit dem sich Tazieff als Dreißigjähriger einen Namen gemacht hatte, bewegte sich zwischen Jules Verne und Hergés Comic Tim im Kongo.
»Sag Paya, keine Angst, zum Feuerberg zu gehen?«
Paya hat keine Angst, aber er hat gehört, was die »Eingeborenen« rund um den Vulkan erzählen.
»Sie sagen: Teufel werden wach, weil gottlose Männer keine Opfer bringen. Böse Teufel werfen Steine aus Feuer auf die Männer. Dann sie opfern Ziegen. Wenn Shétanis (Teufel) sehr böse sind, sie opfern Rinder.« »Ja«, bemerkte ich, »eine gute Ausrede, sich vollzustopfen!« »Nein, Bwana. Werfen Ziegen lebend in Lava.« Einige Zeit gingen wir schweigend weiter, dann fuhr er fort: »Sie sagen auch: Manchmal ein Opfer nicht genug, denn wenn Shétanis nicht mehr böse, ist noch etwas anderes.« »Ach so. Was?« »Früher großes Oberhaupt, tot, krank sein in anderer Welt. Dann er sehr viel springen in seinem Bett, sich umdrehen, au, au, au! Und Erde öffnet sich …« »Und dann, noch mehr Opfer?« »Ja, Bwana. Opfer machen nicht immer gut, aber kann nie schaden!« Und er lachte nur und zeigte all seine schönen Zähne!
Nach Cratères en feu sollten noch etliche Bestseller und Erfolgsfilme folgen, aber schon gleich in seinem Debüt präsentiert sich Haroun Tazieff als unerschrockener Verteidiger der Vernunft. Wie der Heilige Georg Drachen zu Leibe rückt, so bekämpft er den Glauben des Homo sapiens an Fabeln und Erzählungen, der ihn fest im Griff der Rückständigkeit hält. Wissen darüber, wie die Natur funktioniert, ist das Gegenmittel, mit dem Tazieff die Weltbevölkerung gern impfen würde.
Zum Schluss von Cratères en feu schwört er einen Eid auf seine Treue zur Wissenschaft. Tazieff pilgert zum Torre del Filosofo direkt unter dem Gipfel des rauchenden Ätna, einer Ruine, bei der es sich laut Überlieferung um eine 2500 Jahre alte Beobachtungshütte handelt. Von diesem Unterstand auf 2900 Metern aus soll Empedokles die Geheimnisse des Feuerbergs studiert haben, bis er eines Tages vom Krater verschlungen wurde. Nur seine Sandalen hat man angeblich wiedergefunden.
Alter, großer Empedokles, Held und erster Märtyrer der Wissenschaft von den Vulkanen, mit Freude rufe ich auf dieser letzten Seite deine legendäre Gestalt an, die Gestalt eines Geistes, dem Legenden nicht reichten und der wissen wollte.
16.
Zu dem Zeitpunkt, als der französische Botschafter und Tazieffs Abgesandter François »Fanfan« Le Guern am 24. August 1986 die Sahara überfliegen, befiehlt der Präsident von Kamerun seinen Generälen, das Totental von der Außenwelt abzuriegeln, keiner darf mehr in das Tal hinein. Er kündigt eine vollständige Quarantäne an.
Der seismische Dienst hat keine Erdbeben registriert. Mount Cameroon ist ruhig. Dass weiter oben an der Kamerunlinie ebenso wenig Aktivitäten gemessen wurden, heißt noch nicht, dass es diese nicht gegeben hat. Das Netzwerk an Messpunkten hat sich aufgelöst. Seit Kamerun 1961 als selbstständige Republik aus den Kolonien Französisch-Kamerun und Britisch-Kamerun hervorgegangen ist, ist die nationale Infrastruktur eher zerbröckelt als dass sie erweitert wurde. Die Hauptstadt Jaunde bekam ein paar Hochhäuser mit spiegelnden Fassaden, der abgelegene Grassfields-District jedoch, wo sich die Katastrophe ereignet hat, ist stark vernachlässigt. Und gerade in dieser Bergsavanne setzt sich die tektonische Bruchzone fort, sichtbar als eine Schnur blauer Kraterseen. Weiter landeinwärts spaltet sich die Kamerunlinie wie die Zunge einer Schlange. Auf der östlichen Zungenspitze liegt der Manoun-See, auf der westlichen der Nyos-See.
Die Mystère 20 der französischen Luftstreitkräfte landet, als es schon dunkel ist. Es regnet, die Rollbahn glänzt im elektrischen Licht, Fanfan befindet sich jetzt auf kamerunischem Hoheitsgebiet, aber Inlandsflüge zu den Grassfields gibt es an diesem Tag nicht mehr.
17.
Am Garnisonsort Wum im äußersten Nordwesten Kameruns verfügt Generalleutnant James Tataw über zwei Kompanien von je hundert Soldaten. Nicht einmal ein halbes Bataillon. Tataw mangelt es nicht nur an Mannschaften, sondern auch an Transportmitteln, die schwer genug wären, um dem Schlamm zu trotzen. Er stellt sich diesen Problemen, indem er zwei Maßnahmen einleitet: 1) Konfiszierung aller Bierwagen, die sich in Wum befinden (oder die gerade aus Bamenda kommen). 2) Arbeitseinsatz aller Krimineller und Geisteskranker aus dem überquellenden Gefängnis von Wum. Außerhalb der Stadt lässt er die Schlagbäume des Rain Gate für seine Bierwagenkolonne öffnen. Es ist Montag, der 25. August. Tataw fährt an der Spitze im Kommandojeep, in seiner Brusttasche ein ziegelsteingroßes Walkie-Talkie. Wie der Rest seiner Männer stammt Tataw nicht aus den Grassfields. Trotzdem kennt er die Geschichten über den kreisförmigen, nahe seiner Kaserne gelegenen Wum-See. In den Jahren, in denen der Mount Cameroon Feuer speit, erwacht das Wasser dieses Sees zum Leben: Es beginnt zu blubbern und zu sprudeln. Die beiden Göttinnen, die auf dem Boden des Wum-Sees wohnen, schicken hin und wieder brodelnde Unheilsbotschaften zur Oberwelt.
Auf Tataws Stabskarte erstreckt sich das Totental über 18 Kilometer. Am Oberlauf des Flusses Katsina Ala liegen zwei Dörfer: Cha und Nyos, und weiter oben, hinter der Wasserscheide, ein drittes: Subum. Cha und Subum sind von einem Flickenteppich aus Maisäckern, Gemüsegärten, Avocado-, Mango- und Ölpalmenwäldern umgeben. Nyos ist anders. Nyos gibt es zweimal: das nicht betroffene Upper-Nyos auf einem bewaldeten Berggipfel über dem See, ein Miniatur-»Königreich« mit einem eigenen Fon, Hofhaltung, Harem, Palast; und Lower-Nyos, rund 300 Meter tiefer im Flaschenhals des Tals. Lower-Nyos, eine noch junge Siedlung, die in den letzten Jahren unbändig gewachsen ist, besteht aus Hütten, kleinen Läden, einer Schmiede, einem Schlachtplatz, einer Gerberei, einem Gemeindehaus, einer Moschee, einer Schule und etlichen Kneipen; es ist geschäftiger und kommerzieller als die umliegenden Dörfer. Alle acht Tage wird in einem Kral aus gestampfter Erde ein Viehmarkt abgehalten.
Tataws Auftrag: die Toten begraben, die Lebenden vertreiben. Zwei Stunden pflügen sie durch den Schlamm, bis Äcker mit Mais, Maniok und Süßkartoffeln das Dorf Cha ankündigen. Bei jeder größeren Ansammlung aus Hütten, manche rund und mit Schilf gedeckt, andere rechteckig und mit einem Dach aus Zinkplatten, hält der Konvoi an. Überall derselbe faulige Verwesungsgestank. Die Gefangenen bekommen einen Spaten in die Hand gedrückt und werden in Gruppen eingeteilt. Stundenlang heben sie Gruben aus, schwitzend unter der Bewachung von Soldaten mit roten Baretten und Uzi-Maschinengewehren. In jeder Grube verschwindet ein Dutzend Leichen. Aus Zeitnot erklären die Soldaten kurzerhand die Latrinen auf einem Feld hinter der Schule von Nyos zu einem Massengrab für Ziegen, Erdferkel und Hunde, die am Schwanz herangeschleift werden. Sie verschwinden unter einer weißen Decke aus ungelöschtem Kalk und einer schwarzen aus Erde. Zwei Tage lang sind Generalleutnant Tataw und seine Gefangenen-Brigade damit beschäftigt, sämtliche Leichen und Kadaver in Cha, Lower-Nyos und Subum zu begraben. Sie tragen keinen Mundschutz.
18.
Die französische Botschaft in Jaunde muss Himmel und Erde in Bewegung setzen, um Fanfan in die Nähe des Nyos-Tals zu bringen. Am Dienstag, dem 26. August 1986, wird er mit zwei Hubschrauberflügen über die Barrikaden der kamerunischen Bürokratie hinweg nach Wum gebracht, 20 Kilometer vom betroffenen Gebiet entfernt.
Während Fanfan die Tropenwälder und den breit mäandernden Sanaga unter sich dahingleiten sieht, verbreitet AFP um 10.23 Uhr den Augenzeugenbericht eines Missionars aus Wum mit einem niederländisch klingenden Namen: Pater ten Horn. Am Samstag, dem 23. August – zwei Tage vor Generalleutnant Tataw –, ist er im Tal gewesen, wo er Hunderte von Leichen gesehen hat, Männer, Frauen und Kinder, »vor ihren Hütten liegend, mitten auf dem Sandweg oder noch auf dem Bett«. Und auch tote Hühner, Ziegen und Schlangen. Vögel, die vom Himmel gefallen waren. Abgestorbene Termitenhaufen. Die Häuser, Marktstände und auch Bäume aber waren allesamt unversehrt geblieben. Pater ten Horn: »Es war, als wäre eine Neutronenbombe explodiert, die keine Verwüstung angerichtet, aber alles Leben ausgelöscht hatte.« Am späten Nachmittag erreicht Fanfan den Garnisonsort Wum. Tazieffs Mann vor Ort steht jetzt am Rand der Sperrzone. Er geht davon aus, trotz der Verspätung noch immer einen Vorsprung gegenüber den Truppen an Sachverständigen zu haben, die aus allen Himmelsrichtungen seine Verfolgung aufgenommen haben. Aber Fanfan ist nicht der Erste. Im Krankenhaus von Wum und in dem von Nkambe – auf der anderen Seite des abgeschlossenen Tals – sind 17 israelische Militärärzte (Pathologen und Toxikologen) bereits seit vierundzwanzig Stunden zugange. Sie haben auch ein Notkrankenhaus aus Zelttuch errichtet. In Arztkittel gehüllt untersuchen und behandeln sie die Wunden der Überlebenden.
19.
Am Abend des 8. Dezember 2010, als ich aus Paris nach Hause kam, meldete sich Frédéric Lavachery, Tazieff junior, per E-Mail. Seine Nachricht war um 22.24 Uhr versendet worden. Im ersten Satz entschuldigte er sich für unsere geplatzte Verabredung, im zweiten schrieb er: »My house went into heavens on Saturday. Please excuse my bad English.«
Darunter hingen Links von Nachrichtenberichten mit Schlagzeilen wie »Abgelegenes Wohnhaus durch Brand zerstört« und »Bauernhof in Flammen aufgegangen«. Als ich sie anklickte, landete ich auf den Websites von Zeitungen aus der Region Haute-Loire. Ich betrachtete Fotos eines schwelenden Steinhaufens auf einer beschneiten Bergweide. Feuerwehrmänner standen mit hängenden Schultern bei der Haspel eines ausgerollten Schlauchs. Der Bauernhof, las ich, gehörte »Frédéric Lavachery, dem Sohn des gefeierten Vulkanologen, des verstorbenen Haroun Tazieff«. Lavachery und seine Frau waren dabei, den Hof zu renovieren, um dort das künftige Centre Haroun Tazieff unterzubringen.
»Die Eigentümer haben alles verloren«, schloss L’Éveil. Le Progrès: »Zum Glück waren die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.« Ich akzeptierte Frédérics Entschuldigung. Gleichzeitig dachte ich: Wenn ein spontaner Brand im Schnee tausend Kilometer von mir entfernt den Lauf dieser Geschichte beeinflussen kann – welche Rolle spielt dann der Faktor »unvorhergesehen« in der Geschichte, die ich zu entwirren versuche?
Zum Abschluss schrieb Tazieffs Sohn, er würde mich trotz des Rückschlags gern treffen. Er arbeite an einer Biografie, die »Haroun Tazieff und sein Werk in den historischen Kontext des 20. Jahrhunderts stellen wird«.
20.
Schenkt man Tazieffs Autobiografie Glauben, hatte er keinen Sohn. Seine Lebensgeschichte – Ma vie – umfasst zwei Teile, die Anfang der Neunzigerjahre kurz hintereinander erschienen. Seine große Liebe France kommt darin vor. Haroun hatte sie 1939 am Fuße des Mont Blancs kennengelernt und 1957, 18 Jahre später, geheiratet. France arbeitete beim Institut Pasteur. Das Paar, so geht es jedenfalls aus Tazieffs Autobiografie hervor, war kinderlos geblieben.
21.
SUBUM, 25. August 1986 – Bei ihrer Ankunft im Dorf Subum fanden Rettungskräfte ein Neugeborenes. Das Kind lag weinend zwischen den Beinen seiner toten Mutter.
Den Ärzten zufolge musste das Mädchen geboren sein, kurz bevor die tödliche Gaswolke die Mutter erreichte. Sie verstehen nicht, wie das Baby die Katastrophe überleben konnte.
Diesen Artikel entdeckte ich in einem Zeitungsarchiv und las ihn bestimmt zehnmal. Da wird eine nackte Tatsache ohne jedweden Schnörkel berichtet. Ein weinendes Baby zwischen den Beinen seiner toten Mutter, und die Mediziner, die dies mit eigenen Augen gesehen haben, verstehen nicht, wie das um Himmels willen möglich sein kann.
Sollte ich diese Geschichte glauben? Zwischen Donnerstagabend, dem 21. August 1986, und Montag, dem 25. August, lagen vier Tage: Konnte ein Säugling so lange, mutterseelenallein, überleben?
Wie Moses im Weidenkörbchen, der von der badenden Tochter des Pharao aus dem Nil gerettet wird, ist während der zahlreichen Hochwasserkatastrophen in der niederländischen Geschichte mehr als einmal ein Baby in einer Wanne oder einer Wiege angespült worden. An der Stelle, an der sich so etwas ereignet haben soll, erinnern Giebelsteine und Ortsnamen wie Kinderdijk an dieses Wunder. Die dazugehörenden Geschichten sind herzzerreißend (die Wiege von Kinderdijk wurde im Wellengang von einer hin- und herspringenden Katze ausbalanciert) und immer wundersamer, als es in Wirklichkeit je hätte passiert sein können. Offenbar brauchen wir Hinterbliebene diese Art von Geschichten, um Trost oder Hoffnung aus ihnen zu schöpfen. Das Leben ging weiter.
22.
Haroun Tazieff ist noch zu Hause in Paris, als er den ersten Sieg für sich verbucht. Die Experten, die auf H2S als unsichtbaren Killer Agent des Nyos-Tals gesetzt hatten (wie der Utrechter Professor Schuiling), sind inzwischen zu der Erkenntnis gelangt, dass Schwefelwasserstoff zu schnell verfliegt, um noch über eine Entfernung von vielen Kilometern tödlich zu wirken. Kohlenmonoxid, Methan und Blausäuregas (das nach Mandeln riecht) entfallen aus demselben Grund. Vierundzwanzig Stunden nach Tazieff, am 26. August 1986, kommen mehr und mehr Wissenschaftler zu dem Schluss, dass Mensch und Tier tatsächlich in einer Wolke von CO2 erstickt sein müssen.
23.
Die Forscher, die sich auf den Weg ins Nyos-Tal machen, kommen aus Israel, den USA, Italien, Großbritannien, Japan, Westdeutschland, der Schweiz, Neuseeland. Dr. John Lockwood, Leiter des Vulkanobservatoriums auf Hawaii, erhält die Leitung über die zehnköpfige amerikanische Forschertruppe.
Oberstarzt Dr. Michael Wiener führt das israelische Team an.
Dr. Kusakabe repräsentiert Japan. Dr. Tietze Westdeutschland. Dr. Schenker die Schweiz. Dr. Giggenbach Neuseeland.
Dr. Freeth Großbritannien. Samuel Freeth ist Leiter des Zentrums für die Erforschung von geo hazards (Georisikoforschung) der Universität Swansea in Wales und lässt sich vom Toxikologen Dr. Peter Baxter aus Cambridge unterstützen.
Auch Tazieff steht am 26. August 1986 kurz vor seiner Abreise. Auf dem Flughafen Charles de Gaulle in Paris stellt er sich erneut der Presse. An seiner Seite ist René Faivre-Pierret, der für das Zentrum für Nuklearforschung in Grenoble arbeitet und aufgrund seiner Statur Yeti genannt wird.