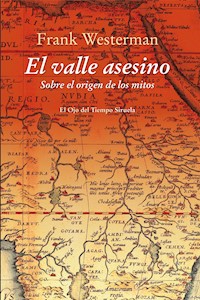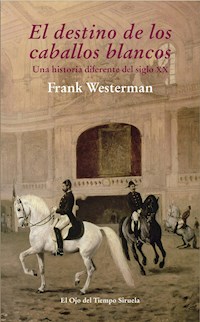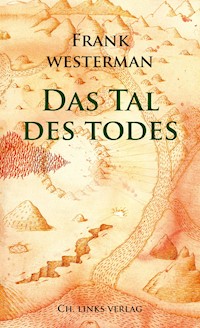16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was unterscheidet uns Menschen vom Tier. »Westerman ist ein Meistererzähler, der mit Thriller-Effekten die Leser in seinen Bann schlägt.« Hans Christoph Buch, Die Zeit. In einer Höhle auf einer Insel im indischen Ozean wird 2003 ein fossiler Urmensch gefunden, der kaum einen Meter misst. Um ihn herum liegen Skelette ausgestorbener Tiere: Ratten, so groß wie Hunde, Elefanten so klein wie Ponys. Was sagt diese urzeitliche Welt darüber aus, wer wir sind und woher wir kommen? Frank Westerman reist zu den Vulkanhängen Indonesiens - und um die ganze Welt. In einer faszinierenden Mischung aus Reportage und Essay findet er auf spielerische Weise Antworten auf die großen Fragen: Was macht uns zu Menschen? Und tragen wir die Krone der Schöpfung zu Recht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Was unterscheidet uns Menschen vom Tier.
»Westerman ist ein Meistererzähler, der mit Thriller-Effekten die Leser in seinen Bann schlägt.« Hans Christoph Buch, Die Zeit.
In einer Höhle auf einer Insel im indischen Ozean wird 2003 ein fossiler Urmensch gefunden, der kaum einen Meter misst. Um ihn herum liegen Skelette ausgestorbener Tiere: Ratten, so groß wie Hunde, Elefanten so klein wie Ponys. Was sagt diese urzeitliche Welt darüber aus, wer wir sind und woher wir kommen? Frank Westerman reist zu den Vulkanhängen Indonesiens - und um die ganze Welt. In einer faszinierenden Mischung aus Reportage und Essay findet er auf spielerische Weise Antworten auf die großen Fragen: Was macht uns zu Menschen? Und tragen wir die Krone der Schöpfung zu Recht?
Über Frank Westerman
Frank Westerman, geboren 1964 in den Niederlanden, Journalist und Schriftsteller, ist ein Meister der literarischen Reportage. Er studierte Agrarwissenschaften, bevor er als Auslandskorrespondent für zwei große Tageszeitungen aus Russland und Osteuropa berichtete. Seine Bücher wurden in mehr als zehn Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Mehr zum Autor unter www.frankwesterman.nl.
Verena Kiefer, geboren 1964, lebt als freie Übersetzerin in Siegen und Amsterdam. Sie hat bereits die früheren Bücher von Fran Westerman sowie Werke von Douwe Draaisma, Stella Braam, Mirjam Bolle, Henri van Daele und Jan Paul Schutten ins Deutsche übersetzt und ist Lehrbeauftragte für Niederländisch an der Universität Siegen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Frank Westerman
Was uns zu Menschen macht
Eine anthropologische Detektivgeschichte
Aus dem Niederländischen von Verena Kiefer
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Quellennachweis und Danksagung
Impressum
Prolog
Lange Zeit habe ich nicht verstanden, wo er hergekommen ist, der kleine Prinz. Er hat mich dauernd ausgefragt, aber wenn ich etwas von ihm wissen wollte, hat er einfach nicht hingehört. Erst nach und nach habe ich mir aus seinen Andeutungen zusammengereimt, was er verschwieg. Zum Beispiel, als er zum ersten Mal mein Flugzeug sah […]
»Was ist das denn für ein Dings?«
»Das ist kein Dings, das kann fliegen. Es ist ein Flugzeug und es gehört mir.«
Ich war stolz darauf, dass ich fliegen konnte.
Da rief er: »Na, so was, du bist also vom Himmel gefallen?«
»Ja«, sagte ich bescheiden.
»Das ist aber lustig …«
Und er fing an, mich auszulachen. Das ärgerte mich, denn ich mag es nicht, wenn man sich über meine Unfälle lustig macht.
Er aber fragte mich weiter aus: »Du kommst also auch aus dem Himmel! Auf welchem Planeten bist du denn zu Hause?«
Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz
Pfingstmontag 2012 leitet die einmotorige Cessna Skyhawk mit dem Heckzeichen PH-SJK über Ouddorp den Sinkflug ein. Eine Minute lang taucht der Pilot unter die Wolkendecke, um Sicht auf die Küstenlinie und den von ihm festgelegten Kurs zu bekommen.
In der Ferne steigt Nebel aus dem Meer. In einer fließenden Bewegung schiebt er sich auf den Strand – so, wie einst die ersten Meerestiere an Land gekrochen sein müssen.
Früher an diesem Morgen – um 10:22 Uhr – hat das Königlich Niederländische Meteorologische Institut KNMI in seinem Bericht für die Luftfahrt vor dem Zustrom feuchter Luft aus nordwestlicher Richtung gewarnt. Es wird ein strahlender Tag, aber entlang der Küste kann »Dunst aufsteigen, örtlich auch Nebel«.
Die Art von Nebel, die der Pilot vor seinen Augen entstehen sieht, gibt es im Durchschnitt alle zwei Jahre einmal und er heißt Seerauch. Seinen Namen verdankt er der optischen Illusion einer qualmenden Brandung: Die Wellen spritzen nicht normal, sie dampfen wie Teekessel.
Um 11:19 Uhr erreicht das kleine Flugzeug den tiefsten Punkt seines Sinkflugs: 450 Fuß. Ein Fuß ist so lang wie ein Schuh der Größe 47. Um sich die Flughöhe vorzustellen, kann man »Hacke gegen Spitze« einmal 450 Schritte abmessen. Die Entfernung, die man dann erhält, lehnt man wie eine imaginäre Leiter gegen die Wolken und steigt hinauf. Das Ziel ist schnell erreicht.
Sobald der Pilot die Landschaft in sich aufgenommen hat, zieht er das Nasenrad der Skyhawk wieder nach oben. Unter sonorem Brummen beschreibt er eine Kurve in Richtung offenes Meer, um den aufsteigenden Nebel zu umfliegen. Es ist 11:20 Uhr (eine Minute nach dem Tiefflug unter den Wolken), als die PH-SJK über den Bordfunk mit dem Kontrollturm des Rotterdamer Flughafens Kontakt aufnimmt. Der Pilot bittet um Landeerlaubnis über die Anflugroute HOTEL. Das bedeutet: Im Bogen über die Mündung von Maas und Rhein und dann ostwärts über den Nieuwe Waterweg – wie die Öltanker und Containerschiffe, aber eben höher.
Der Tower heißt PAPA. Dort hinten leuchtet die Landebahn wie ein ausgerollter Teppich in der Sonne; die Luft ist buchstäblich rein.
»This is Rotterdam informationPAPA«, antwortet der diensthabende Fluglotse. Er weist den Piloten an, auf 1500 Fuß zu steigen und sich über Hoek van Holland erneut zu melden. Angesichts des Kurses, der Dauergeschwindigkeit und der Position auf dem Radar müsste die PH-SJK innerhalb von fünf Minuten die vereinbarte Stelle erreichen. Aber die PH-SJK wird sich nicht mehr melden. Nie mehr, bei niemandem.
Ein Einwohner von Ouddorp ist der letzte, der die rot-weiße Cessna »visuell ausgemacht hat«: Der Mann sieht, wie sich das Endstück des Viersitzers in den Wolken über dem Dünenrand auflöst.
Wenige Flugminuten nördlich von Ouddorp versammelt sich zur gleichen Zeit eine Gruppe Eltern mit Kindern zu einer Rundfahrt mit dem FutureLand Express. Das ist ein cooler Zug bestehend aus einem Traktor, der zwei zu Fahrzeugen umgebaute Karren zieht.
Die Passagiere sind aufgeregt, weil sie zu den ersten gehören, die auf jungfräulichem Boden abgesetzt werden sollen: Die frisch aufgespülte Maasebene 2 ist noch fast unbetretenes Gebiet. Physisch gesehen ist es ein kleiner Schritt, wenn sie gleich vom Trittbrett auf dieses neue Land-im-Meer springen; und doch wirkt es bedeutend, als ginge es jeden etwas an.
Laut Fahrplan soll der FutureLand Express um 12:00 Uhr von einer Plattform aus Betonplatten am Rand des bestehenden Hafengebiets abfahren. Der Morgenhimmel ist blau, aber gegen Mittag bewölkt es sich. Eine Brise kommt auf, die Temperatur sinkt. Die dreiflügeligen Windräder von GREENCHOICE rühren recht zurückhaltend im aufkommenden Nebel. Sie mischen die salzige Seeluft mit dem Fabrikqualm aus den Häfen.
In dieser Woche, nur ein paar Tage zuvor, ist die Maasebene 2 mit einem Feuerwerk aus blauem Rauch in Betrieb genommen worden. Mit einem Champagner-Toast – am Dienstag, dem 22. Mai – wurde auch der umliegende Strand für die Öffentlichkeit freigegeben. Zu diesem neuen Strand gehört eine vierzehn Meter hohe Dünenreihe und dahinter die »Sandkörper« der zukünftigen Kais. Weil die Anpflanzung von Dünengras auf sich warten lässt, ähnelt die Maasebene 2 vorläufig noch der Sahara.
An diesem Pfingstmontag treibt ein kalter Nebel die Badegäste vorzeitig nach Hause. Die Fahrt des FutureLand Express findet statt, auch wenn die Sicht schon kurz nach der Abfahrt auf fünfzig, höchstens hundert Meter sinkt. Weder der Traktorfahrer noch seine Passagiere haben an diesem Vormittag das Gebrumm eines Propellerflugzeugs gehört. Nur Möwengeschrei.
Das Verschwinden eines Flugzeugs in einem der weltweit am dichtesten bevölkerten Länder ist eine Rarität. Das Fliegen selbst nicht mehr; durch die Luft zu steuern, fühlt sich mittlerweile an wie eine zweite Natur.
Ein Jahr später veröffentlicht der Untersuchungsrat für Sicherheit einen 151 Seiten umfassenden Bericht unter dem Titel Flugzeug vermisst. Anders als bei Schiffen im Bermudadreieck ist die Vermisstenanzeige der Cessna Skyhawk nicht für immer. Die Suche dauert 301 Minuten. Fünf Stunden nach dem letzten Kontakt mit Rotterdam PAPA wird das Wrack der PH-SJK gefunden – 800 Meter hinter dem entferntesten Halteplatz des FutureLand Express, auf dem im Bau befindlichen Kai zwischen den zwei Prinzessinnenhäfen – dem Prinzessin-Amalia-Hafen und dem Prinzessin-Alexia-Hafen. Das kleine Flugzeug, geknickt und flügellahm, liegt mit einer Vierteldrehung neben seinem eigenen Einschlagkrater. Wie ein Vogel, der gegen eine Fensterscheibe geprallt ist. Der Zeiger des Geschwindigkeitsmessers steht auf 118 Knoten – 129 Kilometer pro Stunde.
Vorn im Cockpit hängt der Körper des 50-jährigen Piloten. Der aus der Luft Gefallene ist nicht ansprechbar, atmet aber noch. Er wird das Bewusstsein nicht mehr wiedererlangen und zwei Wochen später im Krankenhaus sterben. Das Display seines Telefons zeigt eine Reihe verpasster Anrufe an. In seiner Flugtasche befindet sich ein Visual Approach Chart für den Anflug auf Rotterdam Airport. Auf der Luftnavigationskarte (aus dem Jahr 2008) liegt die Küstenlinie dreieinhalb Kilometer landeinwärts.
Auch die Rettungsbrigade arbeitet mit Karten, die von der fortschreitenden Wirklichkeit eingeholt wurden. Die Cessna wäre ins Meer gestürzt, hätte man die Küstenlinie nicht verlegt. Das Wasser hat dem Trockenen Platz gemacht. Aber bei der Eingabe der letzten bekannten Koordinaten der PH-SJK (sechsunddreißig Sekunden vor dem Aufprall), erscheint auf den Computerschirmen des Rotterdamer Flughafens eine Position über dem Meer. Zwar steht dort BEINGRECLAIMED, aber die Farbe der Karte ist hellblau für Wasser.
»Wir haben, glauben wir … [nicht verständlich] ins Meer stürzen sehen«, meldet ein Fluglotse der Küstenwache. Daraufhin fahren fünf Schiffe aus.
Die Maasebene ist ein nationales Sandschloss, die Prinzessinenhäfen sind seine Burggräben. Der verwendete Sand stammt aus einer unterseeischen Grube: Er wurde über die Saugstangen von Baggerschiffen aus einer Sandbank geschlürft, sechs Meilen vor der Küste. In den Eiszeiten lag diese Sandbank trocken. Über die windige Fläche zwischen dem, was jetzt England und die Niederlande heißt, liefen Nilpferde und Hyänen, Mammuts und Nashörner, Höhlenlöwen und Waldelefanten.
Durch die Abgrabung des Nordseebodens machen wir Menschen unbeabsichtigt etwas Wahnsinniges: Wir sprühen die Prähistorie zurück an die Oberfläche. Natürlich sind die Baggerer auf Sand und Kies aus, den sie in glitzernden Schlammbögen an die Stellen »rainbowen«, an denen Land entstehen soll. Aber ihr Beifang besteht aus Backenzähnen von Mammuts, Elchgeweihen, versteinerten Hyänenköteln – Überresten der Urzeitfauna.
Den Teilnehmern des FutureLand Express reichen im Prinzip zwei Meter Sicht; Hauptsache, sie sehen den Sand unter ihren Füßen. Strandräuber sind es. Sie suchen keine über Bord gefallenen Whiskykisten, auch keine Muscheln, sondern Fossilien.
Der Hauptpreis wäre der Schädel eines Menschenartigen. Weiter oben an der Küste, in Zeeland, wurde das erste Stückchen Urmensch bereits gefunden. Ein Wanderer entdeckte es zwischen dem Unrat, der von einem Muschelsauger an Land gespült worden war. Es handelte sich um ein Schädelfragment mit einer Ausstülpung über den Augenhöhlen, die dem modernen Menschen fehlt. Bei näherer Betrachtung war es der erste in den Niederlanden gefundene Neandertaler, der 2009 unter dem Namen »Krijn« der restlichen Bevölkerung vorgestellt wurde. Zu Lebzeiten muss er ein Jäger gewesen sein, der im Delta der Flüsse Themse, Rhein und Maas über die Mammutsteppe zog – vor etwa hunderttausend bis vierzigtausend Jahren.
Seither schmolzen die Eiskappen, stieg der Meeresspiegel, starb der Neandertaler aus und brachte sich der flügellose Homo sapiens das Fliegen bei. Er lernte auch, das Land vom Wasser zu trennen.
Das neue Land ist noch nicht übergeben, da nähert sich eine Cessna Skyhawk. Obwohl der Tower den Piloten angewiesen hat zu steigen, sinkt er noch einmal unter die Wolken, um zu schauen, wo er hinfliegt. Wie ein Delphin, aber gespiegelt in der Luft. Es gibt nur einen einzigen Unterschied zu eben: unter den Wolken hängt dichter Nebel. Der Pilot drückt den Steuerknüppel weiterhin nach vorn. Sein Flugzeug taucht in eine graue Welt aus Wasserdampf, die bis zur neuen, von Fossilien nur so wimmelnden Erdoberfläche weitergeht.
1
Die Stoßzeit ist vorüber, die erste verkehrsarme Stunde des Tages bricht an. Mein Intercity hat fünf Minuten Verspätung, was meiner Sehnsucht nach Kaffee und Proviant sehr entgegenkommt.
Ich bin unterwegs für eine Reportage, doch zur Abwechslung mal nicht allein. Seit Kurzem habe ich einen Lehrauftrag als Gastschreiber an der Universität Leiden. Vor fünfundzwanzig Jahren habe ich zuletzt im Hörsaal gesessen; jetzt stehe ich vor den Bänken. Ich bin kein Student mehr, ich habe Studierende. Einundvierzig laut Liste – ein Großteil von ihnen taucht oft gar nicht auf. Der Rest, der harte Kern, wird sich mir gleich um zwölf Uhr anschließen. Sie studieren Niederländisch, Englisch, Französisch, Humanistik, Pädagogik, Kunstgeschichte, Philosophie und Theologie, auch wenn es Letzteres nicht mehr gibt: es heißt »Religionswissenschaften«. Mein Lehrauftrag dreht sich um Berichterstattung. Schon während meiner ersten Veranstaltung habe ich angekündigt, dass wir eine Fahrt auf der Maas unternehmen werden. Jetzt, nach vier Wochen drinnen, ist es soweit. Start- und zugleich Treffpunkt ist der Bahnhof Tegelen am Limburger Maasufer. Jeder Studierende wird von dem, was wir heute Nachmittag gemeinsam erleben, individuell einen Bericht verfassen; er zählt für die Endnote.
Im Gang des mittlerweile eingetroffenen Intercitys erscheint auf Kniehöhe die Nase eines Golden Retrievers in einem Führgeschirr aus weißen Lederriemen. Das Tier ist auf der Suche nach einem Sitzplatz für eine Frau mit indonesischen Gesichtszügen. Sie geht hinter ihm, die Hundeleine in der einen Hand, in der anderen einen hin- und hertickenden Stock.
Gemeinsam lassen sie sich nieder: Der Golden Retriever auf dem Boden zu meinen Füßen, die Frau mit ihrer Umhängetasche auf dem orangefarbenen Sitz mir gegenüber.
In drei Tagen ist Nikolaus – ich esse Pfeffernüsse. Zwei wässrig schimmernde Augen sehen mich von unten her an. Der Hund trägt eine Weste aus dünnem Stoff, wie ein Wettkampfathlet. Statt der Rückennummer steht dort NICHTSTREICHELN. Füttern wird dann erst recht nicht erlaubt sein, also stecke ich die knisternde Tüte weg.
»Dankeschön«, sagt die Frau. Tastend, aber dennoch treffsicher, zieht sie einen Papierstapel aus ihrer Tasche. Plötzlich spricht ihre Armbanduhr: »Am-ster-dam Haupt-bahn-hof, neun Uhr sieben.« Das ist die fahrplanmäßige Abfahrtszeit, aber das Trillern der Schaffnerpfeife lässt noch auf sich warten.
Weil ich selbst auch einen Bericht schreiben werde, zücke ich mein Notizbuch. Es ist schwarz und flexibel mit einer vorgedruckten Zeile: In case of loss, please return to … As a reward: $ … Müsste ich mal ausfüllen, aber nicht jetzt.
Ich schlage das Deckblatt um und notiere schnell ein paar Stichworte zum Golden Retriever, den Pfeffernüssen, der sprechenden Uhr.
Als ich wieder aufschaue, liest die Frau. Der Packen Papier auf ihrem Schoß entpuppt sich als tintenloses Buch. Ihre Fingerspitzen bewegen sich aufeinander zu und voneinander weg. Brailleschrift lesen ist eine zweihändige Tätigkeit, wie Stricken ohne Nadeln, ohne Wolle. Ich staune.
Über das blind lesen, blind reisen, blind vertrauen.
Über die Brailleschrift.
Über Blindenführhunde. Nein, falsch. Über die Symbiose zwischen Menschen und Tieren.
Berichterstattung, habe ich den Studierenden erzählt, entsteht aus Staunen. Egal, wovon man berichtet – in Gedanken kann man dem immer ein »Hör mal!« vorausschicken. Manchmal ist die Nachricht so dringend, dass nicht einmal dafür genügend Luft bleibt. »Wir haben gewonnen!«, ruft man dann aus, als wäre man ein Eilbote, der von Marathon in Athen einläuft.
Ich erkundigte mich, wer von ihnen joggte. Ob sie wüssten, dass ihr Sport aus dem Überbringen von Nachrichten hervorgegangen sei. Vom Kurier und Courant zum niederländischen Wort krant für Zeitung. Anders als Hasen oder Füchse rennen wir, weil wir etwas zu erzählen haben.
Und darauf kommt es an: Jemand hat etwas gesehen oder gehört und will es denjenigen überbringen, die nicht dabei waren. Sprache ist das Medium. Sechsundzwanzig Buchstaben und eine Handvoll Satzzeichen, nicht mehr und nicht weniger.
Jeder Reporter müsste sich eigentlich fühlen wie ein Kind, das nach Hause rennt, um den Eltern zu erzählen, was es Besonderes erlebt hat. Das zwingt zu kurzen Sätzen, Ordnung, das Wichtigste zuerst. Aber auf diese Methode habe ich verzichtet. Die Wirklichkeit ist zu widerspenstig für Übereiltes. Sie ist zu krumm für direktes Reden, zu zerknittert zum Ausbügeln, zu ungereimt für einen Limerick.
»Erzählt es deshalb einem Kind«, sagte ich meinen Zuhörern. Ich suchte nach einem Stück Kreide und fand einen Stift. Die Schultafel hinter mir entpuppte sich als Whiteboard. »Ein Kind schaut nicht nur mit den Augen. Es weiß, dass die wichtigsten Dinge unsichtbar sind.«
Im Seminarraum roch es säuerlich. Ich ließ ein Fenster öffnen und hängte eine Landkarte von Indonesien auf, die Inselkette von Sumatra bis Papua-Neuguinea. Die Tafelwischer zum Entfernen der Stiftspuren waren magnetisch – sehr praktisch.
Von einem Ende der Javasee zum anderen gehend, besprach ich mein Programm für die wöchentlichen Übungsseminare zwischen jetzt, Oktober 2016, und den Weihnachtsferien.
»Wir beginnen am Anfang«, hörte ich mich sagen. »Anfang« durfte man wörtlich nehmen. Ich selbst wollte eine lange Reportage schreiben, hatte aber noch fast nichts. Nur die Idee, der ich im Freien nachjagen wollte, und das vorgesehene Jagdgebiet.
Ich lud die Studierenden ein, sich am Entwurf zu beteiligen. Als Kollektiv würden wir die groben Umrisse skizzieren, was bedeutete, dass wir gemeinsam an der Wiege eines neuen Buches standen. Dieses Buches.
In der Praxis, fuhr ich fort, geben wir uns als Ermittler aus, die auf einen Fall angesetzt werden. Das hieß, wir würden Vermutungen nachgehen, Zeugen befragen, mögliche Szenarien ausarbeiten, laut über eventuelle Motive nachdenken. Und auch: Spuren am Tatort untersuchen.
Gab es eine Leiche?
Die gab es. »LB1« stand auf dem Etikett am Zeh.
»Wer von Ihnen hat schon einmal vom »Mensch von Flores« gehört, dem Homo floresiensis?«
Ich preschte voraus. Aber zum Glück hatte ich die Karte aufgehängt. »Flores, die Insel?«
Laut The World Factbook der CIA zählt der indonesische Archipel 17508 Inseln. Rund tausend von ihnen sind bewohnt. Ganz Indonesien ist islamisch geprägt, aber mindestens eine Insel ist überwiegend hinduistisch (Bali), eine protestantisch (Ambon) und eine katholisch (Flores).
Meine Hand glitt über den Smaragdgürtel: »Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores … und hier, zwischen Bali und Lombok die Wallace-Linie.« Ich kam mir vor wie ein Erdkundelehrer.
Weder die Wallace-Linie noch ihr Namensgeber Alfred Russel Wallace lösten so etwas wie Erkennen aus. Dies war die älteste Universität der Niederlande, gegründet 1575, aber meine Seminarreihe fiel unter Literaturwissenschaft, und es hatten sich keine Studierenden der Naturwissenschaften angemeldet. Erneut ging ich ein paar Schritte zurück, dieses Mal für einen Anlauf, der bei Charles Darwin begann, On the Origin of Species (Über die Entstehung der Arten), 1859.
Die Galapagosinseln ließ ich außen vor und schaltete zurück nach Indonesien, wo Alfred Russel Wallace – unabhängig von Darwin – zur gleichen Zeit eine Evolutionstheorie aufgestellt hatte. Wallace verwies auf den tiefen Graben zwischen Bali und Lombok und die unterschiedliche Flora und Fauna, die sich beidseitig der Meerenge entwickelt hatten. Die Inseln westlich dieser Trennlinie wiesen einen typisch asiatischen Artenreichtum auf, die im Osten einen typisch australischen.
Eigentlich wollte ich nur sagen: Flores liegt östlich der Wallace-Linie. »Und dort fand man 2003 in einer Höhle ein Skelett.«
Es handelte sich um die sterblichen Überreste einer erwachsenen Frau. Das Skelett war ein Fossil aus der Urzeit. Obwohl sie erwachsen war, muss sie zu Lebzeiten gerade mal einhundertvier Zentimeter gemessen haben. Ihre Zwergengestalt an sich hätte kein Erstaunen hervorrufen müssen, wäre nicht auch ihr Kopf klein gewesen. Außergewöhnlich klein, denn ihr Schädel hatte das Format einer Kokosnuss. »Einer Grapefruit«, wie manche meinten.
Das Papierrascheln und Hantieren mit Schreibetuis hörte auf. In der Stille, die sich im Raum 0.04 des Literaturtrakts ausbreitete, berichtete ich den Studierenden über die abweichende Anatomie von LB1:
Sie besaß das Gehirnvolumen eines Schimpansen (400 ccm). Zum Vergleich: Wir, der Homo sapiens, haben dreimal so viel Gehirnvolumen (1200 bis 1400 ccm).
Betrachtete man den Bau ihrer Wirbelsäule und ihrer Handgelenke, war sie keine Affenartige, die in den Bäumen lebte;
LB
1 ging aufrecht, genau wie der Homo habilis, der Homo erectus und andere Mitglieder des Menschengeschlechts.
Sie hatte flache Füße, die sich für das Zurücklegen langer Strecken eigneten.
Datierungstechniken wiesen aus, dass sie vor etwa 18000 Jahren auf der Erde herumgelaufen sein musste.
Ihre Nachfahren sollen erst vor 12000 Jahren gestorben sein, bei einem Vulkanausbruch, der ganz Flores unter einer Schicht versengender Asche begrub.
»A new human«, behauptete das Ausgrabungsteam. Am 28. Oktober 2004 prangte dieser Miniaturmensch von kaum fünfundzwanzig Kilo auf der Titelseite von Nature. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden hatten nahezu alle Nachrichtendienste dieser Welt den »Homo floresiensis« als den neuesten Spross in der Familie der Menschenarten »begrüßt«.
Der Mensch von Flores mochte zwar ein neuer Trieb am Stammbaum des Geschlechts Homo sein, aber niemand wusste, an welchem Ast, denn es gab etwas, das einfach nicht in Übereinstimmung zu bringen war: LB1 hatte nicht mehr Gehirnvolumen als ein Affe, war jedoch intelligent genug, um Werkzeuge herzustellen und zu jagen (wie die gebrochenen Tierknochen und Faustkeile besagten, die man neben ihrem Skelett gefunden hatte). Diese Kombination schien nicht möglich. Der Mensch von Flores war in jeder Hinsicht ein Fremdkörper.
Um im Bild zu bleiben: Wenn alle bislang bekannten Menschenartigen zu den Obstarten gehörten, war LB1 eine Christbaumkugel. Ein kleiner Scherz des Allmächtigen.
Was macht das mit unserem Menschenbild?
Jetzt näherte ich mich allmählich meiner Idee.
ABWEICHUNGVERSUSNORM, schrieb ich auf das Whiteboard. Was ist normal? Und wie legt man das fest?
Es ging mir um mehr als um Maße, Plattfüße oder Hirnvolumen. Groß-klein, dick-dünn – das waren augenfällige, messbare Kontraste. Ich wollte diese Linie sukzessive vom Äußeren zum Inneren, von der Gestalt zum Verhalten, vom Früher ins Jetzt verlängern.
Was ist abnormal? Wer bestimmt das?
Solche Fragen beschäftigen mich. Als Kind hat man mir beigebracht, fügsam durchs Leben zu gehen, Kopf zwischen den Schultern. Wer sich am Median rieb, spielte auf Nummer sicher, er war das Freimal, von dem man sich beim Fangenspielen am besten nicht zu weit entfernte. Aber jetzt, kaum eine Generation später, verlangt man den Kindern das Gegenteil ab. Auffallen. Herausragen. »Sich unterscheiden« ist zu einem Verb geworden, einer Lebensaufgabe. Worin unterscheiden? Egal. Worin man sich vom Rest unterscheidet, bestimmt, wer man ist. Nicht mehr lange und der Unterschied wird zur Übereinstimmung!
Wir alle schlagen wie wild mit der Flosse aufs Wasser, aber anders als der Wal glauben wir Menschen, die Spritzer, die wir verursachen, seien wichtig. »Wir neigen dazu, uns selbst zum Maßstab zu machen«, hielt ich den Studierenden vor. »Aber warum bezeichnen wir den Menschen von Flores eigentlich als klein?«
Im Handumdrehen gelang es den Seminarteilnehmern, die Begriffe »groß« und »klein« zu relativieren. Ob man jemanden oder etwas für klein hielt, hing von der eigenen Körpergröße ab. Der Elefant schaut auf die Maus nieder, die Maus auf die Ameise. Ja, sagte ich, aber jeder war mal klein. Wir können uns in die Haut eines Zwerges versetzen, weil wir alle einmal zu Erwachsenen aufgesehen haben. Wir haben an Rockzipfeln und Hosenbeinen gehangen. Jeder von uns hat Ärmchen hochgestreckt, jedes Kind wurde Hunderte Male von Onkeln und Tanten hochgehoben, um genauso oft wieder auf seinen Platz zurückgestellt zu werden.
Ich zitierte Antoine de Saint-Exupéry: »Alle großen Leute waren einmal Kinder (aber nur wenige erinnern sich daran).«
Es wurde mitgeschrieben.
»Vielleicht war LB1 nur zufällig klein geraten?« Dieser Einwurf kam von Lian, Philosophiestudentin im dritten Studienjahr, selbst asiatischer Abstammung und nicht gerade groß. (»Darum trage ich Absätze«, wird sie später sagen). »Oder eine Liliputanerin? Ich meine: dass sie die Ausnahme war?«
Ich bekomme gern Kontra. Zur Verteidigung der Ausgrabenden führte ich an, sie hätten diese Möglichkeit sehr wohl erwogen, untersucht und ausgeschlossen. Ihre Entdeckung hatten sie in einer Höhle mit dem Namen Liang Bua gemacht. LB1 stand für Liang Bua 1. Unter diesem überhängenden Felsgewölbe fanden sie auch Rippen und Armknochen anderer Floresmenschen: LB2, LB3 bis einschließlich LB9. Auch wenn bei ihnen keine Schädel lagen – die Knochen stammten ausnahmslos von Miniaturmenschen.
Und um die Geschichte noch ein wenig auszuschmücken: In derselben Höhle lag das Skelett einer ausgestorbenen Storchenart. Ein Gigant. Aufrecht stehend war dieser Riesenstorch fast doppelt so groß (1 Meter 80) wie der Mensch von Flores. Auch das wirkte schon wie ein Scherz einer Gottheit, der es ein satanisches Vergnügen bereitet, die Menschheit im Märchen glauben zu lassen: Je größer der Storch, desto kleiner die Babys, die er abliefert.
Die Fauna von Flores war im Übrigen ziemlich groß im Zustandebringen abweichender Formate. Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts fand der niederländische Missionspater Theodor Verhoeven auf Flores fossile Reste von Elefanten mit der Widerristhöhe eines Ponys. Es waren keine Mastodonten, sondern Stegodonten: Zwergelefanten mit Minirüsseln und Ministoßzähnen; ihre Jungen hätte man wie Kuscheltiere hochheben können.
Der Pater war der erste, der in Liang Bua einen Spaten in den Boden gestoßen hatte. In einer Ecke unter den Stalaktiten, die wie Tropfkerzen von der Decke hingen, ließ er 1950 eine Probegrabung durchführen, einfach, um zu sehen, was dort verborgen lag. Er fand – die Fabel beginnt gerade erst – Skelette von Ratten in der Größe von Hunden. Pater Verhoeven lebt in ihrem Artennamen weiter, papagomys theodorverhoeveni, auch bekannt als »Verhoeven’s Giant Tree Rat«. Er fand spitznasige und stumpfnasige Ratten, Bodentiere und Baumkletterer – unsere Wühlratten können ihnen nicht im Entferntesten das Wasser reichen.
Noch immer steht Flores für verschiedene Tiere mit einer Riesengestalt. Außer den Ratten sind auch die Schildkröten und Echsen am Strand riesig. Letztere werden bis zu drei Meter lang und bewegen sich wie hochbeinige Krokodile fort. Komodowarane heißen sie, dragons auf Englisch: Aus Jurassic Park ausgebrochene Reptilien, so korpulent wie die Touristen, die sie bestaunen.
Was anderswo auf der Welt für groß gehalten wird (Elefanten), ist auf dieser Insel klein. Dagegen sind kriechende Tiere (Schildkröten, Echsen, Ratten) übergroß. Die umgekehrte Welt von Flores: Könnte es einen schöneren Versuchsgarten geben, an dem sich Abweichung und Norm messen ließen?
Wir gehen hinunter in den Kaninchenbau, kündigte ich an, und dazu brauchen wir Alice im Wunderland gar nicht. Flores ist ein Wunderland, ein real existierendes.
Aber wir brauchen versierte Begleiter. Als Erstes wollte ich den Lebenslauf von Pater Verhoeven vertiefen. Er entsprach a priori dem Profil des tragischen Helden. DERMANN, DERNICHTTIEFGENUGGRUB schrieb ich auf das Whiteboard. Pater Verhoeven schien wie geschaffen für die Vermittlerrolle zwischen der Idee, der es nachzujagen galt (Warum halten wir uns selbst für die Norm?), und dem Jagdgebiet (Flores als Schatzkammer für abweichende Lebensformen). Er diente uns vorläufig als Leitfigur.
Von Theodor Verhoeven wusste ich bislang nur, dass er ein außergewöhnlicher Missionar gewesen sein musste: Ein Geistlicher, der nicht nur zum Himmlischen tendierte, sondern auch zum Irdischen und Unterirdischen. In den fünfziger und sechziger Jahren führte er in der Höhle Liang Bua zahlreiche Grabungen durch, immer tiefer. Wie wahrscheinlich ist es, auf den Schädel einer noch unbekannten Menschenart zu stoßen, wenn man irgendwo auf dieser Welt einen Spaten in den Boden sticht? Doch wie durch ein Wunder lag Pater Verhoeven genau richtig. Allerdings war seine Grube nur 3 Meter tief, während der verborgene Schatz, das Skelett von LB1, auf einer Tiefe von 5 Meter 90 lag.
»Doch seine Tragik reicht noch tiefer«, sagte ich. Denn womit war er nun eigentlich zugange, während er im Erdboden wühlte? Die Fakten, die der Priester aufdeckte, unterminierten die Kirchenlehre. Stand der Fund fossiler Zwergelefanten nicht im Widerspruch zur Genesis? Wie erklärte er das seinen indonesischen Seminaristen? Vergesst die ersten sieben Tage, vergesst dieverbotene Frucht, die lispelnde Schlange, die Vertreibung aus dem Paradies. Im Anfang waren Stegodonten …
Seine Leidenschaft für Fossilien konnte nur im krassen Widerspruch zu seiner Missionsarbeit, seinem Gottesglauben stehen. Es schien mir nicht undenkbar, dass Pater Verhoeven mit sich selbst im Unreinen war. Wer weiß, vielleicht war er ja sogar von seinem Glauben abgefallen?
Außer seinem Geburts- und Todesjahr (1907–1990) trug Theodor Verhoeven bei jedem Internet-Treffer die Abkürzung SVD hinter seinem Namen. Das stand für Societas Verbi Divini, die Gesellschaft des Göttlichen Worts, eine katholische Kongregation mit Stammsitz im Dorf Steyl an der Maas bei Tegelen in der niederländischen Provinz Limburg.
Die Klostergemeinschaft in Steyl entsandte Theodor Verhoeven 1948 als 41-jährigen Missionar nach Flores; in Amsterdam ging er für die sechswöchige Seereise an Bord der SS Kaloeloe. Fühlte er sich vom Abenteuer angezogen oder litt er wie der Schriftsteller Jan Jacob Slauerhoff an »Herausweh« und wurde von einer unsichtbaren Hand kraftvoll die Landungsbrücke eines Ozeanschiffs hinaufgeschoben, weg aus den Niederlanden? Ich sprach von Push- und Pullfaktoren, die bei jeder Auswanderung eine Rolle spielten. Viele Missionare waren Flüchtlinge, die wegen der herrschenden Armut und Aussichtslosigkeit ihr Elternhaus verlassen hatten, und ihr Heil im Seminar suchten.
Hatte Theodor Verhoeven Kinder? Er mochte zwar ein zölibatär lebender Priester gewesen sein, der ein Keuschheitsgelübde abgelegt hatte, doch Verhoevens eventuelle Kinder könnten unehelich sein. Darüber wissen wir nichts, sagte ich, aber wir dürfen es auch nicht im Vorhinein ausschließen.
»Er war aber verheiratet.«
Aus den Augenwinkeln hatte ich gesehen, dass eine Seminarteilnehmerin nach ihrem Smartphone gegriffen hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass private Kommunikation im Seminar erlaubt war. Gerade, als ich eingreifen wollte, hob sie die Hand. Anders als vermutet, hatte sie hier und jetzt das Netz nach Daten zu Theodor Verhoeven durchsucht. In einem Spezialwörterbuch über Säugetiernamen – unter dem Eintrag »Verhoeven’s Giant Tree Rat« war sie fündig geworden.
»Soll ich es vorlesen?«
Father Dr. Theodor Verhoeven was a Dutch archeologist who was also a Catholic missionary in Indonesia. After twenty years as a priest […], he left the priesthood, married his secretary, and returned to Europe.
2
Unmittelbar hinter dem Bahnhof Tegelen ragt ein raketenförmiges Minarett auf. Wir kommen wegen eines Klosters und stehen vor einer Moschee. Unser Treffpunkt Tegelen liegt auf der höchsten Maasterrasse rund um Gruben mit schwerem Flusslehm, aus dem schon die Römer tegulae, Fliesen, brannten.
Ich bilde anscheinend die Vorhut. Damit wir nachher keine Zeit verlieren, vergleiche ich schon mal den Bahnhofsplatz mit der Fußgängerstrecke nach Steyl, wie sie auf Google Maps abgesteckt war. Parallel zur Bahnlinie hat man gewaltige Happen aus der Landschaft genommen. Tongruben, von denen eine noch für die Dachpfannenindustrie in Betrieb ist.
Ich will mich darin üben, Landschaften »lesen« zu können. Schrammen, Narben, Einkerbungen – wer hat sie verursacht? Wem es gelingt, durch die Linse der Zeit zu schauen, dem eröffnen sich unerwartete Panoramen. Geologen machen nichts anderes: Sie ergänzen jede Felswand oder Flussablagerung um eine zusätzliche Dimension, die »Zeittiefe«. Die Vorstellung, dass der Tegelener Lehm vor zwei Millionen Jahren entstanden ist, verwandelt die Löcher in der Landschaft in prähistorische Abgründe: Auf dem Boden der Gewinnungsstellen hat man Fossilien von Nashörnern und Nilpferden gefunden, von Panthern und Affen, von Sumpfschildkröten und Stachelschweinen, und vom großen und kleinen Eucladoceros teguliensis, dem »Tegelener Hirsch«. Direkt zu meinen Füßen liegt eine ebenso fabelhafte Fauna wie die von Liang Bua auf Flores.
Aber wir sind wegen andersartiger Grabungsarbeiten hier. Sobald alle eingetroffen sind und wir das Bahnhofsgebäude verlassen, gebe ich die Anwesenheitsliste herum. Wir sind fünfzehn. Unten im Klosterdorf Steyl, dem Anlegesteg der kleinen Fähre über die Maas gegenüber, erwartet uns ein Mitarbeiter der Gesellschaft des Göttlichen Worts. Er wird uns herumführen.
In kleinen Gruppen gehen wir den Steylerweg hinunter bis zu einer Steinmauer, die einen botanischen Garten mit drei Klöstern umgibt. Bevor wir am Tor angelangt sind, rückt Pien, studentische Hilfskraft, drittes Studienjahr Niederländisch und Violinistin, mit einer Idee heraus. Sie denkt darüber nach, ihren Bericht mit der Beerdigung von Pater Verhoeven im Jahr 1990 anfangen zu lassen.
»Ashes to Ashes sozusagen.«
Ich bin überrascht. Ein Begräbnis als Anfang. Ich sehe eine Eröffnungsszene vor mir, die sich mit der Ausgrabung des Menschen von Flores dreizehn Jahre später spiegeln lässt. Wie eine Waage, die ebenso plötzlich wie unerwartet (postum!) ausschlägt: Das Absenken des Sargs mit den irdischen Resten von Pater Verhoeven und die Wiederauferstehung des Homo floresiensis. Das ist doch mal ein Bildreim!
Nur: Ich bezweifele, dass Theodor Verhoeven hier auf dem Friedhof von Steyl begraben ist. Ein Priester, der den Orden verlässt und heiratet – ist das kein Grund zur Exkommunikation? Aber vielleicht habe ich etwas verpasst, und die katholische Kirche ist mit der Zeit gegangen.
Einzig und allein für das Gefühl des Ankommens überqueren wir die Maas mit der Fähre Steyl-Baarlo, hin und zurück. Der Fährmann berechnet uns die einfache Strecke, wenn wir an der gegenüberliegenden Seite nicht an Land gehen. Er lässt zwei Binnenschiffe passieren, bevor wir umkehren; offensichtlich bewegt sich hier alles ein wenig träge. Auf dem Vorderdeck stehend, Kurs auf die behäbigen Kirchen und Klöster von Steyl, erfolgt unser inszenierter Einzug.
Wir sind kein unbeschriebenes Blatt. In den vergangenen Wochen haben wir eine Menge geleistet, Hintergründe aufgedeckt. Unser Durchbruch als Rechercheteam verlief entlang der Linien, die einen Thrillerautor neidisch machen würden: Eine der dicksten Rattenarten, die Pater Verhoeven ausgegraben hatte, war nach einer gewissen Paula benannt worden. Der Nagetierexperte des amerikanischen Museum of National History in New York legte 1980 fest, dass dieses Exemplar einer gesonderten Gattung angehörte. Dazu gab es einen eigenen Namen, paulamys naso: »Paulas Nasenratte«. Bei der taxonomischen Beschreibung standen zwei Besonderheiten: 1) obwohl anfangs als ausgestorben ausgewiesen, wurde paulamys naso 1989 als lebend in den Wäldern von West-Flores beobachtet; 2) benannt nach der Ehefrau von Dr. Theodor Verhoeven.
Studentin Mariëlle war es gelungen, Paulas Mädchennamen herauszufinden und aus einer Bilddatenbank stammte ein Scan ihres Trauerbildchens. Paula Hamerlinck war 1904 in Evergem geboren und 2001 in Eeklo gestorben, beides Ortschaften in Flandern, Belgien.
Lebensgefährtin des verstorbenen Theo Verhoeven.
»Paula Hamerlinck war eine ehemalige Nonne«, schrieb Mariëlle in unserer Dropbox. »Wie sie sich begegneten, ist noch nicht klar. Jedenfalls waren sie beide schon älter und haben keine Kinder bekommen.«
Obwohl sie nicht die Jüngste der Gruppe war (Mariëlle hatte fünfzehn Jahre als Staatsbeamtin gearbeitet), besaß sie von uns allen die besten Qualitäten bei der Onlinesuche. Stunde um Stunde verbrachte sie in den digitalen Minenschächten, in die sie tiefer eintauchte als alle anderen.
Dabei hatte sie auch eine hundert Jahre alte Anfrage von Theodors Vater Petrus Verhoeven ausgehoben, der darum bat, eine Bäckerei in Uden bauen zu dürfen, auf der Brabanter Moorhochebene, die in die Maas entwässert. Dann jedoch kam Sand ins Getriebe: Seine Frau starb im Jahr darauf, nach der Geburt ihres zehnten Kindes im Jahr 1917. Theodor war Nummer fünf.
Sein eigenes Trauerbildchen aus dem Jahr 1990 vermeldet:
Er war zehn Jahre alt, als seine Mutter starb. Von Anfang an lief Theo allein zum Missionshaus und klingelte dort. Ob es schon einen Platz gäbe? Ein paar Wochen lang, bis er aufgenommen wurde.
Paula hieß in diesem Dokument »seine große Liebe aus dem Spätsommer seines Lebens«. Gemeinsam hatten sie Momente existenzieller Zweifel erlebt:
Er war ein weiser Mann, der kindlich geblieben war und Kinder liebte. Kinder, die unsere Schwierigkeiten mit dem Mysterium Gott, dem Leben und dem Sterben noch nicht kannten.
Stolz wurde seine größte Heldentat erwähnt: Mit seinen Fossilienfunden auf Flores hatte er es in die Weltpresse geschafft. »Er schaute an der Erde vorbei zum Kosmos, zu dem, was weiter reichte.« Letzteres gefiel mir, vor allem, wenn man bedenkt, dass Theo Verhoeven kein Sternkundiger war, sondern in Erdlöcher spähend nach Fernsichten suchte.
Die Universitätsbibliothek Leiden besaß seine Dissertation über das Konzept der Dreifaltigkeit bei Kirchenvater Tertullianus. Sie war ohne Einwände durch die Kirchenzensur gekommen und enthielt Anmerkungen wie: »Es ist nicht alltäglich, sich den alltäglichen, gängigen Vorstellungen zu entziehen.«
Im Katalog befand sich ein Hinweis auf H 1429: Sammlung Dr. Theodorus VerhoevenSVD(1907–1990) mit Aufzeichnungen, Artikeln, Umdrucken und Karten archäologischer Ausgrabungen. Ab 1950, 1½ Kartons. Die Unterlagen konnten auf dem Dachboden der »Besonderen Sammlungen« eingesehen werden. Vier von uns machten sich damit an die Arbeit.
Das Besondere an der Abteilung Besondere Sammlungen: Bevor man einen Archivkarton mitnehmen durfte, wurde dieser bis auf das hundertstel Gramm gewogen. Bei der Rückgabe passierte der Karton dieselbe elektronische Waage – ein Ritual, dem sich jeder Besucher schweigend unterzog. Wir stellten uns einen indonesischen kulturellen Anthropologen vor, der daran ermessen könnte, wie viel Vertrauen die Niederländer ineinander setzen (Ergebnis: kaum ein hundertstel Gramm).
Die Sammlung Verhoeven umfasste keine brüchigen, steinalten Stücke, wohl aber (halb-)wissenschaftliche Veröffentlichungen mit Fotos von Knochenfragmenten und Fundorten. Auf einem war Theodor Verhoeven selbst abgebildet. Darauf beugt er sich über eine flache Grube, seine rechte Hand stützt sich auf einen Erdwall, mit der linken macht er eine schöpfende Bewegung. Anders als der erstaunte indonesische Junge im Hintergrund schaut er ernst, in sich gekehrt. Sein Haar ist gekämmt, er trägt es gescheitelt, die Ohren frei. Aus seiner Haltung und Mimik spricht die Hingabe eines – ich finde kein anderes Wort – Musikers.
Dann kommen die Zeichnungen. Es sind Landkarten der Küstenlinie von Flores, eine durchgehende Straße, die sich an der Längsachse von Flores, den Flussläufen und Höhlen entlangschlängelt. »Liang Mommer« ist offenbar nach Pater Mommersteeg benannt, »Liang Bekkum« nach Vikar van Bekkum. Aus einem gesonderten Ordner taucht ein einzelnes Blatt aus Verhoevens Tagebuch auf – möglicherweise das wichtigste von allen. Das Datum in der oberen Ecke ist der 28. August 1950:
Wir fahren morgens los, Pater Mommersteeg, Pater Piet Smits (und ich), von Ruteng nach Téras. Eine dieser (lokalen) Höhlen ist sehr groß. Während einiger Jahre wurden mehrere Klassen gleichzeitig darin unterrichtet.
Die Dorfkinder, die sie begleiten, tragen einen Tofas bei sich; am Rand ist die Zeichnung eines Hakens mit einer Eisenspitze und einem Griff »von +/- 60 cm«. Pater Verhoeven ist beeindruckt vom »wunderschönen Tropfstein, viele Meter lang«.
Unten nehmen wir das Eckchen rechts und graben: 1½ Meter lang und 75 cm tief. In den oberen zwanzig Zentimetern befindet sich viel Feuerstein. Mit den Tofas können wir wenig anfangen und eine Schaufel haben wir nicht. Das ist eine gute Lehre. Besser in Zukunft ein paar Stichproben machen, bevor wir irgendwo einen Graben ausheben. Die Höhle heißt Liang (=Höhle) Bua (=kalt).
Ich muss an das Spiel »Schiffe versenken« denken. In einem Raster von zehn auf zehn Kästchen versteckt man einen Flugzeugträger, einen Torpedojäger, ein Minensuchboot. Spieler und Gegner wollen gegenseitig ihre Flotte versenken. Abwechselnd werfen sie eine Bombe auf einen der Quadranten, C7 oder F2. Die Hoffnung konzentriert sich auf das U-Boot, das nur zwei Kästchen lang ist und dadurch schwer zu finden. In der Höhle Liang Bua auf Flores kündigen sich an einem Augusttag im Jahr 1950 drei niederländische Pater an, sie wählen einen Quadranten und lassen einen Trommelwirbel aus Tofas der Dorfjugend niedergehen: Direkt über dem Schädel des Homo floresiensis, der ein halbes Jahrhundert später als »die erstaunlichste Entdeckung jedweder Wissenschaft im vergangenen Jahrzehnt« (Science) empfangen wird.
Im März 1952 kehrt Pater Verhoeven mit seinen eigenen Seminarstudenten nach Liang Bua zurück, dieses Mal mit Spaten ausgerüstet. Drei Löcher an drei sorgfältig ausgemessenen Stellen legen Ascheschichten frei sowie ein Tongefäß. »Nach 30 Zentimetern fanden wir Knochen.« Mitfühlend beschreibt er, wie manche der Mitgrabenden die Flucht ergreifen, als sie auf eine Menschenhand stoßen – aus Furcht vor bösen Geistern.
Im Sommer 1954 fördert Pater Verhoeven in der Höhle Liang Toge – zwischen den Resten einer Riesenfledermaus – ein komplettes menschliches Skelett zu Tage. Der Schädel ist zerbrochen; es ist ziemlich aufwändig, ihn mit einem Malerpinsel freizulegen. Der Missionar verpackt die Knochen in Hostiendosen und schickt sie mit dem Paketschiff nach Surabaya auf Java und von dort in die Niederlande. Eine Dose wird falsch zugestellt und landet bei Verhoevens Schwester in Uden.
Aus der Korrespondenz mit einem naturwissenschaftlichen Anthropologen der Universität Utrecht: »Dieser fragmentierte Schädel ist ein faszinierender Fall. Wir sind begeistert.«
Kein Geringerer als der berühmteste Fossilienjäger des Landes, der Deutsch-Niederländer Professor Dr. G.H.R, von Koenigswald gibt das Ergebnis der Untersuchung bekannt: »Zu unser aller großen Freude gehört dieses Skelett eindeutig zu einem Negrito.« Es handelt sich um ein »Mitglied der langschädeligen asiatischen Pygmäen«: ein moderner Mensch, Homo sapiens, aber ein früher: ein Proto-Negrito. Der Mensch von Liang Toge maß zu Lebzeiten 1 Meter 46.
Als Finder und Amateurarchäologe geht Pater Verhoeven daraufhin selbst zur Publikation über – im schweizerischen Kirchenblatt Anthropos: »Das Skelett hat viele archaische Merkmale.« Der Bau des Beckens, die Schärfe der Schneidezähne und die Form des Schädels lassen ihn offen über eine mögliche Abstammung von einem lokalen, noch unbekannten Urmenschen spekulieren.
Verhoeven gräbt weiter. Anfang 1957 findet er einen Elefantenkiefer, nicht in einer Höhle, sondern an einem Steilrand bei einem trockengefallenen Fluss, ein Landschaftselement, das er aus dem Maastal kennt. Er schafft es damit in die Presse; zunächst in den Javabode, dann auch in den Maasbode.
FOSSILESVORSINTFLUTLICHESTIERAUFFLORESENTDECKT
Der Kiefer mit Zähnen oben und unten stammt von einem Zwergelefanten, der vor einer halben Million Jahre lebte. »Was für eine wunderbare Entdeckung, einen dicken Glückwunsch wert«, schreibt von Koenigswald. »Ich hätte nie gedacht, dass unsere Elefanten so weit in den Osten vorgedrungen sein könnten.«
Der Finder selbst fügt dem nicht ohne Stolz hinzu, Alfred Russel Wallace (»ein Freund Darwins«) habe 1859 angemerkt, die großen asiatischen Landsäugetiere seien nicht weiter als bis Bali gekommen. Oder: nicht an der Meeresstraße zwischen Bali und Lombok vorbei. »Man nannte dies die Wallace-Linie«. Aber jetzt hatte der Missionar Verhoeven aus Uden fossile Elefanten auf Flores ausgegraben, zwei Inseln östlicher. In der englischsprachigen Presse hieß es, er habe der Wallace-Linie »a heavy blow« versetzt, einen schweren Schlag.
Nirgendwo in seinen Aufzeichnungen klang Theodor Verhoeven eitel oder einsam oder irgendwie launisch. Es blieb unklar, ob Paula die Artikel in den Archivkartons vorab auf Schicklichkeit durchgesehen hatte. Bei der Korrespondenz über deren Erwerb fanden wir einen von ihr verfassten Brief. Auf seinem Sterbebett hatte ihr Mann, so schreibt sie, den Wunsch geäußert, seine Privatsammlung keinem Klosterarchiv zu vermachen, sondern einer Universität.
»Zu dieser Zeit (April 1990) war er schon sehr krank. Am 3. Juni 1990 starb er.«
Was wir hier im Klosterdorf Steyl bislang nicht einmal ansatzweise aufgefangen haben, sind religiöse oder spirituelle Äußerungen zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben von Pater Theodor Verhoevens. Ja, er hatte das Kleine Priesterseminar durchlaufen und anschließend das Große Priesterseminar, war zum Priester geweiht und als Missionar nach Flores geschickt worden, um Gottes Wort zu verkünden. Wir wissen auch, wie es endete: Um Weihnachten 1966 verlor Verhoeven die Gewalt über das Steuer seines Missionswagens. Der Pater flog aus der Kurve und landete in einer Schlucht. Er trug so viele Knochenbrüche davon, dass er repatriiert werden musste. »Ich musste sofort nach Europa zurück«, steht dort ganz sachlich. Der Autounfall markierte das Ende seines achtzehnjährigen Aufenthalts auf Flores.
MISSIONERFÜLLT?!
Wenn man mit der Maashopper – der Fähre – Steyl erreicht, hat man den Eindruck, als würde sich ein mittelalterliches Dorf vor einem auftun. Die vermeintliche Burg ist jedoch eine Doppelkirche des Missionsklosters Steyl.
So beginnt Elisabeth, zukünftige Pädagogin aus Zeeland, ihren Bericht. Vielleicht spukte ihr dabei die Flutkatastrophe von 1953 durch den Kopf, denn in den folgenden Zeilen konzentriert sie sich auf drei Gedenksteine in der Kirchenwand, Markierungen der höchsten Wasserstände des zwanzigsten Jahrhunderts: 1926 (als der Altar durch die Kirche trieb), 1993 und 1995 (damals blieb es bei nassen Böden und Kniebrettern). Die Maas kann innerhalb weniger Stunden anschwellen und über die Ufer treten, um im Sommer und Herbst wieder in Lethargie zu versinken.
Der Ehrenamtliche, der auf dem Platz gegenüber vom Fährhaus auf uns wartete, war ein Mann in Jeans mit dem samtweichen Akzent der südlichen Niederlande. Er stellte sich als Karel vor. Ich ging davon aus, dass er Priester im Ruhestand war – einer der dreißig, die hier lebten. Das Sankt-Michael-Männerkloster, das vor unseren Augen auftauchte, diente jetzt als Seniorenheim.
»In der Blütezeit vor dem Zweiten Weltkrieg gab es hier siebenhundert Pater«, sagte Karel. Mit großen Schritten durchquerte er den Klostergarten und lotste uns zu den Höhlen, die Mönche in einen Hügel gegraben hatten: Unterirdische Gänge mit Heiligenbildern in spärlich beleuchteten Nischen und Orgelmusik, die aus den Lautsprechern plätscherte.