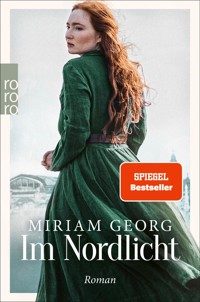9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hamburger Auswandererstadt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Zwei Frauen, verschieden wie Ebbe und Flut. Verbunden durch das Schicksal und die Hoffnung auf ein besseres Leben ... Das dramatische Finale des neuen großen Zweiteilers von Bestsellerautorin Miriam Georg. Die Hafenmetropole Hamburg ist rettungslos überfüllt, es kocht wie in einem Kessel. Bei den Auswandererhallen werden mit den Hoffnungen der Menschen auf ein besseres Leben rücksichtslose Geschäfte gemacht. Hier arbeitet Ava – unermüdlich, Tag für Tag, nachdem ihre einzige Hoffnung zerschlagen wurde, in Amerika ihre Familie zu finden. Sie wurde gnadenlos hintergangen. Von der Frau, die ihr näherstand als eine Schwester. Trotzdem sorgt sie sich um Claire. Sie sucht nach ihr, überall, doch diese ist wie vom Erdboden verschluckt. Claire musste alles aufgeben, um sich zu retten. Sie musste Ava verraten, ihre Mutter verlassen, alle Brücken hinter sich abbrechen. Aber ihr Stolz und ihr Eigensinn helfen ihr durch die dunkelsten Stunden. Denn nun wird sie kämpfen. Gegen sich selbst. Um Ava. Um die Liebe. Und um ihr Leben. Zwei Frauen. Verbunden durch Freundschaft, getrennt durch Verrat. Nur zusammen können sie zu sich selbst finden. Die mitreißende Saga von Bestsellerautorin Miriam Georg. Für alle Leserinnen und Leser von Lena Johannson, Carmen Korn und Jeffrey Archer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Ähnliche
Miriam Georg
Das Tor zur Welt: Hoffnung
Roman
Über dieses Buch
Alte Welt, neue Hoffnung
Die Hafenmetropole Hamburg ist rettungslos überfüllt, es kocht wie in einem Kessel. Bei den Auswandererhallen werden mit den Hoffnungen der Menschen auf ein besseres Leben rücksichtslose Geschäfte gemacht.
Hier arbeitet Ava – unermüdlich, Tag für Tag, nachdem ihre einzige Hoffnung zerschlagen wurde, in Amerika ihre Familie zu finden. Sie wurde gnadenlos hintergangen. Von der Frau, die ihr näherstand als eine Schwester. Trotzdem sorgt sie sich um Claire. Sie sucht nach ihr, überall, doch diese ist wie vom Erdboden verschluckt.
Claire musste alles aufgeben, um sich zu retten. Sie musste Ava verraten, ihre Mutter verlassen, alle Brücken hinter sich abbrechen. Aber ihr Stolz und ihr Eigensinn helfen ihr durch die dunkelsten Stunden. Denn nun wird sie kämpfen. Gegen sich selbst. Um Ava. Um die Liebe. Und um ihr Leben.
Zwei Frauen. Verbunden durch Freundschaft, getrennt durch Verrat. Nur zusammen können sie zu sich selbst finden.
Vita
Miriam Georg, geboren 1987, ist die Autorin des Zweiteilers «Elbleuchten» und «Elbstürme». Beide Bände der hanseatischen Familiensaga wurden von Leserinnen und Lesern gefeiert, sie schafften auf Anhieb den Einstieg auf die Bestsellerliste und wurden zum Überraschungserfolg des Jahres.
Die Autorin hat einen Studienabschluss in Europäischer Literatur sowie einen Master mit dem Schwerpunkt Native American Literature. Wenn sie nicht gerade reist, lebt sie mit ihrer gehörlosen kleinen Hündin Rosali und ihrer Büchersammlung in Berlin-Neukölln.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg Copyright © 2022 by Miriam Georg
Redaktion Hanne Reinhardt
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Abigail Miles/Arcangel; Richard Jenkins; Shutterstock; Karte: Umgebung von Hamburg, 1906/Christian Terstegge; Deutsches Historisches Museum/© DHM/Bridgeman Images
ISBN 978-3-644-01280-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Schwestern
Wo findet die Seele die Heimat, die Ruh
Auszug aus einem Auswandererlied
Das Meer
Es gab kein Zurück. Immer schneller pflügte das Tenderboot durchs Wasser. Der Wind zerrte an ihren Haaren, Gischt benetzte ihr Gesicht. Im Nebel wartete das riesige Schiff auf seine Passagiere. Möwen umkreisten die Schornsteine, kleine geisterhafte Schatten vor dem Hintergrund der noch aufgehenden Sonne. Die Dampfbarkassen, die den Ozeanriesen an der Elbmündung der Nordsee übergeben würden, lagen schon bereit.
Sie konnte Menschen auf dem Oberdeck sehen, Damen mit Hüten, winkende Kinder. Aber erst, als sie die Gangway betrat, das Vibrieren der Maschinen unter ihren Füßen spürte, konnte sie es wirklich glauben.
Was tun wir nur, dachte sie. Ein Schwindel erfasste sie. In diesem Augenblick spürte sie eine große, warme Hand an ihrem Rücken, und instinktiv lehnte sie sich haltsuchend in die Berührung. Zumindest war sie nicht allein.
Doch der Mann hinter ihr war der falsche Mann. Es war die falsche Hand, die falsche Berührung. Sie schloss die Augen und versuchte, ihren Atem zu beruhigen. Wie hatte alles so furchtbar schiefgehen können? In einem Anflug von Panik drehte sie sich um und blickte zurück in Richtung Hamburg. Doch er zog sie am Arm zum Oberdeck, und nach einem letzten inneren Aufbäumen, bei dem alles in ihr zu schreien schien, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hatte, gab sie nach und folgte ihm.
Vielleicht war es gut so.
Vielleicht würde ihr Leben auf der anderen Seite des Ozeans endlich einen Sinn ergeben.
Altes Land
1963
Der Hof lag im Dämmerlicht. Es flimmerte durch die Blätter der Birken, sickerte wie Wasser über das moosbewachsene Reetdach, zog helle Streifen über den Stall und die Wiesen. Alles hier erzählte vom Verfall, von Jahren, die niemals wiederkehren würden. Die Trauerweide beugte sich über den Kräutergarten, als wollte sie darin versinken, das Haus mit seinem löchrigen Mauerwerk und den eingeschlagenen Fenstern schien, als würde es jeden Moment zu Staub zerfallen. Eine ganz besondere Ruhe lag über dem Bild. Eine Ruhe, die ihr sagte, dass niemand hier war. Schon lange nicht mehr. Und auch niemand mehr kommen würde. Höchstens, um den alten Bauernhof abzureißen.
Vielleicht wäre es das Beste, dachte sie, als sie am Zaun stehen blieb und dem Gefühl nachspürte, das der Anblick des Moorhofs in ihr aufsteigen ließ. Vielleicht muss man erst alle Spuren der Vergangenheit begraben, bevor man mit ihr Frieden schließen kann.
Die Wolken schwammen in einem riesigen blauen Ozean über ihrem Kopf. Im Alten Land hatte der Sommer schon immer eine besondere Weite, einen besonderen Geruch. Auch hier, an seinen Rändern, tief im Moor. Als sie die Pforte aufdrückte und unwillkürlich tief einatmete, mischte sich der Duft des Flusses und der Wiesen mit Holz und Erde, mit Heu und Wasser aus den Marschgräben. Irgendwo hinter dem Grün lag der Deich. Und dahinter glitzerte die Este, die Lebensader der Elbmarsch. Es war so windstill, dass sie aus weiter Ferne die Klappermühlen in den Kirschbäumen hören konnte.
Ihre Hand zitterte, als sie das Seitentörchen aufdrückte und das hohe Gras sich gegen das Holz stemmte. Aber ihre Hand zitterte jetzt immer.
«Mama, ich helfe dir doch!» In der Stimme ihrer Tochter schwang Ungeduld.
«Ich habe dir gesagt, ich will das alleine machen.» Auch sie war angespannt. So lange hatte sie auf diesen Moment gewartet, ihn immer wieder hinausgezögert. Sie wusste nicht, was sie glaubte, hier zu finden. Antworten vielleicht.
Oder neue Fragen.
«Warte bitte beim Wagen.»
«Und wenn du hinfällst? Dort drinnen ist sicher alles morsch, ich kann doch …»
«Nein!» Sie fuhr herum, und ein Blick genügte, um Kat verstummen zu lassen. Inzwischen war sie vielleicht alt, die Hände zitterten, und die Beine wollten nicht mehr so, aber ihr Blick war noch genauso eindringlich wie früher.
«Schön, wie du willst. Aber dann lass die Tür auf, damit ich höre, wenn du durch den Boden brichst!» Kat rückte ihr scheußliches neumodisches Hütchen zurecht, das die grauen Haare auch nicht verdecken konnte, und ging zum Wagen. Eine fünfzigjährige Frau, bockig wie ein kleines Kind. Manche Dinge änderten sich nie.
Sie beobachtete, wie ihre Tochter sich, beim Wagen angekommen, sofort eine Zigarette anzündete, und konnte förmlich sehen, welche Gedanken dabei hinter ihrer Stirn vorbeizogen. Es war ihr egal. Schon lange hatte sie aufgehört, sich darum zu kümmern, was andere von ihr dachten, ob sie sie schwierig oder seltsam fanden. Sie drehte sich um und ging durch das Törchen.
Es war ein kleiner Hof. Hier gab es keine Brauttür, keine Giebelschwäne, keine Prunkpforte wie auf den meisten der restaurierten Anwesen im Herzen des Alten Landes, an denen sie in der letzten Stunde vorbeigefahren waren. Als sie näher kam, über die zugewucherten Steine schritt, hätte sie doch gerne Kats Arm zum Festhalten gehabt, der Boden war uneben und voller Stolperfallen. Aber sie würde sich nicht umdrehen und nach ihr rufen. Sie bat nicht gern um Hilfe. Und noch weniger gern gab sie zu, dass sie sich geirrt hatte. Der große Schlüssel wog schwer in der Tasche ihres Rocks, während der Fahrt hatte sie immer wieder ihre Finger darum geschlossen.
Einen Moment sah sie sich um. Am Horizont schwebten die Flügel einer Windmühle über den Bäumen.
Sie brauchte lange, um die Kette zu lösen, die die Türgriffe zusammenhielt, und als sie sie schließlich in den Händen hielt, wusste sie nicht, was sie damit tun sollte. Suchend sah sie sich um, und ihre Arme zitterten so stark, dass die Kette schließlich zu Boden glitt. Dabei streifte sie über ihr Kleid. «Verdammt!», seufzte sie, als sie die Rostflecken auf der zarten Schweizer Spitze sah.
Zögernd schloss sie die Finger um die kalte Klinke, drückte sie vorsichtig hinunter und stieß die Tür auf. Der Geruch war wie eine Wand. Alte Steine, moderndes Holz. Es war der Geruch einer anderen Zeit, den es heute nur noch an wenigen Orten zu finden gab. Stille schlug ihr entgegen. Auch hier zog das Nachmittagslicht schräge Streifen über den Boden. Die meisten Fenster waren mit Brettern vernagelt, aber das Licht reichte, um sich zu orientieren.
Sie trat über die Schwelle, und es schien ihr, als würde das Haus den Atem anhalten, sich leise knirschend zur Seite neigen und auf die alte Frau in der weißen Spitze lauschen, die plötzlich hier auftauchte, an einem sonnigen Samstag im Juni, und nach der Vergangenheit suchte.
Natürlich hatten andere Leute hier gelebt. Wie viele Familien gekommen und gegangen waren, wusste sie nicht, und es war auch egal. Sie würde nichts mehr von damals finden.
Aber darum war sie nicht hier.
Unsicheren Schrittes ging sie über die alten Dielen, ihre Fingerspitzen streiften über die Wände. Die Feuerstelle in der Flettwand zwischen der Wirtschaftsdiele und dem Wohnbereich war noch erhalten, wenn auch modernisiert und mit Kacheln eingerahmt. Alle Höfe im Alten Land waren ähnlich gebaut, ihr Grundriss war der eines anderen Jahrhunderts, den nun niemand mehr brauchte, den man aber auch nicht ändern durfte. Vielleicht stand der Hof deshalb leer. Oder vielleicht, weil es ein Unglücksort war. War es das, was sie hier spürte? Das Unglück, das sie alle heimgesucht hatte?
In der Kammer neben der Küche hatte die Großmutter geschlafen, bevor sie weggegangen waren und alles in sich zusammengebrochen war. Das winzige Fenster zeigte auf den Gemüsegarten hinaus. Sie schritt langsam über den dunklen Flur, öffnete eine Tür, dann eine zweite. Die kastenartigen Alkoven zwischen Diele und Wohnbereich hatten im letzten Jahrhundert den Mägden als Nachtlager gedient. Man konnte sich nicht richtig hinlegen, nur halb aufrecht sitzend schlafen. Später waren sie anscheinend als Schränke genutzt worden, jemand hatte Nägel in die Wände gehauen und Bretter darübergelegt. Lange starrte sie hinein. Dies war einst der Rückzugsort für ein sehr junges, sehr einsames Mädchen gewesen. Ein Mädchen, das vom Meer geträumt hatte, von weichen Kissen, gutem Essen und einem Leben ohne Schmerz. Ein Schrank, nicht größer als eine Besenkammer.
Langsam streifte sie weiter durch das Haus, öffnete sogar die Tür, die in den Stall führte. Die Kuhgeschirre hingen noch an den Eisenstangen, klirrten leise im Halblicht. Es war kühl hier drin.
Sie ging zurück in die Küche und sah sich um. Nun gab es keinen Raum mehr, den sie noch nicht gesehen hatte, so klein war der Hof. Eine Weile stand sie verloren da, drehte sich um sich selbst, aber ihre Augen fanden nichts, woran sie sich festhalten konnten, keinen Gegenstand, der ihr etwas sagte, keinen Hinweis, kein Zeichen.
Und da wusste sie es. Es hatte keinen Sinn mehr, sich weiter etwas vorzumachen.
Sie war das Unglück.
Sie war verantwortlich für das, was damals geschehen war. Egal wie lange sie in der Vergangenheit suchte, wie viele Geister sie rief.
Es gab nichts, das diese Tatsache ändern würde.
Teil 1
1912
Hamburg
1
Sie tastete im Dunkeln umher. Einen Moment überkam sie die grauenvolle Gewissheit, dass sie blind war. Nie wieder würde sie Farben sehen, nie wieder das Gesicht ihrer Mutter. Die Panik packte sie so fest, dass sie aufschrie und sich mit den Händen über die Augen kratzte.
Da spürte sie den Verband.
Ava fiel wieder ein, was passiert war, und mit einem Stöhnen ließ sie sich in die Kissen zurücksinken. Sie war schweißgebadet.
Jedes Mal, wenn sie einschlief, erwachte sie danach voller Angst. Jedes Mal vergaß sie, dass ihre Augen nur verbunden waren. Dass sie noch sehen konnte.
«Ich nehme Ihnen die Binde ja gleich ab. So langsam sollten Sie sich daran gewöhnt haben, oder nicht? Dass Sie sich aber auch immer so anstellen müssen.» Die Stimme der Schwester klang ungeduldig, beinahe scharf.
Ava konnte es ihr nicht verdenken. Sie war eine undankbare Patientin. Drei Wochen war es nun her, dass man sie operiert hatte. Und noch immer musste sie so oft wie möglich mit Kräutern getränkte Umschläge auf die Augen legen, um zu verhindern, dass sie sich entzündeten. Damit die Umschläge nicht verrutschten, band man sie nachts fest.
«Haben Sie gehört, dass Sie bald entlassen werden? Es dauert nicht mehr lang.» Schwester Karla hob ihren Kopf vom Kissen und löste die feuchte Binde.
«Was?» Ava blinzelte, und die Erleichterung, die Farben und das Licht zu sehen, das Zimmer um sie her und sogar das verkniffene Gesicht der Schwester war wie jeden Tag so groß, dass ihr ein Gewicht von der Brust zu fallen schien. «Aber ich bin doch gar nicht gesund.» Plötzlich hämmerte ihr Herz. Allerdings nicht vor Freude. So ungeduldig sie auch war, endlich das Krankenhaus verlassen zu dürfen, endlich ins Leben zurückzukehren, so sehr fürchtete sie sich auch davor.
«Ein wenig müssen Sie auch noch warten, aber die Entzündung ist unter Kontrolle. Sie können dann von Ihrem Hausarzt weiter behandelt werden.»
Ava hätte beinahe laut aufgelacht. Aber natürlich wusste die Schwester nicht, warum sie hier war und wie lächerlich dieser Gedanke schien. «Gut», murmelte sie und sank wieder in ihr Kissen zurück.
«Ich dachte, Sie machen Luftsprünge. So lange wie Sie hatten wir schon ewig niemanden hier. Zumindest nicht mit einem Trachom.»
«Danke, dass Sie mich daran erinnern», murrte Ava, und Schwester Karla warf ihr erst einen missbilligenden Blick zu, schmunzelte dann aber. «Ich werde Sie vermissen.»
«Werden Sie nicht», erwiderte Ava, musste dann aber ebenfalls lächeln.
Sobald die Schwester gegangen war, stand Ava auf, griff nach ihrer Strickjacke und tappte langsam zum Spiegel an der Wand. Weil ihre Krankheit einen so unerwartet schweren Verlauf genommen hatte und so ansteckend war, hatte sie die meiste Zeit über ein Einzelzimmer bewohnt. Anfangs war sie dankbar dafür gewesen, doch irgendwann waren die Stille und die Einsamkeit über sie hergefallen wie unsichtbare Wölfe, hatten sie halb wahnsinnig werden lassen in der Dunkelheit. Sie hatte begonnen, sich Lieder vorzusingen, Gedichte von früher aufzusagen, an die sie sich nur noch halb erinnerte. Wann immer möglich hatte sie am offenen Fenster gesessen und auf die Geräusche der Stadt gelauscht, aber es war zu kalt gewesen, die Gefahr einer weiteren Entzündung zu groß. Irgendwann hatten die Schwestern die Tür zum Gang für sie offen stehen lassen, damit sie wenigstens etwas von draußen mitbekam. Sie konnte nicht lesen, sie hatte nichts, um sich abzulenken. Und niemand kam zu Besuch.
Denn niemand wusste, dass sie hier war.
Sie trat an den Spiegel und blickte auf ihre Füße, zögerte den Moment hinaus, in dem sie sich in die Augen schauen musste. Sie trug keine Strümpfe, ihre Zehen waren rot gefroren.
Langsam hob sie den Blick. Und als ihre honigfarbenen Augen im Spiegel auf ihr Ebenbild trafen, wurde sie von Ava zu Claire.
Ihr Mund begann zu zittern. Seit Wochen vermied sie den Blick in den Spiegel, so gut es ging. Ihre Augen waren gerötet, in den Winkeln hatten sich Krusten gebildet, die Wimpern waren verklebt. Über der linken Iris lag ein Schleier. Ein weißer Nebel. Hauchfein, aber deutlich.
Er würde ihr für immer bleiben.
Außerdem hatte sich das Lid leicht verkrümmt, sodass die Wimpern in eine Fehlstellung geraten waren. Ihre Sehkraft indes war noch genauso gut, wie sie immer gewesen war. Der Arzt hatte ihr erklärt, dass das andere Auge lernen würde, den Nebel auszugleichen. Der Anblick versetzte ihr trotzdem einen so brennenden Stich, dass sie ihr Spiegelbild am liebsten zerkratzt hätte.
Sie krallte die Hände um den kalten Rand des Waschbeckens und versuchte, den heißen Kloß herunterzuschlucken, der in ihrem Hals anschwoll. Sie musste dankbar sein. Dankbar, dass sie ihr Gesicht überhaupt sehen konnte. Aber es war so schwer, nicht damit zu hadern.
Nie wieder würde sie aussehen wie früher.
«Wären Sie so gut, mir den Tee zu reichen?» Agatha lächelte mit blassen Lippen, man sah, wie viel Kraft es sie kostete, so zu tun, als wäre alles wie immer.
Ava ging zur Anrichte. Bedächtig schüttete sie den heißen Schwarztee in die zartgeblümte Porzellantasse von Oscar Schlegelmilch, die sicher mehr gekostet hatte als alles zusammengenommen, was sie besaß, und brachte sie an den Diwan, auf dem Claires Mutter saß.
«Soll ich die Vorhänge ein wenig zuziehen?» Sie sah, wie das grelle Licht des Vormittags Agatha in den Augen schmerzte.
«Vielleicht ein bisschen.» Ihre Stimme war kaum mehr ein Hauch. Agatha trank einen Schluck. Die Hand, die die Tasse zum Mund führte, zitterte ganz leicht.
Ava ging zum Fenster und zog die Gardine zu, schloss den kalten Hamburger Wintertag draußen aus. «Dann geht es Ihnen heute wohl nicht besser?», fragte sie, als sie sich wieder umdrehte.
Agatha schüttelte den Kopf. «Ich bin nur etwas geschwächt, machen Sie sich keine Gedanken. Es muntert mich immer auf, Sie zu sehen. Wie schön, dass Sie mich besuchen kommen.»
Ava lächelte. Sie goss sich ebenfalls eine Tasse Tee ein und versuchte, nicht aufzuschauen, denn sie merkte, wie Agathas Blick auf ihr ruhte, tastend ihr Gesicht erforschte. Seit Wochen kam sie nun hierher, und immer noch sah Agatha sie so an.
Als könnte sie nicht glauben, dass Ava da war.
Als wäre sie jemand, den sie lange Zeit vermisst hatte.
Es klopfte, und Marie steckte den Kopf zur Tür herein. Ava wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. «Madame, könnte ich Sie einen Moment sprechen?»
«Was gibt es, Marie?» Mit einem Klirren setzte Agatha die Tasse ab. «Nur zu, sprich ruhig, sprich.»
Ava war klar, dass auch Agatha sofort an Claire dachte. Wie könnte sie auch nicht. Sie alle dachten seit Wochen an nichts anderes.
Marie warf Ava einen zweifelnden Blick zu, dann trat sie ein und faltete die Hände vor der weiß geblauten Schürze. «Madame, ich war eben auf dem Markt, und ich habe dort … jemanden getroffen. Ein anderes Dienstmädchen.» Mit großen Augen blickte Marie zwischen ihnen hin und her, offensichtlich unsicher, ob sie reden durfte.
«Bitte, so sag doch», forderte Agatha sie auf, und Ava bemerkte, wie sich jeder Muskel in ihrem Körper anspannte. Auch sie umklammerte mit beiden Händen ihre Tasse.
Marie schluckte sichtbar. «Magnus Godebrink ist zurück.»
Agatha wich das Blut aus dem Gesicht, doch bevor sie reagieren konnte, fügte Marie hinzu: «Ich habe mit seiner Mamsell gesprochen. Er … er hat Claire nicht gesehen.»
Nachdem Agatha an jenem Tag, an dem ihrer aller Leben durch Claires Flucht aus den Angeln gehoben worden war, vor Avas Augen zusammenbrach und ins Krankenhaus kam, hatte Ava gemeinsam mit Wilhelm und Quint die Villa unverrichteter Dinge wieder verlassen müssen. Am folgenden Tag war sie nach Eppendorf gefahren, wo man sie zu ihrem Erstaunen auch tatsächlich sofort in das Privatzimmer geführt hatte, in dem Agatha Conrad nach ihrem Herzanfall lag.
Ava hatte erwartet, dass Claires Mutter sich erklären, irgendetwas darüber sagen würde, was geschehen war. Warum sie Ava angesehen hatte, als stünde der leibhaftige Tod vor ihr, und dann ohnmächtig auf den Teppich gesunken war.
Aber alles, was Agatha sagte, als Ava hereinkam und an ihr Bett trat, war: «Wissen Sie, wo meine Tochter ist?»
Die kranke Frau griff nach ihrer Hand und sah sie mit so riesigen, angsterfüllten Augen an, dass Ava am liebsten aus dem Raum gelaufen wäre. Sie hatte Angst, dass Claires Mutter erneut einen Schwächeanfall erleiden, ihr Herz die Nachricht nicht verkraften würde. Aber sie musste es schließlich erfahren. Sicher war nichts schlimmer, als in der Ungewissheit zu leben.
Also hörte sich Ava selbst dabei zu, wie die unglaublichen Worte aus ihrem Mund kamen. Sie erzählte, wie Claire in aufgelöstem Zustand zu ihr ins Gängeviertel gekommen war. Dass Claire daheim an der Tür gelauscht und gehört hatte, wie sich Dr. Schwab und Agatha besprachen, wie er plante, sie einweisen zu lassen oder sie andernfalls zu ehelichen, um sie vor rechtlichen Konsequenzen zu bewahren. Agatha blickte sie an, ohne einmal zu blinzeln, und Ava konnte an ihrer Miene nicht ablesen, ob sie das Gehörte begriff, ob sie verstand, was Claire getan hatte.
Auf ihre Erzählung folgte eine seltsame Stille. Agatha kniff ein paarmal die Augen zusammen, als fragte sie sich, ob sie wach war oder noch träumte. «Es ist meine Schuld», hauchte sie schließlich, so leise, dass Ava es kaum hörte. «Es ist alles meine Schuld. Ich wollte sie doch nur schützen.» Agatha schlug die Hände vor den Mund, sah Ava mit flackernden Augen an. «Sie muss solche Angst gehabt haben.»
«Ja», erwiderte Ava, und seltsamerweise spürte sie einen Moment des Mitgefühls für Claire, ein kurzes Flattern, ein Erweichen irgendwo in ihrer Brust. «Sie hatte große Angst.»
Ava war nach Eppendorf gekommen, um Geld zu fordern. Um Agatha zu sagen, dass Claire nicht nur ihr, sondern auch Ava das Herz gebrochen, ihr das Einzige genommen hatte, das ihr etwas bedeutete; ihren Traum von einem neuen Leben. Fest entschlossen war sie durch die Stadt marschiert, bis raus zum Krankenhaus.
Und dann brachte sie es nicht über sich.
Sie konnte Agatha Conrad nicht sagen, was ihre Tochter getan hatte. Nicht alles, nicht die kleinen, grausamen Details, die es so schlimm machten, die ihre Flucht zu einem Verrat werden ließen. Dass sie sie eingeschlossen, sich heimlich mit Avas Fahrkarte und all ihren Habseligkeiten davongeschlichen hatte. Genau wusste sie nicht, was sie davon abhielt, schließlich bedeutete Geld für eine Agatha Conrad nicht das Gleiche wie für sie selbst. Doch als sie in die schuldgeplagten Augen einer Mutter sah, die von der Sorge um ihre Tochter gepeinigt wurde, brachte sie nichts über die Lippen, das diese Sorge noch vertiefen würde. Ich sage es ihr an einem anderen Tag, nahm sie sich vor, als sie dort an Agathas Bett stand. Wenn es ihr ein wenig besser geht.
Aber eine Sache konnte sie nicht zurückhalten. «Verzeihen Sie, Madame Conrad», begann sie vorsichtig. «Gestern, kurz bevor Sie die … Schwäche befallen hat, da schien es mir, als würde ich Sie an jemanden erinnern. Sie haben mich so erschrocken angesehen. Und dann sagten Sie, ich sollte eigentlich tot sein.»
Agatha hielt noch immer die Hände vor den Mund gepresst und schüttelte den Kopf, als wollte sie die Neuigkeiten über Claire einfach nicht wahrhaben. Sie hob den Blick, ihre Augen trafen sich.
Und Ava sah, dass sie sich erinnerte.
Sie sah, dass Agatha genau wusste, wovon sie sprach. Doch Claires Mutter schüttelte nur weiter den Kopf. «Ich … Sie haben mich an jemanden erinnert. Herrje, es tut mir leid, ich muss Sie zu Tode erschreckt haben.» Sie schloss einen Moment die Augen, das Gesicht unter den noch immer dunklen Haaren weiß wie das Kissen.
Ava spürte, wie sich ganz tief in ihr etwas verabschiedete. Zu Staub zerfiel. Der Glimmer einer irrwitzigen, unmöglichen Hoffnung, die sie sich niemals hätte erlauben dürfen. «Ach so», sagte sie leise.
«Ich war nicht bei Sinnen. Die Sorge um meine Tochter hat mir den Verstand geraubt. Claire war plötzlich einfach verschwunden, wissen Sie. Die Mädchen haben mir gestanden, dass sie an der Tür gelauscht hat. Ich … wir … Aber Sie wissen ja bereits alles. Dr. Schwab sah keine andere Möglichkeit. Wir wollten ihr nur helfen. Sie hat sich durch ihren Wahn für diesen Magnus Godebrink in eine unmögliche Lage gebracht. Wenn ich mir vorstelle, was alles hätte passieren können.»
Agatha schloss wieder die Augen. Eine Schweißperle rann ihr seitlich die Schläfe hinab, dabei war es nicht besonders warm im Zimmer. Unruhig blickte Ava zur Tür, voller Sorge, dass Agathas Herz einfach alles zu viel wurde.
«Sie hat sich vor Angst übergeben. Können Sie sich das vorstellen?», wisperte Agatha, und jetzt standen Tränen in ihren Augen. «Sie wissen ja nicht, wie stark sie ist, Claire kann nichts erschüttern. Dass sie solche Angst ausgestanden hat …»
Plötzlich streckte Agatha die Hand aus, eine zitternde, bleiche Hand, die Finger voll schwerer Ringe, die sie Ava Halt suchend entgegenstreckte. Nach einem Moment des Erstaunens ergriff Ava sie, ließ sich auf der Bettkante nieder, eine Situation, so absurd, dass sie beinahe aufgelacht hätte. Jemand wie sie am Bett einer reichen Dame.
Es war wie eine verkehrte Welt.
«Ich weiß», sagte sie. «Sie hat mir alles erzählt.»
Agatha richtete sich ruckartig ein Stück auf, als wäre ihr gerade erst klar geworden, dass sie mit der Person sprach, die Claire zuletzt gesehen hatte. Sie umklammerte Avas Finger so fest, dass es wehtat, zog sie unwillkürlich näher an sich. «Hat sie irgendetwas zu Ihnen gesagt? Wo genau sie hinwill? Wie man sie erreichen kann? Wann sie zurückkommen wird?»
Ob sie zurückkommen wird.
Ava sah die unausgesprochene Frage in Agathas Augen und zögerte. «Sie ist nach New York gefahren, so viel ist sicher», sagte sie, einen bitteren Geschmack auf der Zunge. «Mehr weiß ich leider nicht. Ich denke, sie wird dort Magnus treffen. Sicher müssen wir uns um Claire keine Sorgen machen, Sie sagen es ja selbst, sie ist sehr stark. Und Magnus wird für sie sorgen.»
Agatha nickte beklommen. «Aber Herrgott. Sie hatte doch gar nichts dabei, kein Geld, keine Kleider», stammelte sie. «Ihr hitziges Wesen hat sie ja schon oft in unangenehme Situationen gebracht, aber dass sie so etwas …» Jetzt begann sie zu weinen. «Wie kann sie nur einfach gehen, ohne ein Wort!», rief sie, zog ihre Hand aus Avas und wischte sich die Tränen von den Wangen. «Ich weiß ja, dass sie wütend war. Und verzweifelt. Aber ihr muss doch klar gewesen sein, was das für mich bedeutet. Was ich mir für Sorgen machen würde!»
«Sie hatte Kleider dabei», erklärte Ava tonlos. «Und ein wenig Geld. Von mir.»
Agathas Augen spiegelten ihre Verunsicherung. Sie wusste offenbar nicht genau, was sie von dieser Information halten, ob sie Ava Vorwürfe machen sollte. «Oh, das ist gut», sagte sie schließlich. «Ich danke Ihnen, es war sehr großmütig von Ihnen, dass Sie ihr geholfen haben.»
Das alles war nun Wochen her. Seit Avas Besuch im Krankenhaus hatte sich eine zarte, etwas befremdlich anmutende Freundschaft zwischen ihr und Agatha entwickelt. Lange hatte Ava damals noch an ihrem Bett gesessen, und irgendwann, nachdem die erste Sorge um Claire abgeklungen war, hatte Agatha begonnen, Ava verstohlen zu mustern, ihr Fragen zu stellen. Und die ganze Zeit über hatte Ava das Gefühl nicht losgelassen, dass hinter diesen Fragen etwas anderes steckte. Dass Agatha etwas ganz Bestimmtes von ihr erfahren wollte.
«Kommen Sie doch wieder, ja?», bat sie, als Ava nach ihrem ersten Besuch irgendwann aufbrechen musste. «Wenn Sie da sind, habe ich das Gefühl, noch eine Verbindung zu meiner Tochter zu haben.» Beinahe flehend gruben sich ihre Finger in Avas Unterarm. «Vielleicht gleich morgen? Ich zahle Ihnen selbstverständlich die Droschke hier heraus. Es würde mir so viel bedeuten. Sonst liege ich ja doch nur hier und mache mir Sorgen.»
Ava hatte zugesagt. Weil sie genauso eine Verbindung zu Claire brauchte wie Agatha.
Weil sie dem flehentlichen Blick nichts entgegenzusetzen hatte.
Und weil sie ganz tief in sich die Gewissheit spürte, dass da etwas war, das Agatha ihr nicht erzählte.
Sie sah es daran, wie Agatha jede ihrer Bewegungen verfolgte, als würde sie Ava mit etwas vergleichen. Wie sie sie beharrlich über ihr Leben ausfragte, mit diesem Blick, der sich veränderte, sobald ihre Augen sich trafen.
Und so war sie wiedergekommen, am nächsten Tag nach der Arbeit. Seitdem kam sie alle paar Tage, saß an Agathas Bett, las ihr aus der Zeitung vor, beantwortete geduldig Frage um Frage über ihr Leben, die Agatha hinter ausgesuchter Höflichkeit versteckte, die aber viel zu präzise waren, um bloß Konversation zu sein.
Irgendwann war Agatha aus dem Krankenhaus entlassen worden, mit der Diagnose einer Herzschwäche und der strikten Anweisung, sich zu schonen und nicht aufzuregen. Froh, der harten Arbeit in der Ballinstadt, die sie nun wieder aufgenommen hatte, für eine Weile zu entgehen, begann Ava, den Besuchen erwartungsvoll entgegenzublicken. In der Villa bekam sie guten Kaffee, süßes Gebäck, das ihr auf der Zunge schmolz, und sie traf auf jemanden, der sich freute, sie zu sehen. Auch wenn sie Agathas Sorge um Claire nicht mildern konnte. «Noch immer nichts?», fragte Agatha, sobald Ava zur Tür hereinkam, und sah sie so hoffnungsvoll an, dass es ihr jedes Mal wehtat, wenn sie den Kopf schütteln und verneinen musste.
Immer noch nichts Neues von Claire.
Die lange Auffahrt auf der Uhlenhorst war auch im Dezembergrau beeindruckend. In der eleganten Kutsche der Conrads fuhr Ava an Wiesen und prachtvollen Pferden vorbei und fragte sich, wie es sein musste, hier zu leben. Die Luft roch nach Nebel, ein paar Raben krächzten in den kahlen Bäumen. Es war eiskalt, und als sie um eine Kurve bog, sah sie durch das Fenster, wie der Atem der Pferde in der Luft verdampfte.
Vor der Freitreppe hielten sie an. Ava schaute an der Fassade empor. Claire stand oben auf dem Balkon, hielt das Gesicht in die Sonne, glücklich über ihr neues Leben, das sie sich so lange erträumt hatte.
Aber nur für eine Sekunde.
Dann verpuffte das Bild, und der Balkon blickte leer und grau in den eisigen Nachmittagshimmel. Ava fröstelte. Sie fragte sich, ob wohl dort oben in dem Zimmer mit den vorgezogenen Gardinen das Kind gestorben war.
Sie klingelte, und ein streng blickendes Dienstmädchen mit hohen Wangenknochen öffnete ihr die Tür.
Sie schien irritiert, Ava am Haupteingang zu sehen, runzelte die Stirn, dann aber gewahrte sie die herrschaftliche schwarze Kutsche auf der Auffahrt und schien zu beschließen, erst einmal abzuwarten, bevor sie Ava rügte. «Ja, bitte?», fragte sie kühl.
«Ich komme im Auftrag von Frau Agatha Conrad», erklärte Ava höflich. «Ihre Tochter ist … eine gute Bekannte von Herrn Godebrink.»
«Wir sind im Hause vertraut mit Fräulein Conrad», erwiderte das Mädchen, und ihre Stimme verhärtete sich. «Sie war in der Vergangenheit oft hier zu Besuch.»
Ava nickte, und als sie sich ansahen, war beiden klar, dass die jeweils andere wusste, was sich bei Claires Besuchen abgespielt hatte.
«Wie Sie vielleicht wissen, ist Fräulein Claire seit einiger Zeit spurlos verschwunden. Sie wollte nach Amerika fahren, um dort Herrn Godebrink zu treffen, und seitdem hat niemand etwas von ihr gehört.»
Das Mädchen sah sie abwartend an. Ihr Blick hatte beinahe etwas Lauerndes. Sie erwiderte nichts.
«Madame Conrad hat mich gebeten, bei Herrn Godebrink vorzusprechen. Wir möchten gerne erfragen, ob er Informationen über Claires Aufenthaltsort hat.»
Das Mädchen sagte noch immer nichts, musterte Ava mit ihren schönen, stechenden Augen. Sie weiß etwas, zog es Ava durch den Kopf. Sie weiß etwas über Claire.
«Ich werde Sie anmelden», erwiderte das Mädchen in diesem Moment – und bevor Ava etwas erwidern konnte, drückte sie ihr die Tür vor der Nase zu.
Ava stand draußen in der frostigen Luft und zog ihr Schultertuch enger, drehte sich zum Hof und ließ den Blick über die Stallungen schweifen. Die Raben saßen jetzt in den kahlen Ästen der Kastanie, ihr anklagendes Krächzen erfüllte die Luft. Sie hatte das Gefühl, dass die Vögel sie beobachteten. Ihre Finger prickelten vor Kälte.
Endlich erklangen Schritte im Haus, und sie fuhr herum.
Das Mädchen streckte gerade einmal die Nasenspitze zu ihr heraus. «Bedauere, Herr Godebrink ist nicht zu sprechen», sagte sie und drückte die Tür so schnell wieder zu, dass Ava nur erstaunt blinzeln konnte.
Einen Moment stand sie da und beobachtete durch das Glas, wie das Mädchen durch die Halle davonschritt, ohne sich auch nur einmal zu ihr umzudrehen. Dann ging sie langsam zur Kutsche zurück. Doch als der Mann auf dem Bock mit rot gefrorenen Wangen heruntersprang und ihr die Tür aufhalten wollte, schüttelte sie den Kopf.
«Fahren Sie alleine.» Sie blickte zum Haus. «Es ist zu kalt, um zu warten. Ich komme zu Fuß nach.»
«Aber Fräulein Ava, der Weg ist doch viel zu weit», protestierte er. «Bei diesen Temperaturen.»
Ava lächelte. «Ich bin Laufen gewöhnt.»
Nach einigem Drängen ratterte er davon. Sie sah ihm eine Weile nach, dann drehte sie sich entschlossen um und ging die Stufen zur Haustür wieder hinauf.
Der Gong zitierte das Hausmädchen ein zweites Mal in die Halle. Als sie Ava sah, wurden ihre Augen schmal vor Zorn. «Ich habe Ihnen doch gesagt …», begann sie wütend, aber Ava fiel ihr ins Wort.
«Ich werde mich nicht von hier fortbewegen, bis ich Herrn Godebrink gesprochen habe», sagte sie ruhig. «Richten Sie ihm das aus. Und richten Sie ihm auch aus, dass er gerne die Polizei rufen lassen kann, oder einen seiner Angestellten, der mich fortschickt, aber dann werde ich morgen wiederkommen. Und übermorgen. Und am Tag danach.» Sie lächelte. «Sagen Sie ihm das.»
Die Augen des Mädchens ruhten einen Moment forschend auf Avas Gesicht. Und zu ihrem maßlosen Erstaunen öffnete sie die Tür und trat zurück. «Das werde ich ganz sicher nicht ausrichten», sagte sie, mit einem Blick über die Schulter. Dann fixierte sie einen Punkt irgendwo neben Avas Stirn. «Aber da Sie die Tür offen vorgefunden haben und ich nicht zugegen war, konnte ich auch nicht verhindern, dass Sie ins Haus gelangen, nicht wahr?», sagte sie seltsam hölzern. «Sein Büro ist den Gang hinunter, rechts neben dem Kamin.»
Verblüfft betrat Ava das Haus und ging an ihr vorbei. Als sie dann doch einen Blick wechselten, fragte sie sich, wie viel das Mädchen damals mitbekommen haben mochte. Ob sie hier gewesen war, an dem Abend, als es passierte.
Der Kamin in der Halle wurde von Löwenstatuen umringt, ihr Brüllen in Stein gemeißelt. Der rot gemusterte Teppich verschluckte den Klang von Avas Schritten. Ob man sie dafür verhaften konnte, dass sie einfach so ein fremdes Haus betrat?
«Ja doch», rief eine dunkle Stimme voller Ungeduld, als sie schließlich an die Tür klopfte.
Ihr Herz hämmerte. Eben war sie noch fest entschlossen gewesen, doch jetzt bekam sie Angst. Er ist der Mann, den Claire liebt, beruhigte sie sich. So schlimm kann er nicht sein.
«Was ist denn nun schon wieder», tönte es ihr entgegen, während sie die Tür aufdrückte, die über den Teppich schabte. «Ich habe dir doch gesagt, du sollst sie weg…»
Er brach ab, starrte sie so ungläubig an, dass es der Situation beinahe eine gewisse Komik verlieh.
Ava schloss leise die Tür hinter sich und trat an den Schreibtisch. Magnus Godebrink war umgeben von Papierstapeln. Eine Zigarette qualmte neben ihm in einem silbernen Aschenbecher, und einen Moment war der wabernde Rauch, der in einer kleinen Säule davon aufstieg, die einzige Bewegung im Raum.
«Guten Tag», sagte Ava, als wäre nichts dabei, dass eine Fremde einfach so in sein Büro spazierte. «Entschuldigen Sie, dass ich unangemeldet erscheine. Die Haustüre war offen. Und ich muss dringend mit Ihnen reden.»
Seine Stirn zog sich zusammen. Noch immer hatte er sich nicht bewegt, keinen Ton gesagt, schien abzuwägen, musterte sie, ein Blatt Papier in den Händen, als könnte er sich nicht entscheiden, ob er sie angreifen oder weglaufen sollte. Sie sah an seinen Augen, dass er sich fragte, was sie wusste.
«Ich bin eine Freundin von Claire.»
Sein Gesicht veränderte sich. Kaum merklich. Aber sie sah es.
«Und im Auftrag ihrer Mutter hier», fügte sie hinzu.
Noch einige Sekunden lang hielt er die Stille. Dann war es, als legte sich eine Maske über seine Züge. Er lächelte und erhob sich. «Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie eben abweisen ließ, Sie sehen ja, ich ertrinke in Arbeit.» Mit großer Geste deutete er auf das Chaos auf seinem Schreibtisch. «Ich hoffe immer, dass sich die Probleme in meiner Abwesenheit in Luft auflösen, aber leider …» Er lachte auf. Es wirkte beinahe echt. Er hatte Charme, wenn er lachte. Sie konnte sehen, was Claire an ihm fand. Und gleichzeitig war da etwas an ihm, sodass sie sich fühlte wie ein Kaninchen vor einer Schlange.
«Bitte, setzen Sie sich doch.» Er wies auf zwei Sessel vor dem Kamin, und Ava ließ sich zögernd auf der Kante nieder, noch immer erstaunt darüber, dass es tatsächlich funktioniert hatte, sie tatsächlich hier war und mit ihm sprach.
«Bitte verraten Sie mir, warum ist Agatha nicht selbst gekommen?», fragte er, immer noch mit einem steifen Lächeln, das beinahe wie ein Zähnefletschen wirkte, nachdem er sich ebenfalls gesetzt und ein Bein über das Knie des anderen gelegt hatte, sodass sie seine teuren braunen Schuhe und einen Teil seines Strumpfhalters sehen konnte. «Warum hat sie nicht telefoniert, wenn es so dringend ist?»
«Frau Conrad ist leider seit einiger Zeit unpässlich», erwiderte Ava. Sie merkte, wie schwer es ihr fiel, seinen Blick zu halten. «Sie hatte einen Herzanfall, als sie erfuhr, dass Claire Hamburg verlassen hat.»
«Claire hat die Stadt verlassen?» Magnus runzelte die Stirn, schüttelte leicht den Kopf. «Davon hat Linda ja gar nichts erzählt. Ach, aber ich habe Ihnen gar nichts angeboten. Möchten Sie einen Kaffee?»
Überrascht blickte Ava ihn an. Sie war sich sicher, dass er log. Aber vielleicht stimmte es auch, vielleicht wusste er von nichts? Immerhin war er hier.
Und Claire nicht.
Vielleicht hatte sie ihn in New York nicht gefunden, vielleicht war unterwegs etwas passiert. Das Schiff war jedenfalls ohne Zwischenfälle angekommen. Es hatte während der Überfahrt ein paar Todesfälle gegeben, aber darunter war keine Frau in Claires Alter gewesen. Quint hatte bei der entsprechenden Besatzung nachgefragt.
«Nein, danke», erwiderte sie. «Es ist seltsam, dass Sie nichts von ihr gehört haben. Sie ist Ihnen nachgereist. Nur einen Tag nach Ihnen hat sie ein Schiff nach Amerika bestiegen. Sie hat sich nicht anders zu helfen gewusst.»
Einen kurzen Augenblick, einen Wimpernschlag nur, fiel die Maske von seinem Gesicht. Aber beinahe sofort hatte er sich wieder unter Kontrolle. «Aber das ist doch …» Magnus lachte auf, nahm das Bein herunter, lehnte sich zu ihr vor. «Das ist doch absurd, warum sollte sie mir hinterherfahren? Was meinen Sie damit, dass sie sich nicht zu helfen wusste?»
Ava dachte wieder, dass er ein sehr attraktiver Mann war, groß, schlank, mit welligem blondem Haar. Aber etwas in seinen Zügen gefiel ihr nicht. Es war wie bei einem Gemälde, dessen wahrer Charakter sich erst auf den zweiten Blick erschloss. «Herr Godebrink», sagte sie nachdrücklich und lehnte sich ebenfalls vor. «Bevor Claire das Schiff genommen hat, ist sie zu mir gekommen und hat mir erzählt, was an jenem Abend passiert ist. Ich weiß alles.»
Sie konnte dabei zusehen, wie ihm das Lächeln im Gesicht einfror. Er blickte zum Fenster. Es hatte zu regnen begonnen, die Tropfen wanden sich in dünnen, glitzernden Fäden am Glas hinab. Es war offensichtlich, dass er nach Worten suchte, nicht wusste, wie er sich geben sollte.
«Wir waren dumm», sagte er schließlich, nachdem er sich geräuspert hatte, begegnete ihrem Blick mit einem Lächeln, das sicherlich verschmitzt wirken sollte, aber schmerzhaft aussah, und wich Avas fragenden Augen gleich wieder aus. Er legte die Fingerspitzen aneinander, nur um sie dann nervös durch seine Haare fahren zu lassen. «Sie kennen Claire. Wer würde ihr nicht verfallen. Eine so schöne Frau.» Als würde er sich über seine eigene Dummheit wundern, schüttelte er den Kopf. «Ich habe mich … hinreißen lassen. Linda war schwanger und unpässlich, und Claire … nun. Wie Sie sicherlich wissen, sind wir uns schon länger bekannt. In einem anderen Leben wäre sie meine Frau geworden. Dann wäre nichts von alldem passiert», murmelte er wie zu sich selbst und rieb sich jetzt scheinbar erschöpft mit Daumen und Zeigefinger die Augenbrauen.
Ava runzelte die Stirn. In seinen Worten hörte es sich an, als hätte Claire ihn verführt. Als wäre er schwach geworden beim Anblick des Apfels, den die Schlange ihm vor die Nase hielt. Und warum hatte er Claire nicht einfach geheiratet, wenn er sie so umwerfend fand, wie er behauptete?
«Sie beide hatten ein Verhältnis», sagte sie nüchtern. «Ein einvernehmliches Verhältnis. Von dem Ihre Frau nichts wusste.»
Sein Unterkiefer zuckte, und seine Augen wurden hart. «Warum sind Sie hier?», sagte er, und alles an ihm, seine Mimik, seine Stimme, seine Körperspannung, veränderte sich. Von dem höflichen Gentleman, der ihr einen Sessel und etwas zu trinken angeboten hatte, war nichts mehr übrig. Feindseligkeit strahlte aus jeder Pore.
«Weil ich wissen möchte, wo Claire ist», erwiderte sie und war froh, dass man ihrer Stimme nicht anhörte, wie sehr dieser Mann sie einschüchterte.
«Und warum denken Sie, dass ich das weiß? Meinen Sie nicht, wenn eine vollkommen aufgelöste Claire bei mir in New York in mein Hotel eingefallen wäre, dann hätte ich ihre Mutter bereits benachrichtigt?»
Ava musterte ihn. Sie wusste nicht, was sie ihm glauben sollte. Dann erzählte sie ihm mit knappen Worten, was in der Villa Conrad passiert war, nachdem Dr. Schwab Claire von Magnus weggezerrt und sie mit der Kutsche zu Agatha gebracht hatte. Was Claire belauscht hatte. Welche Angst es ihr eingeflößt und in welch ausweglose Situation es sie gestürzt hatte. Ava konnte nicht sagen, ob es ihn überraschte.
«Sie verstehen also, warum wir uns an Sie wenden», schloss sie kalt. «Wären Sie nicht auf dem Weg nach New York gewesen, hätte sie sich niemals auf das Schiff begeben.»
Seine Lippen zuckten. «Ich weiß, wie es nach außen hin wirken muss», sagte er steif. «Und das ist alles sehr bedauerlich. Aber ich kann Ihnen nicht helfen.» Er stützte beide Ellbogen auf die Knie und sah sie mit durchdringendem Blick an. «Ich habe Claire nicht mehr gesehen seit dem Abend, an dem mein Sohn starb.»
Etwas in Ava wusste, dass er dieses Mal nicht log.
2
Will lag im Bett und hörte dem Regen zu, der gegen das Fenster trommelte. Die Tropfen liefen in schmalen Bahnen am Glas hinab. Er mochte den Gedanken, dass das Klima in Hamburg vom Atlantik bestimmt wurde. Wenn es im Winter stürmte, wusste er, dass der Luftdruck über der Nordsee rasch abgenommen hatte, während sich Kälte über dem Meer westlich von Norwegen zusammenballte. So erklärten sich die Maifröste und die häufigen Sommerregen von Juli bis September, die starke Bewölkung des oft ruhelosen Himmels über der Stadt, die hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer, die milden Winter und das angenehme, selten bedrückende Klima in den warmen Monaten. Will wusste diese Dinge, weil er sein Leben damit verbracht hatte, die Welt um sich her so gut wie möglich verstehen zu wollen. Er wusste, warum es in Hamburg meist morgens oder nachmittags regnete und so gut wie nie um Mitternacht. Er wusste, warum es hier beinahe ausgeschlossen war, dass es wärmer als dreißig Grad Celsius wurde, und warum die Grundwasserspiegel in den Hamburger Brunnen genau wie das Wetter von meteorologischen Verhältnissen abhingen.
Was Will nicht wusste, war, wie er seine Frau wieder glücklich machen konnte.
Er hörte ihre Stimme bis in sein Zimmer herauf. Irgendwo unten im Haus rief sie den Jungs zu, dass sie sofort die Schlittschuhe aus dem Garten holen sollten, wenn sie kein Donnerwetter erleben wollten, und es lag eine Schärfe in ihrem Ton, die der Sache nicht angemessen war. Ihm war klar, dass diese Schärfe nicht den Jungs galt, sondern ihm.
Und dass er sie verdiente.
Will seufzte tief, blickte wieder aus dem Fenster in den wolkenverhangenen Himmel. Er musste aufstehen, lag schon viel zu lange hier. Aber es war mal wieder eine grauenvolle Nacht gewesen, eine ruhelose, peinigende Nacht, und er spürte jeden Knochen im Leib. Sein Kopf war wie in Watte gepackt, er hatte einen faden Geschmack im Mund. So kannte er sich nicht. Sein ganzes Leben lang war er morgens gerne aufgestanden, hatte den Tag voller Tatendrang begonnen, lieber angepackt, was es anzupacken galt, als sich vor schwierigen Aufgaben zu drücken. Und jetzt lag er hier, lauschte auf die vertrauten Geräusche seiner Familie und wollte nicht zu ihnen hinuntergehen. Er freute sich nicht auf das Frühstück, er freute sich nicht auf die Arbeit.
Er freute sich auf gar nichts.
Seit Wochen ging das nun so. Seit er sich eingestanden hatte, dass er Ava liebte. Und sie am selben Tag aufgehört hatte, mit ihm zu sprechen. Sie ignorierte ihn nicht, war immer noch höflich, immer noch freundlich, wenn sie sich zufällig auf dem Hof begegneten oder ihre Blicke sich trafen. Aber es war, als hätte sie eine unsichtbare Wand zwischen ihnen aufgebaut. Natürlich konnte er das verstehen. Manchmal schämte er sich so sehr, dass er seinem eigenen Abbild im Spiegel auswich. Er hatte es geschafft, zwei Frauen gleichzeitig zu täuschen, und auch noch sich selbst. Was für ein Kerl er doch war.
Wütend hob er den Kopf, zog das Kissen hervor, drückte seine Faust hinein und schob es wieder an seinen Platz. So war das also mit der Liebe. Endlich ergab alles einen Sinn, die Gedichte, die Lieder. Es erstaunte ihn zutiefst. Er liebte seine Kinder, aber schon immer hatten sie viel mehr zu Therese gehört als zu ihm. Er liebte seine Mutter, aber auf so eine andere Weise, dass man es nicht einmal vergleichen konnte. Und irgendwie, vermutete er, liebte er wohl auch seinen Vater. Sonst hätte er sicher nicht jede Minute seines Daseins damit verbracht, ihn stolz machen zu wollen. Er liebte Quint, er war sein Bruder und würde es immer sein. Und etwas in ihm liebte auch Therese. Doch seit er Ava kannte, fragte er sich, ob man jemanden lieben konnte, einfach nur, weil er so vertraut war. Weil er zum Leben dazugehörte. Weil man sich aneinander gewöhnt hatte.
Das, was er für Ava empfand, war anders. Tiefer. Alles erschütternd. Es war, als würden seine Gefühle plötzlich Dinge tun, die sie selbst nicht verstanden, als wäre etwas in ihm kaputtgegangen und funktionierte nun anders als vorher.
Will war klar, dass er vor einer Entscheidung stand. Und dass diese Entscheidung sehr vielen Menschen sehr wehtun könnte. Aber er wusste auch, dass er so nicht weitermachen konnte. Nichts war mehr wie früher.
Das ist also Liebe, dachte er. Zornig schlug er die Decke zurück und stand auf. Warum hatte ihm nur nie jemand gesagt, wie schmerzhaft sie sein konnte?
Im Bad erschrak er darüber, wie hohl seine Wangen aussahen, wie stumpf und freudlos er sich selbst aus dem Spiegel entgegenblickte. Aber es war ja auch kein Wunder. Jede Nacht wälzte er sich hin und her, wachte auf und wusste nicht, wo er war, träumte von ihrem Gesicht, ihrem Lachen. Meist stand er irgendwann in der Dämmerung auf, weil er es im Bett nicht mehr aushielt. Im dunklen Salon wartete er dann sehnsüchtig auf das Gefühl der Erleichterung, das die Morgendämmerung nach einer Nacht mit sich brachte, in der er von seinen eigenen Geistern heimgesucht worden war.
Seine Ehe war zu Ende. Er liebte eine andere Frau.
Und er konnte Therese nicht mehr ertragen.
In seinem Kopf war sie zum Sinnbild geworden für alles, was ihn von Ava trennte. Und sie spürte es. In jedem Wort, das er sagte, und fast mehr noch in jedem Wort, das er nicht sagte. Sie sah es in seinem Blick, wenn er sie musterte und sich wünschte, sie nie kennengelernt zu haben, hörte es an seiner Stimme, wenn er ruppig und kurz angebunden auf ihre Fragen antwortete, die ihm auf die Nerven gingen, weil sie ihn in seinem Grübeln unterbrachen.
Aber er liebte seine Kinder. Seine neue kleine Tochter war ein Wunder. So wie alle seine Kinder Wunder für ihn waren. Er war verrückt nach ihr, konnte nicht aufhören, sie anzuschauen, ihren Geruch einzuatmen, ihre winzigen Hände zu halten. Zart wie eine Rose war sie, und deswegen hatten sie sie auch so genannt. Rosa. Rosa, wie ihre winzigen, perfekten Zehen und die Spitzen ihrer kleinen Muschelohren. Er konnte sich nicht vorstellen, auch nur einen Tag seines Lebens ohne sie zu verbringen.
Und doch war er so grauenvoll unruhig. Jede Sekunde eines jeden Tages spürte er, dass etwas nicht stimmte.
Er verstand, dass die Unruhe in ihm Ava war. Und dass sie nicht weichen würde. Wie sehr er auch versuchte, sie zu verdrängen.
Als er zurück ins Schlafzimmer ging, um sich anzuziehen, erklangen Thereses Schritte auf der Treppe, und im Spiegel über dem Kamin erwischte er sich dabei, wie er eine Grimasse zog.
«Na endlich», sagte sie, als sie hereinkam und ihn neben dem Bett stehen sah. «Ich dachte schon, du stehst gar nicht mehr auf.» Sie musterte ihn so missbilligend, dass er unter ihrem Blick zu schrumpfen begann.
«Ich habe schlecht geschlafen», erwiderte er.
«Muss schön sein, wenn man nach einer schlechten Nacht einfach liegen bleiben kann. Soll ich dem Herrn vielleicht noch sein Frühstück im Bett servieren?», fragte sie mit harten Augen. «Ich habe übrigens auch schlecht geschlafen. Ich schlafe immer schlecht. Weil ich ein Neugeborenes habe, das ich fünf Mal in der Nacht stillen muss. Trotzdem stehe ich morgens auf. Weil wir noch andere Kinder haben, die frühstücken wollen, weil wir ein Haus haben, um das sich jemand kümmern muss.»
«Du wolltest ja keine Amme», murmelte er und wusste, noch während er es aussprach, wie erbärmlich er sich benahm.
«Wie bitte?», zischte sie auch sogleich. «Wir haben kein Geld für eine Amme, deswegen wollte ich keine. Wenn deine Eltern wüssten, dass du mich …»
«Herrgott, ja doch, lass mich doch erst mal wach werden!» Dass sie recht hatte, machte ihn bloß noch ungehaltener. Natürlich hatte sie recht. Mit allem.
Plötzlich wurde ihr Blick weicher. Sie sah ihn unschlüssig an, trat dann zwei Schritte zurück und schloss die Tür hinter sich. «Die Kinder spielen im Salon. Und Rosa ist noch mal eingeschlafen», erklärte sie, und der Klang ihrer Stimme kündigte an, was sie als Nächstes sagen würde. «Wir können uns auch zusammen noch einmal hinlegen.» Mit einem Lächeln ließ sie ihr Schultertuch fallen und knöpfte ihr Kleid auf.
Früher hätte er sie gepackt und spielerisch in den Hals gebissen, bis sie wonnevoll aufschrie, er hätte sie aufs Bett geworfen und ihren ganzen Körper mit Küssen bedeckt. Allein der Anblick ihrer Brüste hätte gereicht, um ihn alles andere vergessen zu lassen.
«Ich bin wirklich nicht in der Stimmung», murmelte Will, aber sie hörte gar nicht zu. Sie trug noch ihr weißes Spitzennachthemd und, weil es so kalt war, auch ihre wollenen Kniestrümpfe. Therese war schön, und in diesem Moment das Sinnbild der Verführung.
«Wir haben doch kaum noch Zeit für uns», schnurrte sie, ein verbissenes Lächeln auf dem Gesicht, an dem er registrierte, wie sehr sie sich bemühte, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ihre Brüste waren riesig durch die Milch, und als sie auch das Nachthemd abstreifte und nur noch in Strümpfen dastand, auf ihn zutrat und seine Hände fasste, sie zu ihrem Hintern führte, reagierte sein Körper, wie er immer reagiert hatte. Sie schmeckte so vertraut, fühlte sich so richtig an. Trotzdem war nichts an ihr richtig.
Ich sage es ihr morgen, dachte er, als sie ihn zum Bett drängte und sich auf ihn setzte.
Er legte die Nadel auf, hielt mit der linken Hand die runde Scheibe fest und bediente mit der rechten behutsam die kleine Kurbel. Das Grammophon quietschte unwillig, doch nach ein paar Sekunden begann die Platte, sich zu drehen, und die ersten kratzigen Töne eines Walzers erklangen.
Dr. Schwab lächelte. Er wippte den Oberkörper im Takt, tappte von einem Fuß auf den anderen, drehte sich, als die Melodie erklang, einmal halb um die eigene Achse, hob die Arme, um seine Partnerin zum Tanz aufzufordern.
«Aber Herr Doktor», Claire lächelte katzenhaft und senkte den Blick. Als sie ihn wieder hob, bohrten sich ihre honigfarbenen Augen in ihn hinein, und ihn überlief ein Schauder vom Scheitel bis in die Kniekehlen. Sie sank in seine Arme, schmiegte sich an ihn, und zusammen wiegten sie sich ein paar Schritte zur Melodie. Wie sie duftete, wie weich ihre Haut war …
Er stolperte über eine Teppichfalte, und der Zauber zerbrach.
Zurück blieben nur sein leeres Büro und die kratzige Musik, die ihm in den Ohren dröhnte. Er machte zwei ärgerliche Schritte, hob die Nadel hoch, und die Melodie brach ab.
Einen Moment stand er da und sah sich selbst in grausamer Desillusionierung. Ein alter Mann, der sich lächerlichen Tagträumen hingab und dabei über seine eigenen Beine stolperte.
Dann straffte er die Schultern, ging zurück zum Schreibtisch und zog die Unterlagen heran, die er studiert hatte, bis ihn der Gedanke an Claire ablenkte, wie so oft. Kopfschüttelnd drehte er die Lampe auf, lehnte sich im Stuhl zurück und las weiter in der Abhandlung; einer genauen Auflistung der verschiedenen Behandlungen, die bei Seelenstörungen Anwendung fanden. Aufmerksam studierte er den Bericht über die Heilanstalt in der Neurologischen Wochenschrift. Auch Kaltbadproceduren kamen langsam aus der Mode, aber noch vor wenigen Jahren waren sie bei Seelengestörten die Regel gewesen: Die Patienten wurden in eiskaltes Wasser getaucht, mit nassen Tüchern abgeklatscht, übergossen mit einer Regendouche, wobei das Wasser tröpfchenweise und mit wenig Druck über lange Zeit auf den Kopf appliziert wurde. Dann gab es noch die Strahldouchen, bei denen das Wasser durch lederne Schläuche geleitet wurde, wobei der Behandelnde mithilfe einer Handfeuerspritze Druck aufbaute, sodass man die Patienten damit abspritzen konnte. Besonders bei Tobsucht oder Melancholie waren diese Methoden vielseitig zur Anwendung gekommen – und sicherlich immer noch, es war unmöglich zu sagen, welche Anstalt mit welchen Mitteln arbeitete. Aber mittlerweile hatten sich vielerorts Heißwasseranwendungen durchgesetzt, und er fand sie faszinierend. Besonders das prolongierte Bad.
Abwesend strich er sich mit dem Zeigefinger zwischen den Augenbrauen entlang, wo sich ein kleiner, entzündeter Knoten gebildet hatte, den er während seiner Lektüre unablässig mit dem Finger malträtierte.
Es war wirklich ein gewagtes Unterfangen, die Erkrankten mussten teilweise über Wochen in den Bädern ausharren. In Riedstadt-Goddelau hatte man vor Kurzem eine moderne Dauerbadeanlage errichtet. Es gab sogar Abbildungen in der Zeitschrift, und gebannt beugte er sich vor, wobei er wieder einmal bemerkte, wie sein Rücken schmerzte. Er wurde alt, man konnte es nicht leugnen. Aber er schlief ja auch nicht gut, lag immer wach und grübelte über sie nach. Claire war wie vom Erdboden verschwunden, niemand hatte etwas von ihr gehört. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis sie zurückkommen würde, da war er sicher.
Und er bereitete sich darauf vor.
Mit einem Räuspern blätterte er eine Seite um. Einen ganzen Raum gab es in Riedstadt, nur für die Badewannen. Sie mussten so beschaffen sein, dass die Patienten darin schlafen und essen, sich aber nicht selbstständig aus ihnen befreien konnten. Die alten Holzdeckel waren inzwischen aus der Mode gekommen, stattdessen hatte man einen Segeltuchschuh erfunden. In den meisten Anstalten war man inzwischen von Fixierungen abgekommen, aber hier musste man die kranken Seelen eben für ihr eigenes Wohl in der warmen Wanne halten. Zwölf Tage, vierundzwanzig Stunden am Stück. Er pfiff leise durch die Zähne. Das war sicherlich nicht einfach auszuhalten, Geisteszustand hin oder her. Wenn er allein daran dachte, wie sein Rücken protestierte, wenn er zu lange auf seinem scheußlichen Bürostuhl saß. Er fragte sich, ob die Kollegen wohl Sedativa verwendeten, fand aber keinen entsprechenden Eintrag.
Gedankenverloren gab er einen Löffel Zucker in seinen lauwarmen Tee, rührte langsam um, sodass sich die goldene Flüssigkeit in der Tasse drehte. Sein Blick verlor sich im Januargrau hinter den Fenstern. Und er erlaubte sich einen weiteren Moment des Träumens.
Er würde sie weit weg von hier bringen. Vielleicht nach Riedstadt, vielleicht an einen ähnlichen Ort. Anstalten gab es zuhauf, und viele von ihnen lagen abgeschieden im Nirgendwo. Man konnte sich dort wunderbar vor der Welt zurückziehen. Er selbst würde sich in der Nähe ein Zimmer anmieten und sie täglich besuchen. Vielleicht konnte er sich sogar für eine Studie in der Einrichtung bewerben und selbst mit ihr arbeiten. Er wäre ihr einziger Berührungspunkt mit der Außenwelt, ihre Stütze, ihr Mentor. Er sah es vor sich, wie sie gemeinsam lange Spaziergänge durch den Kurpark unternahmen, wie er ihr vorlas, bei den Mahlzeiten Gesellschaft leistete, wie ihre Seele sich langsam beruhigte. Und wie sie es ihm irgendwann danken würde. Eines Tages würde sie in ihm erkennen, was sie bisher nicht imstande war zu sehen.
Er seufzte tief, und die Bilder, die er vor seinem inneren Auge sah – Claire mit ihrer blütenweißen Haut in einer Badewanne, Claire im Morgenmantel auf einem Diwan, verzweifelt die Hände nach ihm ausstreckend – zerplatzten. Nun, es war ein Tagtraum, und er war sich bewusst, wie fern der Realität er war. Nicht nur Claire hatte in seinen Träumen stets eine vollkommene Wesensveränderung durchlebt, auch er war darin – das musste er sich zähneknirschend eingestehen – meist deutlich jünger und stattlicher als der Mann, den der Spiegel ihm morgens vorführte … Sei’s drum. Er hatte es selbst gesehen, immer und immer wieder: Patientinnen, die sich in ihre Ärzte verliebten, Hysterikerinnen, die so sehr in der Fürsorge aufgingen, die ihnen zuteilwurde, dass sie sogar in den Verdacht der Simulation gerieten, weil sie alles dafür zu tun schienen, dass ihre Symptome nicht nachließen.
Dr. Schwab verschränkte die Hände im Nacken und lehnte sich im Stuhl zurück. Er musste nur ihr Vertrauen gewinnen. Wenn er sie erst wieder unter seiner Kontrolle hatte … Er war zu zögerlich vorgegangen, hatte es nicht gewagt, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Und nun wurde ihm erst richtig bewusst, wie verrückt er nach ihr war. Es war kaum zu ertragen, dass er nicht wusste, wo sie sich aufhielt, bei wem sie war, in welchem Bett sie schlief. Er würde es kein weiteres Mal dulden, dass sie sich seiner Kontrolle entzog.
Wütend schob er den Bericht beiseite und zog Breuers und Freuds Studien über Hysterie heraus. Die Ehe bringt neue sexuelle Traumen. Es ist zu wundern, dass die Brautnacht nicht häufiger pathogen wirkt, da sie doch leider so oft nicht erotische Verführung, sondern Notzucht zum Inhalte hat. … Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte, die große Mehrzahl der schweren Neurosen bei Frauen entstamme dem Ehebett.
Breuer und Freud widersprachen sich in diesem Punkt, aber er musste sagen, dass er Breuer zustimmte, der Geschlechtsakt konnte bei Frauen ganz sicher tiefen Schaden anrichten, wenn er gewaltsam oder stümperhaft ausgeführt wurde. Und die meisten Männer wussten doch gar nicht, wo bei einer Frau oben und unten war. Wenn er daran dachte, dass Claire mit Godebrink das Bett geteilt, dass dieser Lump ihr ihre Würde genommen und sie für immer beschmutzt hatte … Es schnürte ihm geradezu die Luft ab. Wutentbrannt hieb er mit der Faust auf den Tisch und stieß dabei die Teetasse um, ihr Inhalt verteilte sich auf seinen Beinen, und ihm entfuhr ein ärgerliches Grunzen.
Plötzlich ruckte sein Kopf herum. Stirnrunzelnd sah er sich um. Ganz deutlich hatte er eine Stimme gehört, jemand hatte seinen Namen gesagt.
Doch sein Büro war leer.
Verwirrt huschte sein Blick über den Schreibtisch, den Schrank mit den Medikamenten, die Liege, die Bücher in den Regalen.
Er stand auf, ignorierte das Stechen im Rücken und ging zur Tür. Der Korridor lag verlassen vor ihm.
Es war eindeutig, er war überarbeitet.
Als er wieder hineinging, blieb sein Blick an dem kleinen Spiegel neben der Tür hängen, den er benutzte, um seinen Bart zu zwirbeln, bevor er hinausging. Es war nicht zu fassen, nun bekam er doch tatsächlich eine Haut wie ein pubertierender Jüngling, er hatte ja einen regelrechten Furunkel zwischen den Brauen. Ärgerlich ging er zum Schrank und holte eine Salbe heraus, tupfte sie sich sorgfältig auf die Stirn und zuckte zusammen, als sein Finger die empfindliche Stelle berührte. Nun, es war kein Wunder, dass seine Haut verrücktspielte, er verbrachte jede wache Minute bei seinen Patienten oder bei Agatha, der er in ihrem Elend – nicht ganz uneigennützig – zur Seite stand. Und jede schlafende Minute in unruhigen, peinigenden Träumen von Claire.
Aber er wusste, was er zu tun hatte. Er hatte einen Plan, hatte sich genau überlegt, wie …
Er hielt inne, weil plötzlich ein leises Pfeifen in seinem linken Ohr entstand, legte erstaunt den Kopf schief, schlug mit der Hand ein paarmal auf sein rechtes Ohr, wie um den Ton aus dem anderen herauszuschütteln. Das Pfeifen ebbte ab, und er schnalzte missbilligend mit der Zunge.
Es klopfte an der Tür.
«Du bist spät», schnauzte er, als Olga hereinkam.
Sie sah müde und abgekämpft aus, und er fragte sich kurz, ob er sie überhaupt noch wollte. Wenn sein Plan funktionierte, musste ihr Arrangement ohnehin bald ein Ende finden.
Sie ignorierte ihn, und er ging ans Fenster und zog die Vorhänge vor. Wortlos entledigte sie sich ihrer Kleidung. Und obwohl er ihren Körper immer gemocht hatte, konnte er an nichts anderes denken als an Claire.
Sie brachte ihn buchstäblich um den Verstand.
Sie hatten etwas Tröstliches, die Abläufe in der Ballinstadt, die ihr inzwischen so vertraut waren. Ava hätte nicht so genau benennen können, wie sie sich hier fühlte. Doch sie war kein unsichtbarer Geist wie bei den Plattmanns und auch keine Maschine wie in der Fabrik. Hier war sie eher ein Rädchen im Getriebe. Jeden Morgen zwischen sieben und neun wurden die Schlafsäle gereinigt. Große Teile des Personals frühstückten in den Hotels der Stadt, aber die meisten Frauen aßen im Speisesaal, bevor er geöffnet wurde. Es gab große Kessel mit gesüßtem Kaffee und Tee, riesige Mengen an Weißbrotsemmeln, Feinbrot mit Butter und immer auch eine große Schale mit Fruchtmus, das Ava besonders gern mochte. Sobald die Speisesäle sich mit den Durchreisenden aus der Auswandererstadt zu füllen begannen, fingen sie mit der Arbeit an, machten die Metallbetten sauber, brachten die Matratzen zum Desinfizieren, die nach jeder Abreise gereinigt wurden, spülten die Näpfe aus, die überall bereitstanden, damit die Leute in den Schlafsälen nicht auf den Boden spuckten. Um zwölf wurde der Mittagstisch ausgeteilt, es gab immer eine nahrhafte Suppe, Beilagen, so viel man wollte, und für jeden ein halbes Pfund Fisch oder Fleisch am Tag. Wann immer Ava ihren Teller entgegennahm, musste sie daran denken, wie Claire damals mit Kessie um die Menge gekämpft hatte, die ihr zustand.
Sie hatte viel gelernt bei diesem Streit.
Die jüdische Küche, in der sie an diesem Tag arbeitete, war genauso eingerichtet wie die christliche. Auch hier gab es vier Dampfapparate, die das Wasser in den riesigen, fünfhundert Liter fassenden Kesseln innerhalb von zwanzig Minuten zum Kochen brachten. Der einzige Unterschied zwischen den Küchen war, dass es hier einen Osterkeller mit einem Vorhängeschloss daran gab, der nur zum jüdischen Osterfest benutzt werden durfte. Er entfachte eine kindliche Faszination in Ava, die sich die fantastischsten Dinge dahinter ausmalte.
Die Küchen mochten gleich aussehen, aber die Essenszubereitung war es nicht. Alles stand hier unter der Aufsicht eines Beschauers, der vom Oberrabbiner ausgewählt wurde und peinlich genau darauf achtete, dass alles nach jüdischem Ritual ablief. Ava hatte inzwischen gelernt, dass Fleischgerichte und Milchspeisen in verschiedenen Töpfen zubereitet werden mussten und dass es ein spezielles Geschirr für jede Speise gab. Allen ausgeteilten Portionen lag ein kleiner Zettel bei, auf dem in hebräischen Buchstaben stand, dass es sich um koscheres Essen handelte. Die sehr frommen Juden speisten sogar in eigenen Räumen, und einer der Köche hatte ihr erzählt, dass die meisten von ihnen eher Hunger leiden würden, als etwas ohne dieses Koscherzeichen zu sich zu nehmen. Religion war ihr immer eher fremd gewesen, sie hatte sie nie wirklich verstanden, nie einen Zugang zu Gott gefunden, und es war daher umso faszinierender für sie, wie andere Menschen ihr Leben so sehr nach ihm ausrichten konnten.
Sie mochte alles in den beiden Küchen, die riesige Kaffeemahl- und die Kartoffelschälmaschine, die fünfundsechzig Kilo Kartoffeln in einer Viertelstunde schälen konnte. Sie mochte es, dass man hier wirklich versuchte, den Wünschen der Menschen nachzukommen, obwohl es so viele waren, obwohl die Angestellten täglich zehntausend Semmelbrötchen austeilten. Wenn besonders viele Ungarn hier waren, schnitten die Köche mehr Paprika in das Gulasch, und wenn besonders viele Schweden in der Stadt wohnten, war der Kaffee hell und süß und bestand zur Hälfte aus Milch.
Normalerweise hatte Ava in der Küche keine Zeit zum Nachdenken, es war immer laut und hektisch, man musste schnell reagieren und gut zuhören, sonst konnte man sicher sein, den geballten Zorn des Küchenchefs auf sich zu ziehen. Aber heute bekam sie Magnus’ Gesicht nicht aus dem Kopf. Im Akkord zerteilte sie Fischleiber, während sie an seine Stimme dachte, daran, wie sich sein Gesicht verändert hatte, als sie ihm sagte, dass sie Bescheid wusste. Schwer atmend stampfte sie Kloßteig in riesigen Wannen und sah dabei seine kalten Augen.
Sie musste Quint so bald wie möglich darüber informieren, dass Magnus zurück war. Und ihr graute davor. Denn sie hatte keine Ahnung, wie er auf die Neuigkeit reagieren würde.
Quint entdeckte Ava durchs Fenster. Schon an ihrem Gang sah er, dass sie Neuigkeiten hatte. Er fluchte leise.
Vor seinem Büro trat sie unruhig von einem Fuß auf den anderen. Sie hob den Blick, ihre grauen Augen trafen auf seine, und ein giftiger Stachel schien sich in ihn hineinzubohren. Bitte nicht, dachte er. Bitte nicht.
Sie sah wohl die Angst in seinem Blick, als er die Tür öffnete, denn sie schüttelte sofort den Kopf. «Nein, das ist es nicht!», beruhigte sie ihn. Ava zögerte kurz und musterte ihn, als hätte sie Angst, wie er auf ihre Worte reagieren könnte, dann sagte sie: «Godebrink ist zurück.»