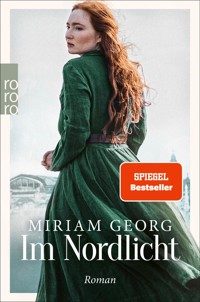9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hamburger Auswandererstadt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Stadt der Tränen, Stadt der Träume – die Hamburger Auswandererhallen. Die neue dramatische Saga vor einzigartiger Kulisse von Bestsellerautorin Miriam Georg! Jeden Tag arbeitet die junge Ava bis zur Erschöpfung auf dem Moorhof im Alten Land. Jede Nacht träumt sie vom Meer. Die Erinnerung an ihre Familie ist von Jahr zu Jahr mehr verblasst, kaum weiß sie noch den Namen ihrer Mutter. Irgendwann will Ava sie in Amerika wiederfinden. Claire Conrad ist reich. Sie ist schön. Und in ihrem willensstarken Kopf stehen die Zeichen auf Rebellion. Sie will reisen, die Welt sehen, aus den strengen Regeln der Gesellschaft ausbrechen, sie träumt davon, dass ihr Leben endlich anfängt! Wenn wenigstens der Reedersohn Magnus Godebrink um ihre Hand anhalten würde … Hamburg ist in Aufruhr. Die Cholera hat ihre Spuren in der Stadt hinterlassen. Zahllose Reisende passieren die Hafenmetropole auf ihrem Weg in die Neue Welt, getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben. In der Auswandererstadt begegnen sich Ava und Claire – zwei Frauen, verschieden wie Ebbe und Flut. Doch das Schicksal schweißt sie untrennbar zusammen. Die mitreißende Saga von Bestsellerautorin Miriam Georg. Für alle Leserinnen und Leser von Lena Johannson, Carmen Korn und Jeffrey Archer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 836
Ähnliche
Miriam Georg
Das Tor zur Welt: Träume
Roman
Über dieses Buch
Stadt der Tränen, Stadt der Träume
Jeden Tag arbeitet die junge Ava bis zur Erschöpfung auf dem Moorhof im Alten Land. Jede Nacht träumt sie vom Meer. Die Erinnerung an ihre Familie ist von Jahr zu Jahr mehr verblasst, kaum weiß sie noch den Namen ihrer Mutter. Irgendwann will Ava sie in Amerika wiederfinden.
Claire Conrad ist reich. Sie ist schön. Und in ihrem willensstarken Kopf stehen die Zeichen auf Rebellion. Sie will reisen, die Welt sehen, aus den strengen Regeln der Gesellschaft ausbrechen, sie träumt davon, dass ihr Leben endlich anfängt! Wenn wenigstens der Reedersohn Magnus Godebrink um ihre Hand anhalten würde …
Hamburg ist in Aufruhr. Die Cholera hat ihre Spuren in der Stadt hinterlassen. Zahllose Reisende passieren die Hafenmetropole auf ihrem Weg in die Neue Welt, getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben. In der Auswandererstadt begegnen sich Ava und Claire – zwei Frauen, verschieden wie Ebbe und Flut.
Doch das Schicksal schweißt sie untrennbar zusammen.
«Ich habe mit Ava und Claire gehofft, gebangt und geahnt. Was für ein Ende! Jetzt warte ich voller Ungeduld auf den zweiten Band!»
Tanja Fornaro, Schauspielerin und Hörbuchsprecherin
Vita
Miriam Georg, geboren 1987, ist die Autorin des Zweiteilers «Elbleuchten» und «Elbstürme». Beide Bände der hanseatischen Familiensaga wurden von Leserinnen und Lesern gefeiert, sie schafften auf Anhieb den Einstieg auf die Bestsellerliste und wurden zum Überraschungserfolg des Jahres.
Die Autorin hat einen Studienabschluss in Europäischer Literatur sowie einen Master mit dem Schwerpunkt Native American Literature. Wenn sie nicht gerade reist, lebt sie mit ihrer gehörlosen kleinen Hündin Rosali und ihrer Büchersammlung in Berlin-Neukölln.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg Copyright © 2022 by Miriam Georg
Redaktion Hanne Reinhardt
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Abigail Miles/Arcangel; Richard Jenkins; Shutterstock; Ullstein Bild; Karte: Umgebung von Hamburg, 1906/Christian Terstegge
ISBN 978-3-644-01279-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Schwestern
Es waren zwei Königskinder
Die hatten einander so lieb
Sie konnten beisammen nicht kommen
Das Wasser war viel zu tief
Das Wasser war viel zu tief
Prolog
Sie waren im Bauch eines Wals gefangen. Eines kranken, stinkenden Wals, der sich voller Qualen hin und her warf. Das Meer donnerte gegen die Planken, die Urgewalt des Wassers nur eine Handbreit knirschenden Holzes von ihnen entfernt. Der Sturm heulte wie ein gefangenes Tier und übertönte gnädigerweise das Weinen um sie her.
Was er nicht übertönen konnte, war der Geruch.
Die Paddemangs am Ende des Schiffsbauches stanken schon an guten Tagen zum Gotterbarmen. Aber seit das Unwetter aufgekommen war, sickerten die Exkremente in kleinen Bächen an ihren Füßen vorbei. Die Rocksäume und Schuhe waren damit eingekrustet, und auf der linken Seite lief es aus dem Oberdeck an den Wänden zu ihnen herunter.
Seit zwei Tagen war es dunkel. Seit zwei Tagen hatte man kein Wasser mehr hinuntergebracht, kein Essen. Vielleicht war das auch besser so, hatten sich am Anfang doch alle regelmäßig übergeben, waren ununterbrochen zu den Aborten gewankt. Nun lief niemand mehr zu den Aborten. Überhaupt war es seltsam ruhig geworden im Bauch des Schiffes. Als es losgegangen war, mitten in der Nacht, hatten alle geschrien und sich aneinandergeklammert. Manche hatten sich an die Betten gebunden, um nicht hin und her geschleudert zu werden. Nach und nach waren die Lampen ausgegangen, und die Menschen waren im Dunkeln panisch geworden, blind durcheinandergestolpert. Jemand war gegen sie gestoßen, hatte ihre Brüste gerammt, den Bauch. Sie hatte sich in eine Ecke gekauert, mit einer Hand ein Tau umschlungen und mit der anderen versucht, ihr ungeborenes Kind zu schützen. Nun hörte man nur noch leises Schluchzen und Stöhnen, wenn das Heulen des Windes sich für ein paar Sekunden legte. Oder in der grauenvollen schwebenden Stille, bevor eine riesige Welle gegen den Bug krachte, das Schiff einen Moment durch das Nichts zu gleiten schien und dann fiel. Fiel und fiel, direkt in den Schlund der Hölle hinein.
Bis der Aufprall kam.
Sie war jedes Mal sicher, dass sie sterben würde. Aber dann starb sie nicht, und das war auch nicht besser.
Die Luke am Ende der Treppe war mit Eisenriegeln verschlossen. Sie hatte es gesehen, als sie an Bord gegangen war, aber nicht verstanden, wozu man sie brauchen würde.
Nun wusste sie es.
Nach Sonnenuntergang wurde die Finsternis pechschwarz. Die alte Frau im Bett über ihr regte sich nicht mehr. Sie war tot, da war sie sich sicher, aber sie hatte weder die Kraft noch das Verlangen, nachzusehen. Bald war es ohnehin egal. Sie würden alle auf dem Grund des Ozeans enden. Das Meer würde sie verschlingen, der Sturm, der um sie her tobte und kreischte wie eine Armee wütender Geister. Wenn die Planken nicht brachen, würden sie hier drin verhungern oder ersticken.
Sie waren erst drei Wochen unterwegs. Wenn das Unwetter sie nicht vom Kurs abbrachte, mussten sie mindestens noch einmal so lange in dieser stinkenden Hölle aushalten.
Und seit gestern hatte sich etwas verändert.
Das Kind in ihrem Bauch war ruhig geworden. Es lebte, sie war sich sicher. Da war etwas neben dem panischen Flattern ihres eigenen Herzens, eine warme Präsenz, das Gefühl einer zweiten Seele. Aber es bewegte sich nicht mehr. Und seit ein paar Stunden spürte sie ein Ziehen im Rücken. Ein Drücken in der Leistengegend.
Es ist zu früh, dachte sie. Die nächste Welle krachte gegen den Bug, der Wal stöhnte, als könnte er die Qualen nicht länger ertragen. Im selben Moment fuhr ein kochender Schmerz durch ihren Körper.
Viel zu früh.
Teil 1
1892
Altes Land
1
Sie träumte wieder vom Meer. Es war immer da, seit sie denken konnte. Irgendwo an den Rändern der Nacht zog es sich durch die Tiefen ihres Bewusstseins, wie ein Lied, das einem nicht aus dem Kopf geht. In ihrer Kammer, zwischen Schlaf und Wachen, hatte sie in der Finsternis einen Moment das Gefühl zu sinken. Sie spürte das Wasser, das an ihren Haaren zog, ihre Lungen füllte. Eine endlose Tiefe unter ihren Füßen. Und obwohl sie wusste, dass sie im Traum gerade ertrank, war da keine Angst. Im Gegenteil, es fühlte sich ruhig an. Ruhig und warm. Als sollte es so sein.
Als wäre sie da, wo sie hingehörte.
Ava erwachte mit einem Seufzer auf den Lippen. Sobald sie das Stroh fühlte, das durch das Laken stach, den modrigen Geruch des Holzes wahrnahm, die Kühe schnauben hörte, die auf der anderen Seite der Wand auf den Morgen warteten, sehnte sie sich zurück in den Traum. Einen Moment lang sah sie ein Bild. Eine weiße Gardine wehte im Wind. Eine Frau und ein Mann standen vor einem Haus und lächelten. Es roch nach warmem Brot. Seufzend drehte sie sich um, aber genau in diesem Moment krähte draußen der erste Hahn.
Es kann nicht schon Zeit sein, dachte sie verzweifelt, wie an jedem einzelnen Tag, an den sie sich erinnerte. Sie war doch eben erst ins Bett gefallen, hatte eben erst gedacht, dass ihr Rücken keine einzige Minute Arbeit mehr aushalten würde, dass sie sicher hundert Jahre schlafen könnte und trotzdem noch müde sein würde.
Aber der Hahn krähte ein zweites Mal, und die Kühe auf der anderen Seite der Wand begannen, unruhig mit den Hufen zu scharren.
Sie setzte sich auf und lauschte in sich hinein. Alles tat weh, ihr Kopf war dick und schwer, die Augen brannten. Manchmal, wenn die Tage im Sommer so lang waren, als würden sie niemals enden, stellte sie sich vor, sie wäre die schlafende Prinzessin aus dem Märchenbuch in der Stube. Der Wind würde sich legen, die Dornen der Rosenhecke würden sich um das Haus winden, es mit all seinen Bewohnern verschlucken, und sie würde schlafen. Schlafen, bis sie nicht mehr müde war. Schlafen ohne den brennenden Wunsch beim Aufwachen, sofort wieder in der Nacht zu versinken. Und statt vom Prinzen, der kam und sie wach küsste, würde sie vom Meer träumen.
Und von dem, was dahinterlag.
«Ava!» Ruth donnerte mit der Faust gegen die Wand. «Los!»
Nie sagte sie «Guten Morgen», nie «Steh auf» oder «Es ist Zeit». Immer dieses «Los!», ein gebellter Befehl aus der Nachbarkammer, als wäre es zu viel, mehr als eine Silbe an sie zu verschwenden. Sie könnten es noch ein bisschen hinauszögern, die Kühe würden es aushalten. Aber wenn sie spät aufstanden, verlängerte es den Tag nur nach hinten und machte den nächsten Morgen umso schwerer. In Avas Kammer gab es kein Fenster, doch draußen war es ohnehin noch dunkel. Trotzdem konnte sie den Morgen schon riechen. Im Sommer stahl sich in den ersten Dämmerstunden der Duft nach nassem Heu und Tau durch die Ritzen. In ihm mischten sich Spuren von den Wiesen, den Birken, dem Wasser aus den Marschgräben. Und obwohl es ein betörender Duft war, mochte sie ihn nicht. Er brachte die Welt zu ihr herein. Und sie war zu müde, um es mit der Welt aufzunehmen.
Ava streckte im Dunkeln die Füße vor sich in die Luft, gähnte, wackelte mit den Zehen. Irgendwann wache ich woanders auf, dachte sie, als sie nach ihrem Leibchen griff und sich mit mechanischen Bewegungen anzog, die ihr genauso vertraut waren wie die Gedanken, die ihr dabei durch den Kopf zogen. Irgendwann habe ich ein Fenster und eine eigene Waschschüssel, meine Matratze stinkt nicht nach Moder, ich muss morgens keine Kuh mehr melken, kein Feuer machen, kein Gemüse putzen, keinen Torf stechen.
Irgendwann.
Genau wie das Meer war das Wort immer da. Sie flüsterte es sich in Gedanken zu, wenn die Wirklichkeit sie zu erdrücken drohte. Es gab ihr Kraft, zu glauben, dass sich alles ändern konnte.
Als sie über den Flur schlich, ihre Dose mit Kreide und Kampfer zum Zähneputzen in der Rocktasche, stieß sie mit der Hüfte gegen die Anrichte, und etwas fiel scheppernd herunter. Sie blieb kerzengerade stehen. Aus dem Schlafzimmer drang ein lauter Schnarcher, dann ein Knarzen. Als es wieder still wurde, schloss sie eine Sekunde die Augen. Die Haut in ihrem Nacken prickelte. Sie meinte, Branntwein zu riechen, aber dann schüttelte sie den Kopf. Inzwischen roch sie überall Branntwein, wie eine Wolke schien er das Haus einzuhüllen, unter den Türritzen hindurchzukriechen, nachts in unsichtbaren Schwaden durch die Räume zu geistern, und wenn sie abends ihr Haar aus der Haube löste, schnüffelte sie manchmal daran und meinte, eine feine Alkoholnote zu erkennen.
Ava musste nicht hinaus, um in den Stall zu gelangen, die Kühe lebten im selben Haus wie sie, nur eine Tür trennte die Menschen von den Tieren. Aber sie hatte es sich angewöhnt, jeden Morgen kurz in den Hof zu treten. Die frische Luft machte den Kopf klarer. Als sie jetzt die Tür aufdrückte, flüchteten zwei der Hühner in Richtung Misthaufen.
Der einsame Ruf des Brachvogels zog über die Wiesen. Das Moor roch nach Nebel. Ava mochte die Gerüche, die alle mochten; altes Papier, Regen auf warmem Stein. Aber sie mochte es auch, wie die Kühe nach der Nacht rochen, warm und sauer zugleich. Wie ihre eigene Haut roch, nachdem auf dem Feld stundenlang die Sonne darauf gebrannt hatte. Wie die dampfenden Marschgräben rochen, wenn sie frisch ausgehoben wurden und die Erdklumpen auf der Wiese lagen. Und den Geruch des Morgennebels mochte sie. Weil er keinem anderen gleichkam und sich verflüchtigte, sobald man versuchte, ihn einzuatmen.
Am dürftigen Kräuterbeet blieb sie stehen. Die Weide beugte sich tief über den Zaun, wirkte, als würde sie sich jeden Moment erschöpft zum Schlafen niederlegen. Es war der heißeste Sommer, an den Ava sich erinnern konnte. Sogar jetzt, am frühen Morgen, spürte sie die Wärme, die vom Boden aufstieg. Sie mussten gießen. Hinter den Kuhwiesen gab es noch ein Feld, dort wuchsen Rettich, Kohl, Porree, türkische Erbsen, Knollen. Wenn etwas fertig war, schleppten Ava und Ruth es mit Kiepen zum Hof. Oft saßen sie dann bis spät in die Nacht, banden die Mairüben und fleeten den Rosenkohl. Sie war froh, dass die Erntezeit vorbei war, das Karren des Düngers, das Hacken in dem trockenen Boden und schließlich das Beladen der Ewer im Morgengrauen war harte, schweißtreibende Arbeit. Sie verkauften ihr Gemüse an die Marktfrauen aus dem Dorf, die es dann nach Hamburg zum Hopfenmarkt brachten. So verloren sie einen Großteil des Gewinns, aber um es dort selbst anzubieten, hatten sie keine Zeit. Und es war auch nicht genug.
Eine Spur Salz lag in der Luft.
Ava hatte das Meer noch nie gesehen. Aber sie wusste, dass die Wellen niemals verstummten und das Wasser seine Farbe wechselte. Es passte sich dem Himmel und seinen Launen an. Julius hatte es ihr erzählt. Er war Knecht auf dem Beekshof und weit gereist, in Preußen auf Wanderschaft gewesen, in Holland als Mähhelfer, und wann immer er davon sprach, hing Ava an seinen Lippen.
Auf einer Karte im Rathaus hatte sie gesehen, dass die Elbe sich zwischen Friedrichskoog und Cuxhaven wie eine Blume öffnete, sich weitete und dann plötzlich kein Fluss mehr war, sondern das Wattenmeer.
Und dann die Nordsee.
Und schließlich der Atlantik.
Und irgendwo hinter dem Atlantik begann Amerika. So hatte sie es zumindest gehört.
Manchmal roch man wie heute das Salz im Wind, und wenn die Flut gegen die Deiche der Este spülte, gab es einen Teil in ihr, der sich freute. Es war, als würde das Meer kommen, um sie zu sich zu holen. Ich kann nicht mit, dachte sie dann jedes Mal. Ich muss Kühe melken, Torf stechen und Butter rühren, bis ich eines Tages zusammenbreche und nicht mehr aufstehe.
Ava wusste nicht, welcher Tag es war, aber der Wachtelkönig hatte schon vor zwei Wochen aufgehört zu rufen, und das sagte ihr, dass es Ende Juli sein musste, vielleicht schon August. Bald würde der Herbst kommen.
Und dann der Winter.
Der Herbst war nicht schlimm, sie mochte den Dunst in der Luft, das Krächzen der Zugvögel im Wind. Elsa und sie sammelten Kastanien und bunte Blätter und legten sie den Schweinen in den Koben. Und obwohl es im Herbst immer feucht war und sie entzündete Rachen und fiebrige Wangen hatten, wusste Ava von der Großmutter, dass es noch viel schlimmer sein konnte. Sie hatte oft erzählt, wie es ihnen damals ergangen war, als eine der ersten Generationen im Moor. Alle ihre Geschwister waren an der Schwindsucht gestorben, und der Vater sagte oft, die Großmutter sei so klein und schmächtig, weil sie nie richtig zu essen bekommen habe. Als sie ein Kind war, besaß die Familie nicht mal einen Ofen, musste das ungebackene Brot über die Wiesen und Moore in die Backhäuser des Dorfs tragen. Anfangs lebten die meisten Moorbauern mit den Tieren zusammen in Hütten, die nur aus Birkenstämmen bestanden. Sie wurden oben zusammengebunden und dann mit Plaggen und Heide abgedeckt. So erzählte es zumindest die Großmutter. Später bauten sie dann irgendwann die ersten Häuser, winzig kleine Katen. Im Sommer war es so warm, dass die Häuschen zu Backöfen wurden. Im Winter hing das Eis zentimeterdick an den Wänden. Damals mussten sie das Moor erst kultivieren, die Gräben waren nicht ausgehoben und damit nicht schiffbar. Straßen gab es ohnehin keine. Die Kinder waren betteln gegangen, so hatten sie gehungert. Da haben wir es doch noch gut, dachte Ava oft und versuchte, sich an diesem Gedanken aufrechtzuhalten.
Aber der Winter war nicht gut. Der Winter war lang und dunkel und kalt. Im Winter stopften sie Kleider, sie drehten Strohbänder für die Lücken im Dach und flochten Körbe und Matten, die sie dann im Frühling verkauften.
Und im Winter hatte der Vater keine Arbeit.
Ava begrüßte die Schweine in ihrem Koben, setzte sich eine wertvolle Minute auf die Bank vor dem Küchenfenster und sah zu, wie in der Ferne der Nebel über den Deich kroch. Schon sehr bald würde die Sonne ihn vertreiben. «Im Nebel tanzen die Elfen», hatte die Großmutter früher immer gesagt. Und Ava sah es. Sie sah, wie sie sich in stummem Reigen drehten und neigten. Und sie wünschte, sie hätte Zeit, um die Nebelelfen zu beobachten, solange sie wollte. Bis die Sonne über die Wiesen wanderte und sie sich in das dunstige Nichts auflösten, aus dem sie gekommen waren.
In diesem Moment klopfte von drinnen ein knöchriger Finger gegen das Glas, und sie stand ruckartig auf. Träumen durfte man nur nachts.
Der Tag war zum Arbeiten da.
Während sie sich nach Ruth über der Schüssel in der Küche wusch und die Zähne putzte, ging sie in Gedanken die anstehenden Aufgaben durch. Heute waren die Bohnen dran. Ava und Ruth würden sie in den Steintöpfen einsalzen und die andere Hälfte in der Stube zum Trocknen unter die Deckenbalken hängen. Aber vorher musste Ava genau wie gestern ein paar Stunden bei den Hinderks als Heumagd aushelfen, eine Plackerei, die sie noch Tage später in den Armen spürte. Bis gestern hatten sie die frisch gesenste Grasmahd auf den Wiesen ausgelegt, damit sie in der Sonne trocknen konnte. Mehrmals am Tag wurde umgeschlagen. Abends musste das Gras in Rangen aufgeheut und am Tag drauf wieder auf der Wiese verteilt werden. Ein Spiel, das sich wiederholte, bis es ans Einfahren ging. Sie waren spät dran dieses Jahr. Die Wiesengänger begannen oft schon morgens um drei mit der Arbeit, und trotzdem kamen sie kaum hinterher. Bald würden sie auch mit dem Festtreten beginnen, eine Arbeit, die den Frauen vorbehalten war. Sie schwitzten schrecklich in der heißen Scheune, bekamen kaum Luft, während sie bis zur Erschöpfung auf dem Heu herumtrampelten. Ava wurde müde, wenn sie nur daran dachte. Und auf dem Hof gab es doch genug Eigenes zu tun. Ihr fiel ein, dass jemand zum Krämer musste, das Schlachtfett war aus, also brauchten sie Öl. Und Essig für die Bohnen. Kaffee gab es schon lange keinen mehr, nicht einmal sonntags. Aber Ava hatte sich an den Geschmack des Zichorien-Ersatzes gewöhnt.
Woran sie sich nicht gewöhnen konnte, war das Essen.
Gemüse gab es genug, aber die Geest war so unfruchtbar, dass außer Kartoffeln, Kohl und Rüben kaum etwas gedieh. Und Gemüse machte nicht satt. Es füllte den Magen, aber nach einer Stunde Arbeit war Ava wieder hungrig, und gegen Abend zitterten ihr die Hände. Es gab ständig Bratkartoffeln, Mehlklöße aus der Pfanne oder Milch mit eingebrocktem Schwarzbrot. Morgens bekam der Vater noch immer Schinken auf sein Brot, manchmal Mettwurst, und Ava sah meistens mit knurrendem Magen zu, wie die Bissen in seinem Mund verschwanden. Es blieb so gut wie nie etwas über. Und wenn, dann bekam es Elsa. Ava selbst aß genau wie Mette und Ruth jeden Morgen Brot mit Butter oder Schmalz. Sie verstand es ja, dem Vater musste der beste Bissen zukommen, denn er arbeitete am härtesten. Und trotzdem hätte sie alles gegeben für ein Stück Schinken.
Ruth kam aus Ostfriesland, und als es dem Hof noch besser ging und sie sich normale Lebensmittel leisten konnten, hatte sie an Feiertagen und zu Silvester Spekdikken gemacht. Duftender Pfannkuchenteig wurde in Schmalz gebacken und auf der einen Seite mit Mettwurstscheiben und auf der anderen mit Speckstückchen belegt. Wenn Ava nur daran dachte, rumpelte ihr Magen, und ihr Mund zog sich zusammen. Elsa und sie hatten immer etwas abbekommen. Manchmal hatten sie sich sogar noch Zucker darübergestreut. Er war mit dem Fett karamellisiert und hatte eine knusprige braune Schicht gebildet. Aber Zucker gab es ebenfalls schon lange nicht mehr, nur noch Sirup. Sie backten auch nur noch mit Talg aus, der an der Zunge klebte und den Mund verbrannte. Auch heute würde sie wieder Stippbrot machen. Man tunkte Brot in eine Pfanne mit heißem Talg und sparte sich so den Aufstrich. Ein Arme-Leute-Essen. Das waren sie nun mal, auch wenn niemand es jemals aussprach. Arme Leute.
Moorbauern.
Das Gesinde war schon lange weg. Nur noch Ruth war übrig.
Zumindest würden sie nicht verhungern. Das Land versorgte einen. Aber es verwöhnte einen nicht.
Ava war so dünn, dass sie ihre Taille mit beiden Händen umfassen konnte, ihr Kleid so oft geflickt, dass der Stoff sich unter den Armen bereits auflöste. In der Kirche starrte sie voller Neid auf die feinen Sonntagskleider der Altländer Bauersfrauen aus Crêpe, Piqué und sogar Cheviotstoff, die sich an der städtischen Mode orientierten, von weither bestellt wurden und nur einem Zweck dienten: zu zeigen, wie gut es den Leuten im Alten Land ging, wie fruchtbar der Boden war, wie exklusiv die bäuerliche Oberschicht, zu der sich die Großgrundbesitzer zählten. Geest und Marsch lagen eben nur landschaftlich nah beieinander. In der Kirche zeigte sich in aller Deutlichkeit, wie weit sie eigentlich voneinander entfernt waren. Aber sie gingen ohnehin nicht oft. Der Weg war weit, die Zeit knapp. Und das Moor kannte keine Sonntage. Genauso wenig wie die Kühe.
«Du versorgst heut die Alte!»
Ruth hatte schlechte Laune. Ava sah es daran, wie ihre Stirn sich unter der Haube zusammenzog und sie mit ruppigen Bewegungen die Sachen umherschleuderte. Sie warf einen Blick in Richtung Diele. Nicht auszudenken, wenn er vom Lärm aus der Küche geweckt würde. Aber sie konnte Ruth die schlechte Laune nicht verdenken, sie war seit zwanzig Jahren auf dem Hof und hatte nachts oft so schlimme Rückenschmerzen, dass sie im Schlaf wimmerte. Und vor ihnen lag nur ein weiterer Tag voll mühseliger Arbeit, die eigentlich von einem Dutzend Hände erledigt werden müsste, nun aber mehr schlecht als recht von ihnen allein gestemmt wurde. Und darauf folgte ein weiterer Tag. Und ein weiterer. Und es gab nicht einmal gutes Essen, auf das man sich freuen konnte.
Stumm setzte Ava einen wässrigen Getreidebrei aufs Feuer. Brot konnte ihre Großmutter nicht kauen.
Ruth nahm den Bocke, ihren dreibeinigen Melkhocker, und klemmte ihn sich unter den Arm. «Ich gehe zu den Kühen. Dass du dich bloß nicht wieder von ihr festhalten lässt!»
«Sie liegt den ganzen Tag in ihrer Kammer. Du weißt, wie sie sich freut, wenn jemand zu ihr kommt», erwiderte Ava leise.
«Und ich soll alleine melken?»
«Du kannst doch auch zu ihr gehen!»
«Sie will mich nicht. Letzte Woche hat sie mir den Becher an den Kopf geworfen.»
«Sie meint es nicht so.» Wie immer verspürte Ava den Drang, die Großmutter zu verteidigen. In den letzten Jahren war die alte Frau eine schreckliche Bürde geworden. Aber Ava erinnerte sich an die Großmutter vor der Krankheit. Sie hatte ihr voller Geduld die Buchstaben beigebracht. Ihr vorgelesen. Mit leiser Stimme das Gedicht aufgesagt:
Schläft ein Lied in allen Dingen …
«Es ist für welche wie dich», hatte die Großmutter immer gesagt, wenn Ava weinte, mit ihren wässrigen blauen Augen gelächelt und ihr die Tränen abgewischt. «Für Menschen, die mehr sehen als nur den Dreck und die Arbeit.»
Ava hatte sich immer schon fortgeträumt. Es geschah wie von selbst. Sie kniete im Beet, riss Kartoffeln aus, und ihr Blick wurde entrückt, richtete sich nach innen, ihre Gedanken begannen zu wandern. Alle außer der Großmutter hassten das an ihr. Sie spürten, dass sie sich fortsehnte, und nahmen es ihr übel. Vielleicht, weil sie es ihr neideten. Denn wie könnte man sich nicht fortsehnen aus einem Leben wie diesem?
Ruth knurrte etwas Unverständliches, nahm die Melkeimer und ging zur Tür. «Du bist genauso eine Magd wie ich, also hör auf, dich zu drücken!», zischte sie.
«Bin ich nicht», flüsterte Ava ins Herdfeuer. Aber erst, als die Tür schon hinter Ruth zugefallen war. «Ich bin keine Magd. Und das weißt du genau.»
Einen Moment beobachtete sie die züngelnden Flammen, stand reglos da, den Kochlöffel in der Hand, und in ihrem Kopf flüsterte eine Stimme: Aber was bist du dann?
Ava war mit fünf Jahren auf den Moorhof gekommen. Sie wusste, dass die ärmsten Bauern im Kaiserreich noch immer ihre Kinder auf Auktionen versteigerten, und sie schauderte jedes Mal, wenn sie davon hörte. Ihre Geschichte war anders. Sie sollte nur vorübergehend bleiben. Die Eltern wollten in Amerika ein neues Leben anfangen und würden Ava nachholen, sobald sie konnten.
Das erzählte Mette. Anfangs zumindest.
Eine Bewegung im Augenwinkel lenkte sie ab. Etwas war da, in der Ecke neben dem Regal. Sie legte den Breilöffel zur Seite, trat stirnrunzelnd näher und bückte sich. Eine Maus saß neben dem Besen. Sie zitterte, hatte ihr Fell aufgestellt. Als Ava sie näher betrachtete, sah sie, dass ihr eine weiße Flüssigkeit aus den Augen tropfte. Rasch nahm sie das Kehrblech und schubste das Tier mit dem Besen darauf, dann trug sie es zum Misthaufen. Eigentlich hätte sie die Maus mit der Schaufel erschlagen müssen. Aber sie setzte sie vorsichtig neben einem Löwenzahn ins Gras, blickte sich um und ging dann rasch wieder ins Haus.
Als sie hineinkam, öffnete sich im selben Moment die Tür zum Schlafzimmer.
«Guten Morgen, Mutter!»
Mettes Augen waren wie kleine schwarze Perlen. Mit wütender Miene legte sie einen Finger an den Mund. Ava hatte leise gesprochen, schließlich wusste sie, was passierte, wenn der Vater zu früh geweckt wurde, aber Mette hielt trotzdem besorgt inne und lauschte auf eine Regung hinter der Tür. Als nichts passierte, atmete sie hörbar auf, schlurfte an den Tisch und ließ sich ächzend nieder. Ihr Gesicht war morgens so verquollen, dass man sie kaum erkannte. Ava wusste aus den Erzählungen der Großmutter, dass sie einmal eine schöne Frau gewesen war, nach der sich alle umdrehten. Von dieser schönen Frau waren nicht einmal mehr Spuren übrig. Mettes Stirn lag in tiefen Falten. Ava hätte ihr gerne etwas Gutes getan, ihr Sorgen abgenommen. Aber sie wusste nicht, wie. Und sie arbeitete selbst so viel, dass sie nicht hinterherkam.
«In acht Tagen hat das Kind Geburtstag», murmelte Mette und warf einen Blick Richtung Flur. «Du musst bald zum Krämer und das Papier holen.»
Ava klopfte an die niedrige Tür und öffnete sie vorsichtig. Der Schrank war so klein, dass sogar Elsa darin die Knie anziehen musste. Aber sie schlief lieber hier im Flur als auf der Küchenbank oder bei Ruth, die im Traum um sich trat.
Elsas Brust unter dem Leibchen hob und senkte sich langsam, die Wimpern warfen zuckende Schatten auf ihre Wangen. Sie brauchte morgens Zeit, fand nur schwer aus dem Schlaf, und wenn man sie hetzte, fing sie an zu weinen. Ava verstand das nur zu gut.
«Elsa!» Sacht strich sie der Schwester die Haare aus der warmen Stirn. «Elsa. Aufwachen.»
Elsa gab ein Brummen von sich. Sie blinzelte, ohne Ava wahrzunehmen, und drehte sich zur Wand.
Ava lächelte. Es war jeden Morgen das Gleiche. «Komm, die Kühe warten schon. Die Schweine sind auch schon wach. Und die Gänse. Und weißt du, was ich vorhin gesehen habe? Nebelelfen, hinten am Waldrand. Eben habe ich in der Küche eine Maus gefangen. Du verpasst ja alles, wenn du so lange schläfst», sagte sie in leisem Singsang und streichelte ihrer Schwester den Rücken. Von der Schule sagte sie nichts. Elsa hasste die Schule, sie konnte sich nicht daran gewöhnen, wollte auf dem Hof bleiben, in ihrer vertrauten Umgebung.
Langsam setzte das Mädchen sich auf. Lila Schatten lagen unter ihren blauen Augen. Ava wünschte sich wie jeden Tag, sie könnte sie schlafen lassen.
Elsa rieb sich mit ihren kleinen Fäusten die Augen und starrte einen Moment ins Nichts. Dann ließ das Kind sich langsam gegen sie sinken, und eine Weile saßen sie einfach da. Ava kniete vor der Strohmatratze und hielt ihre kleine Schwester fest, wiegte sie sacht vor und zurück und wartete. Sie roch den Schlaf an Elsa, den warmen Kinderschweiß, den leichten Schimmel der Strohmatratze, den torfigen Dunst der Wände.
«Weißt du, dass du bald Geburtstag hast?», flüsterte sie Elsa ins Ohr, und sie spürte, wie die Schwester nickte. «Wann?», fragte Ava leise, und Elsa löste sich von ihr, überlegte einen Moment und hielt dann acht kleine Finger in die Höhe.
Ava nickte. «Richtig!», sagte sie stolz. «Noch …» – sie stupste jeden einzelnen der Finger mit einem der ihren an und zählte dabei mit – «… fünf, sechs, sieben, acht Tage.»
Ein Lächeln tanzte um Elsas Mundwinkel. Aber es verschwand so schnell, wie es gekommen war. Geburtstage waren auf dem Hof schon lange keine fröhliche Angelegenheit mehr.
Ava betrachtete ihre Schwester. Die nagende Sorge wegen des Hungers, in der sie alle lebten, die unaussprechliche Angst vor dem langsam voranschreitenden Wahnsinn des Vaters, der mit dem Branntwein und den Schulden ins Haus gekommen war, zeigte sich bereits in dem kleinen Kindergesicht. Elsas Stirn schien immer kummervoll zusammengezogen, die blauen Augen erschrocken geweitet. Wie sie alle machte Elsa sich klein und unsichtbar, wenn der Vater in der Nähe war. Aber manchmal schien es Ava, dass sie sich nun auch klein und unsichtbar machte, wenn er nicht da war. Dass es irgendwann zu ihrer Natur werden würde. Elsa war nicht wie sie. Elsa war laut und neugierig. Fröhlich. Und Ava befürchtete, dass diese Eigenschaften langsam verschwinden würden, wenn die Schwester sie zu lange in sich einsperrte.
Elsa verschwand im Stall, um Ruth vor der Schule beim Seihen der Milch zu helfen, und nachdem Ava der Großmutter den Brei gefüttert hatte, kam auch sie dazu. Danach frisierte sie Elsa, passte auf, dass sie sich ordentlich anzog. Sie war gerade ins erste Schuljahr gekommen, und Ava beneidete sie nicht. An ihre eigene Schulzeit dachte sie nur mit Schrecken zurück. Im Winter mussten sie meist um sechs schon im Klassenzimmer sein, um den großen Kanonenofen anzufeuern, damit er um acht, wenn der Unterricht begann, warm glühte. Sie hatte dafür morgens einen Korb voll Torf mitgebracht, das mit Petroleum getränkt war, und der lange Weg durch eisige, dunkle Kälte spukte oft durch ihre Träume. Die Luft roch anders im Winter, und sie roch anders am frühen Morgen, bevor die Sonne aufging. Auch die Geräusche im Moor waren anders in der Dunkelheit. Besonders für ein kleines Kind mit zu vielen Gedanken im Kopf.
Immer hatte sie sich geschämt. Alle wussten, dass sie nicht von hier stammte. Außerdem war sie zu groß und zu dünn, sie stellte zu viele seltsame Fragen. «Taternkind» wurde sie genannt. Ava hatte erst ein Mal Tatern gesehen, in einem Sommer tauchten sie plötzlich auf, campierten mit ihren Wagen in der Nähe des Dorfes und führten auf dem Kirchplatz Kunststücke auf. Selten hatte sie etwas so sehr fasziniert wie diese großen, lauten Familien, die in Wagen wohnten und zusammen durchs Land zogen. Ihre Andersartigkeit grenzte sie von den Menschen im Dorf ab. Aber sie schweißte sie auch zusammen.
Es hatte Ava nicht gestört, dass die Kinder dachten, sie wäre eine von ihnen. Es hatte sie gestört, dass sie zurückgelassen worden war.
Der erste Winter war in den ersten Frühling übergegangen, der Sommer war gekommen und dann der nächste Winter und dann wieder ein Frühling, ohne dass sie etwas von den Eltern hörten. Mette sagte nicht mehr, dass sie Ava nachholen würden. Und als die Jahre verschmolzen, sprach sie schließlich davon, dass die Eltern sich bloß nicht einbilden sollten, sie könnten irgendwann einfach auftauchen und Ava wiederhaben.
Ava hatte ihre Kindheit damit verbracht, die Ankunft der Eltern gleichzeitig zu fürchten und herbeizusehnen. Anfangs weinte sie sich jede Nacht in den Schlaf, wünschte sich ihre Mutter zurück, deren Gesicht in ihrer Erinnerung immer mehr verschwamm, bis sie sich nur noch an das Gefühl erinnerte, von ihr im Arm gehalten zu werden. Aber je mehr sie zu einem Teil der anderen Familie wurde, desto mehr wuchs auch die Angst. Das Leben auf dem Moorhof war hart, aber es war ihr Leben. Die fensterlose Kammer, in die sie zog, als sie zu alt wurde, um bei Mette und Vater zu schlafen, war ihr Zuhause. Und mit der Zeit konnte sie sich nicht mehr an die Eltern erinnern. Sie hatte sogar ihre Namen vergessen. Manchmal hatte sie das Gefühl, sie nie gewusst zu haben. An anderen Tagen tanzten sie ihr auf der Zunge, schienen so greifbar, als müsste sie nur den Mund öffnen, um sie zu hören.
Doch genau wie die Namen kamen die Eltern nie zurück.
Dann, einige Jahre später, wurde Mette endlich schwanger. Ava hatte nun eine kleine Schwester. Sie liebte Elsa mehr als alles andere. Und trotzdem war da immer dieses Gefühl, dass sie ein Leben lebte, das nicht passte. Dass sie am falschen Ort gelandet war und alles unausweichlich auf den Tag zusteuerte, an dem ihr altes Leben mit einem neuen zusammenstoßen und sich und alles verändern würde.
Ihre Eltern hatten sie zurückgelassen. Sie war nicht gewollt. Und die Kinder rochen es an ihr.
Sie hatte nur wenige Freunde und blieb lieber für sich. Obwohl sie den Unterricht mochte, die Buchstaben und Zahlen, die Auszeit von der schweren Arbeit auf dem Hof, machte ihr die Schule jeden Tag bewusst, wer sie war.
Und wer sie nicht war.
Als Elsa schließlich aufbrach, die Haare ordentlich geflochten, die Schürze zwar mehrfach geflickt, aber dennoch weiß geblaut, dachte Ava, wie seltsam es war, Elsa in Schuhen zu sehen. Ab Mai liefen sie auf dem Hof nur noch barfuß. Sie hoffte nur, dass die Schwester nicht wieder trödeln und dafür Schelte von der Lehrerin bekommen würde. Wenn Elsa im Moor oder auf den Wiesen unterwegs war, sammelte sie heimlich Blüten in ihrer Schürze, und manchmal vergaß sie dabei die Zeit. Letzte Woche hatte das Fräulein ihr so hart mit dem Stock auf die Finger gehauen, dass sie am nächsten Morgen nicht melken konnte.
Seit dem Frühling hatte Ava immer wieder ganz hinten im Katechismus Blüten zwischen die Seiten gelegt. Weißes Schnabelried, Moosbeere, Glocken- und Rosmarinheide. Sie stellte sich vor, dass die Blüten den Geruch nach Sommer in sich bewahren würden wie die Gewürze und Kräuter, die in dicken Büscheln von der Decke der Küche hingen. Man konnte seine Nase hineinpressen und einen Augenblick lang vergessen, wie viele dunkle Tage und Wochen noch vor einem lagen. Sie würde bei Marquards im Laden buntes Papier zum Geburtstag kaufen, Mette hatte ihr extra ein wenig Geld dafür gegeben. Dann konnte Elsa die Blüten aufkleben und an die Wand hängen.
Früher hatte es an Geburtstagen ab und an ein kleines Spielzeug gegeben. Die Erinnerungen daran erschienen Ava wie Bilder aus einem anderen Leben. Hannelore vom Beekshof besaß sogar ein Schaukelpferd. Seit sie es gesehen hatte, musste Ava immer wieder daran denken. Sie war nicht ganz sicher, wozu man ein Pferd aus Holz brauchte, wenn doch überall welche auf der Weide standen, aber der Gedanke faszinierte sie, dass das Pferd keinerlei Nutzen hatte, es allein zu Hannelores Freude gekauft worden war.
Ava sah ihrer kleinen Schwester nach, bis sie hinter der Weggabelung verschwunden war. Dann ging sie ins Haus und begann mit der Arbeit.
2
Am nächsten Morgen weckte der Vater Ava noch früher. Es war Torfzeit. Wenn sie auf dem Hof abkömmlich war und nicht beim Mähen gebraucht wurde, ging Ava mit ihm ins Moor. Schweigend feuerte sie den Herd an, schweigend frühstückten sie kalte Bratkartoffeln und schlürften den bitteren Zichorien-Aufguss.
Während sie kaute, beobachtete sie, wie draußen das Schwarz langsam in waberndes Blau überging. Wie immer, wenn es ins Moor ging, dachte sie, dass sie diesen Tag nicht schaffen würde. Nicht mit so wenig im Magen. Nicht mit so wenig Schlaf. Nicht mit keinerlei Aussicht auf etwas zum Freuen.
Ava mochte den Geruch der dunklen, torfigen Erde. Sie mochte das brackige Wasser, in dem die Männer am Grunde der Kuhlen herumwateten. Und sie mochte die vielen Insekten, das Wollgras, das im Wind wogte, den Kiebitz im Gebüsch, der seine Eier auf den Boden legte, sodass man immer vorsichtig sein musste, um nicht daraufzutreten.
Aber sie hasste das Torfstechen und alles, was dazugehörte.
Ihre Aufgabe war es, den Torf, den der Vater stach, auf den Karren zu laden und die Soden dann zum Deich zu bringen, wo sie trocknen sollten. Ava schichtete sie dort auf, nach vier Wochen wurde umgespekt, und die untersten Soden kamen nach oben. Zwischen dem Stechen und dem Umschichten wurde Heu geerntet, Brot gebacken, Honig gemacht, Zäune wurden repariert, Schweine ins Dorf zum Schlachter getrieben, Beeren und Wurzeln gesammelt. Es hörte nie auf. Und manchmal kam es ihr so vor, als liefen sie immer hinter allem her, dem Torf, den Kühen, dem Garten, versuchten Schritt zu halten.
Aber es gelang einfach nicht.
Immer war da Sorge. Sorge um die Ernte, Sorge um den Regen, Sorge um die Tiere. In nassen Jahren bekamen sie den Torf kaum vom Damm, und in manchen Kuhlen war der Boden so von Schilfgras und Binsen durchsetzt, dass man nicht stechen konnte und doppelt so lang brauchte.
Nie war irgendetwas einfach.
Der Damm bestand aus einem Stück Land, das nicht bestochen war. Ringsherum befanden sich Moorkuhlen, so weit das Auge reichte, unterbrochen nur von Birken und krummen Kiefern. Aus den meisten Kuhlen schauten Köpfe heraus, auch die anderen Arbeiter waren bereits früh am Werk. Das Moor wartete nicht, und der Sommer war kurz.
Auf dem Damm pfiff der Wind stärker als in den Kuhlen, daher wurde dort der Torf getrocknet. Zwei Soden nebeneinander, dann zwei quer obenauf und wieder zwei andersherum. Sechs Soden, immer gleich. Man musste auf die Abstände achten, damit der Wind gut hindurchkam.
Wenn der Torf nach vier Wochen getrocknet war, wurden die Soden zu großen Haufen geschichtet. Sie liefen oben zusammen wie Bienenkörbe, und man musste aufpassen, dass sie nicht einstürzten. Vor der Roggenernte musste alles fertig sein, sonst konnte ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen. Und obwohl sie keinen Roggen zu ernten hatten, weil er bei ihnen nicht wuchs, wusste der Vater immer, wann es Zeit war. Er war sehr gut im Schichten, seine Törbe waren immer etwas gerader als die der anderen Stecher, und er war erst zufrieden mit dem Sommer, wenn der ganze Deich voll rechteckiger, akkurat geschichteter Torfstapel war.
Obwohl sie an Tagen wie diesem von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zusammen waren, sprachen sie nicht viel. Die Arbeit war zu anstrengend. Der Vater hatte immer eine tiefe Furche zwischen den Brauen. Oft legte er sich ein altes Hemd über den Kopf, zum Schutz vor der Sonne, weil es dünner war als seine Kappe, und auch Ava band sich ein Tuch um, um die Strahlen abzuhalten und den Schweiß aufzufangen, der ihr sonst den Nacken herunterlief. So arbeiteten sie vor sich hin, in stummem Einklang. Manchmal war Ava schneller als er und wollte in die Kuhle zu ihm hinabsteigen, um zu helfen, aber das ließ er nicht zu. «Ist zu schwer für dich», brummte er nur.
Die Kuhle, in der er heute arbeitete, war sicher zwei Meter tief. Seine dicken Holzschuhe standen im Wasser, jeder Schritt machte ein patschendes Geräusch. Sie konnte sehen, wie schwer ihm die Arbeit fiel. Immer, wenn er sein Haumesser in die Erde senkte und dann den Spaten nahm, um den Torf herauszustechen, schien es Ava, er bräuchte ein klein wenig länger als bei dem Stich davor. Sie hatte eine Forke mit kurzen Zinken, mit denen sie die Soden entgegennahm, und obwohl es noch nicht einmal richtig hell war, zitterten bereits ihre Arme. Nachdem sie den vierten Karren zum Deich gefahren hatte, sah sie beim Wiederkommen, wie der Vater einen Schluck aus einer Flasche nahm.
Auch hier, dachte sie, und kalte Panik stieg in ihr auf. Es durfte nicht wahr sein.
Aber es war wahr. Er versteckte die Flasche, trank immer nur, wenn sie den Karren wegfuhr. Doch bald mischte sich der Geruch des Branntweins unter den der torfigen Erde, und Ava biss die Zähne so fest aufeinander, dass ihre Wangen anfingen zu brennen.
«Wir machen Pause», sagte er nach etwa drei Stunden, warf den Spaten hin und kletterte aus der Kuhle.
Ava war überrascht. Es war noch früh. Vielleicht hatte der Vater daheim nicht genug gegessen? Das einzig Gute an Stechtagen war das Essen. Im Moor gab es oft ein zweites Frühstück, manchmal legte Mette ihnen sogar gekochte Eier in den Korb. Eier wurden normalerweise im Colonialladen gegen Ware eingetauscht. Als der Vater jetzt vier aus dem Korb zog und sogar ein Stück Schinken, wurden Avas Augen groß. Er gab ihr ein Ei und ein kleines Stück Schinken und baute dann den Strohschauer auf, der sie beide vor dem Wind schützen sollte. Sie setzten sich hinein und aßen. Avas ganzer Körper prickelte. Sie wollte gar nicht schlucken, so herrlich schmeckte es.
«Ich leg mich eine Minute um, hab schlecht geschlafen heut Nacht», brummte der Vater, sobald er seine Eier verschlungen hatte, und warf seine Mütze als Kissen auf den Boden.
Bald hallte sein Schnarchen über die Wiese. Ava musterte ihn voller Sorge. Sie arbeiteten ja noch gar nicht lange. Wie sollten sie fertig werden? Langsam aß sie ihr Ei und den Schinken, leckte sich die Finger und versuchte, den Geschmack, solange es ging, im Mund zu behalten. Sie beobachtete die anderen Torfstecher in ihren Kuhlen, beobachtete, wie die Sonne über den Deich kroch, den Nebel vertrieb und stattdessen das Wollgras weiß leuchten ließ. Sie ging auf den Damm und musterte die Soden, rückte ein paar gerade, zählte die Moorlöcher.
Der Vater schlief und schlief.
Irgendwann bekam sie Angst. Was, wenn er aufwachte, merkte, wie viel Zeit sie verloren hatten, und Ava die Schuld daran gab? Unruhig sah sie zwischen dem Vater und der Kuhle hin und her. Vielleicht würde eine List helfen. Sie nahm die Kanne und trank einen Schluck. Dann hustete sie laut. Als der Vater in die Höhe fuhr, hustete sie noch einmal und rieb sich die Augen. «Ich habe mich verschluckt», keuchte sie.
Er setzte sich auf. Seine Augen waren blutunterlaufen. «Wird Zeit, dass wir weitermachen», brummte er, und Ava spürte, wie die Erleichterung durch ihren Körper sickerte wie warmes Wasser.
Mittags brachte Elsa ihnen die Vesper, Wurzeln mit Kohl, Hirse und Vizebohnen – mit einer Schwarte gekocht und dadurch genießbar. Die Schwester half eine Weile mit, aber dann musste sie zurück zum Hof, um die Kühe zu hüten, wie jeden Nachmittag.
Sie waren erst fertig, wenn sie sechstausend Soden gestochen hatten. Keine einzige weniger. Das Tagessoll hielt der Vater immer ein.
Todmüde wankten sie schließlich im Dämmerlicht nach Hause. Noch nie waren sie so lange draußen gewesen. Alle anderen Stecher waren längst gegangen. Als sie den Hof erreichten, saßen drei dicke weiße Eulen auf den Einfriedungspfählen und lauerten auf Beute. So spät ist es schon, dachte Ava und blinzelte. Ihre Lider fühlten sich dick und schwer an. Die Eulen erwachten erst, wenn die Nacht hereinbrach. Und morgen früh in der Dämmerung würde es weitergehen. Aber wenn sie nicht half, musste der Vater die sechstausend Soden alleine stechen. Und dann war niemand da, um ihn aufzuwecken. Und niemand, vor dem er die Flasche verstecken musste.
Am nächsten Morgen jedoch schreckte sie vom Krähen des Hahns in die Höhe. Sie rieb sich den Schlaf aus den Augen, dann sprang sie auf und lief in die Küche. Ruth und Mette saßen am Tisch.
«Was ist los?» Ava spürte ihr Herz klopfen. «Wir wollten doch ins Moor.»
«Er ist gestern noch in die Wirtsstube.» Mette kaute ihr Brot, als würde sie es am liebsten wieder ausspucken. «Und noch nicht zurück.» Sie warf ihr einen müden Blick zu, in dem so viel Sorge lag, so viel Wut, dass Ava erschrak. Im nächsten Atemzug sagte Mette: «Zieh dich an. Du musst ihn holen gehen.»
Sie hatte es geahnt.
Ihre Mutter erhob sich vom Tisch und schaute in die Schränke. «Wenn du schon ins Dorf musst, bring Bleich-Soda mit. Reis brauchen wir auch, aber nicht zu viel. Und Essig.»
«Und Öl», ergänzte Ava, und Mette nickte. «Dann kannst du auch in der Posthalterei nachfragen, ob ein Brief für uns gekommen ist. Hermann wird wieder nicht daran denken. Und dass du ja den Wagen nicht mit ins Dorf nimmst. Es fehlt noch, dass die Leute das sehen.»
Mit mechanischen Bewegungen zog Ava sich an. Es war schon ein paarmal vorgekommen in den letzten Jahren, dass der Vater in die Wirtschaft gegangen und nicht nach Hause gekommen war. Der Weg war weit und in der Dunkelheit gefährlich, besonders, wenn man betrunken war. Aber unter der Woche, wenn sie eigentlich stechen mussten … Das war neu.
Langsam lief sie los, den Bollerwagen hinter sich herziehend. Zuerst über das Moor, dann an den kleinen Nebenzügen der Este entlang. Es war Hochsommer und der Himmel so blau, die Felder so leuchtend gelb, dass sie nicht anders konnte, als den Weg zu genießen. Der Wagen rumpelte hinter ihr her, und sie wünschte, sie hätte daran gedacht, einen Strick mitzunehmen. Den könnte sie sich um den Bauch binden und müsste so nicht immer die Arme nach hinten strecken. Es war ein langer Weg, bald rann ihr der Schweiß den Nacken hinab. Der Hauptstrom des Flusses war nicht weit weg, und wie immer, wenn sie in der Ferne einen der kleinen Raddampfer sah, stellte sie sich vor, sie könnte an Bord springen und mitfahren. Die Primus fuhr jeden Tag mit Passagieren und Vieh in die Stadt und wieder zurück. Natürlich gab es auch die Eisenbahn, die von Hamburg nach Buxtehude ratterte. Wenn der Wind günstig stand, hallte ihr einsames Tuten über die Wiesen. Ava hob jedes Mal den Kopf und stellte sich vor, wie die Bahn durchs Land dampfte. Alle konnten gehen und fahren, wohin sie wollten. Nur sie war auf dem Hof gefangen.
In den Moorkuhlen, die weniger wurden, je weiter sie auf das Dorf zukam, und irgendwann ganz verschwanden, glitzerte das Wasser. Sie standen voller Sonnentau. Ava mochte diese seltsame Pflanze, die aussah wie ein hungriges Tier und sich schloss, wenn man seinen Zeigefinger hineinsteckte. Um sich abzulenken, zählte sie die Krüppelkiefern und irgendwann die Schmetterlinge. Es waren so viele, dass die Luft bunt flimmerte. Als sie an den hellen Stellen in der Heide Bickbeeren entdeckte, jauchzte sie leise, ließ den Karren stehen, wo er war, und rannte hin, um sie zu pflücken. Die Stiele waren nicht mehr rot, also war jetzt die Zeit, in der sie am besten schmeckten. Ava passte auf, die Beeren ganz in den Mund zu stecken und nicht viel zu kauen, damit sie die Lippen nicht blau färbten. Sonst würde Mette genau wissen, dass sie getrödelt hatte. Aber die Eltern hatten kein Geld für Obst, und Ava aß es so gerne. Die Süße ließ sie vor Glück schaudern. Rasch riss sie ganze Hände voll aus und stopfte sie sich in die Rocktasche. Also hat der Tag doch etwas Gutes, dachte sie, als sie weiterging. Und sie würde das Papier für Elsa kaufen können. Somit war er doppelt gut.
Sie gehörten zum Kirchspiel, aber deswegen noch lange nicht zum Ort. Die Nachkommen der armen Moorbauern waren eben immer noch arme Moorbauern, auch wenn sie jetzt nur noch als Nebenerwerb Torf stachen und sonst Schweine züchteten oder in der Ziegelei aushalfen oder taten, was auch immer der Vater tat, wenn er auf Arbeit war und den Frauen den Hof überließ. Und wenn man nicht im Ort lebte, sondern ausgesiedelt, wenn man keine Giebelschwäne und keine Brauttür besaß, keine Hannoveraner auf der Weide und keine Obstwiesen, wenn der Vater launisch war und die Mutter verschämt und kurz angebunden, die Kleider geflickt waren und die Schürzen nicht so weiß, wie sie sein sollten. Dann gehörte man erst recht nicht dazu.
Sie versteckte den Wagen am Dorfrand in einem Gebüsch unter einer Kastanie. Ava merkte, dass Gardinen sich bewegten und Augen sie verfolgten, sobald sie an den ersten Häusern vorbeiging. Im Dorf blieb nichts unbemerkt. Viele der Häuser hatten vorne überdachte Veranden. Auf einer davon saßen ein paar alte Frauen in Trachten, und obwohl sie ihre Unterhaltung nicht unterbrachen, klebten die Blicke an ihr. Ava wusste, dass sie noch so zügig und mit gesenktem Kopf an ihnen vorbeilaufen konnte, ihnen würde nichts entgehen. Nicht die Schuhe, die ihr schon lange zu klein waren und vorne wie hinten Löcher hatten, nicht die fleckige Schürze, nicht die strähnigen Haare.
Als sie zum Fluss kam, der das Dorf in zwei Teile schnitt, blieb sie stehen. Gerade fuhren zwei Raddampfer aufeinander zu. Der linke in Richtung Blankenese kam mit dem Strom und hatte damit das Wegerecht, aber der rechte machte keine Anstalten, es ihm zu lassen. Die Schiffe würden sich an einer der engsten Stellen des Flusses begegnen, wo sie kaum aneinander vorbeikamen. Der Brückenwärter hatte die Klappbrücke bereits hochgezogen und sah mit gerunzelter Stirn zu. Als die Schiffe schon fast gleichauf waren, bellten sich die Kapitäne wütend etwas zu, die Schiffe fuhren aneinander vorbei, nur eine Handbreit Wasser zwischen ihnen, und der Fluss platschte gegen die Hauswände. Der Brückenwärter fluchte leise und ließ dann seinen Klingelbeutel am Stab hinunter, um das Brückengeld einzuholen.
Als er Ava sah, verfinsterte sich sein Blick. «Was gaffst du denn so? Mach, dass du weiterkommst!», rief er.
Rasch lief Ava an der Brückenbäckerei vorbei, aus der es nach Kuchen roch, an der Kohlenhandlung bog sie links ab und betrat die Posthalterei.
«Ah, endlich kommt einer von euch!» Der Mann hinter dem Schalter beäugte sie durch sein Monokel. «Ich habe schon eine ganze Weile einen Brief aus Übersee.»
Ava musste an sich halten, um nicht an dem Umschlag zu riechen. Er kam aus dem Land, in dem ihre Eltern waren. Das Siegel war dick und glänzend. Eine Briefmarke klebte obenauf. «United States of America», las Ava leise, Buchstabe für Buchstabe. «Postage. Landing of Columbus.»
«Das heißt United States of America», korrigierte der Postbeamte ihre Aussprache. «Das ist Englisch. Das spricht man anders. Und auf der Marke sieht man, wie Columbus in Amerika ankam und die Wilden vertrieb», fügte er hinzu, eine Spur Stolz in der Stimme, als wäre er persönlich mit Columbus bekannt. «Aber das habt ihr ja sicher in der Schule gelernt.»
Ava nickte, obwohl sie keine Ahnung hatte, wovon er sprach. Es klang so fremd und seltsam.
«Aber du liest gut», fügte der Mann hinzu, wie um seinen Tadel von eben wiedergutzumachen. «Sehr gut für ein Moorkind!»
Ava hob den Blick. «Danke», sagte sie, obwohl sie das Gefühl hatte, dass sie etwas anderes hätte sagen sollen. Dann knickste sie kurz, weil sie wusste, dass Mette es erwarten würde – der Postbeamte war immerhin ein feiner Mann und kein Landwirt –, und ging hinaus.
Das Dorf war für Ava die weite Welt. Sie konnte nicht anders, als alles mit den Augen aufzusaugen. Wie anders die Frauen aussahen, wie gepflegt die Gärten. Es gab sogar ein, zwei Damen mit Hüten. Sie mussten aus der Stadt sein und einen Ausflug mit dem Dampfer machen. Wie es sich wohl anfühlte, sich einfach in das Lokal zu setzen und eine Limonade zu trinken. Sonntags in einem feinen weißen Kleid mit der Familie essen zu gehen. Beim Metzger einholen zu können, was immer man wollte.
Die Gastwirtschaft war das feinste Haus im Ort. Hier gab es nicht nur Colonial- und Porzellanwaren, sondern auch Cigarren und eine Manufaktur. Manchmal veranstalteten sie Preisskat und im Frühling die Konfirmationsfeste. Sie hatten einen Saal mit Ausspann, und einmal im Jahr fand hier der Assekuranzball der Schiffer von Cranz statt, auf dem sich die jungen Kapitäne vorstellten. Wie oft hatte Ava schon davon geträumt, auf diesem Ball tanzen zu können, in einem blassblauen Kleid, mit Blumen im Haar und auf dem Handgelenk einen Tropfen von Großmutters Duftwasser, das auf der kleinen Anrichte stand und langsam begann, nach Essig zu riechen. Manchmal sah Ava dabei Julius vor sich, manchmal einen fremden jungen Kapitän. Aber natürlich war es undenkbar, dass jemand wie sie an einem solchen Fest teilnahm. Niemand würde mit ihr tanzen.
Die Ladenglocke bimmelte, als sie bei Marquards eintrat. Es roch nach altem Holz und Kaffee. In den Regalen lagen unzählige Dinge, die Ava faszinierten. Besonders die Colonialwaren, die hinter der Theke und im Schaufenster ausgestellt waren, hatten es ihr angetan. Die meisten waren in Boxen oder Konserven verpackt, und es standen Wörter darauf, die ihr nichts sagten, sich aber fremdartig und geheimnisvoll anhörten: Plum Pudding, Boiled Beef, Rabbits prepared by hand, Golden Syrup, Fresh Oyster, Ranch Tongues. Es klang alles so seltsam, dass sie es nicht einmal aussprechen konnte. Aber wahrscheinlich war es, wie der Postbeamte gesagt hatte: Das ist Englisch, das spricht man anders.
Hinter dem Tresen saß die kleine alte Rosina. Ava atmete auf. Bei Rosina fühlte sie sich willkommen. Im Gegensatz zu ihrer Tochter Hilda, die Ava nie etwas anschauen ließ, sondern immer forderte, dass sie sofort etwas kaufen und dann den Laden verlassen sollte.
«Ich suche Farbpapier.» Zaghaft trat Ava an den Tresen mit der großen Kasse und der Krämerwaage. Wie immer, wenn sie mit anderen Leuten in Berührung kam, hatte sie das Gefühl, nicht zu wissen, wie man sprach. Wie man sich richtig verhielt. «Für meine Schwester. Zum Geburtstag.»
Rosina rutschte vom Hocker. Wenn sie stand, ging sie Ava nur bis zur Brust. In den letzten zehn Jahren hatte die winzige Frau sich kein bisschen verändert, sie trug tagein, tagaus die gleiche Tracht, die weißen Haare unter dem dicken Haubenkranz nach hinten geschoben, die wachsamen schwarzen Augen das Einzige, was sich in ihrem Gesicht bewegte.
Wortlos huschte sie zwischen die Regale und kam bald darauf mit einer Auswahl an Papier zurück, die sie vor Ava ausbreitete. Sie tippte auf ein hellrotes Blatt mit zarter Maserung. Rosina reichte es ihr mit einem Blick aus ihren kleinen dunklen Augen, und Ava strich andachtsvoll mit den Händen darüber.
«Es ist wunderschön. Wie viel macht es?», fragte sie.
Rosina hielt fünf Finger hoch.
Ava zählt die Münzen in ihrer Hand. «So viel habe ich nicht», sagte sie mit einem Seufzer des Bedauerns. Sie hatte es sich schon gedacht.
«Nun hast du es aber schon angefasst!» Eine schneidende Stimme drang aus dem hinteren Teil des Ladens. Hilda Marquard tauchte zwischen den Regalen auf, als hätte sie nur darauf gelauert, Ava bei etwas Verbotenem zu ertappen. «Sicher hast du es schon dreckig gemacht. Aber dann bezahlst du es auch, hast du gehört?»
Ava zog erschrocken die Schultern ein. Ein kalter Schauer überlief sie. Wenn sie nicht bezahlen konnte, würde Hilda am Ende dem Vater etwas sagen. Die Panik ließ ihre Gedanken aussetzen. Wie ein wütender Drache kam Hilda auf sie zu.
Wortlos nahm Rosina Ava das Papier wieder ab. Als hätte sie ihre Tochter nicht gehört, wickelte sie es in ein Stück Zeitung und knotete mit ihren winzigen, altersfleckigen Händen in aller Seelenruhe ein Band darum. Dann reichte sie es Ava zurück und hielt die Hand auf. Zögerlich gab Ava ihr die Münzen. Hilda war direkt neben ihr stehen geblieben und stemmte die Arme in die Hüften.
Rosina verzog keine Miene. Sie zählte das Geld in ihrer Hand auch nicht nach. Sie sah Ava nur an. Und dann nickte sie.
«Herrgott, Mutter, du bist viel zu mildtätig!», zischte Hilda.
Avas Stimme zitterte, als sie nach den restlichen Posten auf ihrer Liste fragte. Und als sie erneut Geld auf den Tresen legte, diesmal ausreichend, beugte Hilda sich darüber und zählte laut mit.
Rosina packte alles ein und schob es ihr über den Tresen. Ava bedankte sich mit einem kaum hörbaren Flüstern, sie knickste und huschte mit gesenktem Kopf aus dem Laden.
Draußen lief sie ein paar Schritte, dann drehte sie sich um. Rosina saß wieder auf ihrem Hocker hinter der Scheibe und betrachtete den Dorfplatz. Ihr runzeliges Mondgesicht wirkte, als wäre sie in Gedanken weit weg. Aber als Ava die Hand hob und winkte, winkte sie ganz sachte zurück.
Ava glaubte zu wissen, warum Rosina das getan hatte. Manchmal, wenn sie in der Adventszeit im Dorf war und sehnsüchtig die Auslage im Schaufenster betrachtete, kam die alte Frau aus dem Laden und stellte sich neben sie. Dann zeigte sie mit ihrem winzigen Finger auf das Lametta oder einen Engel, und wenn Ava bewundernd nickte und ihr sagte, wie herrlich die Sachen waren, lächelte sie. Sie mochten beide gerne schöne Dinge. Sie waren beide ein bisschen anders als die anderen Menschen im Dorf.
Ava hasste das Wirtshaus. Man wusste nie, wer gerade herausgestolpert kam. Manchmal, wenn der Vater guter Laune war, erzählte er auf dem Heimweg lallend von den Prügeleien der Schlachtergesellen und Ziegelarbeiter, die schon immer verbitterte Feinde waren, auch wenn niemand so genau zu wissen schien, warum. Manchmal kam er selber mit Schrammen und Kratzern nach Hause. Im Winter verloren die Schifferknechte bei Eisgang ihre Arbeit und gingen in die Schlachtbetriebe und Ziegeleien. Ihr Vater ging in das Wirtshaus. Aber dass er nun auch im Sommer so oft dort zu finden war, machte Ava Angst.
Im Gegensatz zum Laden roch es hier sauer. Nach altem Schuh und Bier. Zögernd trat sie ein. Das Holz des Fachwerks war so alt, dass es schwarz geworden war, und der Boden so ausgetreten, dass er bei jedem Schritt knirschte. Es fiel kaum Licht in den Schankraum, doch sie sah sofort, dass er so gut wie leer war. Es war ja auch früh. Wer hat schon Zeit, um diese Stunde im Wirtshaus zu sitzen, dachte sie bitter.
Der Vater lag mit dem Gesicht auf einem Tisch, die Hand um ein Glas geschlungen. Er schnarchte. Seine dicke Nase war voll geplatzter kleiner Äderchen. Ihm lief ein wenig Speichel aus dem Mund.
Ava hörte hinter sich ein Geräusch und sah auf. Der Wirt trat an die Theke, und in der Sekunde, bevor er ihr zunickte, sah Ava Mitleid in seinen Augen. Sie schluckte und presste die Lippen aufeinander. Ihre Eltern waren stolze Leute. Sie wusste, wie sehr sich Mette schämen würde, wenn sie jetzt hier wäre. Also war Ava entschlossen, sich an ihrer statt so würdevoll wie möglich zu verhalten.
«Na, Mädchen, kommste ihn holen?», fragte der Wirt freundlich, und Ava nickte stumm.
«Bin gespannt, wie der den Weg nach Hause schaffen will.»
«Ich habe einen Wagen dabei.» Sie hatte eine Sekunde gezögert, aber dann waren die Worte doch aus ihr herausgekommen, und sie spürte eine kleine, warme Welle der Genugtuung.
Erstaunt hielt der Wirt inne, dann schüttelte er kaum merklich den Kopf.
«Hat er …» Ava zögerte. «Hat er bezahlt?», fragte sie dann und konnte dem Mann nicht in die Augen sehen. Wenn sie auch noch hier Schulden hatten …
Aber der Wirt nickte. «Ich lass ihn schon lange nicht mehr anschreiben.»
Einen Moment lang sah sie den dünnen Getreidebrei vor sich, den sie am Morgen für die Großmutter gemacht hatte, sie schmeckte den scheußlichen bitterherben Ersatzkaffee und das schwarze, krümelige Brot und bohrte die Finger in die Handflächen. Sie dachte an Ruths schmerzenden Rücken, an das verquollene Gesicht der Mutter.
Noch immer stand sie bewegungslos vor dem Tisch. Sie wusste, dass sie ihn wecken musste. Aber sie konnte sich nicht rühren. Der Vater gab einen lauten Schnarcher von sich, seine Hand kratzte über den Tisch. Ava trat hastig einen Schritt zurück, prallte gegen einen Stuhl. Doch er räusperte sich nur im Schlaf und schnarchte dann weiter.
Der Wirt hatte sie beobachtet. Er legte das Tuch beiseite, mit dem er die Krüge poliert hatte, und kam hinter der Theke hervor. «Nu geh mal schon vor die Tür. Ich bring ihn dir», sagte er mit ruhiger Stimme, und Ava war so erleichtert, dass sie nur nicken konnte. Mit gesenktem Kopf huschte sie nach draußen.
Wenig später hörte sie ein Poltern und laute Stimmen. Der Wirt kam heraus, das Gesicht rot und verzerrt, der Vater hing ihm an der Schulter. «Wo ist der Wagen?», fragte er gepresst.
«Mir fehlt nichts», lallte der Vater. «Lasst mich einfach schlafen.»
«Du hast genug geschlafen, Hermann.» Der Wirt wollte den Vater auf die eigenen Füße stellen, aber er schlug um sich und stierte mit roten Augen in die Gegend. Ava wusste, dass er sich wunderte, wo er war. Und dass er niemals alleine würde laufen können.