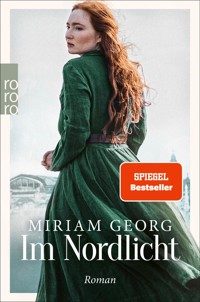9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Nordwind-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine Liebe, die nicht sein kann. Zwei Welten, die nicht zusammengehören. Eine gemeinsame Sehnsucht: Freiheit … Der erste Band des eindrucksvollen Zweiteilers von Bestsellerautorin Miriam Georg. Mitreißend, dramatisch, schlicht nicht weglegbar. Hamburg, 1913. Es muss einen Ausweg geben! Alice wohnt im rauen Arbeiterviertel auf der Uhlenhorst, und ihr Ehemann Henk macht ihr das Leben zur Hölle. Der einzige Lichtblick: ihre Tochter Rosa. Als sie das Kind kaum noch vor Henk beschützen kann, wagt Alice das Unmögliche. Sie will diese Ehe beenden! Nicht weit entfernt vom Elendsviertel lebt der Rechtsanwalt John Reeven in der Villa seiner alteingesessenen Familie. Die Geschäfte florieren, John ist standesgemäß verlobt. Aus guter hanseatischer Tradition berät er auch mittellose Hamburger in rechtlichen Fragen. Das Ansinnen dieser jungen Frau allerdings ist aussichtslos: Sie will sich von ihrem Ehemann trennen. Wider jede Vernunft willigt er ein, sie zu vertreten. Aber das Wagnis birgt ein hohes Risiko. Für Alice steht alles auf dem Spiel. Und John ahnt nicht, wie sehr seine sichere Welt ins Wanken geraten wird ... Der erste Band des packenden neuen Zweiteilers von Bestsellerautorin Miriam Georg. «Miriam Georg hat ein Händchen für Geschichten, für Pointen, für drastische Schattenmomente – und für Cliffhanger. Unterhaltungsliteratur, die Spaß macht.» NDR Podcast Eat.READ.Sleep
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Ähnliche
Miriam Georg
Im Nordwind
Roman
Über dieses Buch
Freiheit und Liebe
Hamburg, 1913. Es muss einen Ausweg geben! Alice wohnt im rauen Arbeiterviertel auf der Uhlenhorst, und ihr Ehemann Henk macht ihr das Leben zur Hölle. Der einzige Lichtblick: ihre Tochter Rosa. Als sie das Kind kaum noch vor Henk beschützen kann, wagt Alice das Unmögliche. Sie will diese Ehe beenden!
Nicht weit entfernt vom Elendsviertel lebt der Rechtsanwalt John Reeven in der Villa seiner alteingesessenen Familie. Die Geschäfte florieren, John ist standesgemäß verlobt. Aus guter hanseatischer Tradition berät er auch mittellose Hamburger in rechtlichen Fragen. Das Ansinnen dieser jungen Frau allerdings ist aussichtslos: Sie will sich von ihrem Ehemann trennen.
Wider jede Vernunft willigt er ein, sie zu vertreten. Aber das Wagnis birgt ein hohes Risiko. Für Alice steht alles auf dem Spiel. Und John ahnt nicht, wie sehr seine sichere Welt ins Wanken geraten wird …
Der erste Band des packenden neuen Zweiteilers von Bestsellerautorin Miriam Georg.
Vita
MIRIAM GEORG, geboren 1987, ist die Autorin der Romane «Elbleuchten» und «Elbstürme». Beide Bände der hanseatischen Familiensaga wurden zum Überraschungserfolg des Jahres. Ihr großer Zweiteiler «Das Tor zur Welt» katapultierte die Autorin mit allen ihren Büchern auf die obersten Ränge der Jahresbestsellerlisten 2022. In ihren Romanen gelingt Miriam Georg die Kunst, Fakten und Fiktion auf mitreißende Weise zusammenzubringen. Für ihre ungeschminkte Darstellung Hamburger Geschichte wird sie von Leserinnen und Lesern hoch geschätzt.
Die Autorin hat einen Studienabschluss in Europäischer Literatur sowie einen Master mit dem Schwerpunkt Native American Literature. Wenn sie nicht gerade reist, lebt sie mit ihrer gehörlosen kleinen Hündin Rosali und ihrer Büchersammlung in Berlin-Neukölln.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2024 by Miriam Georg
Redaktion Hanne Reinhardt
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Shelley Richmond / Trevillion Images, Look and Learn / Bridgeman Images, Shutterstock
ISBN 978-3-644-01706-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Louisa
Freiheit ist Liebe, Freiheit ist Recht
(Friedrich Halm)
Hamburg
1912
Prolog
Hamburg roch nach Zucker. Der Lärm des Jahrmarkts hing wie ein Lied über der dunklen Stadt. Lachend ließ er sich von seinen Kollegen in das Zelt schubsen. Er hatte zu viel getrunken, der Met stach ihm heiß im Magen. Beinahe wäre er über seine eigenen Füße gestolpert. Handlesen, 50 Pfennige, hatte draußen auf einem Schild gestanden. Lernen Sie Ihre Zukunft kennen. Es war keine gute Idee, der Jahrmarkt bot zu viele Versuchungen, sie hatten es mit dem Met übertrieben, und ihm war übel. Er sollte sich eine Weile draußen hinsetzen, einen klaren Kopf bekommen.
Trotzdem trat er ein.
Roter Samtstoff bildete einen Baldachin unter dem Zeltdach. Auf einem Tisch flackerten Kerzen. Er sah die Frau erst auf den zweiten Blick. Versteckt unter einem Turban und seidenen Tüchern war es unmöglich zu sagen, wo der Stoff aufhörte und ihr Körper begann.
Sie reagierte nicht auf seine Anwesenheit, starrte mit konzentrierter Miene auf die Karten, die sie vor sich ausgebreitet hatte. Man musste es ihr lassen, sie machte ihre Sache gut. Draußen hörte er seine Freunde reden, entfernt wie unter einer Glasglocke.
Er räusperte sich, und endlich hob sie den Blick. «Guten Abend. Ich höre, Sie sagen die Zukunft voraus …»
Wortlos deutete sie auf das freie Kissen.
Umständlich knöpfte er den Mantel auf, musste sich kompliziert zusammenfalten, um auf den Boden zu kommen. Sicher hatte er seit zwanzig Jahren nicht mehr auf der Erde gesessen. Draußen hatte es geschneit, seine Schuhe waren schlammig. Als er ihr plötzlich so nahe war, sah er, dass sie wesentlich jünger war, als er angenommen hatte. Und wesentlich schöner.
Die Frau ertappte ihn dabei, wie er sie musterte, und es kam ihm vor, als würde sie sich über ihn amüsieren. «Sie haben eine Frage.»
«Ja … ich, richtig», überrascht nickte er. Aber es war wohl keine Hexerei, das zu wissen. Warum sonst war er schließlich hier.
«Über eine Person, die Ihnen nahesteht.»
«Nun …» Er zögerte. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, nach der Teilhabe der Kanzlei zu fragen, auf die er spekulierte. Aber als er den Mund öffnete, hörte er sich sagen: «Ich habe mich vor Kurzem verlobt.»
Sie nickte wissend, ein Lächeln zuckte ihr um die Lippen. «Und nun fragen Sie sich, ob Sie die richtige Wahl getroffen haben.»
«So könnte man es ausdrücken.» Was tat er hier? Sein Gesicht brannte bei dem Gedanken, was sein Bruder sagen würde, wenn er ihn so sähe. Oder – noch schlimmer! – seine Verlobte.
Sie streckte die Hände aus, und einen Moment verstand er nicht, was sie von ihm wollte. Dann begriff er und hob rasch die Arme, um seine Finger in die ihren zu legen. Ihre Haut war warm. Die Kerzen spiegelten sich in ihren Augen. Warum nur hatte er so viel Met getrunken.
Seltsamerweise schaute sie gar nicht auf seine Hände, sondern sah ihn unverwandt weiter an, als forschte sie in seinem Gesicht nach einer Antwort. «Sie ist perfekt», sagte sie leise, und es war, als würde ein Gewicht von seiner Brust genommen. Ein Gewicht, das er vorher nicht einmal bemerkt hatte. «Aber Sie lieben sie nicht.»
Entgeistert hob er den Blick. «Wie bitte?»
«Sie lieben sie nicht», wiederholte die Frau mit einem kaum wahrnehmbaren Achselzucken, als wollte sie sagen: Tut mir leid, aber so ist es nun mal. «Die Liebe fragt nicht. Sie weiß.»
Er fühlte sich, als hätte sie ihn geohrfeigt. Irritiert zog er seine Hände zurück. Ärger schwappte in ihm hoch. Was sollte er bitte mit dieser Information anfangen? «Na wunderbar. Vielen Dank. Das hilft mir sehr.»
Ungerührt sah sie ihm dabei zu, wie er sich aufrappelte, seinen Schal nahm, den Hut aufsetzte.
Er war schon beinahe am Ausgang, da fiel ihm ein, dass er sie nicht bezahlt hatte. Einen Fluch unterdrückend kramte er in seinem Mantel, ging zurück und legte die Münzen auf das Tablett. «Für Ihre Mühe.» Er wusste, dass er sich unmöglich benahm, aber er konnte nicht anders.
Draußen blieb er stehen, starrte in den dunklen Himmel, versuchte, seinen Atem zu beruhigen. Es schneite noch immer, die Kälte auf dem Gesicht ließ ihn innehalten. Die Luft trug den Geruch von Zuckermandeln, aus den Fahrgestellen drang Lachen und Kreischen zu ihm herüber. Plötzlich durchflutete ihn Erleichterung, er begann, leise zu lachen. Für einen Moment hatte er diesen Unsinn tatsächlich geglaubt. Ihr billiger Jahrmarkttrick hatte so echt gewirkt.
Beinahe hätte sie ihn drangekriegt.
Sie riss sich den Turban vom Kopf und trat aus dem Hintereingang des Zelts in die kalte Hamburger Nacht. Um sie herum war die schneegetränkte Luft erfüllt vom Lärmen der Fahrgestelle, von Musik und Kindergeschrei, dem Geruch nach Schmalzkuchen und Mandeln. Einen Moment lang stand sie da und blickte in den Winterhimmel. Warum zur Hölle hatte sie das gesagt! War sie verrückt geworden? Die Liebe fragt nicht, sie weiß. Was für ein Schwachsinn. Nichts brachte einen mehr durcheinander als die Liebe, nichts ließ einen mehr infrage stellen.
Der Mann hatte ihr geglaubt. Sie hatte es in seinem entsetzten Blick gesehen. Er hatte wirklich geglaubt, sie wisse, wovon sie spreche.
Dabei war doch alles hier eine einzige Täuschung.
Schuldbewusst warf sie einen letzten Blick auf das Zelt. Dann zuckte sie die Achseln, löste ihre Haare aus dem verschwitzten Knoten, bis sie ihr lang über den Rücken fielen, und schlüpfte zwischen den Schaubuden hindurch in die lärmende Hamburger Domnacht.
Und wennschon. Falls er zurückkommen und sich beschweren wollte, würde er sie ohnehin nicht mehr finden. Sie war nur die Aushilfe. Morgen würde sie wieder gesponnenen Zucker verkaufen. Wozu sich den Kopf zerbrechen.
Sie würde ihn nie wiedersehen.
Hamburg
1913
1
Ihr Mann hatte getrunken. Sie hörte es daran, wie er die Treppe heraufkam. Alice hielt in der Bewegung inne, die Hand über dem brodelnden Kochtopf. Wann immer er in der Nähe war, reagierte ihr Körper. Der Magen zog sich zusammen, die feinen Härchen an ihren Armen stellten sich auf.
Henk fluchte. Auf der Stiege draußen war ein Rumpeln zu vernehmen. Offenbar hatte er im Dunkeln den Halt verloren. Er rief ihren Namen, und sie erkannte den Zorn in seiner Stimme. Natürlich würde es ihre Schuld sein, dass er gestürzt war.
Alles war ihre Schuld.
Alice warf einen Blick auf ihre Tochter. Rosa saß neben dem Herd auf dem Boden und malte auf einem Stück alter Pappe. Aber auch sie hatte ihn gehört. Ihre braunen Augen waren erschrocken geweitet. Als ihre Blicke sich trafen, formte sie ein Wort mit dem Mund. «Papa.»
Es war, als würde sie sagen: Hilfe!
Alice schmiss den Kochlöffel hin. Mit zwei Schritten war sie bei der Tür und schob den Riegel vor. Entschlossen zog sie das Mädchen in die Höhe, lief mit ihr nach nebenan ins Schlafzimmer, packte den Besen, der in der Ecke stand, und sprang aufs Bett. So kräftig sie konnte, donnerte sie zweimal mit dem Stiel gegen die Luke in der Decke.
«Sei da!», murmelte sie, während sie die Klinke der Küchentür nicht aus den Augen ließ. «Gott, bitte sei da.»
Die Luke über dem Bett schob sich zur Seite, Mariettas rundes Gesicht erschien, und gleich darauf griffen zwei Arme nach Rosa und zogen sie hoch. Es war nicht immer von Vorteil, dass die Wohneinheiten einmal zusammengehört hatten und später nur notdürftig voneinander getrennt worden waren. Aber in Situationen wie dieser war Alice dankbar für die Enge, in der sie lebten.
«Plüsch!» Rosa streckte die Hände nach ihrem ramponierten Stoffbären aus, ohne den sie nirgendwo hinging. Schnell reichte Alice ihn durch die Luke.
«Komm auch hoch!» Marietta hielt ihr die Hände entgegen.
Aber Alice stieg vom Bett und schüttelte den Kopf. «Du weißt, dass das nicht geht.» Erst ein Mal war auch sie in die Nachbarwohnung geflohen, zu Beginn ihrer Ehe. Als sie noch geglaubt hatte, dass die Dinge sich bessern könnten. Selten hatte sie etwas mehr bereut.
«Mama!» Rosas Gesicht schob sich neben das von Marietta. Bittend streckte sie die Arme nach ihr aus.
Alice zwang sich zu einem Lächeln. «Ich muss das Essen fertig machen.» Mit den Augen sagte sie ihrer Tochter, was sie wirklich dachte: Du weißt, dass es nicht geht. Reiß dich zusammen. «Ich hole dich später.»
In diesem Augenblick rüttelte Henk draußen im Flur an der Klinke. Alice fuhr herum. «Schnell!», zischte sie. Ihr Rücken war steif vor Angst. «Er hat getrunken.»
Henk trat gegen das Holz.
Trotzdem zögerte Marietta. «Sei vorsichtig», flüsterte sie, bevor sie die Luke schließlich doch schloss und es über ihrem Kopf dunkel wurde.
Alice schnaubte leise. Als ob Vorsicht irgendetwas bringen würde. Sie strich sich die Haare aus dem Gesicht, das noch immer Spuren von der letzten Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann trug, dann ging sie mit festen Schritten zurück in die Küche, schob so leise sie konnte den Riegel wieder zurück und atmete tief ein.
«Es ist doch offen!», rief sie, gespieltes Erstaunen in der Stimme, das ihre Angst nicht ganz überdecken konnte. «Was polterst du denn im Flur herum.»
Als sie die Klinke hinunterdrückte, fühlte sie sich, als öffnete sie einen Käfig und ließe ein wildes Tier zu sich herein.
Henk schien die ganze Tür auszufüllen. Er schob sich ins Zimmer, eine Dunstwolke aus Alkohol hinter sich herziehend. Als er nichts sagte, sich einen Moment blinzelnd umsah, als wäre er nicht ganz sicher, in der richtigen Wohnung gelandet zu sein, dachte sie schon, sie würde davonkommen. Doch dann hob er den Blick. Und sie realisierte, dass er nicht so betrunken war, wie sie gehofft hatte.
«Wo ist er?»
Erstaunt zuckte sie zusammen. «Was? Wer?»
«Wo hast du ihn versteckt?»
Er brüllte so laut, dass Alice unwillkürlich einen Schritt zurückwich. Das war es also. Er bildete sich mal wieder ein, sie würde ihn betrügen. Seine Eifersucht kam und ging, ebbte ab und nahm dann plötzlich von einem Tag auf den anderen wieder zu. Sie hatte sich so lange nicht gezeigt, dass in ihr die Hoffnung gekeimt war, seine Gefühle für sie wären mittlerweile so erkaltet, dass sie ihm egal war. Aber natürlich ging es ihm nicht um sie. Ihm ging es um Besitz. Sie gehörte ihm, und niemand anderes hatte sie anzufassen.
Seine Faust landete mitten in ihrem Gesicht.
Alice taumelte zurück, stieß mit der Hüfte gegen die Kante des Herdes. Der Schmerz in ihrer Nase war so gleißend, dass er für einen Moment alles andere überdeckte. Sie sah nichts mehr, hörte nichts mehr, da war nur noch rotes, pulsierendes Feuer.
«Du Miststück!»
Mit aller Kraft versuchte sie, ihn abzuwehren. Er schlug nach ihr, kratzte, trat, versuchte sogar, sie zu beißen, überschüttete sie dabei mit Vorwürfen und absurden Anschuldigungen, das einzige Ziel in seiner blinden Raserei, ihr so wehzutun, wie er nur konnte. Sie wusste aus Erfahrung, dass nichts, was sie sagte oder tat, ihn aus diesem Zustand herausholen konnte. So wütend war er schon lange nicht gewesen. Die Schlafzimmertür schien unerreichbar weit weg, und wenn sie jetzt aufhörte, sich zu wehren, würde sie am Ende auf dem Boden landen. Ihr lief Blut aus der Nase, und sie spürte schon nach kurzer Zeit, wie ihre Kräfte schwanden. Plötzlich packte Henk sie von hinten um die Mitte und schleuderte sie gegen den Herd. Noch bevor sie sich wieder aufrichten konnte, war er über ihr.
Und dann sah er das Bild. Die Pappe auf dem Boden. Rosa hatte einen Baum gemalt, ein kleines Haus, ein Kaninchen. Oh nein. Sie hatte vergessen, es zu verbrennen, bevor sie die Tür öffnete.
Henk bückte sich, während Alice sich keuchend am Herd hochzog, ihre Nase betastete. Er hob das Bild auf. Etwas in seinen Augen veränderte sich. «Woher hat sie die Farben?» Er war immer am gefährlichsten, wenn seine Stimme ruhig wurde.
«Ich … sie …», stotterte Alice.
«Woher hat sie die Farben?», brüllte er.
Sie wich zurück, aber hinter ihr befand sich der heiße Herd.
Es war ohnehin vollkommen egal, wie sie Rosas Bild erklärte. Ihr Mann hatte verboten, dass im Haus gemalt wurde, und sie hatte sich ihm widersetzt. Aber trotz der Angst kochte Zorn in ihr auf. «Es ist nur ein Tuschkasten. Sie hat doch sonst keine Freude!»
Er packte sie so schnell, dass sie erschrocken aufkeuchte, drehte sie herum. Und dann drückte er ihren Kopf in Richtung des brodelnden Wassers.
Alice krallte die Hände in die Kante des Herdes. Der Schmerz in ihren Fingern, als sie auf der heißen Kochplatte landeten, glich einem Peitschenhieb. Sie gab einen Laut von sich wie eine gequälte Katze. Und in einer panischen Sekunde der Klarheit verstand sie. Er würde es tun. Er würde ihren Kopf in das kochende Wasser drücken.
«Irgendwann bringt er dich um», sagte Marietta manchmal, wenn sie Alice’ geschwollenes Gesicht sah, die blauen Arme, die blutenden Mundwinkel. Alice winkte dann immer ab. Sie hatte bis jetzt nicht geglaubt, dass er ihr wirklich gefährlich werden würde. Er war dumm, sicherlich. Und wenn er trank, musste sie aufpassen. Aber in diesem Moment wurde ihr klar, dass Marietta recht hatte. Sie hatte ihn unterschätzt, hatte seine Eifersucht unterschätzt, den Alkohol, die blinde Wut, die sie einfach nicht verstand, die schon immer in ihm geschwelt hatte und mit den Jahren nur rasender und zielloser zu werden schien.
Panisch stemmte Alice sich gegen ihren Mann. Natürlich half es nichts, er war viel zu stark, presste erbarmungslos ihren Nacken in Richtung des brodelnden Wassers, seine Finger bohrten sich in ihren Hals, schnürten ihr die Luft ab. Ihre Hand ertastete ein Holzscheit im Fach unter der Kochstelle. Sie dachte nicht nach, und sie zögerte auch nicht.
Alice ließ den Herd los, wand sich in seinen Armen herum und krallte die verbrannten Finger, so fest sie konnte, in Henks Augen. Als er aufbrüllte und sein Griff sich lockerte, packte sie das Scheit und schmetterte es mit beiden Händen gegen seinen Schädel.
Henk sah sie an, Erstaunen im Blick. Dann sank er lautlos in die Knie, wie ein gefällter Baum.
Schwer atmend stand Alice da und schaute auf den Mann hinunter, von dem sie einmal gehofft hatte, dass er sie glücklich machen würde, das Scheit immer noch erhoben, bereit, erneut zuzuschlagen, sollte er sich bewegen.
Aber das tat er nicht.
Irgendwann ließ sie das Holz fallen. Henks Ohr blutete. Der Mund stand leicht offen. Sie ging in die Knie, streckte zwei zitternde Finger aus und fühlte seinen Puls. Er lebte. Alice ließ die Hand sinken. «Verdammt», murmelte sie leise.
Marietta packte Henk an den Beinen. «Stinkt wie ein Iltis.» Sie verzog das Gesicht.
Alice lachte auf, aber sofort fuhr ihr ein stechender Schmerz durch die Schläfen. Ihre Nase hatte zu pulsieren begonnen. Sie traute sich nicht, in den Spiegel zu schauen.
Die beiden Frauen brauchten all ihre Kraft, um Henk die drei Meter ins Nebenzimmer zu ziehen, hatten aber keine Chance, ihn aufs Bett zu heben. Groß war er nicht, dafür aber schwer, bullig gebaut. Er würde auf dem Boden aufwachen. Mit Schaudern dachte Alice an den Moment, in dem er das Bewusstsein zurückerlangte. Sie konnte nur hoffen, dass er sich an nichts erinnerte.
«Meinst du, er braucht einen Arzt?» Nachdenklich sah sie auf ihn hinunter. Blut sickerte von seinem aufgerissenen Ohr am Hals hinab.
Marietta machte ein Gesicht, als wollte sie ausspucken. «Lass ihn doch verrecken. Eine Sorge weniger.»
Erschrocken sah Alice sie an. «Willst du, dass ich im Knast lande?», erwiderte sie und war erstaunt, wie ruhig sie klang. Wie kalt.
«Wir würden für dich aussagen, Bertie und ich. Wir hören doch, wie er brüllt. Und wir sehen dich», setzte Marietta hinzu, die Stimme sanfter als zuvor.
Alice’ Hals verengte sich. Sie hasste es, dass andere sie anschauten und wussten, was in ihrem Zuhause vor sich ging. Nun trat sie doch vor den Spiegel. Der Anblick war ernüchternd. Die Nase war schief und geschwollen, Mund und Wangen blutverschmiert.
Marietta trat hinter sie. «Aber du. Du brauchst einen Arzt.» Sie hob die Hand, um ihr über die Wange zu streichen, doch Alice wich zurück. «Du musst hier raus! Ihr müsst beide hier raus.»
«Ach ja?» Mit einem bitteren Lächeln sah Alice sie an. «Und wo sollen wir hin?»
Alice wusste, dass ihre Nase nicht von selbst heilen würde. Schon einmal hatte sie die Folgen von Henks Schlägen zu lange ignoriert. Nun stand der kleine Finger an ihrer linken Hand schief ab und würde für immer so bleiben, es sei denn, man brach ihn erneut – eine Aussicht, auf die sie verzichten konnte.
Sie lief am Kuhmühlenteich entlang über Hohenfelde in Richtung Altstadt. In der Nähe der Steinstraße wurden die Gassen enger und dunkler, die Häuser schoben sich über ihr zusammen, Unrat und Müll verstopften die Rinnsteine. Bald sah sie das rostige kleine Schild, nach dem sie gesucht hatte. Als sie an die Kellertür klopfte, hörte sie es von drinnen klappern. «Ist offen. Reinkommen musst du schon selbst!»
Gebückt ging sie die zwei Stufen hinunter. Vater Kohl war gerade dabei, eine Spritze zu reinigen, zog den Kolben auf und drückte ihn wieder zurück, und eine kleine Fontäne Wasser ergoss sich auf den Boden. Wie immer roch es hier drin schwach nach Äther und Jodoform. Alice’ Magen zog sich zusammen. Sie hatte in diesem Keller bisher nur Unschönes erlebt – und das würde wohl auch so bleiben. Vater Kohl war aus den Gängevierteln nicht wegzudenken, man kannte ihn in ganz Hamburg. Offiziell verkaufte er Kräuter, die in dicken Büscheln unter der Decke hingen. Inoffiziell nahm er sich aller körperlichen Leiden an, von Furunkeln über Hämorrhoiden bis zu gebrochenen Knochen. Der zahnlose alte Mann behandelte und lebte in diesem Keller, in dem es immer feucht war, obwohl der kleine Ofen in der Ecke selbst im Sommer bollerte.
Bei ihrem Anblick pfiff er durch die Zähne. «Na, dich hat er ja mal wieder schön zugerichtet, Mädchen!»
Er erhob sich und schlurfte Alice in seinen viel zu großen Holzschuhen entgegen, bedeutete ihr, sich auf die Pritsche zu setzen. Ungewohnt behutsam wischte er ihr mit seinen krummen Händen das Blut aus dem Gesicht, das nicht aufhören wollte, aus ihrer Nase zu strömen. Dann strich er eine fettige Paste auf die pulsierenden Brandwunden an den Fingern. Besorgt fasste er ihr Kinn und drehte ihr Gesicht hin und her. «Die Nase muss ich richten.»
Alice hatte es sich schon gedacht. «Jetzt?», fragte sie beklommen.
«An Weihnachten!», gab er zurück, ohne die Spur eines Lächelns im Gesicht.
«Was kostet das?» Nun, da Angst und Anspannung langsam wichen, war der Schmerz kaum noch zu ertragen. Der Alte nannte den Preis, und sie gab einen entsetzten Laut von sich. «Das habe ich nicht.» In Wahrheit hatte sie so gut wie gar nichts. Ihren Lohn musste sie an Henk abgeben. Und wenn sie doch etwas an ihm vorbeischleusen konnte, verwendete sie es ausschließlich für Rosa.
Er schüttelte den Kopf. «Ich schreibe nicht an. Das weißt du.»
Plötzlich war sie wieder da, diese verzweifelte Wut. «Was soll ich denn tun? Nicht ich sollte dafür zahlen, sondern er.»
Kurz wurden die harten Augen in Vater Kohls runzeligem Gesicht weich. Er betrachtete sie beinahe liebevoll. Aber als er sprach, war kein Mitgefühl in seiner Stimme. «Niemand, der hierherkommt, hat’s so gewollt, Alice. Schau dich um. Denkst du, ich kann Seide spinnen von dem, was ich hier verdiene?»
Resigniert ließ sie den Blick durch seine Behausung schweifen. Er schlief auf der Pritsche, auf der er auch behandelte, und kochte sein Essen auf dem kleinen Ofen in der Ecke. Trotzdem ebbte die Wut in ihr nicht ab.
Vater Kohl schlurfte in seinen Holzschuhen zum Schrank und nahm eine Flasche heraus, tröpfelte eine Flüssigkeit auf einen schmutzigen Lappen. «Du hast drei Wochen Zeit. Aber dafür kostet es zwei Mark mehr.»
Sie presste die Zähne aufeinander. In der Fabrik verdiente sie eine Mark und fünfzig Pfennige am Tag. «Schön.» Sie hatte keine Wahl, der Schmerz war kaum noch zu ertragen, schien von Minute zu Minute schlimmer zu werden.
Er sah sie an. «Betäubung ist extra.»
Natürlich war sie das.
«Ich brauche keine Betäubung.»
Er lachte leise. «Und ob du die brauchst.»
«Ich schaffe das auch so.»
Er protestierte nicht weiter, schlurfte zurück und blieb vor ihr stehen, den dreckigen Lappen in der Hand, als wollte er ihn ihr aufs Gesicht pressen. Angstvoll sah sie zu ihm auf.
«Bereit?»
Sie war ganz und gar nicht bereit. Aber dann dachte sie, dass der Schmerz nicht schlimmer werden konnte als in dem Moment, als Henks Faust in ihrem Gesicht gelandet war.
Sie nickte.
«Gut, tief Luft holen. Eins, zwei …» Er wartete nicht bis drei. Bei zwei presste er ihr den Kopf in den Nacken, packte die Nase und drehte sie mit geübten Fingern herum. Es knirschte entsetzlich. Ihr Kopf explodierte in einer Wolke aus Schmerz.
Als Alice wieder zu sich kam, wusste sie, wozu er den Lappen gebraucht hatte. Sie hustete würgend, weil die Petroleumdämpfe ihr in Nase und Rachen stiegen. Zufrieden warf Vater Kohl das dreckige Stück Stoff in eine Ecke. Wieder fasste er ihr Kinn, begutachtete sein Werk. «Das hätten sie im Sankt Georg auch nicht schöner zusammengeflickt.» Er spuckte Kautabak in einen Bottich und grinste sie mit schwarzen Zähnen an. «Wird aber noch ’ne Weile blau sein», verkündete er und streckte die Hand aus, um sie in die Höhe zu ziehen.
Stöhnend rappelte Alice sich auf. Das Pulsieren war noch da, aber es schien ihr dumpfer, leichter zu ertragen als vorher.
«Drei Wochen!» Vater Kohl schlurfte zur Tür. «Und keinen Tag länger. Sonst kostet es doppelt.»
Rosa war bei Marietta sicher, Henk hoffentlich noch außer Gefecht gesetzt, und so musste sie sich auf dem Rückweg ausnahmsweise nicht beeilen. Sie hätte es auch nicht gekonnt. Alles tat weh, der Rücken, die verbrannten Hände, der Kopf, die Hüfte. Natürlich musste auch Vater Kohl sehen, wo er blieb, aber während Alice langsam einen Fuß vor den anderen setzte, verfluchte sie trotzdem seine horrenden Preise und die unsanfte Behandlung.
Nach einem kurzen Marsch, der sich wie eine Ewigkeit anfühlte, tauchte sie aus den dunklen Gassen der Gängeviertel auf. Diesmal lief sie nicht durch die Stadt, sondern nahm den Weg über den Jungfernstieg, steuerte am Alsterufer entlang auf die Uhlenhorst zu. Es war ein strahlender Herbsttag, auf dem blauen Wasser nickten Segeldingis auf und ab. Am Ufer lagen die stattlichen Villen mit ihren herrschaftlichen Gärten, den Bootsanlegern und Trauerweiden. Aber nur wenige Straßen weiter, westlich des Hofwegs, endete die Welt der alten Familien. Hier begann das Arbeiterviertel der Uhlenhorst. In der Umgebung des Winterhuder Wegs und der Humboldtstraße lebten die Menschen in bedrückender Enge. Alice ließ die Villen und blühenden Gärten hinter sich, tauchte ein in die vertrauten Gassen, den Kopf gesenkt, um den neugierigen Blicken auszuweichen, mit denen die Leute ihr geschundenes Gesicht musterten.
Sie wohnten im vierten Stock eines langen und schmalen Hauses, das aussah, als hätte jemand es nachträglich zwischen die anderen gequetscht. Eine jener bretterbudenartigen Mietskasernen, wie es sie in Hamburg zu Hunderten gab. Wenn Alice den Durchgang zum zweiten Hinterhof passierte und ihr Zuhause sah, konnte sie manchmal nicht glauben, dass sie hier gelandet war. Dass dies aus der großen Rettung geworden war, die sie sich einmal erhofft hatte.
Wie immer spielte eine Horde Kinder im Hof. Zwei Mütter lehnten aus den Fenstern und unterhielten sich, wobei sie genauso laut brüllten wie die Kleinen. Es herrschte ein rauer Ton hier, ab und an schauten die Frauen zwischen der Hausarbeit nach ihrem Nachwuchs, aber meist waren die Kinder sich selbst überlassen. Viele bekamen nur abends etwas zu essen, manche durften tagsüber gar nicht in die Wohnungen, weil ihre Eltern Schlafgänger beherbergten oder von zu Hause aus arbeiteten und den Platz brauchten. Die Kinder zogen umher und bettelten, fuhren grölend auf schottischen Karren durch die Gegend, warfen Seile über die Querstangen der Straßenlaternen, um daran zu schaukeln, oder kletterten über die Zäune der Villen am Feenteich und stahlen Gemüse und Blumen. Krätze und Läuse wurden nur so hin und her gereicht. Deswegen hatte Alice nie erlaubt, dass Rosa mit den anderen spielte. Sie merkte genau, wie die Nachbarinnen über sie redeten, sobald sie vorbeiging, spürte die Blicke, die an ihr kleben blieben wie Teer. Alle hier glaubten, sie hielte sich für etwas Besseres, weil sie ihre Tochter nicht hinunterließ. Es war schließlich normal, dass Kinder auf der Straße aufwuchsen.
Das Treppenhaus war dunkel wie ein Grab. Eine ganze Kolonie aus Ratten hatte sich dort breitgemacht. Alice hatte sich angewöhnt, wie eine Katze zu fauchen, sobald sie das Haus betrat, und sofort raschelte und quiekte es unter der Treppe.
«Ja, rennt nur», murmelte sie müde.
Wie eine Schlafwandlerin stieg sie die Treppe hinauf. Das Haus war voller Geräusche, aus den Wohnungen drangen Stimmen und Essendünste. Als sie im vierten Stock ankam, sah sie, dass die Tür neben der ihren nur angelehnt war. Sie stöhnte leise auf. Im selben Moment schoss auch schon die alte Westram aus ihrer Wohnung. «So geht das nicht weiter!» Mit funkelnden Augen versperrte die Nachbarin Alice den Weg, bohrte ihr den knochigen Zeigefinger in die Brust. «Das Geschrei und Gepolter. Irgendwann kracht ihr denen unten durch die Decke! Das sag ich immer, irgendwann kracht ihr denen durch die Decke!» Frau Westram hatte die Angewohnheit, sich selbst zu wiederholen. Sie war so klein und bucklig, dass sie Alice nur bis zur Brust reichte. Ihr Unterkiefer war eingefallen, die Augen unter den runzeligen Lidern kaum noch zu sehen, aber ihre Wut machte sie dennoch zu einer bedrohlichen Erscheinung. Alice hatte sogar Verständnis für ihre Beschwerden, Frau Westrams Küche war nur durch eine dünne Bretterwand von der ihren getrennt. Sie musste jedes Wort ihres Streits mitbekommen haben.
«Jeden Schritt hör ich. Jeden Schritt.»
«Es tut mir wirklich leid …», begann sie müde, brach aber mitten im Satz ab. Sie hatte keine Kraft für eine Diskussion, die sie schon Dutzende Male geführt hatte. Sie hatte keine Kraft, sich zu entschuldigen für etwas, das nicht ihre Schuld war. Unruhig warf sie einen Blick zur Tür. Nicht, dass Henk sie hörte.
«So welche wie euch hätten sie hier nie reinlassen dürfen.» In Frau Westrams Mundwinkeln standen kleine Spuckebläschen, missbilligend glitt ihr Blick über Alice’ dunkles Haar, das ihr offen über den Rücken wallte. «Ich hab’s von Anfang an gesagt, so was bringt uns Ärger, hab ich gesagt. Das hier ist ein anständiges Haus! Pack wie ihr gehört hier nicht her.»
Beinahe hätte Alice laut aufgelacht. Was an der rattenverseuchten Bretterbude im zweiten Hinterhof anständig sein sollte, war ihr ein Rätsel. Und was an Frau Westram anständig sein sollte ebenfalls. Ihre Kleidung stank nach Kohl, ihre Haare klebten vor Fett, die Alte verließ nie das Haus, hielt sich mit einer kleinen Witwenrente über Wasser. Und sie stellte regelmäßig ihren Abfall in den Hausflur und ließ ihn dort vor sich hin rotten.
«Der Vermieter wird ein Schreiben von mir bekommen. Jawohl, das wird er bekommen! Dann fliegt ihr raus und könnt wieder dahin verschwinden, wo ihr hingehört. Wo ihr hingehört! Zigeunerpack wie euch wollen wir hier nicht.»
Ihr Körper fühlte sich so schwer an, es war ein Kraftakt, die Augen offen zu halten. Einen Moment lang stand Alice einfach nur da und sah dabei zu, wie die fahlen Lippen von Frau Westram sich bewegten. Sie wusste, dass ihre Nachbarin eine einsame, verbitterte alte Frau war. Ihre Söhne waren tot, ihr Mann war tot, sogar ihre Katze war elendig krepiert, nachdem sie eine kranke Ratte verspeist hatte – vermutlich aus dem Treppenhaus dieses ach so anständigen Hauses. Damals hatte Frau Westram tagelang geschluchzt und lamentiert, während sie ihrem Ehemann keine Träne hinterherweinte. Normalerweise ignorierte Alice ihre Beschwerden und Beleidigungen. Aber plötzlich konnte sie nicht mehr.
«Jetzt hören Sie mir zu, Sie alte Hexe.» Genau wie die Nachbarin es eben mit ihr gemacht hatte, stieß sie Frau Westram den Zeigefinger in die Brust. «Sie gehen mir jetzt aus dem Weg und lassen mich mit Ihrem Gezeter in Ruhe. Sonst hetze ich Ihnen was auf den Hals!»
Im Halbdunkel des Flurs weiteten sich Frau Westrams winzige Augen unter den schlaffen Lidern. «Wenn Sie mich noch einmal so nennen, dann haben Sie Ihre letzte Nacht in Ruhe geschlafen, das verspreche ich Ihnen.»
Frau Westram schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen.
So würdevoll Alice es vermochte, ging sie in ihre Wohnung und ließ Frau Westram im Flur stehen. Drinnen lehnte sie sich gegen die Tür und schloss die Augen.
Warum hatte sie nicht einfach den Mund gehalten.
Aus dem Schlafzimmer drang kein Geräusch. Natürlich konnte es sein, dass Henk dort drinnen auf sie lauerte, aber sie bezweifelte es. Er gehörte nicht zur lauernden Sorte. Er polterte herein und nahm sich, was er wollte.
Leise zog sie das Schultertuch ab. Ihre Wohnung bestand nur aus zwei Zimmern: der Küche mit dem kleinen Fenster über dem Tisch und dem Zimmer nebenan. Rosas Schlafplatz war seit zwei Jahren auf der Küchenbank. Das Klosett befand sich einen Treppenabsatz weiter unten und wurde von sechs Familien geteilt. Langsam ließ Alice den Blick schweifen. Ihr Leben. Alles, was sie hatte. Es war so erbärmlich.
Henk lag noch da, wo sie und Marietta ihn hingeschleift hatten. Vorsichtig tippte sie ihm mit dem Fuß in die Seite. Er rührte sich nicht, aber sie sah, dass er atmete. Während sie darüber nachdachte, was sie mit ihm tun sollte, klopfte es hinter ihr leise an der Tür.
«Alice?» Marietta lugte mit Rosa an der Hand um die Ecke. «Die alte Westram hat wieder gezetert, was?» Sie blickte zur Schlafzimmertür. «Immer noch ausgepustet?»
«Wie eine Kerze.»
«Besser so», knurrte Marietta, dann deutete sie auf Rosa. «Sie kann nicht bei uns bleiben, Willie ist krank.»
Schnell schloss Alice die Tür zum Schlafzimmer hinter sich. «Ist es schlimm?», fragte sie besorgt.
«Es könnten die Röteln sein, er hat Schwämmchen auf der Zunge. Ich will nicht, dass sie sich ansteckt. Morgen sollte sie auch nicht hochkommen.» Marietta war gelernte Weißnäherin, arbeitete aber, seit sie Mutter war, von zu Hause aus und erledigte Flickarbeiten. An den meisten Wochentagen passte sie auf Rosa auf. Ihr Sohn Willie war im gleichen Alter, und die beiden waren mit den Jahren beste Freunde geworden.
Alice warf einen Blick auf die geschlossene Schlafzimmertür. «Dann werde ich sie mitnehmen müssen.»
Gequält verzog Rosa das Gesicht. «Schon wieder?» Sie stampfte mit dem Fuß auf.
«Es geht nicht anders.» Alice kniete sich hin, strich Rosa über die Wange. «Papa hat keine Zeit, um auf dich achtzugeben.»
Der Blick, den Alice daraufhin von ihrer Fünfjährigen kassierte, war der Blick einer Erwachsenen. Rosa wusste natürlich genau, warum sie nicht bei Henk bleiben sollte. Aber sie sagte nichts, sah Alice nur an. Dann hob sie ihre Hand, als wollte sie ihr ebenfalls übers Gesicht streichen.
«Vorsicht, die Nase tut ein bisschen weh.»
Die kleinen Finger hielten kurz vor Alice’ Gesicht in der Luft an. «Warst du bei Opa Kohl?»
Alice lächelte, obwohl sie vor Schmerzen und Müdigkeit beinahe umfiel. Das Pulsieren hatte sich inzwischen auf ihr ganzes Gesicht ausgebreitet. «Genau.»
«Hast du einen Drops bekommen?» Die Bonbons aus einer alten Metalldose über dem Herd wirkten nach Aussage von Vater Kohl wahre Wunder gegen Schmerzen. Der alte Mann versicherte seinen kleinen Patienten stets so überzeugend, die Süßigkeiten würden ihnen bei jeglicher Art von Beschwerden helfen, dass es in den meisten Fällen tatsächlich funktionierte. Es schien, alles, was es manchmal brauchte, war Glaube. Natürlich wusste sie es besser. Glaube konnte helfen. Aber retten würde er niemanden.
«Sogar zwei», log sie.
«Dann ist ja gut.» Rosa lief zur Küchenbank, unter der sie ihre Spielsachen aufbewahrte. Alice und Marietta wechselten einen müden Blick. Wenn es so einfach wäre.
«Lass sie doch im Hof. Ein paar Tage werden schon nicht schaden. Wenn du einer unten was zusteckst, passt sie sicher auf», schlug Marietta leise vor.
Alice schüttelte den Kopf. «Auf keinen Fall.»
«Bestimmt kannst du sie bald wieder zu uns bringen.» Auf dem rundlichen Gesicht ihrer Freundin spiegelte sich das schlechte Gewissen. Marietta wusste, was es bedeutete, wenn Alice Rosa mit zur Arbeit nehmen musste. Aber sie bei Henk zu lassen, war keine Alternative. Zwar hatte er noch nie die Hand gegen seine Tochter erhoben, aber er ließ sie den ganzen Tag auf der Straße spielen oder nahm sie mit in die Wirtschaft. Und Rosa hatte Angst vor ihm. Wenn er laut wurde, versteckte sie sich unter dem Bett.
«Mach dir keine Gedanken, wir schaffen das schon!» Alice bugsierte Marietta mit einer dankbaren Umarmung zur Tür hinaus. Sie hasste Mitleid. Deswegen tat sie auch immer, als wäre alles halb so wild. Besonders vor ihrer Tochter, die schon viel zu viel erlebt und gesehen hatte. Vor Marietta, die genau wusste, dass es nicht halb so wild war.
Und meist sogar vor sich selbst.
In einer Art Halbschlaf bereitete Alice ihrer Tochter rote Grütze mit Milch zu, die nicht mehr ganz frisch roch, schnitt einen Gurkensalat dazu und richtete ihr das Bett auf der Küchenbank her. Normalerweise erzählten sie sich vor dem Einschlafen Geschichten, sangen Lieder, oder Alice holte die kleinen selbst genähten Handpuppen hervor und dachte sich ein Theaterstück aus, wie es ihr Bruder früher für sie getan hatte. Aber heute war sie so müde, dass sie kaum noch wusste, wo oben und unten war.
«Mama, ich will das Gebet sprechen», verlangte Rosa, als sie endlich zugedeckt auf ihrer Schlafstätte lag.
«Heute nicht.»
«Ich will aber. Marietta sagt, man muss es jeden Tag sprechen, sonst wirkt es nicht.»
Es kommen keine Engel, niemand wird dich beschützen. Niemand außer mir! Die Worte lagen ihr auf der Zunge. Aber Rosas Augen waren so groß und rund in ihrem kleinen Gesicht. Alice seufzte ergeben. «Gut, in Ordnung.»
Und als ihre Tochter begann, mit ihrer klaren Kinderstimme die vertrauten Worte zu sagen, stimmte Alice mit ein, obwohl sie wusste, dass es Unfug war.
«Euch, ihr meine Lieben,
soll heute nichts betrüben,
kein Unfall noch Gefahr.
Gott lass euch selig schlafen,
stell euch die güldnen Waffen
ums Bett – und seiner Engel Schar.»
Offenbar trösteten Rosa die Worte. Alice konnte dabei zusehen, wie ihr kleines Gesicht sich entspannte. Und vielleicht, dachte sie, als sie ihrer Tochter einen Kuss auf die verschwitzte Stirn gab, ist das alles, was sie sollen.
Schließlich ging sie ins Nebenzimmer, zog sich aus und rollte sich auf dem Bett zusammen. Als Matratze dienten ihnen Strohgarben, die mit einem Laken bespannt waren, und heute spürte Alice die klamme Härte stärker als sonst. Vielleicht weil ihr ganzer Körper aus Schmerz zu bestehen schien. Henk lag immer noch auf dem Boden. Inzwischen schnarchte er leise.
Bevor gnädige Dunkelheit sie in Empfang und die Schmerzen mit sich nahm, hörte Alice noch einmal Rosas Stimme im Kopf und fragte sich, ob es nicht vielleicht doch möglich war, dass die Engel am Bett ihrer Tochter standen und wachten. Und was sie selbst falsch gemacht hatte, dass sie zu ihr nie gekommen waren.
Nebel hing über dem Fluss. Es roch nach den nassen Wollpullovern der Männer und dem dunklen Kaffee aus ihren Zinnflaschen. Nichts glich einem frühen Morgen auf der Elbe. Das Grau des Wassers neben dem Grün der Marsch. Alles war weit und hell, das Licht breitete sich ungehindert aus und überflutete die Welt. Die Wasservögel erwachten, ein beständiges Schnattern erfüllte die nebelgetränkte Luft. Besonders die Graureiher lärmten, wo man auch hinschaute, sah man sie ihre Beine heben und vorsichtig wie Seiltänzer wieder aufsetzen. Jaris atmete tief ein. Hier fühlte er sich ruhig. Nichts zählte außer dem Boot und dem Fluss. Das echte Leben war weit weg.
Plötzlich kam Bewegung im Wasser auf. Sofort waren die Männer an ihren Plätzen, arbeiteten Hand in Hand, jede Bewegung eingespielt, kein Wort mehr notwendig. Als sie das Netz hochzogen, stieß Jaris einen erstaunten Laut aus. Er traute seinen Sinnen nicht, beinahe glaubte er, sie hätten einen der Wassermänner gefangen, von denen sein Großvater oft geredet hatte.
Aber es war kein Wassermann. Es war ein Stör.
Der riesige Fisch maß sicher an die drei Meter. Panisch zappelte er im Netz. Jaris empfand einen Anflug von Schuld. Den ganzen Fluss hatte das Tier sich hinaufgequält, Jahr für Jahr der starken Strömung und den Fischerbooten getrotzt, um zu seinen Laichgründen zu kommen, und nun würde er mit aufgeschlitztem Bauch im Dreck enden. Aber dann dachte er an Alice. Daran, was sie sagen würde, wenn er mit Räucherstör vor der Tür stand. Wie ihre Augen leuchten würden.
Von März bis Juli zogen die Störe durch die Nordsee, immer der Elbe entgegen. Sein Großvater hatte oft damit geprahlt, dass die Fischer früher in einer Saison bis zu fünftausend aus dem Wasser gezogen hatten. Aber nun waren sie selten geworden, und wenn Jaris genau nachdachte, hatte wohl auch sein Großvater diese Geschichten mehr erzählt bekommen als sie selbst erlebt. So ein Riese wie dieser hier wäre sicher auch damals ein fetter Fang gewesen. Außerdem waren um diese Jahreszeit bereits die Aale auf dem Vormarsch und Störe eigentlich kaum noch zu finden. Sie hatten einen Glückstag erwischt.
Die Schuppen des Tieres waren hart wie ein Panzer. Jaris strich mit zwei Fingern über den zuckenden Riesenbauch. Die Männer zogen dem Stör noch im Netz einen Haken mit einem Tau daran durchs Maul und warfen ihn mit vereinten Kräften wieder ins Wasser, sodass das Tier nun gezwungen war, hinter dem Boot herzuschwimmen. Bis sie zwei Stunden später anlegten, war der Kahn voll mit kleinen, zappelnden Fischen und die Stimmung ausgelassen.
Mithilfe des Hakens holten sie den Stör ein, und als sie ihn schließlich an Land hatten, waren die Männer in Schweiß gebadet. Doch als sie dem Fisch den Bauch aufschlitzten, war alle Anstrengung vergessen. Eine schwarze Masse sprudelte hervor, ergoss sich über ihre Hände und das Messer: ein Rogenstör! Sicher zwei Eimer Kaviar. Bares Geld.
Die Fischer hatten auch Hering gefangen und unzählige Sprotten, klein wie Finger, die sie einpökeln würden. Wenn ein Tag so begann, konnte er nur gut werden.
Während Jaris seinen Anteil am Fang in Zeitungspapier wickelte und dabei genüsslich die erste Zigarette des Tages rauchte, beobachtete er, wie Männer auf dem Ponton nebenan einen Albatros vom Schiff luden. Der Vogel war in einem Flechtkorb gefangen und flatterte ängstlich. Für Jaris waren diese Tiere ein Wunder. Die Spannweite der Flügel konnte über dreieinhalb Meter erreichen, mehr als bei jeder anderen Art. Er betrachtete den Albatros in dem winzigen Käfig, kaum größer als das Tier selbst, er sah die grob gestutzten Flügel, die nie wieder durch die Luft gleiten würden, und fühlte ein dumpfes Ziehen im Magen. Menschen, dachte er verächtlich. Wie sehr er sie manchmal hasste.
Man fing die Vögel mit einer Schnur, indem man ein Stück Fleisch auf einen Korken legte, welcher wiederum an einem dreieckigen Eisenstück befestigt war. Auf Schiffen, die die drei Kaps passierten, war dies ein beliebter Zeitvertreib für Seemänner. Albatrosse galten als gefährlich und gemein, sie attackierten gerne Schwimmer im Meer. Aber Tiere waren nicht gemein. Sie taten, was ihnen die Natur vorgab. Die Menschen verstanden das nicht, projizierten ihre eigenen dunklen Eigenschaften in sie hinein. Jaris war klar, dass der Vogel nicht mehr lange leben würde. Albatrosse waren als Ware begehrt, aus ihrer Beinhaut wurden Tabakbeutel gemacht, die Knochen als Rahen oder Masten in Schiffsmodellen verbaut.
Er trat seine Zigarette aus, warf einen letzten Blick auf das einst so stolze Tier und hoffte nur, dass die Männer es bis zu seinem Tod nicht zu sehr quälen würden.
Eine Stunde später durchschritt er die Tore der Holsten-Brauerei und hielt geradewegs auf den Stall zu. Der vertraute würzige Geruch kam ihm entgegen, und als er die Tür aufstieß, begrüßten ihn die Pferde, indem sie schnaubend an die Gitter traten. Wotan, Heinrich, Axel, Hannibal … Fünfundvierzig Hengste standen hier, und er kannte sie natürlich alle mit Namen. Allesamt Füchse, allesamt Schleswiger Kaltblüter. Schweif, Mähne und Kötenbehang hatten die gleiche helle Farbe, die Blesse war bei allen besonders elegant geschwungen. Ihm persönlich war es egal, er mochte die Tiere wegen ihres Charakters und nicht wegen des Aussehens, aber die Hengste waren das Aushängeschild der Brauerei, und beim Kauf musste streng darauf geachtet werden, nur die besten und schönsten auszuwählen. Der Sechserzug war in ganz Norddeutschland bekannt. Doch der Landauer war nichts gegen die Fassbierwagen, die die Pferde sonst zogen, ganze fünf Tonnen setzten sie in Bewegung. Dafür mussten sie wendig sein und trotzdem eine hohe Zuglast stemmen, mussten auch im größten Chaos gelassen bleiben. Alle Tiere hatten ein langes Training durchlaufen, bevor sie hier eingesetzt werden konnten. Sie brauchten gesunde Hufe, gut sitzende Geschirre, Futter, das sie kräftig und gesund hielt. Für all das war er zuständig. Jaris pflegte die Tiere mit Hingabe, gab ihnen Kaffeebohnen mit ins Futter und fuhr jede Woche auf den Markt, um Gemüsereste für sie zu ersteigern. Und man sah es. Es erfüllte ihn mit Stolz, wie sehr die Pferde unter seiner Pflege aufgeblüht waren. Aber Pferde brauchten nicht nur einen Stallmeister, der ihnen wohlgesonnen war. Was sie außerdem brauchten, waren zufriedene Kutscher. Wenn die Männer ihre Arbeit nicht gerne machten, saß die Peitsche wesentlich lockerer. Tiere konnten nicht sprechen, sich nicht wehren. Die Arbeiter konnten zwar sprechen, aber sie trauten sich nicht.
Also hatte er das für sie übernommen.
Jaris durchquerte den Stall, stieg mit bollernden Schritten die kleine Holztreppe empor, die zu seiner Wohnung führte. Auch hier oben roch es nach Pferd, aber es machte ihm nichts aus, im Gegenteil. Seine zwei kleinen Zimmer mit Blick auf den Brauereihof erschienen ihm immer noch wie der Kaiserpalast selbst. Schließlich war er in einem Wagen aufgewachsen, hatte seine ganze Kindheit nachts auf einer Holzbank geschlafen. Niemals hätte er geglaubt, dass er die Freiheit der Straße einmal eintauschen, dass er der lauten, bunten Welt, aus der er kam, den Rücken kehren würde. Aber er musste auf seine Schwester aufpassen. Er hatte sie schon einmal verloren. Und er würde nicht zulassen, dass das noch einmal geschah.
Nach dem Morgen auf dem Fluss war er vollkommen durchgefroren. Jaris streifte die Stiefel von den Füßen. Seine Socken waren klatschnass, und er kramte neue aus der großen Holztruhe, zog sich einen sauberen Pullover über, setzte die Kappe auf. Dann stutzte er. Am Abend zuvor hatte er mit zwei Kutschern noch länger zusammengesessen. Auf dem Küchentisch lagen neben leeren Bierflaschen und Zigarettenstummeln eine Handvoll Flugblätter. Er zögerte kurz, dann raffte er die Zettel mit den Händen zusammen, schmiss sie in die offene Kleidertruhe und schlug den Deckel zu. Niemand betrat seine Wohnung, wenn er nicht da war. Aber trotzdem. Auf Nummer sicher zu gehen, war immer besser.
Im Laufen warf Jaris sich seine Weste über und ging rüber in den Braukeller. Den in Zeitungspapier eingewickelten Fisch trug er in seinem Seesack über der Schulter. In den kühlen Gewölben der Brauerei füllte er den Sack bis oben hin mit Bierflaschen auf. Wenn er Alice besuchte, tat er immer so, als wollte er vor allem seinen Schwager sehen, und brachte Henk großzügig von seiner wöchentlichen Holsten-Ration mit. Es war heuchlerisch, aber notwendig. Auf keinen Fall durfte Henk ihm den Umgang mit Rosa und Alice verbieten. Und darum besuchte er Alice auch nicht häufiger. Sein Schwager sollte nicht merken, wie wichtig sie ihm war. Wie sehr Jaris ihn dafür verfluchte, dass er ihr kein besseres Leben bieten konnte. Wäre ich doch früher da gewesen, dachte er jedes Mal, wenn er von einem seiner seltenen Besuche mit der Bahn zurück nach Altona fuhr und die Kiefer vor Frustration so fest aufeinanderpresste, dass es wehtat. Wenn ich sie nur gesucht hätte, damals. Wenn ich geahnt hätte, was sie aushalten musste. Ich hätte etwas tun können.
Als sie die Tür öffnete, stand er einen Moment einfach nur da und nahm ihren Anblick in sich auf. Dann entfuhr ihm ein Knurren. Mit zwei Schritten war er bei ihr, packte ihr Kinn.
«Jar, das tut weh!» Sie versuchte, ihn abzuwehren, aber er hielt sie fest.
«Ich bringe ihn um!», stieß er hervor. Die Wut war so gleißend, dass sie ihm einen Moment die Sicht nahm. «Wo ist er? Wo ist das Schwein?»
Alice fasste seine Handgelenke und stieß ihn sanft, aber bestimmt von sich. «Was glaubst du wohl?», sagte sie nur und ging zum Herd. «In der Wirtschaft.» Auf ihren Wangen hatten sich zwei kleine rote Kreise gebildet. «Es ist nicht so wild.»
«Deine Nase blutet ja noch!», rief er außer sich.
«Ich war schon bei Vater Kohl.» Beinahe ärgerlich wischte sie sich mit einem Tuch über das Gesicht. «Er hat sie gerichtet, aber es hört nicht auf.»
Jaris ließ den Seesack fallen und nahm stattdessen Rosa hoch, die ihm in die Arme sprang. Alice sah ihn warnend an. Nicht hier!, sagte ihr Blick. Nicht vor ihr.
«Du riechst nach Pferd!» Rosa schlang die Arme um seinen Hals.
«Bester Geruch der Welt, würde ich meinen.» Er grinste, obwohl alles in ihm vor kalter Wut bebte. Jaris trug Rosa zum Tisch und setzte sie darauf, musterte sie, suchte in ihrem kleinen Gesicht nach Spuren des Geschehens, die er Gott sei Dank nicht fand. Außer vielleicht in den Schatten unter ihren Augen. «Und, was macht die Lücke?»
Rosa entblößte das klaffende Loch, in dem einst ihre zwei Vorderzähne gesteckt hatten. «Ich kann meinen Finger durchbohren», erklärte sie lispelnd, nicht ohne Stolz, und machte es vor.
Jaris stieß einen Pfiff aus. «Großartig!» Er gab seiner Nichte einen Kuss aufs Haar, drückte sie einen Moment an sich und atmete ihren Kinderduft ein.
«Plüsch sagt, du hast Bonbons dabei.» Rosa schielte zu ihm hoch.
«Dieser Bär hat hellseherische Fähigkeiten.» Schmunzelnd zog er die Karamellen aus der Westentasche.
Sie verzog das Gesicht. «Er sagt, du hast noch mehr.»
«Frech!», antwortete er in Richtung des Bären. «Einfach nur frech.» Ergeben holte er auch die andere Tüte hervor und reichte sie seiner Nichte. «Aber gut, irgendwie müssen wir deine übrigen Zähne ja auch noch rauskriegen.» Dann nahm er den Sack und reichte Alice das Paket mit dem Fisch.
Wie er erwartet hatte, freute sie sich. Aber ihre Augen leuchteten nicht. «Was würden wir ohne dich machen!» Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange.
Jaris schluckte hart. Es war wie eine Ohrfeige. Er tat nichts, rein gar nichts, um ihnen zu helfen.
«Möchtest du Kaffee?»
Wie schaffte sie es nur, vor Rosa stets heiter und gut gelaunt zu sein? Man merkte ihr nicht das Geringste an. Wenn man von dem Blut absah, das weiter aus ihrer Nase tropfte. Gott, wie sehr er es hasste, sie so zu sehen.
«Gerne. Aber ich mache das!» Er packte seine Schwester an den Schultern und dirigierte sie zum Tisch. «Setz dich.»
«Du weißt doch gar nicht, wo alles ist», protestierte sie.
«Kaffeepulver und Wasser, das werde ich gerade noch hinbekommen.» Jar drehte sich um und stutzte. Der Wassereimer neben dem Herd war leer.
Sie lachte, als sie sein Gesicht sah.
Alice begleitete ihn in den Hof. Er wusste, dass sie die Gelegenheit nutzen wollte, um ihm einzuschärfen, dass er vor Rosa nicht über die Situation sprechen sollte, aber er kam ihr zuvor. Im dunklen Flur hielt er seine Schwester fest. «Alice, es geht so nicht weiter.»
Sofort entwand sie sich seinem Griff. «Hör auf. Es bringt doch nichts. Ich brauche ihn.»
«Du brauchst ihn nicht, ich kann für euch beide sorgen!» Er fühlte sich so hilflos, dass es seinen Zorn noch weiter steigerte.
«Ach ja? Sollen wir vielleicht zu dritt in deiner Kammer über dem Stall schlafen?»
Wie immer roch sie nach Wolle und Kindheit, und er hätte sie gerne in den Arm genommen. Natürlich hatte sie recht. Alice würden immer nur schlecht bezahlte Arbeiten bleiben, die ihr kein Auskommen boten. Er selbst hatte die Stelle in der Brauerei nur mit großem Glück und viel Charme ergattert, verdiente gerade genug, um über die Runden zu kommen. Wenn man einmal am Boden war, war es schwer, sich aufzurichten. Und sie hatten ohnehin ziemlich weit unten begonnen.
«Wir leben nicht im Mittelalter, Frauen können sich von ihren Männern trennen.»
Es war so dunkel im Treppenhaus, dass er nur ihre Umrisse wahrnahm. Sie zögerte. «Aber nicht Frauen wie ich.»
Wenn sie so etwas sagte, hätte er sie am liebsten geschüttelt. «Alice!», brachte er nur hervor, die Hände um den Henkel des Wassereimers geklammert. «Es gibt einen Weg. Es muss einen geben.»
«Weißt du einen?»
Als er nichts erwiderte, trat sie auf ihn zu und strich ihm über den Arm. «Ich halte das aus.»
«Vielleicht», antwortete er schließlich. «Du hältst alles aus, Alice. Aber was ist mit Rosa?»
Sogar im Dunkeln spürte er, wie sie sich versteifte. Kurz dachte er, sie würde noch etwas sagen, doch sie drehte sich um und polterte wortlos die Stufen hinunter. Im Treppenhaus hinter ihm quiekten die Ratten. Jaris schloss die Augen. Es war kaum zu ertragen, dass er Alice wiedergefunden hatte und ihr trotzdem nicht helfen konnte. Dass sie all das überstanden hatte, nur um jetzt in diesem Leben festzusitzen. Und am schlimmsten war, dass er auch Rosa nicht retten konnte.
Das brach ihm das Herz.
2
Der Tag, an dem es anfing, begann wie jeder andere. Hinterher fragte er sich manchmal, was er getan hätte, hätte ihn jemand gewarnt. Wenn man wüsste, dass Dinge geschahen, die das Leben in zwei Teile schnitten, ein Vorher und ein Nachher: Was würde man nicht alles anders machen. Aber ihr Nachher begann leise, unauffällig. Es schlich sich in ihr aller Leben wie ein kühler Windhauch, der unter einer Tür durchkriecht. Niemand sah es kommen. Und niemand konnte etwas dagegen tun.
Samstags frühstückten sie zusammen, das war in der Reeven-Villa seit jeher Sitte und Tradition. Als John die geschwungene Treppe hinunterlief, die Halle durchquerte und das Morgenzimmer betrat, saß seine Mutter bereits am Tisch, ihre Korrespondenz neben sich, eine dampfende Tasse Kaffee in der Hand. Wie so oft hatte Gesa Reeven den Mund missbilligend zusammengekniffen und die Stirn leicht gerunzelt. Er küsste sie auf die Wange, die sie ihm hinhielt, ohne von dem Brief aufzusehen, den sie gerade las.
«Guten Morgen, John.» Gesa trug ihre Frühstückstoilette aus pastellfarbenen, großzügig fallenden Kleidern. Mittags wechselte sie zu strengeren Konturen, und fürs Abendessen zu dunkleren Farben und opulenteren Schnitten.
«Schlechte Neuigkeiten?» Er setzte sich, faltete die Serviette auf und nickte Sala zu, sie solle Kaffee einschenken. Natürlich konnten es keine wirklich schlechten Neuigkeiten sein, sonst hätte er es längst gewusst. Seine Mutter klingelte die gesamte Familie herbei, wenn sie etwas erfahren hatte, von dem sie glaubte, es teilen zu müssen – wenn nötig auch mitten in der Nacht. Sie hatte John sogar schon in der Kanzlei angerufen, um ihm aufgeregt zu erzählen, dass das Kleinmädchen von nebenan beim Putzen aus dem Fenster gefallen war. Es war tragisch, sicherlich. Was er mit der Information allerdings mitten in einer Verhandlung anfangen sollte, blieb ihm schleierhaft.
John trank zwei Schluck Kaffee und hoffte, dass sie das müde Pochen in seinen Schläfen vertreiben würden. Am Abend war er mal wieder viel zu spät aus dem Gericht gekommen, hatte anschließend mit Evelyn ein Konzert im Englischen Garten besucht, bei dem er beinahe weggenickt wäre. Nur ihr spitzer Ellbogen hatte ihn davon abgehalten, mit dem Kinn auf der Brust einzuschlafen und vor versammeltem Publikum zu schnarchen. Zum Glück hatte Evelyn Humor. Mit blitzenden Augen hatte sie ihm zugeflüstert, dass die Verlobung noch nicht final war und er besser aufpasste, dass sie sich niemand anderes zum Heiraten suchte. Jemanden, den ihre Gesellschaft nicht zum Einschlafen brachte. John hatte so laut gelacht, dass ihre Nachbarn sich entrüstet räusperten.
Der Kaffee war stark und heiß. Von den anderen Familienmitgliedern war noch nichts zu sehen, aber das Haus summte vor morgendlicher Betriebsamkeit. Irgendwo im zweiten Stock fiel eine Tür ins Schloss, aus der Küche drang schwach das hohe Pfeifen eines Teekessels.
«In Lockstedt gibt es Probleme mit den Wasserleitungen.» Seine Mutter faltete den Brief zusammen und schob die Post von sich, als würde sie unangenehm riechen. «Kaum sind wir fort, läuft dort alles aus dem Ruder.»
«Ich werde gleich nach dem Frühstück anrufen.» Tatsächlich hatte er nichts dergleichen vor. John wusste genau, dass ihr Verwalter, der sich um das Sommerhaus kümmerte, durchaus in der Lage war, die Dinge selbst zu regeln, und sie nur der Form halber informierte.
«Und was sagst du dann?», bohrte sie nach.
«Ich sage gar nichts. Ich frage nach, was passiert ist», erwiderte er und zog die Zeitung zu sich heran.
«Darüber habe ich dich soeben in Kenntnis gesetzt, oder nicht?» Gesa reagierte nur selten auf seine Versuche, eine Situation zu entschärfen. «Und komm gar nicht erst auf die Idee, diese Zeitung aufzuschlagen. Samstags unterhalten wir uns!»
Seufzend zog er die Hand wieder zurück und nahm stattdessen den Brieföffner, um sich seiner eigenen Post zu widmen.
Energische Schritte kündigten Julius an. «Das wird dir nicht gefallen», rief er in Gesas Richtung und wedelte mit einem offenen Kuvert. Sein Bruder schien an diesem Morgen einem Kolportageroman entsprungen, trug schwarze Stiefel zu blauer Hose, hatte den Kragen seines Hemdes aufgeknöpft, das helle Haar auf eine Art zerzaust, die ihn gleichzeitig zerstreut und verwegen erscheinen ließ.
John schmunzelte, Gesa zog eine Augenbraue in die Höhe. «Ich wünsche dir auch einen guten Morgen, Sohn.»
Johns Bruder ignorierte die Rüge, ließ sich breitbeinig auf seinen Stuhl fallen und warf das Kuvert auf den Tisch. «Vater soll geadelt werden.»
Mit einem Knall setzte Gesa Reeven die Tasse ab, die sie gerade zum Mund geführt hatte. «Julius, das können wir nicht hinnehmen. Unser guter Name! Was soll dann als Nächstes kommen, der Freiherrentitel?»
John lachte in seine Tasse. Gesa war Hamburgerin durch und durch. Hier war man nicht adelig, egal wie sehr das Unternehmen florierte. Es gehörte einfach nicht zum guten Ton. Ein Kaufmann ließ sich nicht erheben.
«Ich weiß, dass es deinen Bürgerstolz verletzt, aber er wird wohl kaum ablehnen können.» Amüsiert warf Julius John einen Blick zu. «Es war doch klar, dass es irgendwann kommt.»
«Am Ende muss er noch sein Mandat niederlegen!»
«Ach was.» Julius winkte ab. «Niemals.»
Adel war von der hamburgischen Regierung ausgeschlossen. Als Mitglied der Bürgerschaft würde ihr Vater die Zustimmung des Senats benötigen, um sein Amt zu behalten.
«Von Reeven, das muss man sich einmal vorstellen. Wie man uns anschauen wird!»
«Es wird den Austausch mit Berlin enorm erleichtern», versuchte John halbherzig, seine Mutter zu beruhigen, dabei wusste er genau, dass es an diesem Tag – wie auch in den kommenden – kein anderes Gesprächsthema geben würde.
Erneut waren von der Treppe Schritte zu hören. Kurz darauf wehte Blanche herein, wie immer schon am frühen Morgen sprühend vor Energie. Sie hatte ihre hellen Locken einflechten lassen, über dem Hauskleid trug sie einen fließenden Morgenmantel. «John, gute Neuigkeiten, dein Kostüm ist angekommen.» Sie küsste erst ihre Mutter, dann ihre Brüder der Reihe nach auf die Wange und setzte sich dann neben ihn, ein Strahlen im Gesicht, das nichts Gutes verhieß.
«Blanche, ich habe dir gesagt, dass ich nicht …»
«Erspar mir das!» Sie hob die Hand. «Wir wissen alle, dass du es machen wirst. Die Rolle ist dir wie auf den Leib geschrieben.»
Das Theaterstück zu Weihnachten hatte in der Familie ebenfalls Tradition. Dass sie schon Monate vorher proben sollten, war allerdings neu. Aber es würde ja auch nicht irgendein Weihnachten sein. Der Gedanke verursachte ein Ziehen irgendwo in Johns unterer Magengegend.
An Weihnachten würde er heiraten.
Blanche hatte sich daher vorgenommen, jede vorangegangene Aufführung zu übertreffen. John wusste, dass sie es nicht nur seinetwegen tat, sondern sich damit auch selbst auf andere Gedanken brachte. Ihr Mann Niklas war geschäftlich in Übersee, und sie hatte nichts anderes zu tun, als auf seine Rückkehr zu warten. Daher war sie vorübergehend wieder zu ihnen in die Villa gezogen. John hatte nichts gegen Theaterstücke. Ob er aber in der Adaption von Schneeweißchen und Rosenrot, die seine Schwester plante, wirklich seine Rolle finden würde, bezweifelte er.
Sala erschien mit dem heißen Wasser, und wie auf Knopfdruck rumorte es über ihren Köpfen. Johns Vater brühte seinen Kaffee gerne selbst auf, dafür stand auf dem kleinen Biedermeiertisch neben dem Buffet eine Maschine mit blauer Spritflamme bereit. Theodor Reeven klingelte bereits beim Ankleiden nach dem heißen Wasser, damit es gebracht wurde, noch bevor er in den Räumen im Erdgeschoss ankam. Es war ein Ritual, das er jeden Morgen mit Hingabe zelebrierte.
Die nahenden Schritte seines Vaters klangen wesentlich ruhiger und fester als die seiner Schwester.
«Theodor, du musst in Lockstedt anrufen.» Gesa war beim Thema, bevor ihr Mann an den Tisch getreten war. «Die Wasserleitungen. Wirklich, als könnte ich hellsehen! Habe ich es dir nicht gesagt?»
Die Mundwinkel seines Vaters zuckten amüsiert. «Ich werde mich kümmern», versprach er und wandte sich zum Biedermeiertisch, um an der Flamme zu schrauben.
«Und hast du es schon gehört?» Gesas Augen funkelten; trotz ihrer Empörung genoss sie das Drama. «Du sollst geadelt werden.»
Theodor blickte zu Julius, der bestätigend nickte.
«Ich habe es befürchtet.» Johns Vater brauchte offensichtlich ein paar Sekunden, um die Information zu verarbeiten. «Nun, die Zeiten ändern sich.» Er trat ans Fenster, die Hände auf dem Rücken verschränkt, die Brille auf die kahle Stirn geschoben. Seit im Garten der große Teich angelegt worden war, beobachtete er jeden Morgen, welche Vögel auf dem Wasser zu sehen waren. «Ein Reiher», murmelte er erfreut. «Mitten in der Stadt.»
Plötzlich ertönte draußen in der Halle ein lautes Knarren, als sich der hauseigene Ascenseur in Bewegung setzte. Alle sahen erstaunt auf. Einzig Blanche blieb ungerührt, faltete ihre Serviette auseinander und nahm sich ein Milchhörnchen aus dem Porzellankorb. Keiner sprach, bis das Knarren und Quietschen des Aufzugs verstummt war. Es folgte ein Schleifen, begleitet von leisen Klicklauten auf den Dielen. Wenige Sekunden später rollte Johns Großvater Eugen in seinem Rollstuhl herein, neben ihm erschien Burchard, seine schwarz-weiße Dänische Dogge.
«Was herrscht hier für eine Grabesstimmung? Da hätte ich ja auch oben bleiben können.»