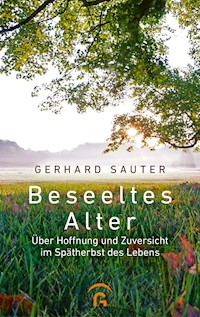23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Theologie in seelsorgerlicher Perspektive
- Der lange erwartete neue Entwurf einer theologischen Anthropologie
- Das reife Werk eines international renommierten Theologen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 777
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Den treuen Weggefährten
»Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott« An die Kolosser 3,3
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
»Was ist der Mensch?« Eine offene Frage! Wird sie eingeriegelt oder wird versucht, sie umfassend zu beantworten, beeinträchtigt dies die Wahrnehmung des Menschseins. Auch eine jede Definition würde zu kurz greifen, denn sie erfasst nur selektiv und übersieht, wie unergründlich Menschen sind, auch für sich selber. Wer »dem Menschen« nachdenkt, begibt sich auf einen Weg, der den Denkenden nicht unverändert lässt.
Was darf von einer theologischen Anthropologie erwartet werden? Doch wohl eine Rechenschaft darüber, wie Menschen sich selbst wahrnehmen: als von Gott gerufen, von seinem Handeln erfasst und, wenn sie darauf zu antworten versuchen, vor neue Fragen gestellt. Was bemerken sie dabei? Welche Fragen brechen auf, welche Räume werden ihnen eröffnet, an welche Grenzen stoßen sie? Gottes Wirken und Rufen ist vielgestaltig. Unüberhörbar erreicht es die Menschheit in der Gestalt Jesu Christi. »Seht, welch ein Mensch!«, rief Pontius Pilatus über ihn aus, den bald darauf Entwürdigten, Todgeweihten, Ausgestoßenen, und er hat damit weit mehr und noch ganz anderes gesagt, als er beurteilen konnte (Joh 19,5). Den Ausruf »Seht, welch ein Mensch!« hatte Gott sich seit jeher zu eigen gemacht. Er wird bei der Menschwerdung des neuen Menschen Jesus Christus laut, angesichts seiner Worte und Taten, über seinem Sterben und seiner Auferweckung von den Toten. Der Ruf weist auf den, der die Wahrheit des Menschseins verkörpert, der Menschen gleichsam in den Weg tritt und mit ihnen geht, auf seine unaufdringliche, verborgene Weise. Wie sieht Gott uns in ihm, und wie nehmen wir uns wahr, wenn er uns begleitet und zu sich ruft? Welches Licht fällt hier auf menschliche Lebensäußerungen, und wie werden sie von diesem Licht durchdrungen? Was heißt es, wahrhaft Mensch zu sein: es zu bleiben – und zugleich anders, weil erneuert, zu werden? So lauten einige der leitenden und treibenden Fragen theologischer Anthropologie.
Gottes Ruf kann auch unausdrück lich ergehen: verborgen in Daseinsbedingungen und Lebensumständen, aufrüttelnd in der Rätselhaftigkeit des anderen Menschen und des eigenen Selbst, in der Nähe des Fremden und der Fremdheit des Nächsten, erschütternd und ermutigend im Zerbrechen der Selbstgerechtigkeit. Dem Vernehmen von Gottes Ruf können Hindernisse entgegenstehen, die Menschen aufgerichtet haben und hinter denen sie sich verschanzen; dazu gehören ihre Selbstgespräche, die sich dem Hören verweigern und die Aufmerksamkeit ablenken.
Theologische Anthropologie erwächst aus dem Staunen darüber, dass Gott Menschen ins Leben rief, was er ihnen anvertraute, wessen er sie würdigte, wie er sie immer wieder aus ihren eingefahrenen Lebensweisen herausruft und wie er sie sich gegenüber stellt, gerade auch durch andere Menschen. Indem er ihnen nahe tritt, werden sie ihrer selbst neu ansichtig, in einer sie oft erschreckenden, aber immer heilsamen Weise. Ihnen wird zugemutet, was sie sich niemals erdenken können: so außer sich selber versetzt zu werden, dass sie sich auf Gott verlassen und zugleich in bestimmter Hinsicht sich selber verlassen, wenn sie sich zu dem ausstrecken, was ihnen zuteil werden soll.
Damit Gottes oft leiser Ruf vernommen werden kann, bedarf es der Aufmerksamkeit für Gottes ausgesprochenen Willen, für seine Verheißungen und Weisungen. Dazu verhelfen Denkerfahrungen, die die Theologie in Atem halten. Sie müssen in ihrem Begründungszusammenhang bedacht und so deutlich wie möglich ausgesprochen werden. Menschliche Antwort wird jedoch oft um Sprache ringen, auch weil viele Wörter, die hier gebraucht werden, unzureichend oder bereits bedeutungsbesetzt sind. Wenn gesagt werden soll, wie Gottes Handeln in menschlichem Leben aufleuchtet, werden Missverständnisse oft nur schwer zu vermeiden sein: entweder erscheint zu viel oder zu wenig von der Ferne und der Nähe Gottes zum Menschen gesagt. Diese Schwierigkeiten, die ja keine bloßen Sprachprobleme sind, können durch keine Reflexion aufgehoben werden. Jede Rechenschaft über menschliches Antworten auf Gottes Ruf, die diesen Ruf zu Gehör bringen möchte, ist eine Gratwanderung zwischen einem Zuviel und einem Zuwenig dessen, was Menschen zu sagen anvertraut ist.
Theologische Anthropologie – wie bisher umrissen – berührt sich in vielem mit der Lehre vom Menschen als Bestandteil der Dogmatik oder der Systematischen Theologie, aber sie deckt sich nicht mit ihr. Die christliche Lehre vom Menschen ist in der Regel ein Bestandteil der Lehre von der Schöpfung, ergänzt durch Partien aus der Sünden- und Gnadenlehre sowie aus der Lehre von den letzten Dingen (Eschatologie), oder, anders tituliert: aus der Versöhnungs- und Erlösungslehre. 1 Die Lehre vom Menschen geht davon aus, dass dieser ursprünglich makellos und unversehrt gewesen ist, und sie geht dem nach, was aus ihm wurde, was ihm im Grunde blieb und wessen er bedarf, damit er seine Bestimmung zu erfüllen vermag. Doch diese Perspektive wird nicht einmal dem spannungsvollen Duktus biblischer Theologie gerecht, geschweige denn, dass sie auf das Geheimnis der Menschwerdung des Menschen aufmerksam machen könnte (Kap. 3). Außerdem verengt sie das Blickfeld für die Vielfalt der Widerfahrnisse des Handelns Gottes an und mit Menschen, für die Zerreißproben menschlicher Selbstwahrnehmung, für ihre Gebrochenheit und für notwendige Aufbrüche.
Ein ganz anders lautender Ansatz hat in den beiden letzten Jahrhunderten radikale Verwerfungen bewirkt. Er versprach, die Grundlagenkrise neuzeitlicher Theologie dadurch zu beheben, dass die Theologie insgesamt auf eine anthropologische Begründung zurückgeführt und von ihr aus wieder aufgebaut werden könne: als Zugang zur Theologie vom grundlegenden und allgemeingültigen Wissen um den Menschen aus. Diese Begründung sollte aus dem reflektierten Verhältnis des Menschen zu sich selber erhoben werden: beispielsweise aus seinem Selbstbewusstsein, dessen religiöse Dimension es auszuloten gelte; aus der Selbstvergewisserung über Herkunft und Zukunft des Menschen, über seine Daseinsmöglichkeiten, deren Begrenzung und einen letzten Halt jenseits dieser Grenzen; aus der Einsicht in persönliche Freiheit, aus der die Verantwortung gegenüber Gott, Menschheit und Welt gespeist werde; aus veränderter Gesinnung oder aus gewandeltem Selbstverständnis. Diese Wende zum Menschen beanspruchte, alles theologische Reden zu erschließen, indem sie sämtliche Themen der christlichen Glaubenslehre als Artikulationen der Selbstdurchleuchtung des religiös affizierten Menschen zur Darstellung bringen wollte. Ganz abgesehen davon, dass hier die Kardinalfrage nach der Ermöglichung theologischer Erkenntnis abgestumpft wurde – die Reduktion auf Bewusstseinsakte oder Sprachphänomene führte auch zu einer intellektuellen Versteppung, sie überging die Verwicklungen und Abhängigkeiten menschlicher Selbstwahrnehmung. Was hat sie für die Einbindung einer theologischen Anthropologie in die Aufgaben, die der Theologie als Ganzer gestellt sind, erbracht?
Eine weitere Grenzziehung betrifft das Verhältnis einer theologischen Anthropologie zur Ethik. »Was sollen wir tun?«: die Art und Weise, wie auf diese Frage geantwortet wird, verrät manches über die Auffassung dessen, was Menschen sein können. Doch gerade deswegen muss die Frage »Was ist der Mensch?« aufrecht erhalten und offen gehalten werden, um eine Ethik vorzubereiten, die das Menschsein nicht nur aus Handlungen und ihren situativen Zusammenhängen begreifen will.
Eine theologische Anthropologie ist voraussetzungsreich: Menschen möchten angesichts dessen, was sie an sich und an anderen bemerken – oft zuerst an anderen und daraufhin auch an sich selbst –, zur Klarheit vor Gott gelangen. Sie sind verwundert und verwirrt, wenn sie erleben, wozu Menschen fähig sind, was ihnen zugemutet werden kann, oft erschrocken angesichts dessen, was sie sich und anderen antun können, wie sie sich anderen in den Weg stellen und sich selber im Wege stehen. Sie beginnen zu fragen, wie Glanz und Elend des Menschen sich zueinander verhalten, und doch können sie schwerlich von selber und aus sich selber eine Antwort finden, die nicht in neuer Täuschung und Enttäuschung endet.
Solche Entdeckungen bedürfen einer theologischen Begründung. Ihr widmen sich theologische Denkerfahrungen, wie sie in der Dogmatik formuliert worden sind und weiter entwickelt werden: Wenn Menschen sich zu Gott und an ihn wenden, geraten sie in eine Distanz zu sich selber, ohne sich distanzieren zu können. Denn sie sehen sich Gottes Handeln ausgesetzt: oftmals so, dass zerbrochen wird, was sie sich einbilden und was sie vor sich sehen möchten. Was sie vernebelt haben oder verbergen wollten, wird heilsam aufgerissen und in einen weiten Raum hinein gestellt, in dem sie zusammen mit anderen neue Schritte wagen können.
Theologische Denkerfahrungen unterstützen andererseits die Entfaltung und Formulierung anthropologischer Einsichten, ohne dass sie in diesen Einsichten aufgingen. Sie helfen, die Frage »Wer sind wir wirklich?« darauf zu lenken, wie Gott uns Menschen ansieht, wessen er uns würdigt und was er uns zusagt: im Zusammenhang seines Handelns als Schöpfer, seiner Gerechtigkeit, seiner Anteilnahme in Gericht und Gnade, kraft seiner Versöhnung, die Altes unwiderruflich beendet und einen Neuanfang schafft, im Erwecken einer Hoffnung auf Erlösung und Vollendung wider alles Erwarten. Insoweit ist die Frage, die durch den Grundlagenstreit aufgeworfen wurde – wie Anthropologie und Theologie sich zueinander verhalten –, weiterführend, allerdings nicht so, wie sie bei der anthropologischen Umformung der Theologie mit allen ihren Varianten anvisiert wurde und neuerdings wieder erhoben wird.
Das Gespräch darüber darf nicht abbrechen, sich aber auch nicht in der Debatte über Begründungsprobleme, über eine Gesamtanschauung vom Menschen oder über die Sorge darüber verlieren, welchen Part Theologinnen und Theologen im Konzert der Human-, Lebens- und Kulturwissenschaften spielen können. Darum begnüge ich mich damit, im ersten Kapitel einige Annäherungen zu verfolgen: Wege zu dem, was einer theologischen Anthropologie angemessen ist und was sie leisten kann; auch gilt es zu prüfen, wohin bereits begangene Wege führten. Erst in den beiden letzten Kapiteln werde ich einen Abriss der Debatte in den letzten sieben Jahrzehnten über die Streitfragen skizzieren, ob Anthropologie die Theologie zu begründen vermag und wie dogmatische Aussagen in die theologische Anthropologie eingreifen. Diese drei Kapitel fassen die Darstellung ein, bei der die Zugänge zu den einzelnen Themen mit deren inhaltlicher Entfaltung verschränkt sind. Deshalb sind die Themen nicht durch eine konzeptionelle Entwicklung oder durch ein quasi zeitliches Schema miteinander verkettet, die ihre Abfolge vorschreiben müssten. Ihr innerer Zusammenhang wird durch elementare Fragen gebildet, die jeweils von neuem unsere geistigen Sehgewohnheiten zunächst herausfordern, um unsere Aufmerksamkeit zu schärfen: dafür, dass wir selber nicht mehr die Perspektiven der Wahrnehmung der Wirklichkeit bestimmen können, deren Glieder wir sind. Vor solche Fragen werden wir mitten im Leben gestellt, nicht erst an seinen Grenzen, und ihnen gilt es nachzugehen.
Eine theologische Anthropologie wird Beobachtungen, Reflexionen und Zeugnisse enthalten und dementsprechend zwischen Beschreibungen, Meditationen und verbindlichen Aussagen (Assertionen) abzuwechseln haben. Ihre Sprachform kann nicht einförmig sein. Gerade weil sie sich vor Verallgemeinerungen hüten muss und nicht »den Menschen« zum Gegenstand einer Untersuchung herabsetzen darf, wird sie mitunter nicht umhin können, die Leserinnen und Leser persönlich anzureden.
BLAISE PASCAL schrieb – wohl nicht zufällig in seinen Betrachtungen menschlicher Natur, in denen er den Wildwuchs menschlicher Selbsteinschätzung aufzeichnete, und bei seinen bruchstückhaften Einblicken in Gottes Weisungen zum Leben, die sich nicht zu einer in sich geschlossenen Konzeption fügen wollten: »Das letzte, was man findet, wenn man ein Werk schreibt, ist, daß man weiß, womit man beginnen soll.« 2 Dies hat sich mir bei meinen Ansätzen zu einer theologischen Anthropologie, deren Anfänge bis zum Beginn meiner Lehrtätigkeit im Jahre 1965 zurückreichen, des Öfteren bestätigt. Von dem, was ich jetzt vorlege, verdanke ich vieles den Gesprächen mit meiner Frau Annegrete, mit Freunden, meiner Sozietät, meinen Doktorandinnen und Doktoranden, die sich in ihren Dissertationen anthropologischen Themen widmeten.
Manche Kennwörter, die wohl in einer theologischen Anthropologie erwartet werden – zum Beispiel Gewissen, Seele, Vernunft –, sind nur indirekt berücksichtigt worden: in thematischen Zusammenhängen, die das, was mit diesen Wörtern theologisch gemeint sein kann, besser zur Sprache bringen dürften, als Anleihen aus der Begriffsgeschichte es leisten könnten. Anderes wie Willensbildung, Leiden, Gedenken und Vergessen – sie stehen sonst eher am Rande oder werden vernachlässigt – gilt es stärker zur Geltung zu bringen. Zahlreiche Themen könnten weiter entfaltet werden, auch in der Auseinandersetzung mit anderen Betrachtungsweisen. Damit und mit problemgeschichtlichen Exkursen habe ich mich hier zurückgehalten. Auch von dem Reichtum an Menschenkenntnis, der in der Christenheit gewonnen wurde und bloß zum Teil in theologische Abhandlungen Eingang fand, können nur einige Ausschnitte berücksichtigt werden. Auf ein Verzeichnis der Literatur, die über die in den Anmerkungen genannten Schriften hinausgeht, habe ich verzichtet, weil es ausgeufert wäre. Eine Auswahl einschlägiger Beiträge enthält WOLFGANG SCHOBERTHS »Einführung« 3.
Die Belege aus dem Alten Testament werden meistens in der Übersetzung der Zürcher Bibel (Ausgabe 1955) zitiert. Abkürzungen entsprechen dem Verzeichnis in »Religion in Geschichte und Gegenwart« (RGG4, Bd. 8, Tübingen 2005). Bei Literatur aus den USA habe ich, wie dort üblich, auch den Verlag angegeben. Wegen längerer krankheitsbedingter Arbeitspausen kann das Buch leider später als angekündigt erscheinen. Herzlich danke ich Herrn Lektor Diedrich Steen für seine verständnisvolle Begleitung, meiner Frau, Herrn Pfarrer Thomas Bergfeld und Herrn Dr. Wilfried Theilemann für ihre Mithilfe beim Korrekturlesen.
Sankt Augustin, den 27. August 2010
Gerhard Sauter
1. Annäherungen: Wie wird eine theologische Anthropologie möglich?
Was ist der Mensch?
– ein empor gekommener Affe?– Gottes Ebenbild?– das Lebewesen mit aufrechtem Gang?– ein krummes Holz?– ein krankes Tier?Was werden Sie antworten? Das hängt davon ab, wie Sie Menschen ansehen, wie Sie Menschen zu sehen bekommen, wie diese Sie anblicken und wie Sie sich dann selber anschauen. Ihre Antwort kann auch verraten, woher Sie erfahren, was Sie vom Menschen zu halten haben.
Von den Antworten, die hier aufgelistet sind – ohne Vollständigkeit zu beanspruchen – , entspricht die erste einer populären Evolutionstheorie, die wissenschaftlich längst überholt ist, aber immer noch zu provozieren vermag, vor allem im Kontrast zur zweiten Antwort, die der biblischen Schöpfungsgeschichte entnommen ist (Gen 1,26 f.). Die dritte wurde beispielsweise von der Philosophischen Anthropologie vertreten, die die Sonderstellung des Menschen im Vergleich zu den Tieren auf den Begriff bringen wollte: Seine »Weltoffenheit« und »Entscheidungsfreiheit« verdankt der Mensch der eigentümlichen Konstellation seiner Hände und Füße im Verhältnis zum Gesichtsfeld; dadurch wird ihm ein Handlungsspielraum gewährt, den er vergegenständlichen kann und durch sein Sprachvermögen repräsentiert. Statt wie das Tier auf eine natürliche Umwelt angewiesen zu sein, vermag der Mensch sich in einer zeitlich nach vorn hin offenen Welt zu bewegen, diese zu seiner Umwelt einzugrenzen, ohne sich dadurch fesseln zu lassen; er kann sich darin disponieren und möglichst viel von dieser Welt für sich einrichten.4 Weil er aufrecht steht und geht, kann er weiträumig sehen und von vielen gesehen werden.5 Zum »aufrechten Gang« wollte schon die Freiheitsparole der Aufklärung verpflichten: mit der Aufforderung, sich weder vor Mächtigen zu ducken noch die Schultern hängen zu lassen. Beides würde zu Haltungsschäden führen. IMMANUEL KANT (1724-1804), der nachdrücklich für diese Parole eintrat, stellte ihr jedoch die Beobachtung zur Seite, der Mensch sei »aus so krummem Holze gemacht«, dass daraus »nichts ganz Gerades gezimmert werden« könne; dennoch sei das Menschengeschlecht »von der Natur aus« dafür angelegt und dank der Absicht der » Vorsehung« dazu bestimmt, sich dem Ziele der Vollendung des Menschen anzunähern.6 Diese Bestimmung darf nicht dazu verleiten, den Menschen gewaltsam gerade biegen zu wollen, denn daran könnte er zerbrechen. Schonungsloser zeichnete FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) die Widersprüchlichkeit des allzu Menschlichen: Der Mensch ist »das kranke Thier«, »krankhaft« deshalb, weil es »noch nicht festgestellt« ist – geleitet nicht durch seine Instinkte, von ihnen gleichermaßen getrieben wie geschützt, sondern zugänglich und bereit für viel zu vieles, sogar für seine Selbstzerstörung. Weil er ebenso »das tapferste und leidgewohnteste Thier« ist wie das »grausamste«, »gegen sich selber das grausamste Thier«, eignet ihm ein ambivalenter »Doppelcharakter«: viel zu leicht lässt dieses Tier sich täuschen, und doch: »seine furchtbaren und als unmenschlich geltenden Befähigungen sind vielleicht sogar der fruchtbare Boden, aus dem allein alle Humanität in Regungen, Thaten und Werken hervorwachsen kann.«7 Der Hamburger Satiriker HANS SCHEIBNER will, was sich bei Nietzsche tragisch überschlägt, ironisch auf den Punkt bringen: »Der Mensch, der bleibt ein böses Vieh – ich lieb’ ihn trotzdem irgendwie.« Ein Vorschuss, der sich immer auszahlt? Der Mensch als Tier, das wird, was es aus sich gemacht hat und was es mit dem anfangen konnte, was andere aus ihm machten: ein nie beendetes Projekt, bilanziert nur durch den Tod und dadurch von innen her abgeschlossen? Ein Schriftsteller lässt einen Weisen seine Menschenkenntnis so bilanzieren: »Denn was ist schließlich der Mensch? Ein Gemenge aus Charakter und Schicksal, nichts anderes.« Wenige Augenblicke zuvor hatte er zu seinem Gegenspieler gesagt: »Euer Gesicht ist nicht eben menschlich, doch auch nicht tierisch, es ist, als wäret Ihr eine Übergangsstufe zwischen Mensch und Raubtier. «8 Was wird dann die Totenmaske zeigen? Wird vielleicht nicht sie, aber die Zeitspanne zwischen Sterben und Totenstarre überraschend Anderes erahnen lassen? Eine Gelöstheit, die die Mühen des Lebenslaufes hinter sich lässt? Womöglich sogar Anzeichen einer Hoheit, die zeitlebens verborgen geblieben war?
1. Zugänge oder Abwege?
Was also ist der Mensch? Sind alle bisher genannten Antworten und noch viele ungenannte dazu sämtlich richtig – irgendwie, wir wissen nur nicht recht, wie? Die Liste, die ich zusammenstellte, bietet sicherlich keine multiple-choice-Auswahl, bei der nur eine Möglichkeit zutrifft. Jede dieser Antworten führt in eine bestimmte Richtung. Wir befinden uns an einem Scheideweg, und wenn wir hier eine Richtung einschlagen, führt sie uns unweigerlich von allen anderen fort. Es mag sein, dass ein besonders einladender Weg reizt, ihn schon deswegen zu gehen, weil wir meinen, auf ihm die meisten Weggefährten zu finden, doch dann teilt er sich erneut, und wir kommen an einer neuen Richtungsentscheidung nicht vorbei, vielleicht für einen schmalen, verschlungenen Pfad oder für eine Gratwanderung. Falls wir uns für einen Weg entschieden haben, bei dem wir später sehen müssen, dass er uns gar nicht weiterführt – andere mögen auf ihm zum gewünschten Ziel kommen! –, können wir zwar zur Kreuzung zurückkehren und einen neuen Weg suchen, doch wir haben dann unnötig viel Zeit und Kraft verloren, auch wenn wir um einige Erlebnisse reicher geworden sind.
Was für manche Zwecke zum Ziel führt, ist für andere irreführend. Für eine theologische Anthropologie seien drei Beispiele genannt: die Erfassung der menschlichen Natur, der religiöse Aufschwung zu Gott, das christliche Menschenbild.
Werden alle Merkmale, Eigenschaften und Verhaltensweisen aufgelistet, die Menschen von anderen Lebewesen unterscheiden und graduell auch mit ihnen verbinden, dann erscheint die Natur des Menschen in seiner Lebenswelt und mit seinen Lebensbedingungen erfasst: die conditio humana. Solche Verzeichnisse erstellen Humanbiologie, Physiologie, Anthropologie als Wissenschaft von der menschlichen Entwicklung, Humanethologie, medizinische Anthropologie, die sich um die »Ganzheit des Menschen« kümmert, Verhaltensforschung, Psychologie, Soziologie, Pädagogik, jeweils mit weiteren Forschungszweigen. Sie wollen feststellen und ergründen, was dem Menschen eigentümlich und wesentlich ist, was im Großen und Ganzen unverändert bestehen bleibt und mit Bedacht bewahrt werden muss. Außerdem wird geschichtlichen Prozessen nachgegangen, in denen Menschen sich ändern oder geändert werden, manchmal so sehr, dass Unterschiede zueinander viel mehr ins Auge fallen als ihre Gemeinsamkeiten. Beide Forschungsperspektiven können auch überlappen, etwa in der Humangenetik, die sich mit der menschlichen Erbmasse und möglichen Veränderungen beschäftigt, aber immer im Rahmen grundlegender Konstellationen. Auch die »strukturale Anthropologie« eines CLAUDE LÉVI-STRAUSS (1908-2009) rechnet mit Konstanten menschlicher Natur, die kulturellen Variablen Spielräume gewähren. So sehr auch die Theologie daran interessiert sein muss, dass Menschen sich nicht »widernatürlich« verhalten – in dem eben genannten Sinn von »Natur« – , kann die Natur des Menschen, die durch Vergleiche mit anderen Lebewesen ermittelt wird, nicht ihr Gegenstand sein. Denn auf diese Weise beobachtet und beschrieben werden kann nur, wie Menschen sich zu ihrer Umwelt und zu sich selbst verhalten und was ihnen dafür als angeboren und erworben zur Verfügung steht.
Ein anderer Zugang folgt religiösen Elementen im seelisch-geistigen Aufbau des Menschen: Menschen fühlen sich von einer Wirklichkeit gehalten, die sie ebenso trägt wie übersteigt. Solche Elemente begegnen bei Menschen in allen uns bekannten Zeiten und an allen Orten in verschiedenen Ausprägungen: Menschen fragen über sich selber hinaus und gelangen, wenn sie nur weit genug gehen, zu einer letzten Wirklichkeit, die sie »Gott« nennen mögen, die aber, weil sie der perspektivische Fluchtpunkt einer lebenslangen Suchbewegung ist, der äußerste Horizont aller Wirklichkeit wäre. So spricht WOLFHART PANNENBERG von Gott als dem »Gegenüber der grenzenlosen Angewiesenheit des Menschen«9: »Was für das Tier die Umwelt, das ist für den Menschen Gott: das Ziel, an dem allein sein Streben Ruhe finden kann und wo seine Bestimmung erfüllt wäre. «10 Eine solche Ausrichtung verwehrt jedem Menschen, der sich von ihr fortbewegen lässt, Vorläufiges für endgültig zu halten und an Vergänglichem haften zu bleiben – ein Impetus, der sich als Bildungsziel durchaus bewähren mag.
Was sich hier herausbildet, wird heute religionsphilosophisch vorzugsweise Gottesbeziehung genannt – von ferne vergleichbar mit einer Nabelschnur, die nährt und in einer Abhängigkeit hält, die ebenso trägt wie fordert: die Entwicklung bis zur vollen Reife hin, die diesseits der Todesgrenze nicht erreicht werden kann. Anders als bei der Geburt eines Menschenwesens, nach der die Nabelschnur zur Mutter abgetrennt wird, bleibt diese Symbiose erhalten, trotz aller tiefgreifenden Veränderungen in der Entwicklungsgeschichte eines Menschen.
Damit verbinden sich in der Regel zwei Vorstellungen, die einander stützen sollen: eine Grundstimmung der Geborgenheit, eines tiefen Daseinsvertrauens, das sich mit der Bereitschaft zu unaufhaltsamer Offenheit bewähren muss, die alle falschen Sicherungen durchschaut und sich nicht an eigenen Interessen festhält, sondern auch Verantwortung für die Bedürfnisse anderer übernimmt. Beides ruht letztlich in Gott – wie PAUL TILLICH (1886-1965) formulierte – als dem »letzten Grund« und verweist auf ihn als den »Sinn« und die »Tiefe des Seins«11. Diese Haltung darf bei allen Menschen vorausgesetzt werden. Sie prägt, wenn auch auf unterschiedliche Weise, jeden Menschen, der bestrebt bleibt, die Bestimmung der Menschlichkeit zu erfüllen.
Dieser Weg setzt bei dem Wesen des Menschen ein, das sich nicht aus seinen Lebensbedingungen erfassen lässt, und will beides übersteigen: hin zum Gottesbegriff als Inbegriff unendlicher und allumfassender Integration. »Gottesbeziehung« soll die Verbindung Gottes mit allen Menschen bezeichnen: eines namenlos wirksamen Gottes, der verschieden benannt werden kann, der aber nicht selbst Name ist wie der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Beziehung bedeutet ein wechselseitiges Verhältnis, ein » Verhältnis zwischen« mit Distanz und Nähe im Sinne von » Verbindung mit« – kein » Verhältnis zu«, keine Proportion. In unserer heutigen Lebenswelt eignen dem allumfassenden Begriff »Beziehung« eine einladende Verschwommenheit, eine unbestimmte Verpflichtung und ein vages Fluidum, die sich nicht fassen lassen, auch wenn versichert wird, Beziehung sei inhaltlich »gefüllt«, weil sie Zuwendung verspricht und als schöpferische Liebe Zusammenhalt stiftet. Verräterisch sind die Metaphern, die hier herangezogen werden, die nur benennen, auf was sie sehen, es aber nicht beschreiben, die schillernden Assoziationen, die »Beziehung« angenommen hat, der sozialtechnische Jargon, der hier die Alltagssprache durchsetzt: Beziehungen werden begonnen, unterbrochen, angeknüpft und abgebrochen, sie werden auf Widerruf eingegangen und sind krisenanfällig, sie können dramatisch enden, manchmal dämmern sie dahin und müssen aufgefrischt werden. Sind sie gestört, müssen sie entstört, ihre Bruchstellen aufgefunden und repariert werden. Auf dieser Sprachebene fehlen die Worte für alles, was sich nicht beziehungsmäßig relativieren und abschleifen lässt, zum Beispiel radikales Ende und völliger Neubeginn, unverbrüchliche Treue, zerstörerische Untreue oder Sündenerkenntnis in der Bitte um Vergebung. Würde eine Zeitlang auf den Beziehungs-Begriff verzichtet, dürfte sich bald zeigen, wie wenig er wirklich sagt und wie sehr er stattdessen zu Phrasen verführt. »Beziehung« wird zu einem trügerischen Zauberwort vor allem dann, wenn es die Struktur eines Wirklichkeitsganzen erfassen soll, in das alles deutend eingeordnet werden kann, was Menschen angeht: auch das Verhältnis des lebendigen Gottes zu menschlichem Leben und Sterben, zu Irrwegen und Umkehr, Abbruch und Neuanfang, Anfechtung und Hoffnung. »Gottlosigkeit« wäre dann lediglich relativ, ein vorläufig abgrenzender Begriff wie auch »Beziehungslosigkeit«, der nur mit Hilfe des übergeordneten Bezugssystems sinnvoll gebraucht werden könnte. Auf diese Problematik werden wir im Laufe der Darstellung immer wieder treffen. Sie zeigt, wo der religionsphilosophische Zugang zu einem Abweg wird.
Hier geraten wir in den Bannkreis religiöser Subjektivität: zum Ich, das seiner selbst umfassend bewusst ist, als Gegenstand oder zumindest als Referenzrahmen einer theologischen Anthropologie, vielleicht sogar der Theologie insgesamt. Ein solches Verfahren will sich auf die Subjektivität stützen: auf alles, wessen »ich mir selbst bewusst werde«, und auf das, was »ich in Erfahrung bringen kann«, wenn ich mit allen Außeneindrücken nur tief genug in mein Selbst eindringe. Eine solche Schulung kann zur Generalisierung verführen, sofern »ich« voraussetze, dass alle anderen zwangsläufig ebenso denken, weil sie dieselben Erkenntnisbedingungen mit mir teilen und ebenso wie ich zu denselben Erkenntnissen gelangen. Deshalb werden sie gleichermaßen wie »ich« ihr Dasein in Erfahrung bringen, auch wenn diese Erfahrung unterschiedlich ausfallen mag. Vielleicht kann »ich« sogar auch für andere sagen, dass und wie sie auf Gott bezogen sind.12
Geht Gott dagegen mit Menschen in eine Geschichte ein, dann tritt er in Beziehung zu ihnen. So beginnt ein anderer Weg als jener zum integrativen Gottesbegriff. Jetzt redet Gott einen Menschen namentlich mit »Du« an, er eröffnet ihm dadurch, antwortend »ich« zu sagen, den Gottesnamen anzurufen und sich damit dem Handeln Gottes in seiner ganzen Vielfalt auszusetzen. Die unergründliche und unabsehbare Geschichte Gottes mit den Menschen setzt einzelne Lebensgeschichten frei, die »richtig« erzählt werden wollen: Was geschieht mit Menschen, die mit der Geschichte konfrontiert werden, die Gott mit anderen Menschen eingegangen ist – in besonderer Weise mit seinem Volk? Was ist Menschen geschehen, die nicht mehr anders können, als dass sie zu Gott reden und so von Gott und von Menschen? Wie verhält sich Gottes Zuwendung zum Menschen zu dessen Abwendung von Gott? Wie sieht ein Mensch seine bisherige Geschichte, die er erinnert, wenn Gottes Geschichte sie berührt, ja sogar durchkreuzt, so dass sie jetzt anders als bisher wahrgenommen werden will? Warum geht ihm die Tragweite der Frage »Was ist der Mensch?« neu auf? Dies alles treibt zum Nach- und Mitdenken: nicht zuletzt zur Frage danach, ob und wie auch wir darin einbezogen sind – und zwar so, dass wir in die Klagen und Anklagen dieser Menschen, in ihre Bitten an Gott und Lobpreisungen Gottes einstimmen können?
Die Innenspannung des Redens zu Gott und dessen, was sich hier als Geschichte von Menschen abzeichnet, gehört zum Gegenstandsfeld theologischer Anthropologie.
Gott kann Menschen auch unausdrücklich ansprechen: etwa indem die Zeitlichkeit ihres Erlebens und Handelns ihnen die Frage nach dessen Rechtzeitigkeit aufdrängt, in der Gottes schöpferisches Wirken verborgen ist (Kap. 4.2); oder indem die Selbstverstrickung des Lebenswillens zerrissen wird (Kap. 5.1); oder wenn das Gedenken sich nicht mehr im Gedächtnis verläuft (Kap. 11.1).
Ein dritter Zugang bietet sich im Unterfangen an, ein christliches Menschenbild zu zeichnen und sich an dieses Bild zu halten, um im Gestrüpp der Meinungen über den Menschen einen Kurs zu verfolgen, der sich durch Jahrhunderte hindurch bewährt zu haben scheint und von dem daher auch in Zukunft nicht abgewichen werden sollte. Die Berufung auf den Menschen als »Ebenbild Gottes« scheint einen solchen Eindruck nahe zu legen. Dieses Bild soll sämtliche Charakterzüge in sich vereinigen, die sich in biblischen Erzählungen und Reflexionen wiederholt finden und die sich in der Geschichte des Christentums als typisch herausgestellt haben – nicht auf Christen eingeschränkt, sondern für alle Menschen gültig, wenn auch nicht von allen und jederzeit ernst genommen.
Bilder des Menschen zeigen im kulturgeschichtlichen Wandel, was in Darstellungen und Selbstdarstellungen als charakteristisch hervorgehoben werden soll; so kann etwa versucht werden, den typisch »hebräischen Menschen« zu zeichnen. 13 Davon zu unterscheiden, aber auch nicht reinlich zu trennen, sind Menschenbilder als normative Anschauungen. Derart wird das christliche Menschenbild für christliche Ethik oder für eine dem Christentum noch verbundene Politik in Anspruch genommen. Heute erscheint es zumeist darauf reduziert, dass jeder Mensch als Person von Gott mit unantastbarer Würde begabt ist, die Entscheidungsfreiheit und Verantwortlichkeit im Gefolge hat. Dieses Menschenbild soll als Leitbild dienen und zur Profilierung des Christlichen in einer pluralistischen Gesellschaft verhelfen. Für solche Zwecke mag es brauchbar sein, auch wenn es schwierig sein dürfte, es bildhaft anschaulich werden zu lassen – etwa im Kontrast zum marxistischen Menschenbild, das an Anschaulichkeit kaum zu überbieten sein dürfte und das gleichwohl auf tönernen Füßen steht: Der prometheische Mensch, mit dem Zirkel in der einen Hand und dem Maschinenhebel in der anderen, mit angespannter Aufmerksamkeit und voller Energie, Mittelpunkt und zugleich Bestandteil der gestaltungsbedürftigen und veränderungsfähigen Materie.
Auf dem Weg zu einem christlichen Menschenbild soll abgeschritten werden, womit Menschen von Gott als ihrem Schöpfer ausgestattet worden sind: Menschen, die sich getreu der biblischen Tradition und ihrer Wirkungsgeschichte als geschaffene Wesen verstehen. Darauf zu achten und dafür dankbar und verpflichtet zu sein, besteht Grund genug: Menschengeschöpfe haben sich nicht selber hervorgebracht und verdanken sich nur in biologisch-geschichtlicher Hinsicht ihren Eltern. Kraft seiner Sprache kann der Mensch Dinge und Sachverhalte benennen und zeichenhaft repräsentieren. Darauf beruht seine Verständigung mit anderen Menschen, und sie ermöglicht ihm, Gott anzusprechen, ihn zu vernehmen, ihm zuzustimmen oder ihm sogar zu widersprechen. Auf die Sprache angewiesen ist auch die Vernunft, die Empfänglichkeit des Denkens, mit der der Mensch seine körperlichen Grenzen in gewissem Maße zu überschreiten vermag, ohne sie zu verlassen. Mit dem Verstand klärt er, was er mit allen seinen Sinnen aufnimmt, und lenkt seine Wissbegierde in die rechten Bahnen. Fühlend und denkend findet er sich in einer oft unübersichtlichen Umwelt zurecht. Frei ist er, das Gute und Rechte zu wählen und zu erproben, denn Gott führt ihn nicht am Gängelband, sondern gewährt ihm eine selbständige Willensbildung und lässt ihm die Freiheit, sich zwischen den Möglichkeiten zu entscheiden, die ihm offen stehen. Deswegen ist er aber auch rechenschaftspflichtig für sein Tun und Lassen. Dafür bedarf er der Schuldeinsicht, die in unerbittlicher Selbsterkenntnis im Gewissen verankert ist, einer Selbsterkenntnis, die nicht in eine skrupulöse Nabelschau umschlagen darf. Die Einsicht, auf andere Lebewesen angewiesen und für sie verantwortlich zu sein, schützt ihn vor einer egozentrischen Haltung. Um seine Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen tragen zu können, bedarf er der Versöhnung mit Gott, mit anderen und mit sich selbst. Versöhnung bewährt sich in der Vergebung, mit der er anderen schuldig Gewordenen weitergibt, was er empfangen hat. Ebenso wie seine Geburt ist sein Tod seiner Verfügung entzogen – beide bleiben Geheimnis seiner Zugehörigkeit zu Gott, die ewiges Leben verspricht.
Die charakteristischen Züge des christlichen Menschenbildes können uns einer theologischen Anthropologie näher bringen, sofern sie einzelne und jeweils fragmentarische Ansichten vom Menschen festhalten, die die Christenheit aus verschiedenen Gründen im Gedächtnis behielt und weiterhin bewahren sollte. Doch dies gerade nicht, um erfassen und katalogisieren zu wollen, wie der Mensch von Gott gleichsam gebaut und angelegt ist: Der Mensch hat dies, ihm eignet jenes, er ist durch dies und das ausgezeichnet, er ist zu diesem und jenem befähigt, ihm ist es angeboren und er kann daraufhin angesprochen werden.
Auf dem Wege zu einer theologischen Anthropologie dürfen wir nicht dem folgen, was Menschen an sich anschauen können, auch wenn sie noch so tief in sich gehen und sich zu einer ausgreifenden Ahnung von allem ausstrecken, was ihnen gegeben und aufgegeben ist. Auch dies wäre ein Abweg für eine theologische Anthropologie, sogar ein besonders trügerischer. »Du sollst dir kein Bildnis von mir machen«, hat Gott geboten (Ex 20,4). Dürfen wir uns ein Bild vom Menschen machen, den Gott sich ihm »ähnlich« erschaffen hat (Gen 1,26)? Das Gebot, sich kein Gottesbild zurechtzuzimmern, richtet sich gegen Götzenbilder aller Art. Ein Menschenbild müsste zwar nicht sogleich ein Götzenbild sein. Aber wie jenes wird es verfertigt, damit Menschen sich daran halten und sich so ihrer selbst versichern können. Es kann allzu leicht zum Selbstbild des sich selber erhöhenden und derart vergötzenden Menschen missraten: er erbaut sich an sich selber, samt allem, was ihm gegeben und aufgegeben ist und was er aus sich gemacht hat. Eine theologische Anthropologie sollte sich nicht als Bilderstürmerei gebärden, aber sie kann allein der Spur des wahr werdenden und nur so wirklichen Menschen nachgehen, auf dem Weg, den Gottes Menschwerdung bereitet hat: Gott machte durch die Menschwerdung Christi, »die im Glauben vorangetrieben wird, aus unseligen und hochmütigen Göttern [sich selbst vergötzenden Menschen] wahre [wirkliche] Menschen, d. h. Elende und Sünder«, die Christus »gleichförmig gemacht und gekreuzigt werden.«14
Die Menschwerdung Christi schneidet in alle evolutionären Entwicklungen kollektiver und individueller Natur ein. Hier ist Gott in eine Geschichte nicht nur mit einzelnen Menschen, sondern mit der Menschheit eingetreten, hautnah und verletzlich, auf andere Weise noch als bei seiner Erschaffung des Menschen, beim Bund, den er zur Erhaltung der Welt geschlossen hat, und dem Segensbund mit den Verheißungsträgern für die Menschheit. In der Geschichte Jesu Christi tut sich Gottes Menschlichkeit kund: in der Geburt des wehrlosen Kindes, das nicht nur überschwengliche Freude an Gottes Gegenwart auf sich zieht, sondern sogleich auch den mörderischen Widerspruch gegen diese Gegenwart. Allzu menschlich ist, dass Jesus der Versuchung unterzogen werden kann, sich nicht mehr Gottes Handeln aussetzen zu müssen, dass er keine Bleibe findet, dass ihn Todesangst überfällt und dass er dem Sterben nicht entnommen wird. Und doch leuchtet in dieser Geschichte von Anbeginn an die Klarheit Gottes auf (Joh 1,14), seine Gegenwart in menschlicher Natur, der Ursprung des verborgenen Lebens, das nicht auf den Tod zuläuft, nicht von ihm verschlungen wird und auch nicht einem Jenseits des Todes vorbehalten bleibt. Der menschgewordene Gott bewahrheitet die Menschlichkeit – als die Gestalt des wahren Gottes, nicht als verkörpertes Menschenbild. Diese Menschlichkeit begründet, wahrhaft Mensch zu sein und zu bleiben – die Menschwerdung des Menschen.
Wenn es ein wahrhaft christliches Menschenbild geben sollte, dann könnte es Züge der Maria mit ihrer Empfänglichkeit, des verlorenen Sohnes, der sich selber überlassen sein wollte und unverdiente Güte erfuhr, des hoffnungslos toten Lazarus, des zweifelnden und verleugnenden Petrus, des Paulus mit seiner körperlichen Schwäche und seinem aufgestörten Geist tragen – und noch vieler, vieler anderer mehr. Wessen werden sie gewürdigt? Wie hat Gott an ihnen und mit ihnen gehandelt? Nur dergleichen kann uns auf den Weg zu einer theologischen Anthropologie bringen, auf den Weg, der uns im biblischen Reden vom Menschen gewiesen wird.
Die Bibel ist der maßgebende Zugang zur theologischen Anthropologie, weil sie sich jedem Zugriff verweigert : dem Zugriff auf alles, was als Gottes Handeln an Menschen und mit ihnen geschieht. Nur wenn wir uns in das biblische Reden vom Menschen finden, können wir uns in ihm wiederfinden.
Weder durch eine Außenperspektive noch durch eine Innenschau wäre dies möglich: weder indem wir Menschen darauf ansehen, was für das Menschsein typisch sein könnte (von dem wir schon hinreichend viel wissen müssten, damit wir die Anzeichen dafür recht deuten können), noch indem wir versuchen, uns von innen her aufzuschließen.
Als Zugang zur theologischen Anthropologie will die Bibel weder als Kompendium des christlich-jüdischen Menschenbildes gelesen werden noch als Dokument religionsgeschichtlicher Entwicklung menschlichen Selbstverständnisses in einer Region Vorderasiens oder als Sammlung religiöser Verarbeitungen von Befindlichkeiten und Erlebnissen. Wie die Bibel gelesen wird, ist selber ein anthropologisch gehaltvoller Vorgang.
In der Bibel reden Menschen oder wird von Menschen geredet, die auf verschiedene Weise ihrer Selbstreferenz entzogen werden : durch Gottes Anrede, seinen ausgesprochenen Willen, seine Weisung und Zurechtweisung, seine Verheißung und sein gestaltendes Wort, sein schöpferisches Urteil. Was derart an Menschen und mit ihnen geschieht, was sie werden, warum und wie sie dann davon und von sich selbst reden – dafür will die Bibel transparent werden, um uns ins Licht der Geschichte Gottes mit den Menschen zu stellen.
»Uns«: hier wird es unerlässlich, »wir« zu sagen – nicht als Stilmittel, das die Darstellung auflockern und die Leser an ihr beteiligen will. Das Wir ist ein Kennzeichen theologischer Anthropologie, sogar eine notwendige Bedingung dafür, auch wenn es nicht immer ausgesprochen wird. Dieses Wir zeigt an, dass sich Menschen finden und zueinander finden: als Geschöpfe und als Gerufene, denen eine Verheißung zuteil geworden ist und die in begründeter Hoffnung einander zugewandt sind. »An diesem ›wir‹ ist nicht das Gefühl der Zusammengehörigkeit oder das Eintreten von ›Identität‹ entscheidend, sondern der damit gegebene Ort, das zu hören und zu erfahren, was Menschen sein dürfen.«15 Sie haben an einer Einheit teil, die ihnen voraus ist, die sie nicht geschaffen und gebildet haben. »Theologisches Urdatum ist im Alten Testament nie der Mensch, sondern das Volk, die heilige Erwählungsgemeinde«,16 im Neuen Testament die Teilhabe am Leibe Christi17 und an seiner Geschichte. Das Wir in einer theologischen Anthropologie hat eine bestimmte Gestalt, vor aller Rhetorik und jenseits ihrer: die Lebensform des Gewärtigseins von Gottes Handeln und der Einstimmung in dieses Handeln. Dass das Wir der Glaubensgemeinschaft keinesfalls gegenüber »dem Menschen« abgeschottet ist, dass hier tiefe, oft auch schmerzhafte Einblicke in das Menschsein schlechthin gelingen – daran zeigt sich die überraschende Dynamik theologischer Anthropologie und ihre Innenspannung, die manchmal verstören kann.
In der Gemeinschaft des Glaubens können Menschen einander zusprechen, was Gott ihnen gemeinsam – und über sie hinaus ! – bereitet hat und zumuten will. Sie können einander und andere aufrichten, ermutigen, hoffnungsvoll zurechtweisen und trösten. So kann dieses Wir auch – auf unauffällige Weise – dem Umstand Rechnung tragen, dass kein Mensch durch Bestandsaufnahmen erfasst werden kann, denn viel zu viel bleibt an ihm und für ihn selber im Dunkel; auch die Sondierung seines Vor-, Unter- und Unbewussten wird ihn nur partiell erschließen können. Was er wirklich ist, kann und will Gott allein ihm zusagen.
In diesem Wir finde »ich« »mich« in spezifischer Weise wieder: »Ich« spreche zu anderen und von anderen in der Hoffnung, die ich selber niemals einlösen kann: dass wir von Gott her und auf ihn hin eines Geistes sein werden. Ein Ich, das sich nur selber reflektiert, sich daraufhin auch anderen mitteilt und sich durch ihr Einverständnis zu bestätigen sucht, wäre dagegen in einer theologischen Anthropologie fehl am Platze. Wir werden noch öfter darauf stoßen, wie klärungsbedürftig es ist, hier »ich« zu sagen. Im englischen Sprachraum bereichert die Unterscheidung zwischen »I« und »me«, die helfen kann, die Fixierung auf ein selbstgenügsames, nur selbstbezügliches Ich zu vermeiden.18 »Ich« kann in einer theologischen Anthropologie Redesubjekt sein oder konfessorisches Ich; im Akt der Selbstwahrnehmung werde »ich« » mir« gegenübergestellt, aber »ich« als Subjekt und Objekt werden nicht durch »mein Selbst« umgriffen. Dies alles gehört zur Sprachkultur der Beschreibung aus einer Distanz, die »ich selber« nicht gewonnen habe und auch nicht aufrechterhalten kann, die aber auch nicht erlaubt, »mich« von » mir selbst« zu distanzieren.
Jede Anthropologie wird, für sich genommen, ein problematisches Unterfangen bleiben – eine theologische zumal. Darum trägt dieses Buch den Untertitel »Eine theologische Anthropologie«, nicht etwa, weil es einer unter vielen möglichen Beiträgen wäre – das ist es sicherlich auch –, sondern weil der Titel »Die theologische Anthropologie« undenkbar ist. Er würde ja versprechen, was er niemals halten kann: eine Erfassung des Menschseins gemäß einer Logik, die nicht den Logos zu umklammern vermag, der die Theologie begründet, während es der Theologie auch versagt ist, diese Logik überwölben zu wollen.
2. Wegweisende Einsichten
Äußerungen angesichts des vielfältigen Handelns Gottes haben immer wieder zu möglichst genauen Beobachtungen veranlasst und angeleitet, zu begleitenden Beobachtungen, denen ich in meiner Darstellung nachkommen möchte. Vorweg sollen hier nur einige Themen angekündigt werden, die für eine theologische Anthropologie charakteristisch sind und die in verschiedenen Kontexten wiederkehren.
Beobachtungen des Menschseins finden sich in größerem Umfang in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur, besonders bei Kohelet, dem »Prediger«. Seine kritischen Einsichten und seine dankbare Selbstbescheidung beeindruckten auch Bibelkundige außerhalb von Synagoge und Kirche. Diese »Weisheit« vertraut darauf, dass Gottes Handeln mit der Struktur der Wirklichkeit konvergiert. Wer die Ordnung aller Dinge wahrhaft einsieht, kann auch »ordentlich« leben, ohne vermeidbare Störungen: nicht etwa spießbürgerlich, sondern umsichtig und offen für alles, was wirklich möglich sein kann. Wem die Struktur der Wirklichkeit einsichtig geworden ist, kann mit der Verlässlichkeit seiner Lebenswelt rechnen. Kohelet zeigt – besonders eindrücklich in seiner Beobachtung der Zeitlichkeit menschlichen Erlebens und Handelns (Koh 3,1-15) – die Begrenzung solchen Vertrauens durch Grenzen, die uns Menschen in all das einweisen, was wir empfangen und wofür wir uns entscheiden müssen (s. Kap. 4.1). Wenn wir sehen, was jeweils »an der Zeit« ist (etwa Saat oder Ernte, Freude oder Trauer, sogar Friede oder Krieg), kann Lebensfreude in jedem gewährten Augenblick erwachen und wachsen.
Was aber bleibt, wenn diese Grenzen scheinbar immer mehr zusammen rücken, wenn der Lebensraum enger und enger wird – wie für Hiob? Er wehrt sich mit allen Kräften, die ihm trotz Krankheit, Verlust und empfundener Ungerechtigkeit noch geblieben sind, dagegen, das Leid, das ihm widerfahren ist, als Bestandteil einer gottgesetzten Ordnung zu begreifen, mit deren Hilfe er sich zurechtfinden könnte – heute würden manche wohl sagen: dem Leid einen Sinn abzugewinnen oder ihm gar einen Sinn zu geben. Für Hiob ist lebensfreundliche Dankbarkeit nicht mehr erschwinglich. Seine wohlmeinende Frau und die Freunde, die auf jede Frage eine religiöse Antwort bereit haben, legen Hiobs Schrei nach Gottes Gerechtigkeit als Eigensinn aus und reden ihm ein, Gründe für sein Unglück in eigenem Verschulden zu suchen, sein Verhalten zu bessern und dadurch sein Leiden zu bewältigen. Je unbeugsamer Hiob darauf mit einem bloßen »Nein!« reagiert und jede weitere Antwort abschneidet, desto eingehender stellt er sich vor Gott bloß. Ihn ruft er klagend, ja anklagend an, er will sich vor ihm verbergen und kann doch nicht von ihm lassen, er sucht den Tod und sieht sich dadurch noch mehr auf sich selbst zurückgeworfen. Erst als Gott ihm sozusagen den Kopf zurechtsetzt und seinen Blick auf die Schöpfung in all ihrer Unbegreiflichkeit lenkt (38,1- 40,2), vermag er Gottes Handeln dort wahrzunehmen und braucht sich nicht mehr auf ein Hörensagen zu verlassen (42,5). Welch ein Prozess des Redens zu Gott und von Gott, in dem Schritt für Schritt enthüllt wird, was »Geschöpf sein« bedeutet und in sich schließt! Sich als Geschöpf wahrzunehmen – das braucht nicht immer so dramatisch kenntlich zu werden wie bei Hiob. Er aber lehrt uns, wie vom Menschen vor Gott, zu ihm hin und von ihm her zu reden ist: im Verhältnis des Geschöpfes zu seinem Schöpfer. Allerdings ist das Wort »Lehre« viel zu schwach, als dass es wiedergeben könnte, was Hiob am eigenen Leibe erfährt und ihn bis an die äußersten Grenzen menschlicher Sprachfähigkeit treibt! Hiob ist – obwohl oder gerade weil er ohne erkennbare Zugehörigkeit zum Gottesvolk spricht – der Mensch schlechthin, wie er sich in Gottes Handeln findet, wie er in diesem Handeln ebenso geborgen ist wie von ihm verwundet und geheilt, getötet und lebendig gemacht wird.
Wenn die alttestamentliche Weisheit vom Einzelnen spricht, scheint sie den alttestamentlichen Propheten fern, die vom Handeln Gottes in der Geschichte und mit seinem Volk zu reden haben. Doch auch ein Prophet wie Jeremia kann nicht übergehen, wie verletzend Gott in sein Leben eingegriffen hat und was ihm daraufhin als Einzelnem widerfuhr (Jer 8,18-23; 12,1-5; 15,16-21; 20,7- 9.14 - 18). 19 Auch ein wider seinen Willen Berufener, der sich ausgesondert fühlen muss, bleibt ein Geschöpf wie alle anderen, doch an ihm wird für viele andere vernehmbar, dass kein Mensch von Gott einfach »hergestellt« worden ist, sondern immer wieder von Gottes Hand geformt und gestaltet wird wie ein Tonklumpen. Wie er dies so verspürt, dass er davon nicht schweigen kann: auch dies gehört zu seiner Berufung. Eine solch schöpferische Konfrontation mit der Lebenswirklichkeit – wie harmlos nimmt sich so manche geläufige Auffassung von »schöpferischer« Tätigkeit dagegen aus! – ist wie ein Wetterleuchten am Horizont theologischer Anthropologie.
Wenn der Apostel Paulus von sich selber spricht, dann gleicht der Fluss seiner Rede einem Wildbach mit Klippen und Strudeln: Ausdruck dafür, dass ein Mensch, den Christus in seine Geschichte mitreißt, seiner selbst nicht mehr mächtig ist – und gerade so ungeahnte Dimensionen zur Sprache bringt:
– in Röm 7,14-25 eine Selbstwahrnehmung, die ihrer heillosen Zwiespältigkeit innewird, weil der Strahl der Erlösung sie getroffen hat;– in Gal 2,19 f. die Unmöglichkeit, mit dem simplen »Ich« eines Redesubjektes einfach fortzufahren, wo Paulus sich selber ins Wort fällt, weil Christus den Raum seines bisherigen Ich einnimmt;– in 1 Kor 7,31 ein neuer Sinn für Ende und Neuanfang, die nicht mit Werden und Vergehen in Einklang stehen, eine Urteilskraft, die unterscheidet, was endgültig ist, von dem, was zu Ende geht;– in Phil 2,12bf. die Fassungslosigkeit eines Menschen, der Gottes Handeln ausgesetzt wird, dem sich menschliches Wollen ebenso verdankt wie das Vollbringen, ohne dass beides oder eines von ihnen dem Menschen abgenommen würde.Was Paulus daraufhin von sich erzählt und wie er sich zu beschreiben versucht, lässt sich nicht auf eine Reihe bringen (2 Kor 6,4-7). Der Apostel stolpert von einem Paradox ins andere (2 Kor 4,7-12; 6,8-10), denn sein Erscheinungsbild deckt sich nicht mit der Kraft, die in ihm mächtig ist (2 Kor 12,9). Was er von sich selber zu sagen hat, wird zur Verkündigung der Gnade Gottes, die im Geschick eines Menschen ihre Spuren hinterlässt, aber kaum jemals so, dass sie als solche ins Auge fällt. Wie oft erscheint sie als Widerspruch zu dem, was wir ihr zuschreiben möchten! Doch gerade so durchstrahlt sie ein Menschenleben, das sich dessen gar nicht recht bewusst werden mag, weil es diese Klarheit sozusagen im Rücken hat, aber nicht demonstrieren kann.
Einer theologischen Anthropologie würden solche Äußerungen entzogen, wenn sie historisiert werden: eingeordnet in einen Lebenslauf, der in seiner Entwicklung rekonstruiert werden soll. Eine solche Biographie könnte vielleicht ein Muster für ähnliche Erfahrungen abgeben, etwa für Bekehrungserlebnisse und für die typischen Schwierigkeiten, sich mit der eigenen religiös geprägten Vergangenheit auseinanderzusetzen, ohne alle Brücken zu ihr abzubrechen.
Wie ist beispielsweise Röm 7,14-25 zu verstehen, wo Paulus von der Macht der Sünde spricht, der kein Mensch entrinnen kann, die ihn vielmehr so gänzlich beherrscht, dass er in Übereinstimmung mit ihr existiert? Hier wird anscheinend auf den Bann einer Unfreiheit zurückgeblickt, der gebrochen worden ist – doch dann erhebt sich doch wieder die Klage über Selbstwiderspruch und Selbstentfremdung, die offensichtlich immer noch lebendig sind, aber sie behalten nicht das letzte Wort, sondern die Klage wird unvermittelt aufgehoben durch den Dank für die Errettung. – Die Reformatoren, allen voran MARTIN LUTHER (1483-1546), haben hier den Menschen von Gott gezeichnet gesehen, wie er »Sünder und Gerechter zugleich« ist: in einer Gleichzeitigkeit, von der anders gesprochen werden muss, als es eine geschichtliche Betrachtungsweise vorsehen kann, die sich mit der Abfolge von Geschehnissen beschäftigt. Luther hat allerdings, trotz seiner theologischen Nähe zu Paulus, den Akzent verschoben: Weil er so sehr betont, dass Gott seine Gerechtigkeit dem Gottlosen mitteilt, kann er auch den Christen und dessen »gute Werke« nicht von der Sünde ausnehmen.20 Denn nur wenn Gottes Gerechtigkeit den ganzen Menschen in der Tiefe seines begehrlichen Wollens trifft, nicht nur einzelne verwerfliche Taten, kann das Leben zur Buße werden, mit der sich ein Mensch ganz und gar Gottes Urteil und der Verheißung seiner Treue anheimstellt. Darum schärft Luther den Blick dafür, dass gerade der Fromme zum willigsten Opfer der Selbstgerechtigkeit werden kann.
Die Frage, von wem Paulus in Röm 7 spricht – von sich selber, wie er früher war und was er jetzt sein kann, oder nur von sich heute oder von einem fiktiven Ich, in dem sich jeder wiederfinden kann –, wird dadurch nur noch dringlicher. In der Exegese hat sich weithin die Auskunft durchgesetzt, Paulus greife zu einer Stilfigur: Ein Ich spricht für alle, weil es alle angeht; es redet von seiner Verstrickung in die Sünde, die als Entfremdung aufgedeckt worden ist und damit ihre Macht verloren hat, deren aber kein Mensch Herr werden kann, wenn sein Wille nicht neu ausgerichtet wird.
Kann so aber »eine Schilderung des Nichtchristen vom christlichen Standpunkt aus«21 entstehen? Dies ist eine weitreichende Frage für eine theologische Anthropologie, auch abgesehen von der Auslegung von Röm 7,14-25. Wie könnte ein »Nichtchrist« anders geschildert werden als mit Hilfe eines Fremdbildes (»Nichtchrist«), das als ein Gegenbild zum Selbstbild ausgemalt wird? Auch eine rückschauende Selbstbetrachtung (des »Christen«) wäre eine solche Projektion. Oder werden erschreckende Züge des Fremden im Selbstbild entdeckt, die ahnen lassen, wie wenig ein jedes Ich, wenn es jetzt sich selber betrachtet, seine Vergangenheit abschütteln kann? Wie viel hat es mit Anderen gemein, von denen es sich fernhalten möchte! Wie auch immer – es sind keine theologisch gehaltvollen Einblicke. Kann es überhaupt gegenüber der Mitteilung von Gottes Gerechtigkeit einen menschlichen »Standpunkt« geben oder wechselnde Perspektiven (etwa: einmal Sünder, ein andermal Gerechter)?
Für derlei Befunde bieten sich psychologische Analysen an, doch sie können nur klären helfen, wenn sie nicht mit Erklärungen Paulus das Wort abschneiden, mit Erklärungen, die überdies so verschieden ausfallen können, wie die psychologischen Theorien, auf denen sie beruhen. So wird etwa der zentrale Satz »Ich lebe – doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir« (Gal 2,20a) einmal als Korrektur der bewussten Einstellung des Apostels zu sich selber durch sein Unbewusstes gedeutet,22 ein andermal als Selbstinterpretation, die Paulus durch die erinnerte Christusbegegnung verändert. 23 Der religiöse Gehalt solcher Erklärungen läuft auf eine Selbstprüfung mit dem Ziel einer Selbstheilung hinaus. Damit stehen sie einer theologischen Anthropologie entgegen, die sorgfältig auspeilen muss, wie die Redeweise des Apostels sich zu dem verhält, was er theologisch zu sagen hat. Dies könnte auch psychologisch erhellend sein.
Die »Bekenntnisse« des AURELIUS AUGUSTINUS (aufgezeichnet 397-401) wurden zum klassischen Beispiel für die Einkehr eines Menschen in sich selbst – für viele ein Muster zur eigenen Selbstbeobachtung, für andere ein abschreckendes Beispiel christlicher Introvertiertheit. Darüber ist hier nicht zu urteilen. Viel wichtiger dürfte es sein, darauf zu achten und mit zu vollziehen, wie Augustin versucht, sich vor Gott zu erkennen und sein Leben im Zusammenhang der Geschichte Gottes mit den Menschen zu erzählen. Dabei gelingen ihm unter anderem Einsichten in die Zeitlichkeit des Menschen, die philosophisch und psychologisch ausgewertet worden sind, dann meistens abgelöst von Augustins theologischer Entdeckung des Zeitbewusstseins (Confessiones X und XI).
Augustins Selbstwahrnehmung bleibt unverständlich, wenn die Gebete übersehen werden, die sie nicht nur begleiten, sondern klären. Seine Rechenschaft über sich selbst wird immer wieder durch die Anrufung Gottes durchbrochen und kann erst daraufhin weitergehen. Dies macht uns auf Sprachformen aufmerksam, auf die eine jede theologische Anthropologie angewiesen bleibt, will sie sich nicht ihre Wurzeln in dem Nährboden abschneiden, der ihr neue Kräfte gibt und dem sie es verdankt, wenn sie lebendig bleiben kann. Neben dem Gebet in seinen verschieden Formen – Klage, Bitte, Fürbitte, Dank und Lobpreis – sind es Bekenntnisse, auch sie in verschiedener Form: als Sündenbekenntnis und als Doxologie, in denen sich – im Unterschied zu einer Autobiographie – Menschen so rückhaltlos aussprechen, weil sie nach der Wahrheit ihres Daseins Ausschau halten. Eine theologische Anthropologie darf davon nicht abstrahieren, auch wenn ihre Sprache nicht direkt die eines Gebetes oder eines Bekenntnisses sein kann.
Augustins Gebete in seinen Confessiones sind zumeist dem Psalter entnommen. 24 Psalmen gehören zur Fundgrube theologischer Anthropologie, wie sich bei Augustin besonders eindrück lich zeigt. Sein Denken war griechisch-philosophisch geschult, vor allem vom mittleren Platonismus geprägt, doch gerade sein Reden vom Menschen verdankt sich dem Psalter und dessen Realismus bei der Umschreibung menschlicher Hinfälligkeit, leibhaftig spürbarer Not, die keine Substanz unberührt lässt, Verstrickung und Selbsttäuschung, des Sterbens in der Gottesferne. Ebenso hautnah versetzt der Lobpreis in eine neue, hoffnungsvolle Situation, auch wenn die Bedrohung noch andauert, und Dankbarkeit lässt sichtlich aufatmen. Und in den Psalmen können sich viele Menschen zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Lebenslagen wiedererkennen. Es sind nicht bloße Muster, von denen wir diejenigen zur Hand nehmen und ausfüllen können, die uns für einen bestimmten Zweck passend erscheinen. Wer sie regelmäßig betet – wie Augustin und später Luther, der diese monastische Übung nie hinter sich ließ, ebenso wenig wie viele andere auch, denen sie Einsicht in Tiefen und Untiefen des Menschseins vermittelten –, der wird seiner selbst in anderer Weise gewahr, als es ohne sie möglich wäre. Gebete werden ja nicht einfach nachgesprochen, sondern sie werden mitgesprochen, und durch dieses Mitsprechen und Einstimmen gewähren sie unzählig vielen eine Gemeinschaft über zeitliche und räumliche Grenzen hinweg: auch dies ein Hinweis auf die universale Reichweite dessen, was einer theologischen Anthropologie zu sagen anvertraut wird. Wo theologisch wahrgenommen wird, was »der Mensch« ist, da geschieht es in aller Regel so, dass wiederholt werden kann, was andere Menschen zu Gott hin gesagt haben, und diese Wiederholung wird erneut zur Anrufung, die neue Erkenntnis zu bilden vermag. Die Sicht der eigenen Geschichte, eingefasst in Gebete und mit ihrer Hilfe gestaltet, kann neu ausgesprochen werden und zu Entdeckungen am eigenen Dasein führen. Beter und Bekenner sind »Menschen wie du und ich«, die zu Gott sprechen und in eins damit von sich selber reden, vielleicht nicht immer im selben Atemzug, aber doch in ein und demselben Duktus. Sie finden sich im Reden von Gott selbst vor, und zwar in höchsteigener Weise – und zugleich so, dass sie vom Menschen schlechthin sprechen können: deshalb, weil sie sich in einer gemeinsamen Geschichte mit anderen Menschen wissen, in der Begegnung mit der Geschichte Gottes mit den Menschen.
Die anthropologischen Einsichten Augustins und die vieler anderer wären ohne intensives Leben mit Psalmgebeten undenkbar – ebenso undenkbar ohne extensives Bibellesen, wobei das Lesen größerer Zusammenhänge besonders fruchtbar ist, auch weil es vermeiden hilft, dass aus einigen wenigen Belegtexten Folgerungen gezogen werden, die viel zu weitreichend sind. So konnte eine falsch verstandene Bibeltreue Augustin auf Abwege führen: zum Beispiel, wenn er sich unter Berufung auf 1 Kor 11,7 darauf versteifte, dass die Frau dem Mann untergeordnet sein müsse, weil dort nur der Mann imago Dei, »Gottes Ebenbild«, genannt wird, nach dem die Frau sich zu richten habe. Das widersprach der unmissverständlich klaren Aussage der Schöpfungsgeschichte, in der Mann und Frau gleichermaßen als Bild Gottes ausgezeichnet werden (Gen 1,26 f.). Dies stand Augustin durchaus vor Augen, und er suchte es in der Regel auch zu beachten und sich vor allem danach zu verhalten.25 Dennoch geriet er in einen Begründungskonflikt, der oft zugunsten einer patriarchalisch eingefärbten Anthropologie entschieden wurde, denn diese bestimmte die Stellung der Frau zur Zeit Augustins ebenso wie lange vorher und nachher. Auch wenn Augustin Fähigkeiten und Tugenden von Frauen höchste Achtung entgegenbrachte, scheint dies für seine theologische Anthropologie kaum etwas ausgetragen zu haben – wenn wir allein darauf blicken, wie er sein Menschenbild psychologisch unterfütterte: mit Anleihen aus der antiken Auffassung menschlicher Fähigkeiten. Wie jene dachte er an eine Hierarchie der Steuerung: die männliche Willenskraft ist imstande, das als weiblich empfundene Gefühlsleben zu lenken, aber die Gefühle von Frauen haben keinen Einfluss auf den Willen des Mannes.
Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass und wie Augustin immer wieder versucht hat, auf das biblische Reden vom Menschen zu achten und viele seiner Vorurteile dadurch stören zu lassen. Vor allem lassen sich seine Einsichten in das Menschsein – in den Confessiones in die Gedächtnisleistung und ihre Komplikationen, die wir noch eigens bedenken werden (Kap. 11.1) – nicht von seiner Anrufung Gottes im Gebet abschneiden, jedenfalls nicht für eine theologische Anthropologie, denn dann würden sie wie Schnittblumen bald verwelken.
Als MARTIN LUTHER 1538 Ps 51, einen der kirchlichen Bußpsalmen, auslegte, fand er dort die Eigenart der Theologie charakterisiert. Der Psalm ist David zugeschrieben worden, dem erwählten Herrscher, der meinte, sich auf Gottes Seite zu wissen. Er übte sein vermeintliches Herrenrecht an einer Frau aus, deren Ehemann er umbringen ließ. Wie in 2 Sam 12, 1-15 erzählt wird, überführte er sich selber im Prozess einer fiktiven Rechtsfindung und wurde gewahr, dass er nicht nur schweres Unrecht begangen, sondern sich an Gottes Gerechtigkeit vergangen hatte:
An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. (Ps 51,6)
Hier wird die »Dramatik des Sündenbekenntnisses« deutlich, in deren Zuge Menschen »erst Sünder werden müssen«26. Mit diesem Bekenntnis marktet der König nichts von dem ab, was er an Menschen verschuldet hat, oder zieht sich auf eine allgemeine Einsicht in die Fehlbarkeit von Menschen zurück. Vielmehr nimmt er sich unversehens wahr, wie er rettungslos und restlos das Verhältnis verfehlt hat, das Gottes Gerechtigkeit entspricht. Schuldig geworden ist er an Menschen, gesündigt hat er allein an Gott. Indem er nun Gott recht gibt, wird er auch der Macht der Sünde gewahr, die ihn schon seit jeher, sogar bereits vor seiner Geburt, beherrschte – ohne dass der Sünder sich entlasten könnte, wenn er seine Eltern beschuldigte. Dass er ganz und gar der Sünde verfallen ist, zeigt sich an der Tragweite seiner Bitte um Vergebung: der Bitte um ein neu geschaffenes, von Grund auf reines Herz und einen neuen, gewissen Geist (Ps 51,12).
Im Sündenbekenntnis zeichnet sich ab, was im Verhältnis Gottes zum Menschen geschieht, wie Gott am Menschen handelt, der dadurch kenntlich gemacht wird. An diesen Menschen wird die Theologie um Gottes willen gewiesen – anders als der Mediziner, der sich um Kranke kümmert, oder der Jurist, der über menschliche Verfügungsgewalt befindet und über menschliches Verschulden verhandelt:
Der charakteristische Gegenstand der Theologie ist der Mensch, der der Sünde schuldig und der verworfen ist, und Gott, der den sündigen Menschen errettet. 27
Diese Umschreibung darf nicht zum Thema »Gott und Mensch« oder auch »Gott in Beziehung zum Menschen« zusammenschmelzen. In dem »und«, das Gott mit dem Menschen verbindet, verbirgt sich die Geschichte, die Gott mit Menschen eingeht, um sie aufzufangen, zu erneuern, in seiner Treue zu befestigen und auf seine Verheißungen hin zu vollenden. So berühren Gottes Wege die Wege der Menschen, auch den Weg zu einer theologischen Anthropologie.
In seinen Thesen zur Disputatio de homine (1536)28 , einer Anleitung zum theologischen Argumentieren über den Menschen, erläuterte Luther den Unterschied zwischen einer philosophischen Vermessung des Menschen und der theologischen Rede ad hominem : Philosophisch könne und solle möglichst lückenlos erfasst werden, was der Mensch an sich selber aufzufinden vermag. Dafür sei die Vernunft zuständig, durch die sich der Mensch vom Tier unterscheidet; Gott habe mit ihr als einer »Sonne« und einer »Art göttlicher Macht« den Menschen begabt, damit er die geschaffene Welt verwalte.29 Die Theologie habe sich aber daran zu halten, dass die Definition des Menschen in Gottes Handeln beschlossen ist: Durch Glauben wird der Mensch gerechtfertigt,30 kraft der Rechtfertigung, mit der Gott menschliche Selbstverschlossenheit durchbricht, nicht innerhalb des Raumes, in dem sich Menschen von sich aus bewegen, in dem sie wirken und auf dessen Grenzen sie stoßen. Die theologische Definition des Menschen unterscheidet sich also von der philosophischen dadurch, dass sie sich auf den »ganzen und vollkommenen Menschen« erstreckt: 31 darauf, dass wir der Teilhabe an Gottes Gerechtigkeit gewürdigt werden, als Menschwerdung auf die vollendete »künftige Gestalt« hin, die Gott hat schaffen wollen.32 Die Vernunft mag über sich reflektieren, aber sie vermag sich selber weder als Ganzes zu überblicken noch ergründend zu durchschauen. Nur dann, wenn sie im Rahmen ihrer Bedingtheit verbleibt, kann sie ausschöpfen, wozu sie fähig ist, nämlich die gegebene Welt und den Menschen als Weltwesen mit all seiner Hinfälligkeit und Zweideutigkeit zu erfassen. Der Glaube hat der Vernunft nichts voraus und übertrifft sie nicht, er ist keine Übervernunft, aber er zeichnet sich auch keinesfalls durch Unvernunft aus. Von Gottes Handeln wird er getragen. Darauf wird der Blick der Theologie gerichtet und so auf den Menschen, nicht auf seine Endlichkeit, sondern auf seinen Ursprung als Geschöpf und auf die Verheißung seines Lebens in Gott.
Bedeutende Seelsorger haben eine theologische Anthropologie fördern können, weil sie verstanden, Menschen zu studieren, ihnen aufgeschlossen zuzuhören und ihre Beobachtungen nicht zu schematisieren. So wurden sie nicht nur zu außergewöhnlichen Menschenkennern. Und eine naturwissenschaftlich geschulte Beobachtungsgabe konnte den französischen Mathematiker, Physiker, Philosophen und Laientheologen BLAISE PASCAL (1623-1662) ebenso wie den amerikanischen Theologen JONATHAN EDWARDS (1703-1750) auch zu weitreichenden anthropologischen Einblicken mit theologischer Tiefenschärfe verhelfen. Sie vertrauten darauf, dass theologische Lehre, die die ganze Erstreckung von Gottes Handeln und seiner Geschichte mit den Menschen im Blick hat, ihnen den Blick auch für die Beschreibung des Alltäglichen zu schärfen vermag, für die Kleinigkeiten, die Gottes Vorsehung so wichtig nimmt (Edwards), und für das Schwanken menschlicher Selbsteinschätzung, die Gott in Christus allein zurecht
absque operibus, breviter hominis definitionem colligit, dicens, Hominem iustificari fide.« – Vgl. dazu G. EBELING, Lutherstudien, Bd. 2: Disputatio de homine, 3. Teil: Die theologische Definition des Menschen, Tübingen 1989, 404- 470; 407: »Nicht das abstrakte Sein des Menschen, sondern das als Leben sich vollziehende Sein des Menschen wird zum Gegenstand der Definition.« Die Alternative »abstraktes Sein / als Leben sich vollziehendes Sein« trifft allerdings noch nicht die Eigenart des »Werdens«, das nicht im Lebensvollzug aufgeht. Denn entscheidend ist doch, was der Mensch »wird« und wie dieses »Werden« geschieht und beschaffen ist!
bringen kann (Pascal). Weder für Pascal noch für Edwards kam jedoch eine vor-und außertheologische Anthropologie als Basis für die Theologie in Betracht.
Der dänische Philosoph und Theologe SØREN KIERKEGAARD (1813-1855) widmete sich in einem Teil seiner Schriften der Frage, was in biblischen Geschichten vorgeht und wie sie wiederholt werden können, eher noch: wie sie sich selber wiederholen, wenn wir Schritt für Schritt mit ihnen gehen. Er richtete das Augenmerk auf die Indirektheit der Mitteilung des Glaubens, die auch seine religiösen Schriften charakterisierte. 33 Wenn wir aus Glauben, auf Hoffnung hin und in Liebe reden, dann treten wir zurück zugunsten dessen, was wir auf Gott hin zu sagen gedrungen sind – und zugleich wissen wir, dass wir es von uns aus gar nicht sagen könnten. Dabei entdeckt das »Selbst« sich auf überraschende Weise. Und wenn diese Entdeckung Kierkegaards beschrieben wird, sieht sich der Betrachter unversehens in sie verwickelt und wird zur Rechenschaft über sich selbst gezogen. 34
Kohelet, Paulus, Augustin, Luther, Pascal, Edwards und Kierkegaard sind einige der Lehrmeister theologischer Anthropologie, von denen ich zu lernen versuchte. Vor allem haben sie mich gelehrt, dass die Frage »Was ist der Mensch?« sich theologisch einzig und allein beantworten lässt, wenn ihr