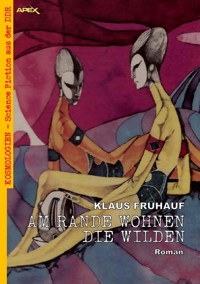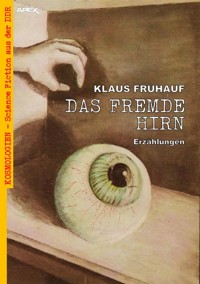7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Über Hunderte von Kilometern erstreckt sich Mortula, die Wüste des Todes, die Bernd Kronert bezwingen muss, um die rettende Marsstation zu erreichen...
Tarzan heißt der Kybernet, der außer Kontrolle gerät und seinen Konstrukteur Jeffer Jefferson vor unlösbare Probleme stellt...
Der junge Stasch ist der letzte Kommandant eines Raumschiffes, das in der Sonne zu verglühen droht...
In sechs Erzählungen gestaltet der Autor Themen der wissenschaftlichen Phantastik aus neuer, origineller Sicht.
Klaus Frühauf (* 12. Oktober 1933 in Halle (Saale); † 11. November 2005 in Rostock) war ein deutscher Schriftsteller und gilt als einer der wichtigsten Science-Fiction-Autoren der DDR; seine Story-Sammlung Das Wasser des Mars erschien erstmals im Jahre 1977.
Der Apex-Verlag veröffentlicht dieses Buch als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe KOSMOLOGIEN - SCIENCE FICTION AUS DER DDR.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
KLAUS FRÜHAUF
Das Wasser des Mars
KOSMOLOGIEN – SCIENCE FICTION AUS DER DDR, Band 18
Erzählungen
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
1. Das Wasser des Mars
2. Kyberneten
3. Risiko
4. Kyborg
5. Das Paradoxon
6. Die weite Reise
Das Buch
Über Hunderte von Kilometern erstreckt sich Mortula, die Wüste des Todes, die Bernd Kronert bezwingen muss, um die rettende Marsstation zu erreichen...
Tarzan heißt der Kybernet, der außer Kontrolle gerät und seinen Konstrukteur Jeffer Jefferson vor unlösbare Probleme stellt...
Der junge Stasch ist der letzte Kommandant eines Raumschiffes, das in der Sonne zu verglühen droht...
In sechs Erzählungen gestaltet der Autor Themen der wissenschaftlichen Phantastik aus neuer, origineller Sicht.
Klaus Frühauf (* 12. Oktober 1933 in Halle (Saale); † 11. November 2005 in Rostock) war ein deutscher Schriftsteller und gilt als einer der wichtigsten Science-Fiction-Autoren der DDR; seine Story-Sammlung Das Wasser des Mars erschien erstmals im Jahre 1977.
Der Apex-Verlag veröffentlicht diesen Roman als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe KOSMOLOGIEN - SCIENCE FICTION AUS DER DDR.
1. Das Wasser des Mars
Die grünlich leuchtende Schlange aus Flüssigkeitskristallen kriecht langsam über das Koordinatennetz. Viel zu langsam. Seit Stunden ist er unterwegs, seit Stunden zieht das eintönige Panorama der grauroten, unmerklich gewellten Landschaft unter der Transportrakete hindurch.
Einen Augenblick lang beobachtet Bernd Kronert die gleitenden Bewegungen des Lenkhebels, der ein eigenes Leben zu führen scheint. Bereits kurz nach dem Start von der Station Ares 1 hatte er weisungsgemäß die Leitstrahlsteuerung und das Konturenfolgegerät eingeschaltet, und seitdem fliegt der Raketoplan sowohl in absoluter Zielrichtung als auch in gleichbleibender Bodenentfernung, automatisch jede Unebenheit des verkarsteten Bodens nachzeichnend. Und seitdem kommt Bernd Kronert sich überflüssig vor.
Es erscheint ihm unsinnig, die Raketoplane auch heute noch zu bemannen, nur um Eventualitäten vorzubeugen. Die Technik ist fortgeschritten genug, um diese Dinger mit einer Startautomatik zu versehen und auf Kurs zu bringen. Dann könnten sie von einem Leitstrahl übernommen werden und so die Zielstation erreichen. Die Landung würde dann genauso automatisch erfolgen wie der Start. Das alles ist kein technisches Problem, zumal ein Großteil des Fluges ohnehin schon automatisch verläuft, nein, technisch ist die Sache lösbar.
Das Problem liegt auf einer ganz anderen Ebene. Auf der menschlichen. Er, der Pilot Bernd Kronert, kann das beurteilen. Wie oft hat er eigentlich schon vorgeschlagen, diese Umstellung an den Transportern vorzunehmen? Vier-, fünfmal bestimmt, vielleicht sogar öfter. Aber die Antwort ist immer die gleiche. Die Automaten seien nicht in der Lage, selbständige Entscheidungen zu treffen, wie sie bei unerwarteten Schwierigkeiten nötig werden könnten. Sie vermögen nur, sich nach ihrem Programm zu richten, und wenn das keinen für die auftretenden Schwierigkeiten eingerichteten Komplex enthalte, würden sie kläglich versagen.
Welche Schwierigkeiten das denn seien, hatte er sie gefragt, diese Büromenschen in ihren weißen Overalls, aber sie hatten die Schultern gezuckt. »Wenn wir das wüssten, könnten wir es ja ins Programm aufnehmen. Aber wir wissen’s eben nicht.«
Basta! Da hast du’s, Kronert. Zerbrich dir nur den Kopf! Wenn du zu uns kommst, werden wir dir klarmachen, dass es so nicht geht.
Wie die Kletten hängen sie an ihren Vorschriften und brüten Gefahrensituationen aus, die nur in ihrer Einbildung existieren. Und die Piloten haben sich dann mit den Sicherheitsbestimmungen herumzuschlagen. Sie sollten ihre Nasen öfter aus den Stationen in die Marsluft hinausstecken, dann wüssten sie, was sie von einer Beeinflussung der Optik durch Stickstoffreif oder vom Ausfall der Sensoren durch Windhosen zu halten hätten. Nichts, aber auch gar nichts!
Wie oft sind denn derartige Situationen entstanden, seit er auf dem Mars ist? Ein- oder zweimal in mindestens acht Wochen. Und die aufgetretenen Gefahren wären programmierbar gewesen.
Kronert blickt aus dem Panoramafenster. Von Horizont zu Horizont erstrecken sich langwellige Dünen, grau-rot, eintönig. Kronert lacht. Es klingt deplatziert in der engen Kabine. Wer nur hat die so weit verbreitete Ansicht aufgebracht, der Mars sei eine Art Bruder der Erde. Ein schöner Bruder ist das, steinig, staubig und trist.
Vielleicht hat es an der Tatsache gelegen, dass der Mars in den Refraktoren der Erde gewisse jahreszeitliche Veränderungen auf seiner Oberfläche zeigt. Vielleicht meinten sie, Veränderung müsse gleichbedeutend mit Leben sein. Aber diese Funktion ist nicht umkehrbar, meine Freunde. Bruder der Erde? Ein kosmischer Felsbrocken ist das, ein Fels, der langsam zerfällt, zu rötlichen Steinen, rötlichem Staub. Wenn der Sand wenigstens noch die Farbe irdischen Sandes hätte...
Die leuchtende Schlange auf dem Bildschirm nähert sich der Formation des Cerberus, eines in Jahrmillionen rund und blank gescheuerten Bergrückens, der sich wie der Rist eines mächtigen Wales aus der Einöde des Sandes reckt.
Kronert zählt die senkrechten Linien auf dem Schirm, die sich zwischen dem Kopf der Schlange und dem durch einen blauen Fleck markierten Ziel befinden. Es sind noch vier Striche, also rund zweihundert Kilometer, ein Katzensprung. In weniger als einer Viertelstunde hat er es geschafft, den Sicherheitsfimmel des Büropersonals ein weiteres Mal ad absurdum geführt.
Hinter dem Cerberus beginnt eine eintönige Wüste, die Mortula, und dahinter liegt Ares 4, die Station am Rande des äußersten Ausläufers der südlichen Polkappe. Alle zwei Jahre dehnt sich diese Polkappe bis auf wenige Kilometer an die Station heran aus, alle zwei Erdjahre selbstverständlich. Dann kriecht der Ammoniakreif in die südlichsten Dünen der Mortula hinein, und dann beginnen die Besatzungen von Ares 4 eine geradezu albern wirkende Geschäftigkeit zu entfalten.
Rechts von ihm beginnt eine Warnhupe zu quäken. Plötzlich sind die Gedanken wie weggewischt, ist er voll konzentriert. Es wäre tatsächlich zum Lachen, wenn ausgerechnet heute, ausgerechnet kurz nachdem er sich über die unangebrachte Haarspalterei der Büromenschen erregt hat, etwas eintreten würde, mit dem er nicht gerechnet hat, ein Vorfall, der ihre Sicherheitsbestrebungen in einem anderen Licht erscheinen lässt.
Kronerts Augen ziehen sich zu schmalen Schlitzen zusammen. Obwohl es sinnlos ist, beugt er sich vor, soweit es die Gurte zulassen, als könne er dadurch besser sehen. Weit vorn, über dem runden, dunklen Rücken des Cerberus glaubt er einen Dunstschleier zu erkennen, der weit hinauf in die dünne Atmosphäre reicht. Mit einer Handbewegung, in die er seinen ganzen Zorn legt, schaltet er das auf die Nerven gehende Warnsignal aus. Einen Augenblick ist nur das feine Singen der Triebwerke um ihn, doch dann setzt ein stärker und stärker werdendes Rauschen ein. Die ersten Ausläufer des Sandsturmes hat er also bereits erreicht.
Hin und wieder treibt eine der auf Mars häufigen Luftströmungen den grauen, feinen Sand tonnenweise an der Südflanke des Cerberus in die Höhe, lässt ihn hoch hinauf über den Bergrücken steigen und weit entfernt davon wieder zu Boden sinken. Noch besteht keine ernste Gefahr, Kronert muss sich nur davor hüten, in die Sandmassen zu geraten, die vor ihm in enormer Dichte in den Himmel schießen. Hier jedoch, in immer noch erheblicher Entfernung vom Cerberus, droht kein Unheil.
Kronert betrachtet die Libelle der Leitanlage. Der gründliche Fächer ist auseinandergeflossen. Der Leitstrahl wird durch den Sand zerstreut und gedämpft.
Plötzlich verliert die Libelle einen ihrer Flügel. Ares 1 hat an Ares 4 übergeben, hat den Leitstrahl planmäßig abgeschaltet, da der Raketoplan wenige Kilometer vor dem Massiv des Cerberus in den Leitbereich von Ares 4 eingeflogen ist. Und eine Bitte um weiteres Senden des Strahles hat der Pilot nicht geäußert.
Na, und wenn schon?, sagt er sich. Der neue Leitstrahl liegt an. Einer ist so gut wie der andere.
Und doch ist ihm nicht ganz wohl. Der neue Strahl ist schwach und aufgefasert, kommt kaum durch den Flugsand hindurch. Hoffentlich fällt er nicht ganz aus.
Kronert zieht die Maschine in eine Kurve, um eine Weile im Sturmschatten zu bleiben. Als er zum Lenkhebel greift, schaltet sich knackend die Konturenfolgesteuerung aus. Jetzt muss er aufpassen.
Einen Augenblick sinnt er noch darüber nach, dass die Büromenschen vielleicht doch ihre Gründe haben, wenn sie darauf bestehen, dass die Raketoplane bemannt werden, dann taucht er in die dichteren Schleier des Sandes ein. Auf den Tragflächen liegt ein helles Rauschen, und er spürt den Druck der fallenden Massen. Seine Hände umkrampfen die Lenkhebel, um die Maschine auf Höhe zu halten.
Die dunkle Kontur des Cerberus ist verschwunden, aber bereits nach wenigen Minuten schimmert sie wieder durch den grauen Schleier, wird schnell klarer und schärfer in den Umrissen. Das Rauschen bricht plötzlich ab, der Druck auf den Flächen verschwindet, aufatmend lehnt Kronert sich nun zurück. Er ist durch. Er hat die fallenden Sandmassen überwunden Und fliegt jetzt in Lee des Gebirges. Weit über ihm schließen sich die Staubwolken wie die Wölbung eines mächtigen Domes. Die einflügelige Libelle auf seinem Steuerpult zittert schwach und kraftlos.
Unmittelbar vor ihm schießen über die Flanken des schwarzen Berges Unmengen von Staub empor. Er zwingt sich, so weit wie möglich an den flatternden Vorhang heranzugehen, drängt die Maschinen aus der Kurve, als das Rauschen erneut beginnt und sie wie irrsinnig zu steigen anfängt. Sie steigt trotz der dünnen Atmosphäre, und plötzlich geht ihm auf, welch ungeheure Geschwindigkeit dieser Sandsturm haben muss.
Zehn Minuten fliegt er parallel zu dem Gebirge, dann zieht er den Raketoplan erneut in eine enge Kurve. Er fühlt, wie die Zentrifugalkraft die Wangenhaut auf seinen Backenknochen zum Flattern bringt, spürt die Last, die ihn in den Konturensitz presst und ihm den Unterkiefer herabdrückt. Verschwommen sieht er die fallenden Sandmassen heranrasen, hört wieder das Rauschen auf den Flächen.
Der Sand versucht die Maschine aus der Kurve zu ziehen, aber Kronert hält den Lenkhebel mit eisernen Muskeln, und wieder schafft er es.
Als das Rauschen abbricht, weiß er, dass er wieder eine Galgenfrist hat, mindestens zwanzig Minuten, in denen er verschnaufen kann. Und vielleicht flaut der Sturm vorher noch ab. Dann sind alle Sorgen, die er sich in den letzten Minuten gemacht hat, umsonst gewesen.
Er blickt auf das Steuerpult. Auch der letzte Flügel der Libelle ist verschwunden. Kein Wunder, er fliegt parallel zum Leitstrahl. Immer wieder schielt er zum Pult, starrt auf das kleine Fenster, hinter dem der beruhigende grüne Fächer den richtigen Kurs anzuzeigen hat. Aber der Raketoplan fliegt nicht auf dem richtigen Kurs, Kronert fliegt zurzeit unter einem Winkel von neunzig Grad zum Leitstrahl. Also kann der Fächer gar nicht zu sehen sein.
Unmittelbar daneben, auf dem Bildschirm des Kursschreibers, hat die grüne Schlange in der Zwischenzeit eine blödsinnig verknotete Linie gezeichnet. Auch diese Schlange sieht jetzt verwaschen und schwindsüchtig aus, es wäre töricht, sich nach ihr richten zu wollen.
Fast ist Kronert geneigt, auf die Technik zu schimpfen oder auf die, die sie geschaffen haben, aber er fühlt, dass das ungerecht wäre. Er blickt auf die Uhr. Eigentlich müsste er jetzt bereits über Ares 4 stehen. Grind und Cortez werden sich Sorgen um ihn machen, um ihn und seine Ladung.
Normalerweise bezeichnet er die Wissenschaftler als Büromenschen, manchmal hat er auch noch schlimmere Ausdrücke für sie, aber zurzeit beneidet er sie. Da sitzen diese beiden sicher und geborgen in ihrer Station, sehen und hören nichts von diesem mörderischen Sturm und können sich wahrscheinlich nicht erklären, wo er abgeblieben ist. Vielleicht streiten sie sich auch schon wieder. In Gedanken an sie muss er trotz seiner kritischen Situation lächeln. Seit sie auf Ares 4 stationiert sind, liegen sie sich in den Haaren, und zwar ausschließlich über wissenschaftliche Dinge. Statt sich mit der Tatsache zufriedenzugeben, dass alle zwei Erdjahre der Winter mit seinen Ammoniakmassen bis an ihre Station herankriecht, suchen sie nach Interpretationen, warum er in den einen Teil der Mortula weiter vordringt als in den anderen, woher bestimmte Temperaturdifferenzen kommen und wieso er aus einer Gegend schneller verschwindet als aus einer anderen.
Der Kursschreiber hat sich wieder beruhigt. Zwar wirkt die Schlange noch immer recht unterernährt, aber sie kriecht zielstrebig in eine bestimmte Richtung, allerdings in die falsche. Und die Libelle ist auch nicht zu sehen. Das ist normal! sagt er sich. Sie darf nicht zu sehen sein. Ich fliege rechtwinklig zu meinem Kurs.
Trotzdem schiebt er die Maschine in eine flache Kurve und atmet erst beruhigt auf, als sich in dem Fensterchen ein breites, mattes Flimmern in zartem Grün zeigt. Der Leitstrahl ist also immer noch da, noch hat er ihn nicht verloren. Gleich fühlt er sich besser.
Sein nächster Blick gilt der Uhr. Die zwanzig Minuten sind fast vorüber. Vorsichtig nähert er sich der vom Cerberus abgewandten Seite, der Seite, an der der Sand aus großer Höhe zur Marsoberfläche herabstürzt. Weiter und weiter bringt er die Maschine an den Vorhang aus Staub heran, und als das Rauschen wieder aufklingt, als er erneut den Druck auf den Flächen spürt, zieht er die Kurve nach Süden hin an.
Bereits als er die Kurve halb durchflogen hat, zu einem Zeitpunkt, da der Libellenflügel zwar matt, aber doch schmal und scharf leuchtet, die Kursschlange jedoch erneut einen sinnlosen Knoten zu schlagen beginnt, weiß er, dass er es nicht mehr schaffen wird. Die staubfreie Zone hinter dem Bergrücken ist auf dieser Seite weit schmaler. Sekundenlang überlegt er, ob er die Strecke durch Steig- oder Fallflug verlängern soll, dann zieht er den Lenkhebel nach hinten. Einen Augenblick lang hebt die Maschine die Nase, dann setzt heftiges Rauschen auf der rechten und gleich danach auf der linken Tragfläche ein.
Mit äußerster Kraftanstrengung zieht er am Lenkhebel, hält ihn an den Leib gepresst. Erst als der Hebel trotzdem in seiner Stellung verharrt, wird ihm bewusst, dass jede Kraftanwendung sinnlos ist. Die Lenkung ist eine Folgesteuerung, die einen bestimmten Hebelausschlag mit einer bestimmten Flossenstellung beantwortet. Dabei ist es unerheblich, welche Kraft am Hebel angreift.
Kronert wird sich der Tatsache bewusst, dass es keine Rettung mehr für ihn gibt. Weiter und weiter senkt sich der Radarsporn des Raketoplans. Lauter und lauter wird das Rauschen auf den Tragflächen.
Plötzlich bricht Schwärze durch die graue Dämmerung. Das Cockpit der Maschine zerbirst in einem hellen, nervenerschütternden Knall. Eine weiße Wand fliegt heran, Kronert hat das Gefühl, in einen mit Watte gefüllten Schacht zu stürzen. Sein Fall wird langsamer und immer langsamer, dann hüllt ihn die Bewusstlosigkeit in Vergessen.
Als Kronert wieder zu sich kommt, steht die Welt auf dem Kopf. Er versucht über diesen befremdenden Umstand nachzudenken, aber es fällt ihm sehr schwer, seine Gedanken zu ordnen. Er fühlt sich beengt, kann weder Arme noch Beine bewegen. Offensichtlich hält ihn etwas fest.
Er schließt die Augen und versucht ruhig zu überlegen. Das Herz hämmert in der Brust wie ein Motor. Als er die Augen wieder öffnet, weiß er, dass nicht die Welt auf dem Kopf steht, sondern er mit dem Kopf nach unten in den Trümmern hängt. Das Kabinendach ist völlig zerstört, und er wird von dem Prallkissen, das sich beim Aufprall explosionsartig mit Gas gefüllt hat und nun das ganze Cockpit einnimmt, in der Schwebe gehalten. Das Kissen ist riesengroß, weich und weiß wie Watte.
Nur leise klingt das Rauschen der steigenden und fallenden Sandmassen durch den Helm des Schutzanzuges.
Noch nie war er in einer derart blödsinnigen Situation. Wenn ihn so seine Kameraden von Ares 1 sehen könnten, sie würden sich über ihn lustig machen. Ausgerechnet ihm, Kronert, muss das passieren.
Während er sich noch die grinsenden Gesichter der Gefährten vorstellt, beginnt er mit den ersten Bewegungsversuchen. Er ist äußerst vorsichtig. Irgendwann hat er gehört, dass man häufig selbst schwere Verletzungen im ersten Augenblick nicht spürt, und das macht ihn doppelt aufmerksam.
Aber so hat das alles keinen Sinn. Das Prallkissen verhindert jede auch nur einigermaßen ausholende Bewegung. Er blickt nach unten. Etwa einen Meter unter seinem Kopf bildet sich langsam eine Sandwehe aus rötlichem Staub. Sie wächst ihm zusehends entgegen. Und jetzt weiß er, dass er nicht warten darf. Bei diesem Sturm ist die Maschine so schnell eingeweht, dass er Schwierigkeiten haben wird, sich durch den Sand zu graben. Kaum hat er den Gedanken zu Ende gedacht, da sucht er auch bereits den Geberknopf des Ultraschallsenders am Manschettenbund des rechten Armes. Es dauert nur Sekunden, bis er ihn ertastet hat. Ein winziger Druck, und vor ihm zerreißt die Folie des Prallkissens. Kopfüber stürzt er in die weiche Sandwehe, und plötzlich durchzuckt ein scharfer Schmerz seinen Fuß. Einen winzigen Augenblick spürt er Erleichterung darüber, dass mit diesem Schmerz der Beweis erbracht worden ist, dass sein Körper noch nicht ganz gefühllos ist, dann wird der Schmerz so heftig, dass es ihm vor den Augen flimmert.
Lange Zeit bleibt er ganz still liegen, ohne die geringste Bewegung. Vielleicht kommt ihm die Zeit auch nur so lang vor, weil der Schmerz nur langsam abklingt. Er spürt, wie der Sturm Sand an seinem Körper ablagert, wie die Wehe des Staubes links und rechts von ihm wächst, aber diesmal ist er vorsichtiger. Wieder beginnt er mit Bewegungen. Zuerst die Hände, dann die Arme und schließlich den Kopf. Lange begnügt er sich mit Kopfkreisen, zu lange. Als die Halswirbel zu knacken beginnen, schilt er sich einen jämmerlichen Feigling, der Angst hat, den kaputten Fuß zu bewegen.
Dann versucht er es zuerst mit dem linken Fuß. Freude wallt in ihm auf, als der Schmerz ausbleibt. Der linke Fuß ist also unverletzt. Jetzt weiß er, dass er sich retten kann. Es gibt viele Möglichkeiten.
Mit dem rechten Fuß versucht er die Bewegungen gar nicht erst. Bereits bei seinen ersten Bemühungen, unter der Rakete hervorzukriechen, beginnt der stechende Schmerz erneut, obwohl er den Fuß nur vorsichtig nachzieht. Er beißt die Zähne zusammen und schiebt sich Zentimeter um Zentimeter unter dem schützenden, auf dem Rücken liegenden Wrack hervor. Draußen springt ihn der Sturm an, aber er scheint nicht mehr so stark zu sein. Langsam zieht Kronert die Knie an den Körper und richtet sich auf. Und dann kniet er neben dem Raketoplan, dessen Vorderteil mit der Kanzel ein Haufen zerfetzten Bleches und Kunststoffes ist. Das Heck ragt schräg aufwärts in den von Sandmassen grau verhangenen Himmel, und unter den Öfen beginnt sich langsam ein Berg feinen Mehls zu sammeln. Es sieht aus, als versuche die Natur des fremden Planeten die Reste eines Meisterwerks irdischer Technik zu stützen. Aber Bernd Kronert weiß es besser. Er weiß, dass es nur wenige Wochen dauern wird, bis dieser mehlfeine Staub auch hier ganze Arbeit verrichtet hat.
Dieser Sand ist das größte Hindernis, das der Menschheit bei der systematischen Erforschung des Nachbarplaneten im Wege steht. Ein übles, ein hinterhältiges Zeug. Selbst die superharten Klarplastfenster der Stationen halten nur einen, höchstens zwei der häufigen Sandstürme aus, dann sind sie blind, wie von einem grauen Schleier überzogen. Der Sand schleift die Scheiben blind, mit Millionen und aber Millionen winzigen Schleifkörnern. Und er schleift die Wände der Stationen ab, poliert an ihrer Oberfläche und kolkt sie aus. Nirgends ist die Erhaltung selbst einfachster Stationen so aufwendig wie auf Mars, auch nachdem viele Teile der Stützpunkte unter die Oberfläche verlegt worden sind.
Der Mars ist tatsächlich ein übler Bursche, aber er, Bernd Kronert, wird ihm zeigen, wozu ein Mensch fähig ist. Noch hat ihn der Sturm nicht untergekriegt, und auch der Sand wird es nicht schaffen. Noch hat er, der Mensch Kronert, mehr als eine Möglichkeit, sich zu retten.
Bevor er mit der Untersuchung des Schadens beginnt, betrachtet er den Raketoplan mit aufmerksamerem Blick. Viel wird er nicht zu untersuchen haben, aber er ist verpflichtet, sich einen groben Überblick zu verschaffen, und er hat sich über den Zustand der Ladung zu informieren. Einmal, weil es um sich wichtige Teile für Ares 4 handelt, und zum anderen, weil er einen Teil der Ladung benötigt, um sich selbst zu retten. Die Ladung besteht in der Hauptsache aus Funkgeräten, und es ist ihm nicht schwergefallen, festzustellen, dass sein persönliches Gerät beim Absturz beschädigt worden ist. Die Kontrolllampe leuchtet nicht auf, offensichtlich ist das im Helm installierte Gerät zertrümmert worden.
Einen Augenblick lang hat er einen grotesken Gedanken. Ist es nicht erstaunlich, denkt er, dass der an sich zerbrechliche Mensch einen derartigen Sturz überlebt, während die Rakete nur noch ein Haufen von Trümmern ist? Die Natur war schon ein verblüffend guter Konstrukteur, sagt er sich, aber er schränkt sofort wieder ein: Schließlich hatte sie ja auch eine Unmenge Zeit.
Stunden später flaut der Sturm ab. Aber der Himmel klart nicht auf. Langsam steigt die Nacht herauf. Und Kronert weiß, dass sich die vielen Chancen, die er sich ausgerechnet hatte, auf eine einzige reduziert haben.
Auch unter der Fracht gibt es kein einziges intaktes Funkgerät mehr. Beim Aufprall sind die Container mit der Ladung nach vorn gerutscht, und dabei haben sie zwei Zwischenwände zertrümmert. Die leichten Behälter sind wie Seifenblasen zerplatzt, und nun bildet ihr Inhalt einen formlosen Haufen von Halbleitern und Plasten.
Dies jagt ihm den ersten großen Schrecken ein. Zuerst hat er sich gefreut, wenigstens noch einen ganz gebliebenen Sauerstoffbehälter gefunden zu haben. Vier Tage kann er sich jetzt mit dem lebenswichtigen Gas versorgen, wenn er den Rest aus seinem eigenen Behälter hinzurechnet. Aber die Freude währt nicht lange. Hinter einer der zertrümmerten Trennwände sind die Reservebatterien aufbewahrt worden. Der eine der Container hat sie durch den Raum gefegt und an der letzten Wand zerquetscht. Dabei ist es durchaus ein glücklicher Umstand, dass wenigstens die letzte Wand gehalten hat, denn dahinter befindet sich das Cockpit.
Aber was fängt er ohne Batterien an? Die Nächte auf Mars sind mörderisch kalt, im Freien ohne Anzugheizung kaum zu überstehen. Und die Kapazität seiner im Anzug eingebauten Batterie ist ziemlich erschöpft. Falls er heil zurückkommt, wird er sich einen Verweis einhandeln, wenn man erfährt, dass er mit halbentladener Batterie abgeflogen ist. Aber wer kommt schon auf den Einfall, dass etwas schiefgehen könnte?
Doch Kronert weiß jetzt, dass er sich glücklich schätzen kann, wenn er einen Verweis erhält. Denn das setzt voraus, dass er zurückkommt, lebend zurückkommt. Toten erteilt man auch auf Mars keine Verweise mehr.
Mit der halbentladenen Batterie kann er sich höchstens zwei Nächte lang warm halten, und auch nur dann, wenn er spart. Bis Ares 4 hat er mindestens einhundertfünfzig Kilometer zurückzulegen, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Sein Weg führt durch die Wüste Mortula, und er hat einen verrenkten, vielleicht sogar gebrochenen Fuß. Ganz so zuversichtlich wie kurz nach der Havarie ist er nicht mehr, und jetzt glaubt er auch nicht mehr, dass die Gefährten grinsen werden, wenn er zurückkommt. Denn...
Es wird schnell dunkel, und er kriecht mit zusammengebissenen Zähnen unter das zertrümmerte Cockpit. Dabei fällt ihm ein, dass das eigentlich völlig sinnlos ist. Es gibt weder Tiere noch Pflanzen auf Mars, wovor also sollte er sich fürchten? Trotzdem bleibt er unter den schützenden Trümmern und fühlt sich irgendwie geborgen. Er schiebt dieses Aufsuchen seiner »Höhle« auf einen Urinstinkt, den wohl niemand je loswerden wird.
Vorsichtig regelt er die Stromaufnahme der Anzugheizung ein. Die Temperatur darf nur so hoch sein, dass es eben noch auszuhalten ist. Und wenn er friert wie ein Schneider, er darf nicht zu viel Strom verbrauchen. Frieren schadet nichts, sagt er sich, nur erfrieren darf er nicht.
Zwei Stunden später ist ihm hundekalt. Der Sand um ihn herum glitzert feucht, aber er weiß, dass es sich nicht um Wasser handelt. Wasser wäre bei diesen niedrigen Temperaturen längst gefroren. Aus der dünnen Atmosphäre fällt Kohlendioxid aus und kondensiert auf dem Sand. Wenn die Sonne den Sand gegen Morgen erwärmt, wird es sich wieder verflüchtigen. Kronert wünscht im Augenblick nichts so sehr, als dass diese Nacht bald zu Ende gehen möge. Nichts erscheint ihm so schön wie die Sonne.
Als die kleine, aber hell strahlende Sonne über den geraden, wie mit einem Lineal gezogenen Horizont heraufrollt, treffen ihre Strahlen auf einen Menschen, der auf den Knien liegt und mit beiden Armen heftig um sich schlägt. Bernd Kronert wendet die älteste, aber in seiner Situation immer noch probateste Methode an, um sich aufzuwärmen, er bewegt sich kräftig.
Bereits nach wenigen Minuten unterbricht er seine Tätigkeit und streckt den Rücken. Er fühlt bereits jetzt die Wärme der Sonnenstrahlen durch den Raumanzug. Als er aufblickt, sieht er über sich einen klaren Himmel, blau wie auf der Erde und doch anders. Minutenlang überlegt er, dann weiß er, was anders ist. Um die Sonne herum ist der Himmel viel dunkler, fast schwarz. Und er weiß, dass ein vor Hitze flimmernder Tag über der Mortula zu erwarten ist.
Vor ihm liegt sie, die Mortula, die Todwüste. Wer weiß, wer diesem Landstrich solch einen blöden Namen gegeben hat? Vielleicht einer der Wissenschaftler, die als erste die Stelle erreichten, an der jetzt Ares 4 steht. Gestern wäre er noch bereit gewesen, sich über den Namen Mortula zu amüsieren, heute aber ist das anders.
Er schützt die Augen mit der Hand. Das Sonnenlicht lässt die weiten Sandflächen heller erscheinen. Dann greift er zur Seite, wo die Aluminiumstrebe liegt, die er sich gestern Abend noch aus dem zertrümmerten Cockpit gebrochen hat, die Strebe, die er als Stütze benutzen will. Langsam richtet er sich mit ihrer Hilfe auf und tut zögernd ein paar Schritte den langen Hang hinunter, dorthin, wo der Cerberus, dieser blankpolierte Höhenzug, in die Mortula übergeht. Der Hang ist überzogen mit einer knöcheltiefen Schicht feinen Staubs, das Gehen fällt schwer, und da unter dem Staub blanker Fels liegt, rutscht er immer wieder aus. Jede dieser ungewollten Bewegungen verursacht stechende Schmerzen im Fuß. Trotzdem marschiert er, als gelte es, einen Rekord aufzustellen. Aber es gilt ja ungleich mehr, als sportlichen Ruhm zu erzielen, es geht um das nackte Leben.
Rechts neben ihm marschiert sein Schatten. Sinnlos kriecht er über flache Hügel und gleitet in kaum sichtbare Täler, Wolke, über die der Wind hinterlistig losen Sand gehäuft hat.
Gegen Mittag beginnt Kronert zu schwitzen. Die Sonne scheint ihm unbarmherzig ins Gesicht. Obwohl sie kleiner ist als auf der Erde und obwohl sich die Helmscheibe kontinuierlich mit dem Ansteigen der Lichtintensität getrübt hat, wird der Marsch bald zur Quälerei. Kronert beginnt leise zu fluchen. Seit Jahren gibt es Schutzanzüge, die mit einem Thermoportsystem ausgerüstet sind, mit Kanülen, die den Anzug unter seiner obersten Haut durchziehen und durch die eine schwer siedende Flüssigkeit gepumpt wird, um die Wärme zu verteilen, aber wer würde schon auf die Idee verfallen, die Piloten mit derartigen Anzügen auszurüsten?
Es ist zum Verrücktwerden, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Leben von einer einzigen Fehlentscheidung abhängen kann.
Bald beginnt ihm Schweiß in die Augen zu rinnen. Das Schweißband im Helm hat sich vollgesaugt und gibt die beißende Flüssigkeit in kleinen Portionen ab. Er kann sich nicht einmal die Augen wischen, da er den Helm nicht abnehmen darf. Es ist ekelhaft und widerlich.
Zehn Minuten später hält er es nicht mehr aus, wendet der Sonne den Rücken zu und stolpert rückwärts weiter, immer wieder über die Schulter in Marschrichtung blickend, um nicht in eine der kleinen verwehten Senken zu stürzen. Beim Umblicken begrenzt der Helm, der fest mit der Anzugmanschette verbunden ist, seinen Sichtwinkel, so dass er gezwungen ist, zeitweilig den ganzen Oberkörper zu drehen.
Auch das ist nicht lange auszuhalten. Trotzdem zwingt er sich zu dieser ungewöhnlichen Fortbewegungsweise, bis er die Wärme der Sonne auf Rücken und Schultern spürt. Erst dann dreht er sich wieder herum.
Noch mehrmals wiederholt er dieses Spiel, ehe die Sonne so tief steht, dass ihre Strahlen einen Großteil ihrer Energie in den dichteren Schichten der Atmosphäre verlieren.
Als er rückwärtsgehend nur mit Mühe einer der verwehten Spalten ausweichen kann, bleibt er fluchend stehen und hebt den Blick vom Boden. Weit hinten, in der Richtung, aus der er gekommen ist, sieht er etwas aufblitzen. Auf dem verschwommenen Kamm des Cerberus steht ein Licht. In der sinnlosen Hoffnung, dort drüben, wo das Wrack des Raketoplans liegt, würden Lichtsignale gesendet, starrt er, bis seine Augen anfangen zu tränen, aber dann ist er sicher, dass ihn ein Sonnenreflex auf der metallenen Oberfläche des havarierten Flugkörpers genarrt hat. Langsam, mit dem Sinken der Sonne, verschwindet auch das Licht.
Kronen lässt in doppelter Enttäuschung die Schultern sinken. Nicht nur, dass dort niemand ist und ihm signalisiert, nein, der Reflex hat ihm auch bewiesen, wie kurz sein bisher zurückgelegter Weg ist.
Höchstens fünfundzwanzig Kilometer hat er sich bisher vom Unfallort entfernt, und die Nacht mit ihrer schneidenden Kälte ist nicht mehr weit. Wenn er am ersten Tag dreißig Kilometer schafft, kann er sich gratulieren, aber er muss in zwei Tagen einhundertfünfzig Kilometer hinter sich bringen, wenn er nicht erfrieren will. Wasser und Atemgas würden vielleicht für vier Tage reichen, die wärmespendende Batterie jedoch höchstens für zwei Nächte, auch dann, wenn er sich zusammenrollt, um die Abstrahlung so niedrig wie irgend möglich zu halten.
Eine einfache Rechnung also, und sie zeigt, dass alle Anstrengungen vergeblich sind. »Dreisatzrechnung!«, murmelt er in den Helm, und immer wieder: »Dreisatz!« Minutenlang gelingt es ihm, dadurch zu verhindern, dass das Hirn diese Rechnung, die alles entscheiden wird, ohne Denkanstoß durchführt, aber wer schafft es schon, sein Unterbewusstsein zu beherrschen? Außerdem ist diese Rechnung viel zu einfach, als dass er sich selbst an ihrer Durchführung hindern könnte.
Einhundertfünfzig Kilometer entsprechen bei seinem derzeitigen Tempo fünf Tagen. Es ist sinnlos weiterzulaufen, sinnlos, sinnlos!
Und doch läuft er weiter. Er sieht die Sonne unter den Horizont tauchen, fühlt, wie die Kälte in ihm heraufkriecht, aber er marschiert, schaltet die Heizung nicht ein, in der törichten Hoffnung, sich warm laufen zu können.
Der feine, mehlige Sand wird schnell dunkler, angefeuchtet von dem in der Kälte kondensierenden atmosphärischen Kohlendioxid. In den letzten Strahlen der Sonne sieht er, wie sich lange hellere Bahnen über den Staub ziehen, so als werde er nicht gleichmäßig feucht. Und dann fällt ihm ein, dass er bereits gegen Mittag, als er rückwärts gelaufen war, eine Beobachtung gemacht hatte, die ihm im Bewusstsein geblieben war, ohne dass er versucht hätte, sie sich zu erklären. Stehenbleibend blickt er sich um über die weite Fläche bis hin zum Cerberus, der jetzt viel weiter entfernt ist.
Zuerst weiß er nicht, was ihm ungewöhnlich erscheint, was ihm schon vor fünf Stunden aufgefallen war, ohne dass er es hätte definieren können. Dann aber sieht er es: Seine Spuren verschwinden im Sand. Langsam fließen die verwaschenen Abdrücke mit der Umgebung zu einer glatten Fläche zusammen, verschwinden trotz Windstille.
Wenige Minuten nur, und er steht inmitten einer unberührten eintönigen Landschaft, inmitten der Mortula, der Wüste des Todes, seines Todes.
Die Nacht hat er zusammengekrümmt verbracht, um Strom zu sparen. Trotzdem hat er entsetzlich gefroren. Und die ganze Nacht über haben ihn diese Gedanken nicht losgelassen, die Gedanken an die Erde, die mit ihrem ruhigen bläulichen Licht langsam über den Himmel gewandert ist, als wolle sie Ausschau halten nach dem Abtrünnigen in der Mortula.
Und da sind auch die Gedanken an Grind und Cortez auf Ares 4 gewesen. Noch einen Tag hat er zu leben, noch einen einzigen Tag, und vielleicht, wenn die Batterie so lange durchhält, noch einen Teil der nächsten Nacht.
Vielleicht suchen ihn Grind und Cortez bereits, aber bei seinen Überlegungen in der vergangenen Nacht ist er zu der Überzeugung gelangt, dass es besser sei, erst am zweiten Tag nach dem Verschwinden mit der Aufnahme der Suche zu rechnen. Und wenn sie ihn suchen, wo sollen sie beginnen?
Es ist ohnehin zu vermuten, dass sich die beiden nicht einigen können, auf welche Art und Weise die Suche in Gang gesetzt werden soll. Dass sie in der Zwischenzeit etwas bemerkt haben, traut er ihnen zwar zu, dass sie sofort etwas unternehmen werden, nicht. Es sind keine guten Gedanken, die er sich in der Nacht gemacht hat.
Grind und Cortez sind typische Wissenschaftler, sagt er sich jetzt. Menschen, die bei jedem neuen Problem immer wieder beim Ursprung aller Dinge beginnen und die auch an den nicht so recht glauben, bevor sie ihn nicht gesehen und genau unter die Lupe genommen haben. Sie würden sich vorsichtig an die neue Situation herantasten, um über eine logische und exakte Analyse zu einer Anleitung zum Handeln zu kommen. In seinem Fall aber muss eine derartige Arbeitsweise unweigerlich scheitern.
Langsam quält er sich hoch von dem bitterkalten Boden. Der stechende Schmerz im Fuß ist zu einem dumpfen Pochen geworden. Er stützt sich auf die Aluminiumstrebe und blickt sich um. Weit im Norden liegt der Cerberus, flimmernd in den aufsteigenden Schwaden des Kohlendioxids, das, selbst farblos, die Atmosphäre mit Schlieren anreichert.
Seine Lippen angeln nach dem Schlauch und saugen einen Schluck belebender Flüssigkeit in den Mund. Er schluckt nicht, sondern lässt ihn langsam hinunterrinnen. Dann fällt ihm ein, dass er mit Nahrung nicht sparen muss, aber trotzdem schiebt er mit der Zunge den Schlauch aus dem Mund.
Er wünscht sich so sehr, dass die beiden Wissenschaftler auf Ares 4 wenigstens einmal, wenigstens in seinem Fall, ihre Pedanterie und Unentschlossenheit ablegen möchten, dass nicht ausgerechnet er es ist, dem ihre verfluchte Exaktheit zum Verhängnis wird.
Er sieht sie förmlich vor sich, die beiden ungleichen Typen. Grind, behäbig, groß und massig, mit langsamen Bewegungen, als fürchte er, mit einer unbeabsichtigten Geste Löcher in die Umwelt zu schlagen. Der mächtige, eckige Schädel bildet mit seinen blonden, schütteren Haaren einen geradezu lächerlichen Gegensatz zu den blauen Kinderaugen.
Da ist ihm der wesentlich kleinere, schwarzhaarige Cortez schon weit-sympathischer. Seine dunklen, wachen Augen sind einfach überall, und wenn er allein auf Ares 4 wäre, würde er sich wahrscheinlich keinen Augenblick bedenken, sondern sich sofort auf die Suche begeben. Aber zusammen mit Sven Grind wohl kaum. Grind wird zuerst versuchen, Fakten zu sammeln, und das ist bei der weiten Entfernung zu Ares 1 und der immer wieder zusammenbrechenden Funkbrücke nicht leicht. Dann aber wird er Cortez’ Initiative durch stundenlange Erörterungen zermürben und dadurch veranlassen, dass sie beide warten, bis es zu spät ist.
Kronert fühlt selbst, dass ihm die Sorge um das eigene Leben böse Gedanken eingibt. Vielleicht irrt er sich wie bei seiner Einschätzung der Sicherheitsbestimmungen.
Und plötzlich hofft er, dass die Wissenschaftler anders sind, als er es sich bisher eingeredet hat.
Langsam wendet er sich nach Süden und beginnt tastend Schritt vor Schritt zu setzen. Nach wenigen Metern fühlt er das Pochen im Fußgelenk nicht mehr. Häufig bleibt er stehen und blickt zurück auf die Spuren seiner schweren Schuhe, die sich langsam auflösen, verschwinden im grauen Sand. Eben noch waren sie in seiner unmittelbaren Nähe scharf und deutlich, aber einige Meter von ihm entfernt verschwimmen sie schon. Er sieht, wie sich die Auflösung ihm nähert, wie sich seine Abdrücke auch in unmittelbarer Nähe verwaschen.
Da wendet er sich um und läuft so schnell ihn seine Füße und die Aluminiumstrebe zu tragen vermögen. Plötzlich ist er bereit, an ein böses Omen zu glauben. Erst nach Minuten hat er sich so weit gefangen, dass er über sich und seine sinnlose Angst lachen kann.
Bestimmt schätzt er Grind falsch ein, versucht er sich Mut zu machen. Er kennt ihn nicht so genau. Wen von den Büromenschen kennt er eigentlich genau genug, um sich ein Urteil erlauben zu können? Eigentlich keinen.
Er meckert über sie, weil er sie für Menschen hält, die sich nur in der sterilen Atmosphäre ihrer Labors und Büros wohl fühlen, fern jeder Praxis. Und manchmal berauscht er sich an seinen eigenen Argumenten. Aber vielleicht sind sie ganz anders.
Vielleicht, vielleicht... Was nützen ihm diese Erwägungen? Was nützt es ihm, wenn er unrecht haben sollte mit seiner vorgefassten Meinung über sie? Er hat nur noch wenige Stunden zu leben. Höchstens für die Hälfte der Nacht wird seine Batterie die Heizung noch mit Energie versorgen können, dann wird alles vorbei sein.
Fast möchte er aufgeben, aber es scheint eine der hervorragenden Eigenschaften des Menschen zu sein, dass er selbst dann nicht an seinen Tod zu glauben bereit ist, wenn sich dessen genauer Zeitpunkt schon berechnen lässt.
Menschen sind eigenartige Wesen, philosophiert er, sie sind in der Lage, etwas zu tun, was ihnen sinnlos erscheint. Und sein Handeln ist ein Beispiel dafür. Er weiß genau, dass er nicht aufgeben wird. Unaufhörlich stapft er weiter vorwärts der Station entgegen, als sei es ein Vorzug, ihr im Tod ein paar tausend Meter näher zu sein.
Während der Mittagsstunden ist er wieder gezwungen, sich ständig zu drehen und zu wenden. Der Wärmeausgleich ist eine kraftaufwendige Angelegenheit, aber Kronert bewegt sich jetzt bereits völlig mechanisch.
Seine Aufmerksamkeit benötigt er für etwas anderes. Er nimmt sich vor, das Verschwinden der Fußspuren aufzuklären, aber er bringt es nicht fertig, einige Minuten für genauere Beobachtungen zu opfern. So konstatiert er nur das Eigenartige dieser Erscheinung und zerbricht sich den Kopf über die Gründe.
Fast scheint es, als führen die Sandschichten ein geheimnisvolles Eigenleben oder als verfolgen ihn unter der Oberfläche Wesen, die seinen nahen Tod ahnen und danach trachten, ihn als leichte Beute nach Eintritt der Agonie zu überfallen.
Aber es gibt kein Leben auf dem Mars. Zumindest ist bisher noch nichts Derartiges festgestellt worden, und die Menschen befinden sich immerhin schon seit rund einem Jahrzehnt auf Ares.
Was also ist es, das seine Spuren in der Mortula so zielstrebig verwischt, das eine erfolgreiche Suche nach ihm für immer unmöglich machen wird?
Am frühen Nachmittag, die Sonne beginnt bereits sich dem Horizont entgegenzusenken, stockt er plötzlich. Zwar fühlt er das Zucken der Motorik in den Beinen, die seit Stunden nur noch mechanisch einen Fuß vor den anderen setzen, aber das Hirn befiehlt ihnen, auf der Stelle zu verharren.
»Was ist das dort vorn?«, fragt sich Kronert selbst, und er ist erstaunt, als eine raue und unbekannte Stimme seinen Helm erfüllt.
»Blödsinn!«, knurrt er, und erst jetzt glaubt er daran, dass die kratzige Stimme seine eigene ist. Seit dem Abflug gestern hat er sie nicht mehr gehört. Gestern? War das wirklich gestern? Oder ist es schon Tage, Wochen, Monate her? Ihm ist, als laufe er durch die Mortula seit undenklichen Zeiten, von einer Ewigkeit zur anderen, mit zitternden Beinen, die jeden Augenblick den Dienst versagen können.
Etwas hat ihn an seinen Platz gebannt, etwas Eigenartiges, etwas, das nicht hierhergehört, nicht in die Mortula und nicht auf den Mars.
Vor ihm, nur wenige Schritte entfernt, liegt ein dunkler Fleck auf dem hellroten Sand. Der Fleck hat eine unregelmäßige Form, obwohl er kompakt, ja fast gefährlich wirkt. Ist es das, worauf er gewartet hat, seit ihm das Verschwinden seiner Fußabdrücke zum Bewusstsein kam? Nach Minuten löst er den Blick von dem Fleck und richtet ihn auf den Horizont, dem sich die Sonne nähert, dann nach links, wo die Station Ares 4 sich befinden muss, so weit entfernt, dass sie noch lange nicht sichtbar werden wird. Noch lange nicht? Für ihn nie mehr!
Dort drüben erhebt sich verschwommen und unklar ein blaugraues, unscheinbares Gebirge, dessen runde Hügel von der Sonne auf einer Seite in rötliches Licht getaucht werden. Wenn er dieses Gebirge vor Einbruch der Nacht erreicht, findet er möglicherweise eine Höhle, in der er sich verkriechen kann, in der er die Wärmeabstrahlung noch weiter reduzieren kann.
Eine unsinnige Hoffnung zuckt in ihm auf. Noch hat er sich nicht bewegt, aber es ist ihm klar, dass er die Berge nur dann erreichen kann, wenn er sich höllisch beeilt. Aber da ist der Fleck.
Er reißt sich zusammen und geht hinüber zu der dunklen Fläche. So unregelmäßig, wie sie aus der "Ferne aussah, ist sie nicht. Eher ziemlich exakt oval. Sie ist nicht nur dunkel, sondern tiefrot, fast dunkelrot, wenn auch die Farbe von einem matten Grau überlagert wird. Als er sich bückt, sieht er an vielen Stellen den Sand unter dem Ding hervorschimmern. Aus der Nähe betrachtet, wirkt es wie ein vielfach verzweigtes feines Netz, wie ein Myzel, das sich an den Sand schmiegt. Ein Gefühl des Ekels steigt in ihm auf, und er vermag nicht zu sagen, warum. Kann man sich vor etwas ekeln, das man nicht kennt, das an keiner Stelle des Erfahrungsschatzes als ekelhaft verankert ist? Kann man sich vor irgendeinem toten Gebilde einer toten Welt ekeln?
Er blickt kurz auf, und da sieht er, dass es noch mehr dieser Flecke gibt, drei, sechs, zehn, immer einer in einem bestimmten Abstand vom anderen. Er fühlt, wie sich ihm die Kopfhaut zusammenzieht, fühlt eine Gänsehaut auf den Armen.
Das ist Leben! Ein ekelhaftes Leben, das beginnt, ihn mit tödlicher langsamer Sicherheit zu attackieren. Er ist nahezu eingeschlossen. Sie waren es, die seine Spuren verwischten, sie haben dafür gesorgt, dass man weder ihn noch seine Spuren finden wird.
Und wieder beginnt er zu laufen. Humpelt im Zickzack um die völlig bewegungslosen Flecken herum, den fernen Bergen entgegen. Hält erst inne, als er weit und breit nur noch unberührten Sand sieht. Ängstlich blickt er über die Schulter zurück nach seinen Fußstapfen und sieht, dass sie weiterhin verschwinden, dass es wieder näher kommt, immer näher. Unter dem Sand verfolgen sie ihn also, feige, mordlustige Bestien.
Nach einer weiteren Viertelstunde hastigen Laufens ist er fertig. Er kann nicht mehr. Sein Atem geht pfeifend, und der Schweiß in den Augen macht ihn fast blind.
Als er wieder sehen kann und die Kreise vor seinen Augen sich langsam auflösen, sieht er vor sich, nur zwei, drei Meter entfernt, wieder einen der Flecke. Ist es der kaum vergangene Schwindel, oder bewegt sich das Ding auf ihn zu? Er starrt und starrt, aber da ist keine Bewegung. Sie halten ihn zum Narren, diese Viecher, verfolgen ihn, und wenn er sie beobachtet, verhalten sie sich still, wie tot. Aber er wird es ihnen zeigen, so leicht gibt er nicht auf.
Mit einem Wutschrei springt er einen, zwei Schritte nach vorn, registriert im Unterbewusstsein, dass der dunkelrote Fleck nicht die geringste Reaktion zeigt, dann springt er mit den schweren Stiefeln seines Schutzanzuges mitten hinein, wühlt brüllend mit dem gesunden Fuß im Sand und hört erst auf, als der Fleck eine zertrampelte, verwüstete Fläche ist.
Das Ding ist verschwunden, über dem Staub schwebt eine feine dunkelrote Wolke.
Er wartet nicht, bis sich die Staubwolke setzt. Vielleicht hat das Tier sich in diesen rötlichen Staub verwandelt, und wenn er aufhört, es zu vernichten, setzt es sich wieder und bildet erneut eines dieser tödlichen Netze. Mit gesenktem Kopf trottet er weiter, der fernen Hügelkette entgegen. Er geht langsam, schleppenden Schrittes. Der Fuß schmerzt wieder.
Nach zwei Stunden Marsch hat er keine weiteren Netze gesehen. Die fernen Hügel sind näher gerückt, und Kronert ist jetzt fast bereit, an eine Halluzination zu glauben. Er ist am Ende seiner Kraft. In den vergangenen Stunden hat er sich nicht mehr umgeblickt, hat nicht gesehen, dass seine Fußspuren nach wie vor verschwinden.
Als die Sonne zum zweiten Mal während seines Marsches den Horizont erreicht, beginnt der Boden anzusteigen. Die Füße berühren blanken Fels. Er verschwendet eine Menge Zeit damit, in den Hügeln nach einer Höhle zu suchen, in der er die Nacht zubringen kann, aber die abgerundeten Buckel zeigen nicht die geringsten Auswaschungen. Nach einer halben Stunde gibt er auf.
Nichts kann ihn mehr retten. In dieser Nacht wird er erfrieren. Er schaltet den Regler der Anzugheizung auf kleinste Leistung. Bereits jetzt beginnt die Kälte in seinen Beinen emporzusteigen. Zwischen zwei Felsen rollt er sich zusammen. Irgendwann wird man seinen Leichnam finden. Vielleicht nach Tagen, vielleicht auch nach Wochen oder Monaten. Man wird ihn in der Nähe von Ares 1 bestatten und seinen Namen auf mehrere Tafeln meißeln. Tafeln, die die Erinnerung an Menschen wachhalten sollen, die im Kosmos umgekommen sind. Eine Tafel wird nur seinen Namen tragen, und sie wird auf seinem Grab stehen. Eine weitere wird seinen Namen am Haus der Wissenschaften zu Berlin unsterblich machen, und eine andere wird den Namen Bernd Kronert in kyrillischen Buchstaben tragen, die Granittafel an der Kremlmauer auf dem Roten Platz zu Moskau. Fremde und bekannte Menschen werden Blumen unter die Tafeln legen. Auch seine Mutter wird ihm Blumen bringen, und trotz ihrer Tränen wird man ihr ansehen, dass sie stolz auf ihn ist.
Man wird ihn einen Helden nennen. Aber ist er ein Held? Frieren Helden in ihren letzten Stunden so, dass sie mit den Zähnen klappern? Oder ist es vielleicht heldenhaft, in seinen letzten Minuten auf Grind und Cortez zu fluchen, weil sie ihn nicht gesucht oder doch zumindest nicht gefunden haben?
Der Atem in seinem Helm beginnt an der Scheibe zu kondensieren. Vorsichtig dreht er den Regler ein wenig weiter auf, wartet minutenlang und stellt mit Entsetzen fest, dass die Kälte nicht mehr zu vertreiben ist. Die Batterie ist nahezu leer.
Einen Augenblick lang muss er geschlafen haben. Er erwacht von einer irrsinnigen, schneidenden Kälte. Zugleich aber glaubt er ein Geräusch zu hören, das nicht in die Totenstille des Mars passt.
Je mehr er sich auf das Geräusch konzentriert, desto deutlicher wird es. Es klingt wie das Rauschen eines Wasserfalls. Kronert richtet sich langsam auf. Das bereitet ihm unsägliche Qualen. Sein Körper ist starr vor Kälte. Auch nach den ersten Schritten ändert sich das nicht. Überall dort, wo er den Schutzanzug von innen mit der Haut des Körpers berührt, an den Handgelenken, dem Hals und beim Umdrehen an den Wangen, hat er das Gefühl, in siedendes Wasser getaucht zu werden. Wasser wird, stellt er sarkastisch fest, langsam zu seiner fixen Idee.
Vielleicht ist es auch dieser unsinnige Gedanke an Wasser, der ihn vorwärts treibt. Er denkt nicht daran, tatenlos auf den Tod zu warten.
Das Geräusch ist lauter geworden, und es wird dem Rauschen von großen Wassermassen immer ähnlicher. Natürlich weiß er, dass es auf Mars kein Wasser gibt, keinen einzigen Tropfen, aber das Rauschen ist keine Einbildung, er hört es genau, mit jedem Schritt wird es lauter. Aber er ist schon zu schwach, um vernünftig denken zu können.
Das Terrain wird immer schwieriger. Die abgerundeten Buckel der Felsen bieten den Füßen nur wenig Halt; immer öfter strauchelt er, und er ist froh, es auf die schlechten Bodenverhältnisse schieben zu können.
Und dann öffnet sich vor ihm zwischen zwei eng beieinander stehenden Felsen der Blick in das Tal. Zwar ist es fast dunkel, aber seine Augen haben sich an das schwindende Licht gewöhnt. Er sieht den Wasserfall. Es ist unglaublich, unmöglich: ein Wasserfall auf dem Mars!
Hinter einer grauschwarzen Dunstwand schießt es röhrend zwischen engen Felsen hindurch, ein mächtiger Schwall grauen, quirlenden Wassers. Über eine Breite von mindestens dreißig Metern fällt der Katarakt fast ebenso tief zu Tal.
Kronert beginnt den Abstieg. Bereits wenige Meter hinter dem gischenden Absturz hat sich der Strom beruhigt. Der aufsteigende Dunst fasziniert Kronert. Dunst entsteht nur dort, wo genügend starke Temperaturunterschiede herrschen, und das kann hier nur Wärme bedeuten.
Mit brennenden Augen starrt Kronert auf die ersten Schwaden, die er erreicht, vor seinen Augen beginnt sich alles zu drehen. Mit äußerster Anspannung kämpft er die Schwäche nieder und betrachtet das Gestein in seiner Umgebung. Irgendwo muss sich hier unter der eisigen Kälte Reif absetzen.
Unter seinen tastenden Händen rinnen an den Felsen kleine Bäche herab. Kondensat? Bei dieser Kälte? Oder ist es bereits wärmer geworden hier zwischen den Felsen? Bringt das strömende Wasser Wärme mit? Ist das die Rettung für ihn, oder ist es eine Halluzination seines schwindenden Bewusstseins?
Er fühlt sich leer; die schneidende Kälte springt ihn wieder an, als er absichtlich mit der Wange das Helminnere berührt. Vielleicht ist dieser Augenblick, in dem auch die letzte Hoffnung schwindet, der schwerste seines Marsches.
Der Entschluss, den er in diesen Minuten fasst, ist weder heroisch noch vernünftig. Er beschließt, seine Leiche von dem Strom, der sich in Richtung Ares 4 bewegt, hinwegtragen zu lassen. Näher an die Station heran, näher hin zu seinen Gefährten...
Mit klappernden Zähnen kriecht er über die Felsen abwärts zu den Wassermassen. Sein Körper ist gefühllos vor Kälte, und die Hände werden zu Klauen, die sich in die runden Steine krallen. Wasser fließt über seine Helmscheibe, graues, schmutziges Wasser.
Wenige Meter über dem Fluss rutschen die kraftlosen, klammen Finger ab, finden keinen Halt mehr auf den Felsen, plötzlich dreht sich das Tal um ihn, das gurgelnde Wasser schießt heran, und dann gibt es nur noch das Dunkel um ihn.
Ihm ist, als stürze er in einen tiefen Schacht, aus dem ihm Wärme entgegenschlägt. Wärme ist um ihn, unter ihm, über ihm.
Sie sind bereits unruhig geworden, als die Verbindung zu Ares 1 plötzlich abbrach. Vor etwa zwei Stunden ist die grüne Libelle auf dem Kommandopult plötzlich auseinandergelaufen. Und da bei Anliegen der Trägerfrequenz des Richtsenders die beiden Flügel der Libelle möglichst schmal sein müssen, bedeutet dies unzweifelhaft, dass die Verbindung zusammenzubrechen droht. Paolo Cortez ist kopfschüttelnd aufgestanden, hat versucht die Frequenz einzuregeln, aber es ist eher schlechter als besser geworden. Minuten später ist die Libelle ganz erloschen.
Eine knappe Stunde nur hat Sven Grind benötigt, um die einzelnen Baugruppen der Empfangsanlage zu überprüfen, dann steht fest, dass der Fehler nicht in der Stationsanlage von Ares 4 liegt.
Eine weitere Stunde ist vergangen, ehe er die Außenanlagen überprüft hat.
Cortez hat in der Zwischenzeit versucht, die Verbindung mit einem kleinen Handgerät herzustellen, aber diese winzigen Dinger sind nicht empfindlich genug. Eigentlich sollen ja an diesem Tag neue Geräte angeliefert werden, und das ist eben der Grund ihrer Sorgen. Jemand ist seit Stunden unterwegs nach Ares 4, und da die Verbindung nach Station 1 abgebrochen ist, kann auch der Leitstrahl abreißen.
Sven Grind kommt aus der Luftschleuse. Seine hellen Augenbrauen sind zusammengezogen, er etwas zu volle Mund ist jetzt schmal und blass.
»Draußen ist ebenfalls alles in Ordnung«, sagt er. »Wenn man davon absieht, dass die Kuppel und die Streben einen neuen Belag brauchen.«
»Verdammter Sand!«, flucht Cortez und schiebt den Tonträger zurück. »Und was nun? Da ist jemand unterwegs zu uns. Der kann ganz schön in einen Schlamassel geraten.«
Grind nickt. »Wer ist unterwegs?«, fragt er dann.
Der Südländer zieht sich die Aufzeichnung des letzten Radiogramms herüber und wirft einen kurzen Blick auf den Streifen. »Kronert von Ares eins.«