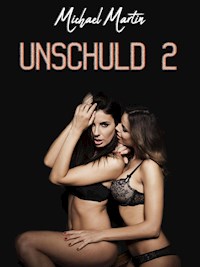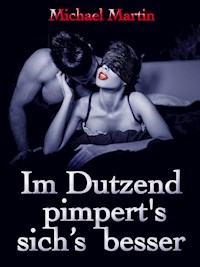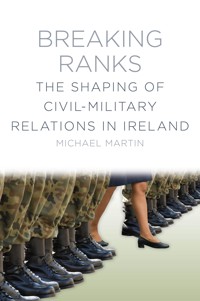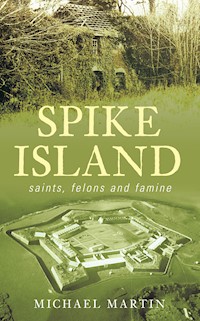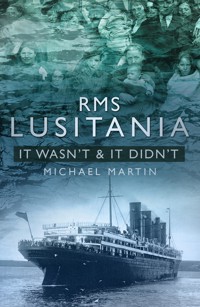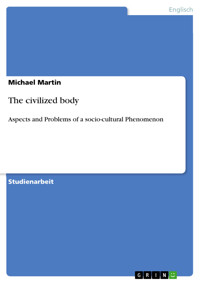12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ludwig Buchverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Unendliche Weite, einzigartige Schönheit, nahezu unberührte Natur – seit mehr als 35 Jahren bereist der Abenteurer, Fotograf und Geograf Michael Martin die Wüsten der Erde und entdeckt immer wieder neue Seiten dieses faszinierenden Lebensraums. Atemberaubende Dünen und karge Gebirgslandschaften oder die überraschend breite Palette an menschlichem, tierischem und pflanzlichem Leben sind nur einige der vielen Facetten, die den Reiz der Wüste ausmachen.
Sind Oasen tatsächlich nur ein paar Dattelpalmen rund um eine Wasserstelle? Weshalb ertrinken mehr Menschen in der Wüste als darin verdursten? Und warum gäbe es ohne die Sahara keinen Amazonas-Regenwald? Michael Martin schöpft aus seinem reichen Erfahrungsschatz und seinem umfassenden Wissen und lässt uns eintauchen in eine Welt voller Wunder und Geheimnisse. In der Stille, der Einsamkeit und der Reduktion dieser Welt erkennt er ein Gegenkonzept zu unserem reizüberfluteten Leben. Erstaunlich, erhellend, bisweilen unglaublich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Unendliche Weite, einzigartige Schönheit, nahezu unberührte Natur – seit mehr als 35 Jahren bereist der Abenteurer, Fotograf und Geograf Michael Martin die Wüsten der Erde und entdeckt immer wieder neue Seiten dieses faszinierenden Lebensraums. Atemberaubende Dünen und karge Gebirgslandschaften oder die überraschend breite Palette an menschlichem, tierischem und pflanzlichem Leben sind nur einige der vielen Facetten, die den Reiz der Wüste ausmachen.
Sind Oasen tatsächlich nur ein paar Dattlmen rund um eine Wasserstelle? Weshalb ertrinken mehr Menschen in der Wüste als darin verdursten? Und warum gäbe es ohne die Sahara keinen Amazonas-Regenwald? Michael Martin schöpft aus seinem reichen Erfahrungsschatz und seinem umfassenden Wissen und lässt uns eintauchen in eine Welt voller Wunder und Geheimnisse. In der Stille, der Einsamkeit und der Reduktion dieser Welt erkennt er ein Gegenkonzept zu unserem reizüberfluteten Leben. Erstaunlich, erhellend, bisweilen unglaublich!
MICHAEL MARTIN
mit Sabine Wünsch
DAS WESEN DER
WÜSTE
Wie der Sand in die Wüste kommt
und weshalb die Dünen singen –
die Entdeckung einer
faszinierenden Welt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2019 by Ludwig Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Thomas Tilcher
Beratung: Stefan Linde
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München,
unter Verwendung der Fotos von Michael Martin (Vorderseite),
Jörg Reuther (Rückseite), Elfriede Martin (hintere Klappe)
Fotos: Michael Martin, ausgenommen Fließtext [>>]: Gerhard Martin,
[>>]: Achim Mende, [>>], [>>], [>>]: Elke Wallner, [>>]: Jörg Reuther;
[>>]: Jörg Reuther, [>>]: Katja Kreder
Bildredaktion: Tanja Zielezniak
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-24476-7V001
www.ludwig-verlag.de
Für meine Eltern Gerda und Gerhard †,
meine Kinder Gina und David
und meine Frau Elly
Inhalt
Einleitung
Faszination Wüste
Von den Sternen zur Erde
Die Große Reduktion
Nichts für leidenschaftliche Zoobesucher
Arm an Reizen und doch nicht reizlos
Der Passat als Landschaftsarchitekt
Vom Winde verweht
Ohne Wüstenstaub kein Regenwald
Trocken ist relativ
Mit ein paar Tropfen Wasser überleben
Wenn dem Regen die Luft ausgeht
Fata Morgana – nichts als heiße Luft
Die »Himmelstreppe« – Kunstwerk mit Überraschungen
Heiße Tage, kalte Nächte – eine Halbwahrheit
Die Gobi – im Sommer Glutofen, im Winter Eisschrank
Wüste ist nicht gleich Wüste
Ein Meer aus Sand – der Erg
Die Hammada – die »Trostlose«
Kies so weit das Auge reicht – der Reg
Die Gebirgswüste – Insel des Lebens
Oasen – Vegetationsflecken in der Wüste
Die Dattelpalme – Sinnbild der Sahara
Königin der Wüsten – die Sahara
Touristen pflücken auf der Gräberpiste
Die Ténéré – das »Land da draußen«
Was Gummibären und Coca-Cola mit der Wüste zu tun haben
Wüstenbäume – Symbole des Lebens
Orientierung auf Nomadenart
Wo geht’s hier raus?
Von allem etwas – die Atacama
Schöner ist Salz nirgendwo – der Salar de Uyuni
Das »Höllenloch der Schöpfung« – die Danakil
Ein Kleinod im wahrsten Sinn des Wortes – die Namib
»Tierpark« Namib
Die Welwitschia – wahrlich wunderbar
Als die Sahara grün war
Der Jurassic Park in der Mongolei
Versunkene Städte
Ertrinken in der Wüste …
Unverhoffte Erfrischung
Regen – nicht immer ein Segen
Erst warten, dann sprießen
Der Lake Eyre – Farbwunder von kurzer Dauer
Wo geht’s zur nächsten Tankstelle?
Giftig oder ungiftig – das ist hier die Frage
Pasta, Pesto und Kamelmilch
Das Kamel – eine »Gottesgabe«
Kamel contra Motorrad
Kamelmilch – das »weiße Gold« der Wüste
Die Wüste ist gefährlich! Oder?
Von Schmugglern und Entführern
Die Straße von Bornu – Endstation Sehnsucht
Wilde Schießerei im Iran
Die Obrigkeit und das Recht des Stärkeren
Der Mensch und die Wüste
»Die Götter müssen verrückt sein«
Die Imraguen – gefangen zwischen Dünen und Meer
Wer lebt schon freiwillig in der Wüste?
»Schneevögel« in der Sonora-Wüste
Saguaro – der stachelige Gigant
Der »typische« Wüstenbewohner
Von echter und falscher Gastfreundschaft
Von Jurten und Zelten, Ziegen und Yaks
Zwischen Tradition und Toyota – Nomadenleben heute
Wo ein Toyota noch lange ein Traum bleiben wird
Haben Nomaden noch eine Zukunft?
Facetten modernen Lebens
Die geschundene Wüste
Auf neuen Wegen
Glossar
Anmerkungen
Den wahren Geschmack des Wassers erkennt man in der Wüste.
JÜDISCHESSPRICHWORT
In der Wüste spürt man das Fließen der Zeit.
ANTOINEDESAINT-EXUPÉRY
Einleitung
Die Wüste ist für viele Menschen etwas Seltenes, Exotisches, dabei sind Wüsten in ihrer Gesamtheit die größte Naturlandschaftszone der Welt: Ein Drittel der Landoberfläche besteht aus Wüsten oder Halbwüsten. Rechnet man die Polargebiete dazu, sind es sogar knapp 50 Prozent. Damit nehmen Wüsten weit mehr Fläche ein als Regenwälder, Savannen, Steppen oder Gebirge. Das bedeutet: Lässt man die Ozeane beiseite und betrachtet nur das Land, ist die Erde eigentlich eher ein Wüstenplanet. Dennoch ist unser Wissen über die Wüste erstaunlich gering; in unserer Wahrnehmung führt sie ein Schattendasein, ebenso im Film, in Büchern, in Fotokalendern und so weiter.
Warum ist das so? Ich denke, das hat damit zu tun, dass nur wenige Europäer je in einer Wüste waren, obwohl die größte von ihnen praktisch vor unserer Haustür liegt. Selbst auf dem Land- und Seeweg braucht es nur zwei, drei Tage, um in die Sahara zu gelangen. Mit dem Flugzeug geht es sogar innerhalb weniger Stunden. Wer auf die andere Seite des Mittelmeers reiste, war jedoch eher an den Stränden als an der Wüste interessiert. Wirtschaftlich und politisch spielten die dortigen Länder wie Algerien, Libyen, Mauretanien, Niger, Mali, Tschad oder Sudan für uns bis vor wenigen Jahren kaum eine Rolle. Erst durch die Flüchtlingskrise sind sie als Transitländer ins Visier geraten und in das öffentliche Bewusstsein gedrungen.
Verbreitet ist immer noch das Klischee, dass es in der Wüste außer Sand nichts gibt, dass die Wüste »wertlos« sei – was unter anderem dazu führte, dass sie in etlichen Ländern von den USA über das heutige Algerien, in Indien und China bis nach Australien für zahlreiche Atomwaffentests herhalten musste. Wenn im Regenwald Bäume abgeholzt werden, ist der Aufschrei – mit Recht – groß, wenn jedoch der Wüste Wunden geschlagen werden, um ihre Schätze auszubeuten, erklingt nicht einmal ein Raunen. Das Leben in der Wüste mag zwar nicht so präsent und überquellend sein wie im Regenwald oder in der Savanne, ist aber nicht weniger faszinierend.
Ich als Wüstenfan sage: Die Wüste ist schön, atemberaubend, ein faszinierender Teil unserer Natur. Auf der anderen Seite engagiere ich mich unter anderem für die Arbeit der Wüstenkonvention UNCCD, die einen fürchterlich sperrigen offiziellen Namen hat: United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particularly in Africa, und der GEF (Global Environment Facility), die gegen die sogenannte Desertifikation kämpfen, die Ausbreitung der Wüste. Ein Widerspruch? Nein, auch ein Fluss kann schön sein, solange er nicht über die Ufer tritt und verheerende Schäden anrichtet. Da, wo die Wüste unter den heutigen Klimabedingungen »hingehört«, nämlich in die Passatwindzone und ins Herz großer Kontinente, ist sie schlicht ein Teil unserer Erde. Doch da, wo sie sich durch Eingriffe des Menschen ausdehnt, weil er ihre Ränder übernutzt, indem er zu viele Tiere weiden lässt, zu viele Brunnen bohrt und so den Grundwasserspiegel senkt, zu viel Holz schlägt, da muss ihr beziehungsweise dem Menschen Einhalt geboten werden. Und so richtet sich die Wüstenkonvention nicht gegen die Wüste an sich, sondern gegen die menschengemachte Wüste, dagegen, dass aus der Halbwüste und der Dornbusch- oder Dornstrauchsavanne ebenfalls Wüsten werden.
Daher finde ich auch Fragen wie »Was nützt uns die Wüste?« völlig unsinnig. Genauso könnte man fragen: »Was nützt uns der Himalaja?« oder »Was nützen uns die Alpen?«. Die Wüste hat genauso ihre Berechtigung wie so manches andere, was wir für überflüssig und unnötig halten mögen: eine Stechmücke oder ein Skorpion, eine Distel oder ein Löwenzahn.
Unsere Vorstellungen von der Wüste stecken voller Klischees: Sand, Dünen, Hitze und Schlangen. Das klingt nicht sehr spannend, und dennoch lösen sie bei den Menschen etwas aus. Wobei die Assoziationen ganz unterschiedlich sind und von langweiliger Einöde bis hin zu großer Gefahr reichen. In der Regel haben die Menschen aber völlig falsche Vorstellungen von der Wüste. Sand ist in der Wüste eher selten, ebenso Dünen. Wobei Sand ungeheuer vielseitig sein kann. Die Körnchen können rund, eckig und oval sein, unterschiedlich groß, weiß, braun, schwarz, einfarbig oder gesprenkelt … Der Sandsammler Daniel Helber hat bei Wetten, dass … einmal fünf Sande richtig zugeordnet, die Thomas Gottschalk willkürlich aus 250 Sandproben aus 130 Ländern ausgewählt hatte.1 Bislang hat Daniel Helber über 7 500 Sande aus über 200 Ländern gesammelt.2 Und er ist nur einer von vielen. Es gibt Vereine von Sandsammlern, spezielle Auktionen, einschlägige Zeitschriften, Ausstellungen, Tauschbörsen und, und, und.
Eintönig ist die Wüste schon gar nicht, denn es gibt unzählige Spielarten. Die Gefahr, sich zu verirren und zu verdursten, gehört dank GPS der Vergangenheit an, das Risiko, in einen Sandsturm zu geraten, liegt praktisch bei null, wenn man zur richtigen Zeit reist, nämlich im Winter. Dann sind auch die Temperaturen angenehm. Auf Schlangen zu treffen ist auch eher die Ausnahme als eine alltägliche Bedrohung. In den 40 Jahren, die ich nun durch die Wüsten der Erde reise, habe ich zwar etliche Exemplare gesehen, hatte aber nicht einmal eine Handvoll kritischer Begegnungen mit diesen Tieren. Wenn es eine Gefahr in der Wüste gibt, dann geht sie von Menschen aus, von einander bekämpfenden Volksgruppen, von Rebellen, Schmugglern oder Islamisten. Doch das ist kein wüstentypisches, sondern ein menschengemachtes und regionales Problem.
Die Wüste hält eine Palette von Angeboten für unterschiedlichste Menschen bereit: für den Trekkinggeher, den Outdoorfan, den Hobbyastronomen, den Abenteurer … Dem Yogi und Meditierenden dient sie als Kulisse mit wenig Ablenkungen, der religiöse Mensch sucht in ihrer Leere und Stille die Nähe zu Gott, der Gestresste Erholung. Insofern ist die Wüste auch eine Projektionsfläche für Wünsche und Sehnsüchte. Wieder andere zieht es aus gänzlich profanen Gründen in die Wüste: Der Rallyefahrer will in ihrem unwegsamen Gelände seine Fahrkünste testen, der Marathonläufer seine Grenzen ausloten. Den Minenbetreiber und den Erdölkonzern interessieren die Bodenschätze und den Solarstromerzeuger lediglich die 350 Sonnentage pro Jahr. Für die Wüstenbewohner wiederum ist sie ihr Lebensraum, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Faszination Wüste
Manchmal wünschte ich, ich hätte das literarische Talent eines Antoine de Saint-Exupéry, der in seinem Roman Nachtflug oder in seinem Erlebnisbericht Wind, Sand und Sterne die Wüste so wunderbar beschrieben hat. Doch ich bin kein Romancier, eher ein »nüchterner Romantiker«.
Die Faszination, die die Wüste auf mich – und auf viele Menschen gerade aus unserem Kulturkreis – ausübt, liegt darin, dass sie in krassem Gegensatz zu unserem Lebensraum und überhaupt unserem Leben steht. Wir leben in einem extrem unübersichtlichen Umfeld. Egal, ob man sich in unseren Städten zurechtzufinden versucht, in den Tarifsystemen des öffentlichen Nahverkehrs, in den Vorschriften beim Hausbau, im Dickicht der unterschiedlichen Leistungen von zig verschiedenen Krankenversicherungen: Es ist kompliziert. Auch die europäische Topografie ist unübersichtlich: Berge, Wälder, Felder, Wiesen, Moore, Seen, überall Dörfer, Städte, Windräder, Strommasten – und alles durchzogen von Autobahnen und Bundesstraßen. Es ist ein Übermaß an Infrastruktur, Informationen, an Ansprüchen und Anforderungen, aber auch an Möglichkeiten, mit denen wir Tag für Tag konfrontiert werden.
Eine beinahe ständige Reizüberflutung malträtiert zudem unsere Sinne. Man muss sich einmal vergegenwärtigen, was alles auf uns einlärmt: Stimmen von Menschen und Tieren, der Radau von Motoren, Hupen, quietschenden Bremsen, Musik aus fremden Kopfhörern, Durchsagen an Bahnhöfen, in den Verkehrsmitteln, in Kaufhäusern, das Rascheln von achtlos weggeworfenem Papier, um nur einiges zu nennen. Ähnlich ist es mit optischen Reizen. Unseren Augen ist im Grunde nur im Schlaf Erholung vergönnt. Die restliche Zeit werden sie im Sekundentakt von Bildern bestürmt. Wohin man schaut Menschen, Tiere, Gebäude, Fahrzeuge, Straßenschilder und Werbung, Werbung, Werbung. Alles bunt und vieles davon in ständiger Bewegung. Dass der durchschnittliche Deutsche pro Tag über 5 000 Werbekontakte hat, ist zwar ein Mythos des Medienalltags, doch bei realistischer Schätzung kommt man, abhängig unter anderem davon, wie lange man vor dem Fernseher sitzt oder im Internet surft, immerhin noch auf 500 bis 1 000.3 Selbst das ist erschreckend viel. Auch die Nase muss einiges verkraften, ist einem beständigen olfaktorischen Angriff zahlreicher angenehmer wie unangenehmer Gerüche ausgesetzt: Deos, Parfüms, Abgase, Schweiß, um nur ein paar zu nennen.
In der Wüste hingegen ist alles auf ein Mindestmaß reduziert. Sie ist klar, übersichtlich, weit, rein und auf eine angenehme Art und Weise »leer« und still. Sie ist Erholung pur für unsere Sinne. Das schafft Platz zum Durchatmen und verleiht – fernab von jeglicher Religion, Spiritualität oder Esoterik – inneren Frieden.
Was mich neben der Klarheit und Ruhe vom ersten Augenblick an faszinierte, war der Dreiklang aus fotografischem Motiv, Geografie und Abenteuer, ein Dreiklang, der durch die folgenden 40 Jahre schwang. Die Fotografie war neben der Astronomie seit meiner Kindheit ein Hobby. Erdkunde, wie der Geografieunterricht in meiner Jugend noch hieß, war mein Lieblingsfach in der Schule, und Abenteuer hatten mich schon immer gelockt. Für ein Kind und einen Jugendlichen ist das sicher nicht verwunderlich, doch ich bin, was das angeht, Kind geblieben; bei mir hält die Abenteuerlust bis zum jetzigen Tag an.
Abenteuer zu erleben ist heute allerdings schwieriger geworden, weil auch die Wüsten immer mehr erschlossen werden, weil ich inzwischen sehr viele Erfahrungen sammeln konnte und weil die Technik immer ausgereifter wurde. Meine abenteuerlichsten und auch gefährlichsten Wüstenreisen waren die in den 1980er-Jahren, als die Wüste für mich Neuland war, als es weder GPS noch Satellitentelefone gab und die Fahrzeuge nicht so zuverlässig waren wie heutzutage.
Dafür gab es damals eine andere, weit größere Gefahr noch nicht: die Islamisten. Wenn man »Glück« hat, nutzen sie einen als Geisel, um Lösegeld zu erpressen, und es findet sich jemand, der einen auslöst. Anderenfalls bringen sie einen um. Ich liebe das Abenteuer, das bedeutet aber nicht, dass ich mein Leben leichtfertig aufs Spiel setze. Seit Jahren ist die Sahara daher für mich tabu, und es ist fraglich, ob ich die »Königin der Wüsten« jemals wiedersehen werde.
Schon als Schüler übten die Sterne eine große Faszination auf mich aus und führten mich mit 17 zum ersten Mal in die Wüste.
Von den Sternen zur Erde
Als Junge hatte ich genauso wenig eine Vorstellung von der Wüste wie jeder andere Schüler. Ich war damals begeisterter, fast schon fanatischer Hobbyastronom. Auf dem Garagendach meiner Eltern hatte ich mir eine kleine Sternwarte eingerichtet und selbst ein großes Teleskop gebaut. Ich war sehr stark in der Jugendgruppe der Volkssternwarte von Diedorf im schwäbischen Landkreis Augsburg engagiert, machte Führungen. Alles drehte sich um Sterne. Mädchen interessierten mich überhaupt nicht, die Schule nicht viel mehr. Mein größtes Problem damals war die Lichtverschmutzung. Denn zwischen meiner Sternwarte in Gersthofen und dem Südhimmel mit seinen vielen interessanten Objekten liegt Augsburg, dessen Lichterschein keine gute Sicht auf die Sterne und Gasnebel erlaubte.
Schon mit 14 radelten mein Freund Achim, ebenfalls begeisterter Hobbyastronom, und ich daher am Wochenende oft ins Berwangtal nach Tirol, um vom 2 000 Meter hohen Hönig aus eine bessere Sicht auf die Sterne zu genießen. Im Gepäck Teleskope, Kameras und Stative. Zum Glück hatte ich weltoffene, tolerante Eltern – wenngleich mein Vater ein eher vorsichtiger Mann mit einem großen Sicherheitsbedürfnis war –, und wir machten ja auch etwas Sinnvolles. Wenn wir erst morgens um vier nach Hause zurückkehrten, kamen wir von der Volkssternwarte, nicht aus der Disco. Besonders mein Vater unterstützte mein Interesse an den Sternen, machte sogar Vorschläge für unsere Routen, wenn wir nach Österreich und später bis nach Italien radelten. Die Grenzposten interessierten sich damals überhaupt nicht für uns, winkten uns einfach durch. Vermutlich wirkten wir trotz unserer langen Mähnen harmlos.
Ein paar Jahre später, mit 17, war uns das nicht mehr genug. Denn bis dorthin, wo die Milchstraße wirklich interessant wird, mit Gasnebeln und Dunkelwolken, wo die beeindruckenden Sternbilder Schütze und Skorpion mit ihren Sternhaufen sind, oder gar bis zum Kreuz des Südens reichte unser Blick nicht, auch nicht von Italien aus. Das Kreuz des Südens zu sehen musste vorerst ein Traum bleiben, dazu hätten wir nach Namibia oder Chile reisen müssen. Aber wir wollten versuchen, mit den vorhandenen Mitteln und in der verfügbaren Zeit – sechs Wochen Sommerferien – so weit wie möglich in den Süden zu kommen. Als Ziel setzten wir uns den Südosten Marokkos. Dort würden wir all das Licht der zivilisierten Welt weit im Rücken haben, während sich vor uns der klare Himmel über der Wüste erstreckte. Das war das Einzige, was mich zu dem Zeitpunkt an der Wüste interessierte, ansonsten war sie mir völlig egal.
Was mir damals überhaupt nicht bewusst war und ich erst im Lauf meiner Reisen lernte, ist, dass wir Europäer die Sterne völlig anders sehen als zum Beispiel die Marokkaner oder die Tuareg. Viele »unserer« Sternbilder gehen auf Gestalten aus der griechischen Mythologie zurück, und sowohl beim Zusammensetzen von Sternen zu Bildern als auch bei deren Benennung war viel Fantasie im Spiel, denn die einzelnen Sterne haben ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Da ist es kein Wunder, dass andere Kulturen und Völker ganz andere Linien zwischen den Himmelskörpern zogen und so völlig andere Bilder entstanden oder dass sie die Bilder anders interpretierten. Unser Großer Bär ist in den USA der Große Löffel. Was bei uns ein Skorpion, ist bei den Chinesen ein Drache, und während wir zwölf Tierkreiszeichen haben, haben die Chinesen, die den Sternenhimmel generell ganz anders kartieren, 28.4
Dieses Mal stimmten unsere Eltern den Reiseplänen nicht so bereitwillig zu. Reisen in entfernte Länder waren Anfang der 1980er-Jahre noch richtige Abenteuer. Es gab kaum Straßenkarten, keine alternativen Reiseführer wie Lonely Planet, kein Internet, kein Handy, keine Billigflüge. Es erforderte einiges an Überzeugungsarbeit – vor allem bei meinem Vater –, bis wir schließlich die Erlaubnis bekamen.
Mit dem Fahrrad in sechs Wochen nach Marokko zu reisen war ein höchst ehrgeiziges Ziel. Da war es vielleicht ganz gut, dass ich mir beim Training für die Gewalttour Knieprobleme zuzog und wir die Fahrräder gegen Mofas tauschen mussten. Dachten wir. Am letzten Schultag brachen wir auf und kamen zunächst zügig voran. Doch schon bei der ersten größeren Steigung – und davon sollten auf unserer Route über die Alpen zu unserem Leidwesen noch etliche folgen – erwiesen sich die Mofas als äußerst nachteilig. Sie waren mit einem PS schlicht zu schwach motorisiert. Statt entspannt gen Süden zu rattern, schoben wir die schwer beladenen Gefährte schwitzend und fluchend einen Pass nach dem anderen hoch. Das geplante Tagespensum von 200 Kilometern schafften wir so natürlich nicht. Als wir die Berge endlich hinter uns hatten, freuten wir uns darauf, nun Gas geben und uns den kühlen Fahrtwind um die Ohren wehen lassen zu können. Doch es war brütend heiß, und das bisschen Fahrtwind trocknete uns nur die Kehle aus. Bald schmerzte uns der Rücken vom stundenlangen krummen Sitzen, und die Fahrerei war fürchterlich eintönig. Nach fünf langen Wochen erreichten wir über Nizza, Barcelona, Algeciras, Tanger und Meknes endlich das marokkanische Städtchen Erfoud. Von dort waren es nur noch 50 Kilometer – auf damals noch ungeteerter Piste – bis zu dem kleinen Ort Merzouga am Rand des Dünengebiets Erg Chebbi, dem südlichsten Punkt, den wir mit unseren Mofas erreichen konnten.
Marokko war für uns ein exotisches Land. Die Menschen in ihren traditionellen Djellabas, den bodenlangen Überwürfen mit der für Marokko typischen spitzen Kapuze, ihre Freundlichkeit, die farbenprächtigen Suks mit ihrer Vielfalt an bunten Stoffen und duftenden Gewürzen – wir fühlten uns wie in einem Märchen aus 1 001 Nacht. Doch war all das nichts im Vergleich zur Wüste. In dem Augenblick, als ich auf die erste Düne stieg und sich vor mir das – wie mir damals schien – endlose Dünenmeer auffächerte, war ich ihr verfallen. Ich fand sie unglaublich ästhetisch und spürte: Das ist es. Das ist meine Landschaft. Schon damals liebte ich das Reduzierte, klare Formen. Was mich mit am meisten faszinierte, war die unglaubliche Weite. Ein Schild im gut 300 Kilometer weiter südwestlich gelegenen Zagora, von dem ich unterwegs ein Foto gesehen hatte, gibt die Entfernung für Karawanen bis nach Timbuktu am Südrand der Sahara mit 52 Tagesreisen an. Für mich unfassbar, denn Achim und ich hatten mit dem Mofa von Gersthofen bis hierher über 30 Tage gebraucht und dabei Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und schließlich noch halb Marokko durchquert. Die Vorstellung, einfach loszumarschieren, in diese Weite mit der freien, durch absolut nichts gestörten Sicht bis zum Horizont hineinzulaufen, war überwältigend. Und das ist bis heute so geblieben. Im Regenwald zum Beispiel fühle ich mich überhaupt nicht wohl; da herrscht mir zu viel Chaos, er ist mir zu unübersichtlich. Er schränkt meinen Blick ein. Auch Berge finde ich am schönsten, wenn ich ganz oben stehe und einen weiten Blick habe.
Ich konnte mich an der Wüste gar nicht sattsehen, und mir war klar, dass ich wiederkommen würde. Kurz vor der Abreise aus Marokko erfuhr ich, dass mein Vater sterbenskrank war. Ein Jahr lang verbrachte er im Krankenhaus und in der Rehabilitation. Er wurde nie mehr der, der er einmal war. So furchtbar das für die ganze Familie war und sosehr ich meinen Vater liebte, war es für mich doch auch eine Chance, denn er verlor seinen liebevoll-autoritären Einfluss auf mich, und so konnte ich von nun an reisen, wie und wohin ich wollte, ohne Konflikte mit ihm ausfechten zu müssen. Er hätte bei vollständiger Gesundheit auch mein nachlässiges Studentenleben nicht toleriert, das sich wegen meiner vielen Wüstenreisen gewaltig in die Länge zog – 21 Semester wurden es, bis ich endlich ein Diplom in der Tasche hatte. Dass ich mit meiner Leidenschaft für die Wüste einmal meinen Lebensunterhalt verdienen würde, konnte er nicht ahnen – so wenig wie ich.
Bei aller Liebe zur Wüste: Nie hätte ich ihretwegen auf Beziehungen, eine Familie, Kinder, ein Zuhause verzichten wollen. Ich genoss das ganz normale Leben mit so banalen Dingen wie Schneeschippen und später Elternsprechstunden genauso wie mein »wüstes« Leben. Es war nicht einfach nur eine Pause zwischen zwei Reisen, die mir half, mich zu ordnen und zu orten, sondern war mir immer immens wichtig. Besonders gilt das für die Familie. Wenn ich nicht schon auf dem Rückweg aus Marokko gewesen wäre, als ich die Nachricht von der Erkrankung meines Vaters erhielt, hätte ich die Reise sofort abgebrochen. Als im Januar 1988 meine Tochter Gina dreieinhalb Monate zu früh auf die Welt kam, war ich gerade auf dem Sprung in die Wüste. Die Pilotsendung zur neuen Serie Abenteuer und Legenden von Dieter Kronzucker sollte die Salzkarawanen von Taoudeni nach Timbuktu zum Thema haben, und ich sollte als Wüstenexperte das Fernsehteam begleiten. Doch für mich stand sofort außer Frage, dass die Wüste und die großartige Chance, mit Kronzucker zu arbeiten, zurücktreten mussten. Ich blies die Reise ab. Monatelang bangte ich um Ginas Leben, bis feststand, dass sie ohne Schäden überleben würde – als erstes Frühchen in München, das mit nur gut 600 Gramm geboren wurde.
Die größte Herausforderung und das größte Abenteuer meines Lebens lagen letztlich genau darin: die Balance zu finden zwischen Berufs- und Privatleben, 40 Jahre lang Wüsten zu erkunden, mit meinen Vorträgen kreuz und quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu reisen und »im Markt« zu bleiben und bei alledem ein »normales« Leben in Deutschland zu führen, zwei Kinder großzuziehen, enge Freundschaften zu erhalten und die Frau meines Lebens zu finden.
Die Große Reduktion
Eines haben alle Wüsten gemein: Es sind Gebiete (fast) ohne Vegetation – wenn man die englischsprachige Definition außer Acht lässt. Englischsprachige Geografen bezeichnen jedes Gebiet ohne Oberflächenwasser als Wüste – unabhängig davon, wie viele Pflanzen es dort gibt. So ist der größte Teil der Großen Victoria-Wüste in Australien von Eukalyptuswäldern, Büschen und Gräsern bewachsen. In der Tanami, ebenfalls Australien, wurden bei Feldforschungen im Jahr 1996 1 073 Pflanzenarten registriert. Egal, für englischsprachige Geografen ist das alles Wüste, und in den meisten Fällen haben wir ihre Bezeichnung übernommen. So sprechen wir auch im Deutschen beispielsweise von der Tanami-Wüste, obwohl sie allenfalls eine Halbwüste, in Teilen sogar eher eine Steppe ist.
In den »richtigen« Wüsten herrscht dagegen tatsächlich Vegetationsarmut. Im Ostteil der Sahara, der sogenannten Libyschen Wüste, und in der Tanezrouft, einem Gebiet an der Grenze zwischen Algerien und Mali, sowie in der iranischen Wüste Lut gibt es sogar Hunderttausende Quadratkilometer ohne Pflanzenwuchs, was aber nicht heißt, dass es dort überhaupt kein Leben gäbe. In Bodenproben, die in der Nähe des südalgerischen Grenzortes In Guezzam genommen wurden, fand man in einem Gramm Boden 3 300 Pilzsporen und 10 000 Bakterien. Im Allgemeinen jedoch ist »Vegetationsarmut« relativ gemeint: So kommen beispielsweise in der Sahara mit ihren neun Millionen Quadratkilometern gerade einmal 1 400 Pflanzenarten vor – ein Wert, der im tropischen Regenwald auf nur wenigen Quadratkilometern erreicht wird. Auch das Vorkommen oder Verschwinden bestimmter Pflanzen ist, neben klimatischen Grenzwerten, ein zuverlässiger Indikator für die Abgrenzung von Wüsten. Die Nordgrenze der Sahara etwa lässt sich durch das Verschwinden des Halfagrases bestimmen, das im westlichen und südlichen Mittelmeerraum heimisch ist, und ihre Südgrenze durch das Auftauchen des Stachelgrases Cenchrus biflorus, dort besser unter dem französischen Trivialnamen Cram-Cram bekannt, und der Dattelpalme.
Neben der Pflanzenarmut oder gar dem gänzlichen Fehlen von Vegetation wird man in der Wüste auch andere Phänomene nur höchst selten erleben: Geräusche, Lichtquellen, Gerüche.
Was mir in der Wüste immer als Erstes auffällt, ist die Abwesenheit des Grundrauschens durch den Verkehr, von dem wir sonst Tag und Nacht umgeben sind. Zumeist nehmen wir dieses Grundrauschen gar nicht mehr wahr, hören nur noch die Geräusche, die daraus hervorstechen, wie das Signal eines Zuges, das Hupen eines Autos oder die Sirene eines Krankenwagens. In abgelegenen Gegenden auf dem Land fehlt das Grundrauschen zwar ebenfalls, aber es gibt immer noch andere Geräusche, das Rascheln von Blättern, das leise Raunen von Ähren im Wind, das Zwitschern der Vögel, vielleicht das Gurgeln eines Baches. In der Wüste bringt der Passat vielleicht mal ein Gebüsch zum Rascheln oder lässt die Zeltplane knattern, bevor er wieder nachlässt. Ansonsten ist es die meiste Zeit still, manchmal so still, dass man den eigenen Herzschlag und das Rauschen des Blutes hört, so still, dass man die Stille fast greifen kann. Dadurch fallen etwaige Geräusche umso stärker auf, und vor allem hört man sie sehr viel eher.
Die häufigsten Geräuschquellen sind Oasen und Nomaden. Schon von Weitem hört man das Lachen von Kindern, das Gackern von Hühnern oder das Meckern einer Ziege. Das markanteste Geräusch in der Wüste stammt von Fahrzeugen, das fürchterlichste definitiv von Kamelen oder Eseln. Im Januar 2014 hatten wir nicht weit entfernt von der Guelta d’Archei unser Nachtlager aufgeschlagen. Am nächsten Morgen wollten wir diese natürliche, von Grundwasser gespeiste Wasserstelle im Ennedi-Gebirge im Nordosten des Tschad besuchen, die berühmt ist als Tränke für Kamele, vor allem jedoch wegen ihrer Krokodile. Die »Sahara-Krokodile« sind ein Überbleibsel aus der letzten Feuchtperiode in der Region, die vor etwa 5 000 Jahren endete. Während in der Folgezeit die Flüsse der umliegenden, offenen Gegenden austrockneten, blieb aufgrund spezieller klimatischer Bedingungen die Wasserversorgung im Ennedi-Massiv erhalten und schuf ein Refugium für die Krokodile. Die wenigen im Ennedi-Gebirge lebenden Exemplare – nach Schätzungen zwischen sechs und neun Tiere, die genaue Anzahl weiß niemand – sind vermutlich die letzten in der östlichen Sahara noch vorkommenden Vertreter des seltenen Westafrikanischen Krokodils.
Während die Fahrer bei den Autos und unsere Freunde beim Lagerfeuer blieben, unternahmen meine Frau Elly und ich wie jeden Abend einen Nachtspaziergang in die Wüste hinein. Wir waren etwa eine halbe Stunde in der Dunkelheit unterwegs, als in unmittelbarer Nähe und ohne Vorwarnung ein ohrenbetäubendes, raumfüllendes Brüllen ertönte, das uns zu Tode erschreckte. Ein Löwe, dachte ich unwillkürlich, und schüttelte im nächsten Moment über mich selbst den Kopf, da es im Ennedi-Massiv schon seit Jahrzehnten keine Löwen mehr gab. Als ich die Taschenlampe anknipste, stellte sich der Urheber des Angst einflößenden, markerschütternden Geschreis als Esel heraus. Nie zuvor und nie mehr danach habe ich einen Esel derart brüllen hören.
Neben der Stille, den höchst selten wahrzunehmenden Geräuschen, fasziniert mich an der Wüste das Fehlen der Lichtverschmutzung. Das wurde mir wieder so richtig bewusst, als ich im Herbst 2018 mit Elly im Murnauer Moos unter freiem Himmel nächtigte. Wir waren weit abseits von Murnau am Staffelsee mit seinen gerade einmal 12 000 Einwohnern im Nordosten und dem kleinen Dorf Grafenaschau mit nur gut 600 Einwohnern im Westen des Mooses. Es war eine stockdunkle Nacht, zumindest theoretisch, denn weit weg im Nordosten sah man den Lichterschein des 60 Kilometer Luftlinie entfernten Münchens.
Die Lichtverschmutzung hat mittlerweile ein derart hohes Ausmaß angenommen, dass über 80 Prozent der Weltbevölkerung und 99 Prozent der Menschen in Europa und den USA unter einem unnatürlich hellen Nachthimmel leben. Das allgegenwärtige Streulicht stört nicht nur unseren Tag-Nacht-Rhythmus, sondern macht uns regelrecht blind gegenüber den Schönheiten des Nachthimmels.5 Wer die wundervolle Milchstraße sehen will, muss dazu in die Wüste. Die nordamerikanischen Wüsten sind in der Regel ungeeignet, da es zu viele Großstädte in ihrer Nähe gibt: Der Lichterschein von Los Angeles und Las Vegas etwa reicht bis tief in die Mojave hinein. In anderen Wüsten ist dem nicht so. Nicht umsonst werden die größten und besten Sternwarten der Welt in Wüsten errichtet, allen voran in der chilenischen Atacama, denn an kaum einem anderen Ort der Welt ist die Luft so ruhig und klar und die Lichtverschmutzung so gering wie dort. Ihr erstes Observatorium baute die Europäische Südsternwarte (ESO) in den 1960er-Jahren auf dem Berg La Silla. Mit »zwei der weltbesten Teleskope der 4-Meter-Klasse [ist] La Silla weiterhin eines der wissenschaftlich produktivsten Observatorien weltweit«.6 Das »fortschrittlichste optische Observatorium […] und das höchstentwickelte optische Instrument der Welt«7, so die ESO auf ihrer Website www.eso.org, steht allerdings gut 600 Kilometer weiter nördlich auf dem Berg Paranal. Vier Einzelteleskope mit einem Spiegeldurchmesser von je 8,20 Metern und vier bewegliche Hilfsteleskope mit jeweils 1,80 Meter Durchmesser können zu einem riesigen Interferometer zusammengeschaltet werden, einem Gerät, das die Überlagerungen von Wellen für Präzisionsmessungen nutzt. Im Mai 2017 wurde ebenfalls in der Atacama der Grundstein zu einem noch gewaltigeren »Fernrohr« gelegt. Einer der fünf Spiegel des neuen European Extremely Large Telescope (E-ELT), der Hauptspiegel, wird den gigantischen Durchmesser von 39 Metern haben.8
Ursprünglich war der Gamsberg (oft auch »Gansberg« geschrieben) in Namibia favorisiert worden. Der Tafelberg, etwa 140 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Windhoek gelegen, gilt dank der äußerst geringen Luft- und Lichtverschmutzung bis heute als einer der besten Standorte zur Beobachtung des südlichen Sternenhimmels. Eine Sternwarte in Namibia zu bauen, das damals noch Südwestafrika hieß und von Südafrika verwaltet wurde, hätte das Apartheid-Regime als Anerkennung seiner Rassentrennungspolitik werten können, weshalb man sich schließlich für La Silla entschied. Man mag es als Treppenwitz der Geschichte sehen, dass sich in Chile wenige Jahre später, 1973, Augusto Pinochet an die Macht putschte und eine brutale Militärdiktatur errichtete, die Tausende Menschenopfer forderte. Heute stehen auf dem brettebenen Plateau des Gamsbergs, das 2 500 Meter in der Länge und durchschnittlich 800 Meter in der Breite misst, Teleskope – unter anderem ein 71-cm-Newton-Teleskop – des gemeinnützigen Vereins Internationale Amateursternwarte e. V., die Hobbyastronomen aus der ganzen Welt anziehen.
Meine Begeisterung für die Astronomie wurde durch die Wüste zwar in den Hintergrund gedrängt, ganz verschwunden ist sie jedoch nie. Es ist unbeschreiblich, am späten Abend unter freiem Himmel in der Wüste zu liegen und auf die Sterne zu warten. Sie schälen sich nicht wie bei uns nach und nach aus dem Dunst am Horizont, sondern erstrahlen einer nach dem anderen urplötzlich in vollem Glanz, als würden sie »angeknipst« werden. Ein Anblick, der mich immer wieder fasziniert.
Was ich in 40 Jahren nicht gesehen habe – und ich hoffe, eines Tages wird es mir vergönnt sein –, ist ein Naturphänomen namens Grüner Blitz: Wenn die Sonne an einem extrem klaren Tag hinter einem weit entfernten und scharf konturierten Horizont verschwindet, kann ihr oberer Rand für einen Sekundenbruchteil leuchtend grün werden. Das kommt daher, dass nahe am Horizont die Lichtbrechung am stärksten ist, weshalb die untergehende Sonne in ihre Spektralfarben zerlegt wird. Wenn der rote innere Kreis schon nicht mehr zu sehen ist, bleiben noch der grüne und der blaue Rand oberhalb des Horizonts. Da blaues Licht aber einer starken Streuung unterliegt, ist es nahezu unsichtbar, sodass nur das Grün übrig bleibt.
Auch Gerüche fehlen in der Wüste, allenfalls nimmt man sie sehr reduziert wahr. Es ist schwer, ja im Grunde unmöglich, diesen Zustand jemandem zu beschreiben, der noch nie in der Wüste war, denn überall sonst auf der Welt, ob in Städten, auf dem Land, im Wald oder auf dem Meer, sind wir beständig von Gerüchen umgeben. Sand und Geröll hingegen riechen nach … ich würde sagen: nach nichts. Allerdings bin ich auch noch nie übers Gestein gekrochen, um daran zu schnuppern.
Die wenigen Gerüche, die man in der Wüste hin und wieder wahrnimmt, rühren von einer krautigen Pflanze oder auch einmal von einem verwesenden Tier. Höchst unangenehm, geradezu eklig ist es, wenn ein kürzlich verendetes Kamel direkt neben einem Brunnen liegt. Abgesehen vom Gestank, fragt man sich in einem solchen Fall unwillkürlich, ob das Wasser dort in Ordnung ist. Doch normalerweise »verdorren« Kadaver dank des trockenen, heißen Klimas so schnell, dass sie die Nase nicht lange belästigen.
Eine neolithische Reibeschale, die ich im Sandmeer der Ténéré fand. Vor 6 000–7 000 Jahren wurde sie zum Mahlen von Getreide verwendet.
Nichts für leidenschaftliche Zoobesucher
Für Tierliebhaber ist die Wüste in gewisser Weise ein Problem: Schlangen und Skorpionen – die einen oft, die anderen immer giftig – will man eigentlich gar nicht nahe kommen, und die meisten anderen Tiere bekommt man nur mit viel Glück zu Gesicht. Während man in einem Regenwald oder auch in unseren Regionen auf Schritt und Tritt Tiere sieht oder hört, trifft in der Wüste die »Große Reduktion« auch auf das Tierleben zu.
Die lebensfeindliche Umgebung zwingt Wüstentiere zu einem immerwährenden Überlebenskampf: Sie müssen sich vor Überhitzung schützen und extreme Temperaturschwankungen aushalten, sie müssen mit einem geringen Angebot an Nahrung und Wasser auskommen, sie müssen hohe Dosen an UV-Licht vertragen und dem Wind trotzen, der die Austrocknung fördert. Beutetiere finden nur wenig Schutz und Raubtiere kaum Deckung. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Wüsten im Vergleich zu anderen Lebensräumen keine Artenvielfalt zu bieten haben. Am häufigsten vertreten und am weitesten verbreitet sind Insekten. Einige Arten sind sogar in unbelebten Gebieten zu finden, wenn auch meist unfreiwillig, weil der Wind sie dorthin verfrachtet hat.
Säugetierarten sind in der Wüste am seltensten. In der riesigen Sahara etwa gibt es gerade einmal 50, die meisten davon Nagetierarten wie Renn- und Springmäuse, die mit relativ wenig Wasser und ein paar Gräsern, Samen, Zweigen oder Wurzeln auskommen. Sie sind wiederum eine wichtige Nahrungsquelle für Reptilien, Vögel und andere Beutegreifer, wie beispielsweise den Wüstenfuchs.
Von Kamelen abgesehen, die in der Regel noch recht munter sind, sieht man in der Wüste daher, wenn überhaupt, häufiger tote als lebende Tiere. Das klingt unangenehmer, als es in den meisten Fällen ist, denn wie bereits erwähnt, wird aufgrund des trockenen, heißen Klimas alles, was nicht anderen Lebewesen als Nahrung dient, in relativ kurzer Zeit mumifiziert und hat daher kaum die Chance, einen Aasgeruch zu verströmen. Erstaunlich oft sah ich in der Sahara tote Zugvögel, die den Überflug aus welchen Gründen auch immer – sei es Nahrungs- oder Wassermangel oder Erschöpfung – nicht geschafft haben. Mitten in der Ténéré, einer Teilwüste der Sahara im Nordosten Nigers, stieß ich einmal sogar auf einen mumifizierten Storch. Schreitet die Desertifikation weiter voran, werden in Zukunft wohl immer mehr Zugvögel dieses Schicksal erleiden, weil sie die größer werdende Entfernung zwischen den Wasserstellen und Futterquellen nicht mehr überwinden können.