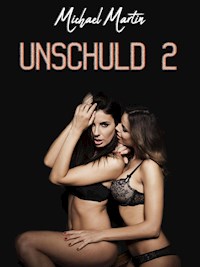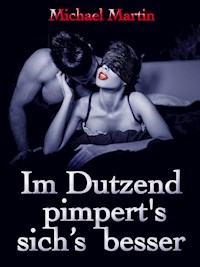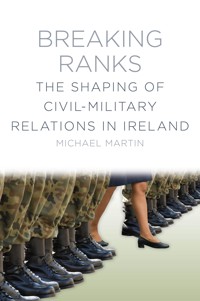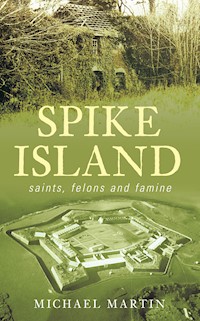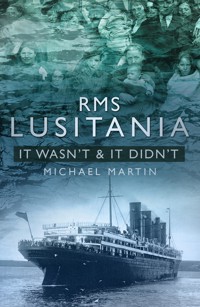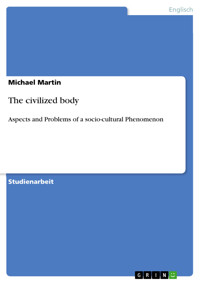19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knesebeck Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knesebeck Stories
- Sprache: Deutsch
Vom jugendlichen Sterngucker zu einem der renommiertesten Reisefotografen der Welt Als Michael Martin fünfzehn Jahre alt war, hielt er seinen ersten öffentlichen Vortrag. Acht Zuschauer kamen – und bescherten dem jungen Hobbyastronomen das erste selbst verdiente Geld. Seither hat Michael Martin über hundert Länder bereist und füllt längst die großen Säle – die Leidenschaft für das Abenteuer und die Fotografie aber ist geblieben. Wo er als Teenager mit Kamera und Fernrohr nach Sternbildern suchte, in die Alpen radelte und mit dem Mofa nach Marokko fuhr, unternimmt er heute weltweite Expeditionen, welche die Vielfalt der Landschaften auf der Erde zeigen: Wüsten und Eisregionen, Regenwälder, Vulkane, Steppen und Savannen, den Südpazifik und das Nordpolarmeer. Michael Martins sehr persönlicher Rückblick auf 45 Jahre Fotografenleben und eine Welt im Wandel In den über vier Jahrzehnten seiner fotografischen Tätigkeit hat sich viel verändert: vor, in und hinter der Kamera. Vor der Kamera werden die Folgen des ökonomischen Fortschritts und des Klimawandels weltweit immer offensichtlicher, und es fand ein rasanter sozialer und kultureller Wandel statt. Technische Neuerungen in der Kamera – vom rein mechanischen Fotoapparat bis hin zur fliegenden Hightech-Drohne, von empfindlichen Diafilmen zu hochauflösenden Sensoren – forderten Michael Martin immer wieder neu, eröffneten ihm aber auch bis dahin ungeahnte Möglichkeiten. Auch hinter der Kamera stand die Welt nicht still. Für einen Profifotografen ist die Arbeit mit dem Drücken des Auslösers längst nicht getan, denn die Bilder müssen ihren Weg zum Publikum finden. Und auf diesem Weg hat sich ebenfalls einiges geändert. Die Bearbeitung von analogen und digitalen Bildern unterscheidet sich fundamental, aus Diavorträgen wurden Multivisionsshows, Bücher, Kalender und Ausstellungen stehen heute im Wettbewerb zu Instagram. Michael Martins Wissen und Leidenschaft, seine persönlichen Erfahrungen und spannenden Geschichten machen das Buch zu einem Muss für Fotografieliebhaber und Reisende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für meine Eltern Gerhard und Gerda Martin
Für meine Frau Elly
Für meine Kinder Gina und David
Für mein Enkelkind Lara
Deutsche Originalausgabe
Copyright © 2021 von dem Knesebeck GmbH & Co. Verlag KG, München
Ein Unternehmen der Média-Participations
Alle Fotografien © Michael Martin außer
Coverbild und Seite 7,30,43,66,76,79,80,98,103,123,126,129,
133,146,147 rechts, 212,218,222,231,237 © Jörg Reuther;
Seite 37 links, 40 rechts, 136,221,229 © Elly Martin;
Seite 185,186 © Achim Mende; Seite 19,68 © Stefanie Wittmann;
Seite 86 © Christoph Höbenreich; Seite 206 rechts © Katja Kreder.
Ferner stammen einige Bilder aus dem Archiv von Michael Martin.
Gestaltung und Umschlaggestaltung: Favoritbüro, München
Grafikelemente: © s_maria/shutterstock.com
ISBN 978-3-95728-539-3
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise.
www.knesebeck-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
INHALT
Vorweg
Vom jungen Hobby- zum Profifotografen
Aus dem beschaulichen Gersthofen in die weite Welt
Motive im Wandel der Zeit
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Unterwegs als Fotograf
Meine Reise- und Fotopartner
Die Suche nach Motiven
Die Gestaltung meiner Bilder
Der Weg zum Porträt
Fotografieren und Filmen sind keine Freunde
Als die Kameras fliegen lernten
Bilder auf großer Bühne
Gedruckte Fotografie
Spiegelreflexkameras – vierzig Jahre lang meine Wegbegleiter
Meine analogen Objektive
Filme – Treibstoff für die Kameras
Mein Einstieg in die Digitalfotografie
Das digitale Fotografieren
Nach dem Fotografieren: sichern, archivieren und bearbeiten
Ein Blick in meinen Kamerarucksack
Die Welt dreht sich weiter
Es ist eine Illusion, dass Fotos mit der Kamera gemacht werden … Sie werden mit dem Auge, dem Herz und dem Kopf gemacht.
Henri Cartier-Bresson
Vorweg
1976 ist Helmut Schmidt Bundeskanzler, Jimmy Carter wird zum US-Präsidenten gewählt, und in China stirbt der »große Vorsitzende« Mao Zedong. Im italienischen Seveso kommt es in einer Fabrik zum bis dahin größten Chemieunfall der Geschichte, als hochgiftiges Dioxin entweicht. Erich Honecker wird zum Vorsitzenden des Staatsrats der DDR gewählt und der Liedermacher Wolf Biermann ausgewiesen. Im Radio laufen die Songs von den Rolling Stones, AC/DC und Elton John, im Kino ist Einer flog über das Kuckucksnest zu sehen. Nach wie vor bestimmen lange Haare, auch bei Männern, Schlaghosen und Plateauschuhe die Mode. Für einen dreizehnjährigen Schüler an einem Gymnasium im kleinen Gersthofen bei Augsburg im südwestlichen Bayern ist 1976 ein Jahr, das sein gesamtes Leben prägen sollte.
Dünenbesteigung an einem Wintermorgen in der Wüste Rub al-Khali
Ich fotografierte damals schon gern, wenn auch mit einer höchst simplen Kamera – einer Kodak Instamatic – und vor allem nicht viel, weil Filme und das Entwickeln teuer waren. Meine größere Leidenschaft war in jener Zeit die Astronomie, weshalb ich dem 13. Mai 1976 entgegenfieberte, dem Tag der Mondfinsternis. Ich wollte das Himmelsereignis aber nicht nur sehen, sondern auch fotografieren. Meinem Freund Achim Mende und mir gelangen, trotz für diesen Zweck denkbar ungeeigneter Kameras, eine Reihe brauchbarer Bilder. Wir fragten Alfons Reichardt, den Vereinsvorsitzenden der Astronomischen Vereinigung Augsburg, der wir gerade erst beigetreten waren, ob wir bei der nächsten Mitgliederversammlung einen Vortrag über die Mondfinsternis halten dürften. Und so standen Achim und ich an einem Sommerabend im Chemiesaal des Augsburger St.-Anna-Gymnasiums erstmals vor Publikum. Die meist älteren Männer zeigten sich sehr angetan, was weniger an den Fotos lag als vielmehr an der Begeisterung, die unseren Bildkommentaren anzumerken war.
1976 war für mich noch aus anderen Gründen ein besonderes Jahr: Die Raumsonden Viking 1 und Viking 2 landeten auf dem Mars – und die detaillierten Aufnahmen von der Oberfläche des Roten Planeten waren sensationell. Durch mein kleines Spiegelteleskop hatte ich den Mars schon öfter bestaunt. Die weißen Polkappen und dunklen Strukturen auf seiner rötlichen Oberfläche hatte ich aber nur verschwommen gesehen. Und nun funkten die Sonden gestochen scharfe Bilder zur Erde, Bilder einer Wüstenlandschaft: staubige Ebenen, Geröllfelder, Dünen. Ich war völlig fasziniert; nicht ahnend, dass die irdischen Wüsten, allen voran die Königin aller Wüsten, die Sahara, über Jahrzehnte mein Leben bestimmen und bereichern würden.
Ein anderer Moment, der mich nachhaltig prägen sollte, war im Oktober 1976 das Erscheinen des allerersten Geo-Magazins. Auf dem Titelbild dieser damals völlig neuartigen Zeitschrift war ein Indigener der Andamanen abgebildet, der am Bug seines Bootes stehend auf die Brandungswellen zusteuert, und im Innenteil reihten sich atemberaubende Fotostrecken und Reportagen aus fremden Ländern aneinander. Für mich war dieses Heft eine Wundertüte – das Fenster zur Welt. Es weckte meine Neugier auf fremde Kulturen und Länder, die Lust zu reisen und Neues zu entdecken und den Wunsch, selbst derart fantastische Bilder einzufangen. Es legte in mir den Keim für die lebenslange Verbindung von Reisen und Fotografie.
Ein weiteres wichtiges Erlebnis in jenem Jahr war ein professioneller Reisevortrag. Bis dahin kannte ich lediglich die Diaabende meines Vaters, der im Kreis der Familie seine Urlaubsbilder zeigte. Achim und ich besuchten in der Augsburger Kongresshalle eine sogenannte Leicavision über Island von Helfried Weyer. Sechs Projektoren warfen Dias auf drei Leinwände, es wurde Musik eingespielt, und Helfried Weyer stand vor dem Publikum statt hinter dem Projektor. Ich war begeistert von Konzept und Wirkung: Der riesige Saal war bis auf den letzten Platz besetzt und die Leute waren gefesselt. Noch im Linienbus zurück nach Gersthofen schmiedeten Achim und ich Pläne für eigene Reisevorträge.
Genau vierzig Jahre später, also 2016, erlebte ich wieder ein ganz besonderes Jahr. Ich hielt mehr als hundert Vorträge Planet Wüste im gesamten deutschsprachigen Raum, der gleichnamige Bildband wurde als »Wissensbuch des Jahres« ausgezeichnet, Geo widmete mir, meinen Fotografien und Reisen eine Sonderausgabe, ich hatte drei Fotoausstellungen und im Fernsehen liefen mehrteilige Dokumentarfilme zu Planet Wüste. Mit diesem Projekt, meinem bis dahin größten, war ich ein hohes Risiko eingegangen, hatte unzählige Reisen unternommen, hatte viel Geld und noch mehr Herzblut investiert – und war nun glücklich, dass sich all das gelohnt hatte. Außerdem hatte ich die Idee für Terra – Gesichter der Erde.
In den vier Jahrzehnten dazwischen war ich zum Berufsfotografen, Vortragsreferenten und Autor geworden. Aber welche Berufsbezeichnung trage ich nun eigentlich in das Einreiseformular eines Landes ein? Wüstenfotograf? Reisefotograf? Oder Abenteurer? Früher schrieb ich Student, heute Geograf. Letztlich ist es mir egal, wie ich bei Vorträgen oder Talkshows angekündigt werde. Nur Aussteiger, Lebenskünstler, Weltenbummler oder Biker höre ich nicht so gern. Meine Arbeit ist eine Kombination aus Fotografieren und Präsentieren, Geografie und Abenteuer. Ich will mehr als schöne Bilder zeigen und abenteuerliche Geschichten erzählen. Wollte schon immer auch die Welt erklären, Zusammenhänge aufzeigen, auf Missstände hinweisen und Verständnis für andere Lebensformen und Kulturen schaffen. Das ist mir mal mehr, mal weniger gelungen.
Die Lust am Reisen und Fotografieren, die Begeisterung, Neues zu entdecken, Menschen anderer Kulturen zu treffen, und die Freude, meine Zuschauer und Leser durch Vorträge, Dokumentarfilme oder Bücher daran teilhaben lassen zu können, sind nach wie vor ungebrochen. Davon und von meiner Welt im Sucher möchte ich im Folgenden berichten.
Vom jungen Hobbyzum Profifotografen
Meine Liebe und Leidenschaft für die Fotografie ist ein Erbe meines Vaters. Er fotografierte leidenschaftlich gern und trug in jedem Urlaub, bei jedem Ausflug seine Agfa-Kamera mit sich. Ich sehe heute noch das braune Lederetui vor mir, in dem er sie, bestückt mit dem damals weitverbreiteten Diafilm Agfachrome CT 18, und eine Ersatzfilmrolle aufbewahrte. Sein ganzer Stolz war ein Foto eines Schäfers mit seinen Schafen, das in seinem Arbeitszimmer hing. Er hatte damit in den fünfziger Jahren einen Fotowettbewerb gewonnen. Mein Vater war eher der grafische, gestalterische Typ. Er liebte das Puristische, wie zum Beispiel unsere Bertoia-Stühle, und skandinavische Architektur. Sein Lieblingsmaler war Emil Nolde, der als überzeugter Anhänger der Ideologie des Nationalsozialismus mittlerweile in Verruf geraten ist. Mein Vater liebte die intensiven, warmen Farben, mit denen Nolde ausdrucksstarke Lichtstimmungen schuf, insbesondere das Orange. Wir hatten eine Wohnzimmerlampe in »Nolde-Orange«, und mein Vater drängte meine Mutter des Öfteren dazu, Kleidung in warmen kräftigen Farben zu tragen. Auch in der Vorliebe für solcherart Farbtöne wurde ich von meinem Vater geprägt, was man bis heute in meiner Fotografie wiederfindet.
Als ich mit zehn Jahren meine erste Kamera bekam, eine Kodak Instamatic, trug ich sie mit mir herum wie einen Schatz. Sie arbeitete nicht mit Filmrollen, sondern mit -kassetten. Und die waren nicht nur teuer, sondern ergaben auch nur zwanzig Bilder. Wenn ich mich richtig erinnere, kam ich auf eine Mark pro Bild, und zwanzig Bilder kosteten mich mein monatliches Taschengeld. Das hatte zur Folge, dass ich mir genau überlegen musste, was ich fotografierte. Auf viele Aufnahmen verzichtete ich daher gleich ganz oder zögerte oft zu lange – dann war der Hirsch schon aus dem Bild gesprungen.
Meine Familie im Jahr 1977
Wenn nach drei, vier Wochen die Filmkassette voll war, brachte ich sie in die örtliche Drogerie. Der Besitzer war selbst leidenschaftlicher Fotograf und hielt sich für außergewöhnlich gut. Über seinen Verkaufsregalen hingen Vergrößerungen seiner Fotos. Eines davon hielt er mir immer wieder als leuchtendes Beispiel vor. Es war eine Hafenansicht von Dubrovnik im schönsten Sonnenlicht. Wenn ich meine Abzüge bei ihm abholte, zog er sie ohne mich zu fragen aus der Versandtasche und ging jedes Bild einzeln mit mir durch. Natürlich konnte in seinen Augen keines mit seiner Dubrovnik-Aufnahme mithalten. Und ungeachtet der Tatsache, dass meine Instamatic einfach nicht gut genug war und ich keine Erfahrung mit dem Fotografieren hatte, sparte er nicht mit gnadenlosen Kommentaren.
Zum Glück konnte ich meine Bilder aber auch immer mit meinem Vater besprechen. Er brachte mir bei, wie man Bilder komponiert und wie man sie in einem Fotoalbum so kombiniert, dass eins plus eins mehr ergibt als zwei. Er gab mir auch einen goldenen Tipp, den ich bis heute befolge. Er sagte: »Bevor du abdrückst, kneif die Augen zusammen und schau, was von dem Motiv noch übrig ist.« Tatsächlich kommen, wenn man die Augen zusammenkneift, nur die starken Bildelemente zum Vorschein, sodass man sieht, was das Foto prägen wird. Mit dieser Methode konnte ich beurteilen, ob es sich wirklich lohnte, mein Taschengeld zu investieren.
Die Fotografie rückte kurz in den Hintergrund, als ich mich für die Astronomie zu begeistern begann. Sie verschwand aber nicht ganz, denn was ich am Himmel sah, wollte ich bald auch fotografieren. Als Glücksfall für mich sollte sich die Astronomische Vereinigung Augsburg erweisen. Ich war als Kind und Jugendlicher sehr schüchtern, ein bisschen eigen (welcher Dreizehnjährige interessiert sich schon für Sterne statt Mädchen); ich war nicht unbeliebt, aber unscheinbar. Außerdem war ich ein mittelmäßiger Schüler, in Sport gar dermaßen schlecht, dass ich beim Zusammenstellen einer Mannschaft immer als Letzter aufgerufen wurde. In der Jugendgruppe der AVA traf ich nun auf junge Menschen, die wie ich Individualisten waren – oder, anders formuliert, Eigenbrötler, Mauerblümchen. Aber wir teilten dieselbe Leidenschaft, und es war völlig egal, ob man wie ich groß und schlaksig war und eine zu große Nase hatte oder klein und dick; welches Fahrrad man hatte, was die Eltern beruflich machten oder welche Klamotten man trug. Endlich hatte ich außer Achim weitere Gleichgesinnte gefunden, wurde für meine Liebe zu den Sternen nicht mehr belächelt – und das stärkte mein Selbstvertrauen ungemein. Diese Jugendgruppe war für mich in meiner Sozialisierung einer der allerwichtigsten Schritte.
Meine erste Kamera von Kodak
Die sogenannten Astrocamps – einwöchige Zeltlager in den Ferien auf immer derselben Wiese, um nachts die Sterne zu beobachten – und die anderen Aktivitäten der Jugendgruppe waren mir bald nicht mehr genug. Ich war damals schon sehr energiegeladen und auf der Suche nach Abenteuer. Achim erging es ähnlich. Und so fuhren wir an den Wochenenden in die Berge – 150 Kilometer mit den Fahrrädern, die mit Stativen, Fernrohren, Kameras, Zeltausrüstung und Essen schwer beladen waren. Dort hatten wir einen viel klareren Blick auf die Sterne als im Dunstkreis der Stadt, denn Lichtverschmutzung war schon in den siebziger Jahren ein Thema. Diese Wochenenden auf dem Gipfel des 2034 Meter hohen Hönig in Tirol waren für uns Jungs, die bei den ersten dieser Ausflüge gerade mal vierzehn Jahre alt waren, Abenteuer und Freiheit pur.
Die Astronomie bescherte uns viele Freiheiten. Unsere Eltern fanden es ganz toll, dass wir unsere Abende und Nächte mit einem Teleskop verbrachten, statt in einer Disco herumzuhängen. Generell wurde ich von meinem Vater nicht bevormundet, sondern unterstützt, nicht mit Forderungen konfrontiert, sondern gefördert. Auch meine Mutter nahm regen Anteil an meinen Hobbys. Überhaupt hatte ich großes Glück und ideale Voraussetzungen: In unserer Familie wurde viel miteinander gesprochen, es herrschten Liebe und Verständnis füreinander.
Die Teleskope auf meiner Sternwarte in Gersthofen
Der Gipfel des Hönig in Tirol bot uns optimale Beobachtungsbedingungen
Das Motiv nachts war also klar. Die Sterne! Aber nun begannen wir so langsam, auch tagsüber zu fotografieren: die Morgendämmerung, Wolken, Blumen, Berge … Und da wir beide nicht die großen Schreiber waren und uns einfach die Lust fehlte, Tagebuch zu führen, wurden die Kameras zu unserem Tagebuch. Wir fotografierten uns auch bei jeder Gelegenheit gegenseitig: im Schlafsack, am Teleskop, neben dem platten Fahrradreifen, der gerissenen Fahrradkette, wie wir, das sperrige Teleskop im Rucksack, den Hönig hochschnaufen … Astronomie, Fotografieren und Reisen – das wurde für uns zum tonangebenden Dreiklang. Ohne die Astronomie hätte ich vermutlich einen völlig anderen Weg eingeschlagen, denn über die Astrofotografie kam ich zur Wald-und-Wiesen- und schließlich zur Natur- und Reisefotografie, und auch mein Weg zum Vortragsreferenten nahm ja seinen Anfang in der Astronomie.
Bald konnte auch der Hönig unsere Freude am Reisen, unsere Lust auf Abenteuer, unsere Neugier auf Neues nicht mehr befriedigen. Das Reisen und vor allem das Fotografieren auf diesen Reisen waren uns mittlerweile so lieb geworden, dass sie schnell zum Selbstzweck wurden. Und letztlich war halt auch der Himmel über uns immer mehr oder weniger derselbe; da wäre es doch schön, mal einen anderen zu sehen. Und so machten wir uns als Siebzehnjährige in den Sommerferien – mit dem Mofa! – auf den Weg nach Marokko. Dass wir dort einen ganz anderen Sternenhimmel sehen könnten, war ein lohnendes Ziel, vor allem aber ein guter Vorwand gegenüber unseren Eltern, denn für uns selbst stand längst das Reisen an sich im Mittelpunkt. So hieß denn auch der Diavortrag, den wir nach dieser Reise hielten, Auf dem Weg nach Marokko und nicht Die Sterne über Marokko oder etwas in der Art.
So wie mich die Astronomie zum Reisen brachte, waren es die Reisen, die mir die Natur näherbrachten. Ich muss, wann immer es geht, raus aus den vier Wänden und raus aus der Stadt und liebe es bis heute, auch nachts draußen zu sein. Das schönste Bett ist für mich ein Schlafsack unter freiem Himmel. Da kann ich beim Einschlafen zu den Sternen schauen und sehe gegen Morgen, noch vor der Dämmerung, das Zodiakallicht – eine Erscheinung, die durch interplanetaren Staub entsteht, der durch die Reflexion des von der Erde noch verdeckten Sonnenlichts zu leuchten beginnt. In der Stadt wird man vergeblich danach Ausschau halten. Danach kommt die astronomische Dämmerung – während der man im Osten das erste Sonnenlicht mehr erahnen als sehen kann –, dann die nautische Dämmerung, die so heißt, weil man nun mit bloßem Auge die Silhouette eines Schiffes am Horizont erkennen könnte.
Vortragsplakat im Jahr 1981
Noch immer steht die Sonne unter dem Horizont. Etwa eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang setzt schließlich die bürgerliche Dämmerung ein, und man kann mit Glück den Merkur leuchten sehen, den man sonst nur bei einer Sonnenfinsternis erkennen kann. Dazu der Geruch eines Sommermorgens in der Nase. Selbst die Kälte einer Winternacht in den Bergen mag ich.
Die Reise nach Marokko war so etwas wie der Startschuss für meinen beruflichen Werdegang. Allerdings einer, der, um bei dem Bild zu bleiben, mit Schalldämpfer abgefeuert wurde, sodass nicht einmal ich ihn hörte. Zwar wusste ich bereits, dass ich weiterhin reisen und fotografieren und Diavorträge über meine Reisen halten wollte, hatte aber nicht die Absicht, es zu meinem Beruf zu machen. Ich gedachte eher, in die Fußstapfen meines Vaters als Bauingenieur zu treten. Keinesfalls aber wollte ich wie er Beamter im Straßenbauamt werden, das erschien mir zu langweilig. Ich hatte große Träume, sah mich als Eigentümer eines Bauunternehmens oder, noch eine Nummer größer, eines Baukonzerns wie Hochtief. Vor meinem geistigen Auge sah ich schon den Schriftzug »Michael Martin« auf Kränen und Baufahrzeugen. Als Alternative konnte ich mir auch Manager vorstellen, ebenfalls auf der obersten Sprosse der Karriereleiter und mit eigenem Flugzeug; das war mir ganz wichtig.
Nach dem Abitur fuhr ich erst einmal mit Achim in einem VW-Bus in den Kongo (darüber später mehr). Ein Jahr darauf schrieb ich mich an der TU München für das Ingenieurstudium ein. Meine ersten Studientage waren eine herbe Enttäuschung. Das fing schon mit den Kommilitonen an: fast nur Männer, noch dazu mit Bügelfalte in der Hose und mit bis zum Kragen zugeknöpftem Hemd unterm rostbraunen Pullunder. Vor Vorlesungsbeginn legten sie ihre Kunstlederaktenkoffer vor sich, ließen die goldfarbenen Schnallen aufschnappen und holten mit gewichtiger Miene Stift und Papier hervor. Ich fühlte mich fremd und fehl am Platz. Über tausend Studierende saßen mit mir in der Mathe-Vorlesung, die, wie ich später erfahren sollte, bewusst schwierig gehalten war, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich war offensichtlich Spreu, denn trotz Mathematikleistungskurs und fünfzehn Punkten im Mathe-Abi saß ich da wie vor den Kopf geschlagen. Ich verstand kein Wort von dem, was der Dozent erzählte. Und ich merkte, dass mich das Ganze im Grunde null interessierte. Nach vier Tagen warf ich das Handtuch.
Ich hatte das große Glück, dass Wolfram, mein Nachbar im Studentenwohnheim, Geografie studierte, und zwar nicht auf Lehramt, sondern als Diplom-Studiengang. Mir war nicht klar gewesen, dass man Geografie auch studieren konnte, wenn man nicht Lehrer werden wollte, aber Erdkunde an sich hatte ich immer gemocht. Daher begleitete ich Wolfram zu einer länderkundlichen Vorlesung über Afrika. Ein Professor präsentierte mit sonorer Stimme miserable uralte Dias. Damit nicht genug, musste sein Gehilfe, weil es keine Magazine gab, die Dias einzeln einschieben und wählte mit schlafwandlerischer Sicherheit aus den acht Möglichkeiten eine der sieben falschen. Die Bilder standen mal kopf, mal um neunzig Grad nach rechts oder links gekippt oder seitenverkehrt und kopf … Das machte den Professor total fuchsig, und wir Studierenden machten uns natürlich einen Spaß daraus, den Assistenten durch Zwischenrufe zusätzlich unter Druck zu setzen. Alles in allem war die Vorlesung, was Didaktik und Präsentation anging, stark verbesserungsfähig. Und trotzdem merkte ich: Geografie ist absolut das, was mich interessiert. Ich wechselte kurzerhand die Studienrichtung.
Geografie war damals ein Orchideenfach und ein Diplom in Geografie eigentlich zu gar nichts nütze. Die Professoren warnten uns Studenten permanent, dass es außer im akademischen Bereich kaum Berufschancen für uns gäbe und wir alle als Taxifahrer enden würden. Ich blieb trotzdem dabei. Einerseits, weil es mich wirklich interessierte, andererseits, weil mir dieser Studiengang nicht besonders schwierig zu sein schien, sodass ich viel Zeit für meine Reisen haben würde.
Mein Studium zog sich, nicht nur wegen der Reisen. Auch die Vorarbeiten für die Vorträge, die ich hielt – Dias rahmen, Bildauswahl treffen, Musik auswählen und vieles mehr –, nahmen viel Zeit in Anspruch. 1988 wurde ich außerdem Vater.
Es wurde immer klarer, dass ich nie als Geograf arbeiten würde. Aber weil meine Eltern mir eingeimpft hatten, dass sich ein Titel gut auf dem Briefkopf mache und es gar nicht gut sei, »abgebrochener Student« zu sein, studierte ich weiter. Um eine Exmatrikulation wegen Überschreitung der Höchststudiendauer in meinem Studiengang zu vermeiden, wechselte ich zwischendurch zu Japanologie – allerdings nur auf dem Papier, ich wusste nicht einmal, wo das Institut war – und wieder zurück. Irgendwann wurde es der Univerwaltung zu viel und ich musste eine Diplomarbeit schreiben, um nicht doch noch exmatrikuliert zu werden. Als Thema wählte ich »Tourismus als Entwicklungsfaktor in Afrika«. Da konnte ich, so meine Überlegung, viele eigene Erfahrungen einfließen lassen. Meine Tochter, die Reisen und Vorträge nahmen jedoch meine ganze Zeit in Anspruch. Am Abgabetag musste ich meinem Diplomvater gestehen, dass ich noch keine einzige Zeile geschrieben hatte. Ich hatte bei ihm aufgrund meiner rhetorischen Fähigkeiten einen Stein im Brett. Und so gewährte er mir Aufschub, schlug jedoch vor, meine Abschlussarbeit über die Münchner Papiertonne zu schreiben – vermutlich, weil er in der Entsorgungsgeografie engagiert war. Dieses Thema interessierte mich zwar nicht wirklich, doch die Datenlage war gut; es gab viel Material von der Stadt München und viele Ansprechpartner.
1988 wurde ich junger Vater
Tatsächlich schaffte ich es, innerhalb der Verlängerungsfrist von vier Wochen eine Arbeit zu verfassen, bekam sogar eine Zwei dafür, und erhielt so auf den allerletzten Drücker – nach elf Jahren – mein Diplom. Das freut mich bis heute. Und ich bin bis heute froh darüber, mich für diesen Studiengang entschieden zu haben, denn Geografie ist die ideale Flankierung und Begleitung für einen Reisefotografen. Bei mir schlägt sich das nicht nur in meinen Vorträgen und Filmen nieder, sondern sogar noch mehr in meinen Büchern. Das Fach ist außerdem ein wunderbares Interessensgebiet, weil es als eine Querschnittswissenschaft die großen Themen unserer Zeit wie Raumplanung, Nachhaltigkeit, Klimawandel oder Bevölkerungsentwicklung wunderbar abbilden kann.
Während ich als Geograf also eine fundierte Ausbildung erhielt, war ich als Fotograf Autodidakt. Manchmal beneide ich meine Tochter, die inzwischen Fotografie studiert hat. Sie bekam eine systematische Ausbildung in Foto-, Kamera- und Objektivtechnik, visuellen und technischen Gestaltungsmitteln und vielem mehr. Das Studium bot neben den theoretischen Grundlagen auch die Möglichkeit, das Gelernte in der Praxis umzusetzen und auszuprobieren. Ich selbst lernte zwar viel von meinem Vater, vor allem wie man ein Bild komponiert und wie man Bilder kombiniert, doch alles andere musste ich mir selbst beibringen. Vermutlich war es aber auch einfacher, sich in die damalige analoge Fotografie einzuarbeiten als heutzutage in die Digitalfotografie.
Was mir in meiner fotografischen Laufbahn viel geholfen hat, war das Betrachten von Bildbänden anderer Fotografen. Schon in den neunziger Jahren hatte ich begonnen, in Fotobuchhandlungen nach besonderen Bildbänden zu suchen und sie trotz knappen Budgets auch zu kaufen. In den letzten dreißig Jahren saß ich oft abends auf dem Sofa und blätterte in aller Ruhe darin. An bestimmten Stellen verweilte ich lange und überlegte mir, wie das Bild wohl entstanden sein könnte oder worauf seine besondere Wirkung beruht. Dabei lernte ich auch, wie wichtig die Gestaltung und die Ausstattung eines Buches sind. Und ich stellte fest, dass die schönsten Bücher nicht unbedingt von den bekanntesten Fotografen stammen müssen.
Trotzdem waren es natürlich die großen Namen, denen ich besondere Aufmerksamkeit schenkte: in der Reportage- und Kriegsfotografie Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Don McCullin, Steve McCurry oder James Nachtwey, im Bereich der Naturfotografie Frans Lanting, Art Wolfe, Yann Arthus-Bertrand und Sebastião Salgado, vor allem dessen Werk Genesis. Manche ihrer Bilder empfand ich als genial, manche bezogen ihre Wirkung eher daraus, dass sie von einem berühmten Fotografen stammten. Die vielen Stunden auf dem Sofa wurden zu einer wichtigen Sehschule für mich. Bildbände sind quasi mein Fernseher. Bis heute habe ich nie ein solches Gerät besessen.
Fotolehrbücher dagegen las ich nie, besuchte keinen Workshop und hatte daher nie einen theoretischen Zugang zur Fotografie. Ich bin immer praktisch an die Fotografie herangegangen. Und deshalb kann ich heute auch nicht mitreden, wenn es um Histogramme von Digitalbildern oder irgendwelche Farbkurven geht. Ein gewisses technisches Verständnis, was unterschiedliche ISO-Zahlen bedeuten, inwiefern sich ein 24-mm- von einem 28-mm-Weitwinkelobjektiv unterscheidet, habe ich natürlich schon. Und das Schöne bei der Fotografie ist ja, dass man immer dazulernt, dass man als Fotograf mit zunehmendem Alter eigentlich eher immer besser wird, anders als manche Profisportler, die mit Mitte zwanzig schon ans Aufhören denken müssen.
Was mir an theoretischem Wissen fehlte, machte ich durch frühe praktische Erfahrung und ein gewisses fotografisches Talent wett, durch Leidenschaft, Selbstdisziplin, die Bereitschaft, früh aufzustehen, nicht lockerzulassen, Ehrgeiz und Ausdauer, um genau die Bilder zu bekommen, die ich haben wollte. Die besten Bilder nützen einem Profifotografen jedoch nichts, wenn sie in seinem Archiv schlummern. Um von der Fotografie leben zu können, muss man nicht nur ein guter Künstler oder Handwerker sein – je nach Sichtweise –, sondern in gewisser Weise auch ein guter Verkäufer. Da bin ich ganz der Enkel meines Opas. Fritz Hertlein war der beste Verkäufer in dem Textilgeschäft in Oettingen, in dem er fünfzig Jahre arbeitete. Bis heute ist »der Hertleins Fritz« im Nördlinger Ries ein Begriff. Man erzählt sich, dass ein Bauer, der nach Oettingen fuhr, um einen Reißverschluss zu kaufen, garantiert mit drei Anzügen nach Hause kam. Mein Opa fuhr auf Kirchweihfeste und präsentierte dort Anzüge und besuchte die Bauern zu Hause, um ihnen verschiedene Modelle zu zeigen. Er war Verkäufer mit Leib und Seele, dabei ein angenehmer und sehr bescheidener Mann. Seine Tochter, meine Mutter, hat seinen Geschäftssinn nicht geerbt, aber auf mich hat er wohl irgendwie abgefärbt.
Mit den Reisevorträgen hatte ich früh meine geschäftliche Domäne gefunden. Dabei kam mir zu Hilfe, dass Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre der Markt für Diavorträge gerade erst bereitet und längst nicht gesättigt war. Nach zehnmal Gardasee sehnten sich die Menschen nach Neuem. Das Interesse an fernen Ländern wuchs. Dank des gestiegenen Wohlstands und des Sinkflugs des Dollars – zwischen 1970 und 1980 brach der Kurs von gut drei Mark sechzig auf die Hälfte ein – konnten sich zudem immer mehr Leute Fernreisen leisten. Auch gab es immer mehr Individualreisende. Ich kann mich noch gut erinnern, wie 1978 ein Reisebüro in München eröffnete, das mit dem Slogan »erstes Spezialbüro für Globetrotter« warb und unschlagbar günstige Flüge vermittelte. Reiseführer für Individualreisende mit exotischen Zielen waren jedoch ausgesprochen rar. Wer der englischen Sprache einigermaßen mächtig war, griff zu einem Lonely Planet. Erst ab Anfang der achtziger Jahre kam nach und nach deutschsprachige Konkurrenz auf den Markt. Viele Menschen waren sehr unsicher, weil sie keine Erfahrung als Individualtouristen hatten, und erhofften sich von einem Diavortrag nicht nur Anregungen, sondern auch Tipps. Als Achim und ich das realisierten, schrieben wir, geschäftstüchtig wie wir waren, auf das Plakat für unseren Vortrag Sahara Sahel Regenwald: »Mit vielen Tips und Anregungen«. Es folgten die goldenen Zeiten der Reisefotografie, und ich lebe immer noch von ihnen, weil es mir damals gelang, mir einen Namen in der Vortragsszene zu machen, und weil ich Kontakte aufbaute, die bis heute bestehen.
Meine Vorträge kombinierten Bilder mit einer frei gesprochenen, lebendigen Erzählung und schilderten humorig Pleiten, Pech und Pannen. Sicher spielte auch mein Äußeres eine Rolle. Ich sah mit meiner ausgebleichten Jeans, T-Shirt und meiner Löwenmähne immer aus, als wäre ich gerade erst von einer längeren Wüstentour zurückgekehrt, was mir mit Sicherheit ein gerüttelt Maß an Authentizität verlieh. Etwa Mitte der achtziger Jahre wurde ich regelrecht auf Veranstaltungen herumgereicht, obwohl nach heutigen Maßstäben gemessen vielleicht fünf von fünfhundert Bildern wirklich gut waren.
Durchquerung der Ténéré im Jahr 1989
Einen großen Sprung nach vorn machte meine Fotografie erst 1989, als ich zum ersten Mal die Ténéré bereiste, eine abgelegene Teilwüste der Sahara. Dank meiner ersten Kamera mit Autofokus, einer Minolta 9000, waren die Bilder vielleicht etwas schärfer, besser waren sie jedoch vor allem wegen der sagenhaften Landschaften der Ténéré. Ein zweiter Sprung nach vorn sollte 1994 folgen …
Die Anfangsjahre waren wirklich eine Ochsentour. Achim und ich mieteten selbst die Säle an, malten eigenhändig die Plakate, fotokopierten sie in einem Copyshop auf wüsten-, also sandfarbenes Papier und plakatierten »wild«. Und zwar klebten wir unsere Plakate mit Tesa – das war wichtig, denn so begingen wir keine Sachbeschädigung – an Hauswände oder Schaufensterscheiben. Anzeigen in Zeitungen waren zu teuer und die Redaktionen interessierten sich nicht für Vorträge – woran sich bis heute wenig geändert hat. Mit viel Glück landeten wir mal im Veranstaltungskalender oder in der Regionalzeitung erschien ein kleines Porträt, aber eine Medienpräsenz, die man so nennen hätte können, hatten wir nicht. Es waren Tausende winzig kleiner Schritte und das Aushalten von zwischenzeitlichen Rückschlägen nötig, um an den Punkt zu gelangen, an dem ich heute bin.
Trotz aller Abenteuerlust und Neugier auf Neues arbeitete ich mit Plänen – Tagesplan, Arbeitsplan, Wochenplan, langfristigem Plan, Lebensplan –, auf die ich mich fokussierte und die ich konsequent verfolgte. Nur einmal geriet ich dabei auf Abwege. 1989 erhielt ich die Gelegenheit, während der 45 Drehtage zum Kinofilm Schatten der Wüste in der Republik Niger als Standfotograf zu arbeiten. Meine Aufgabe war, Fotos von bestimmten Filmszenen unter anderem für das Marketing zu machen. Ich musste also, nachdem eine Szene abgedreht war, nach wie vielen Versuchen auch immer, wenn die Scheinwerfer ausgeschalten waren, der Kameramann seine Kamera, der Mikrofonmann sein Mikro wegpackte, die Schauspieler, die heilfroh waren, dass die Szene im Kasten war und sich schon die Schminke aus dem Gesicht wischen wollten, motivieren, mir noch kurz ihre Aufmerksamkeit zu schenken, dem Beleuchter sagen, dass er seine Lampen noch mal anwerfen soll, damit ich die Szene nachfotografieren konnte … Eines Tages rastete einer der Darsteller aus und machte mich zur Schnecke, weil ich zu fotografieren gewagt hatte, während geprobt wurde. Mein Geklicke hätte ihn aus dem Konzept gebracht, sodass er den Text vergessen habe – was für meine Begriffe auch an seinem enormen Alkoholkonsum gelegen haben konnte.
Aber wenigstens konnte ich im Gefolge des Filmteams, das in dem riesigen Land Narrenfreiheit genoss, das Unmengen von Menschen anlockte und alle möglichen Genehmigungen hatte, auch das eine oder andere Bild für meine Vorträge abstauben. Natürlich fotografierte ich keine ausgeleuchteten Tuareg, sondern vielleicht die Tuareg, die am Set mitarbeiteten, oder ich durfte mit zu ihren Familien. Ich war sozusagen der Trittbrettfahrer. Eines wurde mir jedoch klar: Das ist der unkreativste Fotografenjob, den es gibt. Schon allein das stundenlange Herumstehen. Man hat nichts zu sagen … Trotzdem arbeitete ich danach noch in selber Funktion für viele Folgen der Fernsehserie Die glückliche Familie mit Siegfried Rauch und Maria Schell in den Hauptrollen; einfach, um Geld zu verdienen.
Ich war Standfotograf bei einem Kinofilm
Kurz gesagt war mein Werdegang kein Sprint zum Erfolg, sondern ein Marathonlauf. Geholfen haben mir dabei vor allem zwei Dinge. Das eine war, dass ich das, was ich tat, auch selbst faszinierend, mitreißend, spannend fand – woran sich bis heute nichts geändert hat –, das andere war eine gewisse Unbekümmertheit in finanzieller Hinsicht. Meine Eltern waren beide Beamte, Angst vor Arbeitslosigkeit, finanzieller Not, Armut im Alter war in unserer Familie nie ein Thema. Ich vermute, dass mir das, neben dem liebevollen Zuhause, dem engen Zusammenhalt in der Familie, der Weltläufigkeit meiner Mutter, ihrer Offenheit gegenüber anderen Kulturen, die Sicherheit gab, mich hinaus in die Welt und auf den unsicheren Weg des freiberuflichen Fotografen und Vortragsreferenten zu wagen. Nicht, weil mich meine Eltern finanziell unterstützt oder im Fall des Scheiterns aufgefangen hätten, sondern weil ich nie Not erfahren habe, die sicherlich ein starker Motor ist, nach finanzieller Sicherheit zu streben. Jahrelang machte ich mir keine Gedanken über Rücklagen oder Altersvorsorge, der Saldo meines Kontos stand sogar immer auf der falschen Seite des Auszugs; ohne Dispokredit hätte ich meine Plakate nicht bezahlen, reisen, in neue Ausrüstung investieren, die Saalmieten vorfinanzieren können. Im Sommer 1995 musste ich meine Eltern sogar um eine Bürgschaft für einen höheren Dispokredit bitten. Da war ein Punkt erreicht, wo ich mir sagte, dass es so nicht weitergehen könne. Ich nahm mir vor, bis Weihnachten schuldenfrei zu sein – und schaffte es sogar schon im November.
Aus dem beschaulichen Gersthofen in die weite Welt
Im Rückblick auf vier Jahrzehnte Reisen und Fotografieren sehe ich vor meinem geistigen Auge, wie sich, dem Drehen an einem Zoomobjektiv ähnlich, mein Blickfeld auf die Welt nach und nach erweiterte. Als Achim und ich nach vier Wochen Anreise mit dem Mofa in Marokko den Sahararand erreichten und in der Dünenlandschaft des Erg Chebbi standen, war ich fasziniert vom Anblick des schier grenzenlosen Sandmeers, das sich vor mir erstreckte, der Stille und dem einzigartigen Licht, wie man es nur in der Wüste findet, und mir wurde klar: Die Wüste mit ihren klaren Formen, ihrer Weite, dem freien Blick, den reduzierten, aber warmen Farben ist meine Landschaft. Das war meine Geburtsstunde als Wüstenfotograf.
In den folgenden Jahren erweiterte ich meinen Blickwinkel immer mehr: vom Sahararand hin zur ganzen Sahara, von der Sahara zu den anderen Wüsten Afrikas und schließlich zu den Wüsten des ganzen