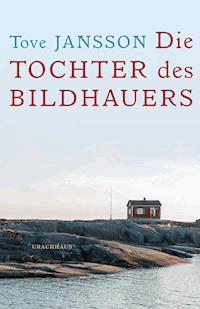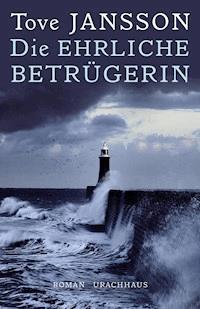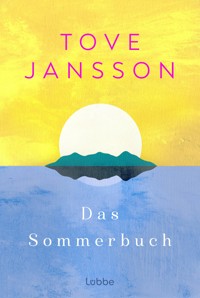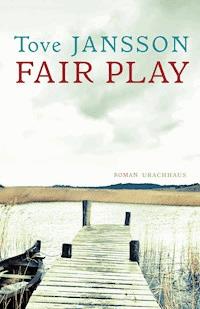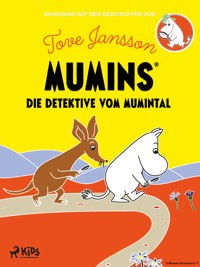9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem wunderbaren SOMMERBUCH liegt nun ein weiterer liebevoll gestalteter Erzählband der finnischen Autorin Tove Jansson vor. Hierin versammelt sind viele ihre beliebtesten Novellen - allesamt wunderschöne und zurückhaltende Prosa, die den Leser durch die dunkle Jahreszeit trägt.
Die Geschichten sind voller Humor und gleichzeitig mit einem guten Maß an Melancholie geschrieben. Sie zeichnen vibrierende Bilder vom Kindsein, Erwachsenwerden und den Freuden und Mühen des Alters. Ein großes Lesevergnügen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Vorwort von Maria Antas
Kapitel I – Das Flüstern des Schnees
Aus »Die Zuhörerin«
Vorschlag für eine Einleitung
Aus »Die Tochter des Bildhauers«
Das Dunkel
Jeremiah
Der Schnee
Das Seerecht
Der Eisberg
Weihnachten
Der Stein
Aus »Die ehrliche Betrügerin«
Kapitel 1
Kapitel 5
Kapitel II – Notizen von einer Insel
Aus »Notizen von einer Insel«
Seiten 41–45
Aus »Reisen mit leichtem Gepäck«
Reise mit leichtem Gepäck
Shopping
Die Möwen
Kapitel III – Aus aller Kraft leben
Aus »Fairplay«
Wladyslaw
Der Brief
Aus »Briefe von Klara«
Emmelina
Aus »Das Puppenhaus«
Kunst in der Natur
Der Affe
Aus »Die Zuhörerin«
Der Sturm
Im Frühling
Nachwort von Maria Antas
Über dieses Buch
Nach dem wunderbaren SOMMERBUCH liegt nun ein weiterer liebevoll gestalteter Erzählband der finnischen Autorin Tove Jansson vor. Hierin versammelt sind viele ihre beliebtesten Novellen – allesamt wunderschöne und zurückhaltende Prosa, die den Leser durch die dunkle Jahreszeit trägt. Die Geschichten sind voller Humor und gleichzeitig mit einem guten Maß an Melancholie geschrieben. Sie zeichnen vibrierende Bilder vom Kindsein, Erwachsenwerden und den Freuden und Mühen des Alters. Ein großes Lesevergnügen!
Über die Autorin
Die Autorin und die Künstlerin Tove Jansson (1914-2001) ist berühmt geworden mit ihren Mumin-Bücher, die in 35 Länder veröffentlicht werden. Das Sommerbuch ist einer von zehn Romanen, die sie für Erwachsene geschrieben hat. Das Sommerbuch ist ein sehr beliebter Klassiker in ganz Skandinavien, fängt es doch auf so wunderbare Weise den Sommer dort ein.
Tove Jansson wurde für ihre Werke vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Hans-Christian-Andersen-Preis, der höchsten internationalen Auszeichnung für Jugend- und Kinderliteratur der Schwedischen Akademie und zweimal mit dem Finnischen Staatspreis.
Tove Jansson
DasWinterbuch
Erzählungen
Übersetzung aus dem Finnlandschwedischen von Birgitta Kicherer
Mit einem Vor- und Nachwort von Maria Antas
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der finnischen Originalausgaben, aus denen die Erzählungen entnommen sind:
»Lyssnerskan«, Copyright © 1971 by Tove Jansson;
»Bildhuggarens dotter«, Copyright © 1968 by Tove Jansson;
»Den ärliga bedragaren«, Copyright © 1982 by Tove Jansson;
»Anteckningar från en ö«, Copyright © 1993 by Tove Jansson;
»Resa med lätt bagage«, Copyright © 1987 by Tove Jansson;
»Rent spel«, Copyright © 1989 by Tove Jansson;
»Brev från Klara«, Copyright © 1990 by Tove Jansson;
»Dockskåpet och andra berättelser«, Copyright © 1978 by Tove Jansson.
Für die Originalausgaben:
First published by Schildts Förlags Ab, Finland. All rights reserved.
Die Erzählungen in diesem Band sind größtenteils Lizenzen folgender deutschsprachiger Ausgaben:
»Fair Play«, © 2014 Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart
»Die Tochter des Bildhauers«, © 2014 Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart
»Die ehrliche Betrügerin«, © 2015 Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart
»Reisen mit leichtem Gepäck«, © 2016 Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart
Copyright für »Das Winterbuch« © 2017/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Julie Hübner, Berlin
Covergestaltung: © SO YEAH Design, Gabi Braun unter Verwendung von © David Scutt; © dinadankersdesign/shutterstock.com; welcomeinside/shutterstock.com; Doloves/shutterstock.com; Gile68/shutterstock.com
eBook-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-4959-7
luebbe.de
lesejury.de
Vorwort von Maria Antas
Ich habe Tove Janssons Erzählungen so oft gelesen, dass ich wahrscheinlich in der Lage wäre, ihren Stil wiederzuerkennen, wenn man mir einen unbekannten Text geben würde mit der Bitte, den Autor zu identifizieren. Ich würde ihre Art, Einsamkeit zu schildern, wiedererkennen, und die Art, wie sie den Einfluss der Natur auf die Gemütsverfassung der Menschen beschreibt, auch den behutsamen Ton, den sie anschlägt, wenn nach überwundenen Konflikten Harmonie erreicht wird. Tove Janssons Texte sind wie Tuschezeichnungen. Einfache, aber kräftige Linien, ohne unklare Grauzonen. Zwar arbeitete die bildende Künstlerin auch mit Ölfarben, also mit kräftigen Farben, aber in den Prosatexten spüre ich ihre künstlerische Eigenart am allerdeutlichsten. Sie war eine Meisterin der klaren Kontraste und der kühnen Linien. Den Kern der Texte bilden psychologische Konflikte von absoluter und zeitloser Natur. Wie soll ich mich verhalten, wenn ich Einsamkeit brauche und mich gleichzeitig nach Gemeinschaft sehne? Wie soll das Kunststück gelingen, rücksichtsvoll zu sein, obwohl es meine Seele eigentlich nach gnadenloser Ehrlichkeit drängt? Warum muss ich mich an gesellschaftliche Normen anpassen, wenn ich am allerliebsten nur ich selbst sein will? Tove Janssons Erzählungen haben eine Aura der Zeitlosigkeit. Die Natur und deren überwältigende Kräfte sind eindeutig nordisch, die Ereignisse dagegen zeitlos und allgemeingültig.
© Jansson Family archive
Kapitel I – Das Flüstern des Schnees
Vorschlag für eine Einleitung
SIE NAHM DEN ÜBERWURF AB, faltete ihn zusammen und legte ihn auf einen Stuhl, machte die Nachttischlampe an und löschte das Deckenlicht. Dann öffnete sie das Innenfenster und nahm eine Flasche Mineralwasser heraus, schloss das Fenster wieder, ersetzte den Flaschendeckel mit einem Gummikorken und stellte die Flasche auf den Nachttisch, dazu kamen zwei Schlaftabletten, die Brille und drei Bücher. Danach schloss sie die Vorhänge und zog sich aus, von unten anfangend, legte die Kleider auf einen Stuhl und zog Nachthemd und Hausschuhe an. Die Zähne putzte sie über dem Ausguss, dann stellte sie die Uhr und sah, dass es elf war, legte die Uhr auf den Nachttisch, schaltete das Radio ein und machte es wieder aus, blieb zehn Minuten auf dem Bett sitzen, streifte die Hausschuhe ab und ging zu Bett. Sie setzte die Brille auf und begann mit dem ersten Kapitel des Buches, das zuoberst lag. Nach vier Seiten nahm sie das zweite Buch und las eine Weile in der Mitte, legte es auf die Seite und schlug das dritte Buch auf. Manchmal las sie einen Satz ein paarmal hintereinander, und manchmal übersprang sie eine Seite oder zwei. Es war sehr still, nur ab und zu ein schwaches Klappern in den Heizkörpern. Um halb eins ermüdeten die Augen, und der Schlaf näherte sich, von den Beinen her; schnell legte sie die Brille und das Buch auf den Nachttisch, löschte die Nachttischlampe und drehte sich zur Wand. Sofort begann sie, das erste Mal in dieser Nacht, alles durchzugehen, was sie gesagt und was sie ungesagt gelassen hatte, dann alles, was sie getan und was sie nicht getan hatte. Sie knipste die Nachttischlampe an und nahm eine der Tabletten, öffnete die Flasche und schluckte die Tablette mit Mineralwasser, löschte das Licht und legte sich mit dem Gesicht zur Wand hin. Nach einer halben Stunde machte sie wieder Licht, setzte die Brille auf, schlug das Buch auf und las das Schlusskapitel. Dann legte sie Buch und Brille auf den Fußboden, löschte die Lampe und zog sich die Decke über den Kopf. Zwanzig Minuten später machte sie Licht und stand auf, öffnete das Innenfenster, holte etwas in Butterbrotpapier Eingewickeltes heraus und packte Brot, Wurst und Käse aus. Sie aß stehend am Fenster. Der Schnee lag ziemlich hoch an den Scheiben, draußen schneite es. Nachdem sie gegessen hatte, schluckte sie die zweite Tablette mit Mineralwasser, das Innenfenster schloss sie jedoch nicht, da es im Zimmer sehr heiß war. Sie legte sich hin und machte die Nachttischlampe aus. Eine Stunde später machte sie wieder Licht, zog das Nachthemd aus und begann im Zimmer hin und her zu wandern. Sie ging zum Ausguss, füllte eine emaillierte Kanne mit Wasser und goss ihre Topfpflanzen, nahm einen Schwamm, wischte das Wasser auf, das aufs Fensterbrett geflossen war, und ließ den Schwamm im Fenster liegen. Dann legte sie sich hin und löschte das Licht. Ungefähr eine Stunde später stand sie auf, ohne Licht zu machen, und schaltete das Radio ein und wieder aus, sie hörte den Aufzug, und kurz darauf kam die Zeitung durch den Schlitz in der Flurtür. Sie machte Licht, zog die oberste Kommodenschublade heraus, holte Briefpapier und einen Stift hervor und setzte sich aufs Bett. Nach zehn Minuten legte sie Papier und Stift auf den Boden, trat ans Fenster und sah, dass es nicht mehr schneite. Sie löschte das Licht und legte sich hin. Der Aufzug fuhr, aber in den Heizkörpern klapperte es nicht mehr. Der Schlaf stieg ihr entgegen, ihr Körper wurde schwer und schwerer und sank, sie hörte auf zu denken und schlief. Eine halbe Stunde später knipste sie die Nachttischlampe an und sah auf die Uhr. Sie stand auf, ging zum Ausguss und putzte die Zähne, zog sich an, oben anfangend, und stellte das Teewasser auf, danach sah sie auf die Uhr und stellte fest, dass sie nicht richtig geschaut hatte, weil sie die Brille nicht aufgehabt hatte. Sie stellte das Teewasser ab, ging zum Ausguss, füllte die emaillierte Kanne und erinnerte sich, dass sie die Topfpflanzen bereits gegossen hatte. Draußen war es dunkel, sie zog den Mantel an und Mütze und Handschuhe, nahm ihre Tasche und steckte die Schlüssel in die Manteltasche. Danach öffnete sie die Flurtür, ging hinaus, schloss die Tür sachte hinter sich, stieg die Treppe nach unten, öffnete die Haustür und sah, dass es angefangen hatte zu schneien. Sie umrundete den Block, und als sie bei der Haustür angekommen war, ging sie noch einmal um den Block, dann trat sie ins Haus und stieg die Treppe hinauf, damit alles wieder von vorne beginnen konnte.
Das Dunkel
HINTER DER RUSSISCHEN KIRCHE GIBT ES EINEN ABGRUND. Das Moos und die Abfälle sind glitschig, tief unten leuchten gezackte Konservendosen. Im Laufe von Jahrhunderten sind sie in immer höheren Stapeln an der Wand eines dunkelroten langen Gebäudes ohne Fenster hochgewachsen. Das rote Gebäude kriecht um den Berg herum, und die Tatsache, dass es keine Fenster hat, ist sehr bedeutungsvoll. Hinter diesem Haus liegt der Hafen, ein stiller Hafen ohne Schiffe. Die kleine Holztür im Fels unterhalb der Kirche ist stets verschlossen.
»Du musst die Luft anhalten, wenn du an der Tür vorbeirennst«, sagte ich zu Poju. »Sonst kommt die Fäulnis heraus und holt dich.« Poju hat andauernd Schnupfen. Er kann Klavier spielen und hält immer die Hände vor sich ausgestreckt, als fürchtete er sich davor, angegriffen zu werden, oder als wollte er sich entschuldigen. Ich mache ihm Angst, und er läuft stets hinter mir her, damit ich ihm Angst machen kann.
Bei Einbruch der Dämmerung beginnt ein großes graues Wesen vom Meer hinterm Hafen heranzukriechen. Das Wesen hat kein Gesicht, dafür aber sehr deutliche Hände, mit denen es eine Insel nach der anderen bedeckt, während es vorankriecht. Wenn keine Inseln mehr da sind, streckt es den Arm übers Wasser, einen sehr langen Arm, der leicht zittert, und beginnt nach Skatudden zu tasten. Die Finger erreichen die russische Kirche und berühren den Berg – oh! Eine große graue Hand!
Ich weiß genau, was das Unheimlichste von allem ist. Das ist die Schlittschuhbahn. An meinem Pullover ist ein sechseckiges Schlittschuhabzeichen festgenäht. Der Schlittschuhschlüssel hängt mir an einem Schnürsenkel um den Hals. Wenn man sich aufs Eis hinunterbegibt, merkt man, dass die Eisbahn nur ein kleines Armband aus Licht weit draußen in der Dunkelheit ist. Der Hafen ist ein Meer aus blauem Schnee, Einsamkeit und melancholischer frischer Luft.
Poju kann nicht Schlittschuh laufen, seine Füße knicken nämlich unter ihm ein, ich dagegen muss aufs Eis. Hinter der Bahn lauert das graue kriechende Wesen, und die ganze Bahn ist von einem Ring aus schwarzem Wasser eingefasst. Manchmal beginnt das Wasser am Eisrand zu atmen, es bewegt sich sacht, ab und zu steigt es in einem Seufzer hoch und überflutet das Eis. Wenn man sich erst einmal auf die Schlittschuhbahn hineingerettet hat, ist es nicht mehr gefährlich, aber melancholisch wird man trotzdem.
Hunderte von schwarzen Menschen fahren im Kreis herum, alle in dieselbe Richtung, entschlossen und sinnlos, und in der Mitte sitzen zwei frierende Männer unter einer Plane und machen Musik. Sie spielen »Ramona« und »Wenn meine Alte da ist, bleib ich weg«. Es ist kalt. Die Nase läuft, und wenn man sie abwischt, entstehen Eiszapfen an den Handschuhen. Die Schlittschuhe müssen am Absatz festgemacht werden. Im Absatz ist eine Mulde aus Eisen, und die ist jedes Mal voller Steinchen, die ich mit dem Schlittschuhschlüssel herauspule. Dann sind da die steifen Riemen, die in ihre Löcher hineinsollen. Und dann fahre ich mit den anderen im Kreis herum, weil es gesund ist, an der frischen Luft zu sein, und weil das Schlittschuhabzeichen sehr teuer war. Hier ist niemand, dem man Angst machen kann, alle fahren schneller, knirschend und quietschend fahren fremde Schatten an einem vorbei.
Die Lampen schaukeln im Wind. Wenn sie ausgingen, würden wir im Dunkeln weiterfahren, immer im Kreis herum, und die Musik würde weiterspielen, und allmählich würde die Eisrinne ringsum breiter werden, sie würde heftiger klaffen und atmen, und der ganze Hafen würde zu einem schwarzen Wasser werden mit einer einsamen Insel aus Eis in der Mitte, auf der wir weiterfahren würden, in alle Ewigkeit, Amen.
Ramona ist bildschön, bleich wie die Donnerbraut und hat Jugendverbot. Aber die Donnerbraut habe ich im Wachsfigurenkabinett gesehen. Papa und ich, wir lieben Wachsfigurenkabinette. Die Donnerbraut wurde ausgerechnet in dem Augenblick vom Blitz erschlagen, als sie heiraten sollte. Der Blitz schlug in ihren Myrtenkranz ein und fuhr zu ihren Füßen wieder hinaus. Daher steht die Donnerbraut auch barfuß da, an ihren Fußsohlen kann man deutlich eine Menge gezackter Linien erkennen, wo der Blitz wieder hinausfuhr.
In einem Wachsfigurenkabinett wird einem vor Augen geführt, wie leicht es ist, Menschen kaputt zu machen. Sie können zermalmt, auseinandergerissen und in Stücke gesägt werden. Davor ist niemand sicher, und daher ist es auch so wichtig, dass man rechtzeitig ein Versteck findet.
Ich sang Poju immer wieder das Trauerlied vor. Er hielt sich die Ohren zu, hörte es aber dennoch. Das Leben ist eine Insel der Trauer, mitten im Leben berührt uns der Todesschauer, und übrig bleibt nur Staub! Die Schlittschuhbahn war die Insel der Trauer. Wir lagen unterm Esstisch und zeichneten sie auf. Poju nahm zum Zeichnen ein Lineal und einen zu harten Bleistift, er zeichnete jedes einzelne Brett im Bretterzaun und sämtliche Lampen. Ich selbst zeichnete immer mit einem 4B und ausschließlich schwarz – die Dunkelheit auf dem Eis oder die Eisrinne oder tausend schwarze Menschen, die auf knirschenden Schlittschuhen im Kreis herumflohen. Poju begriff nicht, was ich zeichnete, und da nahm ich einen Rotstift und flüsterte: »Blutspuren! Das ganze Eis ist voller Blutspuren!« Und Poju schrie, während ich die Grausamkeit auf das Papier bannte, um zu verhindern, dass sie an mich herankam.
Eines Sonntags brachte ich ihm bei, wie er sich vor den Schlangen retten konnte, die in dem großen Plüschteppich in Pojus Wohnung verborgen waren. Man musste dabei vor allem beachten, dass man nur die hellen Streifen betreten durfte, alle Farben, die hell waren. Wer danebentrat, ins Braune, war verloren. Dort unten wimmelte es von Schlangen, das ließ sich gar nicht beschreiben, das musste man sich ausmalen. Jeder musste sich seine eigenen Schlangen ausmalen, da die des anderen niemals so schrecklich werden konnten.
Poju balancierte mit winzigen Schritten und ausgestreckten Händen über den Teppich, und sein großes feuchtes Taschentuch flatterte kläglich in der einen Hand.
»Jetzt wird’s schmal«, sagte ich. »Pass jetzt gut auf und versuch, auf diese helle Blume in der Mitte zu hüpfen!«
Die Blume befand sich schräg hinter ihm, vorher lief das Muster in einer dünnen Schlinge aus. Poju versuchte verzweifelt, das Gleichgewicht zu halten, er flatterte mit dem Taschentuch und begann zu schreien, dann stürzte er ab, ins Braun hinunter. Er schrie und schrie und wälzte sich auf dem Teppich, er rollte auf den Boden hinaus und von dort unter einen Schrank. Ich schrie ebenfalls. Dann kroch ich hinterher und nahm ihn in die Arme und hielt ihn fest, bis er sich beruhigt hatte.
Plüschteppiche sind gefährlich. Da ist es viel besser, in einem Atelier mit Zementboden zu wohnen. Das ist auch der Grund, warum Poju immer so gern in unsere Wohnung kommt.
Poju und ich graben uns einen Geheimgang durch die Wand. Ich habe schon ein gutes Stück geschafft, obwohl ich nur arbeiten kann, wenn ich allein bin. Die Holzverschalung war nicht allzu schwierig, doch danach musste ich zum Marmorhammer greifen. Pojus Loch ist viel kleiner, aber sein Vater hat ja auch so schlechtes Werkzeug, dass es eine wahre Schande ist.
Jedes Mal wenn ich allein bin, hebe ich den Wandbehang hoch und klopfe weiter; bisher hat noch niemand bemerkt, was ich treibe. Der Wandbehang ist aus Sackleinen, und Mama hat ihn bemalt, als sie jung war. Er stellt einen Abend dar. Aus dem Moos steigen gerade Stämme auf, und hinter den Stämmen ist der Himmel rot, weil die Sonne untergeht. Bis auf den Himmel ist alles in unbestimmte, dunkle, graubraune Töne getaucht, doch die schmalen roten Streifen leuchten wie Feuer. Ich liebe Mamas Bild. Es führt einen tief in den Wald hinein, tiefer als mein Loch, tiefer als Pojus Wohnzimmer, es führt ins Unendliche, und man kommt nie an den Punkt, von wo aus man sehen könnte, wo die Sonne untergeht, das Rot aber wird immer leuchtender. Ich glaube, es brennt! Dahinten ist eine große schreckliche Feuersbrunst, genau so eine Feuersbrunst, wie sie Papa immer erwartet.
Als Papa mir zum ersten Mal eine seiner Feuersbrünste zeigte, war es Winter. Er ging voraus übers Eis, und Mama kam hinterher und zog mich auf einem Schlitten. Der Himmel war rot, schwarze Menschen rannten umher, und etwas Entsetzliches war geschehen. Das Eis war mit schwarzen, stachligen Sachen übersät. Papa sammelte sie ein und legte sie mir in die Arme, sie waren sehr schwer und drückten auf meinen Bauch.
Explosion ist ein schönes Wort, und sehr groß ist es auch. Später lernte ich noch andere Wörter kennen, die man nur vor sich hin flüstern kann, wenn man allein ist. Unerbittlich. Ornamentik. Profil. Katastrophal. Elektrisch. Kolonialwarenladen.
Wenn man sie häufig wiederholt, werden sie immer größer. Man flüstert und flüstert und lässt das Wort wachsen, bis außer dem Wort nichts mehr vorhanden ist.
Ich frage mich, warum die Feuersbrünste immer nachts ausbrechen. Vielleicht interessiert Papa sich nicht für Feuersbrünste, die tagsüber brennen, weil der Himmel da nicht rot ist.
Papa weckte uns jedes Mal, und wir hörten das Heulen der Feuerwehr, es war sehr eilig, wir rannten durch die Straßen, die ganz leer waren. Der Weg zu Papas Feuersbrunst war immer schrecklich weit. Alle Häuser schliefen schon und streckten ihre Schornsteine in den roten Himmel, der immer näher kam, und schließlich waren wir da, und Papa hob mich hoch und zeigte mir das Feuer. Aber manchmal war es auch nur ein mickriges kleines Feuer, das schon längst erloschen war, und dann war Papa so enttäuscht und niedergeschlagen, dass er getröstet werden musste.
Mama mag nur ganz kleine Feuersbrünste, die sie verstohlen im Aschenbecher anzündet. Und Kaminfeuer mag sie auch. Jeden Abend, wenn Papa ausgegangen ist, um Bekannte zu besuchen, macht sie im Atelier und im Flur ein Feuer im Kamin.
Wenn das Feuer brennt, zieht sie den großen Stuhl heran. Wir machen das Licht im Atelier aus und setzen uns vors Feuer, und sie beginnt: »Es war einmal ein kleines Mädchen, das war unglaublich schön, und ihre Mutter hatte sie so unglaublich lieb…« Jede Geschichte muss so anfangen, was dann folgt, ist nicht so wichtig. Eine milde, langsame Geschichte in einer warmen Dunkelheit, man starrt ins Feuer, und nichts ist gefährlich. Alles andere ist draußen und kann nicht hereinkommen. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht.
Meine Mama hat dichtes dunkles Haar, es hüllt einen ein wie eine Wolke, es riecht gut, die traurigen Königinnen im Buch haben solche Haare. Das schönste Bild im ganzen Buch ist eine ganze Seite groß. Es stellt eine Landschaft in der Dämmerung dar, eine mit Lilien bewachsene Ebene. Überall auf der Ebene wandeln blasse Königinnen umher, sie halten Gießkannen in den Händen. Die vorderste ist geradezu überirdisch schön. Ihr langes dunkles Haar ist weich wie eine Wolke, und der Zeichner hat es mit Pailletten bestreut, vermutlich hat er Deckfarbe genommen, nachdem alles andere fertig war. Das milde Profil der Königin ist ernst. Da wandelt sie nun ihr Leben lang und gießt und gießt, und niemand weiß, wie schön und traurig sie ist. Die Gießkannen sind mit echter Silberfarbe gemalt, und wie der Verlag sich so etwas leisten kann, das begreifen Mama und ich beim besten Willen nicht.
Mamas Erzählungen handeln oft von Moses, erst im Schilf und dann später; von Isaak und von Leuten, die Heimweh nach ihrem eigenen Land haben oder die sich verirren und dann doch noch den richtigen Weg finden; von Eva und der Schlange im Paradies und von großen Stürmen, die sich schließlich beruhigen. Die meisten Personen in ihren Geschichten haben auf jeden Fall häufig Heimweh und sind oft einsam, sie verhüllen sich in ihrem Haar und werden in Blumen verwandelt.
Manchmal auch in Frösche, und Gott behält sie die ganze Zeit im Auge und vergibt ihnen, allerdings nur, wenn er nicht gerade zornig und gekränkt ist und ganze Städte zerstört, weil die Einwohner an andere Götter glauben.
Moses konnte ab und zu auch recht unbeherrscht sein. Die Frauen aber warteten und warteten und hatten Heimweh. Oh, ich werde dich in dein eigenes Land führen oder in welches Land du willst auf Erden und Pailletten in dein Haar malen und dir ein Schloss bauen, in dem wir leben werden, bis dass der Tod uns scheidet, und niemals werden wir auseinandergehen. Und in einem dunklen, unendlichen Wald, schwarze Wolken, der Donner hallt, ein kleines Kind ganz einsam geht, die Nacht so schwarz und grausig steht, das Kind so traurig weinet sehr, die Mutter seh ich nimmermehr, hier in Finsternis und Not, erleiden muss ich bittern Tod. Sehr befriedigend. Auf diese Art sperrten wir das Gefährliche aus.
Papas Figuren bewegten sich sachte im Schein des Feuers, seine melancholischen weißen Frauen, die einen vorsichtigen Schritt wagten, ständig fluchtbereit. Sie wussten Bescheid um das Gefährliche, das überall lauert, aber für sie gab es nur eine Rettung – sie mussten in Marmor gehauen und in einem Museum aufgestellt werden. Dort war man in Sicherheit. In einem Museum, auf einem Schoß oder unter einem Baum. Möglicherweise unter der Bettdecke. Aber das Beste war wohl doch, in einem hohen Baum zu sitzen, wenn man sich nicht zufällig noch im Bauch seiner Mutter befand.
© Per Olov Jansson
Jeremiah
EINMAL, ALS ES AUF DEN HERBST ZUGING, wohnte ein Geologe im Lotsenhäuschen. Er konnte weder Schwedisch noch Finnisch, er lächelte nur und ließ seine schwarzen Augen funkeln. Wenn er einen ansah, fühlte man sofort, wie außerordentlich glücklich er war, einen endlich kennenlernen zu dürfen, doch dann ging er einfach weiter und klopfte mal hier, mal dort auf die Felsen. Er hieß Jeremiah.
Er lieh sich ein Boot, um zu den Inseln hinauszurudern, und Kallebisin stand grinsend am Ufer und sah zu, wie Jeremiah ruderte, es sah gar zu kläglich aus. Jeremiah auf dem Wasser war eine einzige Blamage, und Papa fragte sich, was die Lotsen wohl denken mochten, wenn sie ihn rudern sahen.
Ich war jeden Tag mit Jeremiah zusammen. Wir umrundeten die Buchten, und ich durfte seinen kleinen Kasten tragen, während er an den Felsen herumklopfte. Manchmal durfte ich auch das Boot hüten. Es war sicher sehr vernünftig, dass ich mich um Jeremiah kümmerte. Er konnte nicht einmal einen ordentlichen Halbschlag machen, es sah jedes Mal aus wie eine Art Schleife. Oder er vergaß es ganz, das Boot zu vertäuen. Aber das kam nur daher, dass er sich ausschließlich für Steine interessierte, sonst für nichts auf der Welt. Die Steine brauchten nicht schön zu sein oder rund oder irgendwie ungewöhnlich. Er hatte seine eigene Vorstellung von Steinen, und die hatte mit allen anderen Vorstellungen nichts gemein.
Ich störte ihn nie, nur ein einziges Mal zeigte ich ihm meine eigenen Steine. Da übertrieb er seine Bewunderung derart, dass es mir peinlich war. Er übertrieb auf die verkehrte Weise. Doch mit der Zeit lernte er es besser.
Wir gingen an den Stränden entlang, er voran und ich hinterher. Wenn er stehen blieb, blieb ich auch stehen, allerdings nicht zu nahe, und sah ihn an, während er klopfte. Er hatte nicht besonders viel Zeit für mich übrig. Aber manchmal, wenn er sich umdrehte und mich sah, tat er so, als wäre er unglaublich überrascht. Er beugte sich vor und riss die Augen auf und versuchte mich durch sein Vergrößerungsglas zu erblicken, und dann schüttelte er den Kopf, als könnte er es einfach nicht fassen, dass jemand so unglaublich klein sein konnte wie ich. Schließlich entdeckte er mich aber doch und ging vor Staunen rückwärts und tat so, als hielte er etwas sehr Kleines in den Händen, und dann lachten wir alle beide.
Manchmal zeichnete er uns in den Sand, einen sehr Großen und eine sehr Kleine, und einmal, als es windig wurde, lieh er mir seinen Pullover. Aber meistens klopfte er nur an den Felsen herum und vergaß mich. Das machte nichts. Ich lief immer hinter ihm her, und morgens wartete ich vor dem Lotsenhäuschen, bis er aufwachte.
Wir hatten ein gemeinsames Spiel. Ich legte ein Geschenk auf seine Treppe und versteckte mich anschließend, und wenn er herauskam, fand er das Geschenk und wurde ungeheuer glücklich. Er wunderte sich, kratzte sich am Kopf und gestikulierte mit den Armen, und dann begann er mich zu suchen. Bei der Suche stellte er sich ziemlich dumm an, doch das gehörte ja dazu. Es musste lang dauern, bis er mich gefunden hatte und entdeckte, wie unglaublich klein ich war. Und ich machte mich immer kleiner, damit er sich freute.