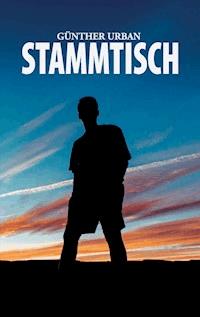Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die fiktive Gemeinde Achhofen in Oberbayern wurde im Frühjahr 2016 von einer Starkregenfront innerhalb weniger Stunden unter Wasser gesetzt. Die ersten acht Monate des Jahres waren geprägt von feuchten Luftmassen aus dem Südwesten, die in Süddeutschland allenthalben zu noch nie beobachteter Bewölkung und noch nie aufgetretenen Hochwasserereignissen geführt haben. Die siebenjährige Lucia vom Biohof Münch, die das schwere Hochwasser von Achhofen hautnah miterlebt hat, fürchtet sich seither, wenn mächtige dunkle Wolken aus dem Südwesten heraufziehen. Ihr fünfzehnjähriger Bruder Benedikt hat während des Hochwassers ganz wesentlich mit dazu beigetragen, dass der Hof nicht in den Fluten versank. Benedikt, der Mitglied einer Gruppe Jugendlicher ist, die die system- und gesellschaftskritische Jugendzeitung »Revolte« herausgibt, ist der Meinung, dass die meisten Erwachsenen wie Lemminge dem Credo der Fortschritts- und Wachstumsfanatiker folgen und deshalb den Klimawandel schulterzuckend hinnehmen; dass also der Jugend nichts anderes übrig bleibt, als die Erwachsenenwelt mit spektakulären Aktionen aufzurütteln, sie damit zum Umdenken zu bewegen, um letztlich zu verhindern, dass die Zukunft der jungen Generation von Katastrophen überschattet wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günther Urban, Jahrgang 1941, setzt sich seit den sechziger Jahren für die Belange von Jugendlichen ein. Er war zwölf Jahre lang für Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat einer oberbayrischen Kreisstadt. Seit langem kämpft er gegen das festgefahrene Wirken etablierter Kreise, gegen das unreflektierte Denken und Handeln von grundsätzlich fortschrittsgläubigen Zeitgenossen und gegen den Wachstumswahn.
Urban ist der Ansicht, dass sich insbesondere seit dem Fall der Mauer Verhältnisse aufbauen, die dem Großteil der Weltbevölkerung zum Schaden gereichen; Verhältnisse, die von einer Minderheit in die Welt gesetzt und von dieser aufrecht erhalten werden.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
I
In der Wohnküche im Biohof Achrainer ist die siebenjährige Luci (Lucia) gerade dabei, den großen Tisch im Herrgottswinkel für das Abendessen der Familie Münch zu decken.
Der fast hundertfünfzig Jahre alte Hof im Außenbezirk der Kreisstadt wird von den Münchs in dritter Generation bewirtschaftet.
Lucis Mutter kommt in die Küche und sagt zu ihr: »Du, für den Papa musst du nachher noch ein Weißbier aus den Keller holen. Ein Bier hat er sich heute mehr als verdient und es wird ihn vielleicht auch ein wenig aufrichten.« Sie schaut auf die Uhr neben der Tür in die Wohnstube, überlegt einen Moment lang und seufzt dann: »Seit achtzehn Stunden ist er nun schon in Achhofen im Hochwassereinsatz. Aber sie haben es jetzt endlich geschafft, mit einem Sandsäckedamm einen großen Teil des Dorfes zu sichern, wie er mir gerade am Telefon gesagt hat.«
»Und wir haben es geschafft, die Ach von unserem Hof weg zu halten, Mama!«, sagt Luci stolz und strahlt.
»Ja, super waren wir alle. Und der Papa wird so was von froh sein, dass uns das gelungen ist. Er weiß ja noch gar nicht, dass die Ach am frühen Morgen auch bei uns herunten über die Ufer getreten ist.«
»Und der Beni und ich haben einfach die Schule geschwänzt und geholfen, als ein ganzer Lastwagen mit Sandsäcken bei uns angekommen ist.«
»Du, Luci, das war kein wirkliches Schwänzen. Als ich am Nachmittag die Schulleitungen angerufen habe, sagten sie mir, dass das ganz in Ordnung ist, dass viele Kinder nicht gekommen sind, weil mehrere Straßen nicht passierbar waren, dass vor allem die größeren Kinder in Achhofen beim Abdichten ihrer Elternhäuser geholfen haben und beim Aufschichten vom großen Damm mit dabei waren.«
Als Luci aus dem Keller kommt, sitzen die Großeltern schon am Tisch. Während sie ein Weißbierglas aus dem Geschirrschrank nimmt, kommt ihr Papa in die Küche. Er sagt nur: »Grüß euch, zusammen«, und lässt sich auf seinen Platz am Tisch fallen.
Luci stellt die Bierflasche und das Glas zu ihm auf den Tisch, legt einen Flaschenöffner daneben und haucht ihm einen Kuss auf die Wange. Der Papa ächzt nur: »Danke, Luci«, und schiebt dann die Bierflasche eine Weile geistesabwesend auf dem Tisch herum.
Sein Töchterl weiß jetzt nicht so recht, wofür er sich bedankt hat – für das Bier oder den liebvollen Kuss, der ihn aufmuntern sollte. Sie muss darüber aber nicht lange nachdenken, weil gerade ihr Bruder und der Onkel Martin hereinkommen.
Der Onkel setzt sich neben die Oma und sagt dann auch schon zu seinem erschöpft im Stuhl lehnenden Bruder: »Herrgott, Bastian, so ein Hochwasser haben wir noch nie gehabt!«
Die Großeltern nicken nur dazu.
»Und du kannst Gott danken, dass der Hof nicht abgesoffen ist«, meint er gleich darauf auch noch und streckt die Beine unterm Tisch aus.
»Wieso der Hof?!« Der Bauer richtet sich mit einem Ruck auf und schaut geschockt in die Runde.
Der Martin, der Lokführer ist, und die letzten drei Tage unterwegs war, schaut den Benedikt fragend an und sagt zu ihm: »Ja weiß denn dein Vater gar nicht, dass das Achhochwasser auch den Hof erreicht hat?«
Der schüttelt nur den Kopf.
Luci dagegen setzt sich neben den Papa und beginnt aufgeregt zu erzählen. Als sie zur Anlieferung der Sandsäcke kommt, springt der Papa auf und eilt hinaus. Die Luci und ihre Mama eilen hinterher.
Nach fünf Minuten kommen die drei zurück.
Der Bauer lässt sich wieder in den Stuhl fallen und ächzt nach einem schweren Schnaufer: »Herrgott, Leute!« Er öffnet dann die Bierflasche und trinkt erst einmal einen Schluck aus der Flasche. Nach einer Weile ächzt er noch einmal: »Herrgott, Leute!«
»Wenn ihr nicht so gekämpft hättet«, meint er nach einer Weile und einmal tief durchatmen, »dann wären jetzt unsere Vorratskeller voll Wasser.«
»Ganz bestimmt, Bastian«, sagt der Großvater und setzt sich auf. »Und ohne den Beni hätten wir es auch nicht geschafft, da wäre das Wasser schneller gewesen.« Der Großvater klopft dem Fünfzehnjährigen, der sich zu ihm gesetzt hatte, anerkennend und dankbar zugleich auf die Schulter und berichtet dann noch: »Dein Sohn, Bastian, hat nämlich gut vier Stunden lang ohne Pause gleich drei Sandsäcke auf einmal geschleppt. Du, ich sag dir, der Beni hat gekämpft, als ginge es um sein Leben!«
Der Benedikt wird ein wenig rot und erklärt hastig: »Wir alle haben gekämpft, Opa!«
Der Vater sagt dazu nur: »Ich weiß schon, Beni, die Luci und die Mama haben mir draußen an der Ach das ganze Drama recht eindringlich geschildert.« Er streckt daraufhin seine rechte Hand zum Sohn hinüber und drückt dessen Hand lange und innig. Und während er sich wieder zurücklehnt, sagt er nachdenklich und irgendwie abwesend: »Die Gemeinde wird einen kilometerlangen Entlastungskanal bauen müssen und oberhalb von Achhofen zusätzlich eine Flutmulde, denn das nächste Hochwasser wird nicht lange auf sich warten lassen.«
Für den Benedikt war der Händedruck des Vaters ein Ritterschlag, und für ihn stand nun fest, dass er den Hof einmal übernehmen wird, was er sich bisher nicht so recht vorstellen konnte.
Luci dagegen flüchtet auf den Schoß vom Vater, schlingt die Arme um ihn und jammert: »Papa, ich will aber kein Hochwasser mehr! Und ich hab auch Angst vor den vielen dunklen Wolken, die wir jetzt immer haben!«
»Ach Luci, schau doch nur hinaus, gerade kommt die Sonne durch, die wird die Wolken ganz schnell vertreiben.«
Der Vater spürt selbst, dass seine Worte nicht so recht trösten können. Weil er restlos kaputt ist, und ein stärkerer Trost auch nicht leicht möglich ist, belässt er es dabei und sagt nur noch: »Du, jetzt lass uns erst einmal essen, und dann gehen wir zwei noch einmal zur Ach hinaus und schauen, ob der Sandsäckedamm auch dauerhaft dicht hält.«
»O ja, Papa, das machen wir!«
Die aus den Wolken hervorlugende Sonne hat Lucis Sorgen nicht vertreiben können, aber mit dem Vater ihr Werk kontrollieren, ließ diese ganz schnell verfliegen. Sie rutscht von seinem Schoß herunter und setzt sich wieder neben ihn.
Am nächsten Nachmittag, nachdem Luci ihre Hausaufgaben hinter sich gebracht hat, geht sie mit dem Großvater zur Ach hinaus.
Dort stellen die beiden erleichtert fest, dass der breite Bach wieder innerhalb seiner Ufer fließt.
»Du, Opa, müssen wir die vielen Sandsäcke jetzt wieder wegräumen?«, fragt Luci mit einer Miene, die so gar keine Begeisterung zeigt.
»Nein, Luci, der Papa hat entschieden, dass wir den Damm vorerst nicht abtragen, weil die längerfristige Wettervorhersage weitere starke Regenfälle ankündigt.«
Luci drückt sich an den Opa und klagt: »Ich will aber keinen Regen mehr, Opa! Und ich mag auch die großen, dunklen Wolken nicht, die schon wieder am Himmel sind.«
Der Großvater streichelt sanft über ihr weißblondes Haar und sagt mit rauer Stimme: »Luci, für morgen sagt der Wetterbericht einen sonnigen Tag voraus.«
»Ja schon, Opa, aber warum regnet es denn heuer so viel?«
»Du, das ist nicht so leicht zu sagen, mein Engel. – Weißt du was, wir setzten uns jetzt erst einmal gemütlich auf die Terrasse, und dann werd ich versuchen, dir das zu erklären.«
Während sie zum Haus zurückgehen, beginnt Luci zu erzählen: »Du, Opa, heut in der Schule haben wir in der ersten Stunde über das Hochwasser geredet, und da hat die Lehrerin gesagt, dass die Erderwärmung den vielen Regen macht. Und … und dann hat sie auch noch gesagt, dass wir Menschen daran schuld sind.«
Der alte Münch setzt sich auf die Bank auf der Terrasse und lässt dann erst einmal einen schweren Seufzer heraus. Luci setzt sich neben ihn und sagt ungeduldig: »Also, Opa, sag schon, warum wir Menschen schuld sind!«
Der seufzt erneut auf und sagt dann zögerlich und stockend: »Weil wir zu viel Auto fahren, Luci, zu viel fliegen, zu viel heizen …« Er bricht ab und stößt nach einer Weile fast schon unwirsch heraus: »Weil wir Menschen von allem einfach zu viel machen!«
Der ärgerliche Tonfall hat Luci nicht wenig erschreckt. Sie schaut den Opa ziemlich verstört an und sagt erst nach einer Weile recht vorsichtig, schließlich aber doch mit Nachdruck: »Aber Opa, wir fahren doch nicht viel Auto, wir fahren doch fast nur mit dem Fahrrad oder mit dem Bus, unser Auto steht doch fast immer in der Garage. Und fliegen, Opa, tun wir doch gar nicht, weil das der Papa ganz, ganz schlecht findet!«
Der alte Herr drückt seine Enkelin liebevoll an sich und seufzt wieder abgrundtief. »Ja, Luci, das mit der Erderwärmung ist eine schwierige Sache«, meint er schließlich und schaut dabei dem Beni zu, der gerade die Milchkühe in den Stall treibt.
»Weißt du«, sagt er nach einer Weile mehr vor sich hin, »wenn sich alle Leute so verhalten würden wie wir, dann würde die Erderwärmung wahrscheinlich viel geringer sein und …«
»Und wir hätten dann auch nicht so viel Regen, oder?«
»Ziemlich sicher, mein Engerl.«
Und dann denkt der alte Münch, während er wieder die Kuhherde beobachtet: ›Herrgott, so weit haben wir es gebracht, dass es zum Problem wird, einer immerhin Siebenjährigen unsere Gegenwart zu erklären!‹
Und mit ihrer nächsten Frage verstärkt Luci dieses Problem auch noch: »Ja Opa, warum machen es denn die anderen Leute nicht so wie wir?«
»Weil ihr Leben halt anders ist, Luci! Manche wohnen weit draußen auf den Dörfern, wo kein Bus hinfährt, andere wieder verbringen ihren Urlaub gerne in weit entfernten Ländern, die nächsten heizen mit Öl oder Gas und dann gibt es Leute, Luci …«
»Aber Opa, wenn das nicht anders wird, dann werden wir doch immer diese schrecklichen Wolken und den vielen Regen haben! – Ja schau, jetzt fängt es schon wieder zu regnen an!«
II
Ich bin ja gespannt«, sagt der alte Münch beim Abendessen, »ob der Bürgermeister und die Leute vom Ingenieurbüro Seltmann die Bürgerversammlung halbwegs friedlich durchziehen können.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen, Opa«, meint der Benedikt forsch und erklärt dann ein wenig vollmundig: »Wenigstens fünftausend Leute sind gegen die Westtangente, die bei uns vorbeikommen soll, und kaum weniger Oststadtler sind gegen die Osttangente; und die Idee mit dem Tunnel ist ja echt hirnrissig, was sogar die Leute im Bauamt sagen.«
»Dann wird wahrscheinlich alles beim Alten bleiben«, meint der Münch-Opa lapidar und fügt hinzu: »Mehr als zwanzigtausend Pkw und Lkw rollen also auch in Zukunft durchs Zentrum, und an der Rathauskreuzung stehen die Fußgänger weiterhin in den Abgasen.«
»Ja, es ist eine tragische Situation, die sich in unserer Stadt aufgebaut hat. Fast alle fahren Auto, aber keiner will den Verkehr haben«, schließt der Martin missmutig daran an und verjagt die Fliegen auf dem Obstteller. Er dreht sich dann zu seinem Bruder hin und sagt: »Und spätestens heute, Bastian, muss dir eigentlich jeder recht geben, wenn du sagst, dass die Entwicklung der Bundesrepublik seit vielen Jahren verkehrt läuft.«
»Aber total verkehrt!«, knurrt die Bäuerin Regina, steht auf und beginnt den Tisch abzuräumen.
Als sie nach einer Weile aus der Speisekammer kommt, sagt sie: »Und dass mir der Beni spätestens um zehn heimfährt, Männer! Dem steht morgen eine Schulaufgabe in Physik bevor, und da sollte er keinesfalls verschlafen antreten. Habt ihr verstanden?!«
Ihr Mann, der Martin und der Benedikt nicken nur, stehen auf und verlassen mit »Pfüat euch, zusammen!« die Küche.
Als die drei auf ihren Fahrrädern in die Zufahrt zur Stadthalle einbiegen, sehen sie zunächst nur Autodächer in der Abendsonne blinken. Der Martin will schon losschimpfen, kann sich aber gerade noch abbremsen, weil der Radlstellplatz vor der Halle ebenfalls voll ist.
Links vom Halleneingang haben die Westtangentengegner einen Infotisch mit einem großen Transparent aufgebaut, und rechts davon – wie ein Spiegelbild – die Osttangentengegner. Im Foyer stehen die Tunnelbefürworter an ihrem Tisch und führen mit nicht überseh- und überhörbarem Engagement Diskussionen mit einem ganzen Pulk von Versammlungsbesuchern.
Im großen Saal, der mit Tischen und Stühlen bis an den Rand vollgestellt ist, geht es zu wie in einem Bienenstock. Bastian kann sich nicht erinnern, dass eine Bürgerversammlung jemals so einen Andrang erlebt hätte, und so finden die Münchs auch nur mit Ach und Krach drei freie Plätze. Der Benedikt setzt sich dann aber doch ein paar Tische weiter zu seinen Freunden von der Landjugend.
Die Bedienungen versorgen außer Atem das Publikum mit Brotzeiten und Getränken. Sie machen erst eine Pause, als der Bürgermeister schon ein Gutteil seiner Begrüßung hinter sich gebracht hat. Er bleibt dabei absolut neutral, und Bastian denkt: ›Was soll er auch sagen, wenn die Bevölkerung so gespalten ist, sich nur einig darin ist, dass sie keinen Verkehr in ihrem Viertel haben möchte. Welche Position er auch einnehmen würde, er würde sich immer in die Nesseln setzten und sich Buhrufe einhandeln.‹
Nach der kurzen Rede des Bürgermeisters schlägt die Stunde der fünf Mitarbeiter des Büros Seltmann, und der Bürgermeister, der Bauamtsleiter und der Kämmerer, die diesen Leuten das Zentrum auf dem Podium zugestanden haben, versinken augenblicklich in Bedeutungslosigkeit.
Die Seltmann-Leute sehen nirgendwo ein Problem: der moorige Untergrund im Westen ist technisch beherrschbar, die Hügelkette im Osten ist sowieso keins, und Tunnel haben sie schon viele gebaut.
Die gut vierhundert Bürger nehmen das alles schweigend zur Kenntnis, was dem Bastian nicht ganz geheuer ist. Die Bürger, vermutet er deshalb, hatten wohl angenommen, dass die Ingenieure eindeutige und klare Vorteile für eine der im Raum stehenden Varianten herausstellen werden. Aber nichts dergleichen. Nach gut einer Stunde sind sie mit ihren Stellungnahmen und Erklärungen sowie mit der Projektion einer Vielzahl von Plänen durch, und geben das Wort an den Bürgermeister zurück.
Dem geht es offenbar wie der Bürgerschaft unten im Saal, und so bringt er erst nach längerem Überlegen Dankesworte für die »fundierten« Informationen heraus, sagt allerdings auch, dass er nun nicht klüger ist als vorher. Er wechselt noch ein paar Worte mit dem Bauamtsleiter und bittet dann die Bürger, sich für ihre Wortbeiträge an den vier Mikrofonen im Saal anzustellen.
Keiner steht auf. Die Leute sitzen wie gelähmt vor ihren Getränken und Brotzeittellern. Nach vielleicht einer halben Minute steht einer von der Landjugend auf und geht zum nächststehenden Mikrofon.
Der Bastian und der Martin schauen sich überrascht an, wollen sich noch halblaut etwas sagen, aber da beginnt der Benedikt – ein Blatt Papier in der Hand – auch schon mit fester Stimme: »Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin der Benedikt Münch vom Achrainerhof und möchte ein paar Worte an die Herren Ingenieure richten. – Also, die Herrschaften, ihr habt uns klar und deutlich vor Augen geführt, dass unser Verkehrsproblem für Euch kein Problem ist. Aber was erreichen Sie letztlich mit ihrer Arbeit? Der Verkehr in unserer Stadt wird nicht weniger werden, im Gegenteil, denn die Tangenten, die eine wie die andere, werden von unseren beiden großen Stadtratsfraktionen nicht zuletzt als Erschließungsstraßen gesehen, was die Pläne, die Sie uns gerade vorgestellt haben, ja auch eindeutig aufzeigen. Mit einer Tangente wird man also neues Gewerbe und damit noch mehr Verkehr auf die Stadt ziehen. Der Tunnel wird möglicherweise ganz ähnliche Wirkungen haben, weil nicht auszuschließen ist, dass vor und nach dem Tunnel neue Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Außerdem ist festzustellen, dass weder eine Tangente noch der Tunnel das Verkehrsaufkommen im Zentrum der Stadt entscheidend verringern werden, weil sich unsere Stadt zu einer Einkaufsstadt entwickelt hat. Und so werden die Menschen aus der Region auch in Zukunft mit dem Auto ins Zentrum fahren. Weil darüber hinaus die Stadt bei weitem nicht allen Bürgern einen Arbeitsplatz bietet, werden diese auch weiterhin in großer Zahl mit dem Auto in die Region auspendeln.
Damit, sehr geehrter Herr Bürgermeister und sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich es auch schon gut sein lassen und nur noch sagen, dass sich die Bürger unserer Stadt im Grunde weniger Verkehr wünschen, dass ihnen mit neuen Straßen keinesfalls gedient ist. – Herr Bürgermeister, ich danke Ihnen dafür, dass ich das vorbringen durfte.«
Der Benedikt dreht sich um und marschiert zu seinen Freunden zurück. Er hat den Tisch noch nicht ganz erreicht, da bricht, als hätte jemand einen Schalter umgelegt, ein Beifallssturm los. Sein Vater und sein Onkel applaudieren ebenfalls was das Zeug hält, überlegen aber auch, was diesen Sturm wohl auslöst. Sie kommen schließlich zu dem Ergebnis, dass die Bürger aus dem Osten und Westen der Stadt, die das weitaus größte Kontingent im Saal stellen, nun annehmen, dass der junge Mann mit seinen Argumenten den Tangenten den Todesstoß versetzt hat.
Nachdem sich der Beifall gelegt hat, drängen die Tunnelverfechter zu den Mikrofonen. Sie bringen vehement ihr stärkstes Argument vor, dass nämlich der Tunnel das Zentrum der Stadt vom Durchgangsverkehr weitgehend befreien wird. Sie handeln sich dennoch wütende Zwischenrufe von Seiten der Anwohner an den geplanten Tunnelportalen ein, weil diese befürchten, dass dort früher oder später Gewerbeflächen ausgewiesen werden, und dann der Verkehr in ihren Quartieren erheblich zunimmt.
Nach dem letzten Tunnelbefürworter tritt der Martin ans nächststehende Mikrofon. Er stellt sich kurz vor, begrüßt ganz knapp den Bürgermeister und knüpft dann an den Benedikt an: »Weil auch unser Herr Landtagsabgeordneter zugegen ist«, beginnt er recht sicher, »möchte ich unser Verkehrsdilemma unter dem gleichen Blickwinkel angehen, wie das mein Neffe Benedikt schon getan hat, möchte diese Sichtweise aber noch etwas erweitern. – Also, meine Damen und Herren, mein Neffe hat ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass neue beziehungsweise zusätzliche Straßen Verkehrsprobleme selten lösen, sondern diese in aller Regel nur verstärken. Und es hat sich wieder einmal gezeigt, dass niemand«, er schaut kurz in die Runde, »Verkehr vor seiner Haustür haben möchte. Es ist also höchste Zeit, dass wir das Grundgerüst, die Struktur unseres Landes verändern und der Vermeidung von Verkehr höchste Priorität einräumen. Das heißt im Klartext, meine Damen und Herren, dass wir auf allen Ebenen unseres Gemeinwesens die Zentralisierungsmaßnahmen stoppen, die Regionalisierungsbestrebungen aber, die vereinzelt schon erkennbar sind, deutlich verstärken müssen. Daneben müssen wir uns energisch dafür einsetzen, dass die öffentlichen Verkehrssysteme ausgebaut werden. Des Weiteren, meine Damen und Herren, müssen wir alles in unserer Kraft stehende daransetzen, dass das unnötige Hin und Her von Waren und Leistungen, das in den letzten Jahrzehnten so enorm zugenommen hat, zurückgefahren wird. – Und nun noch zu Ihnen, Herr Bürgermeister: Unsere Stadt muss zu Gunsten der Fußgänger und Radfahrer umgestaltet werden, damit der Bürger, der fast fünfzig Prozent des städtischen Autoverkehrs verursacht, sein Auto öfter in der Garage stehen lässt.«
Martin Münch atmet einmal tief durch und schließt dann mit »Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.«
Auf dem Weg zu seinem Platz registriert er vereinzelt demonstratives Kopfschütteln und an ein paar Tischen Applaus. Seine Worte haben aber an allen Tischen heftige Diskussionen ausgelöst, in welchen das Schlusswort des Bürgermeisters zur Gänze untergeht.
Der Benedikt ist noch vor zehn Uhr mit seinem Vater und dem Martin nach Hause gekommen.
Auf dem Heimweg wussten die beiden gar nicht, was sie zu seinem Auftritt zuerst sagen sollen. Der junge Mann hatte aber ein ganz simple Erklärung für sein engagiertes und mutiges Vorpreschen: »Also, ihr zwei«, erklärte er zunächst einmal, »ich habe doch nur gesagt, was ihr schon seit Jahren redet. – Ja, und dann habe ich noch angehängt, was wir bei der Landjugend in den letzten Wochen angesprochen haben, dass nämlich die Portalzone von einem Tunnel immer hässlich ausschaut und deshalb zu befürchten ist, dass dort Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Außerdem habe ich mir gedacht, dass es bei den Erwachsenen eher ankommt, wenn ein Jugendlicher neue Gewerbeansiedlungen und das damit verbundene Anwachsen des Verkehrs anspricht.«
Der Martin fährt nahe an seinen Neffen heran, klopft ihm ein paar Mal anerkennend auf den Rücken und sagt restlos begeistert: »Mann, Benedikt, deine Rechnung ist zu hundert Prozent aufgegangen!«
III
In der Jugendkneipe »Saturn« sitzt am frühen Abend der Münch Benedikt mit seinen Freunden zusammen. Mit dabei ist sein Physiklehrer Robert Weinbauer, genannt »Rocco«. Seine Freunde sind die Gymnasiasten Michaela Hört, Gerhard Stamm und Moritz Reiser (Mutter aus Äthiopien, Vater waschechter Bayer) sowie die Auszubildenden Simone Kircher (Bankkauffrau), Justus Liebermann (Kfz-Mechatroniker) und Maximilian Hirmer (Schuhmacher).
Genau genommen ist diese Zusammenkunft eine Redaktionssitzung, bei der die nächste Ausgabe der Jugendzeitung »Revolte« in groben Zügen vorbereitet werden soll.
Allerdings stecken die jungen Leute nun schon fast eine halbe Stunde lang in der Entscheidung bezüglich des Kernthemas fest. Der Benedikt meint hartnäckig, dass man den Klimawandel noch einmal aufgreifen sollte, weil inzwischen die diesbezüglichen Umfrageergebnisse unter den Jugendlichen der Stadt vorliegen. Der Justus redet genauso hartnäckig dagegen und wird nicht müde zu sagen, dass das Reden gegen den Autowahn niemand mehr hören will, und dass dies am Ende noch seine Zukunft gefährden könnte. Die Michaela aus der zwölften Klasse ist dafür, dass man sich endlich der Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich, der Globalisierung und den weltweiten Finanzgeschäften zuwenden sollte. Gegen Letzteres redet Simone, die meint, dass die Finanzwelt, die nicht einmal sie so recht durchschaut, ein zu schwieriges Thema wäre. Sie wird dabei vom Lehrer Weinbauer unterstützt, der ins Feld führt, dass in dieser Welt sogar ausgewiesene Fachleute schwer im Schleudern sind. »Allerdings könnte eine Jugendzeitung schon sagen«, meint er nach kurzem Überlegen, »dass die Vorgänge dort das Potential haben, die Zukunft der jungen Generation ganz ähnlich zu gefährden wie der Klimawandel.«
Dieser Vorschlag des noch recht jungen Physiklehrers löst beim Team einträchtiges Kopfnicken aus, und dann sagt Michaela auch schon voller Elan: »Wir sollten eine Sonderausgabe herausbringen, in der wir der Erwachsenenwelt in Form eines Rundumschlages zu verstehen geben, dass sie unsere Zukunft seit langem und in vielfältiger Weise aufs Spiel setzt.«
Mit »Super, Micha!« segnen Moritz und Maximilian ihren Vorschlag umgehend ab. Nach unübersehbar scharfem Nachdenken meint dagegen der Gerhard: »Wir sollten Schwerpunkte setzen, Leute, ein Rundumschlag würde ziemlich sicher nicht gut ankommen und uns zeitlich überfordern.«
»Richtig, Gerhard! Und so möchte ich vorschlagen, dass wir jetzt«, Weinbauer schaut auf seine Armbanduhr, »ohne Verzug daran gehen, die Problemfelder zu benennen, die euch und eure Freundinnen und Freunde am stärksten umtreiben.«
»Wer schreibt?«, fragt der Gerhard und schaut Michaela charmant lächelnd an.
Die lächelt matt zurück und angelt sich den Schreibblock, der ziemlich mittig – offenbar wollte ihn keiner von den jungen Leuten in Reichweite haben – auf dem großen runden Tisch liegt.
Bestimmt eine halbe Minute lang herrscht dann Ruhe am Tisch, und so kommt der Lehrer nicht umhin, zu denken, dass offenbar gar nicht so einfach in Worte gefasst werden kann, was der Jugend in erster Linie Bauchschmerzen bereitet. Erst als vor der Kneipe laut wird, sagt der Maximilian: »Also … also ich würde gerne bringen, dass unser Volk schon viel zu lange in eine Richtung treibt, die nicht länger beibehalten werden darf. – Übrigens, mein Vater meint diesbezüglich, dass die Weichen bei uns schon vor Jahrzehnten falsch gestellt wurden, und dass wir Deutschen nun ein Riesenproblem haben, einen zukunftsfähigen Kurs einzuschlagen. Und mein Meister sagt immer, dass unsere Regierungen der industriellen Fertigung zu unüberlegt Tür und Tor geöffnet und Marktfreiheit ohne Rahmenbedingungen zugelassen haben, was zu immer größeren Unternehmen führte und unter anderem viel Handwerk sterben ließ.«
»Und so haben wir heute in vielen Wirtschaftsbereichen Konzentrationen«, schließt Michaela missmutig daran an, »die sich für den Verbraucher als äußerst nachteilig erweisen. Wenn ich bloß an das Angebot bei Schuhen denke, das ist ja heute so was von eng und bescheiden, ein regelrechter Eintopf ist das inzwischen! Und deshalb, Leute, würde ich sie mir ja am liebsten vom Maxi machen lassen … Okay, okay, Simone, ich weiß, das kann ich mir nicht leisten. Aber mich grämt es trotzdem, dass man heute mit dem Massenschrott herumlaufen muss.«
»Du, Micha, Schuhe aus unserer Werkstatt könntest du dir durchaus leisten, wenn du dir nicht jedes Jahr ein neues Paar zulegen willst. Jedes Jahr zwei oder drei Paar neue Schuhe aus dem Laden, was bei euch Damen ja gängig ist, ist am Ende nicht billiger und verursacht außerdem ganz erhebliche Umweltbelastungen.«
»Also Maxi, du Simpel, das kann vielleicht ein Mann machen, zehn Jahre lang mit den gleichen Schuhen herumlaufen!«, erregt sich da die junge Frau und wirft ihm einen vernichtenden Blick zu.
»Ja, Leute, jetzt leuchtet mit einem Mal sogar an unserem Tisch auf, warum so manches verkehrt läuft im Land und in der Welt«, befindet daraufhin breit grinsend der Moritz und lehnt sich mit verschränkten Armen zurück.
Michaela versetzt ihm unter dem Tisch einen Tritt gegen das Schienbein und knurrt: »Unsere Schuhe sind nicht das große Problem, Moritz! Die Autosucht von euch Männern ist da schon viel gravierender.«
»Halt, Micha!« Der Maximilian ruckt hoch und sagt dann mit Nachdruck: »Ich werde Schuhmacher, meine Gute, weil das einer der wenigen Berufe ist, in dem der Mann ohne Führerschein bestehen kann. Und gerade dieser Umstand, Freunde«, er schaut in die Runde, »zeigt uns deutlich, dass sich die moderne Welt fehl entwickelt. Denn die Wirtschaft und das Gemeinwesen gründen sich doch viel zu sehr auf das Auto.«
Beim Justus beginnen wieder die Alarmglocken zu schrillen. »Viel zu sehr auf das Auto«, wiederholt er genervt, »willst du damit etwa sagen, dass ich mir den verkehrten Beruf ausgesucht habe, du Sepp!«
Mit »Wahrscheinlich schon« fährt der Moritz dazwischen und grinst wieder.
»Rocco, jetzt müssen Sie eingreifen, bevor die zwei aufeinander losgehen!«, stößt da der Benedikt alarmiert heraus.