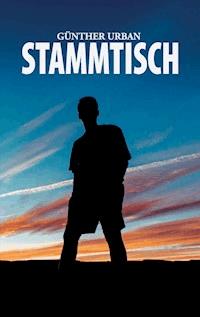Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Gräfin A. I. Eleonore Hortocány, eine strahlende Schönheit in den Fünfzigern und erfolgreiche Unternehmerin in Süddeutschland, ist ein führendes Mitglied der Oberschicht im deutschsprachigen Raum. Ihre Lebensumstände und ihre Herkunft haben aus ihr einen gesellschaftspolitischen Hardliner werden lassen, der eine Klassengesellschaft als naturgegeben ansieht. In ihrem engeren Umfeld bewegen sich ein in sich gespaltener Kardinal, ein ebenfalls sehr erfolgreicher Unternehmer und dessen rebellische Tochter. Die Handlung erstreckt sich über die Jahre 2005-2011, in welchem das Leben der Gräfin ins Wanken gerät, weil sie spürt, sich aber dagegen wehrt, dass die wachsende Weltbevölkerung, der sich immer deutlicher abzeichnende Klimawandel und die weltweiten Krisen ein partnerschaftliches Zusammenleben der Menschen notwendig machen. Das Leben der von den Männern umschwärmten Gräfin trübt zudem, dass es, was die Liebe angeht, von Anfang an unter einem unglücklichen Stern stand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günther Urban, Jahrgang 1941, war als Konstrukteur jahrzehntelang in einem renommierten Maschinenbauunternehmen in Südbayern beschäftigt. In diesem Zusammenhang hat er das Denken und Handeln der Oberschicht in der Bundesrepublik und weit darüber hinaus kennengelernt und erfahren. Er war zwölf Jahre lang Stadtrat für Bündnis 90/Die Grünen und ist so auch in das Spannungsfeld geraten, das sich zwischen der Weltanschauung etablierter Kreise und fundamentalen grünen Sichtweisen aufbaut.
Inhaltsverzeichnis
Kapital I
Kapital II
Kapital III
Kapital IV
Kapital V
Kapital VI
Kapital VII
Kapital VIII
Kapital IX
Kapital X
Kapital XI
I
Seit den Mittagsstunden stürzt ein heftiger Föhnsturm auf das Alpenvorland. Im weitläufigen Park der Villa Hortocány ist der Gärtner Sebastian schon eine Zeit lang damit beschäftigt, abgebrochene Äste und Zweige, die der Sturm rücksichtslos durch den Park wirbelt, von den Blumenbeeten fernzuhalten und auf einen großen Handwagen zu verfrachten. Am Ufer des angrenzenden Sees wogt das Schilf im Gleichklang mit den Böen, die vom Süden her über den See fegen. Einige Wasservögel machen sich offenbar ein Vergnügen daraus, dem Sturm die Stirn zu bieten. Sie stürzen sich mit angelegten Flügeln aus großer Höhe auf den See hinunter und segeln, kurz bevor sie das Wasser berühren, mit ausgebreiteten Schwingen wieder gen Himmel. Der leuchtet in hellem Blau, und lang gestreckte, weißgraue Föhnwolken stehen in Reih und Glied über dem Alpenvorland.
Die Segelboote vom Vormittag liegen längst in den Häfen oder auf den Bootsplätzen am Ufer. Nur zwei waghalsige Surfer rasen, lange Gischtfahnen hinter sich herziehend, mit akrobatischem Geschick und erstaunlicher Ausdauer hin und her über den See.
Die Gräfin Eleonore A. I. Hortocány ist vor kurzem von ihrem Gestüt zurückgekommen und erwartet nun im Salon ihre Gäste zum freitäglichen Fünfuhrtee. Eine Weile beobachtet sie durch eines der beiden südseitigen Rundbogenfenster die beiden Surfer auf dem wild bewegten See. Sie wendet sich dann einem farbenprächtigen Papagei zu, der in seinem Käfig aufgeregt herumhüpft, und sagt zu ihm in liebevollem Tonfall: »Ricardo, Ricardo, ich bin ja schon bei dir, ich bin ja schon bei meinem süßen Ricardo.«
Der hört ihr aufmerksam zu, wiegt dann den Kopf ein paar Mal hin und her und krächzt schließlich laut: »Schönen Tag, Noarri, schönen Tag, Noarri!«
»Den wünsche ich dir auch, mein Guter. Aber jetzt muss ich dich leider zudecken, sonst quatscht du nachher dauernd mit.«
Die Gräfin holt vom Sideboard, das an der den Fenstern gegenüberliegenden Wand steht, ein grünes Seidentuch und legt es über den Käfig. Der Papagei hüpft noch einige Male hin und her, krächzt noch ein paar Laute und ist dann still.
Der kreisrunde Käfig aus Messing steht zwischen den beiden Fenstern auf einem massiven, kunstvoll gedrechselten und gut einen Meter hohen Ständer aus tiefbraunem Holz.
Der Papagei, wie auch der Käfig und der Ständer sind ein Geschenk ihres ersten Gatten Nelson Cortales, einem Argentinier, von dem sie sich nach nicht einmal drei Jahren Ehe scheiden ließ.
Sie hatte ihn bei einem Pferderennen in der Peripherie von Paris kennengelernt und sich Hals über Kopf in den tollkühnen Reiter und Polospieler verliebt.
Nicht lange nach ihrer Hochzeit zeichnete sich allerdings ab, dass Nelson seine Zeit lieber auf Rennbahnen und bei Autorennen in aller Welt verbringt, als bei ihr; und er war schon gar nicht dafür zu gewinnen, einer geregelten Tätigkeit nachzugehen. Bald konnte er seinen Lebensstil aus der Apanage, die ihm seine wohlhabenden Eltern zukommen ließen, nicht mehr voll finanzieren und betrachtete es sodann als eine Selbstverständlichkeit, dass seine Frau die Regelung seiner monetären Engpässe übernimmt.
Für die junge Gräfin entwickelte sich diese Ehe zu einem Drama. Sie liebte Nelson vom ersten Tag an über alle Maßen, aber sie musste sich doch bald eingestehen, dass sie für ihn im Grunde nicht viel mehr als eine attraktive Gespielin ist.
In dieser schweren Zeit war ihr ihre Mutter zum ersten Mal in ihrem Leben eine starke und letztlich auch entscheidende Stütze. Sie erinnerte ihre Tochter eines Tages eindringlich daran, dass sie eine Hortocány sei, und sich deshalb nicht von diesem nutzlosen Mitglied des internationalen Jetset auf der Nase herumtanzen lassen darf. Nur einen Monat später war sie von Nelson geschieden, und es viel eine zentnerschwere Last von ihrem Herzen – und sie war dennoch todunglücklich.
Mein Ricardo ist so ein braver und treuer Vogel, denkt die Gräfin ein wenig wehmütig, während sie eine Taste am Funktelefon drückt und damit die Klingel im Dienstmädchenzimmer auslöst. Das Telefon liegt auf einem kreisrunden Couchtisch, der, umgeben von sechs mit mattweißem Leder bezogenen Polstersesseln, mitten im Salon steht.
Annina, eine hübsche junge Rumänin, bekleidet mit weißer Bluse und knielangen schwarzen Rock, kommt kurz darauf in den Salon, knickst und fragt: »Frau Gräfin, Sie wünschen?«
»Bringen Sie mir bitte eine Flasche Mineralwasser und fünf von den halbhohen Trinkgläsern.«
»Sofort, Frau Gräfin.«
Annina knickst wieder und verlässt eiligst den Salon.
Die Gräfin betrachtet sich dann kritisch in einem ovalen Standspiegel. Sie ist eine große, schlanke Frau und unstreitbar eine Schönheit, deren zweiundfünfzig Lebensjahre zumindest äußerlich keinerlei Spuren hinterlassen haben. Ihr schulterlanges Haar, das von Natur aus zwischen dunklem Blond und Kastanie spielt, hat sie raffiniert und äußerst attraktiv hochgesteckt. Sie trägt eine elegante weinrote Bluse, einen etwa eine Handbreit über den Knien endenden dunkelgrauen Rock und schicke Riemensandaletten mit halbhohem Absatz.
Mit ihrem Aussehen zufrieden, setzt sie sich ans Klavier, das an der fensterlosen westseitigen Wand des Salons steht. Sie wirft noch einen liebvollen Blick auf die Fotografie ihres Vaters, die in einem verchromten Rahmen über dem Klavier hängt, und beginnt dann improvisierend zu spielen.
Innerhalb weniger Augenblicke geht sie in ihrem Spiel völlig auf und hört deshalb auch nicht das Dienstmädchen, das nach mehrmaligem Anklopfen wieder in den Salon kommt. Annina legt ein Leinenset auf die massive Glasplatte des Couchtisches, stellt das Mineralwasser und die Gläser darauf ab und verlässt dann auf leisen Sohlen den Salon.
Der Sturm, der um die Ecken und Kanten der Villa heult und pfeift, das Rauschen der Bäume im Park und das Spiel der Gräfin vereinigen sich zu einem Konzert, das wie eine Komposition von Grieg oder Rimski-Korsakow anmutet. Eleonore Hortocány ist eine vielseitig talentierte Frau und mit einem sehr empfindsamen Gemüt ausgestattet, das sie aber meist routiniert verborgen hält. Die Menschen, die im Alltag mit ihr zu tun haben, kennen sie vor allem als eine energische und erfolgreiche Unternehmerin und als gesellschaftspolitischen Hardliner.
Das Dienstmädchen kommt nach neuerlichem vergeblichen Anklopfen wieder in den Salon, berührt die Gräfin zaghaft an der Schulter und meldet: »Gnädige Frau Gräfin, der Herr Staatssekretär und Herr Wagenlenker mit seine Tochter sind da.«
Die Gräfin rückt den Klavierhocker zurück, steht auf, betrachtet sich noch einmal im Spiegel und sagt dann zu Annina: »Bitte, bringen Sie die Herrschaften herein.«
Annina eilt hinaus und bringt kurz darauf die Besucher in den Salon. Auf das Nicken der Gräfin hin, entfernt sie sich wieder mit Knicks.
»Grüß’ dich, Eleonore, wie schön dich wieder zu sehen … Und blendend siehst du heute wieder aus, meine Liebe.«
Mit diesem etwas stockend daherkommenden Kompliment begrüßt Reinhardt Wagenlenker, ein großer, gut aussehender Mann, die Gräfin und küsst sie auf beide Wangen.
»Grüß’ dich, du Schmeichler!«
Mit dem nächsten Atemzug gesteht sie aber unumwunden und mit nicht überhörbarer Genugtuung: »Aber ich höre es trotzdem gerne, lieber Reinhardt.« Und zu seiner Tochter sagt sie locker und in bester Stimmung: »So sind wir Frauen halt, nicht wahr?«
»Aber ja, und guten Tag, Frau Gräfin.«
Die Gräfin drückt Sabrina Wagenlenker noch kurz die Hand und begrüßt dann mit einem gewinnenden Lächeln den Staatssekretär: »Guten Tag, mein lieber Rehagen, es freut mich sehr, dass Sie wieder einmal zu mir herausgefunden haben.«
Rehagen küsst ihr die Hand und bekennt dann: »Oh, verehrte Frau Gräfin, Sie wissen ja, dass ich Ihre Einladungen nur allzu gerne annehme, wenn es mein Zeitbudget zulässt.«
Die Gräfin nimmt diese neuerliche Galanterie strahlend entgegen und sagt, begleitet von einer einladenden Handbewegung: »Aber nehmt jetzt doch bitte Platz.«
Während sich ihre Gäste setzen, rückt sie die Mineralwasserflasche und die Gläser in die Tischmitte und fragt dann: »Was darf ich euch heute bringen lassen, liebe Freunde?«
»Ich hätte gerne einen Kaffee und ein paar von den Leckereien nach dem Rezept, das du jüngst aus Brasilien mitgebracht hast«, sagt Reinhardt Wagenlenker.
Sabrina möchte eine Cola und der Staatssekretär einen schwarzen Tee.
Die Gräfin setzt sich und klingelt dem Dienstmädchen, das unverzüglich in den Salon kommt.
»Sie bringen uns bitte zweimal Kaffee, einen schwarzen Tee, eine Cola und eine Schale mit dem Ramineza-Gebäck.«
Das Dienstmädchen wiederholt den Auftrag und eilt mit Knicks aus dem Salon.
Mit »Ach, Eleonore, wenn ich mich recht erinnere, wollte doch heute auch unser Kardinal kommen, nicht wahr?« lässt sich gleich darauf Reinhardt Wagenlenker ein wenig besorgt vernehmen.
»Ja, er will auf jeden Fall kommen. Am Nachmittag erhielten wir einen Anruf, mit dem er uns mitteilen ließ, dass es bei ihm etwas später werden kann.«
Reinhardt Wagenlenker lehnt sich nun bequem zurück, schlägt die Beine übereinander und neigt sich zum Staatssekretär hinüber. Bestens gelaunt fragt er ihn dann: »Na, Bodo, wie geht’s und was macht die große Politik?«
»Danke, mir geht es eigentlich ganz ordentlich. Derzeit habe ich nur den üblichen Stress und daneben das scheinbar unvermeidliche Sommertheater.«
»Und, wie läuft es zurzeit bei dir?«, fragt Rehagen zurück.
»Im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Nur das Thema Ukraine ist noch nicht ganz vom Tisch; vielleicht kann ich später darauf zurückkommen.«
»Was ist mit der Ukraine?«, fragt Sabrina und schaut von dem Modejournal auf, das sie sich vom Sideboard genommen hatte.
»Ach, nichts besonders«, antwortet ihr Vater ausweichend.
Es klopft.
Auf das »Ja, bitte!« der Gräfin kommt das Dienstmädchen wieder in den Salon und bringt auf einem Tablett die Getränke, Zucker und Sahne und eine Schale mit Gebäck.
Mit »Stellen Sie bitte das Tablett am Tisch ab … und Sie können dann wieder gehen, Annina« weist die Gräfin das Dienstmädchen an und schenkt sich dabei Mineralwasser in eins der Gläser.
Annina stellt das Tablett auf den Tisch und sagt dann zögerlich: »Entschuldigung, Frau Gräfin, Sein Eminenz, der Herr Kardinal ist gekommen gerade.«
»Ah, sehr schön! Ich bitte ihn selbst herein. Sie warten hier so lange.«
Annina nickt, sagt: »Jawohl, Frau Gräfin«, geht dann zum Sideboard und stellt sich möglichst unauffällig daneben. Sie bildet dort den größtmöglichen Kontrast zum Großvater der Gräfin, der in Öl gemalt in einem vergoldeten Rahmen über dem Sideboard hängt. Das Gemälde zeigt ihn in stolzer Haltung und nahezu lebensgroß in der prächtigen Uniform eines Generalfeldmarschalls des ungarischen Heeres.
Die Gräfin verlässt eilends den Salon und lässt die Tür offen stehen. Nach einer Weile hört man sie in der Eingangshalle sagen: »Lieber Kardinal, schön, dass Sie nun doch kommen konnten.«
Mit »Guten Tag, verehrte Frau Gräfin!« begrüßt sie der Kardinal und schließt nach einem Räusperer euphorisch daran an: »Und was soll ich sagen, verehrte Gräfin, sie sehen wieder einmal überwältigend aus! Unser Schöpfer macht Sie täglich noch etwas schöner, wie mir scheint.«
Die beiden kommen in den Salon und die Gräfin sagt strahlend: »Kardinal, Kardinal, und Sie sind wieder einmal dabei, unseren Reinhardt gehörig auszustechen.«
»Ach ja? Wie schön!«, freut sich der und begrüßt die Wagenlenkers und Rehagen mit »Einen schönen Tag und Gottes Segen, ihr Lieben«.
Bodo Rehagen und die Wagenlenkers haben sich erhoben und der Kardinal schüttelt ihnen der Reihe nach die Hand.
Mit »Schön, dich wieder einmal zu sehen, Johannes« begrüßt ihn Reinhardt Wagenlenker.
Der Staatssekretär belässt es bei einem knappen »Guten Tag, Eure Eminenz«.
Sabrina deutet einen Knicks an und begrüßt ihn mit »Guten Tag, Herr Kardinal«.
Der Kardinal umfasst Sabrinas Hand mit beiden Händen, tätschelt sie ausgiebig und sagt entzückt: »Wie jugendfrisch Sie doch sind und wie anmutig, liebe Sabrina.«
Sabrina entzieht dem Kardinal verlegen ihre Hand und setzt sich wieder.
Ihr Vater, Rehagen und die Gräfin setzen sich ebenfalls.
Der Kardinal, ein großer, stattlicher Mittfünfziger, nimmt neben Sabrina Platz und lächelt sie vergnügt an.
»Lieber Kardinal, was darf ich nun Ihnen bringen lassen?«, fragt die Gräfin, während sie die Wagenlenkers und den Staatssekretär bedient.
»Ihren wundervollen Darjeeling-Tee bitte, und dazu ein kleines Schlückchen von Ihrem exzellenten Cognac, wenn ich darum bitten darf.«
»Aber selbstverständlich, lieber Kardinal. Tee und Cognac wie immer.«
»Sie haben verstanden, Annina?«
»Jawohl, Frau Gräfin. Ein Tee und eine Cognac«, wiederholt Annina brav und verlässt mit Knicks den Salon.
Reinhardt Wagenlenker wendet sich zum Kardinal hin, den man in seinem dunkelgrauen Anzug, einem anthrazitfarbenen Hemd und einer perfekt darauf abgestimmten Krawatte eher für einen Banker halten könnte, als für einen geistlichen Würdenträger, und fragt: »Und, Johannes, wie steht es heute um dein Befinden?«
»Du, der Föhn macht mir arg zu schaffen, das muss ich leider sagen«, klagt der Kardinal mit betrübter Miene und fügt nach einem Seufzer hinzu: »Und ansonsten habe ich derzeit arg viel um die Ohren. Ich muss mich einfach um zu vieles selber kümmern, und der damit verbundene Stress tut meinem Magen so gar nicht gut.«
»Das kommt mir bekannt vor. Mein Unternehmen läuft ja auch nur nach Wunsch, wenn ich nahezu jedes Detail im Auge behalte. Insofern liegen unsere Aufgabenfelder wohl nicht weit auseinander.«
»Ach, Ihr zwei Armen!« Amüsiert lächelnd lässt sich die Gräfin in die Rückenlehne fallen und ruft gleich darauf in Richtung Türe: »Ja, bitte!«
Annina kommt in den Salon und serviert mit schüchternem Lächeln und ein wenig errötend dem Kardinal seinen Tee und den Cognac. Kaum vernehmlich sagt sie dabei: »Bitte, Euer Eminenz.«
Mit »Vielen Dank, mein schönes Kind« revanchiert sich der Kardinal galant und blickt ihr ungeniert tief in die Augen.
Annina wird nun vollends rot, wendet sich rasch zur Gräfin hin und stottert: »Ha… haben Sie noch eine Wunsch, Frau Gräfin?«
»Nein, danke. Sie können wieder gehen, Annina.«
Der Kardinal, der Annina mit seinem Blick bis zur Tür gefolgt ist, bemerkt erfreut: »Was für ein hübsches Ding, das Sie jetzt wieder haben, verehrte Gräfin. Sie ist aber keine Deutsche, oder täusche ich mich da?«
»Nein, da täuschen Sie sich nicht, lieber Kardinal. Sie kommt aus Rumänien und spricht leider nur gebrochen deutsch.«
Nach einem kleinen Seufzer legt die Gräfin den rechten Arm auf die Rückenlehne und erklärt dann noch: »Und so wird es wohl auch noch Monate dauern, bis ich sie auf den Level gebracht habe, den dieses Haus nun einmal erfordert.«
»Nun ja«, sagt der Kardinal nur dazu, meint aber gleich darauf ganz angetan: »Mit Annina haben Sie aber auf jeden Fall eine ganz reizende Person in Dienst genommen, verehrte Frau Gräfin.«
Er wendet sich daraufhin seinem Cognac zu, lässt ihn mit Bedacht im Glas zirkulieren, atmet dann mit sich verklärender Miene dessen Bouquet ein und fragt schließlich mit erhobenem Glas in die Runde: »Ich darf doch den ersten Schluck auf euer Wohl trinken, ja?«
»Aber gerne, lieber Kardinal«, sagt die Gräfin mit nachsichtigem Lächeln.
»Alsdann, auf euer aller Wohl, meine Lieben!«
Hochgestimmt lässt der Kardinal seinen Blick noch einmal über die kleine Gesellschaft schweifen und nimmt dann einen guten Schluck zu sich.
Sabrina Wagenlenker, die dem Kardinal erst zweioder dreimal begegnet ist, beobachtet ihn fasziniert. Er zelebriert das Trinken des Cognac geradezu, er ist wohl ein großer Genießer, denkt sie, und das ist durchaus ein sympathischer Zug an ihm.
Mit »Eine Deutsche hast du nicht gefunden?« kommt Reinhardt Wagenlenker auf das Dienstmädchen zurück.
»Wo denkst du hin?!« Die Gräfin setzt sich auf und lässt dann frustriert eine geharnischte Anklage vom Stapel: »Ohne Ausnahme haben die Deutschen heutzutage geradezu unverschämte Vorstellungen bezüglich der Entlohnung, sie wollen dazu zwei feste freie Tage in der Woche und sind auch sonst wenig anpassungsfähig. Sehr unerfreulich ist auch, dass hierzulande Respekt und Stil beim einfachen Volk offenbar out sind.«
Mit »Sie meinen damit wohl, dass die Deutschen nicht mehr unterwürfig genug sind« geht Sabrina Wagenlenker reflexhaft auf die harsche Kritik der Gräfin ein und legt das Journal zur Seite.
Der Kardinal und ihr Vater reagieren sichtlich irritiert auf diesen Einwurf. Der Staatssekretär dagegen schaut nur etwas überrascht zwischen der jungen Frau und der Gräfin hin und her.
Die schenkt sich eine Entgegnung auf diese in ihren Augen höchst ungebührliche Bemerkung, wirft Sabrina nur einen strengen Blick zu und fährt dann ungerührt fort: »Darüber hinaus schmerzt es ganz besonders, dass bei unseren Landsleuten die Bereitschaft zum Dienen offenbar verloren gegangen ist, einen dramatischen Verfall muss ich diesbezüglich konstatieren.«
Sie rückt nach diesem Befund in ihrem Sessel ein Stück zurück, schlägt ihre Beine energisch übereinander und stellt dann noch abgehoben und missmutig fest: »In diesem Volk will inzwischen jeder sein eigener Herr sein, am liebsten aber selber die Herrschaft! Wie das gehen soll, darüber machen sich die Leute allerdings nicht die geringsten Gedanken. Und so, meine Herrschaften, nimmt diese Situation am Ende geradezu irrationale Züge an, wenn man sich daneben auch noch vor Augen führt, dass einige Millionen Deutsche untätig herumlungern.«
»O ja, da muss ich Ihnen bedauerlicherweise vorbehaltlos zustimmen, verehrte Gräfin.«
Der Kardinal richtet sich mit bekümmerter Miene halb auf und erhebt dann seinerseits Anklage: »Das Dienen, eine der vornehmsten Fähigkeiten, die der Mensch entwickeln kann, geht zunehmend verloren; allen Bemühungen zum Trotz, die von Seiten der Kirche gegeben sind. Der einfache Pfarrer, die Bischöfe, wir Kardinäle und schließlich unser ehrwürdiger heiliger Vater, wir alle leben den Dienst am Menschen tagaus, tagein vor. Aber leider, unser Beispiel fällt immer seltener auf fruchtbaren Boden.«
Mit »Herr Kardinal, Ihr Beispiel überzeugt die Allgemeinheit also zunehmend weniger, wenn ich Sie richtig verstanden habe« kommentiert Sabrina nun auch das Klagelied des Kardinals und schaut ihn dabei unschuldig an.
Ihr Vater wirft ihr einen missbilligenden Blick zu und schaut dann besorgt auf die Gräfin, die sich unübersehbar ungehalten zeigt. Nur der Staatssekretär verfolgt die unversehens entbrannte Debatte ganz entspannt und mit einem zurückhaltenden Lächeln.
Der Kardinal reagiert auf Sabrinas Kommentar steif und knapp mit »Wenn Sie so wollen, Sabrina!« und schlägt dann recht nachdrücklich vor, das Thema doch besser zu wechseln.
Mit »Das finde ich auch!« stimmt ihm Reinhardt Wagenlenker hastig und sichtbar erleichtert zu.
Aber seine Tochter ist jetzt nicht mehr zu bremsen, obwohl auch die Miene der Gräfin recht deutlich zu erkennen gibt, dass eine weitere Behandlung dieses Themas nicht erwünscht ist. Sie richtet sich in ihrem Sessel auf und sagt dann resolut: »Bezüglich des Dienens stellt sich für mich doch ganz klar die grundsätzliche Frage, warum der eine Mensch einem anderen dienen soll? Und welche Gründe kann man nennen, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, dass der eine zum Diener des anderen wird?«
Sabrina schaut fragend in die Runde und führt dann, weil ihre Gegenüber nicht umgehend eine Antwort parat haben oder die junge Frau einfach ins Leere laufen lassen wollen, engagiert weiter aus: »So ein Recht würde doch auch unterstellen, dass mancher Mensch über seinen Mitmenschen steht und wertvoller und wichtiger für die Gemeinschaft ist, als andere Menschen, dass es also zwei Kategorien von Menschen gibt.«
Sabrina Wagenlenker atmet einmal tief durch und wendet sie sich dann direkt an den Kardinal: »Herr Kardinal, lehrt aber nicht gerade Ihre Kirche, dass vor Gott alle Menschen gleich sind?«
Die Gräfin, die nun einen Schlusspunkt unter diese aus ihrer Sicht total überflüssige Diskussion setzen will, lässt den Kardinal nicht zu Wort kommen und meint sarkastisch: »Vor Gott vielleicht schon!«
Der Kirchenfürst sieht sich nun genötigt, auf die Ausgangsthematik ›Dienen‹ zurückzukommen. Nach kurzem Überlegen sagt er so verbindlich wie nur möglich: »Verehrtes Fräulein Wagenlenker …«
Mit »Frau Wagenlenker, bitte!« unterbricht ihn Sabrina dennoch rebellisch, weil sie diesen Ton überhaupt nicht mag.
»Wie meinen Sie?«
»Frau Wagenlenker, Herr Kardinal!«
»Sabrina, bitte!«, stößt da ihr Vater alarmiert heraus.
Mit »Schon gut, Reinhardt, auch die Jugend hat sich gewandelt« gibt sich der Kardinal verständnisvoll und wendet sich dann wieder seiner Tochter zu: »Also, meine Liebe, ohne den Dienst am Nächsten würde unser Zusammenleben unmenschliche Formen annehmen. Denken Sie doch nur an die Kranken- und Altenpflege oder an die Menschen in den verschiedenen Rettungsdiensten. Dann …«
Mit »Kein Einspruch, Herr Kardinal, wenn diesen Tätigkeiten eine adäquate Honorierung gegenübersteht« fällt ihm Sabrina erneut ins Wort. »Aber dienen«, fährt sie nach kurzem Atemholen fast schon aggressiv fort, »damit manche ein bequemes Leben führen und unangenehme Arbeit auf andere abladen können; vielleicht auch noch bei einer Entlohnung, die Almosen gleicht, das können Sie doch nicht meinen, oder?«
Sabrina lässt sich daraufhin in die Rückenlehne fallen und atmet einmal tief durch. Sie spürt durchaus, dass ihr Reden als höchst unpassend und als ausgesprochen fehl am Platze empfunden wird, aber sie ist von Natur aus ein Oppositionsgeist, und der Kardinal und die Gräfin reizen sie im Moment unwiderstehlich, die Dinge von einer anderen Warte aus zu betrachten.
Die Gräfin hat sich während Sabrinas Statement in ihrem Sessel entrüstet aufgerichtet und faucht sie, den Kardinal neuerlich missachtend, nun äußerst aufgebracht an: »Mein gutes Kind, falls du damit auf dieses Haus anspielen willst: Meine engsten Bediensteten haben freie Kost und Logis, sind sozialversichert und erhalten noch dazu ein recht ansehnliches Entgelt!«
»Ach ja, also doch eher Almosen?«
Mit »Sabrina, bitte!« mahnt sie erneut ihr Vater, der wie auf Kohlen das Eskalieren dieser Auseinandersetzung verfolgt.
Der Kardinal, der das Dazwischenfahren der Gräfin nachsichtig hingenommen hat, sagt nun in einem für Sabrinas Ohren unangenehm salbungsvollen Ton: »Liebe Frau Wagenlenker, dienen ist immer gelebte Nächstenliebe, und so ist jedes Dienen positiv, ehrenwert und gottgefällig. Es ist also wenig angebracht, dabei vorrangig an den schnöden Mammon zu denken.«
Nach diesem Plädoyer lehnt er sich selbstzufrieden zurück und erklärt: »Aber, meine Herrschaften, gelegentlich etwas unüberlegt und vorschnell zu reden, ist ja ein durchaus legitimes Vorrecht der Jugend, nicht wahr?«
Der Kardinal wollte damit die Wogen dieser Kontroverse glätten, er erreicht aber eher das Gegenteil.
Sabrina Wagenlenker kontert nämlich gänzlich unbeeindruckt: »Das nehmen wir uns auch gerne heraus, Herr Kardinal«, und schießt gleich darauf einen weiteren Pfeil ab: »All die Bischöfe im Land und Sie selbst, Herr Kardinal, Ihr lasst Euch Eure Dienste an Euren Schäfchen aber ganz bestimmt recht ordentlich honorieren. Liege ich wenigstens damit so halbwegs richtig?«
Ihr Vater schlägt mit der rechten Hand auf die Armlehne und schimpft: »Sabrina, jetzt reicht es aber!«
»Gut, gut, ich weiß Bescheid! … Ich geh ja schon.«
Sabrina steht auf, schnappt sich ihre Handtasche, wirft ihrem Vater eine Kusshand zu und rauscht dann vergnügt winkend und mit »Ciao, ciao … e buonasera a tutti« hinaus.
Die Gräfin und der Kardinal schauen ihr verärgert, der Staatssekretär ziemlich baff, hinterher.
Reinhardt Wagenlenker sitzt in sich zusammengesunken in seinem Sessel. »Es tut mir leid, meine Herrschaften«, sagt er nach einer Weile mit rauer Stimme, »ich muss bei ihrer Erziehung Fehler gemacht haben.«
»Bring sie in Zukunft einfach nicht mehr mit!«, faucht ihn die Gräfin ärgerlich an und schickt anklagend hinterher: »Sie hat sich, das ist doch nicht zu übersehen, mein guter Reinhardt, in den letzten Jahren geradezu unmöglich entwickelt. Neben allen möglichen fragwürdigen Ansichten, die sie ungeniert von sich gibt, kritisiert sie inzwischen ja auch blindlings die Gewinne, die wir mit unseren Unternehmen erzielen.«
Sie wendet sich daraufhin zum Kardinal und zum Staatssekretär hin und erklärt entrüstet: »Würde ich, wenn es nach ihr geht, auf der einen Seite mein Personal noch besser entlohnen, dann müsste ich logischerweise auf der anderen Seite noch höhere Gewinne einfahren, wenn ich weiterhin ein standesgemäßes Leben führen will. Und dieses Leben«, bricht es trotzig aus ihr hervor, »will ich mir von niemand nehmen lassen!«
…
Während Sabrina Wagenlenker im immer noch recht heftigen Föhnsturm auf ihren geliebten Mini zugeht, fragt sie sich – jetzt doch etwas verunsichert –, warum sie sich wohl gar so sehr mit dem Kardinal und der Gräfin angelegt hat. Ein schlechtes Gewissen hat sie aber nur gegenüber ihrem Vater, der sich jetzt bestimmt eine Standpauke der Gräfin und vermutlich eine nicht minder unangenehme Stellungnahme von Seiten des Kardinals anhören muss. Sie fragt sich aber auch, warum die beiden ihre Sichtweisen gar so vehement verteidigen.
Sie bleibt unvermittelt stehen und dreht sich um. Ihr leichtes Kleid und ihr halblanges brünettes Haar beginnen augenblicklich im Föhn wild zu flattern. Sabrina muss ihr Haar mit der linken Hand festhalten, damit sie die imposante Front der Villa Hortocány betrachten kann: das steile, irgendwie gotisch wirkende Satteldach; die beiden turmartigen Erker links und rechts, die vom Kellergeschoß bis zur Dachtraufe hinauf ragen und dort von schlanken, kegelförmigen Dächern abgeschlossen werden; dann die großzügige Freitreppe, die zur Terrasse am Haupteingang hinaufführt – einem Eingang, der mit seinen schweren und mit Schnitzereien versehenen Türflügeln schon eher wie ein Portal anmutet. Das prächtige Wappen der Hortocány über dem Eingang vervollständigt schließlich den herrschaftlichen Eindruck, den die Villa erweckt.
Sabrinas Blick schweift auch noch über die markanten, schwarz lackierten Balkone am ersten und zweiten Stockwerk, die sich über die gesamte Frontseite der Villa erstrecken und durchgehend mit roten Geranien geschmückt sind.
Sie wendet dann der Villa den Rücken zu und genießt das wunderbare Bild, das der Park und der zwischen den Bäumen hervorschimmernde See bieten. Dass die Leute im nahen Dorf immer nur vom Schloss reden, wenn sie die Villa meinen, kann sie gut verstehen; und genauso auch, dass nicht wenige Menschen eine so großartige Bleibe, einen so atemberaubend schönen Besitz gerne ihr Eigen nennen würden. Und sie kann sich auch gut vorstellen, dass der eine oder andere alles daransetzt, um sich so etwas zu schaffen.
Und sicher ist es auch höchst angenehm und von Vorteil, geht es ihr mehr unbewusst durch den Kopf, ein Dienstmädchen stets zur Verfügung zu haben; eine Köchin, einen Gärtner und eine Person für die Hausarbeit beschäftigen zu können; und, wie im Falle der Gräfin, mit Nina von Hagen sogar eine Hausdame, die ihr immer und überall zur Seite steht und das Haus verlässlich weiterführt, wenn sie selbst nicht anwesend ist.
Aber, überlegt sie weiter, diese Annehmlichkeiten werden sich früher oder später unvermeidlich zu einer Sucht auswachsen, sich zu einer elementaren Schwäche entwickeln. Man ist dann ohne Hilfestellungen nicht mehr lebensfähig, und wird deshalb mit allen Mitteln versuchen, sich diese auf Dauer zu erhalten. Man wird Gefangener einer Lebenswelt, die nur mit großem Aufwand, also nur über den Einsatz von erheblichen Geldmitteln realisiert und aufrechterhalten werden kann.
Diese Gedanken fallen über Sabrina geradezu her und drängen sie weiter zu der Schlussfolgerung, dass so eine Lebenswelt in einem gerechten Umfeld nicht aufgebaut werden kann. Das funktioniert doch nur, wenn man große Ertragsanteile aus der Arbeit vieler Hände an sich reißt.
Und ihr steigt eine nicht geringe Wut hoch, während sie daran denkt, dass nahezu alle Leute in ihrer Gesellschaftsschicht kritische Stellungnahmen bezüglich der himmelschreiend weit auseinanderklaffenden Arbeitseinkommen und den daraus resultierenden dramatischen Vermögensunterschieden dumm und skrupellos als Äußerungen von neidgetriebenen Zeitgenossen abtun. Sie schämt sich jedes Mal, wenn sie diese niederträchtige Unterstellung miterleben muss. Und sie empfindet es ganz besonders bedrückend, dass weder die katholischen noch die evangelischen Kirchenoberen diese Einstellung der Topgesellschaft eindeutig und konsequent verurteilen.
Abrupt dreht sie sich wieder zur Villa hin, nimmt noch einmal deren beeindruckende Fassade in sich auf und marschiert dann mit energischen Schritten und dem festen Vorsatz, auch in Zukunft gegen gesellschaftliche Schieflagen und gegen das dazugehörige Denken anzugehen, zu ihrem Auto.
Beim Einsteigen und Losfahren sagt sie sich noch, dass sie nicht mehr ohne sich zu schämen in den Spiegel schauen könnte, wenn sie sich dem vom blanken Egoismus geleiteten Denken und Handeln, das in weiten Teilen ihrer Gesellschaftsschicht unhinterfragt zuhause ist, ergeben würde.
…
Wie Sabrina vermutet hatte, kommt ihr Vater im gräflichen Salon nicht umhin, die Ansichten seiner Tochter und deren ungezügeltes und respektloses Auftreten wenigstens halbwegs verständlich zu machen, auch wenn ihm das ganz und gar nicht leicht fällt.
Er richtet sich in seinem Sessel mühsam auf und sagt zur Gräfin: »Auch wenn ich bei dir wieder einmal ins Fettnäpfchen treten sollte, verehrte Eleonore, in Sabrinas Gesellschaftskonzept gibt es in einem Haushalt im Prinzip keine Hilfskräfte und schon gar keinen Hofstaat. Hilfskräfte im Privathaushalt sind nach ihren Vorstellungen im Grunde nur dann gerechtfertigt, wenn körperliche Gebrechen von Haushaltsmitgliedern dies notwendig machen. Der Staat leistet in solchen Fällen Zuschüsse für die Hilfskraft, und so steht niemand vor der Notwendigkeit, ein hohes Einkommen alleine auf Grund von Personalkosten erzielen zu müssen.«
Mit »Also waschen du und ich in Zukunft selbst die Wäsche, vergnügen uns mit Putzen und Bügeln und mähen eigenhändig den Rasen« kommentiert die Gräfin spöttisch und verärgert zugleich diesen Ansatz. Und während sie sich in ihrem Sessel aufrichtet und mit beiden Händen die Armlehnen umfasst, schickt sie hinterher: »Und wer kümmert sich dann um unsere Geschäfte und Unternehmen, du Vater dieser gestörten Konzepteschmiedin?«
Reinhardt Wagenlenker, der nun wieder ziemlich fest im Sattel sitzt, pariert kühl und gelassen den gräflichen Angriff: »Sabrina geht davon aus, dass jedes Aufgabenfeld in unserer Wirtschaft teilbar ist, sich also niemand ein Arbeitspensum zumuten muss, das ihm für den privaten Bereich keine Zeit mehr lässt. Und sie ist weiter der Ansicht, dass es in unserer Gesellschaft genügend fähige Köpfe gibt, die den Anforderungen in den oberen Segmenten unserer Arbeitswelt gewachsen sind.«
Und während er sich zurücklehnt und den rechten Arm auf die Rückenlehne legt, erklärt er: »Sabrina weiß selbstverständlich schon, dass diese Konzeption nicht ohne fließende Grenzen auskommt. Aber ihrer Meinung nach kann die Arbeitsteilung gegenüber dem heutigen Stand deutlich ausgebaut und so auch die Arbeitslosigkeit erheblich reduziert werden. Dieser Schritt bewirkt schlussendlich auch, dass die Pyramide in den Bereichen Arbeit und Einkommen wesentlich flacher und breiter wird, und so ganz automatisch gerechtere Verhältnisse bei den Arbeitseinkommen einkehren.«
»Das rechte Maß und seine fließenden Grenzen, jetzt sind wir wohl beim ältesten Problemkreis der Menschheit angelangt. Ein Problemkreis, der den Staatsdiener und Politiker seine Grenzen schmerzlich erkennen lässt und leider oft überfordert.« Mit diesen Worten klinkt sich der Staatssekretär unvermittelt in den Disput ein, und es ist nicht zu übersehen, dass er diese elementare Problematik, mit der sich die Führungskräfte im Staat nahezu tagtäglich herumschlagen müssen, nur allzu gerne anspricht und herausstellt.
Die Gräfin reagiert auf diese Anmerkung ziemlich unwirsch und genervt: »Mein lieber Rehagen, sie hängen das Problem schlicht und einfach zu hoch. Das Problem macht und ist für mich im Grunde nur Sabrina. Führungsarbeit teilen, so ein Hirngespinst! Viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Und dann auch noch flachere Arbeits- und Einkommenspyramiden, das ist doch der pure Marxismus!«
Reinhardt Wagenlenker setzt zum Sprechen an, aber der Kardinal kommt ihm zuvor. Er neigt sich zu ihm hinüber und meint in einer fast schon konspirativen Art und Weise: »Ich würde dir … Entschuldige, ich würde dir für Sabrina das Kloster Hochgaden in der Schweiz empfehlen. Dort werden seit Jahrzehnten unsere Außenseiter mit großem Erfolg umerzogen.«
»Also Kardinal, was soll denn diese dubiose Empfehlung?!«, entrüstet sich da Reinhardt Wagenlenker und fährt in seinem Sessel hoch. »Sabrina ist doch im Grunde ein prima Typ, Johannes!«
Verärgert und kopfschüttelnd lässt er sich wieder zurückfallen und verschränkt die Arme vor der Brust. Aber schon im nächsten Augenblick legt er sie auf die Armlehnen und meint in versöhnlichem Tonfall: »Vielleicht hat sich Sabrina im Laufe der Zeit ein etwas überzogenes Gerechtigkeitsempfinden zugelegt, das kann ja sein, und vielleicht schießt sie auch beim Thema Menschenwürde gelegentlich etwas übers Ziel hinaus, das will ich auch gerne zugestehen, aber umerziehen müssen wir sie nun wirklich nicht, Johannes!«
»Etwas überzogen sagst du! Sie benimmt sich aufrührerisch und sie versucht inzwischen bei jeder sich bietenden Gelegenheit, die aus guten Gründen gewachsenen Gesellschaftsstrukturen zu untergraben!«, poltert die Gräfin erneut los.
Und der Kardinal, der Zweifel an seinem Urteil und Wort nicht so ohne weiteres tolerieren kann, schließt daran an: »Und sie respektiert die Basis nicht, der sie entstammt, die ihr ein gesichertes Leben ermöglicht und viele Vorteile bietet.«
Unbeeindruckt und bestimmt entgegnet ihm darauf Wagenlenker: »Das Umfeld, dem sie entstammt, ist aber, das vermute ich ganz stark, der Hintergrund für ihr Verhalten. Sie fühlt sich nicht rundum wohl auf einer Basis, die nur wenigen Menschen vorbehalten ist.«
Reinhardt Wagenlenker trinkt daraufhin einen Schluck Kaffee, fischt sich ein Mandelplätzchen mit Rumglasur aus der Schale und lehnt sich locker und wieder bestens gelaunt in seinem Sessel zurück und stellt überrascht fest, dass ihm erstmals das Vertreten von Positionen, die gravierend von denjenigen abweichen, die in seinen Kreisen üblich sind, ziemlich locker über die Lippen kommt und sogar ein gewisses Vergnügen bereitet.
Dem Staatssekretär ist das nicht entgangen, und er denkt, dass er in Zukunft beim einflussreichen Unternehmer Wagenlenker möglicherweise auf mehr Verständnis für seine politische Richtung stoßen könnte.
Der Gräfin hingegen missfallen Reinhardts illoyales Verhalten und seine Erklärungen über die Maßen und sie sagt aufgebracht: »Sie ist undankbar und lässt selbstherrlich naturgegebene Unterschiede beim Menschen außer Acht, mein Bester! Sie macht sich stark für weite Teile unserer Bevölkerung, die froh und dankbar sein sollen, dass sie in unserem Kielwasser ein gesichertes und geordnetes Leben führen können.«
Trotz des neuerlichen Angriffs von Seiten der Gräfin versucht Reinhardt Wagenlenker unverdrossen, ein wenig Verständnis für die Haltung seiner Tochter zu wecken. Er wendet sich zunächst an die Runde und erklärt: »Sabrina hat während ihres Studiums auch Vorlesungen in Philosophie besucht, und diese haben unter anderem ihr Menschen- und Naturverständnis in einer Richtung gefestigt, die in ziemlichen Gegensatz zu unserer …« Nach kurzem Zögern fährt er mit Blick auf die Gräfin betont ruhig fort: »Vor allem aber zu deiner steht.«
Die Gräfin reagiert aber dennoch in äußerst scharfem Tonfall: »Willst du damit etwa andeuten, dass mein Menschen- und Naturverständnis anzuzweifeln wäre, Reinhardt?!«
»Gott bewahre, ich will damit nur in etwa erklären, warum und wie Sabrina zu ihrer Einstellung gekommen ist.«
»Die Philosophie und die Philosophen, immer gefährlich für den Menschen, wenn er unzureichend gerüstet dieser Welt begegnet«, orakelt daraufhin der Kardinal vor sich hin. Nach einer kurzen Denkpause wendet er sich wieder seinem Freund zu und meint fürsorglich: »Deine im Grunde ja sehr liebe Tochter ist ganz offensichtlich – wie so oft der Mensch – den falschen Propheten in die Hände gefallen, mein guter Reinhardt. Es ist also ohne Frage angezeigt, dass sie baldmöglichst auf den rechten Weg gebracht wird, bevor es zu spät ist.«
Der Kirchenfürst ergreift nach dieser Empfehlung sein Glas, schwenkt eine Weile gedankenverloren den Rest Cognac darin und leert es schließlich mit Genuss.
»Und dieser Weg beginnt in dem Kloster in der Schweiz, meinst du!«, rekapituliert Reinhardt Wagenlenker ungehalten.
»Das meine ich damit!«, antwortet der Kardinal bestimmt und lehnt sich bequem zurück.
»In ein Kloster geht Sabrina ganz bestimmt nicht, mein Freund! Und ich möchte ihr das auch nicht zumuten. – Und bitte«, Wagenlenker richtet sich wieder auf, »macht doch jetzt keinen Fall aus Sabrina! Sie ist doch noch so jung, und wir sollten ihr alleine deswegen Abweichungen von unserer Weltsicht gestatten.«
Der Gräfin wird es nun endgültig zu viel: »Reinhardt«, faucht sie genervt, »es fällt mir extrem schwer, Verständnis für deine Haltung aufzubringen! Deine Tochter triftet doch mit geradezu abenteuerlicher Geschwindigkeit aus unserer Gesellschaftsschicht heraus, und es steht zu befürchten, dass sie über kurz oder lang zur Nestbeschmutzerin abgleitet und am Ende gar im Volk gegen uns antritt.«
Sie streicht sich mit einer hektischen Bewegung eine Haarsträne aus der Stirn und fügt dann fast schon panisch hinzu: »Ich kann ja nur hoffen, dass es noch nicht soweit ist, denn mein Wellnessprojekt, das wissen wir alle, wird nicht nur Zustimmung in unserer Region erfahren.«
Mit »Sabrina wird nie von außen unsere Positionen und Aktivitäten angreifen, diesbezüglich steht sie loyal zu uns!« weist Wagenlenker dieses Szenario gereizt zurück.
Der Kardinal richtet sich alarmiert auf und appelliert händeringend: »Bitte, keinen Streit, nehmt Rücksicht auf meinen Magen!«, und greift dann auch schon nach seinem leeren Cognacglas.
Die Gräfin bemerkt seinen enttäuschten Blick und klingelt dem Dienstmädchen.
Mit »Bitte, bringen Sie dem Herrn Kardinal noch einen Cognac, Annina« instruiert sie gleich darauf das Dienstmädchen. Während Annina hinauseilt, dringt Motorengedröhn und wenig später ein heftiges Bremsgeräusch in den Salon. Im Zwinger hinter der Villa beginnen die Doggen der Gräfin wie rasend zu bellen und der Papagei Ricardo hüpft aufgeregt in seinem Käfig umher und krächzt: »Ruhä, Ruhä!«
»Welche verrückte Person kann denn das nur sein!«, schimpft die Gräfin erschrocken und steht auf. Sie geht zum Käfig, hebt das Tuch ein wenig hoch und flüstert dem Papagei zu: »Ist ja schon gut, Ricardo, ist ja schon wieder gut.«
Während sie sich wieder zu ihren Besuchern setzt, wird es in der Halle laut: »Nein, nein! Bitte, Sie einen Moment warten!«, hört man Annina verzweifelt rufen und eine kräftige männliche Stimme tönt rücksichtslos: »Ach Püppchen, halten Sie mich nicht auf! Ich kenne mich hier einigermaßen aus.«
Und dann stürmt auch schon der junge von Hohenfels in Saint-Tropez-mäßigem Outfit und mit dunkler Sonnenbrille in den Salon, verfolgt vom völlig aufgelösten Dienstmädchen.
»Hallo, zusammen!«, grüßt er großspurig und küsst die Gräfin, die ihn im Aufstehen nicht schnell genug abwehren kann, auf beide Wangen.
Die ringt sich ein »Grüß dich, Maximilian!« ab und herrscht ihn dann äußerst ungnädig an: »Und jetzt erst einmal folgendes: Stell beim nächsten Mal deinen Ferrari wenigstens ein paar hundert Meter vor meinem Anwesen ab! Wir, aber auch meine Tiere, vertragen deine Fahrweise nämlich absolut nicht!« Sie wendet sich dann dem Dienstmädchen zu, das in heller Aufregung an der Tür wartet, und sagt: »Ist schon gut, Annina. Sie können wieder gehen.«
Das Dienstmädchen knickst und verlässt erleichtert den Salon. Nachdem Annina die Salontüre hinter sich geschlossen hat, gibt sich der junge von Hohenfels reumütig: »Gut, gut, liebe Gräfin, ich werde mir das zu Herzen nehmen.«
»Das will ich aber auch schwer hoffen, du Held!« Und während sie sich setzt, sagt sie streng: »Und jetzt sag, was führt dich eigentlich zu mir?«
»Ich dachte, ich könnte Sabrina hier treffen.«
Mit »Sabrina ist vor ein paar Minuten gegangen, ich weiß allerdings nicht wohin« informiert ihn Reinhardt Wagenlenker widerstrebend.
»Zu blöd, ich wollte sie für nächstes Wochenende zum großen Preis von Monaco einladen, das wird nämlich wieder ein supergeiles Happening«, tönt der junge von Hohenfels vollmundig und lümmelt sich ungeniert an das Sideboard.
Der Kardinal dreht sich halb zu ihm um und sagt mit fein dosiertem Spott: »Und ich dachte bisher immer, das wäre ein Autorennen.«
»Ach, mein guter Kardinal, das Rennen ist doch nur der Aufhänger. Das ganze Drumherum macht den Grand Prix erst wirklich interessant. Da trifft sich die Highsociety aus aller Welt und nicht zuletzt die schönsten Frauen, die unsere Erdkugel zu bieten hat.« Und nach kurzem Überlegen sagt der Schlacks auch noch gönnerhaft: »Das wäre doch auch einmal etwas für Sie, Herr Kardinal.«
»Junger Mann, etwas mehr Respekt, bitte!« Und mit dem nächsten Atemzug schießt ihn der Kardinal auch noch unmissverständlich an: »Und außerdem, junger Mann, Sie haben es ja wohl gehört, dass Sabrina nicht mehr hier ist!«
»Okay, okay, Kardinal! Nichts für ungut, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.«
Die Gräfin drückt verärgert die Klingeltaste am Funktelefon.
Annina kommt kurz darauf mit dem Cognac für den Kardinal in den Salon und stellt ihn mit einem schüchternen, den Kardinal aber bezaubernden Lächeln zu ihm auf den Tisch. Sie nimmt noch rasch das Tablett von vorhin an sich und blickt dann fragend auf die Gräfin.
»Herr von Hohenfels möchte gehen, Annina. Bitte, bringen Sie ihn hinaus.«
»Jawohl, Frau Gräfin«, sagt Annina mit Genugtuung und geht dem jungen Mann bis zur Tür voraus.
Der junge von Hohenfels bringt zunächst kein Wort heraus. Total konsterniert schaut er ein paar Augenblicke die Gräfin an und dann verunsichert in die Runde. Schließlich sagt er stockend: »Okay … bye-bye, Leute!«, und geht.
An der Tür versetzt er dem Dienstmädchen einen kräftigen Klaps auf den Po und entschwindet dann trotz der Abfuhr genau so forsch, wie er aufgetaucht ist.
Das Dienstmädchen reagiert auf seine Tätlichkeit mit einem erschreckten Schrei, stößt dann erbost ein paar rumänische Worte aus und folgt ihm schließlich mit verächtlichem Blick in die Eingangshalle.
»Entschuldigt bitte diesen Auftritt«, sagt die Gräfin und geht zur Salontüre und schließt sie. Während sie zum Tisch zurückkommt, meint sie sarkastisch: »Für diesen adeligen Nichtsnutz käme wohl auch Ihr Hochgaden zu spät, nicht wahr, Kardinal?«
Nach dieser Einschätzung nimmt sie im Stehen ein Schluck Wasser zu sich und lässt sich dann ziemlich bedient und mit einem Seufzer in ihren Sessel fallen.
Mit »Da haben Sie nur zu Recht, verehrte Gräfin, diesen Schlacks hätte man rechtzeitig in eine Erziehungsanstalt stecken sollen« stimmt ihr der Kardinal mit Nachdruck zu.
Er überlegt dann ein paar Augenblicke lang und sagt schließlich: »Aber lasst mich nach diesem Intermezzo noch einmal auf Sabrina zurückkommen.« Er setzt sich auf, beugt sich zu Reinhardt Wagenlenker hinüber und beginnt in verbindlichem Tonfall: »Also, mein guter Reinhardt, das mit dem Kloster funktioniert ganz anders, als du dir das offenbar vorstellst. Sabrina bekommt dort eine Anstellung, sie hat ja Betriebs- und Volkswirtschaft studiert, wenn ich das richtig weiß, und wird – ohne dass ihr dies ins Bewusstsein dringt – während ihrer Arbeit im Rahmen der globalen Wirtschaftstätigkeit des Klosters auf ihren angestammten Weg zurückgeführt. Als Wertmaßstab möge dir dienen, und zu deiner Beruhigung kann ich dir sagen, dass das Kloster auch sehr erfolgreich Lehrgänge und Ausbildungen für Unternehmer und Manager aus aller Welt durchführt. – Ja, und darüber hinaus hat es die Achtundsechziger aus unseren Kreisen auf den rechten Weg zurückgeführt, auch wenn uns damals ein ungetrübter Erfolg versagt blieb.«
Der Kardinal lässt sich in die Rückenlehne fallen und fährt nach kurzem Überlegen mit sorgenvoller Miene und an die Runde gewandt fort: »Und, meine Herrschaften, das müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, diese Einrichtung muss sich in Zeiten des neuen und globalen Terrorismus erneut um junge Leute aus der Oberschicht kümmern. Ich will damit absolut nicht sagen, dass Sabrina diesen Abtrünnigen und Verblendeten in unseren Reihen schon zuzurechnen ist, aber, wie schon angedeutet, sicher ist sicher.«
Reinhardt Wagenlenker, der mit zunehmenden Interesse dem Kardinal zugehört hatte, neigt sich nun seinerseits ein Stück weit zu seinem Freund hinüber und meint entgegenkommend: »Okay, Johannes, das klingt erst einmal überzeugend, ich werde mir das gründlich durch den Kopf gehen lassen.«
»Warum willst du da noch lange überlegen, Reinhardt?!«, fährt ihn die Gräfin ungeduldig und verständnislos an. »Zögerlichkeit ist doch sonst ganz und gar nicht deine Art!«
Der dreht sich zur Gräfin hin und sagt sehr bestimmt und ein wenig ärgerlich: »Es geht hier schließlich um meine Tochter, verehrte Eleonore! Und deshalb möchte ich nun auch vorschlagen, dass wir uns jetzt deinem Golfprojekt zuwenden.«
Mit »Gut, gut, belassen wir es vorerst dabei« lenkt die Gräfin ein. Sie nimmt einen Schluck Kaffee zu sich und sagt dann eindringlich: »Um eins möchte ich euch aber schon vorab bitten: Verwendet zukünftig nicht mehr die Bezeichnung Golfplatz oder Golfprojekt. Dies würde nämlich ganz sicher bei den Behörden, den örtlichen Politikern und den Naturschützern vermehrt zu Problemen führen. Ich will ein Wellnesszentrum entstehen lassen, das von einem kleinen Golfareal umgeben ist. Könnt ihr das in Zukunft beherzigen, meine Herren?«
»Aber selbstverständlich, Eleonore«, beteuert Reinhardt Wagenlenker. Und dem Kardinal und dem Staatssekretär zugewandt, befindet er: »Wir werden das in Zukunft ganz sicher beachten, nicht wahr?«
Der Kardinal nickt nur dazu und der Staatssekretär sagt knapp: »Ganz sicher, Herr Wagenlenker. Aber ich möchte unbedingt«, schließt er eilends daran an, »bevor wir uns dem Wellnessprojekt zuwenden, noch ein paar Worte in Sachen Hochgaden an den Herrn Kardinal richten.«
Er wendet sich zum Kardinal hin und sagt dann ein wenig angespannt: »Verehrter Herr Kardinal, lassen Sie mich bitte anmerken, dass das spezielle Wirken des Klosters in der vom Terror geplagten Welt keinesfalls in die Öffentlichkeit gelangen darf. Für manche Presse wäre es nämlich ein gefundenes Fressen, dieses Tätigkeitsfeld auszuschlachten und mit diesem schließlich das Volk gegen die Oberschicht im Lande aufzuwiegeln.«
Der Kardinal, der Rehagen mit Verwunderung und zunehmend verstimmter Miene zugehört hatte, richtet sich empört auf und sagt dann in strengem und überlegenem Tonfall: »Mein guter Herr Staatssekretär, einem Mann der Kirche müssen Sie keinen Nachhilfeunterricht in Menschenführung, Staatslenkung und Diplomatie erteilen! Auf diesen Feldern, das darf ich wohl mit Fug und Recht behaupten, sind wir den Politikern der Neuzeit nämlich um Jahrhunderte voraus.«
Die Gräfin und Reinhardt Wagenlenker amüsieren sich sichtlich über diesen Disput. Sie lächeln sich verstohlen zu und lehnen sich dann ganz entspannt – so, als hätte es nicht die geringsten Differenzen zwischen ihnen gegeben – in ihren Sesseln zurück.
Den Staatssekretär dagegen trifft die harsche Rüge des Kardinals offenbar sehr, und er wirkt mit einem Mal klein und bedeutungslos. Nach einer langen Schrecksekunde sagt er verunsichert: »Verehrter Herr Kardinal, nichts steht mir ferner, als einen Kirchenfürsten zu belehren.«
Er holt daraufhin einmal tief Luft, richtet sich auf und erklärt dann mit fester Stimme: »Zu meiner Entlastung, Herr Kardinal, möchte ich aber schon darauf hinweisen, dass ein Mann wie ich in unserer spannungsgeladenen Zeit immer in der Sorge lebt, dass sich neue Risse im Damm des Staatsgefüges auftun könnten.«
Mit »Entschuldigung angenommen, Herr Staatssekretär, ich verstehe das letztlich recht gut« gibt sich der Kardinal, begleitet von einer großzügigen Geste, umgehend versöhnlich und gesteht auch noch ohne Umschweife: »Wir Kirchenführer leben ja in einer ganz ähnlichen Situation. Denken wir nur an die Kirchenvolksbewegung ›Wir sind Kirche‹, an das unselige Wirken der Piusbruderschaft, an das Zölibat und …«
Mit »Meine Herren, können wir bitte zum Wesentlichen kommen?!« fährt die Gräfin, die befürchtet, dass die beiden nun kein Ende finden könnten, ungeduldig dazwischen.
Der Kardinal lehnt sich wieder zurück und sagt ergeben: »Aber selbstverständlich, verehrte Gräfin.«
»Dem steht nichts entgegen, Frau Gräfin«, sagt der Staatssekretär, der erleichtert und mit Genugtuung das Einlenken des Kardinals aufgenommen hat. Ein wenig spitzzüngig meint er dann aber doch noch, und so, als ob er schon wüsste, dass die nächste Schlacht nicht lange auf sich warten lässt: »Wir zwei haben ja gerade die Friedensverträge unterzeichnet.«
Genervt und ziemlich angespannt kontert die Gräfin: »Gut, gut, Rehagen, dann kann ich mich ja ganz beruhigt dem Herrn Kardinal zuwenden.«
Sie fährt sich noch mit einer fahrigen Bewegung übers Haar und sagt dann: »Also, mein lieber Kardinal, wie weit konnten Sie den Verkauf der Kirchengrundstücke an mein Unternehmen voranbringen?«
Der Kardinal faltet die Hände auf dem Schoß und formuliert seine Antwort bedächtig und mit dem wohl angeborenen Geschick, das führende Männer der Kirche in aller Regel auszeichnet: »Verehrte Frau Gräfin, die Übertragung dieser Flächen kann in Kürze erfolgen. Dennoch wäre es nach wie vor sehr zweckdienlich, wenn Sie vorher eine erste Teilspende für die neue Domorgel leisten könnten. Sie wissen ja, dass unsere Liegenschaftsverwaltung wieder einmal den Einfluss eines Beziehungsgeflechtes wittert und sich lähmend hinter ihrer Froschperspektive verschanzt. Eine Spende vorab würde diese Transaktion in ein günstigeres Licht rücken und allen Bedenkenträgern den Wind aus den Segeln nehmen.«
Die Gräfin richtet sich mit einem Ruck auf und fährt, schlagartig die Beherrschung verlierend, den Kardinal bitterböse an: »Kardinal, mich nervt das unsäglich, dass kleine und wichtigtuerische Angestellte, von mir aus können es auch verbohrte Geistliche sein, in dieser Weise Einfluss nehmen können! Ich zahle für diese Grundstücke einen Preis, den Euch kein Landwirt jemals zahlen würde, und dennoch ist es möglich, dass der Verkauf jetzt schon viele Monate hinausgezögert wird! Ich will das Projekt in einem überschaubaren Zeitraum durchziehen, das verstehen Sie doch, oder?«
»Aber sicher, Frau Gräfin, ich verstehe Sie nur zu gut, aber Sie sollten auch meine Lage …«
Der Kardinal kann seine Erklärung nicht zu Ende bringen, weil die Gräfin jetzt vollends die Fassung verliert. Sie springt auf und geht wutentbrannt zu einem der Fenster.
Dort schaut sie eine Weile frustriert und wehmütig in den Park hinunter und hinaus auf den See. Sie dreht sich dann hektisch um und wütet: »Am liebsten würde ich den ganzen Laden hier hinschmeißen und mich in Brasilien niederlassen! Bei meinem letzten Besuch auf der Farm der Raminezas konnte ich wieder einmal erleben, wie wohltuend und entspannend das ist, wenn sich die Welt noch im Gleichgewicht befindet. Die Herrschaft und die Mannschaften leben dort einträchtig nebeneinander und ziehen Tag für Tag an einem Strang, und selbstredend in die gleiche Richtung – und niemand, aber absolut niemand käme je auf die Idee, einem engagierten Unternehmer auch nur einen Stein in den Weg zu legen!«
Sie marschiert daraufhin zum Sideboard, lehnt sich mit aufgestützten Armen daran und wettert restlos aufgebracht weiter: »Ich will ja gar nicht, wie manche von uns, neidisch in den arabischen und asiatischen Raum blicken, und auch nicht nach Russland, wo heute die Rangordnungen in der Gesellschaft offenbar wieder ins rechte Lot zu kommen scheinen, ich möchte nur unbehelligt von kleinen Geistern meinen Weg gehen und nicht in einem gesellschaftlichen Einheitsbrei ersticken!«
Reinhardt Wagenlenker, der Kardinal und auch Rehagen schauen sich einen Moment lang erschreckt und ratlos an und blicken dann wieder äußerst betroffen auf die Gräfin.
Der Kardinal findet als erster aus der kollektiven Sprachlosigkeit der drei Herren heraus und will mit seiner gesellschaftspolitischen Sicht der Gräfin deutlich machen, dass er im Grunde voll und ganz auf ihrer Seite steht. Er will sie damit wenigstens so weit beruhigen, dass er auf den für ihn so wichtigen Punkt ›Domorgel‹ zurückkommen kann.
»O ja«, hebt er also an, »die französische Revolution und der Kommunismus haben dem Abendland nicht gut getan. Die natürliche Ordnung ist zerstört, viele Menschen können ihre Freiheit und die verordnete Gleichheit nicht sinnerfüllt leben. Sie können sich aber auch nicht mehr einfügen und haben darüber hinaus die Sicht auf das Große und Ganze verloren. Ihr Leben hat sich auf ein menschenunwürdiges Konsumentendasein verengt, und im Gleichschritt mit diesem Vorgang ist ihnen leider auch der für unser Zusammenleben so eminent wichtige Gemeinschaftssinn abhanden gekommen. Deshalb«, der Kardinal versucht einen tröstlichen Tonfall anzuschlagen, »so bedauerlich das auch ist, verehrte Frau Gräfin, neigen sie nur allzu leicht dazu, die Werke der anderen argwöhnisch zu beäugen.«
»Nicht nur das, Kardinal, sie sind zum Störfaktor geworden!«, giftet die Gräfin unverändert aufgebracht vom Sideboard aus weiter, und lässt gleich darauf einem wohl schon über einen längeren Zeitraum angestauten Unmut freien Lauf: »Wenn ich zum Beispiel nur an das Drama letzte Woche im Flughafen denke: Mit tausenden von aufgeregten Touristen wird man durch den halben Airport geschleust, du wirst geschubst und gestoßen – und VIP-Lounge – natürlich wieder einmal Fehlanzeige. Und diese Leute überschwemmen inzwischen nicht nur die Flughäfen, sondern auch alle schönen Flecken auf dieser Erde.«
Mit »Ja, das sind sicher höchst unerfreuliche Zustände, die in den letzten Jahrzehnten eingekehrt sind, verehrte Frau Gräfin« pflichtet ihr der Kardinal umgehend bei. Und darauf hoffend, dass sie sich von seinen zustimmenden Worten in ein ruhigeres Fahrwasser leiten lässt, baut er die gräfliche Kritik auch noch aus: »Und darüber hinaus zerstört das massenhafte Fliegen unsere Atmosphäre, und schlussendlich ruinieren die Heerscharen des modernen Tourismus auch noch Gottes schöne Erde darunter.«
Dass die Topgesellschaft das Fliegen der Masse einige Jahrzehnte lang durchaus hingenommen hat, weil nur so nahezu der gesamte Erdball mit der teuren Infrastruktur für den Flugverkehr überzogen werden konnte, und damit dem oberen Segment der Gesellschaft weite Teile der Erde täglich offen stehen, behält der Kardinal für sich, obwohl dieser Hinweis nach der snobistischen Missfallensäußerung der Gräfin eigentlich angebracht gewesen wäre.
»So weit ist es leider gekommen, Johannes.« Reinhardt Wagenlenker schlägt die Beine übereinander und schließt dann mit Nachdruck daran an: »Und deshalb ist es ohne Frage auch allerhöchste Zeit, dass der gemeine Mensch einsieht, dass er nicht alles haben kann, dass er sich in die Natur einfügen muss, wenn seine Tage nicht bald gezählt sein sollen. ›Macht euch die Erde untertan‹ hat allerdings deine Kirche … entschuldige, Johannes, haben vielmehr beide christlichen Kirchen zu lange den Erdenbürgern gepredigt. Daran, mein Freund und großer Kardinal, möchte ich dich der Gerechtigkeit halber aber schon erinnern.«
»Das sagten wir nur, solange die Erde nicht so dicht bevölkert war wie heute, das weißt du sehr gut, Reinhardt!«
Der Kardinal poliert daraufhin nachdenklich mit dem linken Ärmel seines Sakkos den tiefroten Stein im Ring an seiner rechten Hand und erklärt schließlich: »Inzwischen verändern wir diese Anweisung ja Schritt für Schritt, aber ich habe ja schon anklingen lassen, dass unser Einfluss derzeit zu wünschen übrig lässt, und wir deshalb dem Volk nur kleine Änderungsschritte zumuten können. Gerade die zunächst bitter anmutende Medizin des Verzichts, die allerdings nur flüchtig betrachtet wirklichen Verzicht bedeutet, die uns aber näher zu unserem Gott hinführt, dürfen wir nur in kleinen Teilmengen verabreichen, weil sich sonst der moderne Mensch recht schnell von uns beziehungsweise vom Glauben abwendet. – Das ist wie in der Politik, immer nur verträgliche Häppchen, nicht wahr, Herr Staatssekretär?«
Mit »Leider ist das so« gibt der Staatssekretär dem Kardinal Recht und unterstreicht nach einem tiefen Seufzer diesen problemträchtigen Befund von seiner Plattform aus: »Nur mit kleinen Veränderungsportionen können wir unsere Wähler bei der Stange halten.«
Die Gräfin, die sich inzwischen halbwegs beruhigt und wieder gesetzt hat, rastet erneut aus: »Ihr seid doch beide absolute Weicheier! Ihr werdet mit Euren Häppchen solange herumdoktern, bis es zu spät ist! Dabei ist es doch längst fünf vor zwölf, und da helfen nur mehr radikale Schritte hin zu einer naturverträglichen beziehungsweise naturgemäßen Ordnung. Es kann nicht jeder alles haben, das hat doch Reinhardt gerade eben sehr deutlich gesagt! Es gibt eben die von der Natur, von mir aus auch, wenn ihr so wollt, die vom Schöpfer geschaffenen Eliten und daneben den Massentypus, der sich mit seinen Ansprüchen selbstredend nicht an uns orientieren darf.«
Nach dieser Attacke lässt sie sich erschöpft in die Rückenlehne fallen, schaut aber schon in der nächsten Sekunde kampfbereit auf ihre Männerrunde.
Es ist wieder der Kardinal, der als erster zu einer Entgegnung findet. Weil er der Gräfin aber keinen Ansatzpunkt für einen neuerlichen Angriff liefern will, verzichtet er darauf, auf den Vorwurf des ›Herumdokterns‹ einzugehen, und beschränkt sich auf eine Stellungnahme zum Schöpfungsplan.
Er beugt sich etwas nach vorne, stützt die Unterarme mit verschränkten Händen auf den Knien ab und meint dann vorsichtig: »Verehrte Frau Gräfin, von einem Massentypus sollten wir tunlichst nicht sprechen, denn ohne jeden Zweifel hat der allmächtige Gott jeden Einzelnen von uns nach seinem Ebenbild erschaffen und im Grunde gleich ausgestattet.«
Nach dieser Richtigstellung lehnt er sich wieder bequem zurück, legt den rechten Arm über die Rückenlehne und führt dann weiter aus: »In dieser Ausstattung finden sich aber auch die Elemente Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortlichkeit – und damit lässt er es zu, dass sich die einzelnen Individuen im Laufe ihres Lebens recht unterschiedlich entwickeln. Diesen Vorgang wollen allerdings manche unter uns irrtümlich und unbelehrbar auf ungleiche Entwicklungschancen in den Volksgemeinschaften zurückführen, und versteigen sich auf Basis dieser Sichtweise dazu, wenigstens annähernd gleiche Lebensqualität für alle zu fordern. Ersteres ist aber nun nichts anderes als das Ergebnis einer höchst oberflächlichen Betrachtungsweise, und das Zweite schließlich gar eine Forderung, die mit der Schöpfung absolut nicht zu vereinbaren ist, wie uns heute täglich und unübersehbar vor Augen geführt wird.«
Mit »In der Tat kann niemand mehr übersehen« hakt da der Staatssekretär ein, und bringt damit den Kardinal um seine Abschlussbemerkung, »dass es nicht möglich ist, dass mehrere Milliarden Menschen all die Leistungen und Möglichkeiten nutzen, die uns der technische Fortschritt und unser geballtes Wissen auf vielen Gebieten erbracht haben. – Nur, verehrte Gräfin, Herr Kardinal und mein guter Reinhardt«, fährt Rehagen nach kurzem Überlegen mit etwas erhobener Stimme fort, »es ist absolut nicht einfach, der Mehrheit verständlich zu machen, dass sie in Zukunft nur mehr in eingeschränktem Maße daran teilhaben kann.«
Nach einigem Zögern fügt er noch hinzu: »Noch schwieriger ist es allerdings, einer im Überfluss lebenden Minderheit klarzumachen, dass es am einfachsten und wohl auch am sinnvollsten wäre, wenn alle Menschen ihre Ansprüche auf ein verträgliches Maß zurückschrauben, also eine zukunftsfähige Lebensweise akzeptieren würden.«
»Mann, Rehagen, was Sie da vorschlagen ist doch nichts anderes als einfallslose Gleichmacherei!«, wettert die Gräfin wieder los. »Nur weil es Ihnen und so vielen schwachbrüstigen Politikern an Durchsetzungsvermögen fehlt, sollen wir uns in eine Reihe mit Hinz und Kunz stellen. Mein Gott, unser großer Franz Josef Strauß hat doch schon in den Achtzigern flammend appelliert, dass wir uns keinesfalls einem primitiven und lähmenden Ökokommunismus ergeben dürfen.«
Die Gräfin trinkt hastig ein paar Schlucke Wasser und schickt dann einen entrüsteten Blick zu Rehagen hinüber.
Der gibt sich aber auf den gräflichen Angriff hin geradezu kämpferisch und dreht den Spieß geschickt um: »Verehrte Gräfin, ich stehe im Grunde der Lage ja ganz ähnlich gegenüber wie Sie. Aber im politischen Alltag sind Lösungen deutlich schwerer zu erreichen, als es von hier aus gesehen werden kann.« Und während er sich halb aufrichtet, schließt er mit Nachdruck daran an: »Gehen Sie doch selbst in die Politik, verehrte Frau Gräfin! Sie haben Format, das reklamierte Durchsetzungsvermögen und sind in jeder Weise unabhängig, was ein unschätzbarer Vorteil auf diesem Felde ist.«
»Das werde ich mir nicht antun, mein guter Rehagen. Alleine der Gedanke an Wahlkampf, stickige Versammlungssäle und an das Drücken der Hände von aufdringlichen Parteimitgliedern treibt mir den Schweiß auf die Stirn.«
»Nun ja, das sind leider die recht unangenehmen Seiten dieses Metiers«, gibt Rehagen unumwunden zu. »Aber neben den, wenn oft auch minimalen Gestaltungsmöglichkeiten, verehrte Frau Gräfin, ergeben sich für den Politiker immer wieder erhebliche Vorteile, weil er unter anderem auf der Ebene der Wirtschaft einen wertvollen Kenntnisvorsprung gegenüber allen anderen Mitgliedern einer Volksgemeinschaft besitzt. So kann ich heute schon empfehlen, weil wir vorhin die Problematik des Flugverkehrs angesprochen haben, sich von Wertpapieren zu trennen, die irgendwie damit zu tun haben. Momentan sind diese Anlagen zwar noch auf einem Rekordniveau, aber ihr Wert wird in den nächsten Jahren mit sich beschleunigendem Tempo fallen, weil die Umweltbelastungen, die mit dem Fliegen einhergehen, zu groß geworden sind. In Brüssel sind deshalb schon Konzepte und Maßnahmen in Vorbereitung, die eine deutliche Reduktion der Flugbewegungen im europäischen Luftraum zum Ziele haben.«
»Oh, das ist nun wirklich wieder eine wertvolle Info für mich, und wohl auch für dich, nicht wahr, Reinhardt?«, stellt die Gräfin erfreut und großzügig fest.
Reinhardt Wagenlenker nickt nur dazu, und so fährt die Gräfin hemmungslos freimütig fort: »Und diese Ihre Information zeigt nun auch erneut auf, dass ein Mensch wie ich nicht hautnah in der Politik tätig sein muss, Herr Staatssekretär. Wir haben ja Leute wie Sie als Partner, die, zwar etwas lax, wie ich gerade kritisieren musste, aber grundsätzlich für uns und in unserem Sinne tätig sind.«
Während ihrer letzten Worte lässt die Gräfin Rehagen einen entwaffnend freundlichen Blick zukommen und lehnt sich dann ganz gelöst und zufrieden in ihrem Sessel zurück.
Dem Staatssekretär missfällt dieser Stil, dem er in der Topgesellschaft immer wieder ausgesetzt ist, dennoch ganz entschieden. Er umfasst mit hartem Griff beide Armlehnen und sagt unüberhörbar missmutig: »Bei dieser Gelegenheit darf ich Sie, werte Frau Gräfin, aber schon daran erinnern, dass für uns Politiker das Zusammenspiel mit ihren Kreisen nicht unproblematisch ist. Ein Teil der Presse ist ja auch ständig auf der Suche nach unkorrekten Verhaltensweisen auf unserer Seite, und wir sind deshalb ganz schnell in den Schlagzeilen oder haben gar eine Anklage am Hals.«
Die Gräfin berührt das wenig und antwortet darauf kühl und gelassen: »Damit müssen Sie leben. Und, wenn wir nun schon dabei sind, mein guter Herr Staatssekretär, dann darf ich wohl daran erinnern, dass unser Zusammenspiel, wie Sie zu sagen belieben, ja auch von erheblichem Wert für Ihre Person ist.«
Rehagen, dem der Ärger und die Frustration über die ungeschminkte Offenheit der Gräfin anzusehen ist, will darauf heftig antworten, aber er kommt nicht dazu, weil an die Salontüre geklopft wird. Die Gräfin, der diese Unterbrechung ganz willkommen ist, wendet sich zur Türe hin und ruft: »Ja, bitte!«
Das Dienstmädchen kommt mit einem Telefon in den Salon.
»Ein Gespräch für Herrn Staatssekretär«, sagt sie in Richtung Gräfin, gibt dann Rehagen das Telefon und verlässt den Salon mit Knicks.
Mit »Entschuldigt bitte« wendet sich der Staatssekretär kurz an die kleine Gesellschaft und meldet sich dann am Telefon. Er nickt während des Hörens einige Male zustimmend und antwortet schließlich: »Ich kann in etwa einer Stunde anwesend sein.« Und kurz darauf meint er noch ein wenig aufgeregt: »In Ordnung, auf Wiederhören.«
Rehagen legt das Telefon hastig auf den Tisch und sagt mit stockender Stimme: »Frau Gräfin, meine Herren, zu meinem größten Bedauern muss ich diese Runde umgehend verlassen, im Ministerium wurde überraschend ein Gespräch anberaumt.«
Er steht dann rasch auf und wendet sich halbwegs gefasst an die Gräfin: »Verehrte Frau Gräfin, herzlichen Dank für Ihre Einladung, und ich bin Ihnen trotz des kleinen Disputs von vorhin selbstverständlich auch weiterhin zu Diensten.«
Mit »Oh, Herr Staatssekretär, das freut mich sehr, dass wir das Kriegsbeil wieder begraben können« gibt sich die Gräfin erleichtert und steht auf.
Rehagen küsst ihr die Hand und wünscht Reinhardt Wagenlenker und dem Kardinal einen schönen Abend.
Der Kardinal verabschiedet ihn im Sitzen mit »Gott sei mit Ihnen«.
Reinhardt Wagenlenker dagegen steht auf, drückt Rehagen freundschaftlich die Hand und sagt zu ihm: »Ciao, Bodo, und mach’s gut, alter Freund.«