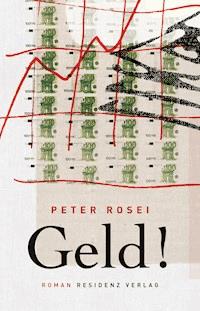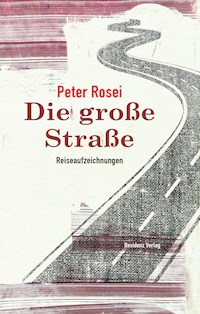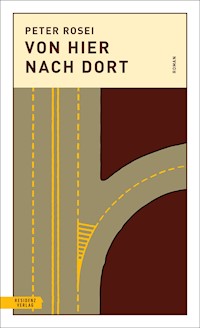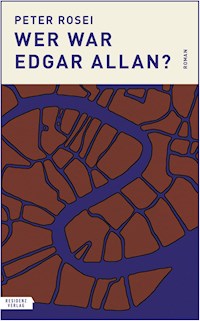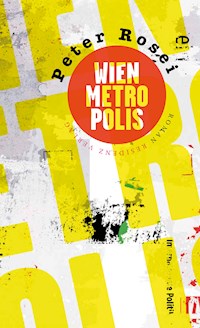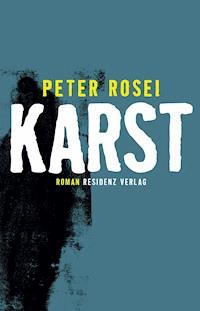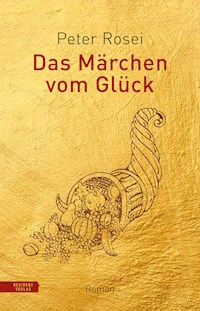Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann ein Dichter die Wahrheit sagen? Peter Rosei versucht es – radikal, selbstkritisch und doch im Glauben an das Wunderbare des Lebens. "Das wunderbare Leben" ist nicht einfach Peter Roseis Autobiografie. Es ist sein Versuch zur literarischen Wahrhaftigkeit und zugleich die Geschichte eines Autors, der viele Leben gelebt hat. Dessen Devise lauten könnte: Das Leben ist wunderbar, auch wenn es zu Zeiten schrecklich ist. Aus kleinen Verhältnissen stammend, kommt der junge Mann als Sekretär des Malers Ernst Fuchs rasch zu Geld, gibt aber alles auf, um seiner Berufung als Dichter gerecht zu werden. Nach Jahren schwerer Krisen folgt ein abenteuerliches Bohème-Leben an der Seite der Künstler und Literaten der 70er- und frühen 80er-Jahre, darunter sein engster und langjährigster Freund H.C. Artmann. Schließlich die große Wende – aber lesen Sie selbst: Wahrheit und Dichtung ergänzen sich in diesem Text.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Rosei
Das wunderbare Leben
Wahrheit und Dichtung
Residenz Verlag
Wir danken für die Unterstützung
© 2023 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Thomas Kussin/buero8
Lektorat: Jessica Beer
ISBN eBook: 978 3 7017 4700 9
ISBN Print: 978 3 7017 1766 8
INHALT
I. BUCH
PROLOG
KARRIERE
REICH WERDEN
INTERMEZZO
VORGRIFF
II. BUCH
PROLOG
BOHEME
III. BUCH
PROLOG
PHANTASTISCHE FAHRTEN
DOKTOR BRAUN
EINE BEKANNTSCHAFT
DER BRUDER
DIE JUNGE FRAU
UMSTÄNDE
IV. BUCH
PROLOG
SKRUPEL
REALIEN
BEHAUPTUNG
RICORSO
SUMME
I. BUCH
PROLOG
Auf einer China-Reise besuchte ich einmal die Stadt Chengdu. Sie liegt im Westen des Landes, eine dieser Riesenstädte mit endlosen Straßen voll Smog, gesäumt von gesichtslosen Hochbauten. Ich erwähne die Stadt auch nur deshalb, weil im achten Jahrhundert dort der Dichter Du Fu gelebt haben soll. Jedenfalls gibt es im heutigen Chengdu, inmitten von Hochhäusern, einen Park, ja man könnte fast sagen, eine Art Wald, ein Bach fließt darin, es gibt einen Teich und, ja, auch ein paar strohgedeckte Hütten: Hier, auf diesem Fleckchen Erde, soll einstmals der Dichter Du Fu gelebt haben. In einer dieser Hütten soll er tatsächlich gelebt haben. Jedenfalls wird das behauptet.
*
Am Anfang waren nur schwarze, federnde Flecken auf zitronengelbem Grund, es roch nach Erde, es war ein großes Geheimnis um diese Flecken, die sich verfärbten, allmählich ins Grüne hinüberspielten und wie unter einem Stoß nachzitterten. Da war auch ein großes Versprechen.
Es waren, wie sich dann herausstellen sollte, bloß die Schatten von Spalierobst, von Blättern und Früchten eines Apfelbaums, der in der tief stehenden Sonne dieser Stunde vor der Hausmauer sein Geäst ausbreitete.
Ein junger Mann kommt eine Wiese heruntergelaufen und wirft sich atemlos in die ausgebreiteten Arme einer Frau, einer blonden, stämmigen Frau, die ihn auffängt: Der Anblick war nur ein warmer, schmelzender Zuschlag zu einem fast schon umfassenden Wohlsein, so will es mir heute vorkommen. Mag sein, dass damals in mir die Vorstellung entstand, die Frau sei das Glück selbst. Man kann es aber nur haben, wenn man zugleich sich selbst aufgibt.
Der Leib meiner Mutter ist mir jetzt fern, mumienhaft, dunkel und gespenstisch sehe ich sie in einer weiter hinten liegenden Tür stehen und warten. Wohin diese Tür führt oder führen wird? – Als mir dieser Körper nah war, was habe ich da empfunden?
Denke ich an die Mutter, ist mir, als hätte man mir ein Geschenk angekündigt, so groß und so himmlisch, wie man es nur als Kind von einem Geschenk sich vorstellen kann und erwartet.
Meine Mutter war ein heiteres, ein unbekümmertes Geschöpf. Denke ich an sie, fällt mir gleich das berühmte Bild Renoirs von der Moulin de la Galette ein, vor allem die Frau im dunklen Kleid mit dem Hütchen, die von hinten ihrer am Wirtshaustisch sitzenden Freundin die Hand auf die Schulter legt: Das durch die Kronen der Kastanienbäume fallende Licht spielt und tanzt mit hellen Punkten über die festliche Menge, über die beiden hin.
Das Haus, in dem wir damals wohnten, steht tief unter der Kurve einer Landstraße: im Graben, wie man sagt. Von der Straße aus sieht man bloß das rote, zeltförmige Dach – das mir mit seiner simplen und geheimnislosen Form jetzt den Eindruck hervorruft: Dort bist du gut aufgehoben gewesen, dort konnte dir nichts passieren.
Der Wiesenhang, die Grashalme, die Bäume, das Geäst der Bäume. Ich lernte, dass das Licht je nach der Stunde die Gräser, die Bäume, das Laub einmal so, dann wieder anders färbt, dass Äste sich mit dem Wind bewegen und drehen, dass sie auf und ab tanzen, dass alles bald einmal so, dann wieder ganz anders ist.
Die oben vorüberführende Straße, eine Asphaltstraße, auf der öfter Schlangen in der Sonne schliefen, so wenig Verkehr gab es da, war rechts von Wald, links von einem Geländer gesäumt, das in seiner Ausführung viel zu fragil war, als dass es Sicherheit vor dem Abstürzen hätte bieten können.
Die blonde Frau, Mitbewohnerin im Haus, hatte zwei kleine Kinder, Säuglinge noch, aber keinen Mann dazu. Mein Großvater ließ sie mietfrei im Haus wohnen, sicher nicht ohne Eigennutz. Freilich, als Kind war mir das nicht klar. Die Soldaten, Verehrer der jungen Frau, es war kurz nach dem Krieg, brachten immer Geschenke mit, die hochwillkommen waren. Nachts hörten wir oft tolles Schreien und Gelächter aus der Stube herauf. Es gab Tanzereien. Wir Kinder, mein Bruder und ich, schliefen unter dem Dach. Gleich am Fuß der Treppe stand der Tisch, um den die Großen sich abends zusammensetzten. Wurde es gar zu laut, lief ich zur Treppe und schaute, halb neugierig, halb verängstigt, hinunter, während mein kleiner Bruder vom Bett her verschlafen fragte: »Was machst du da?«
Die Küsse der Großmutter, wie könnte ich sie je vergessen! Blätter von Leberblümchen oder das Erscheinen der Zyklamen im Herbstlaub, Efeu, der, vom Sprühregen bestäubt, über ein Mühlenwehr hängt. All die Tränen, die geweint werden, vor Freude oder weil man unglücklich ist.
Als meine Großmutter starb, erbrach sie sich. Das Erbrochene waren ihre letzten Worte.
Großmutter war klein und rund, Großvater ein stattlicher Mann mit Hitler-Bärtchen, etwas schütterem, dunklem, straff nach hinten gekämmtem Haar. Er trug den Kopf freilich hoch, war stets in Schale, wie man sagt, was er seiner Beschäftigung im führenden Modehaus der Stadt verdankte. Wer Großvater solcherart im Sonntagsstaat sah, im makellosen Anzug, den aufgebürsteten Hut in der Hand, der hätte sich kaum vorstellen können, dass derselbe Mann ein paar Tage später zerrissen und zerschlagen irgendwo im Rinnstein liegen würde.
Der englische Uniformstoff war sehr rau, es wurde kolportiert, er wäre aus Brennnesselfasern gewoben. Großvater kaufte die Restposten auf, als die Besatzung abrückte. Indes er mit diesem Handel reich zu werden hoffte, ruinierte er sich.
Dieser schwermütige, verschlossene, tief unglückliche Mensch, von ihm ist wohl vieles auf mich übergegangen, so viel, dass ich mit ein bisschen Theologie sagen könnte: Du bist der, durch den ich gelebt habe.
Über kurz oder lang war das kleine Haus unter der Straße versoffen, meine Kinderwelt dahin.
Unterhalb des Hauses läuft der Bach vorbei, der in Kaskaden frisch hinunterspringt. Er speist sich aus dem See weiter oben, mit dem alles anfängt: köstliches Schweigen, durchsichtige Stille, schönster Frieden. Im Kleinen, im Taschenformat, klingt hier an, was in kunstreicher Oper zum Schicksalslied wird. Als Kind wusste ich nichts von Wahnsinn und Lebensgier. Alles war für mich angerichtet, ich brauchte bloß zu atmen, alles war mir zur Hand. Später sollte ich mich oft an den See erinnern, wie ich darin geschwommen war, faul plätschernd im weichen, nachgiebigen Wasser, wie ich, von der Sonne durchwärmt, am Ufer gelegen und gegen eben die Sonne geblinzelt hatte, die auf der anderen Seeseite über den Wald wanderte, strahlend und, weil selbst die Zeit, außerhalb von ihr.
Mein Glück war so groß wie die Welt selbst. Die Welt insgesamt passte haargenau in mein Glück hinein. Wer das verlor, was ich verlor, wo soll der Halt machen?
Großvater fuhr zu den Arbeitern auf Großbaustellen und zu Kraftwerksbauten im Umland. Das Geschäft lief vorerst gut. Der durch den Verkauf der Waren erwirtschaftete Gewinn schrumpfte allerdings, kehr um die Hand, auf ein Häufchen schmieriger Münzen zusammen, die Großmutter heimlich aus den Hosentaschen des Großvaters fischte, wenn der einmal heimkam.
Die Eskapaden des Großvaters waren einfach zu wüst, sie passten mit seiner Absicht, reich zu werden, so gar nicht zusammen, so kam bei alldem nichts heraus.
Die Schuppen an der Rinde der am Waldrand stehenden Föhren leuchten im Abendlicht wie goldene Münzen – wie mein Großvater sie so gerne gehabt hätte: Und er hat sie ja auch gehabt, wenn auch nur kurz.
Wir streifen durch den Wald, auf der Suche nach Schwarzbeeren. Später gibt es sie zu essen, mit Milch und Zucker. Mit der schwarzen Sauce bemalen wir Kinder uns das Gesicht und erschrecken uns dann über die Bemalung.
Einmal, nachts, hat Großmutter mich ausgeschickt, den Großvater zu suchen. Ich klappere die Wirtschaften ab, die er für gewöhnlich frequentiert: Zum Heiligen Josef. Zum Grünen Baum. Zum Weinkönig. Die Straßen strecken sich öd im Licht der Lampen. Gleich zu Anfang geht es an der schier endlosen Mauer eines Klostergartens entlang. Die Stadt selbst, die versperrten, verschlafen dastehenden Häuser: Zuletzt finde ich Großvater in einer der Wirtschaften, er sitzt da allein an einem Tisch. Er sieht aus, als würde er nachdenken, verstrickt in ein Rätsel. Er war wohl vernarrt in dieses Rätsel: Weder konnte er es lösen, noch konnte er es lassen.
Ich trete an ihn heran, schaue von unten her zu ihm auf: »Komm heim, Großvater!«
Da ist er, mein unglücklicher Großvater. Meine Aufforderung hat er entweder überhört oder nicht verstanden. Ein Gast, der mit seinem Bierkrug an der Budel lehnt, lacht und spendiert mir ein Eis.
An besseren Tagen freilich ging ein gutes Licht von Großvater aus, von seinen dunkelbraunen, warmen Augen, der klaren und freien Stirn. Sein Gesicht war glatt, still gefasst, ebenmäßig geformt, das Gesicht, der Kopf, die Gestalt insgesamt, alles am rechten Platz: So liebte ich meinen Großvater, groß und stattlich. In seiner Haltung drückte sich etwas Gelassenes, etwas Respektgebietendes aus, etwas Zartes und Zögerliches auch, möchte ich sagen, das etwa bedeuten sollte: Komm du mir nicht zu nahe, so ist es besser, glaub mir, ich will dir ja auch nicht zu nahekommen.
Mag sein, dass Reue und Scham seine gewöhnliche Grundstimmung waren, und er nur deshalb so gutartig auf mich wirkte, weil er ganz hilflos war. Zugleich aber ragt er als die bestimmende Gestalt in jene Kindertage herein: Weil er für mich unergründlich war, ganz fremd, und sich nie wirklich auf mich einließ.
Das Seeufer besteht aus Viehweiden, deren helles Grün, sich spiegelnd, die kleinen Wellen auf der Seeoberfläche färbt und, prisenweise sich auflösend, im kalten Grau der Tiefe verschwindet.
In einem Gedicht von Anna Achmatowa gibt es das Bild vom selbstverliebten Schwan, der sich nicht genug im Spiegel betrachten kann: Was den See angeht, schwimmt der Schwan in meiner Vorstellung zwar ewig darauf herum, den Kopf stolz erhoben, und manchmal taucht er ihn ein: Aber einmal ist er dann doch gestorben.
Mein Großvater starb übrigens beim Teppichklopfen für andere Leute, er fiel neben der Klopfstange einfach aufs Gesicht. Ich erbte die Schuhe, die er beim Sterben angehabt hatte: halbhohe, schwarze Schnürschuhe, innen mit weißem Nylonvlies gefüttert, die ich dann auftrug.
Der See meiner Kindheit wird durch den Bach, an dem unser Haus stand – es steht immer noch dort –, mit einem zweiten, viel größeren, im Land draußen liegenden See verbunden. Geht man die Straße bergab, die am Haus oben vorbeiführt, tut sich bald der Blick in eine Landschaftsbucht auf, die von Bergen und kleinweise sich abtreppenden Hügeln gefasst wird: Da sieht man den großen See in der Tiefe glänzen.
Die Mühle stand weiter bachabwärts. Was war das dort für ein Leben! Männer, die im Sonnenlicht Mehlsäcke verladen: Es staubt ganz gewaltig. Die Waage. Das Abwägen. Wagen, zwischen deren Deichseln Pferde stehen: Hü-a! Das große Mühlenrad, das sich immerfort dreht. – Für uns Kinder gibt es da immer etwas zu sehen, und schon eher ungehalten werden wir vom Haus oben zum Essen gerufen.
Die Gletscher der Eiszeit haben die Becken der Seen seinerzeit ausgeschürft. Die Zungen der Gletscher waren von Geröllhaufen gesäumt und begleitet – die, nach einer ungeheuren Zeit, unsere Hügel und Berge geworden sind. Dann flogen viele Samen herüber, und Wald und Wiesen wuchsen auf.
Großvaters Mutter war eine Kräutersammlerin gewesen, die allein im Wald lebte. Dort ist er, ein vaterloses Kind, auch zur Welt gekommen. Zu Hilfsdiensten angelernt im Hafen von Triest, wo er viele Jahre später die Großmutter anlässlich einer Ausflugsfahrt ohne Geld oder Papiere auf der Straße einfach hat stehen lassen.
Großvater scheint früh von zu Hause ausgerissen zu sein, wobei der Ausdruck zu Hause bestimmt eine Übertreibung ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach gingen Holzknechte, Förster, Jäger und sonst die Leute, die im Wald zu tun haben, bei seiner Mutter ein und aus. Um sie herum dürfte sich jenes Leben entfaltet haben, wie es an den Rändern geführt wird: Übermut und Gewalt, Verzweiflung, Schnaps und Sex.
Einmal waren wir mit Großvater im großen Dobrawa-Wald zum Pilzesuchen, als ein Gewitter losbrach. Zum Glück fand sich ein Gehöft, eine Keusche, die ganz unerwartet und gleichsam märchenhaft mitten im Wald stand. Außer einer Magd war niemand im Haus. Die Magd schenkt dem Großvater Most ein, wir stehen im Flur. Großvater und die Frau unterhalten sich lebhaft, sie lacht bald hellauf zu seinen Scherzen. Schließlich trug Großvater uns auf, wir mögen doch schon einmal zum Bahnhof vorausgehen, er würde dann nachkommen. Die Erinnerung zeigt mir meinen kleinen Bruder und mich, wie wir, Hand in Hand, durch den finsteren, triefenden Wald gehen.
Nach ein paar Wochen tauchte Großvater zu Hause wieder auf.
Großvater verbrauchte jedes Krümelchen für sich und enterbte uns alle. Er tat es nicht aus Geiz oder Bosheit, er konnte wohl nicht anders. Zuletzt bestand seine ganze Kunst darin, alles für nichts gegeben zu haben oder doch für Dinge, die letztlich ohne Wert für ihn waren.
Im Ersten Weltkrieg tat Großvater Dienst in einer Gebirgsfestung. Von der Festung führt die Straße in steilen Kehren zur Schlucht hinunter. Der Fluss windet sich fort durchs enge Tal. Dann kommen die furlanischen Hügel und die Ebene zur fernen Piave, wo Jahre später, sie mussten über Leichenberge wegklettern, die österreichischen Soldaten am Ufer hinknieten, um endlich Wasser trinken zu können und die Feldflaschen zu füllen.
Die Kirschen, die sie als Kinder auf die Ohren gehängt hatten, läuteten den Sterbenden vielleicht als Totenglöckchen. Möge der Tod ihnen in Form von Früchten erschienen sein, wie sie, warm und süß, im dürren Herbstgras liegen. Würde man alles Blut, das im Isonzo-Tal vergossen wurde, aufstauen, das gäbe einen gewaltigen See.
Großvater überlebt den Krieg nur zu dem Ende, dass er Großmutter kennenlernt und ihr bald Kinder macht.
In den letzten Kriegstagen marschiert die Königlich-Serbische Armee in Kärnten ein.
Als die Serben in Kärnten einmarschieren, kämpft der Großvater für Österreich, die Großmutter spuckt in der Einfallstraße, durch die sie heraufkommen, den fremden Soldaten vor die Füße. Darin und in einem in die Urne gesteckten Abstimmungszettel für Österreich erschöpft sich auch schon der Patriotismus des Paares, man könnte auch sagen, seine ganze Politik. Bald rücken sie, das Haus unter dem See ist verkauft, mit den Kindern in eine Zimmer-Küche-Wohnung in der Klagenfurter Vorstadt ein: Dort werden sie bleiben.
Wie der fesche Soldat im Zauber der Montur in den Laden tritt und ein paar Stumpen verlangt. Wie er immer öfter kommt. Wie ausgegangen wird, zu irgendeiner Tanzerei. Wie sich dann ein Gebüsch oder sonst ein abgelegener Ort am Rand der Festwiese findet, wo man sich hinlegt.
Großmutter ist auf einen Mann vom Schlag des Großvaters gut vorbereitet. Ihre Mutter starb früh, der Vater verkam im Asyl, sie stand als Waisenkind da.
Ihr Dienst war es gewesen, dem Vater Essen ins Asyl zu bringen. Unterwegs tritt sie eines Tages in ein Wespennest. Der aufstiebende Schwarm verfolgt sie, einzelne Wespen verfangen sich in ihren Haaren, und sie läuft und läuft, verfolgt von dem immer wieder sich auf sie herabsenkenden Schwarm.
Man sollte alles mit der linken Hand anfangen, ein brauchbarer Rat. Man sollte sich nicht zu leicht beeindrucken lassen und alles nicht so schwernehmen.
Tiere und Zweige, Pflanzen und Menschen, Steine: Steine ohne Gewicht und Menschen, durch die Bäume oder Blumen wachsen, ohne sie im Mindesten zu verletzen. Tiere, die fliegen können – auch solche, die es für gewöhnlich nicht können. Flüsse, die durch Steine oder Menschen hindurchrinnen. Menschen, die groß wie Häuser sind und Schritte machen können, gegen die Berge klein aussehen, da gehen sie, und der Himmel ist blau – so habe ich es als Kind geträumt.
*
Den Geburtsort meiner Großmutter mütterlicherseits muss ich erst im Netz recherchieren. Meine Leute wurden nach dem Krieg vertrieben. Das Thema war tabu. Ich bin nie dort gewesen, obwohl es doch nur zwei Autostunden von Wien sind.
Dittersbach, in Ostböhmen gelegen, im dreizehnten Jahrhundert von Deutschen besiedelt, lese ich, seinerzeit etwa 1000 Einwohner, also gar nicht so klein. Der Landkreis Zwittau ist vor dem Krieg zu fast hundert Prozent deutsch. Die nächste Eisenbahnstation allerdings heißt Politschka, was weniger deutsch klingt.
Dittersbach liegt zwischen Hügeln in einer Senke, so sehe ich’s auf dem Bildschirm, ringsum Felder, auf den Anhöhen ein wenig Wald, in der Dorfmitte die obligate Barockkirche, es gibt eine Schule, einen Gemischtwarenladen und ein als Kaufhaus ausgewiesenes Unternehmen.
In diese Schule muss Großmutter gegangen sein. Irgendwo da hat sich wohl die einzige Geschichte abgespielt, die ich aus ihrer Kindheit kenne: Im Winter ist sie auf ihrem Schulranzen über einen Abhang gerodelt, ihren Eltern kam das zu Ohren und sie wurde bestraft.
Schneereiche Winter mit eisklarem Himmel, froststarren Bäumen, von denen manchmal Elstern abstreichen: Soll ich mir eher einen engen, nebligen Tag vorstellen, in dem die Konturen der Häuser verschwimmen, der Bach unter der Brücke gluckst und jeder Laut so gedämpft ist, als hätte man Stroh in den Ohren?
Mit ihrer Schwester, die sie gelegentlich traf, unterhielt Großmutter sich in einem Dialekt, den wir Kinder nicht verstehen konnten.
Bei zwölf Kindern auf dem Hof ist der Weg der Großmutter vorgezeichnet: Mit vierzehn bekommt sie einen Koffer und eine Fahrkarte von Politschka nach Wien. Die gewöhnliche Route, die schon vielen zu einer Reise ins Glück wurde. Die Eisenbahnschienen, die sich hinter Zwittau nach Süden biegen, sind der Handlauf an diesem Weg.
Bei der Feldarbeit hatte man sie als Säugling einmal am Rain vergessen, zwischen der in ein Tuch eingeschlagenen Jause und dem Mostkrug. Die Sonne hat das Gesicht der Kleinen verbrannt.
Breites, dunkles Gesicht mit etwas vorspringendem Kinn samt einer Warze, das schon dürftige schwarze Haar zum Zopf geflochten und dann aufgesteckt, den massigen Leib meist in ein kleinteilig gemustertes, beinah bodenlanges Kattunkleid aus dunklem Stoff gehüllt, irgendwie o-beinig, so kommt Großmutter daher.
In Wien bringt sie es im Lauf der Jahre vom Dienstmädchen zur Herrschaftsköchin, eine beachtliche Karriere. Sie ist jetzt fast dreißig Jahre alt, der Erste Weltkrieg, die darauffolgende Wirtschaftskrise sind vorüber, die große Depression und der Bürgerkrieg stehen bevor.
Müßig zu erwähnen, dass Großmutter ihre gesamten Ersparnisse durch die Inflation verlor. Was sie freilich nicht davon abhielt, immer weiter zu sparen.
Sie hatte ihr Schicksal dem Herrgott anvertraut, in seine Hände gelegt, wie man sagt und wie man es ihr beigebracht hatte. Gottergebenheit war das Dogma ihrer Religion, aus der, gleichsam nebenher und im Grund seltsam unverbunden, Güte und Sanftheit flossen. Zelotischer Starrsinn war die weniger schöne Seite. Großmutters Güte, bis heute steigt sie mir auf, wenn ich von einem sagen höre: Das ist ein guter Mensch.
Bei Gelegenheit lernt Großmutter den lungenkranken, nichtsnutzigen Sohn eines leidlich wohlhabenden ungarischen Bahnbeamten kennen. Vater und Mutter des Zukünftigen leben als Pensionäre in Wien. Ob der Bräutigam lungenkrank war, weil nichtsnutzig, oder umgekehrt, dass er durch die Krankheit zum Nichtsnutz wurde, ist nicht bekannt. Also wird geheiratet, bald kommt ein Kind, das einzige im Übrigen – meine Mutter.
Die Wohnung liegt im Parterre: Die fensterlose Küche, in der stets das Licht brennt, mit Tisch, Kredenz, Gasrechaud und Wasserkübel, ist der Mittelpunkt der Wohnung. Anschließend die Kammer mit einem Fenster zur Straße: An der Wand stehen die Betten, gegenüber die Kästen.
Ein wenig gleicht dieses Zimmer dem von Van Gogh in Arles, aber auch Raskolnikoff könnte hier zur Miete gewohnt haben.
Am Ende ist doch nur die Wahrheit schön. Vielleicht steige ich deshalb hinab und hinab, und immer tiefer muss ich steigen, dorthin, wo vielleicht die Wahrheit wohnt.
Neben ihrem Dienst als Hausmeisterin geht Großmutter waschen und putzen. Damit erhält sie die Familie. Der Mann ist lungenkrank. Rundum sind die meisten im Viertel arbeitslos. Wie Krähen im Winter, so stelle ich mir das vor: Die krummen Straßen zum Wienfluss hinunter sind voll hungriger, abgerissener Leute. Großvater, wenn er nicht gerade in einer Heilstätte versucht, gesund zu werden, nimmt da und dort Arbeit an – wenn er denn eine bekommt. Lang hält er meist nicht aus. Dafür ist er in den Wirtshäusern der Gegend bekannt für seinen Schmäh, seinen Witz, ein echter Wiener, wie man so sagt.
Ein dünner Mensch mit einem Schild an einem Bindfaden um den Hals: Nehme jede Arbeit an.
Wien liegt an der Donau. In den Kehrwassern der Donaubrücken und der Steinsporne an den Deichen schwimmt Treibgut ewig im Kreis. Aber gelegentlich packt die Strömung doch eins dieser Hölzchen oder eine der leeren, schmutzverkrusteten Flaschen und reißt sie mit sich fort. Der Strom, gegen Osten schwenkend, beschreibt mit seinem Lauf allerdings einen weiten Bogen, sodass es aussieht, als wollte er sich zurückwenden und, was er hilfreich mitgenommen und befreit hat, bald wieder an die alte Stelle zurückbringen.
Als mein Wiener Großvater starb, war ich zwei Jahre alt. Ich habe ihn also nicht wirklich gekannt. Zuletzt soll er, wie zu hören war, nur mehr ein Schatten seiner selbst gewesen sein, der Schatten eines Schattens.
»Erst wann’s aus wird sein / mit der Musi und an Wein / dann pack’ ma unsere sieben Zwetschk’n ein«, singt der wienerische Zecher und hebt das Glas. Wo nimmt der nur seinen Übermut her? Ist der einfach nur besoffen oder spielt er den Übermütigen bloß, weil er traurig ist, und traurig, traurig darf man nicht sein?
Meine Mutter hat sich beim Spielen auf der Straße das Kleid zerrissen. Sie wartet, in ein Haustor geduckt, bis sie ihre Mutter aus dem Haus gehen sieht. Die Mutter wird bestimmt schimpfen – wegen des Kleides. In der Wohnung sitzt der Vater, mein Großvater, fröstelnd und hustend.
»Was ist?«
»Da – schau.«
»Kauf’ ma halt was Neues.«
*
Mein Vater, in den zwanziger Jahren geboren, hatte als Kind und Heranwachsender wenig zu lachen. Es gibt da die Erzählung von der Kellerstiege, auf der er viele Nächte verbracht haben soll, versteckt vor dem stets betrunkenen, zur Tobsucht neigenden Vater, meinem Großvater. Die Jugend meines Vaters dürfte eine Kette von Enttäuschungen und Erniedrigungen gewesen sein, durch den rücksichtslosen Vater einerseits, durch die schwache und angstbesessene Mutter, meine Großmutter, andererseits, die ihn nicht schützen konnte. Denke ich an die Großmutter, sehe ich sie dastehen, in der Küche, die Hände vor die Schürze gelegt, seltsam starr und isoliert. Selbst zu den Möbeln ringsum hat sie kaum Bezug: Grau, ja farblos ragt alles auf.
Ein Zugpendel mit einer Glühbirne hängt von der Decke in der kleinen, quadratischen Küche. Jetzt kommt Großvater herein, und schlagartig verändert sich das Licht: Mit fliegenden Händen durchwühlt der Großvater den Medikamentenschrank. Was sucht er denn? Die von der Decke hängende Lampe schwankt jetzt ein wenig, kommt mir vor, der Raum wird groß und schrecklich hell. – Aber das kann doch nicht sein!
Von seinen Touren heimgekehrt, trinkt Großvater selbst das Rasierwasser noch aus. Mit dem von Großmutter bereiteten Kaffee schwemmt er eine Handvoll Schlaftabletten hinunter und kann doch nicht schlafen. Bös vor sich hinstierend sitzt er da.
Mein Vater war ein blasses, ein schwächliches Kind, wahrscheinlich ist er oft verprügelt worden.
Von den Eltern, den Vorfahren her, lebt eine Vergangenheit in uns, die nicht vergeht, solange wir leben. Bald fühlen wir diese Vergangenheit nicht, das heißt, sie ist nur unterirdisch und gespensterhaft da. Bald fühlen wir deutlich, wie sie uns aufsteigt: mit Verwunderung oder Erstaunen, je nachdem, öfter aber mit Befremden oder gar Abscheu oder Grauen: Nein – so will ich nicht werden! So will ich nicht sein.
Ich habe meinen Vater immer für etwas verachtet, was ich für Indolenz, für Kleinkariertheit und Duckmäusertum hielt und was doch, wahrscheinlich, nur ein gebrochenes Herz war. Das ist mir allerdings erst viel später aufgegangen, eigentlich erst, als mein Vater längst tot war.
Großvater steckt den Buben in die Lehre bei einem Stoffhändler, aber der Bub ist zu schmächtig, seine Arme sind zu dünn: Er kann die schweren Stoffballen nicht heben, sie nicht auf dem Ladentisch ausbreiten. Bei einem Friseur in der Vorstadt ist eine Stelle frei. Wird der Bub halt Friseur!
Es wird Krieg geben, ist zu hören. Am Krieg ist nichts Gutes. Gar nichts. Trotzdem, gefährliches Leben – ich habe es immer geliebt. Gefahr, das bloße Versprechen darauf. Nur gefährliches Leben ist für mich je richtiges Leben gewesen, so ist das einmal: Spitz auf Knopf. Diese Neigung, bewusst oder unbewusst, mag auch den Vater bestimmt haben, als er sich, kaum achtzehn Jahre alt, freiwillig zur Wehrmacht meldet. Das ist die positive Lesart. Oder ist er doch nur aus Erbärmlichkeit, aus Verzweiflung und Hass gegangen, um dem Leben daheim zu entfliehen?
Vater war nicht allein mit seinem Entschluss, viele seiner Freunde, oft arbeitslos, entschieden sich ebenso. Der Moment war auf seine Art günstig: Ein halbes Jahr später begann der Krieg.
Fest steht, dass Vater im späteren Leben allem Militärischen und Heldischen ganz abgeneigt war. Davon wollte er nichts hören. Ein bubenhaftes und scheues Lächeln war alles, was er jeder Macht gegenüber aufbrachte. Keiner nahm ihn deshalb für voll. Was kümmerte ihn das aber? Darin, nichts ernst zu nehmen, nichts mehr ernst zu nehmen, war er konsequent, das war wohl die Lehre, die er gezogen hatte.
Vater kommt zur Ausbildung zu den Gebirgsjägern. Zu Kriegsbeginn, beim Einmarsch in Polen, ist er dabei. Dort sieht er seinen ersten Toten: Der liegt auf der Straße, im Staub, den Mund weit aufgerissen, die Zähne gebleckt. Meist jedoch erzählte Vater vom Verdrehten und Verrückten des Krieges – als eine Art von tollem Fasching: Die Kameraden plündern, beladen sich mit Gemälden, Standuhren, Schinkenkeulen und Porzellangeschirr, nur um alles wenig später wieder fortzuwerfen. Strohdächer, aus denen fette Rauchwolken quellen, von Funken durchstoben, weinende Frauen, die sich den Soldaten anhängen wollen, verlassene, herumirrende Kinder, Verwundete, die nach dem Sanitäter schreien. – Panzervorstoß: Kameraderie: Wer ist ein Feigling, wer nicht?
Die nächste Gelegenheit, sich zu beweisen, bekommt Vater in Narvik.
Einen Tag vor den Engländern rücken die Deutschen ein, um die Bahn, die nach Schweden führt, zu besetzen. Winter. Die schwedischen Minen sind kriegswichtig. Die Deutschen sind bald eingekesselt und ziehen sich in die Tunnels am Berghang zurück. Die Engländer schießen von ihren Schiffen herüber. Die Flugbahn der Geschosse geht direkt.
Es folgt eine Art Ruhepause als Besatzungssoldat in Norwegen, in Schweden, ich weiß es nicht genau. Vater schließt sich einem älteren Landser an, einem Hallodri und Frauenhelden offenbar. Noch lang nach dem Krieg schreibt Vater Briefe nach Norden, er scheint sich dort verliebt, vielleicht gar verlobt zu haben.
Die Gebirgsjäger werden in die Gegend von Murmansk am Polarkreis verschoben. In ein, zwei Wochen soll die Stadt gefallen sein.
Kriegführen besteht vor Murmansk vor allem darin, den Winter zu überleben. Patrouillengänge auf Skiern: der große Kreis – zwanzig Kilometer. Der kleine Kreis – zehn Kilometer. Getöteten Russen werden zum Beweis die Ohren abgeschnitten.
Als ich ein Kind war, wenn zwei, drei Erwachsene abends beisammen saßen, redeten sie von nichts anderem als vom Krieg. Ich weiß noch, dass ich von diesen Geschichten nicht genug bekommen konnte. Das Ungeheuerliche faszinierte mich. Eine Welt, die so ganz anders war als die, die ich kannte. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute, die diese Geschichten erzählten, sie tatsächlich auch erlebt hatten.
Vater wird vor Murmansk verwundet. Hüftdurchschuss. Reise im Lazarettzug. Viele sterben. Vater kommt nach Deutschland und zuletzt in die verhasste Vorstadt von Klagenfurt zurück, in die Heimat.
Er will nicht mehr an die Front, will stattdessen mit den Partisanen gehen, die im Südkärntner Raum kämpfen. Was waren seine Motive? Abscheu vor den Nazis, Angst vor einem ganz und gar sinnlosen Tod oder einfach Angst überhaupt? Freunde hatten ihn wohl dazu überredet, sich den Partisanen anzuschließen. Was sollte er schon machen? Sich in Luft auflösen kann er nicht. Eines Nachts, als die Kontaktleute ihn holen kommen, verleugnet ihn die Mutter: Nein, er ist nicht da! – Dabei schläft er hinten im Zimmer.
Weil nicht marschtüchtig, wird Vater einer motorisierten Einheit, einer Panzerabwehrkompanie, zugeteilt. Er kommt an die Ostfront. Wenn ich mir vorstelle, wie Vater zumute gewesen sein muss, als er im Viehwaggon durch die östlichen Ebenen fuhr: In dem Haus in der Klagenfurter Vorstadt gab es keinen Atlas, keinerlei Landkarten und also auch keine Vorstellung davon, wohin es nun tatsächlich gehen sollte. War es vielleicht einfacher so?
Am Ufer des Peipus-Sees. Mit dem Finger fahre ich die Umrisse des Sees auf der Landkarte ab. Irgendwo da ist Vater gewesen.
Die Panzerabwehrkanone, deren Bedienung Vater zugeteilt ist, hat die Aufgabe, den Rückzug der sich absetzenden Truppe zu decken, den Gegner möglichst lang aufzuhalten. Praktisch sieht das so aus: Hinter einem Bahndamm oder einem Feldrain geht man in Stellung. Die Russenpanzer kommen übers offene Feld. Sie fahren schnell. Wenn man Glück hat, schießt man einen oder zwei ab, ehe man aufgespürt und selbst zum Ziel wird.
Vater wird von den Kameraden ausgelacht, weil er bei Tieffliegerangriffen in den Graben springt, während die Kameraden sich gar nicht erst rühren oder vom Fahrzeug heruntersteigen.
Leere, von ihren Bewohnern verlassene Dörfer, brennende Gehöfte, von fortgeworfenem Hausrat übersäte Straßen. Herden von brüllenden, halb verwilderten Tieren im Gelände draußen. Kühe, wahnsinnig geworden, weil niemand sie melkt. Das weite Land, da und dort fallen Schneeflocken, die man einfängt, um den Durst zu stillen.
Die Stadt Gumbinnen: Vater und seine Leute, sie stehen am zerschossenen Bahnhof und überlegen, wohin in der brennenden Stadt. Allein der Name ruft bis heute das lustvolle Grauen in mir wach, das ich als Kind bei seiner Nennung wohl empfunden habe: Erregung, die Erwartung von etwas Entsetzlichem, Endgültigem, das mir gleichwohl groß und von Herrlichkeit strahlend vorgekommen sein muss. Und dann die Schwermut, als vergorene Lust.
Feuerbrand, hell wie Wasser, verzaubert und zauberisch.
Im Einzelnen weiß ich über die Truppenbewegungen, deren Teil Vater war, nicht Bescheid. Der letzte Abschnitt war wohl eine einzige Flucht. Auf den Straßen mischen sich zivile Trecks mit geschlagener, zerschlagener Truppe. Spätherbst. Winter. Straßen, Straßen. Man sagt: ein Alptraum! Er aber muss den Alptraum leben!
An den vom Sturm freigeblasenen Stellen sieht man ertrunkene Kinder unter dem Eis: Traumbilder, Bilder, losgerissen aus Träumen, die ich, in gewisser Weise selig, im Grunde aber voll schrecklicher Angst, wohl einmal geträumt habe.
Irgendwo in Norddeutschland ist für Vater der Krieg aus. Er macht sich aus dem Gefangenenlager davon, schlägt sich durch – aber zu welchem Ende? Zuletzt kommt er in Klagenfurt an, eben dort, von wo er weggelaufen ist.
*
Über Kindheit und Jugend meiner Mutter in Wien weiß ich wenig. Wo ist sie zur Schule gegangen, wo hat sie ihre Lehre absolviert? Der Kunde nach war sie munter und unbeschwert, hat im Kreis einer großen Verwandtschaft und vieler Freunde ein, soweit sich das machen ließ, lustiges, ja ausgelassenes Leben geführt: Von Tanzereien, Kinobesuchen, Eislaufen und Rodelpartien wird berichtet, von Badeausflügen an die Alte Donau, in die Lobau. Nach dem Krieg, als sie verheiratet war, hat mein Vater diese Kontakte gleich abgeschnitten. Er wollte Mutter ganz für sich.
Es gibt eine einzige Fotografie, die Mutter mit ihren Eltern zeigt: Rechts der todgeweihte Großvater, hoch aufgerichtet steht er da. Das Starre seiner Haltung, seines Gesichtsausdrucks ist wohl nicht nur der Regiekunst des Fotografen zu verdanken. Man merkt, dieser Mann steht nur eben vorläufig so da, wie hingelehnt. Oberlippenbart. Kräftiges, stark pomadisiertes Haar. Hände, die aus den Ärmeln des Anzugs hervorstehen wie Tierklauen.
In der Mitte steht Mutter, um die zwanzig vielleicht, sauberes Gesicht, ausdrucksvolle, große Augen, eine Frisur mit Tolle – wie Elfriede Jelinek sie später getragen hat. Jung, so jung, dass noch gar keine richtige Person da ist, ein Geschöpf, wie man sagt, dem Anlass entsprechend ernst und gefasst.
Links die Großmutter mit ihrem breiten, böhmischen Gesicht, das bereits vom Alter und von zu fettem Essen deformiert ist. Eindringlich, ja herrisch der Blick der dunklen Augen, die, wie ich doch weiß, voll Güte warm erstrahlen, im Zorn heiß funkeln können. Frontal und repräsentativ steht Großmutter da. Was repräsentiert sie? Den Stolz und die Würde eines Menschen, der sich nicht hat unterkriegen lassen. Solche Leute werden nicht einmal vom Tod besiegt. Sie sterben, aber was zählt das?
Arbeitslosigkeit. Einmarsch deutscher Truppen. Hitler. Da die Familie die Nazis ablehnt, ihnen zumindest tief skeptisch gegenübersteht, versucht sie, einfach weiterzumachen. Großmutter geht jeden Tag zur Kirche. Der Armenarzt, ein Jude, verschwindet. Eine Nachbarin, die nur gebrochen Deutsch spricht, ermahnt Großmutter, doch richtig zu grüßen. Man hört von der Arbeit, die Hitler schaffen will. Na, bitte sehr!
Was für gewöhnlich Geschichte heißt, solche Leute betrifft das wie Flusswasser die Kiesel.
Mutter erzählt später vom Einzug Hitlers in Wien, wie er, bei Kaiserwetter, mit dem schweren Horchwagen, in Uniform und mit erhobenem Arm die Mariahilfer Straße hinunterfuhr unter Jubelgeschrei: Mutters Bericht klang so, als wäre sie zwar dabeigewesen, aber nicht als Betroffene, sondern als bloß Dazugekommene, wie eine Zuschauerin im Theater, im Zirkus. Es gibt aber, wie sich bald zeigen sollte, in solchem Fall kein bloßes Zuschauen.
Mutter wird zum Arbeitsdienst in die Steiermark eingezogen. Die RAD-Kotzen sollte ich später in diversen Ferienheimen noch kennenlernen. Als die Kriegslage prekärer wird, teilt man Mutter einer Scheinwerferbatterie zu: Mit dem Lichtkegel ihres Scheinwerfers soll sie feindliche Flugzeuge am Nachthimmel aufspüren und so zum Abschuss präsentieren.
Die Flaktürme in Wien stehen immer noch. Allerhand Institutionen haben sich darin eingenistet, in der Hauptsache aber Tauben. Spaziere ich heute an einem der Türme vorbei und höre das Gurren der Tauben, fällt mir meine Mutter ein.
Ich erinnere mich an andeutende Schilderungen von Eskapaden und Schikanen diverser Arbeitsdienstführerinnen. Die Berichte über den Dienst waren grundiert von einer Mischung aus Kameraderie, ja, von Freundschaft, von lauernder Gewalt, vom Mief einer lieblosen, alles durchdringenden Sexualität. Ein schlecht geheizter Stall, ein Stall immerhin.
Die Russen kommen. Mit einer abschließenden Aufklärung über die Bestialität der russischen Untermenschen werden die Mädchen entlassen, sie sollen nun zusehen, wie sie auf eigene Faust und ungeschoren nach Hause kommen.
Der Rückweg nach Wien ist Mutter versperrt. Mit einer Freundin weicht sie in weitem Bogen durch die verschneiten Voralpen aus. Im Flachland ist der Frühling schon da und die Bäche springen. Hier, zwischen den Bergen, ist noch Winter, die vereiste Straße schlängelt sich zwischen Felsen fort.
Was zwingt mich denn, einen reinen und klaren Himmel über diese allmählich auftauende Landschaft zu spannen, einen österlichen Himmel sozusagen, einen Himmel, der voller Verheißung ist?
Über St. Pölten und Linz geht es weiter nach Salzburg, immer vor der näherrückenden Front her, teils per Anhalter, teils mit Zügen, die immer nur kurze Strecken fahren, teils zu Fuß. Nach Westen! Ist Mutter bloß vor den Russen geflohen, von der Propaganda und anderen Gräuelgeschichten verängstigt, oder hat sie, ihrer Natur nach, auch Hoffnungen gehegt?
Wahrscheinlich ist sie mit abgerissenen Landsern, mit halbverhungerten Häftlingen und schwer bepackten Zivilisten, die zum Teil wohl guten Grund zur Flucht hatten, auf der Plattform von Lastwagen gestanden, in Zugabteilen ohne Fenster gesessen, hat auf Bahnhöfen gewartet, die man bloß an den zwischen Schuttbergen durchlaufenden Geleisen noch als solche erkennen konnte. Der Vorgang der Flucht, einmal angestoßen, lief ab. Auf Umwegen erreichte Mutter mit ihrer Freundin zuletzt deren Heimatstadt Klagenfurt.