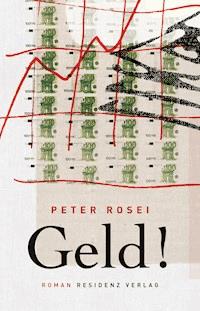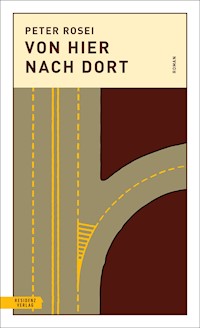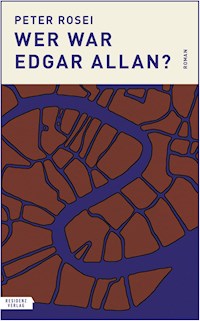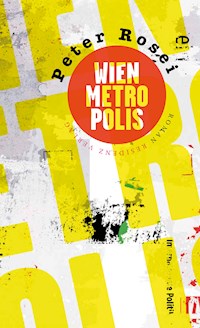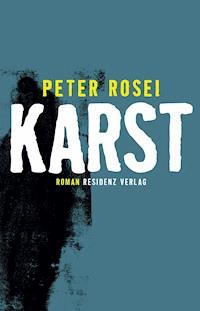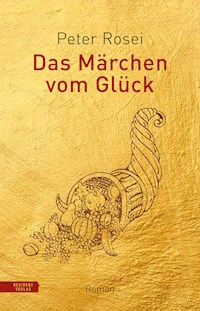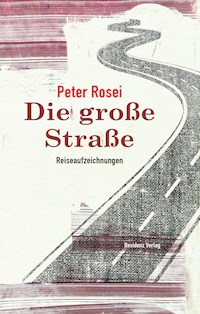
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Peter Rosei ist immer in Bewegung gewesen, geleitet von einer unerschöpflichen Neugierde auf Landschaften und Städte, auf Menschen und ihre Geschichten. "Die große Straße" versammelt erstmals seine Aufzeichnungen aus fünf Jahrzehnten und drei Kontinenten. Wir lernen Peter Rosei als Reisenden kennen, der nicht nur scharf beobachtet und viel weiß, sondern sich auch durchlässig macht für Eindrücke und Bilder, für Gerüche und Klänge, der sich dem Fremden geduldig annähert und ihm dennoch seine Faszination belässt. Von Peking nach Los Alamos, von Seoul nach Kiew, von Paris über Bratislava nach Texas und Istanbul führt uns dieses wunderbar labyrinthische Buch, das erfüllt ist von der Dankbarkeit des Autors für die Buntheit der Welt und die Vielfalt des menschlichen (Über)lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Rosei
Die großeStraße
Reiseaufzeichnungen
Wir danken für die Unterstützung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2019 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Thomas Kussin/Buero 8
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Jessica Beer
ISBN ePub:
978 3 7017 4620 0
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 1717 0
Inhalt
Vorbemerkung
Weiter, Weiter
China zu verstehen (2012)
Beijing (1978) – SK
Metropolis (1978) – SO
Kambodscha (2013 / 14)
Indien (2010)
Noch einmal Indien (2012)
Ägypten (2009)
Anmerkungen anlässlich einer Japan-Reise (1997) – SO
Briefe aus Japan (Frühjahr 2003)
Ein Brief von unterwegs (2003)
Taveuni (Sommer / Herbst 2003)
Über Fidschi (2003)
Detour (Herbst 2003)
Seoul – Bangkok (1998 / 1999) – SO
Über Sri Lanka (2018)
The Americas
Guatemala (1992) – SO
Kanada Bric-à-Brac (1986 und 1990) – KC
Ein paar Worte über New Mexico (1997) – SO
Vom Leben in Middle America (1996) – SO
Briefe aus Amerika (2006)
Wieder Amerika (2016)
Die große Straße (2011)
Europa
Paris (1999) – SO
Nach Istanbul (1981) – KC
Auf Kreta (2000) – D
In den Alpen (1980) – KC
Couchette (1989) – KC
Budapest (1981) – KC
Prag (1984) – KC
Prag II (1995) – SO
Bratislava (1992) – SO
Triest (1985) – KC
Die Straße nach Lendava (1987) – KC
Albanien / Fragment (1988)
Transsylvanien (1995) – D
In Helsinki (1983) – KC
Westberlin-Arbeit (1986) – KC
Zürich (1997) – SO
Raving London (1994) – KC
London / Diary (1998) – SO
Reise nach Italien (1992) – SO
Reise nach Holland (1996) – SO
Russlandzettel (1987) – KC
Eine Zeit in St. Petersburg / Fragment (1996) – SO
Russland (2007) – D
Noch einmal Russland (2015)
Venedig (2012)
Noch einmal Amsterdam (2013)
Reise ohne Ende
Amsterdam (1978) – SK
Hamburg (1976) – SK
Zürich (1972) – SK
Berlin (1982) – SK
Salzburg (1977) – SK
Warschau (1973) – SK
Wien (1977) – SK
Venedig (1979) – SK
Quellenangaben
Vorbemerkung
Nicht jede Reise, die ich je unternommen habe, habe ich auch dokumentiert. Ich bin viel mehr herumgekommen. Vielfach habe ich keine Aufzeichnungen gemacht, aus welchen Gründen auch immer.
Die sich aufdrängende Organisation der Texte an der Zeitlinie entlang kam mir bald nichtssagend vor, weil letztlich zufällig. Weshalb fährt man erst dorthin und dann dahin? Ich weiß es nicht. Es ergibt sich. Also habe ich versucht, die Texte einer inneren Notwendigkeit nach anzuordnen, um so besser herauszubringen, was sie eigentlich ausmacht und verbindet.
Nebenbei ist hier zu sehen, wie einer wurde, was er ist; zugleich aber, wie einer blieb, was er war – eine Art von Lebensgeschichte, in Form eines Logbuchs.
Der erste Teil besteht im Großen und Ganzen aus Aufzeichnungen aus den letzten Jahren, Reisen, die vielfach nach Asien führten, mit ein paar Einsprengseln von früher: Ich habe ihn mit Weiter, Weiter übertitelt. Folgt ein amerikanischer Block, aus unterschiedlichen Zeiten datierend: The Americas. Folgt Europa, Reisen der achtziger und neunziger Jahre, die vielfach Bildungsreisen waren, mehr oder weniger nach Destinationen angeordnet. Zuletzt das Material aus den Siebzigern, das ich seinerzeit unter dem vielleicht gar nicht so illusorischen Titel Reise ohne Ende veröffentlicht hatte.
Etliche Texte habe ich ausgeschieden, einige wenige unwesentlich verändert, die große Zahl nahm ich unverändert auf.
Die Dankbarkeit, die mich während der Arbeit an der Sammlung gelegentlich überfiel, war so real und wahrhaftig, wie ich wahrhaftig nicht weiß, an wen sie sich richtete – sie war einfach da.
Weiter, Weiter
China zu verstehen (2012)
Ironischer-, aber vielleicht auch passenderweise habe ich während meiner dreiwöchigen Reise das alte, das ewige, das ländliche China nur zwei Mal zu Gesicht bekommen, einmal durch das Fenster eines Hochgeschwindigkeitszuges von Chengdu nach Chongqing, das zweite Mal aus dem Fenster eines Flugzeuges von Xi’an nach Beijing: tiefgrün und feucht das Land im Süden, regelrecht prangend, eher trocken, braun und von einer Art Sparsamkeit geprägt im Norden. Sehr gebirgig alles. (Eine dieser Seltsamkeiten: China hab’ ich mir immer als große Ebene vorgestellt.) Wie ein Garten das Land, so weit man schauen kann, fein unterteilt in nahtlos aneinandergefügte Felder und Beete, das Gelände terrassiert und gegliedert, wo immer es notwendig ist, bis in höchste Höhen hinauf: So entsteht der Eindruck einer zweiten Natur, die sich die erste und gegebene vollkommen anverwandelt hat.
Stellen Sie sich etwa hundert Meter hohe Gebäude vor, dreißig, vierzig Stockwerke hoch, keine Türme allerdings, sondern zwei-, dreihundert Meter breit und wallartig aufragend. Platzieren Sie diese Blöcke, voneinander getrennt jeweils durch Grünflächen, auf ebenem Terrain, so weit die Sicht reicht. Sind Sie am Horizont angekommen, stellen Sie weitere Gebäude derselben Art wieder bis zum Horizont auf und immer so fort. Gliedern Sie das so entstandene Revier durch sechsbahnige Straßen, flankiert von Nebenfahrbahnen, legen Sie einen Schachbrettraster an. Komplettieren Sie das Ganze mit Hochbahnen oder zusätzlichen Autobahnen auf Stelzen: Interchanges, Thruway, Expressway, Highway – Straßen, die zwischen den Blocks gleichsam in die Unendlichkeit führen.
Baudrillard hat Los Angeles als die horizontale Stadt schlechthin beschrieben. Es stimmt schon: Schaut man von den Hills gegen Süden, dehnt sich die Stadt, dehnt und dehnt sich aus, in ihrer Hauptmasse, Downtown abgerechnet, besteht sie aus ein- oder zweistöckigen Häusern. Wer kennt nicht das Bild des nächtlichen Los Angeles, wenn die Boulevards wie Perlenschnüre in der Finsternis glitzern, die Vergnügungsmeilen wie giftig entzündete Herde schillernd sich abheben.
In der chinesischen Metropole ist der urbane Traum zu Ende gedacht: Gleichsam ohne Anfang und Ende, gleichförmig – manche nennen es gesichtslos – und auffällig unfremd präsentiert sich die Stadt, da und dort zu Einkaufsmeilen oder Geschäftsclustern verdichtet: Otto Wagner mit seinen Plänen für die endlose Großstadt hätte hier seine Freude.
Gleich am ersten Abend in Shanghai werfe ich mich ins Getümmel, unter einer Hochbahn durch, an den Straßen entlang Stände, wo ausgekocht wird, Fleischspieße, Omeletten, Suppendunst, in halber Dunkelheit, schwankende Lampen, diesig dunkle, smoggesättigte Luft, der Verkehr tobt, die Passanten kaufen von am Boden ausgebreiteten Planen Zwiebeln oder Lauch, direkt vom Bauern, an den Gehsteigrändern, im Schatten der Wohntürme, möchte ich sagen, sitzen Männer beim Schach, beim Mah-Jongg, oder sie spielen Karten, geradeso, als wäre da ein beschaulicher Dorfplatz und nicht die wild dahintosende Stadt.
New York wirkt im Vergleich dazu wie Historyland, eine Art gepflegter Puppenküche, Chicago wie ein stromlinienförmiges, blankpoliertes Maschinenteil, Detroit wie ein verwahrloster Schrebergarten – und Wien? Das lässt sich eben nicht sagen.
Die chinesische Metropole ist inkommensurabel. Mit europäischen Verhältnissen hat das nichts gemeinsam. Keine Referenzgrößen. Du musst dir eine neue Sprache erfinden, willst du das in den Griff bekommen. Der Umschlag von der Quantität in die Qualität, hier wird er vorgeführt: Macht eine Million Menschen das Gleiche wie, sagen wir, hunderttausend, wird etwas ganz anderes daraus.
Alle Städte, die ich in China besuchte, haben zumindest so viele Einwohner wie ganz Österreich insgesamt, manche ein Mehrfaches.
»Ja, als Kind habe ich gelegentlich die Sterne gesehen«, sagt einer meiner Begleiter während einer Nachtfahrt zu mir. Tagsüber scheint die Sonne, sichtbar als helle Blesse im grauen, bald silbrig glitzernden, bald hastig in Schwaden oder Fetzen vorüberjagenden Dunst. Wie Unterseeboote in einem wellenlosen Meer stehen die Hochbauten da, ahnungsvoll und düster.
Als ich wieder einmal mit einem dieser Taxifahrer die Stadt durchquere – mittlerweile sind mir alle Städte in der Vorstellung zu einer einzigen Superstadt verschmolzen –, wünsche ich mir, er möge doch noch schneller, noch irrer und rücksichtsloser fahren, ich würde dann endlich ans Ziel kommen – an irgendein Ziel.
Wer weiß, gibt es den Dichter schon, der das Schicksal der Millionen Wanderarbeiter beschreibt, die die Gebäude errichtet haben. Hoch oben bei den Wolken arbeiten sie. In der chinesischen Kunst spielen Wolken eine hervorragende Rolle. Dort oben wohnt der mythische Drache. Der Riesenvogel Rokh wird sich einmal erheben und seine Flügel ausspannen und dann …
Wenn der Architekt Wang Shu, der Pritzker-Preisträger, in einem Interview über seine Landsleute anmerkt: »I hope they will realize that our country cannot develop at the cost of destroying our history«, ist da was Wahres dran. (In chinesischen Städten findet sich kaum eine Altstadt.) Wie allerdings Wohnraum für Millionen und Abermillionen von Menschen in so kurzer Zeit sonst hätte geschaffen werden können, ist eine andere Frage.
Es ist doch auch chinesisches Leben, wenn eine Großmutter ihr Enkelkind aus der Flasche füttert, irgendwo im Trubel einer Metrostation, der Menschenstrom zieht im Glanz von Stahl, Neon und Marmor vorbei, wenn die Einwohner abends aus ihren Blocks heraustreten, mit vor der Brust verschränkten Armen dastehen, Bier aus der Flasche trinken und sich über ihre Angelegenheiten unterhalten.
Viele beklagen das Rücksichtslose einer nur aufs Geldverdienen abgestellten Gesellschaft. Hier ist einer nur Mensch, wenn er Geld hat, sagt man voll Bitterkeit zu mir. Richtig: Das erinnert mich an Europa und an den Rest der Welt.
Die Liste der Probleme ist lang: Sozialer Gegensatz zwischen Stadt und Land, Minoritäten und fremde Nationalitäten, Menschenrechte, Demokratisierung, beschädigte Umwelt. Ich traue es den Chinesen zu, diese Probleme in den Griff zu bekommen – oder hoffe ich es nur? Engagiert in die Transformation von der Agrar- zur Industriegesellschaft, in einer Bewegung begriffen, die kein Zurück erlaubt: Wie oft hat dieses Volk sich selbst aufs Neue erfunden? Vom Tiger abzusteigen ist bekanntlich schwer. Wer wüsste das besser als die Chinesen? Wer will den Prozess, der da abläuft, auch restlos durchschauen? Es kann bloß gelingen, einzelne Fakten oder Strukturen herauszugreifen, sie zu analysieren und zu versuchen, sie mit anderen in einen nachvollziehbaren Zusammenhang zu bringen: Die Verhältnisse nicht von außen zu denken und also Ratschläge zu erteilen, sondern von innen her begreifen und also Notwendigkeiten erkennen.
Allerorten in China hört man von Finanzjongleuren, von Spekulanten, von Korruption. Schlägt man China Daily auf: Schon platzt einem der Aufmacher über einen dingfest gemachten Großschieber entgegen. Ist Österreich jetzt am vierten oder am sechsten Platz im internationalen Korruptions-Ranking? Ein Spitzenplatz, immerhin.
Auf den Straßen der Megastädte wird dir schlagartig klar – du hast es gewusst, aber offenbar nicht verinnerlicht –, wie weit die globale Vernetzung schon fortgeschritten ist, wie abhängig wir voneinander geworden sind. In Peking oder Shanghai etwa fahren Millionen von europäischen Autos, hier fährt das Produkt unserer Arbeit, denkst du und dann: Wo gäbe es denn Arbeit, hätten wir nicht diese Kunden? Natürlich gilt das auch umgekehrt. Für die Europäer ist es von höchstem Interesse, dass das chinesische Experiment gelingt, wie es andererseits den Chinesen nicht gleichgültig sein kann, ob wir Europäer mit unseren Wohlfahrtsstaaten auf Kurs bleiben oder pleitemachen.
Bild einer großen Schleife, die die Menschheit zu gehen hat, fort und fort.
Verwechsle deine Euphorien nicht mit den Realitäten! Wenn du etwa vom Platz des Volkes kommend die Nanjing-Straße hinuntergehst, zwischen kulissenhaft aufragenden Wolkenkratzern, Shopping Malls allesamt, und du trittst aus dem Lärm der Leuchtschriften und Glitzerfassaden auf den Bund hinaus, den großartig geschwungenen Kai, mächtig biegt sich der ruhig strömende Fluss her, Schiffe und Lastkähne darauf, schnell gleiten sie bergab und schwerfällig streben sie flussauf, drüben die fantastischen Türme von Pudong, ein technisches Märchenland, es erregt dich, ob du willst oder nicht, auch wenn dir aus dem bestürzend beglückenden Augenschein auch schon die Fragen entgegenpurzeln, jene Fragen, auf die du keine richtige und also beruhigende Antwort weißt.
Da ist eine Aporie, nicht zu übersehen.
Kann man etwas finden, von dem man nicht weiß, was es ist? O doch! Wie viel in unserem Schicksal ist nicht gerade darauf gestellt? Wie viel Mut es immer braucht, wie viel Kraft, Lebendigkeit und Glück. Oder folgt doch nur ein Dilemma auf das andere?
»Lernen und das Gelernte bei Gelegenheit wiederholen – ist das nicht auch eine Freude?«, sagt Konfuzius. Man muss immer weiter lernen, auch wenn die Freude gelegentlich bitter schmeckt.
In Chengdu besuche ich die Hütte des Du Fu, meines Lieblingsdichters. Ein Garten zwischen Wolkenkratzern, darin die natürlich bloß nachgebaute Hütte. Du Fu hat im 8. Jahrhundert gelebt, in der zu Ende gehenden Tang-Zeit. Li Bai schreibt ihm zum Abschied in seinem Gedicht: »Wie Wen, der Fluss, denk ich an dich / südwärts rollen endlos seine Wellen«, und in einem zweiten: »Fort gehst du wie der Disteln Flaum fliegt / füllen wir unsere Gläser, leeren wir sie.« Du Fu schreibt ihm: »Wasser so tief, Wellen so weit, wo du bist. / Mögen die Drachen, die gehörnten Drachen, dir kein Leid antun.« – Schwere Zeiten damals, als das Tang-Reich zerfiel, eine Ära zu Ende war.
In Xi’an gehe ich unter den Bögen der Stadtmauer durch, geradewegs zum Glockenturm, der aus der Zeit stammt, als Xi’an noch Chang’an hieß und Hauptstadt eines Weltreichs war. Meine beiden Dichter haben hier gelebt. Bei Starbucks nehme ich einen Kaffee, schaue die Zeile der Läden entlang: Prada, Gucci, Tommy Hilfiger, Vuitton, Chanel … Hinten der Turm der Trommler, die islamische Vorstadt mit Suppenküchen, Ramsch und Früchten, mittendrin die alte Moschee mit ihren mächtigen Mauern.
»Wer nicht in Xi’an war, war nicht in China.« Gilt das noch? Ich weiß nicht. Auffällig jedenfalls ist die Idee von der Mitte, die Idee von der Mitte der Mitte: Weltmittelpunkt! Dementsprechend ist die alte Stadtmauer auch nicht rund, sondern als Rechteck angelegt. Hier begann die Seidenstraße. Durch die Wüsten und Bergwüsten zogen die Karawanen westwärts, nach dem Vorderen Orient, nach Europa. Im Übrigen muss man sich verdeutlichen, dass gut die Hälfte des heutigen chinesischen Territoriums dünn besiedelt und wenig fruchtbar ist: Die Millionen drängen sich im Rest des Landes.
Die Studenten, denen ich vortrage, verstehen mich, wenn ich sage: »Alles, was ich möchte, ist, mich klar und deutlich ausdrücken.« Sie fragen mich nämlich: »Was ist denn deine Wahrheit?« Sie verstehen auch, wenn ich darauf antworte: »Ich bin kein Felsen, ich bin ein Fluss.«
An den Eliteuniversitäten, wir unterhalten uns auf Deutsch, auf Englisch, ist das Niveau sehr hoch. Den Standard der chinesischen Studenten kenne ich aus den USA, es gibt dort viele von ihnen. Als Gedankenexperiment schlage ich im Workshop die Frage vor, wie denn etwa ein Roman über Beijing zu schreiben wäre. Nicht nur Sprachkenntnisse kann ich dabei voraussetzen, sondern auch ein Wissen, das etwa Wittgenstein oder Keynes oder Lévi-Strauss selbstverständlich einbegreift. Vortrag und Debatte machen da freilich Spaß, frei und offen gehen Rede und Gegenrede hin und her. Nachts im Hotel, vor dem Fernseher, erinnern gelegentlich eingeschobene Schwarzkader daran, dass es hier auch ganz anders zugehen kann.
So weit ich verstanden habe, stellt die Kommunistische Partei Chinas eine Art Parallelwelt dar, einen aus dem Hintergrund wirkenden Apparat. Wer sich nicht direkt mit ihm anlegt, merkt wenig davon. Wer sich allerdings anlegt … Die Alltagsgesellschaft sieht sich weitgehend unbehelligt. Ein auf Erfolg und Konsum abgestelltes System hat sich etabliert, eine Ellbogengesellschaft, in der es für die meisten nur ein Ziel gibt: Nach oben zu kommen und oben zu bleiben. Kommt uns das nicht bekannt vor?
Shanghai, Qingdao, Chengdu, Chongqing, Xi’an, Beijing: Ich kehre zu den City Territories zurück. Vergleichsweise wenig Kriminalität hier, kaum Bettler und schon gar keine Junkies. Manchmal geht noch ein alter Mann im Mao-Look oder im Uniformrock der Volksarmee vorüber. Tänzer und Tai-Chi-Gruppen in jedem Park. Martial Arts und Jogging. Lastträger, die schwer beladene Körbe tragen, die von einer über den Rücken gelegten Stange herunterhängen. Schuhputzer. Gedränge überall. Gepäckkontrollen in der U-Bahn. Überhaupt der Hang, alles mehrfach zu kontrollieren, vorgewiesene Papiere abzustempeln und noch einmal abzustempeln. Bürokratische Neigung, wie ich sie etwa auch aus Japan kenne. Manchmal der Eindruck von Arbeitsplatzbeschaffung, diese personelle Überbesetzung erinnert an die frühere Sowjetunion. Die jungen Leute in Jeans und Minirock, auf Stöckelschuhen die Mädchen, je nach Stadtgegend teuer oder billig aufgemacht. Alle scheinen diesem Glück nachzustreben oder nachzulaufen, das ich so gut kenne und von dem ich so wenig halte.
»Erwäge alles drei Mal, dann handle!«, sagt Konfuzius.
Es ist so viel leichter, ein Inferno zu schreiben als ein Paradiso, meinte Ezra Pound. Gerade um Letzteres wollen wir uns bemühen.
Beijing (1978)
Stelle ich Überlegungen zu einem Text über Beijing an, ist da zuerst der graugrüne oder hellgraue Platz des Himmlischen Friedens im sanftgrünen Regengrau meiner Vorstellungen, durch die kleine Radfahrer mit Pelerinen auf ihren militärgrünen Fahrrädern fahren.
Erst ist da immer ein heller, leuchtender Nebelplanet in der weiten Raumstille, langsam kreiselnd, deutlicher werdend, mit Strukturen, die an Bambusschösslinge erinnern oder an jene Blumen, die man essen kann.
Nicht dass ich China kennte, o nein, ich bin ja bloß der rote Seidenvogel, der auf seinen Flügeln diese Tuschezeichen trägt: Ich lebe noch.
Zwar gehöre ich einer aufstrebenden Klasse an, aber ich bin frei von Illusionen und besitze nicht die Fähigkeit zur Selbsttäuschung. Ich weiß also, wie es um uns bestellt ist, dass es mit uns schon vorbei war, noch ehe wir anfingen, an die Macht zu kommen. Wir sind, und das kann in Anbetracht unserer Jugendlichkeit kein Trost sein, Geschichte.
Ich saß in diesen Bars in den Vorstädten, und ich sah die Leute dort, und ich hörte, was sie redeten, und ich fühlte mich nicht so gut.
There is only one purpose in hand-to-hand combat, and that is to kill. Never face an enemy with the idea of knocking him out. The chances are extremely good that he will kill you.
Denke ich zurück, denke ich an Demütigungen. Man verabsäumte es nie, mir zu zeigen, wie machtlos ich war.
Ich las von Menschen, die für zwei Dollar am Tag dreizehn Stunden lang arbeiten müssen. Nachts stellen sie sich vor den Molkereien an, um morgens billige Milch zu bekommen. Wir möchten wissen, fragen sie, ob die Regierung auf unserer Seite ist oder auf der Seite derer, die uns ausbeuten. Diese Frage ist rhetorisch. Es gibt keine Regierung, die nicht auf der Seite der Ausbeuter stehen würde.
Man muss den Ausgebeuteten dienen, um nicht selbst Ausbeuter zu sein. Man muss die Menschen lieben und danach handeln.
Ich saß in diesen Bars in den Vorstädten, und ich sah die Leute dort, und ich hörte, was sie redeten, und ich fühlte mich nicht so gut.
Generally speaking, the side or heel of the boot is a better weapon than the toe, as it tends to slide off the object it is attacking.
Denke ich, denke ich, dass das Denken immer unerträglicher wird, im Angesicht dessen, was zu tun wäre.
In dieser Serie von Mao-Porträts, die Warhol nach dem offiziellen Foto verfertigt hat, lächelt der Große Vorsitzende sein Lächeln. Er lächelt und lächelt. Andy hat das sehr gut begriffen.
Erst ist da immer das finstere Vorhaus, und dann das gewundene, mit Pfeifenton geweißelte Stiegenhaus, und dann die Wohnung mit der schlecht schließenden Tür, hinter der ich aufwuchs und hinter der ich gewartet habe.
Nicht dass ich aufbegehrt hätte, o nein, ich bin ja bloß einer von den Hunden, die man losließ mit dem Zuruf: Siege!
Zwar gehöre ich einer aufstrebenden Klasse an, aber ich bin frei von Illusionen und besitze nicht die Fähigkeit zur Selbsttäuschung. Ich weiß also, wie es um uns bestellt ist, dass wir, weil nur mit umfassendem Neid ausgestattet, zur Veränderung nicht imstande sind. Was aus uns werden wird, wenn denn etwas werden wird, steht fest: Herren, nichts anderes.
Ich saß in diesen Bars in den Vorstädten, und ich sah die Leute dort, und ich hörte, was sie redeten, und ich fühlte mich nicht so gut.
The heart is another fatal spot to be considered in your attack, but it should be noted that the heart is well protected by the rib cage and is pretty hard to hit.
Als Antonioni seinen Film über China abgedreht hatte, warfen ihm die Chinesen vor, dass er, weil er selbst einer sterbenden Klasse angehöre, deren fatale Sicht auf die neue chinesische Gesellschaft angewandt habe. Antonioni hat das sehr gut gemacht, sein Film ist tatsächlich ein Dokument.
Denke ich an das, was zu tun wäre, denke ich an meine Unfähigkeit, das zu tun, was zu tun wäre.
Man muss den Ausgebeuteten dienen, um nicht selbst Ausbeuter zu werden. Man muss die Menschen lieben und danach handeln.
The throat is one of the most vulnerable spots in the body and should be treated as such, las ich in dem Handbuch, das ich hier im Text mehrfach zitiert habe. Ich las und las.
Denke ich an das, was kommen wird, denke ich an das, was ist. Denke ich, denke ich, dass das Denken immer unbrauchbarer wird, dieses ununterbrochene Denken.
Überprüfe ich den Text über Beijing, sehe ich, dass er mit Beijing nichts zu tun hat. Um nicht über das schreiben zu müssen, was mit Beijing so gar nichts zu tun hat, stelle ich mir den graugrünen oder hellgrauen Platz des Himmlischen Friedens vor und lasse kleine Radfahrer mit Pelerinen auf ihren militärgrünen Fahrrädern durch das sanftgrüne Regengrau meiner Vorstellung radeln: Da radeln sie.
Metropolis (1978)
Ich schreibe dieses in Bern, wohin ich aus Zürich kam. Morgen gehe ich nach Holland und dann weiter, nach woanders, und dann wer weiß wohin.
Es ist schön, aus dem Leben in den Tod zu gehen, ohne das zu beabsichtigen, einfach so frank und liederlich.
Ja, wie denn anders? Es ist mir allerdings gleichgültig, wo ich meine Sache betreibe, wenn ich nur erfahren kann, was mein Auftrag denn ist, diese Frage zu lösen.
Manchmal denke ich an die Städte des Sant’ Elia. Dort sich aufzuhalten, im Aluminiumzug durch Röhrensysteme zu rasen, mit Expressliften zum Himmel zu fliegen, das könnte mir gefallen. Ich stelle mir die überdachten Straßen mit der leise brausenden Luft aus Turbinen ganz menschenlos vor im ewigen Frühling. Ich werfe Münzen ein, drücke Knöpfe, reguliere. Das tue ich, sonst nichts. Manchmal leiste ich mir den Luxus, mit einem TV-Adapter zu sprechen: Ich spreche mit mir selbst.
Stehe ich in einer nächtlich leeren Automatenstraße, bin ich so weit. Ich sehe Ginflaschen, Snacks und Damenbinden und Nylons. In der Tasche spiele ich mit den Münzen. War das in dem Film Zabriskie Point, wo die Märchenvilla des Managers immer wieder in Flammen explodierte und sich, zur Musik von Pink Floyd, alles in Nichts auflöste?
Mein Platz ist in Städten, die auf die eine oder andere Weise korrumpiert und verloren sind. In brennenden Kaufhauspalästen einzukaufen, das stelle ich mir zum Beispiel schön vor. Oder in U-Bahnen zu fahren, wo Mörder unterwegs sind, wo Irre sich der Steuerungsmechanismen bedient haben.
Versteht man mich? Ich liebe Städte wie Tokyo oder Los Angeles, die so recht die Zukunft der Stadt aufzeigen. An ihnen demonstriert das System seine Vorzüge: Kälte, Glamour und Entfremdung.
Anderswo belügt man sich und wird belogen. Es ist die Rekonstruktion eines Lebens, das längst vorbei ist. Es ist das Vortäuschen von Verhältnissen, die aufgehört haben, zu bestehen. Es ist ein Als-ob. Diese Menschen sind voller Angst. Ich will leben.
Was ist meine Ausrüstung?
Ich habe eine Hose, einen Rock, ein Hemd, ein Paar Schuhe. Mit ihnen gehe ich durch Metropolis. Meine Augen sind geöffnet.
Kambodscha (2013 / 14)
Nach Absolvierung des touristischen Pflichtprogramms – Königspalast, Silber-Pagode, Nationalmuseum – gehen wir vom Wat Phnom, dem von einer Pagode gekrönten Stadthügel, zum Freiheitspark hinüber. Meine Frau hat am Hügel oben einen Singvogel freigekauft, da fliegt er – angeblich verschafft einem das die sofortige Vergebung aller Sünden. Seit Wochen ist der Freiheitspark jetzt Zentrum der Proteste gegen die Regierung. Gleichzeitig ist er Versammlungsort der für höhere Löhne streikenden Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter. Man hat mir die Lage so erklärt: Aus Kostengründen haben die Fabrikbetreiber, zumeist Amerikaner, Chinesen und Koreaner, auf möglichst kleiner Fläche möglichst viele Arbeitsplätze eingerichtet – dementsprechend sind die Arbeitsbedingungen. Der monatliche Mindestlohn liegt bei achtzig Dollar, davon kann man auch in Kambodscha nicht leben.
Man wird davor gewarnt, politische Versammlungen zu besuchen, Demonstrationszüge soll man meiden. Der Freiheitspark ist eigentlich ein großer, langgestreckter Platz, von kümmerlichen Baumreihen eingefasst. Als wir ankommen, es ist früher Abend, sehr heiß noch, steht dort eine tausendköpfige Menge und hört den Reden von Anführern zu, die man weit, weit vorn auf einer Tribüne sehen kann. Die Stimmung ist aufgeheizt, immer wieder schwenken die Leute ihre mitgebrachten Fahnen oder sie heben zustimmend die geballten Fäuste. Ich kann mir nicht helfen: Der Eifer, die Wut, die kaum verhüllte Hoffnung, all das springt auf mich über. Es zieht mich hinein in die Menge, immer tiefer hinein, ich weiß nicht … Erst als meine Begleiter sich weigern weiterzugehen, kehre ich um.
M. ist Beamtin, knapp an die sechzig, klein und zierlich, große, dunkle Augen, ein schwarzer Zopf, geht wie ein Kind neben mir her, ganz verfangen in die schrecklichen Bilder, die ihr beim Erzählen aufsteigen. Sie spricht stockend, sucht nach Worten, nicht radebrechend: »Nachts kommen die amerikanischen B 52-Bomber herein. Erst werden ›Christbäume‹ geworfen, die alles taghell erleuchten. Wir sind im Erdbunker. Dann die Kanister – auf die geschossen wird. Jetzt läuft das brennende Öl herunter. Meine kleine Nichte wird ganz verbrannt, stirbt – keiner kann ihr helfen.« (Auf Kambodscha, lese ich später, wurden während des Vietnamkriegs ohne Kriegserklärung mehr Bomben abgeworfen als auf Japan während des ganzen Zweiten Weltkriegs.) »Als die Khmer Rouge in Phnom Penh einmarschieren – die Leute jubeln! Die Kinder sind ihnen entgegengelaufen. Man hat mich in den Dschungel geschickt, zu Rodungsarbeiten. Wir alle mussten gehen. Viele sterben. Nachts schlafen wir in den Bäumen, hoch oben, wegen der Tiger. Kam einer in die Nähe, schlugen wir mit Stöcken und Pfannen gegeneinander, bis er weglief.« M. erzählt, wie ich merke, sie erzählt gar nicht mir, ich bin nur Zeuge oder Vorwand – es muss heraus, alles will sie sagen: »Unsere Regierung ist schlecht. Unsere Regierung bestiehlt uns. Sie verkaufen den Wald, die Diamanten – sie verkaufen alles.«
Kokospalmen, Mangobäume, Papayas, Ananas, Gemüse, Gewürze, Palmöl, vor allem aber Reis: Die zentralkambodschanische Ebene ist sehr fruchtbar. Schaut man von den Hügeln von Oudong, ehemals stand dort der Königspalast, auf die Ebene hinunter – sie greift weiter aus, als das Auge reicht, verliert sich draußen im Dunst. Kleine Dörfer, Reisfelder, Reisfelder, Palmen und Buschgruppen.
Auf den Feldern arbeiten Bauern, man sieht kaum Maschinen, dafür diese kegelförmigen Hüte aus Reisstroh, wie man sie aus chinesischen oder japanischen Tuschezeichnungen kennt. Fehlen nur noch die Ochsen und Wasserbüffel – dort drüben weiden sie! Jetzt ist Erntezeit, Trockenzeit. Der Reis wird mit der Sichel geschnitten, die Garben mit Stöcken ausgedroschen. Ochsenkarren. Unterhalb der auf Stelzen stehenden Häuser Arbeitsvorrichtungen, Ställe, Hängematten und Plattformen zum Essen und Wohnen.
Der Morgenverkehr ist heute wie immer sehr lebhaft, deutlich verstärkt allerdings durch mit Fahnen bestückte Tuk-Tuks sowie Kolonnen von Kleinlastern, die man mithilfe von quer über die Ladeflächen gebundenen Brettern in eine Art offener Busse verwandelt hat: Auf den Ladeflächen sitzen, eng gedrängt, meist junge Leute, die zur großen Demonstration unterwegs sind. Es ist Sonntag, arbeitsfrei. Wir winken ihnen vom Gehsteigrand aus spontan zu. Ihr Trotz, ihr Mut, ihre Siegesgewissheit stecken an. Da fällt mir, für einen Augenblick, ein, man könnte uns, als Fremde, als barang, wie sie hier sagen, für Leute von der anderen Seite halten, für Agents provocateurs: Vielleicht halten sie uns für Feinde, fällt mir plötzlich ein. – Aber nein, sie tun es nicht, sie winken freundlich zurück und recken die Fäuste.
Schon in den vergangenen Tagen sind mir Aufläufe aufgefallen, ein irgendwie ratloses Durcheinander an den Fabrikstoren, da und dort von Polizisten beobachtet: Die Menge versuchte die Arbeiterinnen davon abzuhalten, zur Arbeit zu gehen. Streikposten sah ich keine. Die Fabriken: weitläufige, langgestreckte Hallen, stets von hohen Mauern umgeben, die man oben mit Stacheldrahtrollen zusätzlich gesichert hat.
Jetzt geht es die lange und endlos gerade Veng-Seng-Straße hinunter, Richtung Industriezone und Flughafen. Auf den Gehsteigen, vor den Läden mit ihren ausgelegten Waren patrouillieren Militärpolizisten in schwarzen Monturen, mit weißen Helmen, Sturmgewehre vor der Brust. Weiter draußen auch reguläre Truppen in Tarnanzügen, sie kampieren auf den Rasenflächen, stehen müßig herum, die Tuk-Tuks mit den Fahnen, die Kleinlaster mit den jungen Leuten rollen vorbei. Dicke Luft. Ein paar Tage später schießt die Polizei mit scharfer Munition in die Menge, es gibt mehrere Tote.
Wer einmal die Torbauten von Angkor Thom gesehen hat, die aus Stein gehauenen, gottgleich lächelnden Köpfe oder Gesichter, wer über die Schlangenbrücke auf die wuchtige und doch zugleich zarte, filigrane Baumasse von Angkor Wat zugegangen ist, wer von einem der hoch aufragenden Tempel über Urwald, spiegelnde Wasserflächen und das schachbrettförmig gegliederte Bauernland hingeschaut hat, wird es nie vergessen.
Eigentlich bin ich wegen der Tempelanlagen von Angkor nach Kambodscha gereist. Sie begeistern durch ihre Weitläufigkeit und schiere Größe, durch die Feinheit der Ausführung, durch die Strenge des geometrischen Plans der gesamten Anlage, die in denkbar schroffem Kontrast zum Wuchern des umgebenden Dschungels steht. Es ist etwas Märchenhaftes um diese von Alter und Regen dunkel gefärbten, trotz ihrer Wucht feingliedrigen Türme, Treppen, Rampen und Mauern, die sich unversehens aus Dunst und Miasma erheben. Freilich kommt einem bald der Gedanke, dass all diese großartigen Monumente, mögen es die ägyptischen Pyramiden sein, die Tempel von Angkor oder die Wolkenkratzer von NYC, Ausdruck von Gesellschaften sind, die das Leben des Einzelnen einem einzigen Willen unterordnen. Was wäre denn menschliche Architektur, eine dem menschlichen Maß angemessene? Doch wohl ein kleines Haus mit Garten. Das erfüllt die menschlichen Bedürfnisse. Alles andere ist zum Staunen und Träumen da. Staunen und Träumen sind wohl auch menschliche Bedürfnisse.
Mit der beiläufigen Bemerkung unseres Führers, eines jungen Mannes um die dreißig, schwarzhaarig, klein und zart von Wuchs, grundsätzlich sanft und umgänglich wie die meisten Khmer, nimmt alles eine andere Richtung. Er sagt: »Wenn wir nicht leben können, brauchen wir keine Monumente.« Es stellt sich heraus, dass die großen Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft vor allem ein paar Firmen zufließen, die die Lizenzen vom Staat gepachtet haben. Unlängst erst sollte der Transport der Gäste zu und von den Tempeln auf Elektroautos umgestellt werden, zum Schutz der Anlagen. Damit wären die lokalen Tuk-Tuk-Fahrer aus dem Geschäft gewesen. Sie haben sich gewehrt und die Elektroautos angezündet.
Während ich eine der Hauptstraßen in einem der Provinzkaffs hinuntergehe, die Sonne scheint grell auf den überall herumliegenden Müll, auf die immer gleichen Stapel aus Coladosen, Mineralwasserflaschen, aus Crackerpackungen und Kokosnüssen, denke ich plötzlich: Warum muss es nur immer jetzt sein – weshalb kann es nicht später sein, meinetwegen, in hundert, in zweihundert Jahren?
Man könnte sagen, die europäische Geschichte des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts wiederholt sich in Ländern wie Kambodscha. Ob das ein Trost ist?
Indien (2010)
Pilger, die flitterbehangene, im Sonnenlicht gleißende Gestelle auf dem Kopf tragen und die schnurgeraden, schier endlosen Straßen in der Flussebene entlanggehen, zwischen sattgrünen Feldern und im Wind sich bauschenden Bäumen … und dann der Reisende in seinem Station-Car mit den getönten Scheiben, der den Fahrer alle halben Stunden einmal anweist, die A/C einzuschalten, damit sich das Wageninnere angenehm abkühlt.
Durch die Schleife des kaum sich regenden, dunkelfarbigen Flusses, dessen Wasser von unten zu uns heraufstinkt, schwimmt eine Herde von Wasserbüffeln zu einer der spärlich begrünten Sandbänke hinüber. In dem Bild steckt zugleich jene Anmut und Zierlichkeit, wie wir sie von persischen Miniaturen kennen, und das ganze Elend vollständiger Verkommenheit.
Drüben, auf dem anderen Ufer, Verbauung in jedem Stadium der Vollendung, rostige Stahlarmierungen, Verkehrsgebrüll. An den Ufersäumen zierliche Reiher und andere Wasservögel. Knaben, die auf den Buckeln der schwimmenden Büffel sitzen und sie mit um die Hörner gelegten Händen leiten.
Der Straßenverkehr ist in Ermangelung von Untergrundbahnen völlig außer Rand und Band geraten. Autofahrten von einer Stunde und mehr sind innerstädtisch die Regel. (In New Delhi wird jetzt eben eine Metro gebaut, man erwartet die Commonwealth Games. Zur Erinnerung: Delhi hat an die zwanzig Millionen Einwohner.)
Über Indien kann man dieses und jenes sagen: Es wird stets einerseits richtig und zugleich auch wieder falsch sein. Es gibt viele verschiedene »Indien«.
Ich bewundere die arabisch wirkende Schrift des Urdu, die so ordentlich und ein wenig spröd wirkende des Hindi, die verspielte, in sich gerundete des Telugu. In Hyderabad besuche ich die große Moschee, in Delhi einen der Hindu-Tempel, wo ich befremdet vor den so menschlich wirkenden Göttern stehe, bis mir einfällt, dass ja auch in unseren Kirchen Menschen zur Anbetung ausgestellt sind: die »Heiligen«. In Pune stoße ich in einer der von riesigen Banyanbäumen gesäumten Straßen auf einen jüdischen Friedhof: Er sieht, mit den umgesunkenen Grabsteinen und den unkrautüberwucherten Flächen dazwischen, genauso trostlos und verloren aus wie einer bei uns daheim.
Mit den unzähligen Luftwurzeln, die von den Zweigen wie Vorhänge herunterhängen, bildet die gewaltige Krone des Banyanbaumes eine Welt für sich, und man kann sich leicht vorstellen, dass Sadhus früher einmal meditierend ihr ganzes Leben in einer solchen Krone verbracht haben.
Schon auf dem Flughafen in Wien fallen mir Leute auf, die, wie soll ich sagen, die so aussehen, als würden sie sich aufmachen, um in Indien so etwas wie Erleuchtung zu finden. Aber vielleicht will der eine oder andere auch bloß in einem der Ashrams einen Schnellsiederkurs absolvieren, um sich dann, wieder heimgekehrt, als geläutert verkaufen zu können?
Wie man allein dadurch zu etwas Besonderem wird, dass man sich 1000 Kilometer von daheim entfernt.
Rechts und links der achtspurigen Straße gibt es bloß Andeutungen eines Rinnsteins, eines Gehsteiges: Nach dem Regen riesige Lachen, auseinanderfließende Haufen aus aufgeworfener Erde, Abfall, Zeugs: Kühe dazwischen, grasende Ziegen, ein Schwein gar zuoberst auf einem Misthaufen – und Läden, Läden, Läden, die Straße hinunter, kleine Buden, groß beschriftet, Nischen in halbfertigen Betonbauten, Höhlen für Produktion, Kauf und Verkauf – ich schaue in einen Keller hinunter: Dort sitzen fünfzig oder mehr Schneider über ihre Näherei gekrümmt, die Verdammten, die eben jetzt fragend zu mir heraufschauen.
Menschen, in Klumpen um die Verkaufsstände herum, als wandernde Horde an den Straßenrändern entlang – dort hocken ein paar unter schütteren, Schatten spendenden Bäumen, ein Weiser auf einer Holzpritsche, Hunde, immer wieder diese zahmen, freundlichen, indischen Hunde und die Schemen der von mir Weggehenden, Forttrottenden, die festeren Konturen der auf mich Zukommenden: Jetzt male ich mit breiter Bürste Staub und Smog über das Ganze … dabei habe ich die Zelte und die behelfsmäßigen Hütten vergessen, die kilometerlang die Straßen säumen, Ausblicke in Geländemulden, die kleine, in sich abgeschlossene Slums beherbergen, Frauen mit Schalen oder Krügen auf dem Kopf, da und dort ein hoch herausgewachsener Baum, Dächer aus buntem Plastikmaterial und Kinder, immer wieder Kinder, die, hält der Verkehr nur kurz einmal an, akrobatische Kunststücke vorführen – und dann betteln sie.
Atemlosigkeit. Totale Verortung. Alles ist Ort, ein Ort neben dem anderen – und alles ruft: Schau! Schau her!
Unter den Trassen der Stadtautobahnen, den Stelzen der im Bau befindlichen U-Bahn staut es sich kilometerlang, und doch kommen wir voran, vorwärts, auf freies Feld, eine Art Savanne mit schirmförmigen Bäumen: Dann die ersten Hochbauten, Wolkenkratzer mitten in verwahrlostem, von Müll übersätem Gelände: Schon formt sich aus dem Dunst etwas wie eine ferne Stadt, mit Reklametafeln, Shopping Malls, Wohntürmen, kleinere Häuschen dazwischen – Weichbild oder Fata Morgana? Hier ist alles real und echt, dies Märchen dreht sich um Erfolg und Sieg, um gesellschaftlichen Aufstieg, um Geld, Geld, Geld.
Einerseits denken die meisten Inder voll Bitterkeit an die Zeiten der kolonialen Unterdrückung: Herrschaft der Engländer; Herrschaft des weißen Mannes. Andererseits zeigen die zahllosen Plakatwände in den Straßen stets Menschen mit weißer oder beinahe weißer Haut, vom Typus her eher Amerikanern oder Europäern gleichend als Indern. Bleichcremen sind ein Verkaufserfolg, selbst Shah Rukh Khan, der Bollywood-Star, macht Reklame dafür.
Häufig passiert es auch, dass man auf der Straße angehalten wird: Junge Leute wollen sich mit einem fotografieren lassen – der Freund oder die Freundin drückt den Auslöser. Dann das Ganze mit vertauschten Rollen. Im Tempel kommt ein junges Ehepaar herüber und schiebt mir ihr Kind zu: Ich soll es berühren. Das soll Glück bringen.
Jetzt versuche einmal, die Psychologie einer solchen Begegnung zu ergründen. Wie vertrackt das ist!
In den Häusern der Oberschicht herrscht barockes Domestikenwesen. Wie der Diener, so der Herr – und nicht umgekehrt! Ganze Familien leben da mit ihrer Herrschaft dienend zusammen – etwa wie ärmere, eher ungeliebte Verwandte. Naturgemäß findet sich in einem solchen Umfeld auch Schwejk, der Diener, der vorgeblich jede Anweisung ausführt, tatsächlich aber nichts oder sogar das Gegenteil von dem tut, was er soll: »Yes, sir!«
In der Erinnerung korrespondieren die an Hals und Nacken der Rikschafahrer hervortretenden Muskelstränge mit den Stromleitungen, die bündelweise und tief durchhängend die engen und schluchtengleichen Gassen der Altstadt queren. Wir sitzen zu zweit auf der Hinterbank. Gleich an der ersten Steigung bricht dem ausgemergelten Fahrer der Schweiß aus. Old Delhi – aber auch die meisten der anderen Märkte, die man mir zeigt – fantastisch und heruntergewirtschaftet; schmutzig, verrostet, verrottet und doch funktionierend: Esswaren und herumkletternde Affen, wunderschönes Obst und Gemüse, Ersatzteile für Autos und Motorräder, Gewürze und nepalesische Medizinen, Stoffe, Glasschmuck, Kleider – was-weiß-ich, zu schön, um wahr zu sein, und zugleich zu traurig, um wahr zu sein. Der Rikschafahrer hat absichtsvoll die falsche Richtung eingeschlagen – so fahren wir immer weiter, immer tiefer hinein zwischen kleine Bethäuser, Metzgereien, Roti-Backstuben, Garküchen – immer im Kreis, kommt mir vor: Der Fahrer bleibt immer öfter stehen, ich gebe ihm das Verlangte fürs Weiterfahren, und weil ich ein schlechtes Gewissen habe, mehr.
Einer meiner indischen Gastgeber stellt mir bei Gelegenheit seine ganze Familie vor: Sechs oder sieben Brüder, einige Schwestern, wohl an die zehn oder fünfzehn Söhne sind da. Es stellt sich heraus, dass alle diese Leute gut zwanzig Jahre jünger sind als ich, aber sie schauen wie meine Großeltern aus.
Wanderarbeiter, die entlang der Straßen nächtigen, schlafen auch im Winter, in den kalten Winternächten, bloß auf einer dünnen Matte auf blanker Erde.
Viele Bollywood-Filme erzählen die Geschichte eines armen Mannes, der, meist auf wundersame Weise, reich wird. Es gibt sehr viele Kinos in Indien, und sie sind gut besucht.
Wie aus dem Traum eines Kindes herauf, vernarrt in das Bunte und Neue und nie Gesehene, schwebt mir jetzt ein hellgrüner Zimtapfel her, mit seinen an Kristalldrusen oder Diamanten erinnernden Stacheln, während im Hintergrund rote und orange-grüne Mangos sich runden.
Gleicht der Reisende nicht, tief verstrickt in die eigene Befindlichkeit, einem jener von Schmutz und Abwässern gesättigten Flussläufe, auf deren trüben Wellen sich – vielleicht hell, anmutig und bloß ein wenig verzerrt – allerhand spiegelt, dies und das, jenes und dieses, fein und flüchtig vorübergaukelnd – was eben gerade des Weges kommt, den verschlungenen Lauf zufällig begleitet?
Die Sonne scheint grell beim Fenster herein. Saris mit Goldborten. Bunte Stoffe. Hitze. Ein Esel ist an einer Kreuzung zusammengebrochen. Ein Junge sammelt ein, was vom klapprigen Wagen heruntergefallen ist. Da rollen die Sachen.
Noch einmal Indien (2012)
Die Sé de Santa Catarina, die Basilika des Jesuskindes, die Kirche des Franz von Assisi, St. Augustin, die Kirche unserer lieben Frau vom Rosenkranz, St. Anton, St. Xavier: Was Antigua in Guatemala für die amerikanischen Kolonien der Spanier, das war Goa für das asiatische Reich der Portugiesen. 1510 landete Alfonso de Albuquerque hier mit seinen Truppen. Von Goa aus segelte er zu den Molukken, nach Timor, nach Macao in China. Luís Vaz de Camões, der Dichter der Lusiaden, lebte hier. Während ich eine der Straßen zwischen alten, portugiesischen Ansitzen hinunterspaziere, verkommen und von vielerlei Pflanzen überwuchert die meisten, mit eingesunkenen Dächern und herunterhängenden Fensterläden, denke ich mir: Wie muss nur den Portugiesen zumute sein? Einst Herren eines Weltreiches, jetzt nicht gerade obenauf. Bis mir einfällt, dass die Österreicher einst ja auch Beherrscher eines Imperiums waren.
Öfter hört man die Phrase, Indien sei ein Land im Wandel, im Umbruch, und das stimmt. Wandel ist das Wesen des Geschichtlichen. Es fragt sich nur, wie er aussieht.
Ich unterhalte mich mit einem alten Herrn, Inder, offenbar gebildet und zur reichen Oberschicht gehörend. Als ich auf seine Frage, wo ich denn herkäme, antworte: »Aus Goa!«, und hinzufüge: »Goa is just a heap of junk now!«, erwidert er zustimmend, wenn auch gedanklich etwas unscharf und voller Groll: »It’s the British that ruined India.«
Im Hinterland von Goa, östlich von Ponda, liegen die Abbauzonen für Mangan-Erze und Bauxit. Fingerdick bedeckt roter Staub die Bäume an der Straße, ja die ganzen umgebenden Urwaldtäler. Sechs Tage die Woche blockiert eine ununterbrochene Karawane von schweren Lastern die Durchzugsstraße zum Mandovi-Fluss. Dort liegt der Pier, von dem Lastkähne das Erz zum Hafen hinausbringen, wo es auf Hochseeschiffe verladen wird.
Wer zu denken aufhört, beginnt auch schon zu sterben. Unter Palmen und Banyanbäumen lässt sich leicht träumen. Verführerisch ist es, über den Dreck, all die Plastikflaschen, den Schutt und die Abfälle hinwegzusehen. Die Küsten von Goa sind eine Art Jesolo voller Ferienvillen, Resorts und Gästehäuser. Was die Fetzenmärkte für den Einkaufswilligen, sind die halbnackten Touristinnen am Strand für den Voyeur. Bis ins Wasser hinein verfolgen fliegende Händler die Kundschaft. Vom Krokodil bis zum Delfin kann alles besichtigt werden. Die wunderbar besternte Tropennacht – ein Discorausch.
»Where have all the good times gone?«, frage ich in einem anderen Gespräch. Einst war Indien The Golden Bird, Sehnsuchtsziel der Völker, die aus dem Norden kamen. »Our culture, it was all about art and music and dancing«, bemerkt eine indische Dame voll Schwermut. Man sagt, dass eine Handvoll reicher Familien das heutige Indien beherrscht. Tata, Mittal, Mahindra, die Gandhis, um nur einige zu nennen. Korruption heißt das allgemein beklagte Übel.
Für Todessüchtige empfiehlt sich eine Reise hierher stark.
Von Luxus gesättigt, vollgesogen mit tropischen Düften, eingelullt von Vogelgesang, vom Flug bunter Schmetterlinge verwirrt, bis zum Kragen angefüllt mit herrlichen Speisen und Getränken, wer wollte da nicht faul und verfaulend in den Tag fortträumen?
Du kennst dieses Licht aus den Italowestern. Immer, wenn es brenzlig wird, ist die Szene stark überstrahlt. Die Gegenstände, die Häuser, alles scheint zusammengepresst und wie eingesperrt in seine Kontur, farblos. Ragende Pfähle. Hier ist kein Film, hier ist Wirklichkeit. Vom Bahnhof wallt eine Menschenmenge heran, staubwolkenumhüllt. Schaukelnde Dächer von Bussen. Die Gelasse und Verschläge am Straßenrand, wo immer das Gleiche verkauft wird: Cola, Kokosnüsse, Chips, Kaugummi, Bananen. Kundschaft steht herum. Weiße Häuser, auch ganz hinten noch, klein in der Ferne. Ferkel im Müll, groß und grunzend, sondierend. Nirgends eine Uhr. Und gäbe es denn eine, sie hätte keine Zeiger.
Die Infrastruktur des Landes ist desolat. Große Bezirke rein agrarisch. Die Fabriken, etwa Zuckerfabriken oder Stahlwerke, oft in ausländischer Hand. Diese Situation lässt das Erstarken der indischen Wirtschaft nun doch in etwas anderem Licht erscheinen: Vor allem dürften Niedriglöhne und das Beiseitelassen jeden Umweltschutzes für die Erfolge auf dem internationalen Parkett verantwortlich sein. Wie lange das aber gehen kann?
Je mehr Fäden ich aufnehme, desto verwirrender präsentiert sich das Muster.
Zuletzt ist Leben doch eine Frage des Mutes, sage ich mir immer wieder vor – mit der Halbherzigkeit des Europäers.
Hier ist islamisches Territorium. Würde man mit verbundenen Augen an einen Ort entführt, dort freigelassen, man könnte sofort sagen, ob Hindus oder Moslems die Mehrheit stellen. Schwer zu beschreiben, aber zweifelsfrei zu erkennen: Die Welt der Moslems hat etwas Scharfkantiges, auch Verschlossenes, ja Schroffes, während die Ortschaften und Städte, in denen Hindus überwiegen: Da geht alles gerundeter, gelassener seinen Lauf, möchte man meinen oder soll man eher sagen, einfach den Bach hinunter?
Neugier und Freundlichkeit dieser Menschen, Letztere so direkt und auf einen zugehend, dass man, vom Übermaß betroffen, sich sagt oder denken muss: Die kennen mich nicht. Die wissen nicht, was für einer ich bin.
Zweierlei kommt immer wieder auf: Die Rivalität mit China einerseits, die nur notdürftig unterdrückte und kaschierte Feindschaft zwischen Hindus und Moslems andererseits. Da steigen wir Europäer ja direkt noch fein aus. Kastenwesen: Was in der Stadt überwunden scheint, auf dem Land regiert es. Die Geburt zählt viel. Ich traf allerdings auch Unberührbare, die es zu Wohlstand, ja Reichtum gebracht haben.
Tiefe Religiosität vieler Menschen. Mir fällt meine böhmische Großmutter ein, die jeden Tag zwei Mal in der Kirche war, in ihrem Zimmer noch einen kleinen Altar aufgebaut hatte, Muttergottes mit Rosenkranz, wo sie untertags öfter betete, kniend, in tiefer Versunkenheit.
Heilige Bäume am Weg, mit buntem Tand geschmückt, Andachtsstätten. Plattformen um Bäume, wo man im Schatten ruht oder sein Gebet hersagt. Geleiert, das Ganze, aber mit der Kraft des Herzens, inbrünstig. Wie lange habe ich solche Demut, solche Hingabe und Schicksalsergebenheit nicht mehr erlebt?
Die vielen Pilger dagegen, hier in Schwarz gekleidet, barfüßig, sie schauen beinah schon wie Touristen aus.
Fortströmende Landschaft der Hochebene: Meile um Meile wie ein riesiger Park, ganz flach, gegliedert nur durch jetzt meist ausgetrocknete Wasserläufe, die der Monsun dann hoffentlich füllen wird. Missernten. Nach Missernten kommt es zu Selbstmorden unter den Farmern. Verzweiflung. Alles am Äußersten. Preisdiktate der Großabnehmer. Streiks, um doch noch einen gerechten Preis zu erzwingen. – Und dann wieder der friedvolle Ausblick in die sich weitererzählende Landschaft, sanft wellig nun, mit mächtigen Bäumen darin, Mango oder Peepul-Tree, klein in der Weite, Akaziengestrüpp an den Straßen, Brennholz.
Dass eine kleinere Stadt zwei Millionen Einwohner hat, ist hier nichts Besonderes. Moderne Hochbauten zwischen Lehmhütten. Wird die Straße verbreitert, reißt man die Hütten einfach ab. Öfter sieht man die Ärmsten: Sie hausen in den Ruinen, in dem, was übrig blieb.
Zwangsumsiedlungen ganzer Dörfer.
Dann die Gipsies, wie sie hier genannt werden, allerhand unstete Völkerschaften, von alters her diskriminiert, bringen sich als Wanderarbeiter für Erntekampagnen oder beim Straßenbau durch. Zelte aus verwitterter Plastikbahn, Kochen auf dem Dreifuß, Leben auf der Erde. Ochsenkarren, Feldarbeit mit der Hand, die Zuckerrohrschneider in parallel vorgehenden Arbeitskolonnen: kleine Leute im hohen Röhricht, Messer schwingend.
Wo will mein Bericht denn hin? Eingedrückt von der schieren Masse des Erlebten, des oft Unvereinbaren, ich weiß es nicht. Mir wird etwa nebenher klar, dass es um eine Zivilisation, wie z. B. die unsere, die es nicht schafft, sich in ausreichendem Maß fortzuzeugen, dass es, bei all der technischen Überlegenheit, der sozialen Raffinesse, dass es um eine solche Zivilisation nicht gut bestellt sein kann. Eine Art Tabu, wie mir scheint: Das Offensichtliche, klar zutage Liegende wird nicht gedacht, darf auch nicht gesagt werden. Das Ungeheuerliche, das in der Tatsache sich verbirgt, dass es zu wenig Kinder gibt, es wird nicht adäquat angesprochen.
Die historische Ablage, das Ranking des Gewesenen, wenn man so sagen kann, in Indien kommt einem das bald durcheinander, das Gewohnte gilt auf einmal nicht mehr: Hier herrscht eine ganz andere Ordnung.
Gewiss, das Engagement der hochindustrialisierten Länder, meist selbstsüchtig, gibt es, ja, es erscheint sogar gewaltig: Wie aber die Transformation im Einzelnen aussehen und ausgehen wird, ob die Kräfte des Voran, des Immer-Weiter nicht erlahmen, versanden werden, im Forttorkeln schließlich, im Desolaten, Verwahrlosten, in Müll und Plunder enden werden? Gut möglich auch, dass der Spieß einmal umgedreht werden wird: Indisches Kapital geht nach Europa. – Es ist doch längst so weit.
Sind wir jetzt für oder gegen die Globalisierung? Die Auskunft lautet: Nur ein Dummkopf kann das Vergangene zurückwünschen. Und außerdem, ganz gleich, wie wir uns einstellen, der Sog, die mächtige Strömung ist da, sie lässt sich nicht aufhalten.
Monotonie der Landstraße. Die Sonne brennt herunter. Alleen. Das zwanzigste Dorf sieht aus wie das erste. Kleine Häuschen, bunt angemalt. Ein Raum, unterteilt, für die ganze Familie. Daneben Tiere, so vorhanden: Büffel, Ziegen, Schafe – unter Wellblech. Kein Gehsteig. Kehrende Frauen. Viele Handys. Schwatzende Männer. Alle Stadien der Bekleidung. Weißbärtige alte Männer. Frauen, die Lasten auf ihren Köpfen tragen. Schulkinder auf Fahrrädern, von der Regierung gestellt. Schuluniform. Gratisessen. Die Alten sprechen nur den lokalen Dialekt. Die Kinder, mit ihrem Hello-Goodbye-Englisch.
Jetzt wird das Land trockener, ja wüstenhaft. Bewässerungsprojekte. Erbsen, Paprika, Chilischoten, Mais und Weizen, Zuckerrohr, Wein gelegentlich. Vorn erscheint das Weichbild einer Stadt. Türme für Fernsehen und Telefonie. Moscheekuppeln oder Tempel. Erste Imbissbuden und Stände. Passantengewusel. Aufkommender Verkehr.
Zukunft ist Wissen mal Hoffnung, könnte man sagen. Erbärmlichkeit des Lebens, in unserer Zivilisation meist tröstlich verhüllt. Ich meine: Der Pfeil der Betrachtung, akkurat auf das Fremde gerichtet, er biegt sich zurück, biegt sich jetzt gegen dich her und sticht dir ins Herz.
Ägypten (2009)
Als die schlanken Minarette der Moscheen, die massigen Lotos- und Papyrussäulen der alten Tempel um mich herum aufragten, sah ich die gezackte Linie im Hintergrund der weiten Ebene nicht als Gratlinie der kahlen Berge dort in der Wüste, sondern – das Bild schoss ganz unmittelbar und wie selbstverständlich ein – als Diagrammlinie von Börsenkursen; in den letzten Tagen vor Reiseantritt waren solche Bilder unentwegt über die Bildschirme geflimmert.
Da die Ägypter kaum etwas anderes zu verkaufen haben als die touristisch inszenierte Ansicht ihrer Altertümer, werden sie Rezession und Wirtschaftskrisen jeweils deutlich zu spüren bekommen, dachte ich, sie werden eine Zeche mitzubezahlen haben, von der sie keinen Tropfen, kein Brösel konsumiert haben – es sei denn eins der Brösel, das nebenher vom Tisch heruntergefallen ist.
An den reich gedeckten Tafeln, sei es auf den Nil-Kreuzfahrtschiffen, sei es im Vier-Sterne-Resort in Kairo, sei es in den Badehotels am Roten Meer, bedient sich und schwelgt da in vergleichsweise märchenhaften Genüssen die europäische Mittelschicht (von den Reichen rede ich erst gar nicht), während draußen, am Fallreep des Schiffes, am Entrée des Hotels etwa Gassenjungen einander verprügeln, weil der eine im Revier des anderen – oder was der für sein Revier ansieht – gewildert und eine Stange Zigaretten, einen dieser hässlichen Pharaonenköpfe aus Plastik oder ein rotes oder schwarzes Palästinensertuch an den Mann gebracht hat.
Da fährt eine braune Faust mitten in ein Gesicht – der Mund ist schon zum Schrei aufgerissen – oder eine Hand verkrallt sich ins Gewirk eines abgetragenen, schäbigen Pullovers. Staub raucht auf, dreckige Zehen stemmen sich gegen den Dreck.
Frühmorgens, allein an Deck, rechts und links die breite Flusslandschaft mit ihren Dattelpalmenwäldern, den Äckern, Gärten und Gärtlein – die aus Lehmziegeln aufgeführten Hütten der Einwohner dazwischen –, der Strom mit Inseln und Nebenarmen mächtig sich herbiegend, kann ich mich so recht in die Stimmung eines der englischen Kolonialisten hineindenken, die da Flusskehre hinter Flusskehre in ein fantastisches Reich hineinfuhren: Und alles, was sie sahen, alles gehörte schon ihnen – einfach so!
Das sprichwörtlich schlechte Gewissen des Europäers, hier holt es mich wieder ein, und zwar so penetrant, dass es beinah schon etwas Pharisäerhaftes hat: Diese Sorte von Ehrlichkeit und Offenherzigkeit, das ist doch eher bloß Eitelkeit und Selbstbetrug.
Du magst dich noch so viel im Kreis drehen und dich umschauen, du kommst aus der schiefen Optik einfach nicht heraus: Du selbst bist ja Teil davon.
Lautlos und so, als wäre kein Kraftaufwand dafür nötig, gleitet das schwere und vielfenstrige Schiff über den Nil, mitten durch ein Märchenland aus Palmen und saftigem Grün, im Hintergrund die grauen Wüstenberge.
Die Palmenhäuser von Brüssel, das India House und die Ministerien an der Themse, der Obelisk auf der Place de la Concorde – und vieles mehr: all diese Bauten, das Kupfer, die Geländer, Regenrinnen und Poller, der Zierrat, der Kies mit Palmen in Kübeln darauf und die weißen Korbstühle auf den schönen, luftigen Terrassen, von denen aus wir in gepflegte Parks hinein- und hinunterschauen: Wo ist das alles nur hergekommen?
Um diesen Aspekt jetzt einmal abzuschließen: Zur Bewältigung der ökonomischen Krise nehmen die Staaten über die Ausgabe von Schatzscheinen Kredite auf, um ihre diversen Konjunkturpakete zu schnüren. Auf den Kapitalmärkten kommt es zu einer Konkurrenz der Kreditnehmer. Länder wie etwa Ägypten, mit ihrer vergleichsweise geringen Bonität, kommen nur schwer an geliehenes Geld, und wenn, dann zu sehr ungünstigen Bedingungen.
Das ganze Niltal – zu den Gebetszeiten vier Mal am Tag – hallt wider von den Rufen der Muezzins. Rufen – so sagt man traditionellerweise. Tatsächlich klingen die Aufforderungen zum Gebet in meinen Ohren eher wie agitiertes, erregtes, aufpeitschendes Schreien. Natürlich – ich verstehe die Sprache nicht. Sehr wohl aber verstehe ich den Ton, die Sprechhaltung. Rechne ich die kulturelle Differenz ab, bleibt immer noch der Eindruck: Dies ist kein ruhiges, freundliches Herbeirufen. – Und unsere Glocken? Die stören doch auch manche Leute.
Klar ist, dass das Regime die fundamentalistisch ausgerichteten Muslime fürchtet. Je länger ich im Land bin, je mehr ich mit dem oder jenem mich unterhalte, desto deutlicher wird mir – im Zusammenhang mit dem allgegenwärtigen Elend –, dass die ägyptische Gesellschaft tief gespalten ist: in eine kleine, wohlhabende oder reiche Oberschicht, und in die sich gerade eben so durchbringende Masse.
In Abu Simbel sehe ich mich in der Vorhalle des Tempels mit dem Bild des kämpfenden Pharao Ramses konfrontiert. Es geht gegen die Hethiter. Zweitausend vor Christus. Auf dem überlebensgroßen Flachrelief fährt Ramses mit dem Streitwagen her. Dann, im Mittelbild, schlägt er mit der Keule auf einen der herandrängenden Feinde ein. Ein zweiter liegt schon auf dem Boden, tödlich getroffen, und er hebt, in einer Art letzter, vergeblicher Abwehr, die Hände zum Pharao empor, der – mit einem Fuß steht er auf dem Kopf, dem Gesicht des Gestürzten – dabei ist, ihn zu erledigen.
Der Wille zum Töten, der Wille zum Sieg – wie ist das in wunderbar klarer Zeichnung hier ausgedrückt. Für alle Zeiten, möchte ich sagen. Und gleicherweise die Ohnmacht der Opfer, das Elend der Besiegten, deren Menschlichkeit sich auflöst in pflanzenhaftem Gerank, niedergetreten von der animalischen Eleganz einer Bestie.
Der Koloss von Memphis: ein größerer Kontrast ist wohl kaum denkbar. Hier tritt uns Ramses, der Pharao, mit der Würde, Milde und Entrücktheit eines Buddhas entgegen. Vorbei sind die Zeiten der Schlachten: Gerecht, edel und schön, diese Eigenschaften sind jetzt Programm.
Die Souks, bei jeder Orient-Reise ein Höhepunkt: Zwar ist das meiste Ramsch, was hier an Waren ausliegt und angeboten wird. Doch die schiere Fülle des Gebotenen, die Enge der Gänge zwischen den Geschäftsgelassen, die selber wieder Höhlen voller Waren sind, das Geschrei der Händler, das Feilschen, die Gerüche von Parfüms und Gewürzen – einer will noch mit einem Schubkarren durch, ein anderer trägt ein großes Brett mit frischen Broten auf dem Kopf, ein Bettler klammert sich an deinem Ärmel fest –, das Durcheinander von Sachen und Lebensäußerungen ist nicht zu überbieten, du verlierst die Übersicht, ein wenig auch die Beherrschung, das Geld sitzt locker, du treibst fort und wirst getrieben von der aufgekratzten, berauschten, sich unentwegt an den Dingen, an sich selbst berauschenden Menge.
Oleander, Bougainvilleen, Tamarinden, Eukalyptus, Mimosen, Königspalmen, Dattelpalmen, Zuckerrohr; der Domm-Baum mit seinen Früchten, Mangos, Zwergpalmen, Affenbrotbaum, Hibiskus, Papyrus – und so weiter und so fort: Traumhaftes Smaragdgrün bewässerter Flächen, biblische Gestalten zwischen Bäumen, vor dem Dunkel der Haine, flackernde Feuerchen im Gelände. Über die zerbrochenen Stufen am Kai läuft ein Knabe herunter, schnellfüßig, er hat bemerkt, dass unser Boot, das Boot mit den Touristen, bald anlanden wird. Doch der Steuermann unseres Bootes hat ihn längst entdeckt und droht ihm mit der langen Hakenstange.
Anmerkungen anlässlich einer Japan-Reise (1997)
Am Anfang gar kein Fremdheitsgefühl. – Die Wolkenkratzer von Tokyo, kleiner als die von New York City oder Chicago, grüßen wie ein Dorf im Abendrauch von den Hügeln über die Bucht her.
Es ist ein endloses Dorf. Wolkenkratzer, Wolkenkratzer, Blocks, Blocks. Gleich hinter den glitzernden Fronten der Boulevards beginnt es: kleinteiliges Häusergewirr, das in seiner engen, unübersichtlichen Vernetzung an mediterrane Städte, an marokkanische Souks erinnert.
Überall wuchert spitziges Grün heraus, und die zum Trocknen aufgehängte Wäsche der Hausbewohner pendelt zwischen Bambusstauden, kleinen Föhren oder einfach in Kübeln oder Töpfen aufgestellten Pflanzen. – Vorn Wolkenkratzersilhouetten.
Kleine Handwerksbetriebe dazwischen, Auslieferungen für Elektrogeräte und ähnliches, Friedhöfe und Tempelhaine, die Hausschuhe der Bewohner stehen vielfach vor den Schwellen.
Holzhäuser.
Gewaltig strahlende, aufgewienerte Autos: Die Leute hier leben im Auto – sie fahren ja auch, der Staus wegen, tagtäglich stundenlang darin.
Ich will es gleich sagen: Tokyo gefällt mir. Es ist die totale Metropole, in dem Sinn, dass es alles in ihr gibt, ob Boutiquen, Theater, Spielhöllen, Ministerien, Kaufhauspaläste, Puffs, Parks oder Fischmärkte. Das gibt es bald wo, wird man einwenden. Aber Tokyo kann man universell benutzen; alles sehr eng beisammen. Dazu kommt: Man braucht keine Angst vor Überfällen zu haben, und mitten in der Nacht schlendere ich durch wildfremde, mich verträumt anschauende Viertel.
Die Straßen Japans sind weniger beleuchtet als unsere, und wieder ist da die Erinnerung an Dorfstraßen, ja, an die Kinderzeit, als man, wohlig eingebettet ins Gefühl fragloser Sicherheit, heimwärts ging.
Mit Stricken zusammengebundenes Gut entlang der Straße, Bambuszäune, Gerümpel, an Hausfassaden gelehnt. – Habe ich mich richtig ausgedrückt? – Die Verbindung von Dörflichkeit und Metropolis fasziniert.
Die Geschichte von der leeren Mitte Tokyos stimmt übrigens nur bedingt. Zwar liegt der Kaiserpalast mit seinen Gärten tatsächlich von Wassergräben und Steinwällen umgürtet in der Mitte, und keine U-Bahn-Linie darf diese Territorien unterqueren – aber Tokyo ist, darin ähnelt es London oder L. A., multizentral eingerichtet und enthält viele Städte in einer.
Tokyo – Kawasaki – Yokohama: wiederum eine noch viel größere Stadt, grenzenlose Urbanwüste mit Lebenskernen, viele Stunden lang und breit. Im Hintergrund hohe, wie ich später erfahren sollte, unwegsame Berge – vorn das dunkelblaue Meer.
Dazu gehören die Superexpresszüge, die wie Raketen dahinzwitschern.
Ich gehe, eines schönen Tages, an der Klippenküste der Halbinsel Izu spazieren und schaue zwischen Kiefern und Immergrüngewächsen zu den Inseln aufs Meer hinaus.