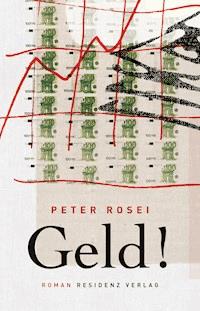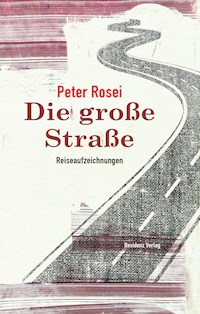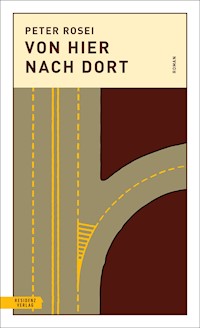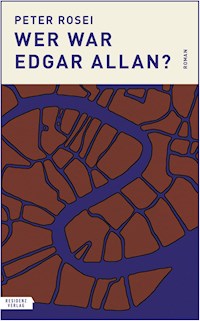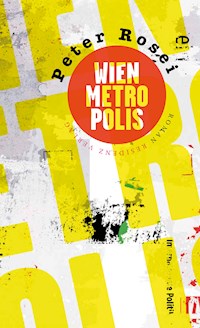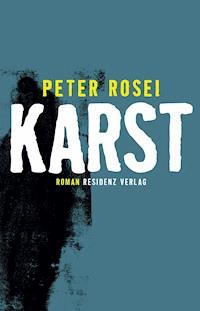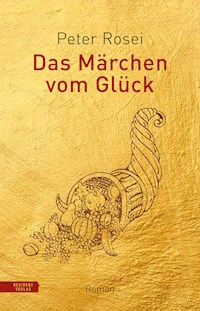Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wir versuchen doch alle nur, auf der goldenen Kugel zu tanzen, ganz egal, wie und wohin sie rollt", meint der Schweizer Geschäftsmann Adolphe Weill, Spezialist für Import/Export, im Wiener Café Imperial philosophisch zu seinem Partner Blaschky. Währenddessen fantasiert der abgehalfterte Dichter Josef Maria Wassertheurer am Ottakringer Brunnenmarkt über sein nächstes Meisterwerk und im fernen Sankt Petersburg erwartet ein geheimnisvoller Herr Tschernomyrdin den entscheidenden Anruf. Das kriminelle Netzwerk der Globalisten spannt sich von Zürich und Paris nach Bukarest und Moskau und macht auch mal Pause im idyllischen Salzkammergut. Mit leichter Hand hat Rosei ein Satyrspiel geschaffen, das die Wirklichkeit zur Deutlichkeit entstellt - so bösartig, dass es eigentlich zum Lachen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Rosei
Die Globalisten
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2014 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN eBook:
978-3-7017-4478-7
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-1633-3
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
I
1. »Was soll ich Ihnen schon sagen? Ich bin ja nur ein kleines, ein winziges Schräubchen im Getriebe. Ich will das gar nicht verschweigen, o nein! Aber auch so kann man eine schöne Stange Geld verdienen und sein Glück machen, nicht wahr?«
Der etwas stockige, untersetzte Mann musterte sein Gegenüber.
»Wir versuchen doch alle nur, auf der goldenen Kugel zu tanzen, ganz egal, wie und wohin sie rollt«, sprach er rasch weiter, und dann hob er neuerlich den Blick, den er für einen Moment zu seinen auf dem Tisch liegenden Händen gesenkt gehabt hatte.
»Haben Sie Kinder?«, fragte er unvermittelt.
»Das ist doch nicht Ihr Ernst, Herr Weill!«, rief sein Gegenüber da aus, ein noch jugendlich wirkender, schwarzhaariger, elastischer Mensch, der in einem guten, blauen Tuchanzug steckte und bisher stillgehalten hatte: »Wollen Sie mich verarschen?!«
Er brachte die Worte mit hartem, slawischem Akzent vor.
»Aber nein!«, beteuerte darauf der so Angesprochene, sein feistes Gesicht lief jetzt noch mehr an, es war ohnehin schon von roten Flecken übersät gewesen – und dann brach er in ein leutseliges, ja in ein gutmütig breites Lachen aus.
»Es geht doch nicht um uns, keineswegs«, meinte er, die Stimme dämpfend, in jener Tonart, die dem Flüstern näher ist als der normalen Stimmlage, der Kellner im Hintergrund hatte, die über den Arm gelegte Serviette zurechtrückend, wegen des lauten Gelächters schon missbilligend herübergeschaut: »Das Spielchen dreht sich doch nicht um uns! Worum dreht sich’s denn, na? – Um die Zukunft natürlich, um diese wunderschöne Fee!«
Die Szene spielte im Café IMPERIAL in Wien, in jenem prächtig inszenierten Raum, der auf die Ringstraße hinausgeht, die beiden Herren saßen auf der gepolsterten Bank, die an der Wand entlangführt und mit kleinen Marmortischen bestückt ist. Gerade oberhalb der Herren und ihrer Köpfe hing eine märchenhaft aufgefasste Alpenlandschaft in schwerer Goldrahmung, auf dem Tischchen vor ihnen standen Tassen samt halb vollen Wassergläsern, die Sonne schien hell durch die großen Fenster, der im Hintergrund postierte Kellner hatte sich beflissen am Kuchenbüfett zu schaffen gemacht.
Nur wenig Leute da! Wenig Kundschaft! – Es ist ja auch erst elf Uhr, dachte Weill, sein Blick hatte dabei seine Armbanduhr kurz gestreift.
Jetzt sitze ich schon eine geschlagene Stunde mit dem Trottel herum, und nichts geht weiter.
»Wissen Sie was? Ich will Ihnen etwas erzählen. – Es war einmal ein kleiner Junge«, hob er an und unterdrückte dabei mit forscher Miene jeden etwa aufkeimenden Protest, »die Familie stammte aus einem abgelegenen Nest in der Westschweiz her, wo sie sich seit Generationen mehr schlecht als recht mit dem Uhrmachen durchgebracht hatte.
Der Vater dieses Jungen, im Übrigen hörte der auf den seltsamen, damals aber gerade in Mode gekommenen Namen Adolphe, hatte den Umschwung der Verhältnisse dadurch eingeleitet, dass er mit Kind und Kegel nach Zug, in den gleichnamigen Kanton, übersiedelte und dort ein Geschäft für teure Uhren eröffnete.«
Weill hatte sich jetzt breit zurückgelehnt, das Kinn gegen den Hals gepresst, sah er sein Gegenüber mit sattem Behagen an, die Hände hatte er dabei über seinem sich wölbenden Bauch gekreuzt.
»Sie wissen ja: Die Stadt Zug erfreut sich infolge einer besonders klugen Steuergesetzgebung eines lebhaften Zugangs von Reichen, von Millionären. Die wohnen« – Weill deutete, seine Erzählung illustrierend, die Lage der Stadt mit einer kurzen Handbewegung an –, »sie residieren in ihren Villen hoch oben auf dem Berg und schauen von dort auf Stadt und See herunter.«
Der Blaugekleidete rutschte bereits unbehaglich auf seinem Platz herum.
»Dem kleinen Adolphe nun«, fuhr Weill launig fort, »er hielt sich nach der Schule gern im Geschäft des Vaters auf, stachen gewisse Leute bald ins Auge. Meist tauchten sie erst am späten Vormittag in den Straßen der Stadt auf, verschwanden bald in den teuren Restaurants, um nur zu dem Zweck wieder zu erscheinen, auf den zum See hin gelegenen Terrassen ihren Kaffee zu trinken. Der Vater begrüßte gerade sie immer mit besonderer Freundlichkeit.
›Papa, du sagst doch immer, dass alle Menschen arbeiten müssen‹, meldete sich der kleine Adolphe nun eines Tages, er stand mit dem Vater in der Tür des Geschäfts, was dieser gern zu tun pflegte: ›Papa, was ist es jetzt mit denen da?‹ «
Gekonnt hatte Weill an der Stelle die lebhafte Stimme eines Knaben nachgeahmt.
» ›Nun, mit denen ist es eine Ausnahme‹, erklärte der Vater: ›Sie arbeiten auch – aber man sieht nichts davon. Was sie so treiben? Dies und das. Hol’s der Teufel! Jedenfalls, Geld haben sie genug. Und es vermehrt sich. Ganz wie von selbst.‹ – Weshalb erzähle ich Ihnen das, Blaschky?« Weill wandte sich jetzt frontal an sein Gegenüber: »Wollen wir nicht alle reich werden? Sie etwa nicht?!« – Und er brach zum zweiten Mal in sein laut schallendes Gelächter aus.
Dem dunkelhaarigen, jungen Mann im guten, blauen Tuchanzug, der geduldig zugehört hatte, reichte es jetzt.
»Sie gefallen mir, Herr Weill!«, platzte er heraus, »Sie gefallen mir wirklich. Unser Geschäft ist doch kein Witz! Da geht’s doch nicht um Peanuts. Und Sie erzählen mir Geschichten! – Der kleine Junge, der sind Sie wohl selbst gewesen?«, schloss er unwillig mit einer Frage.
Weill ging mit keinem Wort darauf ein und erklärte nur knapp: »Was ist es jetzt mit Ihnen, Blaschky? Wollen Sie mir den Kontakt zu diesen Leuten herstellen – oder nicht? Ich meine, zu dem Preis, zu den Konditionen, die ich Ihnen genannt habe?«
»Ihr letztes Wort?«, fragte der andere.
»Mein letztes Wort.«
Der Blaugekleidete war jählings aufgesprungen, unschlüssig stand er da.
»So kommen Sie schon!«, sagte Weill und ergriff die schlaff herunterbaumelnde Hand des anderen.
Kurz darauf saßen die beiden bei einem kleinen Innenstadt-Italiener, Weill hatte den Geschäftspartner eingeladen, er hatte darauf bestanden. Nun bewirtete er ihn aufs Feinste.
»Sie nehmen doch auch Fisch, lieber Blaschky? Fisch ist ganz vorzüglich hier. Kann ich nur wärmstens empfehlen! Schließlich haben wir zwei doch was zu feiern, oder etwa nicht?! Ein bisschen was Grünes dazu? Spinat vielleicht? Oder Rucola? Mit einer Spur Grana drauf?«
Weill zeigte mit den Fingern das Aufstreuen des Käses vor.
Er ließ tüchtig Wein auffahren, über die stets gut gefüllten Gläser weg erläuterte er, dass man hier, in Wien, in Österreich, ruhig ein wenig getrunken haben durfte, wenn man sich ans Steuer setzte: »Autofahren, damit ist es hier nicht so streng wie bei euch daheim«, ergänzte er und prostete dabei mit bedeutsamer Miene seinem Gegenüber zu.
Etwa eine Stunde später treffen wir Weill in der Mariahilferstraße an. Er flaniert da allein mitten unter den Passanten, die an den Auslagen der Kaufhäuser entlanggehen, er ist einer von vielen, da geht er und ist gerade dabei, die Fahrbahn zu überqueren, von der Sonnenseite der Straße in den Schatten, als sein Handy klingelt.
»Alles okay, alles paletti, Manulescu!«, brachte er gerade ein wenig kurzatmig, aber doch unmissverständlich heiter, ja fast übermütig heraus, als er von einem die Straße herunterrollenden Auto seitlich erfasst und hart zu Boden geschleudert wurde.
Rasch sammelte sich der übliche Auflauf aus Neugierigen und Hilfsbereiten um den Gestürzten, der Lenker des Unglücksautos stand verwirrt und betroffen da und beteuerte nur immer wieder: »Ich hab’ ihn wirklich nicht kommen sehen! Wie kann man auch nur so gedankenlos sein?!« – er meinte naturgemäß den Verunfallten – schon kniete ein grauhaariger Herr in solidem Anzug neben dem anscheinend Bewusstlosen, der breit und fett dalag, und sagte mit einer Stimme, die zugleich fürsorglich und wieder autoritativ klingen sollte: »Hören Sie mich? So hören Sie mich doch! Ich bin Arzt.«
Unter den zahlreichen Gaffern stand auch ein stoppelbärtiger Mensch in abgetragenen Klamotten, er sog gierig an einer Zigarettenkippe, rührte sich nicht vom Fleck und schaute nur zu.
2. Zu der in Rede stehenden Zeit lebte in der Wiener Vorstadt, in Ottakring draußen, ein Künstler, ein Schriftsteller namens Josef Maria Wassertheurer. Sie werden den Mann eventuell kennen, seinen Namen vielleicht schon gehört haben, im Augenblick hatte er keinen.
Dieser dürftige, etwas unter Mittelgröße geratene Mensch trug immer und zu jeder Jahreszeit einen halblangen Wintermantel aus dickem Wollstoff, ausgebeulte Hosen, Sportschuhe dazu und, anstelle eines Hemds, einen ausgeleierten Pulli. Sein graues Gesicht mit den etwas schräg gestellten Augen erinnerte an einen Luchs oder Wolf, hungrig und intelligent zugleich. Öfter einmal, das war so eine Art Tick von ihm, fuhr er sich mit der Zunge über die dünnen, kirschroten Lippen, oder er kratzte sich nachdenklich an einer seiner dürren, von Bartstoppeln bedeckten Wangen.
Trotz oder geradezu im Gegensatz zu dieser Äußerlichkeit ging eine beträchtliche Energie, eine nervöse Aura von dem schmalen Mann aus. Lag das an den Augen, an deren durchdringendem, trotz ihrer Kälte geradezu brennendem Blick? An den schlanken Fingern, deren intelligenter Beweglichkeit auch die Trauerränder unter den Nägeln nichts anhaben konnten? Am Losgelösten, irgendwie Weltentrückten seiner Gestalt?
Wassertheurer wusste durchaus, wer er war und was er insgeheim darstellte. Gut, äußerlich sah er nicht so toll aus, er hatte bessere Zeiten gesehen. Dass der Erfolg, der künstlerische Erfolg, ihn bisher gemieden, ihn nicht einmal von fern gegrüßt, ihn launisch und frech einfach übersehen hatte, das hatte vielleicht ein paar Schrammen an seiner Seele hinterlassen, mehr aber auch nicht.
Neben dem öffentlichen Brunnen auf dem Yppenmarkt, unter den aufsprießenden Lindenbäumen da, auf dem kleinen, mit Granit gepflasterten Platz, fand sich, herrschte auch nur einigermaßen freundliches Wetter, meist gegen Mittag eine bunte Schar zusammen, Leute, die den Herrgott einen guten Mann sein ließen, der hoch oben im Himmel wohl anschafft, ohne dass davon aber auf Erden viel zu bemerken ist.
»Hast du vielleicht schon mal Bekanntschaft mit dem da oben gemacht? – Ich nicht.«
Eher machte einer von denen bei Gelegenheit Bekanntschaft mit der Polizei, mit einem Wirt, der die offen gebliebene Rechnung reklamierte, mit einer barmherzigen Schwester oder einem Klosterbruder, der den Eintritt ins Nachtasyl aus dem oder jenem Grund verwehrte.
Schon um diese Stunde, es war der Mittag eines rund sich entwickelnden Sommertages, ging die Flasche immer einmal herum, man erfrischte sich an ihrem Inhalt, ließ sich die gute Sonne auf den Rücken scheinen, erwog auch schon die Übersiedlung in einen schattenden Gasthausgarten.
»Heute bin ich zufällig dazugekommen, wie ein Mann unter ein Auto geraten ist.«
»Wie ist es denn passiert? War er gleich tot?«
»Aber nein.«
»Trink trotzdem einen Schluck drauf!«
»Trink!«
»Der Wassertheurer trinkt doch nichts! Nicht in aller Früh wenigstens«, mischte sich da einer ein, ein Kerl mit vorstehenden Idiotenaugen, aufgedunsenen Backen und eckig vorspringendem Kinn: »Der muss doch klar sein, wegen seiner Alten.«
Müde Lacher kamen ringsum auf, ziemlich gedämpft. Der Witz war nicht besonders herübergekommen. Das Lachen hörte sich sogar ein wenig beklommen an, und achtete man nur genauer darauf, hätte man gar erspüren können, dass dem Wassertheurer, und also auch der Kunst, hier mit Respekt begegnet wurde, mit einer Achtung, die zwar nicht ausgesprochen, aber grundlegend war.
»Ihr Arschlöcher habt doch keine Ahnung! Was versteht ihr denn schon vom Leben?«, rief Wassertheurer da aus, gereizt und, ja doch, auch etwas kryptisch.
»Ich bin gerade dabei«, erklärte er, mit der Hand am Rand der Brunnenschale sich abstützend stand er da, man sah ihm an, dass es ihm jetzt gleichgültig war, ob die anderen ihm zuhörten oder folgen konnten, er tat noch einen Zug aus seiner Zigarette, und dann kam es: »Ich bin eben dabei, wie soll ich sagen, ich werde ein großes Werk schaffen, einen umfassenden Ausblick – wenn hier einer versteht, was ich meine.«
Keine Reaktion. Ein paar der Saufbrüder hörten gar nicht mehr hin.
»Es wird ein komplexes Bild sein. Weit gefasst! Eine Weltlandschaft, wenn man so will, die ins Ferne geht. Früher einmal« – Wassertheurers Stimme nahm jetzt etwas Gedämpftes und dadurch irgendwie Drohendes an –, »früher einmal ist immer unser lieber Herr Jesus, ja der, im Zentrum solcher Offenbarungen gestanden: Als König war er zu sehen, auf seiner Wolke, mit Zepter und Krone. Oder als das arme Schwein, das man nach Golgatha hinausgeführt hat. Wen aber stellen wir heute in die Mitte, ich frage euch!«
Wassertheurers Kollegen, so weit sie überhaupt zugehört hatten, schauten einander verlegen an.
Der ließ seinen Blick nicht einmal in die Runde gehen. Das wäre denn doch unter seiner Würde gewesen. Vielmehr starrte er zu Boden, auf die dreckigen Pflastersteine, als könnte er dort die Antwort ablesen.
Die versammelte Truppe, Männer, leicht schwankend vor Übernächtigkeit und Weltverdruss, mild angesäuselt und vor Ungewaschenheit stinkend, bildeten einen lockeren Ring um ihn herum.
»Deine Sorgen möcht’ ich haben, Wassertheurer!«
»Weiß einer von euch, wo wir heute übernachten sollen?«
»Am Donaukanal vielleicht?«
»Ich wüsste uns was im Augarten.«
»Ein Schlückchen gefällig?!«
Harsch wies Wassertheurer die ihm hingehaltene Flasche neuerlich zurück. In dem Augenblick wirkte er tatsächlich wie einer der ganz Großen, ein Mann von Übersicht und Macht, ein Mensch, der vieles hinter sich hat, der alles durchschaut.
»Einen Manager, einen dieser Geschäfts- oder Geldmenschen werde ich in den Mittelpunkt stellen! Einen dieser Typen, die sich klüger als alle anderen vorkommen. Die jeden abzocken. Eine dieser Gestalten …«
»Aha?!«, wurde er unterbrochen.
»Bravo, Wassertheurer!«
»Hört, hört!«
»Die Sphinxe der modernen Metropolen blicken grausam. Das Salz der Erde wirbelt durch die Gossen. Das Geld rollt wie ein scharfes Rad.«
»So hör’ schon auf!«
»Heut’ kann er’s aber wieder, der Wassertheurer.«
»Wann wird man’s denn lesen können, bitte? Wann wird’s denn fertig sein, dein Buch?«
Wassertheurer antwortete nicht. Auf diese doch eher spöttisch gestellten Fragen trat er bloß einen knappen Schritt zurück. Aber das sagte alles. Er ließ die Hände, die er prophetisch erhoben gehabt hatte, fallen, versenkte sie bis an die Ellbogen in den Taschen seines Mantels, stand stumm und bucklig da.
In die plötzliche Stille herein drang laut das unregelmäßige, helle und dadurch irgendwie lebensvoll und frech klingende Pritscheln des Brunnenwassers. Ein Lüftchen hob die grünenden Zweige der Linden an.
»Was habt ihr schon eine Ahnung?«, stieß Wassertheurer dumpf hervor, er klang jetzt müde, erschöpft: »Was wisst ihr schon von den Kataklysmen der Kunst?!«
Eine Weile standen die Männer noch beisammen, plauderten, tauschten Adressen aus, rauchten die eine oder andere Zigarette, auch ein Joint ging herum. Immer wieder machte die Flasche die Runde.
Zuletzt traten sie auseinander, zu zweit, zu dritt, einige wanderten allein fort, fort in den Tag, zerstreuten sich zwischen den Marktständen mit ihren Sonnenplanen, verloren sich im Getriebe des Marktes: Obst und Käse, Fleischbänke und Würstelbuden, Kleider- und Spielzeughandel, Schuhe, Betten, Glitzerkram, Gemüse, Blumen, Fisch … Kebabstände, aus denen blau der Rauch sich kräuselte.
Im Grund genommen war Josef Maria Wassertheurer genau der Typ, den man landläufig bezeichnet als: der Prophet im eigenen Land. Es ist ja bekannt, dass solche Leute für gewöhnlich nichts gelten. Da machte auch Wassertheurer keine Ausnahme.
Er hatte bessere Zeiten gesehen. Nicht immer war er mit Tippelbrüdern und Stadtstreichern am helllichten Tag herumgestanden und hatte Löcher in die Luft geredet. Aus einer längst vergangenen, schöneren Frühzeit her, wenn wir’s jetzt einmal so nennen wollen, stammte wohl auch seine großartige Haltung beziehungsweise das, was von ihr übrig geblieben war.
Zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, hatte sich Wassertheurer aber einer Stütze und eines Trostes versichert, des wertvollsten, den es auf Erden gibt und der dazu nichts kostet, jedenfalls kein Geld.
Vom Yppenplatz trollte er sich die Marktgasse hinunter. Da und dort sog er im Vorübergehen die Gerüche und Düfte ein, die sich ihm boten, etwa von frisch mit Wasser besprengtem Salat, von gebratenen Würsten oder von holländischen Käselaiben, er weidete seine Blicke an den Farben und Formen, etwa an lackschwarzen Melanzani, an zu Pyramiden gestapelten Tomaten und den Halden leuchtender Orangen und Mandarinen, und dies alles nicht, weil er etwa hungrig gewesen wäre: Hungrig und bedürftig war er in höherem Sinn. Er verstand es, die Freuden, die das Leben spenden mag, rein für sich zu keltern und zu genießen.
»So lang du Augen und Ohren hast, eine Nase, um zu riechen, Finger, zu begreifen, nun, dann kannst du nicht verloren gehen!«
Derart war Wassertheurer für die Liebe geradezu prädestiniert.
Als er noch jung gewesen war, ein aufstrebender Lyriker, eine poetische Erscheinung, damals hatte sich noch gelegentlich ein Verlag seiner Hervorbringungen angenommen, das eine oder andere Stipendium, ein Preisgeld da und dort hatten zu ihm gefunden: Damals, ja seinerzeit, waren die Frauen ihm zu Füßen gelegen. Er hatte sie mit seiner Ausstrahlung bezaubert. Ja, er hatte es sich aussuchen können.
Wassertheurer bog vom Markt ab, in eine der zum Gürtel hinausführenden Straßen. Freundlich umspielten allerhand Erinnerungen seinen Sinn: Haar in verschiedener Qualität und Farbe umwogte ihn, grüne, graue, ja blaue Augen schenkten ihm ein Lächeln, die Berührung von Fingern und Haut erfrischte ihn. – Aber es war doch auch etwas Seelisches dabei gewesen, protestierte er.
Er stand vor der Auslage eines Installateurladens, wo allerhand Waschmuscheln, Badewannen, Armaturen und verspiegelte Sanitätsschränke ausgestellt waren. Sein Blick fand sich in einem dieser Spiegel. Er konnte ja nicht viel von sich darin sehen, bloß sein Gesicht, den aufgestellten Mantelkragen, der schlapp herunterhing, den Ansatz der Schultern unter dem Tuch: und das genügte.
Im ELDORADO, wie er wusste, war um diese Stunde nur wenig Betrieb. Er würde bestimmt ein paar Worte mit Eva wechseln können.
Tatsächlich werkte sie, als er eintrat, gerade hinter dem Tresen, sie wusch Geschirr ab.
Breithüftig stand sie da und, vorgebeugt, wie sie war, konnte man die festen Kugeln ihrer Brüste zumindest ahnen.
Einzig an einem der Tischchen ganz hinten, wo es zu den Toiletten ging, saß ein Gast, ein sitzen gebliebener, das heißt, er schlief, den Kopf in seine auf dem Tisch liegenden Arme gebettet. Man konnte ihn leise schnarchen hören.
»Hallo!«, sagte Wassertheurer mit etwas rauer Stimme.
Wie kam es nur, dass er, wenn er Eva nur ansah, sofort einen trockenen Mund bekam?
Es war dunkel hier drinnen, alle Formen waren vom schummrigen Licht weich umspielt.
»Hallo«, erwiderte sie knapp und schenkte ihm, vom Spülbecken aufschauend, ein flüchtiges Lächeln.
»Könnte ich einen Kaffee haben, einen großen Schwarzen?«
»Ja, gleich.«
Im Hintergrund gurgelte die Klospülung, ein zweiter Gast, ein Mann, trat aus der Toilette herein, er begann den Schläfer, der unverändert dahockte, an der Schulter zu rütteln.
»Aufwachen! Wach’ auf!«
Seit ein paar Monaten arbeitete Eva jetzt im ELDORADO. Ehrlich gesagt, Wassertheurer war froh, dass sie nicht direkt im Nachtgeschäft war. Das hier war ehrliche, solide Arbeit. Es gab reichlich Morgenkundschaft, die kurz einmal hereinschaute: Lastwagenfahrer, Postler, Taxler und Ähnliches, die sich für den Arbeitstag stärkten. Gerade bei denen war aber nicht viel zu holen: Tee mit Rum, ein Glas Bier, gelegentlich ein Doppelter. Dafür nachmittags dann, wenn die Spieler eintrudelten: Pokerrunden, Schnapser, Siebzehn und vier. Da blieb schon was hängen.
Glück beflügelt für gewöhnlich, macht menschenfreundlich und spendabel.
Die Typen, die da spielten? Leute aus dem Milieu, Freier, Tschuschen, Türken mit Gel-Frisuren, Halbstarke, Angeber, Hochstapler, Gesindel.
Eva sah seine Besuche immer mit gemischten Gefühlen, das wusste er. Konnte ja gut sein, dass ein Besoffener aus der Nachtschicht hängen geblieben war. Da wurde sie dann laufend auf Getränke eingeladen, na ja, gelegentlich kam es zu kleineren Übergriffen, aber andererseits, diese Gäste ließen auch was liegen.
Da wäre er, wenn er hereingeschaut hätte, doch nur im Weg gewesen.
»Bist ja doch so etwas wie mein Zuhälter«, sagte Eva manchmal im Spaß zu ihm, das war keinesfalls ernst gemeint, nein, meist lagen sie dann im Bett, warm und geborgen, und meist griff sie ihm anschließend zwischen die Beine.
Als ob das bei ihm nötig gewesen wäre!
Heute war Eva nicht besonders gesprächig. Gut, reden war überhaupt nicht ihr Hauptpläsier. Das überließ sie lieber ihm.