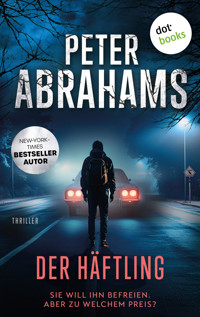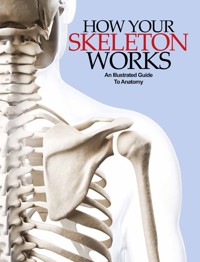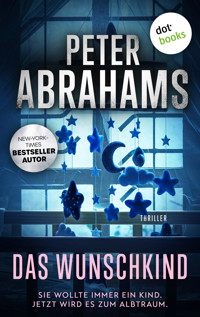
9,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Nach neun Monaten Vorfreude tritt der absolute Albtraum ein … Die frischgebackene Mutter Nina Kitchener ist starr vor Schreck, als sie im Bett ihres Babys die leblosen Knopfaugen einer Puppe erblickt – von ihrem Sohn fehlt jede Spur. Traumatisiert und geschockt von der Untätigkeit der Polizei, stürzt sich Nina selbst in die Ermittlungen. Ihre erste Spur führt sie zur Kinderwunsch-Klinik, in der ihre Befruchtung stattfand, denn die Identität des anonymen Samenspenders könnte etwas mit der Entführung zu tun haben. Als sie dort erfährt, dass sie ihr Schicksal mit einer weiteren Mutter teilt, ahnt Nina Schreckliches … Steckt hinter dem Verschwinden der Neugeborenen ein ganzes Netzwerk der Grausamkeit? Und wird sie ihren kleinen Sohn je wieder lebend in die Arme schließen können? »Abrahams hält die Spannung durchgehend aufrecht und schmückt seine Geschichte mit anschaulichen Details.« – Publishers Weekly Der bahnbrechende Psychothriller über die verzweifelte Suche einer Mutter nach ihrem entführten Säugling – für Fans von Sue Watson und Clare Mackintosh!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die frischgebackene Mutter Nina Kitchener ist starr vor Schreck, als sie im Bett ihres Babys die leblosen Knopfaugen einer Puppe erblickt – von ihrem Sohn fehlt jede Spur. Traumatisiert und geschockt von der Untätigkeit der Polizei, stürzt sich Nina selbst in die Ermittlungen. Ihre erste Spur führt sie zur Kinderwunsch-Klinik, in der ihre Befruchtung stattfand, denn die Identität des anonymen Samenspenders könnte etwas mit der Entführung zu tun haben. Als sie dort erfährt, dass sie ihr Schicksal mit einer weiteren Mutter teilt, ahnt Nina Schreckliches … Steckt hinter dem Verschwinden der Neugeborenen ein ganzes Netzwerk der Grausamkeit? Und wird sie ihren kleinen Sohn je wieder lebend in die Arme schließen können?.
Über den Autor:
Peter Abrahams ist ein renommierter amerikanischer Autor zu dessen weltweiter Leserschaft auch Stephen King gehört, der ihn als seinen »liebsten amerikanischen Spannungsromanautor« bezeichnet. Einige seiner Werke wurden mit hochkarätigen Stars wie Robert De Niro für die große Leinwand adaptiert.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Standalone-Thriller »Der Nachhilfelehrer«, »Der Häftling«, »Der ideale Ehemann«, »Das Wunschkind«, »Dear Wife«, »Blacked Out – Gefährliche Erinnerung«, »Missing Code – Verlorene Spur« und »Hard Rain – Schleier aus Angst«.
Die Website des Autors: peterabrahams.com
***
eBook-Neuausgabe November 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1989 unter dem Originaltitel »Pressure Drop« bei Dutton Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Am Ende der Spur« bei Gustav Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1989 Peter Abrahams
Published by arrangement with The Aaron Priest Literary Agency New York and Michael Meller Literary Agency, Munich
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1992 by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)
ISBN 978-3-98952-487-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Peter Abrahams
Das Wunschkind
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Eva Malsch
dotbooks.
Prolog
Fünf Faden tief liegt Vater dein,
Sein Gebein wird zu Korallen;
Perlen sind die Augen sein,
Nichts an ihm, das soll verfallen,
Das nicht wandelt Meereshut
In ein reich und seltnes Gut.
William Shakespeare, DER STURM
Der blaue Teich ist nicht blau, sondern grau, auch unter einem wolkenlosen Himmel, ein stilles Wasser im Wald. Die Dorfjungen könnten Steine ans andere Ufer werfen, aber sie tun es nicht. Niemals wagen sie sich in die Nähe des blauen Teichs, weil auf seinem Grund ein Ungeheuer lebt. Der Fischer behauptet sogar, es gesehen zu haben – der Fischer, der jeden Tag eine Flasche Rum trinkt.
Die Dorfbewohner gehen nicht zum Teich, also beobachtet niemand die zwei Männer in den schlechtsitzenden Gummianzügen, die unter der Oberfläche verschwinden und ins klare Wasser hinabsinken. Jeder Taucher entrollt ein langes Seil, dessen Ende an seinem Bleigürtel befestigt ist. Das andere umschlingt einen Baumstamm am Ufer. Mit diesen Stricken fühlen sie sich sicher.
In einer Tiefe von 50 Fuß riecht das Wasser nach faulen Eiern und färbt sich rot. Etwas tiefer ist es geruchlos und schwarz. Die Männer sind vorbereitet. Einer hält eine Taschenlampe in der Hand und knipst sie an. Entlang dem gelben Lichtstrahl gleiten sie hinab.
Bei 120 Fuß betreten sie eine Höhle. Hier sind sie bereits gewesen. Ihre Ausrüstung wartet an der hinteren Wand. Nur einer findet in der Höhle Platz, um zu arbeiten. Der andere spendet ihm Licht mit der Taschenlampe.
Sie sind kluge Männer, aber ungeübt im Gebrauch von Tauchgeräten. Sie machen Fehler. Erstens erkennen sie nicht, wie schnell ein arbeitender Mensch seinen Luftvorrat erschöpft. Zweitens vergißt der Mann mit der Lampe, den Lichtstrahl auf den Druckmesser des Gefährten zu richten. Stattdessen beleuchtet er dessen Hände. Deshalb bemerkt er die Gefahr nicht. Der Arbeiter atmet mühsam, doch das wird ihm nicht bewußt. Er atmet ein, atmet aus, atmet ein – aber nichts dringt in seine Lungen. Er läßt die Steine aus der Hand fallen, wendet sich zu dem anderen Mann, gestikuliert im Lichtkegel. Hektische Gebärden. Der Mann mit der Taschenlampe versteht ihn nicht und weicht zurück, der Arbeiter gerät in Panik und greift nach dem Regulator seines Begleiters und verfehlt ihn.
Er schlägt dem Kameraden die Taschenlampe aus der Hand, sie landet am Boden und erlischt. Sie sind blind.
Der Mann, der keine Luft bekommt, klammert sich an den anderen, dessen Vorrat noch nicht versiegt ist. Körper und Schläuche schlingen sich am Ende der Höhle ineinander. Auch in dem Mann, der noch eine halbvolle Preßluftflasche besitzt, steigt nun Panik auf. Er tastet nach seinem Messer, findet es, hackt auf alles ein, was seine Finger berühren. In seiner wilden Angst braucht er einige Zeit, um festzustellen, daß er frei ist, in tiefer Schwärze, im blauen Teich, der nicht blau ist – aber frei.
HENRIK
Kapitel 1
Er kannte die Zimmerdecke so gut. Ihre weiße Glätte bot eine perfekte Glätte für den Film seiner wasserklaren Tagträume, nur von einem einzigen Haar beeinträchtigt, das sich aus dem Pinsel des Anstreichers gelöst hatte und nun in der Tünche klebte. Das Haar störte ihn nicht. Es stellte einen Blickfang in der Leere dar. Was ihn ärgerte, war das Spinnennetz in der Ecke, direkt über seinem Kopf. Und die dicke braune Spinne an der Kurve eines vergoldeten Schnörkels. Manchmal rieb sie ihre beiden Vorderbeine aneinander, als wüßte sie, daß etwas Amüsantes, ein bißchen Widerwärtiges geschehen würde.
Die Zimmerdecke kannte er bis in alle Einzelheiten. Aber es gab ein Problem. Er wußte nicht, in welchem Raum er lag.
Ein gedämpfter Schritt. Sein Gehör hatte sich ebenso geschärft wie sein Sehvermögen. Es nahm das leise metallische Quietschen wahr, als sich der Türknauf drehte. Die Spinne duckte sich hinter dem Schnörkel. Zugluft streifte sein Gesicht und kühlte es. Die Tür hatte sich geöffnet. Irgendwo erklang Musik. Er sehnte sich nach Musik. Wayne Newton sang Viva Las Vegas. Er sehnte sich nach Musik, und nachdem sie endlich ertönt war, mußte es Wayne Newton sein. Er wollte lachen, und er lachte in Gedanken. Die Tür schloß sich und zerschnitt das Tremolo des Sängers.
Schritte näherten sich. Er glaubte zu wissen, wer die Leute waren, aber da keine Gesichter auftauchten, begann er zu zweifeln. Am unteren Rand seines Blickfelds, wo alles verschwamm, meinte er eine Hand mit Leberflecken zu sehen. Dann verschwand sie, und er konnte nicht sicher sein.
Kalte Luft umwehte seinen Körper. Die Decke war weggezogen worden. Trockene Fingerspitzen strichen über seinen Bauch. Sie taten irgendetwas, diese Finger, so trocken wie rissiges, altes Papier. Langsam wurde ein langer, harter, fremdartiger Gegenstand aus ihm herausgezogen. Die Erleichterung war maßlos, atemberaubend, fast unerträglich.
Doch die Manipulationen hörten nicht auf. Die trockene Hand ergriff ihn, nicht sanft, nicht grob – sehr zielstrebig. Sie bewegte sich energisch. Die Hand mit den Leberflecken. O Gott, o Gott! wollte er aus Leibeskräften schreien. Aber er schwieg, und sein Fleisch reagierte aus eigenem Antrieb, auf fleischliche Art. Die Freude glich einer krampfhaften Verzweiflung, denn für einen Augenblick spürte er etwas Kaltes, Glattes – wie Glas. Dann war es vorbei.
Schritte entfernten sich. Der Türknauf quietschte. Die Tür schwang auf, blies frische Luft ins Zimmer. Keine Musik. Die Tür schloß sich. Er hörte einen einzigen Schritt. Dann Stille.
Die Spinne kroch über den Schnörkel und rieb eine Zeitlang die beiden Vorderbeine aneinander. Sah denn niemand dieses Spinnennetz? Warum wurde es nicht mit einem Besen weggewischt?
Die Spinne begann die Wand herabzukriechen, kam immer näher. Nun verließ sie sein Blickfeld. Er wartete ab, ob er die dünnen Beine im Haar fühlen würde, im Gesicht.
Während er wartete, schaute er zur Zimmerdecke. Sie färbte sich blau, meerblau. Immer hatte er die See gehaßt. Wie sie sich hob und senkte, einem atmenden Wesen gleich. Er tauchte hinein, hinab in die Tiefe. Grüne Aale reckten sich ihm entgegen und beobachteten ihn mit ihren winzigen Augen, sahen ihn versinken. Ein Lederkoffer schwebte langsam vorbei, die Messingecken spiegelten manchmal wässeriges Sonnenlicht wider, das von tief unten zu kommen schien, und funkelten wie verlorene Münzen.
Kapitel 2
»Alle glücklichen Familien nuckeln. Unglückliche Familien nuckeln auch.«
Um 6.47 Uhr, am Morgen ihres neununddreißigsten Geburtstags, starrte Nina Kitchener auf diese acht Wörter, den ersten Absatz des Manuskripts auf ihrem Frühstückstisch. »Wie man ohne Männer und Kinder lebt – und es genießt«, von Lois Filer, Dr. phil. Ein Tropfen ungezuckerte, geschmacklose Marmelade rutschte von Ninas Pumpernickelscheibe auf das Papier. Sie versuchte ihn wegzuwischen und zog stattdessen einen orangegelben Bogen durch den zweiten Absatz, wie die Markierung eines Lektors.
Sie ging mit dem Manuskript in das kleine Zimmer, das sie als Büro benutzte, und kletterte auf den Hometrainer. Während sie in die Pedale trat, blätterte sie die Seiten um. Seite 7: »Die Zeit für neue Modalitäten ist gekommen. Wenn Sie nicht alles haben können, was wollen Sie wirklich?« Seite 160: »Überlegen Sie mal – leben Sie für andere oder für sich selbst? Wenn Sie für andere leben, fragen Sie sich: Wer lebt für Sie? Möchten Sie immer noch daran denken, wenn Sie erkennen müssen, daß die Antwort lautet: Niemand – und wenn es zu spät ist?«
In zehn Minuten hatte sie die Quintessenz des Manuskripts erfaßt. In zwanzig war sie 7,3 Meilen geradelt. Mit einer roten Stecknadel markierte sie ihren Weg auf einer großen Weltkarte, die an der Wand hing. Sie radelte von Paris nach Rangun. Die rote Stecknadel kennzeichnete Ninas derzeitigen Standort inmitten des Hindukusch. Nächste Woche würde sie Pakistan erreichen, in einem Monat Kaschmir. Sie ging ins Bad, wo sie sich die Zähne mit einer Antibelagpasta putzte, nach einer Geheimformel hergestellt. So was konnte man am Khaiber-Paß vermutlich nicht kaufen. Sie besaß das Beste von beiden Welten.
Im Spiegel sah sie gute Zähne. Nicht so strahlend weiß wie die Kronen, die ihr Dr. Pearl einreden wollte – ihr Zahnarzt, der für drei Kinder Alimente zahlen mußte –, aber weiß genug für echte Zähne. Und sie hatte schönes Haar, dunkelbraun, dicht, gesund, schick geschnitten von Sherman’s, für 100 Dollar, das Trinkgeld nicht mitgerechnet. Das Gesicht? Da konnte man eher sagen, was es nicht war – weder aristokratisch noch bäurisch, keine Haken-, auch keine Stupsnase, weder sexy noch süß, nicht arrogant, nicht lässig. Eins stand jedenfalls fest – es war intelligent, gut proportioniert, Mittelklasse. Die Art von Gesicht, die in einem frühen Manet auftauchen könnte. Wäre die Annahme zu vermessen, die großen dunklen Augen hätten ihn inspiriert?
Beim Blick in den Spiegel dachte Nina nicht darüber nach. Sie suchte nach Anzeichen, die auf ihr Alter hinwiesen. Es gab vieles, aber nichts, was man Falten hätte nennen können, höchstens ein übelgesinnter Betrachter. Aber sie sah, wo die Falten entstehen würden. Schluß damit! Sie bespritzte ihr Gesicht mit kaltem Wasser, rieb es kräftig mit einem Frotteetuch trocken, zog sich an, stopfte »Wie man ohne Männer und Kinder lebt – und es genießt« in ihre Aktentasche und fuhr im Lift 35 Stockwerke hinunter, zu den Straßen von Manhattan.
»Guten Morgen, Miss Kitchener«, sagte Jules und hielt ihr die Tür auf. Er war wie ein Schweizer Gardist gekleidet, nur noch etwas auffälliger. »Ein schöner Tag«, fügte er hinzu, beinahe so, als würde er es ernst meinen, was ihm gar nicht ähnlich sah. Nina trat in ein Schneetreiben hinaus und erinnerte sich – der Montag nach dem Erntedankfest, der Tag, wo das Trinkgeld fällig war.
Sie ging zur Arbeit und teilte sich die Gehsteige mit steifbeinigen Massen, die sich mißgelaunt vor dem kalten Wind duckten. Atemwolken stiegen empor, wie leere Sprechblasen in Comics. Mit niemandem hatte sie Blickkontakt, außer mit einem reglosen Mann in Lumpen, der an der Ecke der Third und der Forty-ninth stand und plötzlich auf sie zuhinkte und wisperte: »Frohes Scheiß-Weihnachten!« Kein anderer beachtete ihn.
Neunundreißig! Nina stellte sich vor, die Zahlen würden läuten wie Dorfkirchenglocken in einem Frankenstein-Film. Eigentlich konnte sie sich immer noch an die letzten Stunden von achtunddreißig klammern, denn sie war zu Mittag geboren worden. Dann zwanzig glückliche Jahre, beendet vom Tod der Mutter, die an Brustkrebs gestorben war. Später hatte Nina auch den Vater verloren – Dickdarmkrebs. Akt eins: die heile Familie. Akt zwei: mit fließenden Übergängen – die Freunde. Der letzte war zweiundfünfzig, zumindest hatte er das behauptet. Aber manchmal wirkte er älter, so wie an jenem fatalen Tag, wo sie seinen Töchtern am Nacktbadestrand des Club Med auf Tahiti begegnet war. »Freunde« – dieses Wort stimmte nicht ganz, es klang zu allgemein – »Liebe« erschien ihr zu intim. »Verehrer« zu opernhaft, »Bettgenosse« nicht opernhaft genug.
Die Freunde! David hatte sie wegen eines Mädchens im Marin County verlassen. Dann hatte sie Richard Lennys wegen verlassen, der später zu seiner Frau zurückgekehrt war. Alvie hatte Drogen genommen, Marc ihr Geld. Zane war es zu früh gekommen. Ein anderer, Richard, kam nie wieder. Ken schwärmte von einem flotten Dreier, wenn er zuviel getrunken hatte, was fast täglich geschah.
Mit diesen Männern hatte sie es ernst gemeint. Die anderen konnte sie vergessen. David, Richard, Lenny, Alvie, Marc, Zane, Richard der Zweite, Ken. Sie alle teilten Ninas Vergangenheit in scheinbar begreifliche Perioden, wie eine Genealogie von Königen in einem problematischen Staat.
Nun waren sie alle vom Thron gestürzt worden. Nina hatte die Phase dieser Beziehungen beendet. Der Job gab ihr die Kraft dazu. Hin und wieder erlitt sie Rückfälle – wenn ein Freund in einem Restaurant auftauchte oder in einem Alptraum. Aber damit wurde sie fertig. Sie war unabhängig, lebte ohne Männer und Kinder. Über das, was man Liebe nannte, wollte sie noch mehr herausfinden.
Das Büro lag in einem dreistöckigen Braunsteinhaus, mit einer schmalen Eisentreppe, einer kleinen Messingplakette, auf der »Kitchener and Best« stand, und einer Hypothek, so gewaltig wie der Fels des Sisyphus. Vor den Stufen erledigte ein Pekinese mit wütender Miene sein Geschäft. Eine Frau in einem Nerzmantel und flauschigen rosa Pantoffeln hielt die Hundeleine. »Beeil dich, kleiner Trottel!« befahl sie und zerrte das Tier hinter sich her, sobald die Aktion beendet war.
»Großer Gott!« Nina stieg über einen Haufen, der ihr – verglichen mit der Größe des Erzeugers – überdimensional erschien, und betrat das Gebäude.
Jason Best telefonierte am vorderen Schreibtisch. Hinter ihm blinkte farbenfroher Unsinn auf einem Computerbildschirm. »Warten Sie bitte.« Jason drückte auf einen Knopf. »Warten Sie bitte.« Noch ein Knopfdruck. »Warten Sie bitte.« Er schaute zu Nina auf, mit jenem verwirrten Blick, den Cary Grant so gut beherrschte. Auch in anderen Belangen ähnelte er Cary Grant. Vielleicht war er ein bißchen größer, ein bißchen hübscher und hatte ein bißchen dunkleres Haar. »Ein Schlamassel im Zugverkehr«, erklärte er und legte eine Hand auf die Sprechmuschel. »Amalia kommt erst gegen Mittag.«
»Vor der Haustür liegt Hundescheiße.«
»Igitt!« Jason drückte auf einen anderen Knopf. »Kitchener and Best. Warten Sie bitte.«
Auf dem Tisch lagen die Morgenzeitungen. »Triebtäter verletzt drei Frauen, erschießt sich selbst«, verkündete die Post. Nina griff danach und lief hinaus, um die Bescherung zu beseitigen. Dann ging sie in ihr Büro im obersten Stockwerk. Jason hatte nicht erwähnt, daß es okkupiert war. Auf diese Weise arbeitete er nicht. Zwei Frauen saßen auf der Couch am Fenster, in Ninas Alter, möglicherweise etwas älter. Eine hatte Salz-und-Pfeffer-Haare, die andere kurze blonde Locken, und sie trug eine riesige Brille.
»Hallo«, grüßte Salz und Pfeffer. »Ich glaube, wir sind zu früh dran.«
»Wegen des Schnees«, erklärte die Blondine. »Wir wußten nicht, wie lange die Fahrt dauern würde.«
»womynpress?« fragte Nina und wußte nicht, wie sie das kleine w des Verlagsnamens aussprechen sollte.
Salz und Pfeffer nickte. »Ich bin Brenda Singer-Atwell, die Verlegerin.«
»M. Eliot«, stellte sich die andere vor. »Cheflektorin. Und Sie sind Nina Kitchener, nicht wahr?«
»Genau.«
»Wir haben viel Gutes über Sie gehört, Nina«, bemerkte Brenda.
»Von wem?«
»Von allen«, erwiderte M. »Zum Beispiel von Gloria Steinem.«
»Gloria Steinem?«
M. nickte.
»Komisch, die kenne ich gar nicht.«
»Jedenfalls sind Sie ein Medienstar«, meinte Brenda. »Hatten Sie Zeit, in unser Manuskript zu schauen?«
»Ja.« Nina setzte sich an ihren Schreibtisch. »Möchten Sie Kaffee?«
»Oh, das wäre wunderbar«, entgegnete Brenda, und M. nickte.
Nina rief im Erdgeschoß an und Jason berichtete: »Rosie hat sich krankgemeldet. Der Typ von NBC braucht’s schon um vier, nicht erst um fünf, und Amalia kommt nicht vor zwei.« Der Streß näherte sich dem Höhepunkt. Jasons Stimme stieg in ein Register empor, das Cary Grant nie benutzte, nicht einmal wenn er von Hubschraubern gejagt wurde.
»Ist Kaffee da?«
»Kaffee?« fragte Jason.
»In der Maschine«, erklärte Nina, von Brenda und M. aufmerksam beobachtet Zumindest von Brenda. M.’s große Brillengläser reflektierten das Licht und maskierten ihre Augen.
»Ich seh’ mal nach.«
»Danke.« Nina legte den Hörer auf.
M. bewegte den Kopf und enthüllte ihre Augen. Scharfe Augen, die Nina tatsächlich prüfend musterten. »Ein neuer Kaffeejunge?«
»Das war Jason Best, mein Partner.« Die scharfen Augen schweiften davon, und Nina erkannte, daß ihre Stimme ein wenig hart geklungen hatte.
Nach kurzem Schweigen erkundigte sich Brenda: »Nun, was meinen Sie?«
Nina nahm das Manuskript aus der Aktentasche und legte einen Schreibblock daneben. »Ehe wir anfangen, muß ich Sie darauf hinweisen, daß diese erste Beratung hundert Dollar kostet. Wenn Sie nachher beschließen, mit uns weiterzuarbeiten, berechnen wir zweiundfünfzig pro Stunde, plus Spesen. Die Spesen variieren, aber wir unternehmen nichts Großes, wie zum Beispiel Reisen, ohne das mit Ihnen zu besprechen.«
Brenda und M. wechselten einen Blick, dann antwortete M.: »Man sagte uns, von feministischen Organisationen würden Sie keine so enormen Summen verlangen.«
»Wer hat das gesagt?«
»Mehrere Leute.«
»Gloria Steinem?«
M. öffnete den Mund, um die Frage zu bejahen, aber Brenda ließ sie nicht zu Wort kommen. »Nein.«
»Nun, es stimmt nicht«, erklärte Nina. »Unsere Honorare sind festgelegt.« Sie versuchte sich den Zusatz zu verkneifen: »Mögen Sie enorm sein oder nicht.« Beinahe gelang es ihr. Ein paar Geburtstage früher hätte sie es vielleicht geschafft.
Brenda und M. schauten sich wieder an. Schnell und stumm trafen sie eine Entscheidung. Nina sah, wie die beiden zusammenarbeiteten – wie ein Löwe und ein guter Dresseur. M. machte Ärger, und Brenda inszenierte die Show.
»Abgemacht«, sagte Brenda.
»Die Uhr tickt«, fügte M. hinzu.
Nina wandte sich an sie: »Erstens – das Manuskript ist schlecht geschrieben. So ein Buch braucht zwar kein Kunstwerk zu sein, aber ein etwas besserer Stil wäre denn doch erforderlich. Das ist Ihr Terrain. Zweitens – es gibt zu wenig anekdotisches Material, vor allem in den beiden ersten Kapiteln. Die sind zu theoretisch, zu langweilig. Drittens – Sie benötigen ein Vorwort, von einer prominenten Person verfaßt, vorzugsweise von einem Mann.«
»Von einem Mann?« wiederholte M.
»Viertens – sagen Sie der Autorin, sie muß diese Tolstoi-Parodie am Anfang streichen – oder was immer das sein soll. So was fordert Vergleiche mit großen Schriftstellern heraus, und dabei würde sie miserabel abschneiden.«
Brenda starrte M. an, auf deren Gesicht sich rosa Flecken bildeten.
»Falls diese Änderungen vorgenommen werden«, fuhr Nina fort, »ließe sich das Buch ganz gut verkaufen. Es wird viele Frauen ansprechen. Selbstverständlich hängt eine ganze Menge davon ab, wie die Autorin präsentiert wird.«
Brenda machte sich Notizen, M. saß reglos da, das Kinn vorgereckt. »Ist Dr. Filer verheiratet?« fragte Nina.
»Natürlich nicht«, erwiderte M.
»Gut. Kinder?«
»Nein.«
»In welchem Fach hat sie ihren Doktor gemacht?«
M. wechselte einen Blick mit Brenda. »Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht in Soziologie. Spielt das eine Rolle?«
»Allerdings. Hätte sie Metallurgie studiert, könnten Sie das Projekt vergessen.«
Stille. M. schaute Brenda an, die bemerkte: »Soviel ich weiß, kennen Sie Leute von der Donahue-Sendung.«
»Das stimmt«, bestätigte Nina. »Aber die werden mir keinen Gefallen erweisen, und ich will nicht versuchen, ihnen was zu verkaufen, das Phil zum Trottel stempeln würde.«
»Sie kennen ihn persönlich?« fragte Brenda.
»Ich habe ihn getroffen, aber ich kenne ihn nicht.«
M. streckte das Kinn noch weiter vor. »Aber Sie nennen ihn Phil.«
»Du lieber Himmel, es wäre doch albern, ihn Mister Donahue zu nennen.«
Jason kam herein und balancierte drei Tassen auf einem Tablett. »Kaffee, Tee oder meine Wenigkeit?« Brenda musterte ihn ausdruckslos, M. mit eisiger Miene, und Nina lachte.
Sie tranken Kaffee. Er schmeckte ausgezeichnet, mit einem Hauch von Walnüssen. Wie Nina wußte, war Jason unfähig, einen solchen Kaffee zuzubereiten, also hatte er ihn offenbar von irgendwo liefern lassen. Auf der Couch schienen sich Brenda und M. ein wenig zu entspannen.
»Ich würde die Autorin gern kennenlernen«, sagte Nina, und Brenda lächelte – nicht so strahlend wie Jason, aber sehr nett. Vielleicht konnten sie Freundinnen werden.
»Das dachten wir uns. Sie müßte jeden Augenblick kommen. Es stört Sie doch nicht?«
»Überhaupt nicht.« Das Telefon läutete, und Nina meldete sich. »Hallo.«
»Mummy?« rief ein schluchzender kleiner Junge.
»Mummy?«
Seine Stimme brach. »Der Mann hat gesagt, meine Mummy ist da.«
»Moment.« Nina sah auf. »Da ist ein Kind am Telefon ...«
Brenda entriß ihr den Hörer. »Stimmt was nicht, Fielding?« Nina vernahm noch lauteres Geheul, und M.’s Fuß klopfte auf den Teppich. »Das hat sie sicher nicht so gemeint«, beteuerte Brenda. »Sie ist wirklich sehr lieb. Weine nicht, mein Engel. Wir sehen uns bald.« Pause. »Gleich nach der Arbeit.« Pause. »Nein, das ist am Mittwoch. Heute haben wir Montag. Da arbeite ich bis abends. Bye-bye.« Sie legte auf und sagte zu M.: »Diese verdammte Gina!« Zu Nina gewandt, fügte sie hinzu: »Wir haben Probleme mit dem Kindermädchen. Kennen Sie zufällig eine verläßliche Person?«
»Nein. Wie viele Kinder haben Sie?«
»Zwei. Das ältere geht schon zur Schule.«
Nina sah M. an. »Und Sie?«
»Was soll mit mir sein?«
»M. hat eine Tochter«, verkündete Brenda.
»Die bei ihrem Vater lebt«, ergänzte M. im Tonfall eines Leitartikelkommentars. Heißt sie N.? wollte Nina fragen, verzichtete aber darauf.
»Und Sie?« erkundigte sich Brenda.
Ehe Nina antworten konnte, offenbar gehöre sie als einzige Frau in diesem Raum zur Leserschaft, an die sich das geplante Buch wendete, öffnete Jason die Tür, und die Autorin erschien. Sie hatte ein freundliches, aber zu breites Gesicht. Auch ansonsten war sie zu breit – und sie sollte im Fernsehen auftreten, obwohl noch niemand eine Kamera erfunden hatte, die zehn Pfund wegmogelte.
Warum, zum Teufel muß sie so fett sein? überlegte Nina, während sie miteinander bekannt gemacht wurden. Dr. Filer zwängte sich zwischen den Repräsentantinnen ihres Verlages auf die Couch und versicherte erstaunlicherweise: »Es freut mich, daß Sie Zeit für uns finden. Ich bin hier, um zu lernen.« Ihre Worte wirkten weniger überraschend als ihre Stimme, ein weicher Südstaatenalt, der Nina eine klare Botschaft sandte – Rundfunk.
»Schön«, erwiderte Nina. »Sagen Sie mir doch mal, warum es die Frauen genießen sollen, ohne Männer und Kinder zu leben?«
Dr. Filer lächelte. Sie brauchte einen guten Zahnarzt, aber dieses Problem ließ sich mit finanziellen Mitteln lösen. »Ganz einfach. Es wird Zeit, daß die Frauen erkennen, was die Männer schon lange wissen. Es gibt noch ein Leben außerhalb der eigenen vier Wände. Jobs, Freunde, Selbstverwirklichung. Und da heutzutage so viele Frauen allein sind, sollten sie lernen, nicht daran zu verzweifeln. In den letzten zwanzig Jahren hat das weibliche Geschlecht große Fortschritte erzielt, und die Männer konnten da nicht mithalten. Es existieren zu wenig Männer mit guten Qualitäten, und das wird sich so schnell nicht ändern.«
Keine schlechte Antwort, aber auch keine großartige. Umso besser klang die sanfte melodische Stimme. Die Frau war recht hübsch. Und sie hatten genug Zeit, das Buch zu bearbeiten, Dr. Filer in eine Diätklinik zu schicken und ihre Zähne richten zu lassen.
»Okay, nun haben wir einen Anfang gemacht«, konstatierte Nina. »Morgen schicke ich Ihnen eine Zusammenfassung meiner Ratschläge, und dann arbeiten wir weiter.« 1
»Sehr schön«, sagte Brenda.
»Wunderbar«, sagte Dr. Filer.
M. sagte nichts. Sie starrte den Marmeladenfleck auf der ersten Manuskriptseite an.
Nina wandte sich zu der Autorin: »Übrigens, Dr. Filer, ich denke, wir kommen ohne diese Tolstoi-Parodie aus.«
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung.« Dr. Filer lächelte M. an. »Die gehörte auch gar nicht zur ursprünglichen Fassung.« Auf M.’s Wangen zeigten sich wieder rosa Flecken.
Sie gingen. Nina rief die Redaktion der Donahue-Sendung an und sprach mit Gordie. Vor langer Zeit hatten sie beim Rundfunk zusammengearbeitet. Nina beschrieb das Buch und die Autorin, und Gordie versprach, sich bald zu melden.
Nina hatte noch zwei Besprechungen mit Klienten, telefonierte und schrieb zwischendurch die Zusammenfassung für Dr. Filer. Amalia ließ sich nicht blicken. Sie rief an und erklärte, sie habe Fieber und würde morgen wahrscheinlich auch nicht kommen.
Die Nacht brach herein. Nina schaute aus dem Fenster und bemerkte erst jetzt, daß es immer noch schneite. Die Lichter der City färbten die dicken Flocken rosig. Jason kam herein und stellte eine Flasche Champagner auf den Tisch. »Alles Gute zum Geburtstag.«
»Roederer Cristal. Was hat der gekostet?«
»So was fragt man nicht. Es ist ein Geschenk. Laß dir’s schmecken.«
»Okay, mach die Flasche auf!«
»Jetzt? Willst du sie hier trinken? Mit mir?«
»Mit wem sonst?« Nina holte Gläser aus der winzigen Küche, und Jason goß sie randvoll.
»Tut mir leid, daß mein Geschenk so unpersönlich ist. Aber es ist so schwer, rauszufinden, was dir gefallen würde.«
»Sei nicht albern, ich freu’ mich über den Champagner.« f
Stumm blickten sie aus dem Fenster. Der Schnee dämpfte die Geräusche der Stadt. Nina legte die Füße auf den Schreibtisch und leerte ihr Glas. Guter Champagner – er besaß die Macht, die Jahre aufzuhalten oder zumindest den Kummer über deren Verstreichen zu mildern. Sie schloß die Augen. Wärme breitete sich in ihrem Körper aus. Für einen Moment trat sie in Verbindung mit allen Ninas ihres Lebens: Nina, das Schulmädchen, Nina, die Studentin, Nina, das Karrieremädchen, Nina, die Geschäftsfrau. Und sie sah die wesentliche Nina, klar und einfach wie eine Bleistiftzeichnung. Oder sie glaubte, diese Nina zu sehen. Schnell verlor das Getränk seine Wirkung.
Sie öffnete die Augen und sah, daß Jason sie beobachtete. »Was wünschst du dir wirklich zum Geburtstag?«
»Ein Baby.« Die Antwort rutschte ihr heraus – ungewollt, unerwartet, entnervend.
»Ein Baby?«
Verlegen lachte sie. Es klang fremd in ihren eigenen Ohren.
»Meinst du das ernst, Nina?«
Sie fand keine Zeit zu einer Antwort, denn die Tür schwang auf, und Jon kam herein. »Hi, Leute!« Schüchtern grinste er Nina an und küßte Jasons Wange. Wenig später verabschiedeten sich die beiden Männer.
Nina holte sich einen Scotch aus der Küche, setzte sich an den Schreibtisch und blätterte in Dr. Filers Manuskript. Das Telefon läutete, Gordie war am Apparat. »Es gefällt ihnen.«
»Wem?«
»Allen.«
»Auch Phil?«
»Wenn ich von allen rede, meine ich auch Phil.«
»Meine Klientin wird überglücklich sein.«
»Wann erscheint das Buch?«
»Wann habt ihr die nächste Sendung?«
Er lachte. »Ich melde mich wieder.«
Nina trank ihren Scotch aus und goß sich noch einen ein. Es hörte zu schneien auf, das Telefon schwieg. Der Arbeitstag war vorbei. Der kleine Fielding hatte seine Mummy wieder.
Langsam ging Nina nach unten, zog den Mantel und die Stiefel an, versperrte die Haustür hinter sich und machte sich auf den Heimweg. Die Straßen waren weiß und verlassen. Weihnachtsgeschenke füllten die Auslagen. Sie blieb vor einem Antiquitätenladen stehen. Unter einem Scheinwerfer schimmerte ein weißes Schaukelpferd mit schwarzer Mähne und langem schwarzem Schweif, mit einem hübschen roten Ledersattel. Es hatte sogar einen Namen. »Achilles« war in die roten Steigbügel eingraviert. Nina starrte das Pferdchen lange an.
Sie hörte ein Geräusch und drehte sich um. Ein zerlumpter Mann wankte durch den Schnee. Seine wäßrigen Augen richteten sich auf sie, auf das Schaukelpferd und dann wieder auf sie. Da erkannte sie ihn. »Frohes Scheiß-Weihnachten«, murmelte er und stolperte weiter.
Kapitel 3
»Erstklassiger Gebärmutterhals«, diagnostizierte Dr. Berry, während Nina sich anzog. »Kein Grund, warum’s nicht klappen sollte.« Er setzte seine goldgeränderte Brille auf und studierte ihre Karteikarte, ein drahtiger Mann mit rotem Gesicht und weißem Haar. »Allgemeiner Gesundheitszustand – ausgezeichnet. Blutdruck großartig, keine Unterleibsinfektionen.« Er sah auf. »Hatten Sie jemals Schmerzen beim Beischlaf?«
Keine körperlichen dachte sie, und erwiderte: »Nein.«
»Fehlgeburten?«
»Keine.«
»Hätte ich auch nicht für möglich gehalten – nicht bei diesem Gebärmutterhals.«
Der war offenbar ihr wichtigster Pluspunkt. »Soll ich irgendwelche Tests machen?«
»Nicht nötig. Natürlich sind Sie nicht mehr so fruchtbar wie mit fünfundzwanzig, aber es müßte trotzdem funktionieren.«
»Ich habe mich noch nicht endgültig entschlossen.«
Dr. Berry beugte sich wieder über die Karteikarte. »Wie ich sehe, hatten Sie letzten Montag Geburtstag«
»Ja.« i
»Und deshalb sind Sie nachdenklich geworden?«
»So ist es. Allmählich läuft mir die Zeit davon, nicht wahr?« Er nickte, und sie fragte: »Und mit den Jahren erhöht sich das Risiko?«
»Das stimmt. Natürlich sollen Sie sich Zeit nehmen, ehe sie einen Entschluß fassen. Und ich sage auch nicht – jetzt oder nie, aber ...«
»Bald oder nie?«
»Genau«, bestätigte er lächelnd.
»Dann fehlt mir nur noch eins.«
»Was?«
»Ein Vater.«
»Hm, ich verstehe.«
»Ich dachte an eine künstliche Befruchtung. Deshalb kam ich zu Ihnen. Im Zusammenhang mit diesem Thema wurden Sie in der ›Times‹ zitiert.«
»Die haben alles falsch wiedergegeben.« Dr. Berry faltete seine Hände auf dem Schreibtisch. »Ziehen Sie einen bestimmten Samenspender in Betracht?«
Zum Beispiel Jason. Sicher besaß er phantastische Schönheitsgene, aber er war ihr Partner. Sie teilten sich eine Firma. Konnten sie auch ein Baby teilen? Wollte sie den Vater überhaupt persönlich kennen? Außerdem war Jason schwul. Eine erbliche Veranlagung? Wäre sie mit einem schwulen Kind glücklich? Diese Gedankengänge erschreckten Nina. Sie schienen aus einem anderen Gehirn zu stammen. Zum ersten Mal wurde ihr bewußt, welche Veränderungen ein Baby in ihr Leben bringen würde.
»Wenn sie so lange nachdenken müssen, lautet die Antwort vermutlich nein«, meinte Dr. Berry.
»Sie haben recht, Doktor.«
»Dann müssen wir irgendwo einen Samen herkriegen. Am besten wenden Sie sich an das Institut für menschliche Fruchtbarkeit. Mit diesen Leuten habe ich gute Erfahrungen gemacht, und sie verlangen ein vernünftiges Honorar.«
»Ich muß für den Samen bezahlen? Warum?«
»Weil er sehr wertvoll ist. Die anonymen Spender sind hervorragende Männer – Nobelpreisträger, erfolgreiche Künstler. Das hat der Begründer des Instituts zur Bedingung gemacht. Einige meiner Patientinnen finden diesen Aspekt abschreckend, andere nicht.«
Nina fand ihn abschreckend. Aber warum sollte ihr Baby nicht so intelligent wie möglich sein? Auch ein Gedanke, der nicht ihrem eigenen Gehirn zu entspringen schien. »Ich muß mir das noch überlegen. Wieviel Zeit habe ich noch?«
»Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen.«
Als sie die Praxis verließ, schien die Sonne. In einer Telefonzelle rief sie Jason an. »Brauchst du mich heute Nachmittag?«
»Ich brauche dich immer.«
»Kommst du für den Rest des Tages allein zurecht?«
»Klar. Wenn der Typ von NBC aufhört, mich zu peinigen. Und diese Komiker wollen eine Antwort.«
»Welche Komiker?«
»Die Leute, die den Zen-Führer für Bodybuilding rausbringen möchten.«
»Wenn ein kleiner, dürrer Greis ins Büro kommt und einen Safe über seinen Kopf hebt, sag ja, sonst nein.«
»Alles klar.«
Nina wanderte nach Süden, fünfzig Häuserblocks weit. Manchmal strömte die Sonne, zwischen den Gebäuden hindurch und wärmte ihr das Gesicht. Meistens ging sie im Schatten. Sie hatte für nichts ein Auge, nur für ihr Problem, das sie von allen Seiten betrachtete. Um fünf stand sie in der Wooster Street vor der Galerie Bettie und blickte durch die Schaufensterscheibe. Drinnen stieg Suze auf eine Trittleiter.
»Hi!« rief sie, als Nina den Laden betrat, und justierte einen blauen Spot. »Was machst du hier um diese Zeit?«
»Jason kümmert sich ums Büro. Ist dieser Rock nicht ein bißchen kurz?«
»Ich erinnere mich an Sachen, die du früher getragen hast und die nicht mal deinen Arsch verdecken konnten.«
»Das war damals.«
»Nun, wie wirkt das?«
Nina folgte dem blauen Lichtstrahl zu einem Objekt, das drei Kinder in gestreifter Auschwitz-Kleidung zeigte, hinter Stacheldraht. Alles – die Kinder, die Kleidung, der Stacheldraht und eine Hütte im Hintergrund – war aus den Einzelteilen eines rosa 1957er Cadillac Eldorado hergestellt. »Kann ich nicht sagen. Vielleicht wäre ein 64er Chevy besser. Irgendwie universeller.«
»Spotte nicht! Der Künstler ist brillant – und einfach hinreißend, aber von Jasons Standpunkt aus gesehen.«
Suze kletterte von der Leiter herunter. Viel Make-up, viel Schmuck, noch mehr Haare und eine Frisur, – die vielleicht der Vorstellung ihres Coiffeurs von Stacheldraht entsprach. Und sie hatte lebhafte Augen, die meistens belustigt funkelten.
»Gehen wir essen«, schlug Nina vor.
»Jetzt?«
»Jetzt.«
Sie bestellten eine heiße, süßsauere Suppe im Wang’s. Suze trank Tsingtao, Nina ein Glas Beaujolais – und dann noch eins.
»Also, was ist los?« fragte Suze.
Nina rührte in ihrer Suppe. »Hast du jemals daran gedacht, ein Baby zu bekommen?«
»Nie.«
»Auch nicht mitten in der Nacht? Oder wenn du einen Kinderwagen siehst?«
»Nein, nein, tausendmal nein. Was willst du eigentlich von mir?«
»In letzter Zeit denke ich sehr oft daran.«
Suzes Augen verengten sich. »Wer ist der Glückliche?«
»Du weißt, daß es keinen gibt. Es müßte eine künstliche Befruchtung sein.« Nina schilderte ihren Besuch in Dr. Berrys Praxis, und Suze leerte ihre Bierflasche in einem Zug.
»Wann hast du zuletzt gebumst?«
»Was hat das denn damit zu tun?«
»Sehr viel. Kein Mann im Bett, neununddreißig Jahre alt, und dann liest du auch noch diesen ganzen konservativen Quatsch von biologischen Uhren und bist täglich mit oberflächlichen Arschlöchern zusammen. Kein Wunder, daß du in Panik gerätst. Du solltest mal zu Lisas Therapeutin gehen. Die ist sehr gut.«
»Ich brauche keine Therapeutin. Es ist ein objektives, kein subjektives Problem.«
»Und ein Baby wird es lösen?«
»Warum nicht? Ist es denn so unnatürlich, wenn sich eine Frau ein Baby wünscht?«
»In diesem Fall wäre es pervers. Du hast wie eine Sklavin geschuftet, um diese Firma aufzubauen, und in gewissen Kreisen genießt du einen hervorragenden Ruf. Das alles willst du aufs Spiel setzen – für das Vergnügen, erst mal fett und unförmig zu werden und später den ganzen Tag lang Scheiße wegzuwischen?«
»Ich müßte meinen Job nicht aufgeben.«
»Doch, das weißt du ganz genau.«
»Im zweiten Stock in Rosies Büro könnten wir ein kleines Kinderzimmer einrichten. Sie braucht nicht so viel Platz.«
»Jetzt redest du sogar schon vom Nestbau! Du machst mich krank.«
»Was ist daran krank? Ich will nicht bis in alle Ewigkeit ein Teenager bleiben.«
Suze wurde blaß. »Wechseln wir das Thema.«
Aber es gab kein anderes Thema. Sie zahlten und verließen das Lokal. Vor Wangs Tür trennten sie sich. Suze kehrte zu ihrem Auschwitz-Cadillac zurück, Nina ging nach Hause.
Jules öffnete die Tür und bemerkte: »Ein schöner Abend.« Das war ihr gar nicht aufgefallen. Sein Atem roch nach Alkohol. In ihrem Apartment goß sie sich ebenfalls einen Drink ein. Vor fünf Jahren hatte die Wohnung zweihunderttausend Dollar gekostet. Sie war komfortabel eingerichtet, auch mit hübschen Kunstgegenständen, dank Suze. Ein hübscher Lebensstil, ein hübsches Bett. Nina sank hinein und weinte. Noch nie hatte sie ihre Mutter so schmerzlich vermißt wie in dieser Nacht.
Kapitel 4
Das Human Fertility Institute war ein Marmorpalast an der Upper East Side, mit Auswüchsen aus verschiedenen Architekturepochen. Nina konnte die schwere, gepolsterte Ledertür kaum aufstoßen. In der Halle hing ein Ölporträt von einem Mann mit rosigen Wangen und fliehendem Kinn. Darunter stand ein Weihnachtsbaum. Die Leute drumherum hielten Drinks in den Händen. Weihnachtsmusik drang aus einem Lautsprecher, keineswegs zum Tanzen geeignet. Trotzdem wiegten sich einige Paare. neben dem riesigen zusammengerollten Perserteppich.
Nina ging zu einer Frau in Schwesterntracht, die an einem langen Buffet Eiswürfel in ein Glas mit rosa Zinfandel warf. »Ich habe einen Termin bei Dr. Crossman.«
Die Frau hob die Brauen. »Tatsächlich?« Klirr.
Nina nickte. »Können Sie mir sagen, wo ich ihn finde?«
»Erster Stock«, seufzte die Frau und gestikulierte mit ihrem Weinglas. »Die dritte Tür links.« Rosa Zinfandel spritzte auf ihre weißen Schuhe. »Oh, verdammt ...«
»Dr. Russell R. Crossman, Institutsleiter«, stand auf der halboffenen Tür. Nina klopfte und trat in ein menschenleeres Vorzimmer. Auf dem Schreibtisch der Sekretärin lag eine Liste. »Mom – Strümpfe. Benny – eine Prince-CD? Jennifer – Strümpfe. Joanne – Strümpfe. Melissa – Strümpfe?«
»Das war Ihre großartige Idee, wenn ich mich recht entsinne«, sagte eine Männerstimme, und Nina spähte durch die Verbindungstür.
Ein Mann saß an einem Schreibtisch, den ein guter Requisiteur für einen Mussolini-Film ausgesucht hätte. An der Wand hinter ihm hing ein Foto von einem Herrn mit fliehendem Kinn, im weißen Dinerjackett neben einer Palme.
Der Mann am Schreibtisch hatte ein etwas markanteres Kinn und einen sorgfältig gestutzten Schnurrbart. Er trug einen Nadelstreifenanzug mit roter Seidenkrawatte und einen grünen kegelförmigen Partyhut voller Silbermonde. Als er Nina entdeckte, murmelte er in die Sprechmuschel: »Also gut, ich nehme zwei. Bye.« Dann legte er auf.
»Dr. Crossman?«
»Ja?«
»Ich habe einen Termin.« Nina stellte sich vor, und er schaute in seinem Terminkalender nach.
»Heute nicht. Für heute wurden alle Termine abgesagt.«
»Das hat mir niemand mitgeteilt.«
»Hm, das hätte man aber tun sollen. Heute findet hier eine Weihnachtsparty statt.« Das Telefon läutete. Er nahm eine honiggelbe Pastille aus einer Blechbüchse auf dem Schreibtisch und steckte sie in den Mund. Der Apparat verstummte.
»Der Termin wurde letzte Woche vereinbart«, erklärte Nina.
»Ja, ich seh’s.« Dr. Crossman lutschte an der Pastille. »Aber er ist durchgestrichen. Der ganze Tag ist durchgestrichen.« Er drehte den Kalender um, damit sie es sehen konnte.
»Dr. Berry hat mich an Sie verwiesen.«
»Auch das sehe ich. Und ich habe großen Respekt vor ihm. Aber er kann nicht entscheiden, ob Sie qualifiziert sind. Das ist unsere Sache.«
»Nach welchen Kriterien richten Sie sich?«
»Nach verschiedenen. Darum geht es im ersten Gespräch.«
»Können wir anfangen? Da ich schon mal hier bin ...«
Dr. Crossman strich mit einem langen Zeigefinger über seinen Schnurrbart. Sein rötliches Haar und die Sommersprossen bereiteten Nina ein unerklärliches Unbehagen und erinnerte sie an eine Szene aus ihrer frühen Kindheit, wo ihr schlecht geworden war, als sie ein Salamibrot gegessen, und dabei im Radio eine Geschichte über einen Frosch gehört hatte.
Der Arzt schaute auf seine Uhr. Dünn, golden, ohne Ziffernblatt. Vielleicht brauchte er deshalb so lange, um sie zu studieren.
»Also gut.« Er bot ihr einen Platz an, holte einen Aktenordner, auf dem ihr Name stand, und setzte sich wieder. Dann schlug er den ärztlichen Bericht auf, den Dr. Berry ihm geschickt hatte. »Sie sind neununddreißig«, sagte er, ohne aufzublicken.
»Ja. Gibt es eine Altersgrenze?«
»Keine strikte. Aber das Alter ist einer der Faktoren.« Aus einer Innentasche seines Jacketts zog er einen Kugelschreiber und notierte die Zahl 39 auf einem Blatt Papier. »›1.84 groß, 137 Pfund‹«, las er vor. »»Blutdruck – 120 : 90. Allgemeiner Gesundheitszustand – ausgezeichnete Nennenswerte Verletzungen?«
»Ich hatte mal einen Bänderriß im Knie.«
»Wie haben Sie denn das geschafft?«
»Beim Hockeyspielen.«
»Wurden Sie operiert?«
»Ja.«
»Von wem?«
»Von Dr. Hunneycutt.«
»Walter war sehr tüchtig.« Dr. Crossman erhob sich wieder. »Jetzt ist er im Ruhestand.« Er kam um den Schreibtisch herum. »Lassen Sie mal sehen.«
»Was?«
»Das Knie.«
Sie starrte ihn an. »Hängt das Knie mit meiner Eignung zusammen, Kinder zu kriegen?«
Dr. Crossman bemerkte weder den Blick noch den scharfen Tonfall. »Wir müssen alles über Ihr gesundheitliches Befinden wissen. Das gehört zur Routine.« Sie hob den Rocksaum, und er bückte sich, um die Narbe zu begutachten. »Tadellose Arbeit.« Ehe er sich wieder aufrichtete, wanderten seine Augen ihre Schenkel hinauf, und sie zog hastig den Rocksaum nach unten.
Er sank in seinen Schreibtischsessel und schob noch eine honiggelbe Pastille in den Mund, dann blätterte er in dem ärztlichen Bericht. »Ihre Eltern sind tot?«
»Ja.«
»Geschwister?«
»Nein.«
»Keine Geschwister«, schrieb er auf das Blatt Papier. »Wer ist der nächste lebende Verwandte?«
»Ich habe einige Vettern und Cousinen in Kalifornien.«
»Ersten Grades?«
»Nein, um ein paar Ecken herum. Ich habe nur zwei gesehen, vor vielen Jahren. Hängt von diesen Umständen meine Befähigung ab, ein Kind großzuziehen?«
»Das alles zählt zu unseren Standardfragen. Haben Sie ein Testament gemacht?«
»Nein.«
»Wer würde Sie beerben?«
»Verzeihen Sie, Dr. Crossman, ich verstehe wirklich nicht, was das mit meinem Anliegen zu tun hat.«
»Nein?« Er beugte sich vor, und sie erwartete, Honigduft würde ihr in die Nase steigen. Statt dessen roch sie faulige Zähne. »Wenn Ihnen etwas zustößt, wer ist dann verantwortlich für das Kind?«
Daran hatte Nina noch nicht gedacht. »Muß das jetzt schon entschieden werden?«
»Nein, es gehört nur zu den Faktoren. Waren Sie auf dem College?«
»Ja.«
»Und Ihr Abschluß?«
»Bakkalaureus der philosophischen Fakultät, in französischer Literatur.«
»Wo?«
»Barnard.«
»Erinnern Sie sich an Ihre Zensuren?«
»Nicht genau, aber sie waren gut.«
»Nun, darüber können wir uns sicher informieren. Wiederholen Sie die folgenden Zahlen in umgekehrter Reihenfolge: 5 – 17 – 36 – 9 – 23.«
»Warum?«
Er schaute so streng drein, wie es ein Mann mit spitzem grünem Hut voller Silbermonde fertigbringen konnte. »Auch das ergibt einen Faktor, Miss Kitchener.«
»23 – 9 – 36 – 17 – 5«, erwiderte Nina rasch, ehe sie die Zahlen vergaß. »Ich begreife nicht, was das soll.«
Dr. Crossman öffnete eine Schreibtischschublade und nahm ein Blatt Papier heraus, das fünf verschiedene geometrische Figuren zeigte. »Welche paßt nicht dazu?«
»Die da. Testen Sie meinen Intelligenzquotienten, Doktor?«
»Nicht direkt, Miss Kitchener. Aber vielleicht hat Dr. Berry Ihnen nicht mitgeteilt, daß wir hier nur Spermen von hochqualifizierten Männern verwenden. Ich verrate Ihnen keine Institutsgeheimnisse, wenn ich die Nobelpreisgewinner erwähne, die sich uns zur Verfügung stellten – über ein Dutzend, und zwar nicht nur Physiker, Chemiker und Ärzte. Da sind wir aufgeschlossener. Einer unserer Samenspender hat den Nobelpreis für Literatur bekommen.« Er machte eine Pause und gab Nina eine Gelegenheit, nach dem Namen des Betreffenden zu fragen. Als sie es nicht tat, fuhr er fort: »Natürlich bin ich nicht befugt, persönliche Daten anzugeben.«
»War es zufällig Henrik Pontoppidan?«
»Wie bitte?«
»Der Nobelpreisträger von 1917.« Mehr wußte Nina nicht über diesen Mann. Pontoppidan war einer der Lieblingsnamen ihres Vaters gewesen, ebenso wie Mongo Santamaria und Cotton Mather. Er hatte sie ausgerufen, um Verblüffung oder Ekel zu bekunden, so wie andere Leute fluchen.
»Damals gab es unsere Technologie noch nicht«, erwiderte Dr. Crossman. »Aber ich versichere Ihnen, unser Mann ist viel berühmter, als der von Ihnen genannte. Worauf es hier ankommt – wir testen Sie eigentlich nicht, aber angesichts des Kalibers unserer Spender haben wir uns zum Ziel gesetzt ...« Mühsam suchte er nach Worten.
»Ihre Spermen nicht zu vergeuden?«
»Genau.« Seine langen Finger näherten sich der Blechbüchse mit den Pastillen, doch dann besann er sich anders und zog die Hand wieder zurück. »In Ihrer Akte steht, Sie seien Partnerin einer Firma namens ›Kitchener and Best‹. Was tun Sie da?«
»Publikationsberatung. «
»Sind Sie erfolgreich?«
»Möchten Sie uns engagieren, Dr. Crossman?«
Er warf ihr wieder einen strengen Blick zu, dann entschied er, daß sie vermutlich scherzte, und verzog seine Lippen sekundenlang zu einem Lächeln. Das restliche Gesicht behielt die ernste Miene bei. »Was haben Sie letztes Jahr verdient?«
»Das geht Sie nichts an.« Nina stand auf. »Ich glaube, es hat keinen Sinn.«
Zu ihrer Überraschung erhob er sich ebenfalls. »Großer Gott!« Er nahm den Partyhut ab und ließ ihn in den Papierkorb fallen. »Nicht so hastig, Miss Kitchener! Wir müssen uns über Ihre finanzielle Situation informieren. Erstens sind unsere Dienste nicht kostenlos, zweitens legen wir Wert darauf, daß die von unseren Spendern gezeugten Kinder in gesicherten materiellen Verhältnissen aufwachsen.«
Nina blieb auf dem Weg zur Tür stehen. »Was kosten Ihre Dienste?«
»500 Dollar. 750 für einen Preisträger.«
»Bekommen die Spender Prozente?«
»Das bleibt geheim.«
»Beinhaltet diese Summe auch die Geburt?«
»O nein, unsere Klientinnen wenden sich an ihre eigenen Gynäkologen. Bitte, nehmen Sie wieder Platz, Miss Kitchener.« Nina setzte sich, und Dr. Crossman schlug vor: »Wenn Sie es möchten, empfehle ich Ihnen einen, nachdem ich Sie untersucht habe.«
»Ich werde Dr. Berry konsultieren.« Nina wollte diese langen sommersprossigen Finger nicht in ihre Nähe lassen.
»Jim ist sehr tüchtig.« Er zog ein Formular aus einer Schublade, das mit auf der Spitze stehenden Pyramiden bedruckt war. »Nun noch eins.« Er schrieb »Nina Kitchener« in die oberste Pyramide und reichte ihr das Blatt. »Tragen Sie hier Ihren Stammbaum ein, und gehen Sie dabei so weit zurück wie möglich. Geben Sie auch die einzelnen Mädchennamen an, die Geburtsorte, die ethnischen Ursprünge und die Todesursachen, soweit sie Ihnen bekannt sind.«
Nina füllte die Pyramiden aus: Mutter – Alice Landers. Geboren – Syracuse, N.Y. Kaukasierin. An Lungenentzündung gestorben. Das stimmte. Als es mit ihr zu Ende gegangen war, hatte sie an Lungenentzündung gelitten. Vater – John Kitchener. Geboren – Chicago. An einem Unfall gestorben. Auch das stimmte. Von der Chemotherapie geschwächt, war er ein paar Tage vor seinem Tod eine Treppe hinabgestürzt. Weder »Brustkrebs« noch »Dickdarmkrebs« erschienen auf dem Formular. Dr. Crossman sollte nicht befürchten, seine Nobelpreis-Spermen könnten durch Krebszellen geschädigt werden.
Mit den unteren Pyramiden gab es Probleme. Hatte der Mädchenname der Großmutter Turley oder Tolmey gelautet? Und die Kitcheners waren früher Kupsteins oder Kapsteins gewesen. Ein deutschstämmiger jüdischer Einwanderer hatte sich den großartigsten englischen Namen mit K ausgesucht, der ihm eingefallen war. Ein Bigamist, aus seinem eigenen Land vor strafrechtlicher Verfolgung geflohen, hatte Ninas Vater einmal erklärt. Da sie den ursprünglichen Namen des Immigranten nicht kannte und auch nicht wußte, ab wann er sich umbenannt hatte, malte sie ein Fragezeichen unter die Wurzeln ihres Familienstammbaums.
»Dr. Crossman?« Die Zinfandel-Liebhaberin steckte den Kopf zur Tür herein. »Verzeihen Sie die Störung, aber wir schneiden jetzt die Torte an.«
»Ich komme gleich.« Die Krankenschwester schenkte Nina ein breites, beschwipstes Lächeln und verschwand wieder. »Möchten Sie noch etwas wissen, Miss Kitchener?«
»Kann ich mir den Spender aussuchen?«
»Das ist unmöglich. Alle unsere Spender bleiben anonym. Die Klientinnen erfahren nur, daß keine Erbkrankheiten vorliegen und daß das jeweilige Sperma zu ihrer Blutgruppe und anderen Charakteristika paßt.«
»Was sind das für Charakteristika?«
»Zum Beispiel, was die Rasse betrifft ... Aber das ist belanglos, denn unsere Spender sind alle weiß.«
»Ich wußte nicht, daß nur Weiße mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden.«
»Oh, das stimmt nicht, Miss Kitchener, aber ...«
»Ihre Klientinnen sind auch alle weiß.«
Dr. Crossman lächelte, diesmal über das ganze Gesicht. »Sicher wird sich herausstellen, daß Sie auf dem College ausgezeichnete Zensuren bekommen haben.« Er faltete das Formular und sein Notizblatt zusammen und steckte beides in seine Tasche. »Am Donnerstag hält das Komitee eine Sitzung ab. Dabei werden wir über Ihre Kandidatur entscheiden. Wir geben Ihnen Bescheid.«
Am Donnerstag war der 24. Dezember. »Kitchener and Best« feierten ihre Weihnachtsparty. Nina ging als letzte. Sie wollte nicht in ihr Apartment zurückkehren. Aus einem Impuls heraus wanderte sie zum Rockefeller Center, lieh sich Schlittschuhe aus und lief mit vielen anderen Leuten über die Eisbahn. Stundenlang. Aber sie wurde nicht müde. Erst als ihr Knie zu schmerzen begann, hörte sie auf. Seit Jahren hatte es ihr keine Schwierigkeiten mehr bereitet.
Als sie zu Hause mit einem Drink vor dem Fernseher saß, läutete das Telefon. »Miss Kitchener? Hier ist Dr. Crossman.«
»Ja?«
»Wann hatten Sie Ihre letzte Periode?«
»Warum wollen Sie das wissen?« Nina bemühte sich nicht, ihren Ärger zu verbergen.
»Weil wir einen Termin für die Prozedur vereinbaren müssen. Herzlichen Glückwunsch, Miss Kitchener. Das Komitee hat Sie akzeptiert.«
»So?«
»Sie haben die Eignungsprüfung mit Bravour bestanden, Miss Kitchener. Frohe Weihnachten!«
Kapitel 5
»Mein Name ist Percival«, erklärte der Mann im schwarzen Anzug und streckte eine dicke Hand aus, die sich weiß und ziemlich heiß anfühlte, als Nina sie schüttelte.
»Leiten Sie die Prozedur?« Sie hörte, wie ängstlich ihre Stimme klang. Noch war sie nicht dafür bereit, ihr Entschluß stand keineswegs fest. Aber warum war sie dann ins Human Fertility Institute gekommen? Warum hatte sie sich im Labor verschiedenen Tests unterzogen?
»Prozedur?« Er lachte gurrend. Dieses Lachen paßte zu seiner Glatze, zu dem runden rosigen Gesicht. Percival hätte ein Landedelmann aus den Zeiten vor der Entdeckung des Cholesterins sein können. »Du lieber Himmel, nein!« Er schob eine Visitenkarte über den Schreibtisch. »Ablewhite, Godfrey, Percival & Glyde« stand über einer Adresse in der City und einer Telefonnummer. »Ich kümmere mich nur um den Papierkram. Bitte setzen Sie sich.«
Nina sank in einen roten Ledersessel. Das plüschige Büro lag im ersten Stock des Instituts, in der Nähe von Crossmans Sprechzimmer. Durch die bleiverglasten Fenster sah sie tanzende Schneeflocken, die sich in der New Yorker Luft rasch braun färbten. Die schweren goldgelben Vorhänge erinnerten an jene, die es in Inspektor Clouseau-Filmen niemals schafften, Peter Sellers’ Füße zu verstecken. An der Wand hing ein Foto von dem Mann mit dem fliehenden Kinn, der gerade dem Herzog von Windsor die Hand drückte. Percival öffnete einen Aktenkoffer, nahm Papiere heraus und legte sie auf den Tisch. »Sie müssen ein paar Formulare unterschreiben.«
»Was für Formulare?«
»Amtliche. Sehen Sie sich alles mal an.« Während Nina in den Papieren blätterte, erklärte er: »Das ist der Vertrag – und mit diesem Schriftstück verpflichten Sie sich, das Institut für etwaige Probleme bei der Schwangerschaft oder bei der Niederkunft sowie Geburtsfehler nicht zur Rechenschaft zu ziehen. Das nächste Formular enthebt das Institut der Verantwortung für den Lebensunterhalt des Kindes, die Ausbildung und alle sonstigen Kosten. Das hier ist die Anonymitätserklärung des Spenders. Weder Sie noch das Kind dürfen jemals Nachforschungen bezüglich seiner Identität anstellen oder Anspruch auf sein Erbe erheben.«
»Wie kann ich so etwas im Namen eines Menschen unterzeichnen, der noch gar nicht existiert?«
Lächelnd entblößte Percival gelbe Zähne. »Vielleicht besprechen Sie die einzelnen Punkte erst einmal mit Ihrem Anwalt, Miss Kitchener.«
Nina dachte an ihre Anwälte. Janet für die Steuer, Louise für die Verträge. Und Jasons Freund Larry hatte sie erfolgreich bei ihrer Schadensersatzforderung vertreten, 10000 Dollar herausgeholt und 5000 davon selber kassiert. Sie wollte keinen dieser Juristen konsultieren. Was sie sagen würden, wußte sie, und sie mochte es nicht hören. Im nächsten Augenblick fragte sie zu ihrer eigenen Überraschung: »Haben Sie was zum Schreiben?« Ihr schwindelte, als wäre sie in eine reißende Strömung geraten. Die Babyproduktion hatte ihre eigene Schwungkraft gewonnen.
»Natürlich.« Percival zog einen dicken goldenen Füllfederhalter und einen gewöhnlichen Kugelschreiber aus der Innentasche seines Jacketts, kam um den Tisch herum und reichte Nina den Kugelschreiber, wobei er das tintige Ende höflich auf sich selbst richtete. Unter seinem wachsamen Auge unterzeichnete Nina alle Papiere. Währenddessen klingelte das Telefon, und er meldete sich. »Ja? ... Ich verstehe ... Oh, was für eine gute Nachricht ... Keineswegs, Bürgermeister, auf Wiederhören.« Grinsend legte er auf, und als das letzte Formular unterschrieben war, setzte er sich wieder hinter seinen Schreibtisch. »Noch irgendwelche Fragen?«
»War das alles?«
»Ja. Soll ich nach der Schwester läuten?«
»Okay.«
Die Zinfandel-Freundin erschien und lächelte Nina an, nicht halb so breit wie in betrunkenem Zustand. »Alles geregelt?«
»Alles«, bestätigte Percival. »Und alles Gute!« rief er Nina nach, als sie der Schwester zur Tür folgte, wobei er die Papiere in seinem Aktenkoffer verstaute.
Die Schwester führte Nina in einen winzigen Lift am Ende des Flurs, mit einer Schiebetür aus Messinggitterstäben und einer Wildlederbank und drückte auf den Knopf Nummer vier. Der Aufzug bebte, dann begann er in gemäßigtem Tempo nach oben zu gleiten. »Finden Sie diesen Lift nicht auch süß?« fragte die Schwester. »So romantisch!«
Nina, auf dem Weg zu einem Rendezvous mit eingefrorenen Spermen, gab keine Antwort.
Im vierten Stockwerk stiegen sie aus und betraten einen Korridor ohne Teppich, mit kahlen grünen Wänden und Neonlampen. Hinter ihnen erschauerte der Aufzug und kehrte in die tiefer gelegene Eleganz zurück. Die Schwester öffnete die Tür eines kleinen Raumes mit weißen Möbeln – Wandschränken, Arbeitsflächen, einem Untersuchungstisch. An einem Bügel hing ein blauer Papierkittel. »Ziehen Sie das bitte an!«
Die Schwester verschwand in einem Nebenzimmer. Nina legte ihre Kleider ab und schlüpfte in den blauen Papierkittel, der ihr bis zu den Oberschenkeln reichte. Durch die halboffene Tür beobachtete sie, wie die Schwester den Deckel eines Metallbehälters abnahm, der wie Ali Babas Urnen aussah. Nitrogendampf stieg empor und erinnerte Nina an den ersten der Geister, an die Sümpfe, wo in Horrorfilmen die Monstren auftauchen. Mit einer Pinzette brachte die Schwester ein Teströhrchen zum Vorschein und las das Etikett. Dann steckte sie das Röhrchen in eine Zentrifuge und drückte auf einen Knopf. In weißem Nebel wirbelte der Inhalt des Röhrchens umher.
»Was passiert jetzt?« fragte Nina.
»Auf diese Weise gelangen die stärksten Schwimmer an die Oberfläche«, erläuterte Dr. Crossman, der durch eine andere Tür eingetreten war. »Und wir wollen nur die stärksten Schwimmer verwenden.« Er strich über seinen rötlichen Schnurrbart. »Hi, ich bin Dr. Crossman. Und Sie ...« Er schaute auf die Papiere in seiner Hand. »Nina, nicht wahr?«
Sie nickte. Bei der letzten Begegnung war sie Miss Kitchener gewesen. Aber da hatte sie keinen Papierkittel getragen, der ihre Beine zeigte und sich hinten nicht richtig schließen ließ.
»Gerade habe ich die Ergebnisse Ihres Bluttests aus dem Labor erhalten. Sie ovulieren gerade. Mal sehen ... Laut Dr. Berry fand Ihr letzter Eisprung am 10. Januar statt, und wir sprachen uns ...«
»Am Tag Ihrer Weihnachtsparty.«
Dr. Crossman runzelte die Stirn. »Das kann nicht stimmen, da habe ich niemanden empfangen ... Doch, da steht es ja.« Immer noch sichtlich verwirrt, steckte er eine Pastille in den Mund. »Heute ist also der große Augenblick gekommen.« Er zog einen Computerausdruck zwischen seinen Papieren hervor und reichte ihn Nina. »Nun werden Sie den Vater kennenlernen.«
Während sie zu lesen begann, spürte sie, wie der Papierkittel unter ihren Armen feucht wurde.
»VT-3(h). US-Bürger, weiß. Herkunft – Nordeuropa. Größe – 1,96. Gewicht – 175. Haar – hellbraun. Augen – blau. Haut – hell. Blutgruppe – A. Erbkrankheiten – keine. Ausbildung – Universitätsstudium (Musik). Sport – Fußball. Intelligenzquotient – 128. Status – berufstätig. Besondere Merkmale – Linkshänder.«
»Nun, gefällt er Ihnen?« fragte Crossman.
Ihr fiel keine Antwort ein, und sie dachte immer noch darüber nach, als die Schwester zu ihr kam, eine Spritze mit milchiger Flüssigkeit in der Hand. Dr. Crossman zog Plastikhandschuhe an. »Wenn Sie sich jetzt bitte auf den Untersuchungstisch legen ...«
Der Tisch war sehr hoch, und es gab keinen Schemel. Nina preßte ihr nacktes Hinterteil an die Kante, stemmte sich mit beiden Händen hoch und sprang hinauf. Dabei rutschte ihr der Kittel bis zur Taille. Hastig zerrte sie den Saum nach unten und sah, wie Dr. Crossman abrupt wegschaute. Er hatte sie beobachtet. Aber was spielte das schon für eine Rolle? Wenig später steckten ihre Füße in den Beinhaltern, und er stand dazwischen. Er schaltete eine helle Deckenleuchte ein, und die Schwester rollte einen Wagen mit Instrumenten heran.
»Betatine bitte«, sagte er. Die Schwester öffnete eine Flasche mit brauner Flüssigkeit, und der Arzt tauchte ein Wattebäuschen hinein, das er in Ninas Körper schob. Er ging nicht gerade sanft mit ihr um, tat ihr aber auch nicht weh. Vielleicht hätte sie ohnehin nichts gespürt, denn sie versuchte alle physischen Gefühle zu verdrängen, dachte an die langen sommersprossigen Finger unter dem durchsichtigen Plastikmaterial, an Frösche und Salami.
»Wir sind soweit, Sal«, verkündete Crossman.
Die Schwester steckte eine durchsichtige Plastikröhre auf die Spritze und reichte sie ihm. In der anderen Hand hielt er ein Spekulum.
Nina starrte auf die weiße Flüssigkeit, dann sah sie nichts mehr, denn der Saum des blauen Kittels wurde hochgehoben. »Warten Sie!« wollte sie rufen, aber kein Laut kam aus ihrer Kehle. Sie fühlte, wie die Plastikröhre in ihr antiseptisches Inneres glitt. Dr. Crossmans nackter behaarter Unterarm streifte ihren Schenkel, dann spürte sie, wie er langsam auf die Spritze drückte, die sehr lange in ihr zu verharren schien. Es kam ihr so vor, als würde sie sich einer Abtreibung unterziehen.
Endlich zog er die Spritze heraus. Sein Blick glitt zu Ninas Gesicht. »Bleiben Sie noch ein paar Minuten liegen.« Sein Schnurrbart zuckte, schien zu jucken, aber Dr. Crossman wollte sich vermutlich nicht kratzen, mit seinen Fingern in ihrem gegenwärtigen Zustand. Rasch verließ er den Raum.
Sal schaute auf sie hinab. »Es war doch gar nicht so schlimm – oder?«
»Nein.«
»Gut.« Die Schwester rollte den Instrumentenwagen davon. »Bin gleich wieder da.« Die Tür schloß sich, und Nina überlegte, ob sie jemals wieder einen Orgasmus erleben würde.
Bald schwang die Tür auf. »Oh, Sie müssen die Füße nicht in den Beinhaltern lassen«, sagte Sal. »Er meint nur, Sie sollen auf dem Rücken liegen.«
Nina errötete. »Kann ich jetzt aufstehen?«
»Klar. Ich bringe Sie runter ins Büro.« Nachdem Nina sich angezogen hatte, hängte sie den Papierkittel an einen Beinhalter.
Im Büro übergab man ihr eine Rechnung über 500 Dollar. »Und wenn es nicht geklappt hat?« fragte sie.
»Haben Sie den Vertrag nicht gelesen?« erwiderte der Buchhalter.
»Ich entsinne mich nicht.« Sie versuchte nicht, ihren scharfen Tonfall zu mildern.
Der Mann blinzelte. »Sie können wiederkommen – ohne zusätzliche Kosten. Paragraph 13 d.«
Nina stellte einen Scheck über 500 Dollar aus. »Offenbar habe ich keinen Preisträger abgekriegt«, bemerkte sie, weil sie sich an die 750 Dollar für besonders hochwertige Spermen erinnerte.
»Davon weiß ich nichts.« Der Buchhalter nahm den Scheck entgegen.
Nina ging nach Hause, VT-3(h) im Unterleib und immer noch unschlüssig. Sie duschte, so heiß sie es ertrug.
Fünfunddreißig Tage später gratulierte ihr Dr. Berry. Sie mußte irgendetwas geantwortet haben, wußte aber nicht, was.