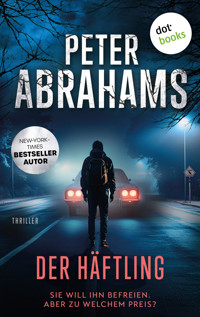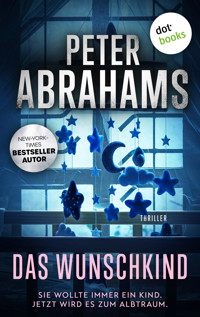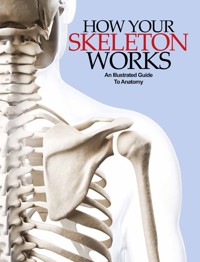0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Domestic-Thrill: Wenn die perfekte Ehe zum Schauplatz des perfekten Verbrechens wird … Der geniale Roger und die schöne Francie Cullingwood: Einst galten sie in der Bostoner High-Society als das Traumpaar schlechthin – ein perfektes Match, das auf den Tennisplätzen Harvards seinen Anfang nahm. Doch aus Roger ist ein eitler und herrschsüchtiger Mann geworden, weshalb Francie Trost in den Armen des charmanten Radiopsychologen Ned sucht. Als Roger von Francies Affäre erfährt, sinnt er auf Rache: Wie Schachfiguren in einem tödlichen Spiel beginnt er, seine Frau, ihre beste Freundin und ihren Liebhaber zu manipulieren und gegeneinander auszuspielen – mit dem Ziel, das perfekte Verbrechen zu inszenieren. Doch selbst einem Genie passieren Fehler. Fehler mit fatalen Folgen ... »Peter Abrahams ist so begabt wie kein anderer, der heute Spannung schreibt.« – Michael Palmer, New York Times-Bestsellerautor Ein genial konstruierter Thriller über Mord und Rechenschaft, Lust und Vergeltung, Begehren und Verantwortung an Amerikas reicher Ostküste. Für Fans von Harlan Coben und Joy Fielding.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der geniale Roger und die schöne Francie Cullingwood: Einst galten sie in der Bostoner High-Society als das Traumpaar schlechthin – ein perfektes Match, das auf den Tennisplätzen Harvards seinen Anfang nahm. Doch aus Roger ist ein eitler und herrschsüchtiger Mann geworden, weshalb Francie Trost in den Armen des charmanten Radiopsychologen Ned sucht. Als Roger von Francies Affäre erfährt, sinnt er auf Rache: Wie Schachfiguren in einem tödlichen Spiel beginnt er, seine Frau, ihre beste Freundin und ihren Liebhaber zu manipulieren und gegeneinander auszuspielen – mit dem Ziel, das perfekte Verbrechen zu inszenieren. Doch selbst einem Genie passieren Fehler. Fehler mit fatalen Folgen ...
Über den Autor:
Peter Abrahams ist ein renommierter amerikanischer Autor zu dessen weltweiter Leserschaft auch Stephen King gehört, der ihn als seinen »liebsten amerikanischen Spannungsromanautor« bezeichnet. Einige seiner Werke wurden mit hochkarätigen Stars wie Robert De Niro für die große Leinwand adaptiert.
Die Website des Autors: www.peterabrahams.com/peter-abrahams/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Standalone-Thriller »Der Nachhilfelehrer«, »Der ideale Ehemann«, »Das Wunschkind«, »Dear Wife«, »Blacked Out – Gefährliche Erinnerung«, »Missing Code – Verlorene Spur« und »Hard Rain – Schleier aus Angst«.
***
eBook-Neuausgabe September 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »A Perfect Crime« bei Ballantine Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Kopflos« bei Knaur Taschenbuch.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1998 by Pas de Deux
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2015 Knaur Taschenbuch.
Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Das Zitat von Nathaniel Hawthorne stammt aus
»Der scharlachrote Buchstabe«, in der Übersetzung von
Barbara Cramer-Neuhaus, Insel Verlag, 2. Auflage 2004
Copyright © der Neuausgabe 2014 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motives von © Adobe Stock / Viorel Sima sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-182-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Peter Abrahams
Der ideale Ehemann
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Frauke Czwikla
dotbooks.
Widmung
Dieses Buch ist Alan Cohen gewidmet.
Zitat
Der scharlachrote Buchstabe
war ihr Pass für Regionen,
welche andere Frauen
nicht zu betreten wagten.
Nathaniel Hawthorne
Kapitel 1
Donnerstag, der beste Tag der Woche – der Tag aller Tage, geradezu prädestiniert für Francie, um ja zu sagen. Aber jetzt, im Atelier des Künstlers mit Blick auf den Gastank von Dorchester, der jenseits des Hafens aufragte, konnte sie sich nicht dazu durchringen. Ihr Problem war, dass sie die Gemälde hasste. Material: Tusche; Technik: Airbrush; Stil: Fotorealismus; Motiv: Menschen mit leblosen Mienen, die in einer Kunstgalerie Installationen betrachteten. Bei genauerem Hinsehen waren die Installationen mit blutverschmiertem Stacheldraht umsäumte Neonbotschaften, Botschaften, die sie trotz der Winzigkeit lesen konnte, wenn sie noch genauer hinsah. Francie, die Nase dicht vor der Leinwand, las sie pflichtschuldig: Erkenn die Melodie; Schwörst du, die Wahrheit zu sagen?; Uns bleibt immer die Erinnerung.
»Eine Welt innerhalb der Welt«, kommentierte sie, eine neutrale Phrase, die man auch positiv verstehen konnte.
»Wie bitte?«, fragte der Künstler, der ihr nervös durchs Atelier folgte.
Francie lächelte ihn an – abgezehrt, hohläugig, reizbar, ungepflegt –, Raskolnikow auf Amphetamin. Sie hatte Gemälde von leblosen Menschen gesehen, die Gemälde betrachten; Neonbotschaften; Stacheldraht, blutverschmiert, rosa, rotweiß-blau; sie hatte Kunst gesehen, die sich selbst verschlang, mit einem Appetit, der jeden Tag stärker wurde.
»Noch etwas anderes, was Sie mir zeigen wollen?«, erkundigte sie sich.
»Etwas anderes?«, wiederholte der Künstler. »Ich bin nicht ganz sicher, was Sie ... «
Francie hielt ihr Lächeln aufrecht; Künstler hatten kein leichtes Leben. »Andere Arbeiten«, erklärte sie so behutsam wie möglich.
Aber nicht behutsam genug. In einer dramatischen Geste riss er seinen Arm empor. »Das sind meine Arbeiten.«
Francie nickte. Einige ihrer Kollegen würden jetzt sagen »und sie sind wunderbar« und ihm die schlechte Nachricht in einem Brief der Stiftung mitteilen, aber das brachte Francie nicht fertig. Schweigen breitete sich aus, lang und unbehaglich. Die Zeit verlangsamte sich, viel zu früh. An Donnerstagen wollte Francie, dass die Zeit sich verhielt wie in einigen von Einsteins Gedankenspielen, bis zum Einbruch der Dunkelheit voranhastete und dann nahezu zum Stillstand kam. Der Künstler starrte auf seine Schuhe, rote Leinenturnschuhe voller Farbspritzer. Francie starrte sie ebenfalls an. Schwörst du, die Wahrheit zu sagen? Selbst miserable Kunst konnte einen berühren, oder zumindest sie. Aus dem Augenwinkel erspähte sie etwas – eine kleine, ungerahmte Leinwand, die an der Laibung eines türlosen Schranks lehnte – und trat näher heran, um wenigstens das Schuhstarren zu beenden.
»Was ist das?« Ein Ölgemälde eines klassischen Sockels, gesprungen, bröckelnd, auf dem Trauben lagen, weindunkel, überreif, verfaulend. Und im Mittelgrund, weder versteckt noch hervorgehoben, einfach da, die reizende Figur eines Mädchens auf einem Skateboard, ganz Hingabe, Balance, Tempo.
»Das?«, fragte der Künstler. »Das ist schon Jahre her.«
»Erzählen Sie mir etwas darüber.«
»Was gibt es da zu erzählen? Es war eine Sackgasse.«
»Sie haben nichts anderes in dieser Art gemalt?« Francie kniete sich hin, drehte das Bild um und las die Rückseite: O Garten, mein Garten.
»Doch, Dutzende«, sagte der Künstler. »Aber ich habe alle übermalt, wenn ich Leinwand brauchte.«
Francie unterdrückte einen raschen Blick zu den aufdringlichen Stücken an der Wand.
»Das ist das letzte. Warum fragen Sie?«
»Es besitzt eine Art ... « Etwas. Es hatte dieses Etwas, nach dem sie ständig Ausschau hielt und das so schwer in Worte zu fassen war. Um professionell zu klingen, sagte Francie: »Resonanz.«
»Ehrlich?«
»Ich finde schon.«
»Damals gefielen sie niemandem.«
»Vielleicht stehe ich einfach auf überreifes Obst.« Aber sie wusste, dass es nicht daran lag. Es war das Mädchen. »Caravaggio und so«, erklärte sie.
»Caravaggio?«
»Sie wissen schon«, sagte sie. Ihr sank das Herz.
»Eine Traubensorte?«
»Das hat er gesagt? Eine Traubensorte?« Nora, die ihr Mittagessen verputzt hatte – ein sehr spätes Mittagessen im Stehen in einer Kaffeebar im North End –, bediente sich bei Francie. »Die Vergangenheit wird bald völlig vergessen sein.«
»Und das Leben kann beginnen«, sagte Francie.
Nora hielt im Kauen inne. »Alles in Ordnung bei dir?«
»Warum willst du das wissen?«
»Wie geht’s Jolly Roger dieser Tage?«
»Warum willst du das wissen?«
Nora lachte, verschluckte sich beinah und wischte sich den Mund. »Kannst du heute Abend für mich spielen?«
Nora meinte Tennis. Sie gehörten demselben Verein an, hatten seit der achten Klasse zusammen gespielt.
»Nicht donners- – nein«, antwortete Francie.
»Ich würde ihr nur ungern absagen.«
»Wem?«
»Anne? Anita? Ein neues Mitglied. Ein schüchternes, kleines Weibchen, aber sie spielt gut. Du solltest sie kennenlernen.«
»Heute Abend nicht.«
»Das sagtest du schon. Was machst du denn heute Abend?«
»Arbeiten«, erwiderte Francie nicht ohne Gewissensbisse. »Und du?«
»Ich bin verabredet. Er hat mich heute Morgen angerufen.«
»Für heute Abend? Und du hast ja gesagt?«
»Er weiß bereits, dass ich schon zweimal verheiratet war – warum sollte ich mich für den Rest meines Lebens anstellen wie eine zimperliche Jungfrau?«
»Wer ist denn der Glückspilz?«
»Bernie Irgendwas.«
»Und da sind wir wieder. Ich bin Ned Demarco und begrüße Sie bei Intimleben. Unsere Themen sind Ehe, Liebe, Familie in einer zunehmend komplexeren Welt. Heute ist Donnerstag, und wie unsere Stammhörer wissen, ist Donnerstag der Tag, an dem wir kein festes Programm haben, keine Studiogäste, keine vorgegebenen Themen. Wir reden über das, worüber Sie reden wollen. Willkommen in unserer Sendung, Marlene aus Watertown.«
»Dr. Demarco?«
»Nennen Sie mich Ned.«
»Ned. Hi, ich liebe Ihre Sendung.«
»Dankeschön, Marlene. Was haben Sie auf dem Herzen?«
»Darf ich Sie zuerst noch etwas fragen?«
»Schießen Sie los.«
»Ihre Stimme. Wird da irgendwas gemacht, um sie besser klingen zu lassen?«
»Lucy in der Regie, macht ihr irgendwas, um mich besser klingen zu lassen?« Er lachte wieder, unbeschwert und natürlich. Mit jeder Sendung entspannter, dachte Francie. »Lucy sagt, sie tut alles, was die Wissenschaft ermöglicht. Sonst noch etwas, Marlene?«
»Na ja, eigentlich geht es um meinen Mann.« Die Frau zögerte.
»Fahren Sie fort.«
»Er – er ist ein wunderbarer Vater, ein ausgezeichneter Ernährer. Er hilft sogar bei der Hausarbeit.«
»Klingt ideal.«
»Ich weiß. Deshalb habe ich auch so ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, was ich auf dem Herzen habe.«
»Was beschäftigt Sie denn, Marlene?«
Sie holte tief Luft, tief und angespannt, deutlich über ihre Telefonleitung, die Übertragung, durch die Lautsprecher in Francies Auto zu hören. »In letzter Zeit habe ich oft Tagträume von dem Jungen, mit dem ich damals auf der Highschool war. Nachtträume auch. Ich meine wirklich andauernd, Dr. – Ned. Und meine Frage ist nun: Wäre es schlimm, wenn ich ihn suche?«
Ned zögerte. Francie konnte spüren, wie er nachdachte.
Sie fuhr in einen Tunnel und verlor ihn, ehe die Antwort erfolgte.
Die Stadt in ihrem Rückspiegel wurde immer kleiner, bis sich vor dem kalten silbrigen Himmel nichts mehr abzeichnete, außer den beiden Spitzen der großen Türme, die der Innenstadt ihr unverwechselbares Aussehen verliehen. Francie überquerte die Grenze nach New Hampshire, fuhr über immer bedeutungslosere Straßen Richtung Norden in die Wildnis hinter der letzten Frühstückspension und erreichte bei Einbruch der Dämmerung Brendas Tor. Sie stieg aus, entriegelte das Tor, und fuhr hindurch, ohne das Tor wieder zu schließen, wie sie es immer tat. Der Feldweg unter der dicken Laubschicht führte über einen Hügel und wieder hinunter durch steinige Wiesen bis zum Fluss. Das Licht war fast vollständig vom Himmel verschwunden, aber der Fluss klammerte sich an das, was übrig war: rote, goldene und orangefarbene Streifen; wie ein herbstlicher Turner, betrachtet durch eine von Fingerabdrücken verschmierte Linse. Francie hielt vor der kleinen steinernen Mole, an deren Leeseite zwei Dingis – das rote Prosciutto und das grüne Melone – festgemacht hatten. Als sie eins davon bestieg, erkannte sie die Ursache der seltsamen Lichtreflexionen – eine Eisschicht bedeckte den Fluss. So früh? Sie ruderte hinaus zur Insel, die Ruderblätter durchschnitten das feurige Schimmern, Eisschollen kratzten am Bug.
Brendas Insel lag rund fünfzig Meter vom Ufer entfernt in der Mitte des Flusses, ein dickes Oval mit flachen Enden, gerade mal ein Morgen groß. Sie verfügte über einen Steg, fünf riesige Ulmen – durch die Quarantäne vom Ulmensterben verschont –, dichtes Gestrüpp, das seit Jahren nicht gerodet worden war, und einen gepflasterten Pfad, der zum Ferienhaus führte. Francie schloss die Tür auf und ging hinein, schloss sie hinter sich und ließ sie unverriegelt, wie sie es immer tat.
Das Ferienhaus: Kieferndielen, Kieferntäfelung; das ganze alte, auf Hochglanz gebohnerte und polierte Holz wirkte fast lebendig, wie ein Baumhaus im Märchen. Die Küche ging nach Süden, flussabwärts; ein L-förmiges kombiniertes Ess-/Wohnzimmer lag gegenüber dem Ufer; im Obergeschoss zwei Schlafräume mit Messingbetten, eines ohne Bettzeug, das andere mit Tagesdecke und Kissen. Ein perfektes kleines Ferienhaus, das sich seit mehr als hundert Jahren im Besitz von Brendas Familie befand; aber Brenda, Francies Mitbewohnerin auf dem College, war die letzte Überlebende, und sie wohnte in Rom. Sie hatte Francie gebeten, dort nach dem Rechten zu sehen und es im Gegenzug zu benutzen, wann immer sie wollte, und Francie hatte sich ohne Hintergedanken dazu bereit erklärt.
Francie schaltete den Generator ein, zündete den Holzofen an, goss sich ein Glas Rotwein ein, setzte sich an den Küchentisch und sah zu, wie die Nacht alles verschlang – Ufer, Fluss, Steg, die großen kahlen Ulmen – und nur die Sterne zurückließ wie Löcher am Himmel, die ein Strahlen dahinter verrieten. Das Skateboard-Gemälde – OGarten, mein Garten – ging ihr durch den Sinn. Durfte sie es für sich selbst erwerben, falls der Preis stimmte? Der Maler wäre vermutlich nur allzu glücklich über den Verkauf, aber ein Ankauf durch die Stiftung wäre seiner Karriere von größerem Nutzen. Francie debattierte eine Weile mit sich selbst. Die Antwort war nein.
Sie legte noch ein Scheit in den Ofen, füllte ihr Glas auf und sah auf die Uhr. Ein erster Anflug von Sorge, wie ein Daumen, der von innen gegen ihr Brustbein drückte, machte sich bemerkbar. Vielleicht ein bisschen Musik. Sie ging gerade geistig Brendas CD-Sammlung durch, als die Tür aufschwang und Ned hereinkam.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin.«
»Ich habe mir Sorgen gemacht.«
»Um mich?«, erwiderte er überrascht. Er lächelte sie an; sein Gesicht war von der Kälte gerötet, sein schwarzes Haar von der Flussbrise zerzaust. Die Atmosphäre im Ferienhaus war vollkommen verwandelt: Die Nacht hatte ihre Macht verloren, ihren Zugriff auf das Ferienhaus, sie zog sich zurück.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Vollkommen.«
Sie standen sich in der Küche von Brendas Ferienhaus gegenüber. Der Ausdruck in Neds Augen änderte sich, dunkle Augen, die Francie zu lesen gelernt hatte, wie Barometer, Meteorologin seiner Seele.
»Weißt du, was ich liebe?«, fragte er. »Wenn du hier auf mich wartest, das einzige Licht im meilenweiten Umkreis, und ich zu dir herüberrudere.« Er kam näher und schloss sie in die Arme.
Francie hörte ihr Aufstöhnen, ein unwillkürlicher Laut, in dem sie unmissverständlich Verlangen erkannte. Es war ihr egal, ob er es auch hörte, sie hätte es ohnehin nicht unterdrücken können.
»Du hast mir gefehlt«, sagte er. Seine Stimme vibrierte in ihrem Ohr. Und was für eine Stimme!
»Was hast du Marlene geantwortet?«, fragte Francie, das Gesicht an seine Brust geschmiegt.
»Marlene?«
»Die sich mit ihrem alten Freund vom College treffen wollte.«
»Du hast die Sendung gehört?« Er lehnte sich etwas zurück, um ihr ins Gesicht zu sehen. »Wie fandest du sie?«
»Du wirst immer besser.«
Er schüttelte den Kopf. »Danke, aber sie war von Anfang bis Ende öde – und das ausgerechnet jetzt, wo die Budgetplanungen anstehen.«
Im darauffolgenden Schweigen spürte Francie, wie seine Gedanken abschweiften. Sie wiederholte ihre Frage. »Was hast du ihr geantwortet?«
Er zuckte die Achseln. »Dass sie mit dem Feuer spielt.«
Ein kurzes Frösteln streifte Francies Nacken, ein Luftzug vielleicht; es war immerhin ein sehr altes Gebäude, fast ohne Dämmung. Im nächsten Moment legte Ned seine Hand auf die Stelle, genau auf den eisigen Punkt, und rieb sie sanft. Dann erneut die Stimme in ihrem Ohr: »Aber manchmal ist Feuer unwiderstehlich.«
Francie spürte, wie ihre Nippel hart wurden, nur von den Worten, nur von der Stimme. Und das Leben kann beginnen. Sie gingen nach oben, Francie voran, Ned hinterher, wie sie es immer taten.
Brendas Ferienhaus war ihre Welt. In Wahrheit war ihre Welt sogar noch kleiner. Im Wohnzimmer hielten sie sich nur auf, um Scheite nachzulegen, in der Küche gelegentlich, um etwas zu trinken, aber nicht zu essen – Ned schien nie hungrig zu sein – und zum Duschen benutzten sie das Bad im Obergeschoss; abgesehen davon verbrachten sie ihre gemeinsame Zeit in dem hergerichteten Schlafzimmer im ersten Stock. Es war nicht viel größer als eine Gefängniszelle, eine Gefängniszelle, in der die Haft nie lang genug dauerte.
In diesem Schlafzimmer herrschte Stille, abgesehen von den Lauten, die sie selbst unter der Decke erzeugten. Manchmal ließ Ned sich viel Zeit; manchmal griff er ohne jedes Vorspiel zwischen ihre Beine, so wie jetzt. Es spielte keine Rolle: Francie, die sexuell immer nur langsam oder gar nicht reagiert hatte, reagierte auf Ned, egal was er tat. Sie begann wieder zu stöhnen, und das Stöhnen steigerte sich zu spitzen Schreien, die immer lauter wurden, so laut, dass man sie mit Sicherheit draußen hören konnte – das nahm sie wenigstens an, obwohl es nicht darauf ankam: Sie waren allein auf dieser Insel mitten im Fluss, wo niemand sie hörte, und dann kam sie, nur durch die Berührung seiner Fingerspitze.
Danach glitten sie ineinander, nicht wie Tanzpartner oder altvertraute Liebende oder irgendein anderes Klischee, sondern wie ein einzelner Organismus, der seine Glieder neu ordnete.
Ihre Welt schrumpfte weiter, wurde enger als selbst das Schlafzimmer, beschränkte sich auf den Platz unter der Decke, eine warme, feuchte, sanfte Welt, die die uralte Verbindung zwischen Sex und Liebe bewies, zumindest in Francies Vorstellung. Sie starrte in Neds Augen, glaubte, bis auf ihren Grund zu sehen, glaubte, dass er dasselbe in ihren sah.
Sie kamen gleichzeitig – wie Francie das Vokabular dafür verabscheute –, konnten dieses vermeintliche Ziel aller Liebenden erreichen, wann immer sie wollten, und Ned ließ sich auf sie sinken.
»Es ist jedes Mal anders«, sagte er nach ein oder zwei Minuten.
»Das habe ich auch gerade gedacht.«
Sie verharrten reglos. Francie stellte sich vor, wie Ned durch die Dunkelheit ruderte, während sie selbst im Ferienhaus wartete, mit klopfendem Herzen. »Es ist wie in der ›Ode an eine griechische Vase‹, nur dass die Erwartungen sich erfüllen.« Er schwieg. »Zumindest meine«, fügte sie hinzu, weil sie nicht für ihn sprechen wollte. Aber Ned war eingeschlafen, wie er es manchmal tat. So wie er auf ihr lag, konnte sie ihre Uhr nicht erkennen; sie würde ihn ein Weilchen schlafen lassen. Sie atmeten gemeinsam, ihre Nasen berührten einander fast. In gewisser Weise war dies das Beste von allem.
Einige Zeit später hörte Francie von draußen ein Geräusch, Laute, die sie zunächst nicht identifizieren konnte, dann aber als das Schlagen schwerer Schwingen erkannte. Eine Eule vielleicht. Zumindest eine lebte auf der Insel; sie hatte sie einmal bei einem Tagflug beobachtet, wenige Minuten bevor sie Ned zum ersten Mal gesehen hatte: im August, nur wenige Monate zuvor.
Francie saß auf dem Steg, ihre Füße in die Strömung getaucht. Sie verbrachte ungefähr eine Stunde damit, die Dias zu betrachten, dann legte sie sie zur Seite und legte sich auf den Rücken, die Augen gegen die Sonne geschlossen. Die Dias gingen ihr noch eine Weile durch den Kopf – Bilder kaltherziger Kinder, befremdend und verstörend –, dann verblassten sie. Francie war fast eingeschlafen, als sie spürte, wie ein Schatten über ihren Körper glitt. Sie schlug die Augen auf; es war keine Wolke, die sich vor die Sonne schob, sondern eine niedrig fliegende Eule, die etwas Weißes im Schnabel trug. Die Eule breitete die Schwingen aus, streckte die Krallen vor und verschwand im hohen Geäst einer der Ulmen. Als Francie sich wieder dem Fluss zuwandte, sah sie ein Kajak, das stromaufwärts glitt.
Ein schwarzes Kajak mit einem dunklen Kajakfahrer, der heftig paddelte. Als er sich näherte, sah Francie, dass er kein Hemd trug. Er war durchtrainiert, ohne muskelbepackt zu sein, mit behaarter Brust, die vor Schweiß glänzte. Er bemerkte sie nicht; sein Blick war leer, und er schien mit aller Kraft zu paddeln, als fahre er ein Rennen. Er flog vorbei, in den östlichen Arm des Flusses, und verschwand hinter der Insel.
Francie legte sich wieder auf den Steg und schloss die Augen. Aber jetzt wollten sie nicht geschlossen bleiben, und sie wollte nicht länger liegen. Sie stand auf, tauchte die Zehenspitzen ins Wasser und sprang in den Fluss. Das Wasser war sehr warm, wärmer, als sie es mochte. Francie schwamm ein paar Züge, dann klappte sie nach vorn, wie sie es vor Jahren im Sommerlager gelernt hatte, und stieß mühelos in die kälteren Schichten vor.
Francie hatte schon immer gut den Atem anhalten können. Sie tauchte stetig am Boden entlang, entledigte sich der von der Sonne erzeugten Trägheit, bis sie schließlich mit klarem Kopf zur Oberfläche aufstieg. Sie brach hindurch, holte tief Luft – und erblickte nur wenige Paddelschläge entfernt das Kajak, das die Insel umrundet hatte und nun direkt auf sie zuhielt.
Der Mann paddelte so intensiv wie zuvor, sein Blick immer noch leer. Francie öffnete den Mund, um zu schreien. In diesem Moment sah er sie. Unvermittelt setzte seine Koordination aus; er geriet aus dem Takt und das Paddel ließ das Wasser aufspritzen. Das Wasser hing noch in der Luft, als das Kajak kippte.
Das Paddel schoss an die Oberfläche und trieb neben dem umgedrehten Kajak, aber den Mann konnte Francie nicht entdecken. Sie tauchte unter das Kajak und langte hinein; er war nicht dort. Sie spähte in die Tiefe, sah nichts, schwamm wieder nach oben. Eine Sekunde später brach er direkt neben ihr durch die Oberfläche und schnappte nach Luft. Er blutete aus einem Schnitt an der Stirn.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie.
Er sah sie an. »Wenn Sie nicht vorhaben, mich zu verklagen.« Francie lachte. Unter der Wasseroberfläche berührten sich ihre Beine. Am nächsten Tag rief er sie im Büro an. Sie hatte nicht nach Liebe gesucht, hatte sich darauf eingestellt, den Rest ihres Lebens ohne zu verbringen, und hatte sich vielleicht aus diesem Grund umso heftiger verliebt.
Ned wachte auf. Francie wusste sofort, dass er wach war, obwohl er sich nicht gerührt hatte. Sie öffnete den Mund, um ihm von O Garten, mein Garten zu erzählen, als er plötzlich ganz steif wurde. »Wie spät ist es?«, fragte er.
»Das weiß ich nicht.«
Er rollte zur Seite und sah auf seine Uhr. »Lieber Himmel.« In Sekundenschnelle war er aus dem Bett, aus dem Zimmer verschwunden, und die Dusche lief. Francie stand auf, zog den Morgenmantel an, den sie in Brendas Schrank aufbewahrte, ging hinunter in die Küche und trank ihren Rotwein aus. Ganz plötzlich hatte sie Hunger. Sie malte sich aus, wie es wäre, mit ihm irgendwo essen zu gehen, zu feiern, und dann zurückzukehren, zurück in das kleine Schlafzimmer.
Ned kam die Treppe herunter und band im Gehen seine Krawatte. Eine schöne Krawatte – all seine Krawatten, seine Kleidung, die Art, wie er sein Haar trug: schön.
»Hungrig?«, fragte sie.
»Hungrig?«, wiederholte er überrascht. »Nein. Du?«
Sie schüttelte den Kopf.
Er beugte sich vor und küsste sie zart auf die Stirn. »Ich rufe an«, sagte er.
Sie hob das Gesicht. Er küsste sie erneut, diesmal auf den Mund, immer noch sehr zart. Sie leckte seine Lippen, schmeckte Zahnpasta. Er richtete sich auf.
»Zurückrudern ist nicht so schön«, bemerkte er.
Dann war er fort, die Tür öffnete und schloss sich leise. Der Luftzug erreichte Francie ein paar Sekunden später.
Während er zurück in die Stadt raste, wurde Ned bewusst, wie hungrig er eigentlich war. Hatte er seit dem Frühstück etwas gegessen? Er dachte daran, unterwegs irgendwo anzuhalten, fuhr aber weiter, ein Auge auf dem Radarwarngerät; er aß am liebsten zu Hause.
Ned schaltete das Radio ein, suchte ihre einzige Tochterfirma, einen schwachen Mittelwellensender, der die Sendungen nachts wiederholte. Er hörte sich selbst sagen: »Wie meinen Sie das, ihn suchen?«; ein bisschen zu scharf, darauf musste er achten.
»Sie wissen schon«, antwortete die Frau – Marlene oder wie sie hieß. »Herausfinden, wo er ist. Ihn anrufen.«
»Zu welchem Zweck?«
»Zu welchem Zweck?«
Er hätte sie in diesem Moment loswerden müssen; er musste noch so viel über den Gesprächsteil lernen. »Was wollen Sie damit erreichen?«
»Ich schätze, ich möchte einfach wissen, was dann passiert.«
»Marlene?«
»Ja?«
»Als Sie die guten Seiten Ihres Mannes beschrieben haben – korrigieren Sie mich bitte, wenn ich mich irre –, haben Sie nichts über Ihr Sexualleben gesagt.«
»Ich habe es versucht, Ned. Es interessanter zu machen. Es hat nicht funktioniert.«
»Was haben Sie versucht?« Das Autotelefon klingelte, und Ned entging die Antwort der Frau; soweit er sich erinnerte, war sie auch nicht sonderlich interessant gewesen, obgleich er annahm, dass die Frage zu denen gehörte, die den Gesellschaftern gefielen.
»Hallo?«, meldete er sich.
»Dad? Hi, ich bin’s, Em.«
»Ich habe deine Stimme erkannt.«
»Du hältst dich wohl für komisch. Wo bist du?«
»Auf dem Weg.«
»Es gibt keinen Nachtisch.«
»Was hättest du denn gern?«
»Krokanteis mit Mandeln.«
»Betrachte das als erledigt. Hab dich lieb.«
»Ich hab dich auch lieb, Dad.«
Ned hielt an einem Supermarkt in der Nähe seines Hauses und besorgte zwei Packungen Krokanteis, Schokoladensauce und Mandeln. An der Kasse fielen ihm hübsche Schnittblumen ins Auge: Iris, immer eine sichere Wahl. Er kaufte ein paar für seine Frau.
Kapitel 2
In Gedanken bei Francies Stöhnen und ihren spitzen Schreien parkte Ned in der Garage neben seinem Haus und blieb noch einige Momente in der Dunkelheit sitzen. Es musste einen evolutionären Grund für diese weiblichen Laute geben, etwas, das wichtig genug war, um das Risiko angreifender nächtlicher Raubtiere aufzuwiegen. Hatte es etwas mit Paarbindung zu tun, deren positiver Auswirkung auf die nächste Generation? Ned rieb sich die Stelle auf seiner Stirn zwei Zentimeter über seiner rechten Augenbraue, wo die Kopfschmerzen immer ihren Anfang nahmen, wie jetzt auch wieder, griff nach der Einkaufstüte und ging ins Haus.
Em saß im Schlafanzug am Küchentisch und malte. Die nächste Generation. »Rat mal, was das sein soll.«
»Das Sonnensystem.«
Sie nickte. »Rat mal, wie viele Monde der Saturn hat.«
»Viele. Vielleicht zehn.«
»Achtzehn. Und welcher ist der größte?«
»Schwere Frage. Triton?«
»Triton, Dad? Triton gehört zum Neptun. Du hast noch eine Chance.«
»Krokant?«
»Das ist nicht lustig.«
Ned löffelte Eiskrem in zwei Schalen – drei Löffel für ihn, er war so hungrig –, goss Schokoladensauce darüber und streute Mandeln drauf. Er hob den ersten Löffel: »Ich schau dir in die Augen, Kleines.«
Em verdrehte die Augen. »Warum finden alle alten Leute diesen blöden Film so toll?«
»Alte Leute?« Er schob das Eis in den Mund und zuckte vor Schmerz fast zusammen; Eiskrem war exakt der Treibstoff, auf den seine Kopfschmerzen gewartet hatten.
Anne betrat das Zimmer, unter dem Arm einen leeren Wäschekorb. »Du kommst spät.«
»Es ist Donnerstag, Mom«, sagte Em, ehe er antworten konnte. »Da bleibt Dad doch immer länger, um die Sendungen für nächste Woche vorzubereiten.«
»Hatte ich vergessen«, sagte Anne.
Ned drehte sich zu ihr um. »Du wirkst müde.«
»Es geht mir gut. Wie lief die Sendung?«
Hörte sie sich nie eine an? »Nicht schlecht.« Er langte in die Einkaufstasche und reichte ihr die Iris.
»Die sind aber schön«, sagte Anne. »Was ist denn der Anlass?«
»Einfach nur so.«
»Um Himmels willen, Mom«, sagte Em. »Wo bleibt denn dein Sinn für Romantik.«
Ned benutzte Zahnseide und -bürste, nahm zwei Ibuprofen und eine Schlaftablette und ging ins Bett. Sein Gehirn fuhr herunter, Abteilung für Abteilung, bis nichts außer den Kopfschmerzen zwischen ihm und dem Schlaf stand. Dann waren sie weg, und er versank in einen Traum. Einen Ferienhaustraum: er lag in dem roten Boot, doch irgendwie schaute er gleichzeitig aus dem Fenster des kleinen Schlafzimmers; Francie lag hinter ihm, streichelte seine Oberschenkel mit ihren weichen, wunderbar geformten Händen, die immer höher glitten. Er wurde sofort steif, stöhnte, rollte sich herum, griff nach ihr, hätte beinah »Francie« gemurmelt. Aber es war Anne; seine Hände erkannten sie sofort, retteten ihn. Der Traum löste sich auf, das Bild des roten Bootes verblasste als Letztes.
Sie liebkoste ihn. Es war angenehm, vertraut, heimelig. Aber Anne, die ihn aufforderte? Das war ungewöhnlich. Er versuchte sich an ihr letztes Mal zu erinnern – ihr Geburtstag? seiner? –, aber es gelang ihm nicht. Als könnte sie seine Gedanken lesen sagte sie: »Ich habe durchaus Sinn für Romantik, weißt du.«
Das traf ihn. »Ich weiß.« Die Worte blieben ihm im Hals stecken, beinah hätte er hier und jetzt alles gebeichtet. Aber er riss sich zusammen, sagte nichts mehr; sie interpretierte das Stocken seiner Stimme falsch, hielt es für Lust; ließ ihn ohne weitere Umstände in sich gleiten; bewegte ihre Hüften mit kurzen stakkatohaften Bewegungen, effizient und angenehm; endete mit einem stummen Schauern, wie ein Expressfahrstuhl, der das oberste Stockwerk erreicht.
Sie schmiegte sich an seine Schulter. »War es gut?«
»Natürlich.«
Nach ein oder zwei Minuten: »Bist du gekommen?«
»Was glaubst du denn?« Er drückte ihren Arm.
Sie antwortete nicht. Kurz danach drehte sie sich um und schlief ein. Neds Gehirn fuhr wieder hoch. Die Kopfschmerzen kehrten zurück. Er lag mit offenen Augen da.
Francie duschte, zog sich an, machte das Bett, ging nach unten. Sie wusch ihr Glas aus, verkorkte den Wein, schaltete den Generator ab. Dann blieb sie reglos in der Dunkelheit stehen. Die Stille war vollkommen, Brendas Ferienhaus unter einem Zauber, wie so oft.
Francie öffnete die Tür, ließ das Rauschen des Flusses ein, dann zog sie sie hinter sich zu und schloss ab. Brendas Schlüssel hing anonym an ihrem Schlüsselbund, einer von vielen. Der Mond war aufgegangen, und in seinem Schein sah sie den Nebel entlang des Ufers aufsteigen. Es war wärmer geworden, das Eis war geschmolzen. Francie stieg ins Dingi, stieß sich ab und ruderte zur Anlegestelle. Der Mond spiegelte sich verzerrt in ihrem Kielwasser. Sie vertäute ihr Boot, ersetzte Neds schlampigen Altweiberknoten – er hatte wie immer Prosciutto genommen – durch zwei halbe Schläge und schaute noch einmal zurück zum Ferienhaus: ein geometrischer Schatten unter den unregelmäßig geformten Schatten der Ulmen. Die Eule, deren Schwingen weiß wie Signalflaggen durch die Nacht leuchteten, erhob sich in den Himmel. Sie fuhr durch das Tor, stieg aus, schloss ab, fuhr weiter. Fünf oder zehn Minuten war sie allein in den dunklen Wäldern, die zu beiden Seiten der Straße aufragten und den Himmel verbargen. Dann tauchten die Scheinwerfer eines anderen Fahrzeugs auf, und der Bann war gebrochen; sie gab Gas wie alle anderen erschöpften Pendler, die nach Hause eilten, nur dass sie kein bisschen müde war.
Das Haus – in Beacon Hill, aber mit Hypotheken belastet und dringend renovierungsbedürftig – war dunkel, abgesehen von dem Licht im Kellerbüro, einem großen, abgeschiedenen Raum, der ein perfektes Schlafzimmer für einen Teenager abgegeben hätte, wenn es jemals einen gegeben hätte. Francie schloss auf, trat ein, schaltete das Licht an, hörte den Anrufbeantworter ab, ging die Post durch, öffnete den Kühlschrank, stellte fest, dass sie nicht mehr hungrig war, trank ein Glas Wasser. Dann ging sie nach unten durch den Waschkeller und blieb vor der geschlossenen Bürotür stehen.
»Roger?«, fragte sie. Keine Antwort. Lag er auf dem Sofa und schlief? Francie meinte das Klicken der Computertastatur zu hören, war sich aber nicht sicher. Sie ging nach oben und ins Bett und war schon fast eingeschlafen, als OGarten, mein Garten in ihrem Kopf Gestalt annahm, die verrottenden Trauben, das Skateboard fahrende Mädchen. Ein Teenager natürlich. Sie versuchte, nicht in diese Richtung weiterzudenken und versagte wie immer. In ein Haus zu kommen, wo ein Skateboard im Flur herumlag, ein Rucksack am Treppengeländer baumelte, merkwürdige Musik aus diesem Kellerraum nach oben drang. Denk an was anderes, Francie.
Em. Sie dachte an Em. Em würde bald ein Teenager sein, obwohl Francie nicht wusste, wie alt sie genau war, wann sie Geburtstag hatte. Ned sprach fast nie über sie, eigentlich nur, wenn Francie ihn fragte, und selbstverständlich hatte Francie sie noch nie gesehen, nicht einmal ein Foto. Von dem fehlenden Em-Foto zu OGarten, mein Garten und von dort zu einer Idee war es nur ein Katzensprung: Was für ein tolles Geschenk für Ned das Gemälde sein würde! Bestand irgendeine Möglichkeit, es ihm zu schenken? In gewisser Hinsicht waren sie wie Spione, deren Verhalten von Berufsregeln bestimmt wurde. Sie rief niemals bei ihm an, sondern er bei ihr, und auch nur unter ihrer Büronummer; keine Briefe, keine Faxe, keine E-Mails; sie trafen sich ausschließlich im Ferienhaus. Grund war die Aufrechterhaltung seiner Ehe, und der Grund dafür war Em. Francie verstand das. Sie konnte ein Geheimnis wahren, in dem Sinn, dass sie nicht mit anderen Menschen darüber redete – sie hatte ohnehin nicht das Bedürfnis, ihre Liebe lauthals zu verkünden –, aber sie verabscheute das Agentengehabe.
Dennoch waren Geschenke eine Grauzone: Er brachte ihr ab und an Blumen mit, wenn er sie im Ferienhaus traf. Immer Iris, vermutlich, weil sie sich beim ersten Mal so überschwänglich bedankt hatte. Sie mochte Iris eigentlich gar nicht so gern, aber darauf kam es nicht an. Sie waren normalerweise verwelkt, wenn sie sie am nächsten Donnerstag wiedersah. Francie schlief ein, während sie Pläne schmiedete, wie sie OGarten, mein Garten Ned zuspielen konnte.
Roger wusste, dass sie dort war, direkt vor der Tür. Er warf einen Blick auf die Zeitanzeige am oberen rechten Bildschirmrand: 00:02 Uhr. Erwartete sie Dankbarkeit, weil sie so lange arbeitete? Er war derjenige, der ihren Abschluss in Kunstgeschichte finanziert hatte, jene Sommer in der Villa I Tatti, die Akkumulation dieses ganzen nutzlosen Wissens, für das sie eine Verwendung gefunden hatte. Er konzentrierte sich wieder auf seine Vita.
Exeter als Klassenbester, Harvard, Summa in Wirtschaftswissenschaften, Kapitän der Tennismannschaft. Dreiundzwanzig Jahre bei Thorvald Securities, am Anfang als Analyst, am Ende stellvertretender Vizepräsident, Nummer drei in der Hierarchie. Nummer drei auf dem Papier, aber das Hirn hinter allem, wie jedermann wusste – zumindest jedermann, der integer war. »Ich kann nur Wow sagen«, wie der Berater bei Execumatch ihm bei ihrem ersten Gespräch versichert hatte. »Lassen Sie mich raten: Sie haben das College doch garantiert mit Spitzennoten abgeschlossen?«
»Korrekt.«
»Und das in der guten alten Zeit, als die Hürden noch ganz oben lagen?«
»Gute alte Zeit?«
»Klar. Heute darf man Fehler machen und bekommt trotzdem Bestnoten. Ist doch verräterisch, oder? Aber das hier« – er tippte auf den Lebenslauf–, »das ist das einzig Wahre.« Und warum suchte er dann ein Jahr später immer noch nach einer passenden Stelle?
Roger lockerte seine Krawatte, schloss seine Vita, ging ins Internet und loggte sich beim Rätselclub ein.
MODERATOR: Hallo, Roger.
Roger antwortete nicht, er äußerte sich nie im Internet. Das Kreuzworträtsel der Times of London von morgen stand bereits zur Verfügung, und im Rätseltalk daneben fand eine lebhafte Diskussion statt. Roger sah auf die Uhr – 00:31 – und begann mit dem Rätsel. Eins senkrecht: Wort für Unordnung, sechs Buchstaben. Er tippte Ataxie. Zwei senkrecht: Pugilist, sieben Buchstaben – Rabauke. Drei senkrecht: ein X machen – kreuzen. Demnach war eins waagerecht Arkebuse und vier senkrecht ... er tippte zügig weiter und hatte das Rätsel um 00:42 beendet. Nicht gerade seine Bestleistung. Roger überflog die Diskussion.
MODERATOR: Flyboy, was meinst du mit perfektes Verbrechen????
FLYBOY: Natürlich eins, das einem nicht nachgewiesen werden kann.
MR.BUD: Nicht nachgewiesen? Klingt wie ein schlechter Krimi.
REB: So was gibt’s nicht. Da dürfte man doch nicht mal in die Nähe vom Tatort kommen, wegen der DNS und dem ganzen Scheiß. Wenn einem nur ’ne Schuppe aus den Haaren fällt, wird man gegrillt.
MODERATOR: Also braucht man jemanden, der es für einen erledigt, oder wie meinst du das?
MR.BUD: Du guckst zu viele schlechte Filme, Flyboy.
MODERATOR: emsv?
FLYBOY: eh man sichs versieht.
MR.BUD: Jesus.
FLYBOY: Oder ein Penny fällt vom Empire State Building. Der knallt durch den Schädel auf den Bürgersteig.
MODERATOR: Ein Penny fällt vom Empire State Building????
Roger loggte sich aus, schaltete den Computer aus, entledigte sich der Krawatte und seiner Schuhe, legte sich auf die Couch und deckte sich zu. Er lachte laut. Diese Vulgarität, diese Ignoranz, die im Web vor aller Augen zur Schau gestellt wurde: Nahmen die sich eigentlich gar nicht wahr? Er schloss die Augen, rief sich das Bild des ausgefüllten Times-of-London- Kreuzworträtsels ins Gedächtnis, Wort für Wort, perfekt, erledigt. Ataxie: Das war heutzutage das Problem. Vielleicht konnte er das bei seinem Frühstückstermin einflechten.
Ein Fenstertisch im Ritz.
»Roger?«
»Sandy?«
»Du hast dich kein bisschen verändert.«
Roger zwang sich zu »Du dich auch nicht.«
»Ich bin ein alter Sack«, meinte Sandy und setzte sich. Roger hasste diese Redewendung, hasste es, wenn Männer ihren Bauch tätschelten und fragten »Wie nennst du denn das?«, wie Sandy es soeben tat, besonders, da er keinen nennenswerten hatte. Der Kellner schenkte Kaffee ein; aus Angst, seine Hand könnte zittern, rührte Roger die Tasse nicht an.
»Spielst du noch?«, erkundigte sich Sandy.
Er war die Nummer zwei der Tennismannschaft gewesen und von Roger jeden Frühling in Grund und Boden gespielt worden. Nun führte er die drittgrößte Risikokapitalgesellschaft in New England.
»Unregelmäßig«, antwortete Roger. Vielleicht sollte er Sandy fragen, ob er noch spielte, aber das konnte zu einer Art Wiederholungsmatch führen, abstoßend und fünfundzwanzig Jahre zu spät, weshalb er schweigend nach seiner Tasse griff. Die Tasse klirrte gegen den Unterteller; er stellte sie ab.
»Kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Schläger in der Hand hatte«, fuhr Sandy fort. »Mittlerweile haben wir mit Felsenklettern angefangen, unsere ganze Truppe.«
»Felsenklettern?«
»Das solltest du mal probieren, Roger. Ein großartiger Familiensport.«
Dazu fiel Roger nichts ein. Er riss sein Brioche in kleine Stücke.
»Übrigens, was macht Francie denn so?«
»Du kennst meine Frau?«
»Flüchtig. Sie hat vor ein paar Monaten einen Vortrag bei uns gehalten. Über die neue Skulptur in der Eingangshalle. Ich will gar nicht so tun, als würde ich die Skulptur jetzt verstehen, aber deiner Frau haben wir alle aus der Hand gefressen.«
»Habt ihr das?«
»Die Mischung aus gutem Aussehen und Verstand, wenn ich das mal so formulieren darf, ohne politisch unkorrekt zu sein ... Aber das muss ich dir ja nicht sagen, oder, du Glückspilz?«
Roger nahm sein Buttermesser, tauchte es in eine Schale mit Himbeermarmelade, verstrich etwas auf einem Fetzen Brioche und hinterließ dabei einen klebrigen Fleck auf dem weißen Tischtuch.
Sandy starrte den roten Klecks einen Moment an, dann sagte er: »Wie ich höre, hat es bei Thorvald Veränderungen gegeben.«
»Ja.« Wie sollte er das Sandy erklären. Sandy war nicht besonders helle; Roger sah ihn vor sich, wie er früher in der Widener-Bibliothek über dicken Schwarten gebrütet hatte. Am besten ging er mit einer vagen, diplomatischen Bemerkung darüber hinweg. Roger tupfte sich die Mundwinkel mit der Serviette und versuchte, sich etwas Vages, Diplomatisches einfallen zu lassen. Aber was er äußerte, war: »Sie waren außerordentlich dumm.«
Sandy lehnte sich zurück. »Inwiefern?«
»Ist das nicht offensichtlich? Sie waren solche Idioten, dass sie -« Er verschluckte den Rest: – mich gefeuert haben.
»Dass sie was, Roger?«, fragte Sandy.
Roger dämmerte, dass Sandy im vergangenen Jahr womöglich begonnen hatte, Geschäfte mit Thorvald zu machen und deshalb interne Quellen kannte. »Nicht so wichtig«, sagte er. Wichtig ist, dass du mich einstellst, falls du nicht zu unterbelichtet bist, um zu erkennen, wie sehr ich dir helfen kann.
Sandy trank schweigend seinen Kaffee. Hegte Sandy etwa wegen dieser so lange zurückliegenden wöchentlichen Abreibungen einen Groll gegen ihn? Hatte er womöglich nie begriffen, dass es nichts Persönliches gewesen war, sondern einfach nur die Art, wie man das Spiel spielte? Dieses Gespräch musste offensichtlich sehr behutsam geführt werden.
»Sandy?«
»Ja, Roger?«
»Ich brauche einen Job, verdammt.« Absolut nicht das, was er hatte sagen wollen, aber Sandy gehörte zu diesen Promotern – ein Grundlinienspieler, wie er sich erinnerte, ohne jede Phantasie –, und Promoter brachten ihn auf die Palme.
Und jetzt bedachte Sandy ihn mit einem Blick, als würde er ihn taxieren, was angesichts des Unterschieds ihres Intellekts geradezu lächerlich war. »Ich wünschte, ich könnte dir helfen, Roger, aber wir haben momentan nichts für jemanden deines Niveaus.«
Das war gelogen. Roger wusste, dass sie jemanden suchten, sonst hätte er dieses Treffen nicht herbeigeführt. Aber diese Feststellung wäre zu taktlos gewesen; deshalb sagte Roger stattdessen: »Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe?«
Sein Orangensaft kippte um, vielleicht wegen eines Krampfs in seinem Unterarm; er war sich nicht sicher.
Nachdem der Kellner alles aufgewischt hatte und wieder verschwunden war, sagte Sandy: »Es geht mich nichts an, Roger, und bitte versteh mich nicht falsch, aber hast du jemals einen vorgezogenen Ruhestand erwogen? Ich weiß, dass Thorvald dir – dass Thorvald normalerweise Abfindungen großzügig handhabt, und da Francie sich so gut macht, solltest du vielleicht -«
»Was hat sie damit zu tun?«
»Ich dachte nur –«
»Weißt du, was sie letztes Jahr verdient hat? Fünfzig Riesen. Kaum genug, um ihren Friseur zu bezahlen. Abgesehen davon bin ich zu jung –«
»Wir sind gleichaltrig, Roger. Ich habe schon vor einiger Zeit aufgehört, mich als jung zu betrachten. Das verheißungsvolle Stadium kann per definitionem nicht ewig anhalten.« Roger spürte, wie ihm die Hitze ins Gesicht stieg, als ob er rot würde, obgleich sicherlich keine Veränderung sichtbar war. Er riss sich zusammen und erklärte: »Mir war nicht bewusst, dass du dieses Stadium jemals erreicht hast.«
Bald danach bat Sandy um die Rechnung. Roger riss sie dem Kellner aus der Hand und zahlte selbst. Auf dem Weg die Treppe hinunter traf Sandy einen Bekannten und blieb stehen, um mit ihm zu sprechen. Roger ging allein hinaus. Auf der Straße fiel ihm auf, dass er vergessen hatte, Trinkgeld zu geben. Na und? Er hatte das Gefühl – seltsam, weil er seit seiner Kindheit dort verkehrte –, dass er nie wieder im Ritz essen würde.
Roger kaufte eine Flasche Scotch in einem Laden, in dem man ihn mit Sir anredete, aber nicht heute – er wurde von einem neuen Angestellten bedient, der kaum Englisch sprach –, und fuhr mit dem Taxi nach Hause. Der Fahrer hatte das Radio eingeschaltet.
»Worum geht's heute, Ned?«
»Danke, Ron. Unser Hauptthema heute bei Intimleben ist die männliche Unfruchtbarkeit. Bei uns im Studio ist einer der führenden –«
»Würde es Ihnen etwas ausmachen, das abzustellen?«, fragte Roger.
»Biiite?«, sagte der Fahrer.
»Radio«, sagte Roger. »Aus.«
Der Fahrer schaltete es ab.
In seinem Kellerbüro trank Roger Scotch auf Eis und spielte auf dem Rechner Jeopardy! Der erste Europäer, der den Ort erreichte, den wir heute Montreal nennen. Die Währung des Senegal. Der größte Mond des Neptuns. Wer war Cartier, was ist der CFA-Franc, was ist Triton? Alles viel zu einfach. Er versuchte, sich in seinen alten Rechner bei Thorvald einzuloggen, konnte aber die Firewall nicht durchbrechen.
Er schenkte nach und ging wieder einmal seine Vita durch. Schade, dachte er, dass der IQ im Lebenslauf nicht standardmäßig angegeben wurde. Warum nicht? Welchen besseren Maßstab gab es? Er stand auf, öffnete eine Aktenlade und wühlte sich durch Zeitungsausschnitte, Fotografien, Bänder, Trophäen bis zu einem vergilbten Umschlag ganz unten, der an Mr. und Mrs. Cullingwood adressiert war. Er las den darin enthaltenen Brief.
In der Anlage erhalten Sie das Ergebnis des Stanford-Binet-Test, dem sich Ihr Sohn Roger letzten Monat unterzogen hat. Roger hat laut der Messung einen Intelligenzquotienten oder IQ von 181. Dieses Ergebnis erreichen weniger als ein Prozent aller Personen, die sich diesem Test unterziehen. Vielleicht ist es für Sie von Interesse, dass es in unserem Bereich mehrere Schulen mit erstklassigen Programmen für begabte Kinder gibt, die für Roger geeignet sein könnten. Bitte zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, falls Sie weitere Informationen wünschen.
Roger las den Brief noch einmal und dann noch einmal, ehe er ihn weglegte. Er füllte sein Glas nach, loggte sich beim Rätselclub ein. Die Kreuzworträtsel der Times of London waren noch nicht online, aber einige andere, darunter dass der Le Monde. Er benötigte fast eine Stunde dafür – sein Französisch war eingerostet. Nachdem er alle Rätsel gelöst hatte, starrte er auf die Online-Diskussion, die die ganze Zeit über den Monitor geflimmert war.
MODERATOR: Wie sind wir auf das Thema Todesstrafe gekommen????
BOOBOO: Der Fall Sheppard. Die Vorlage für Auf der Flucht.
MODERATOR: Ich glaube nicht, dass das besonders häufig vorkommt, oder????
RIMSKY: Ich sag dir mal was, ich bin Gefängniswärter hier unten in Florida.
BOOBOO: Und?
RIMSKY: Und deshalb weiß ich, worüber ich rede, wenn es um eiskalte Mörder geht.
BOOBOO: : /
RIMSKY: Du kannst mich. Schon mal von Whitey Truax gehört?
MODERATOR: ????
FAUSTO: Und was hat das mit dem Preis von Äpfeln zu tun?
Roger folgte der Diskussion, bis der Klang von Schritten über ihm ihn dazu brachten, den Blick vom Bildschirm zu lösen. Francie. Er war überrascht, als er sah, dass draußen vor dem kleinen Fenster hoch oben in der Kellerwand die Nacht angebrochen war.
Und die Flasche fast leer, obwohl er vollkommen nüchtern war. Das Schlimmste an Sandy war sein Geifern beim Thema Francie. Der Ausdruck in seinen Augen war zweifellos Lust gewesen. Was für ein totaler – wie nannten die Juden das? Putz. Das war es. Für einen Putz wie Sandy wollte er sowieso nicht arbeiten. Auch nicht mit ihm.
Doch irgendetwas an diesem wollüstigen Blick, Francie, Juden und dem Begriff Putz selbst – eine schmierige Kombination – löste in Roger den Drang aus, diese Nacht oben zu schlafen, etwas, das er nicht mehr getan hatte, seit ... Er konnte sich nicht erinnern. Er zog seinen scharlachroten Morgenmantel an, leerte den restlichen Scotch in zwei Gläser und trug sie nach oben.
»Francie?«, rief er. »Bist du das, Liebes?«
Kapitel 3
Am ersten Tag im offenen Vollzug machte sich Whitey Truax auf die Suche nach Nutten. Er hatte das nicht geplant: Niemand, der im Voraus plante, wäre auf die Idee gekommen, denn der Job, den man Whitey besorgt hatte – Müll sammeln auf dem Mittelstreifen der I-95 –, endete um siebzehn Uhr, und um achtzehn Uhr musste er sich zurückmelden.
Kurz vor Anbruch der Dämmerung begann der Transporter des Bauamts die Mannschaft jeweils im Abstand von mehreren Meilen einen nach dem anderen abzusetzen. Whitey war der letzte. Er kauerte auf der Ladefläche, sah die Sonne zwischen zwei Hügeln aufgehen und begann zu zittern. Er hatte siebzehn Jahre nur nach Westen gesehen, aber vielleicht lag es auch an der morgendlichen Frische.
Der Transporter hielt nördlich der Ausfahrt 42 am Straßenrand und Whitey kletterte herunter. Dann fuhr der Wagen davon, und da stand er nun auf dem taufeuchten grünen Gras, ein freier, nicht überwachter Mann. Er ruckelte seine Warnweste zurecht, stopfte die eng zusammengefalteten orangefarbenen Müllbeutel in seine Tasche und spießte ein Marspapier mit der Stange auf.
Spieß, spieß, spieß: Whitey war total energiegeladen. Um sechzehn Uhr hatte er ein Dutzend Beutel gefüllt, alle, die man ihm gegeben hatte, und war mittlerweile fast bei Ausfahrt 41 angekommen. Da er nichts mehr zu tun hatte, blieb er auf seine Stange gestützt stehen, ließ den Schweiß langsam trocknen und beobachtete die vorbeifahrenden Wagen. Die meisten Modelle kannte er nicht. War das eine schlechte Art, sein Geld zu verdienen? Zu warm – Hitze hatte er noch nie gemocht –, aber ansonsten gar nicht übel. Niemand, der einen überwachte, niemand, der einen herumkommandierte: Freiheit.
Stoßzeit, der Verkehr stockte. Eine Frau in einem Cabrio sah zu ihm herüber, keine zehn Meter entfernt. Ihr Pferdeschwanz war feucht an den Spitzen, und sie trug ein Bikinioberteil – war bestimmt am Strand, dachte Whitey; aber er dachte nicht wirklich, starrte einfach nur ihre Titten an, schwer, rund, faszinierend. Die Kombination aus visuellem Überangebot und völligem Berührungsentzug brachte ihn erneut zum Zittern, nur ein bisschen. Er öffnete den Mund, um ihr etwas zuzurufen, aber mehr als »ficken« fiel ihm nicht ein, und er war sicher, dass das nicht funktionieren würde. Die Autos krochen weiter, sie war fort und hinterließ nichts als die Erinnerung an diese Riesentitten. Auch ihre Schultern waren kräftig; im Rückblick war sie vermutlich dick, sogar fett, aber diese Erkenntnis streifte ihn nur flüchtig. Rückblick gehörte nicht zu seinen Stärken.
Stattdessen wanderten seine Gedanken ein kurzes Stück weiter zu den Lauten, die Frauen von sich gaben, wenn sie in Fahrt kamen. Er kannte das aus Filmen. Natürlich waren im Bau keine Pornos erlaubt, aber selbst in normalen Filmen gaben Frauen diese Laute von sich. Melanie Griffith und wie hieß noch mal die andere, die ihm gefiel? Whitey konnte ihr Gesicht deutlich vor sich sehen, den Mund geöffnet, aber er suchte immer noch nach dem Namen, als etwas seinen Knöchel streifte. Er sprang zurück – er war sehr schnell –, dachte Schlange, Trieb den Spieß direkt durch den Kopf des Reptils, nagelte den sich windenden Körper am Boden fest. Seine Geschwindigkeit war immer noch dieselbe, er hatte nichts eingebüßt.
Wie sich herausstellte, war die Kreatur keine Schlange, nicht mal ein Reptil, sondern ein Ochsenfrosch. Zu spät, das war nicht mehr zu ändern. Whitey sah zu, wie er starb: Blut von seinem Kopf tropfte, die Bewegungen immer schwächer wurden, die Augen erloschen. Whitey hatte leichte Gewissensbisse, aber nur sehr leichte. Schließlich war der verdammte Frosch selbst schuld, weil er ihn in Panik versetzt hatte. Whitey reagierte manchmal panisch, besonders, wenn er überrascht wurde. So war er nun mal – was nicht hieß, dass er eine Memme war oder so was. Aber das Syndrom – an das Wort konnte er sich aus dem Gutachten vor langer Zeit erinnern –, kombiniert mit seiner Reaktionsgeschwindigkeit, konnte zu Ärger führen, wie er nur zu gut wusste.
Weshalb er unbedingt gelassen bleiben musste. Er holte ein paarmal tief Luft, um sich zu beruhigen, setzte den Fuß auf den Kopf des Ochsenfroschs, zog die Stahlspitze heraus. Der Ochsenfrosch sprang auf.
»Verschissener Allmächtiger«, fluchte Whitey und besorgte es ihm noch einmal. Danach blieb der Frosch mit weitgespreizten Beinen reglos auf dem Boden liegen. In diesem Moment tauchte der Gedanke an Nutten in Whiteys Hirn auf, Nutten, und zwar heute noch.
Ein Transporter des Bauamts sammelte ihn ein paar Minuten später ein und setzte ihn um siebzehn Uhr vor dem Depot ab.
»He, du.«
Whitey, der gerade verschwinden wollte, blieb stehen und drehte sich um.
»Was glaubst du, wo du damit hingehst?« Whiteys Gedanken rasten. »Nirgendwo.«
»Nirgendwo stimmt genau. Die Ausrüstung bleibt hier.« Whitey ging hinüber und warf die Stange mit der Stahlspitze auf die Ladefläche. »War keine böse Absicht.«
Der Typ sah ihn nur an.
Ein Bus fuhr vor, Linie 62. Er warf einen Blick auf die handschriftlichen Anweisungen des Sozialarbeiters: sein Bus; die Haltestelle lag einen Block von dem Resozialisierungswohnheim entfernt. Aber Whitey stieg nicht ein. Stattdessen lief er in Richtung einer neonerleuchteten Kreuzung, die er in der Ferne erkennen konnte, die Art Kreuzung, an der man vermutlich Schnapsläden, Bars, Frauen fand. Whitey kramte in seiner Tasche. Er hatte dreißig Dollar dabei plus vierhundert und ein paar Zerquetschte auf dem Bankkonto, bei dessen Einrichtung ihm der Sozialarbeiter am Abend zuvor geholfen hatte.
Was konnte man für dreißig Dollar kaufen? Erst mal eine Pepsi. Im Bau gab es keine Pepsi, nur Coke, und Pepsi war Whiteys Lieblingsgetränk. Er betrat den ersten Lebensmittelladen, an dem er vorbeikam. »Wow«, murmelte er leise, vielleicht auch laut. So viel Zeug. Er ging zur Kühltheke an der Rückseite und fand die Pepsi. Sie hatten das Design der Dose geändert. Das alte gefiel ihm besser. Hatten sie auch am Geschmack herumgepfuscht? Er meinte so etwas gehört zu haben.
Whitey nahm einen Sechserträger, ging nach vorn und stellte ihn auf den Tresen neben eine Zigarrenauslage. »Bin sofort bei Ihnen«, sagte eine Stimme ein paar Gänge weiter.
Whitey betrachtete die Zigarren. Waren Zigarren jetzt in? Er hatte noch nie eine Zigarre geraucht, in seinem ganzen gottverdammten Leben nicht. Whitey sah sich um. Er entdeckte eine Videokamera, aber sie baumelte lose von der Decke, völlig schief. Whitey schnappte sich die dickste Zigarre aus der Auslage und ließ sie in seinen Ärmel gleiten, während er so tat, als striche er sich die Haare nach hinten.
Der Angestellte tauchte auf. »Sonst noch etwas?«, fragte er.
»Streichhölzer«, antwortete Whitey.
»Streichhölzer sind gratis.«
Whitey nahm zwei Heftchen. »Schönen Dank.«
Er lief einen Block in Richtung Neon-Kreuzung, blieb stehen, knackte eine Pepsi und setzte sie an. Himmel, war die gut, sogar noch besser als in seiner Erinnerung. Er trank die Hälfte, dann steckte er sich die Zigarre an, füllte seinen Mund mit einer dicken Wolke heißem wunderbarem Rauch, ließ ihn langsam durch gespitzte Lippen entweichen. Er lebte. Stand vor dem Schaufenster eines Elektronikladens – an dessen Scheibe ein Plakat klebte: SIND SIE BEREIT FÜR HIGH DEFINITION? –, trank seine Pepsi und paffte seine Zigarre. Eine hinreißende Wetterfrau auf einem Großbildschirm zeigte auf Blitz- und Donnersymbole auf der Karte irgendeines europäischen Landes, Frankreich vielleicht, oder Deutschland. Europäisches Wetter: Das war der Knaller. Whitey versank in den Anblick, bis er das Preisetikett an dem Fernseher bemerkte. Und der war reduziert. Er ging weiter.
Die Zigarre im Mund, die verbliebenen fünf Dosen Pepsi an dem leeren Plastikring baumeln lassend, erreichte Whitey die Kreuzung. Schnapsläden, ja. Bars, ja. Frauen, nein. Er betrat Allies Alligator Lounge und setzte sich an den leeren Tresen. »Was darf ich Ihnen bringen?«, erkundigte sich der Barkeeper.
Alkohol kam nicht in Frage; Wohnheimregeln. »Was haben Sie denn?«, fragte Whitey.
»Was ich habe?«
»Bier«, sagte Whitey, das Erste, was ihm in den Sinn kam. »Narragansett.« Das war seine Marke gewesen.
»Narragansett?«
»Dann eben ein Bud.«
Der Barkeeper servierte ihm ein Bud. »Ein Dollar fünfzig.«
Whitey gab ihm zwei, winkte ab, als das Wechselgeld kam, winkte mit der Zigarre ab, echt cool.
»Ich will ehrlich zu Ihnen sein«, sagte Whitey. Er wartete darauf, dass der Barkeeper etwas erwiderte oder sich seine Miene änderte. Als nichts davon passierte, fuhr er fort. »Offen gestanden war ich eine ganze Weile weg.«
Der Barkeeper nickte. »Narragansett ist so ’ne Art Sammlerstück.«
»Und jetzt wäre ein bisschen Gesellschaft ganz nett, verstehen Sie? Jemand zum Reden«, ergänzte er, aber der Barkeeper griff bereits zum Telefon. Er sagte leise ein paar Sätze, wobei er Whitey nicht einmal ansah, dann legte er auf. Einen Augenblick später kam eine Frau herein und setzte sich neben Whitey; der Barkeeper beschäftigte sich mit seinen Flaschen. Whitey lachte, eher ein Kichern, dass er gegen Ende modulierte.
»Was ist so lustig?«, fragte die Frau.
Whitey zog an seiner Zigarre. »Im Bau kriegt man keinen einzigen Scheiß«, sagte er. »Draußen muss man einfach nur fragen.« Er drehte sich ihr ganz zu. Sie war umwerfend. Er konnte sie riechen. Das war auch umwerfend. Was für Geräusche sie wohl machte, wenn sie in Fahrt kam? Sein Mund wurde trocken.
Sie beobachtete ihn, blinzelte ein bisschen, vermutlich wegen des Zigarrenrauchs, oder vielleicht hatte sie ihre Brille vergessen. »Du bist doch der, der ein Date bestellt hat, oder?«
Whitey schluckte. »Ein Date«, wiederholte er. Der Klang gefiel ihm. »Ja.«
»Willst du erst noch dein Bier austrinken?«
»Bier ist pfui-bäh.«
Sie stand auf. Er lief ihr durch die Lounge nach zur Hintertür. »Wir gehen?«, fragte Whitey.
»Weißt du, was eine Schanklizenz kostet?«
Sie führte ihn durch eine Gasse, um eine Ecke, in ein Hotel. Auf dem Schild stand HOTEL, aber es gab keine Lobby, nur einen fleischigen Typen hinter kugelsicherem Glas, dessen Kopf auf dem Tisch lag.
Die Frau ging weiter, eine Treppe hoch – oh, ihrem Arsch die Treppe hoch zu folgen, das war schon was – in ein Zimmer mit einem Bett, einem Waschbecken und sonst nichts.
»Würdest du dich waschen?«, sagte die Frau mit einem Nicken zum Waschbecken. »Heutzutage kann man gar nicht vorsichtig genug sein.« Sie war immer noch umwerfend, trotz der grellen Deckenleuchte. Ihre Pickel, oder was immer das war, störten ihn kein bisschen, und er war diese Art Beleuchtung gewohnt.
Whitey wusch sich. Als er sich zu ihr umdrehte, saß sie gähnend auf dem Bett, »’tschuldigung«, sagte sie. »Okay. Blasen macht fünfundzwanzig, ficken vierzig, blasen und ficken fünfzig.«
Whitey wusste nicht, was er sagen sollte, hätte sowieso nicht sprechen können, weil sein Mund völlig ausgetrocknet war. Er stellte ein paar Berechnungen an. Blasen und ficken war eindeutig ein gutes Angebot, aber nur ficken war das, was er eigentlich wollte – tief in ihr sein, sie dazu bringen, diese Melanie-Griffith-Laute zu machen –, und er hatte nur dreißig Dollar abzüglich der Kosten für das Bier und die Pepsi. Himmel! Er konnte sich nicht mal Blasen leisten.
Sie brach das Schweigen. »Du siehst wie ein netter Kerl aus, da könnte ich dir vielleicht einen Sonderpreis machen.« Whitey versuchte etwas zu sagen, scheiterte, legte sein ganzes Geld, auch die Münzen, aufs Bett. Sie starrte es an. Er beugte sich über sie und strich die zerknitterten Scheine glatt.
»Ach, zum Teufel«, sagte sie und steckte alles in ihr glitzerndes Portemonnaie. »Wollen wir mal nicht ... wie heißt das Wort? Beginnt mit k.«
Whitey wusste es nicht. Er wusste nur, dass er endlich flachgelegt werden würde. Dieses Wissen löste eine Art Summen in ihm aus, ein Summen, das er schon lange Zeit nicht mehr gehört hatte, nicht seit – aber lieber nicht dran denken. Er legte seine Arme um die Frau und zog sie an sich, wobei er ihren Kopf ungeschickt gegen seine Gürtelschnalle drückte. »Langsam«, sagte sie. »Zieh die Hose aus.«
Aber dafür hatte Whitey keine Zeit; er begnügte sich damit, sie bis unter die Knie zu ziehen. In der Zwischenzeit legte sich die Frau rückwärts aufs Bett, zog ihren Rock hoch, streifte den Schlüpfer ab, und er sah das andere Geschlecht, die Lippen und Haare, alles echt, direkt vor ihm, während das Summen lauter wurde. Sie stopfte den Schlüpfer in ihren Stiefelschaft. Whitey stürzte sich auf sie und schob ihn hinein.
Nicht ganz rein, eher gegen ihren Schenkel. Sie langte nach unten, nahm seinen Penis in die Hand – »Kniepig«, sagte sie. »Das ist das Wort, nach dem ich gesucht habe« – und führte ihn ein.
»O Gott«, stöhnte Whitey. »O mein Gott.« Er stieß vor und zurück, ertrank beinah in dem Summen, würde jeden Moment kommen, als ihm plötzlich Melanie Griffith wieder einfiel. Langsam, Großer, langsam, befahl er sich. Er musste diese weiblichen Laute hören. Er glitt mit der Hand über ihren Bauch, in die Nässe, fand ihren Kitzler oder so was und begann, ihn so fest zu reiben, wie er konnte.
»Finger weg«, sagte die Frau.
Whitey erstarrte. Sein Steifer in ihr wurde schlaff, einfach so. Das Summen erstarb. In der Stille hörte er irgendein kleines Tier in der Wand. Die Frau machte eine kreisende Bewegung mit den Hüften.
»Du dumme Nutte«, sagte Whitey.
»Hä?«
Alles kippte, genau wie beim letzten Mal. Wo steckten die klugen Frauen? Seine Bedürfnisse waren einfach, und die hier war doch angeblich ein Profi, um Himmels willen. Es machte Whitey so wütend, dass er sie schlug, nicht hart, nur mit dem Handrücken in ihr pickliges Gesicht.
Whitey wurde beinah umgehend klar, dass er das wiedergutmachen musste. »Okay, wir haben beide einen Fehler gemacht«, sagte er. »Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht trotzdem –« Doch sie schlängelte sich bereits unter ihm hervor und hieb auf einen Schalter an der Wand, der ihm vorhin nicht aufgefallen war.
»Was soll das?«, fragte Whitey. »Hör mal, das eben ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Kein Grund –«